| |
|
Eissporthallen-Chronik
Von der Idee bis zur Fertigstellung - Geschichten rund
um den Puck in der Eissporthalle |

Von Harald Jeschke
Erste Planungen, den Sport auf gefrorenem
Hallenboden in Duisburg zu etablieren, gab es im Jahr 1968. Ob
in der Politik oder im Sport - das Jahres 1968 war in vielerlei
Hinsicht ein beliebtes Thema. Dies gilt auch in Duisburg für die
Eissporthalle, die ab der Saison 2003/2004 den Namen
Scania-Arena erhielt.
Am 15. Oktober 1968 meinte der damalige SPD-Fraktionsvorsitzende
und spätere Oberbürgermeister der Stadt Arnold Masselter: "Wenn
wir uns nicht auf die Hinterbeine stellen, dann ist es bald
nicht mehr weit her mit Duisburgs traditionell gutem Ruf als
Sportstadt des Reviers. Andere Städte bauen eine Eissporthalle,
und wir sollten ein solches Projekt ernsthaft prüfen, da immer
mehr Duisburger nach Düsseldorf und Krefeld fahren, um dort die
Schlittschuhe anzuziehen."
Trotz der auch damals vorherrschenden Finanzprobleme sollte in
Duisburg neben dem Schwimmstadion am Westufer des Margaretensees
ein solches Projekt entstehen. Das städtische Sportamt hatte
schon vor der Forderung Masselters in einer Vorlage dem Projekt
Eissporthalle ein größeres Kapitel gewidmet. Weiterhin gab es
ein Bauangebot der Firma IBACO aus Velbert.
In dieser Firma war der spätere Eishockey-Vorsitzende des ersten
Duisburger Eishockey-Klubs DSC Kaiserberg 1947 Abteilung
Eishockey und auch spätere Funktionär des Deutschen
Eishockeybundes Wilfred Wegmann die treibende Kraft zum Bau der
Halle. Die IBACO hatte im Jahr 1968 schon den Bau der
Hallenbäder in Duisburg-Süd und Duisburg-Meiderich in Angriff
genommen (beide existieren heute nicht mehr, fielen dem Rotstift
und der Abrissbirne zum Opfer), die dann 1969 fertig gestellt
wurden.
Die IBACO plante auch in vielen Nachbarstädten Eisarenen mit
einer Kapazität von mehr als 4000 Zuschauern. In diesen Hallen
sollte auch im Sommer Rollschuh gelaufen oder Handball gespielt
werden können. Die Baukosten wurden damals mit dreieinhalb
Millionen Mark veranschlagt, wobei der Stadt keinerlei
Finanzbeteiligung aufgebürdet werden sollte. Sie sollte
lediglich das Grundstück mit angrenzenden Parkmöglichkeiten zur
Verfügung stellen. Die Halle in Duisburg wurde gebaut und gibt
es in gleicher Ausfertigung auch in den Städten Essen, Herne,
Soest und Iserlohn.
Kapitel II
Die ersten Tage im Leben der Eissporthalle
oder:
Als das deutsche Traumpaar der 60er und 70er
Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler
die Duisburger entzückte
Nachdem die Politik 1968 die Weichen zum Bau der Eissporthalle
an der Wedau gestellt hatte, traten die Planer in Aktion. Im
Jahr 1969 wurden die letzten bürokratischen Hürden genommen und
am 23. Oktober 1969 war es NRW-Kultusminister Fritz Holthoff,
ein gebürtiger Duisburger, der gemeinsam mit dem
Bundestagsabgeordneten aus Bissingheim Hermann Spillecke und dem
Direktor der IBACO Dr. Krieger den Grundstein zum Bau der
Eissporthalle legte. Mit dem Fanfarenkorps der "Roten Funken",
einem überdimensionalen Schlittschuh an einem Kran und viel
Prominenz wurde der zweite und symbolische Akt zum Bau der
Eissporthalle angegangen. Im Dezember 1970 stieg der dritte Akt
des neuen Duisburger Kindes Eissporthalle. Die Halle stand, das
erste "Eis wurde gekocht". Am zweiten Weihnachtstag 1970 wurde
die Eisfläche erstmals für den Probelauf kostenlos der
Duisburger Bevölkerung angeboten.
Um 15 Uhr war draußen leichter Schneefall, drinnen war der
Innenausbau noch nicht ganz abgeschlossen, aber die ersten
Duisburger wagten sich auf das gefrorene Gebiet. Darunter auch
das spätere Ehepaar Ute und Günter Michel, die Jahre später
Funktionen im Duisburger Eishockey übernehmen sollten. Am
Mittwoch, den 27. Januar 1971 nahm das Bauordnungsamt die
Eissporthalle ab und gab die Eisfläche frei.
Die erste öffentliche Laufzeit gab es dann tags darauf, am
Donnerstag, den 28. Januar 1971. Ab 13.30 Uhr wurde die
Eisfläche für die erste öffentliche Laufzeit freigegeben. Von da
an ging es sozusagen Schlag auf Schlag mit neuen Höhepunkten
weiter. Am 16. Februar wurde der Aufbau für das Deutsche
Eistheater Berlin mit dem Stück "Maske in Blau" begonnen. Vom
17. bis zum 24. Februar gab es rauschende Vorstellungen. Es war
der erste Veranstaltungshöhepunkt im jungen Leben der Eishalle,
als in der proppevollen Halle das Duisburger Publikum dem
damaligen deutschen Traumpaar auf dem Eis Marika Kilius und
Hans-Jürgen Bäumler sowie Manfred Schnelldorfer zujubelte. Alle
waren entzückt und 50 000 Besucher gaben den Veranstaltungen
einen würdigen Rahmen, so dass der damalige Eistheater-Direktor
Willy Schilling den Duisburgern ein hohes Lob zollte: "Das haben
wir nicht erwartet, es war ein phantastisches Publikum." Das Lob
nahm auch der erste Hallendirektor Rudi Weide freudestrahlend
entgegen. Er sollte später noch für viel Furore in Duisburg
sorgen.
Kapitel III
Eissporthallen-Veranstaltungen waren im ersten Jahr der absolute
Hit
Die Eissporthalle wurde so etwas wie die gute Stube Duisburgs in
Sachen Eissport. Aber auch andere Ereignisse rund um den Sport
oder das moderne Entertainment kamen in dem neuen Duisburger
Eistempel Anfang der 70er zu Ehren. Immerhin bot die Halle an
der Margaretenstraße eine rund 60x30 Meter große Eisfläche, die
mit dem Kältesystem der Ammoniak-Verdampfung eine
Eisaufbereitung auch
zu sommerlichen Temperaturen möglich werden ließ, Platz für rund
1500 Sitz- und 2500 Stehplätze. Der erste Eismeister hieß
Wolfgang Daumann, der das damalige 70 000 Mark teure Gefährt
namens "Zamboni" (die norditalienische Familie Zamboni war
Vorreiter in Sachen fahrbare Technik zur Eisaufbereitung, dem
Eishobeln und Waschen des Eises mit heißem Wasser), das aus
Kalifornien geordert worden war. Das Panorama-Restaurant mit
knapp 100 Plätzen lud viele neugierige Duisburger zum Verweilen
ein. Ein Glas Bier kostete damals 80 Pfennig, das der erste
Pächter Hans Werner, ehemals Klubwirt des Eintracht-Klubhauses,
ausschenkte. Speisen gab es aus der Küche für 5 bis 15 Mark.
Eine Kegelbahn mit vier Bahnen gab es zum sportlichen Part neben
dem Eis. Nach einem Jahr verschlug die Besucherzahl so manchem
Optimisten und auch dem ersten Hallendirektor Rudi Weide fast
die Sprache.
Rund 150 000 Besucher kamen zu den Veranstaltungen, über 800 000
Sporttreibende hatten sich auf dem Eis getummelt, was damals
eine Einnahme von rund 1,5 Millionen Mark einbrachte. Rund 2500
Paar Schlittschuhe gingen an die Aktiven. Welch ein Erfolg. Und
der Vereinssport in Sachen Eissport wurde auf die Beine
gestellt. Beim DSC Kaiserberg wurden ruckzuck mehr als 500
Eissportfreunde gezählt – die Abteilung boomte. Die
Veranstaltungspalette reichte von der "Maske in Blau" über die
"Heiße Nacht auf kühlem Eis", mit dem unvergessenen
Fernsehlotterie-Star Hans Rosenthal (Dalli, Dalli), dem
Eistheater "Weißes Rößl" mit Manfred Schnelldorfer bis zu dem
Angebot, bei den mehrfachen deutschen Meistern im Paarlaufen
Margret Göbl und Franz Ningel die hohe Kunst des Paarlaufens zu
lernen. Und dann war es mehr als nur nahe liegend, eine
schlagkräftige Eishockeymannschaft aus dem Boden zu stampfen.
Mit Hallendirektor Rudi Weide hatte man ja einen Mann, der in
seiner Heimatstadt Riga das Eishockey-ABC gelernt und es bis zum
Nationalspieler Lettlands gebracht hatte. Über Augsburg,
Krefeld, Dortmund, Essen, erneut Krefeld (wurde 1951 mit den
legendären Preußen aus Krefeld Deutscher Meister, 18facher
deutscher Nationalspieler und zweifacher WM-Teilnehmer) kam er
in den Westen und 1970 nach Duisburg. Er wurde zusammen mit
Wilfred Wegmann zu dem Mann, der das Duisburger Eishockey ans
Laufen brachte.
|
Kapitel IV
Duisburg und der Puck
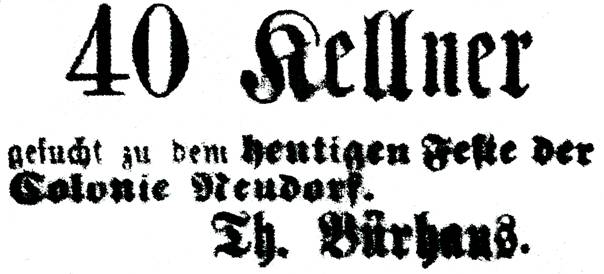
Nachdem die Eissporthalle stand und
ihr erstes Jahr mit den unterschiedlichsten
Veranstaltungen unter einem mehr als guten Stern
gestanden hatte, machte sich der damalige
IBACO-Vertreter Wilfred Wegmann mit dem ersten
Eissporthallen-Direktor Rudi Weide ans Werk, eine
Eishockeymannschaft aus der Taufe zu heben. Nach
ersten Gehversuchen des Duisburger SC Kaiserberg mit
vielen ehemaligen Krefelder Spielern und dem ersten
Testsieg (14:0) über die Pokalmannschaft von Preußen
Krefeld vor 2000 Fans folgte ein 23:2 über eine
Soldatenmannschaft aus Soest. Weitere Tests mit
ersten Niederlagen gegen den Krefelder EV und
Bad Nauheim folgten bis zum Frühjahr 1971.
Ab dem Herbst 1971 ging es in der Regionalliga
erstmals offiziell los. In den folgenden
Monaten staunten Duisburger Fans in immer größerer
Zahl über die Künste und Erfolge von Heiner Bayer
und Kameraden. Der DSC wurde Meister der
Regionalliga und stieg durch einen 9:1-Erfolg im
letzten Qualifikationsspiel über Eintracht Frankfurt
vor 4000 begeisterten Duisburgern in die Oberliga
auf. Die Cracks waren irgendwie bei der IBACO
beschäftigt und bekamen so rund 40 Mark pro Spiel.
Das war es auch schon neben dem riesigen Spaß. Am
27. November gab es ein Eishockey-Länderspiel in der
Eissporthalle.
Deutschland gewann gegen die Schweiz mit 6:4 mit
Erich Kühnhackl, Alois Schloder und Udo Kießling vor
5000 Duisburgern. Der DSC Kaiserberg sorgte
weiterhin für Furore und schaffte auch aus der
Oberliga 1972/73 den Aufstieg. Als Neuling wurde der
DSC Kaiserberg Neunter und schaffte damit den Sprung
in die neu gegründete zweite Bundesliga. Eine
gravierende Entscheidung fiel August 1974. Die
Eissporthalle ging in den Besitz der Stadt Duisburg
über. Die IBACO war in finanziell schweres
Fahrwasser geraten und die im Vertrag mit der Stadt
geregelte "Heimfall-Klausel" sorgte dafür, dass die
Stadt die Halle übernehmen konnte, Kämmerer Dr.
Wolfgang Dumas dafür aber nichts zu bezahlen hatte.
Die Duisburger Betriebsgesellschaft übernahm die
Regie. Später kam auch mit Fritz Hesselmann ein
neuer Gastronom ins Restaurant, der auch später im
Duisburger Eishockey führend und zur bekanntesten
Person wurde, aber auch mit für den Passskandal 1980
verantwortlich war.
Im Eishockey ging es beim DSC in der 2. Bundesliga
weiter. Dieser Liga gehörte der Klub lange Jahre mit
wechselndem Erfolg an, ehe ihm in der Saison 1978/79
sogar der Sprung in
die Eliteliga gelang. Die damaligen Kanadier, die
dies mit Toren und Fäusten schafften, hießen Lynn
Powis, Ken Baird und Gerald Hangsleben, die zu
Duisburger Legenden wurden.
Sie sorgten mit dem damaligen Team
für einen ungeheuren Boom und viele ausverkaufte
Spiele. Die Karten wurden zum Teil wie Erbhöfe
gehandelt. Ein dunkles Kapitel mit Passfälschungen
folgte 1980/81, danach der Absturz und der Neuaufbau
1981/82 als
Duisburger SC Eishockey in der 2. Bundesliga –
allerdings mit Schulden, die fast die Millionenhöhe
erreichten. Der Konkurs ließ sich aber nur
hinauszögern, zu groß war der finanzielle Schaden
durch das Skandaljahr. Aber erst 1986/87 wurden die
Schulden übermächtig und ein Schlussstrich gezogen.
Durch Satzungslücken wurde der totale Absturz in die
untersten Klassen abgefedert und ab 1987 ging der
Duisburger SV 87 ans Werk,
dem
allerdings 1991 die Luft ausging. Im November 1991
wurde nach Konkurs des DSV 87 der EV Duisburg aus
der Taufe gehoben, der mit behutsamen Schritten und
einem Neuaufbau von ganz unten anfangen musste. Über
die Regionalliga und 1. Liga Nord war er dann in der
2. Bundesliga wieder bundesweit Duisburgs Vertreter.
Bis zur Saison 2004/05.
Im April 2005 gelang nach einer sehr guten Saison
und fulminanten Schlussspurt der große Wurf. Im
Play-off-Finale gegen den Ligenprimus Straubing
Tigers wurde gewonnen und der Aufstieg in die
Eliteliga DEL perfekt gemacht. Nach dem
Bundesliga-Aufstieg mit den legendären Kanadiern
Powis und Baird der größte Duisburg Erfolg, der
unter der Federführung von Unternehmer Ralf Pape
unter Dach und Fach gebracht wurde. Er war neben
Erfolgstrainer und Deutschlands ehemaligen Torjäger
Dieter "Didi" Hegen "finanzieller Motor" und damit
auch der Erfolgsgarant. |
|