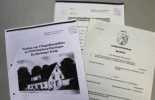|
Verurteilung eines Journalisten wegen Veröffentlichung von
Beschlüssen aus einem Ermittlungsverfahren gegen Mitglieder
der Gruppierung "Letzte Generation" rechtskräftig
Bundesgerichtshof Leipzig, 28. Januar 2026 - Beschluss vom
31. Juli 2025 - 5 StR 78/25
Der in Leipzig ansässige 5.
Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat die Revision des
Angeklagten gegen das Urteil des Landgerichts Berlin I vom
18. Oktober 2024 verworfen. Mit der angefochtenen
Entscheidung hat das Landgericht den Angeklagten wegen
verbotener Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen schuldig
gesprochen, ihn verwarnt und die Verurteilung zu einer
Geldstrafe vorbehalten (§ 59 Abs. 1 StGB).
Mit seiner
auf die Sachrüge gestützten Revision hat der Angeklagte im
Wesentlichen geltend gemacht, dass die angewandte
Strafvorschrift des § 353d Nr. 3 StGB verfassungswidrig sei.
Das Rechtsmittel hat keinen Erfolg.
Nach den
Feststellungen des Landgerichts veröffentlichte der
Angeklagte im August 2023 im Internet Beschlüsse des
Ermittlungsrichters des Amtsgerichts München, nämlich
Anordnungen von Telekommunikationsüberwachung, Durchsuchungen
und Beschlagnahmen, welche die Generalstaatsanwaltschaft
München in einem laufenden Ermittlungsverfahren gegen
Mitglieder der Gruppierung "Letzte Generation" wegen des
Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung (§ 129
StGB) beantragt hatte.
Diese Beschlüsse, die
insbesondere den Stand der Ermittlungen im Zeitpunkt der
Antragstellung zusammenfassten, veröffentlichte der
Angeklagte mit Einverständnis der betroffenen Beschuldigten
unter Schwärzungen von Namen und Geburtsdaten, der
Kontoverbindungen der Beschuldigten sowie weiterer
individualisierender Angaben, im Übrigen aber vollständig und
wortlautgetreu mit Aktenzeichen und Rubrum.
Der
Angeklagte ging davon aus, dass er durch sein Vorgehen den
Straftatbestand des § 353d Nr. 3 StGB erfüllen werde. Die
Überprüfung des Urteils hat keinen Rechtsfehler zum Nachteil
des Angeklagten ergeben. Die rechtsfehlerfrei getroffenen
Feststellungen tragen den Schuldspruch. Auch die
Strafzumessung ist frei von Rechtsfehlern.
Entgegen
der Rechtsauffassung der Revision steht die durch Art. 10
EMRK gewährleistete Freiheit der Meinungsäußerung - auch mit
Blick auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte - dem Schuldspruch nicht entgegen. Denn
die Strafvorschrift des § 353d Nr. 3 StGB greift lediglich
äußerst schonend in die Meinungs- und Pressefreiheit ein.
Sie gilt nur für Straf-, Bußgeld- oder
Disziplinarverfahren und dort jeweils nur für einen eng
begrenzten Zeitraum. Dabei erfasst sie nur solche
Publikationen, bei denen vorsätzlich amtliche Dokumente ganz
oder in wesentlichen Teilen im Wortlaut öffentlich mitgeteilt
werden; die inhaltliche Berichterstattung bleibt hingegen
stets möglich.
Es handelt sich um eine zulässige
gesetzliche Einschränkung im Sinne des Art. 10 Abs. 2 EMRK.
Entgegen dem Antrag der Verteidigung hat der Senat das
Verfahren nicht ausgesetzt, um ein Normenkontrollverfahren
gemäß Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG einzuleiten.
Die
Voraussetzungen der Norm sind nicht erfüllt. Angesichts der
bereits zu der Strafvorschrift des § 353d Nr. 3 StGB
ergangenen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts hält
der Senat die Vorschrift - auch unter Berücksichtigung des
Vorbringens der Revision - nicht für verfassungswidrig. Das
Urteil des Landgerichts Berlin I ist damit rechtskräftig.
Vorinstanz: Landgericht Berlin I - Urteil vom 18. Oktober
2024 - 536 KLs 1/24 237Js 3347/23
Bundessozialgericht: Kein Zugang zur beitragsfreien
Familienversicherung über kurzzeitigen Bezug einer Teilrente
Kassel, 23. Januar 2026 -
Ehepartner sind nicht familienversichert, wenn sie
ihre Altersrente lediglich für wenige Monate als Teilrente in
Anspruch nehmen und dadurch in dieser Zeit die
Einkommensgrenze für den Zugang zur Familienversicherung
unterschreiten. Dies hat der 6a. Senat des
Bundessozialgerichts am 22. Januar 2026 für die noch bis zum
31. Dezember 2025 geltende Rechtslage entschieden und die
Revision des Klägers zurückgewiesen (Aktenzeichen B 6a/12 KR
14/24 R).
Die beitragsfreie Familienversicherung ist
als Maßnahme des sozialen Ausgleichs nur dann gerechtfertigt,
wenn der Familienangehörige gegenwärtig und in absehbarer
Zeit schutzbedürftig ist und auch bleibt. Sie wird deshalb
nur durchgeführt, wenn das Gesamteinkommen des
Familienangehörigen "regelmäßig im Monat" unter einem
bestimmten Grenzbetrag liegt (2021: 470 Euro).
Zwar
dürfen Rentner jederzeit wählen, ob sie ihre Altersrente in
voller Höhe oder als Teilrente in Anspruch nehmen und auch
die Dauer des Teilrentenbezugs frei bestimmen. Die so
begründete Einkommenssituation muss allerdings eine gewisse
Stetigkeit und Dauer im monatlichen Rhythmus aufweisen. Daran
fehlt es, wenn die Teilrente nur wenige Monate beansprucht
wird. Die von der Krankenkasse zu treffende Prognose über die
Einkommensentwicklung des Familienangehörigen hat sich bei
Teilrenten an einem längeren Zeitraum, in der Regel von zwölf
Monaten zu orientieren.
Der Gesetzgeber hat die
Vorschrift über die Familienversicherung ab dem 1. Januar
2026 neu gefasst und zum "Schutz der Solidargemeinschaft"
Rentnern den Zugang zur Familienversicherung der gesetzlichen
Krankenversicherung über die Wahl einer Teilrente nunmehr
gänzlich verschlossen, unabhängig von der Dauer des
Teilrentenbezugs.
Verurteilung eines Berliner Arztes wegen Mitwirkung an einer
Selbsttötung rechtskräftig
Beschluss vom 14. August 2025 - 5 StR 520/24
Karlsruhe, 19. Januar 2026 - Der in Leipzig ansässige 5.
Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat die Revision des
Angeklagten gegen ein Urteil des Landgerichts Berlin I vom 8.
April 2024 verworfen. Das Landgericht hat den Angeklagten für
seine Mitwirkung an der Selbsttötung einer 37-jährigen
Geschädigten wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von
drei Jahren verurteilt. Vom wegen seiner Mitwirkung an einem
vorhergehenden Suizidversuch der Geschädigten erhobenen
Vorwurf eines versuchten Tötungsdelikts hat es ihn
freigesprochen.
Nach den Feststellungen des
Landgerichts befand sich die Geschädigte zur Tatzeit in einer
akuten depressiven Episode ihrer manisch-depressiven
Grunderkrankung, aus der sie sich nicht mehr herauszuhelfen
wusste. Sie kontaktierte deshalb den Angeklagten, einen
pensionierten Facharzt für Innere Medizin, der als
"Freitodbegleiter" arbeitete. Er erklärte sich nach einem
90-minütigen Kennenlernen sogleich zur Unterstützung ihrer
Selbsttötung bereit.
Ein Abwarten oder das Einbinden
einer Sterbehilfeorganisation hielt er nicht für
erforderlich, obwohl ihm bekannt war, dass eine depressive
Erkrankung die freie Willensbildung beeinflussen kann. Er sah
sich aber in der Lage, eine entsprechende Beurteilung
eigenständig vorzunehmen. Zudem empfand er die von
Sterbehilfeorganisationen bei psychisch erkrankten
Suizidwilligen regelmäßig geübte Zurückhaltung als
unangebracht und diskriminierend.
Einen wenige Tage
später mit vom Angeklagten bereitgestellten Mitteln
unternommenen Suizidversuch überlebte die Geschädigte
(Freispruchsfall). Angehörige verständigten Rettungskräfte,
die sie in eine psychiatrische Klinik brachten, wo sie durch
richterliche Anordnung untergebracht wurde.
Der
Angeklagte hatte versucht, die Verständigung von
Rettungskräften, den Transport der Geschädigten in die Klinik
und die richterliche Anordnung ihrer Unterbringung zu
verhindern. Nachdem ihm die Klinik Hausverbot erteilt hatte,
hielt er nunmehr telefonisch engen Kontakt zu der
Geschädigten und versicherte ihr fortwährend seine
jederzeitige und kurzfristige Bereitschaft, ihre Selbsttötung
weiter zu unterstützen.
Die Geschädigte konnte unter
dem Einfluss ihrer depressiven Erkrankung weder die ihr in
der Klinik angebotenen Behandlungsmöglichkeiten noch ihr
Leben und ihre Zukunftsperspektiven realitätsgerecht
einschätzen. Fälschlich sah sie sich als "austherapiert" an
und meinte, in ihrem Leben noch nie glücklich gewesen zu sein
und folglich nie mehr glücklich sein zu können.
Krankheitsbedingt ambivalent schwankte sie zwischen neu
gefasstem Lebensmut und dem Wunsch zu sterben. Mehrfach
teilte sie dem Angeklagten mit, seine Unterstützung nicht
mehr zu benötigen, da sie weiterleben wolle, um ihn dann -
mit Entschuldigung für das ewige "Hin und Her" - erneut um
Unterstützung zu bitten. Der Angeklagte erkannte ihre
Ambivalenz.
Um ihr die Angst vor einem erneuten
Misslingen und von der Geschädigten befürchteten Folgeschäden
zu nehmen, versicherte er der Wahrheit zuwider, ihr
Versterben dieses Mal erforderlichenfalls durch Gabe
zusätzlicher Mittel sicherzustellen.
Am Tag ihrer
Klinikentlassung nahm die Geschädigte zunächst wieder einmal
gegenüber dem Angeklagten von einer Selbsttötung Abstand. Nur
Minuten später bat sie ihn um Unterstützung für eine
Selbsttötung noch am selben Tag. Hierzu erklärte sich der
Angeklagte bereit. Er traf sich nur Stunden nach der
Entlassung mit der Geschädigten in einem Hotelzimmer, legte
ihr einen Zugang und schloss eine Infusion an, die er mit
einem nur ihm als Arzt zugänglichen Narkosemittel versetzte.
Die Geschädigte öffnete den Durchflussregler und verstarb.
Das Landgericht ist davon ausgegangen, dass die
Geschädigte den Entschluss, ihrem Leben ein Ende zu setzen,
nicht freiverantwortlich getroffen hat. Es hat dafür
maßgeblich auf den Einfluss der akuten depressiven Episode
auf ihre Willensbildung, auf die Labilität ihres
Todeswunsches während des Klinikaufenthalts und auf die
manipulative Zusicherung des Angeklagten abgestellt.
Der Angeklagte habe vorsätzlich gehandelt und das Geschehen
steuernd in den Händen gehalten, so dass er als mittelbarer
Täter eines Totschlags anzusehen sei. Für den vorangegangenen
Selbsttötungsversuch hat das Landgericht hingegen einen
Mangel an Freiverantwortlichkeit nicht sicher feststellen
können und den Angeklagten deshalb insoweit freigesprochen.
Die Überprüfung des Urteils durch den
Bundesgerichtshof auf die vom Angeklagten erhobene Sachrüge
hat keinen Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten ergeben.
Das Urteil des Landgerichts ist damit rechtskräftig.
Vorinstanz:
Landgericht Berlin I - Urteil vom 8. April
2024 - (540 Ks) 278 Js 405/21 (2/23)
Die maßgeblichen
Vorschriften des Strafgesetzbuchs lauten:
§ 25
Täterschaft
(1) Als Täter wird bestraft, wer die Straftat
selbst oder durch einen anderen begeht.
§ 212 Totschlag
(1) Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird
als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren
bestraft.
§ 213 Minder schwerer Fall des Totschlags
War der Totschläger ohne eigene Schuld durch eine ihm oder
einem Angehörigen zugefügte Mißhandlung oder schwere
Beleidigung von dem getöteten Menschen zum Zorn gereizt und
hierdurch auf der Stelle zur Tat hingerissen worden oder
liegt sonst ein minder schwerer Fall vor, so ist die Strafe
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren.
Bundesverfassungsgericht feiert 75-jähriges Jubiläum
Karlsruhe, 12. Januar 2026 - Anlässlich des 75-jährigen
Jubiläums des Bundesverfassungsgerichts wird genau 75 Jahre
nach seiner feierlichen Eröffnung am 28. September 1951 ein
Festakt in der Stadthalle im Kongresszentrum Karlsruhe
stattfinden.
Zu dieser Feierlichkeit am 28. September
2026 wird auch Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier
erwartet, der sich mit einer Rede an die Festgesellschaft
wenden wird. Zudem öffnet das Bundesverfassungsgericht am
16. Mai 2026 an seinem Sitz im Schlossbezirk in Karlsruhe
seine Türen für die Bürgerinnen und Bürger.
Diese
können sich bei vielfältigen Programmpunkten über die
Aufgaben und Organisation des Bundesverfassungsgerichts
informieren. Dabei kann nicht nur ein Blick auf, sondern auch
in das vom Architekten Paul Baumgarten entworfene und im Jahr
1969 fertiggestellte Gerichtsgebäude geworfen werden.
Ebenfalls im Mai 2026 findet im Rahmen des alljährlichen
Karlsruher Verfassungsgesprächs die Vorstellung der Studie
über die frühen Jahre des Bundesverfassungsgerichts statt.
Gefeiert wird aber nicht nur in Karlsruhe, sondern im ganzen
Land.
Mit einer Geburtstagstorte im Gepäck wird jede
und jeder der sechzehn Richterinnen und Richter des
Bundesverfassungsgerichts jeweils eines der sechzehn
Bundesländer besuchen. Dort werden sie an Schulen bei einem
Stück Torte mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen
und hierbei insbesondere die Arbeitsweise des
Bundesverfassungsgerichts erläutern.
Klausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines
Telekommunikationsunternehmens mit einer
Mindestvertragslaufzeit, die mit der Freischaltung
des Anschlusses beginnen soll, ist unwirksam
Urteil vom 8. Januar 2026 - III ZR 8/25
Karlsruhe, 8.
Januar 2026 - Der unter anderem für das Dienstvertragsrecht
zuständige III. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat heute
über die Wirksamkeit einer Klausel in Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB) eines
Telekommunikationsunternehmens zur anfänglichen
Mindestvertragslaufzeit entschieden.
Sachverhalt:
Der Kläger ist ein in die Liste nach § 4 UKlaG eingetragener
Verbraucherverband. Das beklagte
Telekommunikationsunternehmen, das sich am Ausbau des
Glasfasernetzes in Deutschland beteiligt und
Telekommunikationsdienstleistungen für den Internetzugang
über Glasfaserleitungen erbringt, verwendet in Verträgen mit
Verbrauchern über einen von der Beklagten noch
herzustellenden Glasfaseranschluss (DGN-Anschluss) eine
Klausel, die eine anfängliche Mindestlaufzeit von 12 oder 24
Monaten vorsieht, die mit der Freischaltung des
DGN-Anschlusses zu laufen beginnen soll.
Der Kläger
hält die Bestimmung, dass die Mindestvertragslaufzeit mit dem
Datum der Freischaltung des Anschlusses beginnt, für
unzulässig.
Bisheriger Prozessverlauf:
Das
Oberlandesgericht hat die Beklagte unter Androhung von
Ordnungsmitteln zur Unterlassung der Verwendung dieser und
einer inhaltsgleichen Klausel in Bezug auf
Dauerschuldverhältnisse über
Telekommunikationsdienstleistungen gegenüber Verbrauchern
sowie zum Ersatz von Abmahnkosten nebst Zinsen verurteilt.
Mit ihrer Revision möchte die Beklagte die Abweisung der
Klage erreichen.
Entscheidung des Bundesgerichtshofs:
Der III. Zivilsenat hat die Revision der Beklagten
zurückgewiesen. Er hat entschieden, dass die Klausel gemäß §
309 Nr. 9 Buchst. a BGB sowie gemäß § 307 Abs. 1 Satz 1, Abs.
2 Nr. 1 BGB in Verbindung mit § 56 Abs. 1 Satz 1 TKG
unwirksam ist.
Nach § 309 Nr. 9 Buchst. a BGB sind
Klauseln unwirksam, wenn sie eine den anderen Vertragsteil
länger als zwei Jahre bindende Laufzeit des Vertrags
vorsehen. Dabei beginnt die Vertragslaufzeit im Sinne dieser
Vorschrift nach ständiger Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs mit dem Vertragsschluss und nicht erst im
Zeitpunkt der Leistungserbringung.
§ 309 Nr. 9 BGB
ist auch auf den vorliegenden Vertrag anwendbar. Bei diesem
überwiegt nicht die Gebrauchsüberlassung. Denn die Beklagte
hat keine Verpflichtung zur Herstellung und
Gebrauchsüberlassung eines Glasfaseranschlusses übernommen.
Die beanstandete Klausel verstößt gegen § 309 Nr. 9
Buchst. a BGB, weil sie dazu führen kann, dass die - mit
Vertragsschluss beginnende - Laufzeit eines Vertrages 24
Monate überschreitet.
§ 56 Abs. 1 TKG verdrängt als
speziellere Vorschrift § 309 Nr. 9 Buchst. a BGB nicht und
führt auch nicht dazu, dass in seinem Anwendungsbereich als
Beginn der Laufzeit das Datum der Bereitstellung des
Telekommunikationsdienstes beziehungsweise der Herstellung
des Anschlusses anzusehen wäre. Der Senat hat mit Urteil vom
10. Juli 2025 (III ZR 61/24) für Folgeverträge (insbesondere
Vertragsverlängerungen) entschieden, dass auch bei § 56 Abs.
1 TKG für den Beginn der Vertragslaufzeit nicht auf den
Zeitpunkt der vereinbarten erstmaligen Leistungserbringung,
sondern auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses abzustellen
ist.
Die in diesem Urteil offengelassene Frage, ob
die Besonderheiten des Marktes auf dem
Telekommunikationsdienstleistungssektor (Vorvermarktung beim
Glasfaserausbau; Praxis des Anbieterwechsels) zu einer
abweichenden Auslegung beim Abschluss eines Erstvertrags
führen, hat er nunmehr verneint. Für eine solche Auslegung
ergeben sich weder aus dem Wortlaut der Vorschrift noch aus
ihrer Systematik oder Entstehungsgeschichte Anhaltspunkte.
Vielmehr hat der Gesetzgeber mit § 56 Abs. 2 TKG diesen
Besonderheiten Rechnung getragen.
Eine Vorlage an den
Gerichtshof der Europäischen Union war nicht veranlasst, da
die einschlägige Richtlinie über den europäischen Kodex für
die elektronische Kommunikation (EU) 2018/1972 ausdrücklich
nationale Regelungen gestattet, die kürzere maximale
Mindestvertragslaufzeiten vorsehen.
Zugleich ist die
Klausel gemäß § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB unwirksam, weil sie mit
wesentlichen Grundgedanken von § 56 Abs. 1 Satz 1 TKG nicht
zu vereinbaren ist und daher die Vertragspartner der
Beklagten gemäß § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB unangemessen
benachteiligt.
Vorinstanz:
Hanseatisches
Oberlandesgericht - Urteil vom 19. Dezember 2024 - 10 UKl
1/24
Die maßgeblichen Vorschriften lauten:
§ 307 BGB
Inhaltskontrolle
(1) Bestimmungen in Allgemeinen
Geschäftsbedingungen sind unwirksam, wenn sie den
Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treu
und Glauben unangemessen benachteiligen. …
(2) Eine
unangemessene Benachteiligung ist im Zweifel anzunehmen, wenn
eine Bestimmung
1. mit wesentlichen Grundgedanken der
gesetzlichen Regelung, von der abgewichen wird, nicht zu
vereinbaren ist …
§ 309 BGB Klauselverbote ohne
Wertungsmöglichkeit
Auch soweit eine Abweichung von den
gesetzlichen Vorschriften zulässig ist, ist in Allgemeinen
Geschäftsbedingungen unwirksam …
9. bei einem
Vertragsverhältnis, das die regelmäßige Lieferung von Waren
oder die regelmäßige Erbringung von Dienst- oder
Werkleistungen durch den Verwender zum Gegenstand hat,
a)
eine den anderen Vertragsteil länger als zwei Jahre bindende
Laufzeit des Vertrags …
§ 56 TKG Vertragslaufzeit,
Kündigung nach stillschweigender
Vertragsverlängerung
(1) Die anfängliche Laufzeit eines Vertrages zwischen einem
Verbraucher und einem Anbieter öffentlich zugänglicher
Telekommunikationsdienste, der nicht nur nummernunabhängige
interpersonelle Telekommunikationsdienste oder
Übertragungsdienste für die Bereitstellung von Diensten der
Maschine-Maschine-Kommunikation zum Gegenstand hat, darf 24
Monate nicht überschreiten. …
(2) Absatz 1 ist nicht
anzuwenden für Verträge, die nur die Herstellung einer
physischen Verbindung zum Gegenstand haben, ohne dabei
Endgeräte oder Dienste zu umfassen, auch wenn mit dem
Verbraucher vereinbart wird, dass er die vereinbarte
Vergütung über einen Zeitraum in Raten zahlen kann, der 24
Monate übersteigt.
|