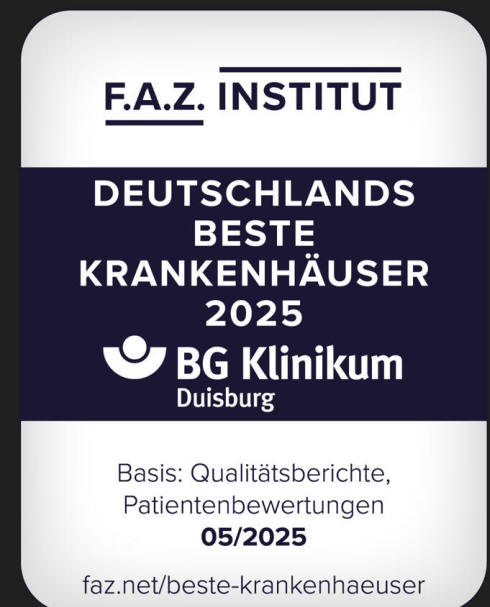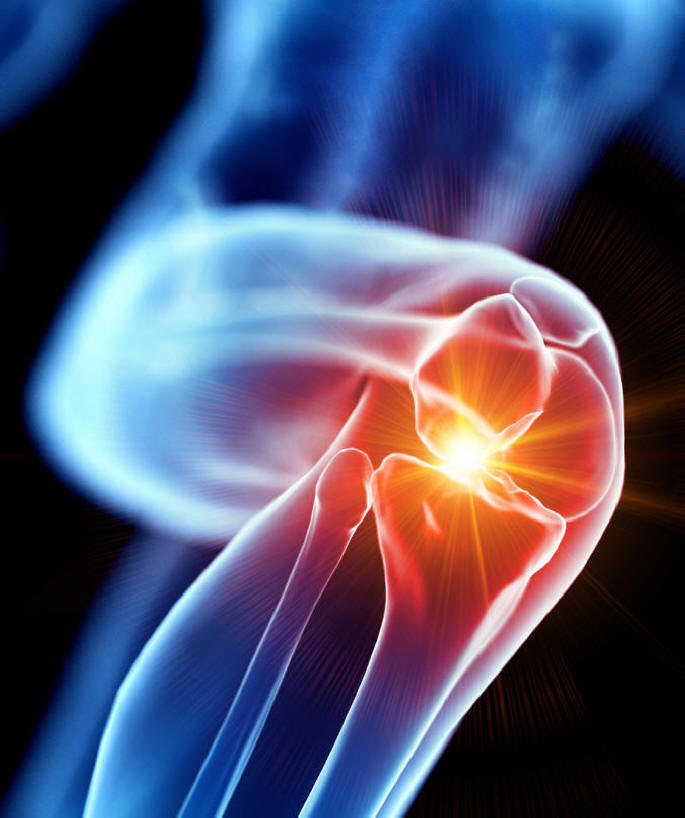|
|
Archiv Januar -
Juni 2025
|
|
Augenklinik-Schließung des Evangelischen
Klinikums Niederrhein zum 30.06.2025 |
|
Zukunftsorientierte Neuausrichtung durch veränderte Nachfrage
und Ambulantisierung
Duisburg, 27. Juni 2025 - Mit großem Bedauern gibt das
Evangelische Klinikum Niederrhein bekannt, dass die
Augenklinik am Standort Duisburg-Nord zum 30.06.2025
geschlossen wird. Diese Entscheidung ist das Ergebnis eines
intensiven Prüfungsprozesses, bei dem die Klinikleitung über
ein Jahr lang im engen Austausch mit zuständigen Behörden und
Ministerien stand, um alternative Lösungen zu finden. Trotz
dieser umfangreichen Bemühungen konnte keine tragfähige
Perspektive entwickelt werden, sodass die Schließung nun
unausweichlich ist.

Foto EVKLN.
„Es war eine der schwierigsten Entscheidungen, die wir in den
vergangenen Jahren treffen mussten,“ erklärt Franz Hafner,
kaufmännischer Geschäftsführer. „Wir wissen um die
langjährige Verbundenheit unserer Patientinnen und Patienten
zu dieser Einrichtung und schätzen das herausragende
Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
täglich mit Herzblut für das Wohl der Menschen sorgen.“
Gründe für die Schließung – Ambulantisierung und veränderte
Nachfrage
Ein wesentlicher Grund für die Schließung der Augenklinik ist
der anhaltende Trend zur Ambulantisierung. Durch den
medizinischen Fortschritt und den Einsatz moderner
Technologien können immer mehr Augenbehandlungen ambulant
durchgeführt werden. Dadurch ist die Nachfrage nach
stationären Aufenthalten in den letzten Jahren kontinuierlich
zurückgegangen.
„Die medizinische Versorgung befindet sich im Wandel. Um
langfristig eine hohe Behandlungsqualität zu gewährleisten,
müssen wir unsere Ressourcen gezielt einsetzen und uns
zukunftsorientiert aufstellen“, erläutert Dr. Andreas Sander,
Medizinischer Geschäftsführer. „Auch, wenn es uns
schwerfällt, diesen Schritt zu gehen, ist er notwendig, um
die Versorgungsqualität in anderen Bereichen weiter zu
stärken und auf die veränderten Bedürfnisse der Patientinnen
und Patienten zu reagieren.“
Intensive Prüfung und Verantwortung gegenüber den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
Die Entscheidung zur Schließung wurde nicht leichtfertig
getroffen. „Wir haben alle Möglichkeiten sorgfältig abgewogen
und zahlreiche Gespräche geführt, um eine Zukunft für die
Augenklinik zu sichern. Leider konnten wir keine tragfähige
Perspektive entwickeln,“ betont Andreas Sander. „Unser
größtes Anliegen ist es nun, die Auswirkungen auf die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so sozialverträglich wie
möglich zu gestalten. Wir wissen, dass diese Nachricht viele
persönliche Schicksale betrifft. Daher werden wir gemeinsam
mit den betroffenen Kolleginnen und Kollegen individuelle
Lösungen suchen und bestmögliche Unterstützung anbieten,“
versichert Franz Hafner.
Die Geschäftsführung bedankt sich ausdrücklich bei den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Augenklinik für ihr
außerordentliches Engagement und ihre jahrelange,
hervorragende Arbeit. „Wir sind dankbar für ihre Hingabe und
ihren unermüdlichen Einsatz für die Patientinnen und
Patienten,“ hebt der Medizinische Geschäftsführer hervor.
Patientinnen und Patienten werden auch nach der Schließung
eine umfassende und qualitativ hochwertige Versorgung
erhalten. Hierzu steht das Klinikum im engen Austausch mit
umliegenden Einrichtungen, um eine nahtlose Weiterbetreuung
zu gewährleisten.
|
|
87 Medizinische Fachangestellte in Duisburg
losgesprochen |
|
Ärztekammer Nordrhein übergibt
Abschlusszeugnisse
Duisburg, 26. Juni 2025 - Insgesamt 87
Auszubildende zur/zum Medizinischen Fachangestellten (MFA)
aus Duisburg haben am 25. Juni 2025 im Hotel-Restaurant „Am
Rubbert“ im Duisburger Stadtteil Walsum feierlich ihre
Abschlusszeugnisse erhalten. Die Absolventinnen und
Absolventen des Berufskollegs Walther Rathenau hatten ihre
Abschlussprüfungen im Winter 2024/25 sowie im Frühjahr 2025
bestanden.
Dr. Rainer Holzborn, Vorsitzender der
Kreisstelle Duisburg der Ärztekammer Nordrhein, gratulierte
den MFA zu ihrem Abschluss und überreichte den erfolgreichen
Absolventinnen ihre Abschlusszeugnisse. „Sie sind oft die
erste Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten und prägen
damit maßgeblich den ersten Eindruck einer Praxis. Als
Gesicht des Praxisalltags tragen Sie entscheidend zum
Vertrauen der Patienten bei,“ betonte Holzborn in seiner
Ansprache.
Auch Dr. Helmut Gudat,
Ausbildungsbeauftragter für MFA der Duisburger Kreisstelle,
würdigte die Leistungen der Absolventinnen und Absolventen:
„Wer diese Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat, bringt
nicht nur medizinisches Fachwissen mit, sondern auch
Organisationstalent, Kommunikationsstärke und ein hohes Maß
an Empathie. Diese Kombination ist für unsere Praxen
unverzichtbar.“
MFA sind die Schnittstelle zwischen
Arzt und Patient. Sie empfangen, beraten und betreuen die
Patientinnen und Patienten. Sie organisieren Praxisabläufe
verantwortungsbewusst und zuverlässig. Ohne die kompetente
Mitarbeit der MFA könnten die anstehenden Aufgaben in den
Arztpraxen nicht bewältigt werden.
Weitere
Informationen, zum Beispiel zur MFAAusbildung, finden Sie
unter www.aekno.de/mfa
|
|
Qualitätssicherung Früh- und Reifgeborene und
mehr... |
|
Künftig Erfassung
aller Verlegungen von Frühchen mit Geburtsgewicht unter 1500
Gramm – Dokumentation der Strukturanforderungen bis 2026 über
Servicedokument
Berlin, 19. Juni 2025 – Künftig
wird das Verlegungsgeschehen Frühgeborener mit einem
Geburtsgewicht von unter 1500 Gramm auch über
Einrichtungsgrenzen hinweg erfasst. Damit können Verlegungen
und erneute Aufnahmen zusammenhängender Behandlungsfälle
erstmals dargestellt werden. Mit Änderungen in seiner
Qualitätssicherungs-Richtlinie Früh- und Reifgeborene
(QFR-Richtlinie) hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA)
gestern dafür die letzten Voraussetzungen geschaffen.
Erfasst werden die Verlegungen automatisiert über die
Sozialdaten der Krankenkassen und zwar erstmals ab dem
Erfassungsjahr 2025. Die Details dazu hatte der G-BA bereits
im Juli 2024 mit der Spezifikation zum QS-Verfahren 13
„Perinatalmedizin“ in der Richtlinie zur datengestützten
einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung beschlossen.
Auf der Plattform www.perinatalzentren.org wird das
Verlegungsgeschehen neben den Qualitätsergebnissen
standortbezogen veröffentlicht. Die Kliniken erhalten ihre
Daten dazu vorab und haben die Möglichkeit zur Kommentierung
und Erläuterung.
Hintergrund der Erfassung des
Verlegungsgeschehens
Bislang konnten verschiedene
Behandlungsfälle eines Kindes in der Dokumentation zur
Qualitätssicherung nicht einrichtungsübergreifend dargestellt
werden. Ob und wie häufig ein Kind verlegt wurde, war so
nicht nachzuverfolgen. Das konnte zu Fehlinterpretationen und
Verzerrungen bei den Qualitätsanalysen führen.
Mit
einer zusammenhängenden Auswertung der Behandlungsfälle soll
dies künftig verhindert werden, da Verlegungen und erneute
Aufnahmen zusammenhängender Behandlungsfälle und die
zugehörigen qualitätsrelevanten Ereignisse nun über
verschiedene stationäre Einrichtungen und Aufenthalte hinweg
erfasst werden können.
Dokumentation über
Servicedokument für weitere zwei Jahre
Mit dem Beschluss
von gestern wurde zudem noch eine bestehende
Übergangsregelung um ein weiteres Jahr verlängert: Die
Datenübermittlungen, mit denen die Kliniken nachweisen, ob
sie die Strukturanforderungen eingehalten haben, laufen nun
für die Erfassungsjahre 2025 und 2026 weiter über das vom
G-BA bereitgestellte Servicedokument. Erst danach wird eine
Spezifikation zur Integration in die Kliniksoftware
bereitgestellt und die Dokumentation automatisiert.
Lungenkrebs-Früherkennung bei starken Raucherinnen
und Rauchern wird voraussichtlich ab April 2026
Kassenleistung
Berlin, 18. Juni 2025 – Menschen
mit starkem Zigarettenkonsum haben ein hohes Risiko, an
Lungenkrebs zu erkranken. Der Gemeinsame Bundesausschuss
(G-BA) hat heute für diese Personengruppe die
Lungenkrebs-Früherkennung als neue Leistung der gesetzlichen
Krankenkassen beschlossen. Ziel ist es, eine Krebserkrankung
frühzeitig zu erkennen, zeitnah die Behandlung zu ermöglichen
und so die Überlebenschancen der Betroffenen zu erhöhen.
Das Screening-Angebot kann voraussichtlich ab April 2026
in die Versorgung kommen, wenn das Bundesministerium für
Gesundheit den Beschluss nicht beanstandet und auch die
Versicherteninformation vorliegt. Starke Raucherinnen und
Raucher im Alter zwischen 50 und 75 Jahren können dann alle
12 Monate eine Untersuchung der Lunge mittels
Niedrigdosis-Computertomographie (NDCT) wahrnehmen.
Mindestpersonalausstattung in Psychiatrien – Mehr
Flexibilität, weniger Dokumentationsaufwand
Berlin, 18. Juni 2025 – Künftig sollen stationäre
Einrichtungen der Psychiatrie und Psychosomatik ihr Personal
noch flexibler einsetzen können, um bedarfsgerecht zu
arbeiten und ohne die Mindestvorgaben zu unterschreiten.
Zugleich soll es weniger Dokumentationsaufwand für sie
geben bei gleichbleibender Versorgungsqualität. Den Weg dafür
freigemacht hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) heute
durch eine Anpassung seiner „Personalausstattung Psychiatrie
und Psychosomatik-Richtlinie“ (PPP-RL).
Außerklinische Intensivpflege – Neue Ausnahmeregelung zur
Potenzialerhebung
Berlin, 18. Juni 2025 – Der
Gesetzgeber sieht vor, dass vor der Verordnung von
außerklinischer Intensivpflege bei beatmeten oder
trachealkanülierten Patientinnen und Patienten eine
sogenannte Potenzialerhebung stattfinden muss: Besonders
qualifizierte Ärztinnen und Ärzte prüfen, ob eine
vollständige Entwöhnung von der Beatmung, eine Umstellung auf
eine nicht-invasive Beatmung oder die Entfernung der
Trachealkanüle möglich ist.
Der Gemeinsame
Bundesausschuss (G-BA) hat jetzt in seiner Richtlinie zur
außerklinischen Intensivpflege eine neue dauerhafte
Ausnahmeregelung von der verpflichtenden Potenzialerhebung
beschlossen: Bei Versicherten, die bis einschließlich 30.
Juni 2025 Leistungen der außerklinischen Intensivpflege
erhalten haben, ist eine Potenzialerhebung nicht zwingend
notwendig.
Sie erfolgt für diesen Kreis nur noch bei
Anzeichen für ein Entwöhnungs- bzw. Dekanülierungspotenzial
oder auf Wunsch der Betroffenen. Folgeverordnungen von
außerklinischer Intensivpflege sind für diesen
Versichertenkreis künftig bis zu 12 Monate möglich.
G-BA aktualisiert DMP Diabetes mellitus Typ 1
Berlin, 18. Juni 2025 – Der Gemeinsame
Bundesausschuss (G-BA) hat seine Anforderungen an die
Diagnostik und Behandlung im Disease-Management-Programm
(DMP) Diabetes mellitus Typ 1 aktualisiert. Wissenschaftliche
Basis war die Auswertung von insgesamt 28 neuen Leitlinien
durch das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im
Gesundheitswesen.
Diese hatte an verschiedenen
Aspekten des DMP Diabetes mellitus Typ 1 Anpassungsbedarf
ergeben. Die beschlossenen Änderungen betreffen u. a. die
Eingangsdiagnose, die Therapie sowie die Vorbeugung
verschiedener diabetischer Folgeerkrankungen. Derzeit nehmen
rund 278.500 gesetzlich versicherte Menschen mit Diabetes
mellitus Typ 1 an einem strukturierten Behandlungsprogramm
teil.
|
|
Weltblutspendetag: Demografischer
Wandel erfordert gemeinsames Handeln
|
|
DRK-Blutspendedienste setzen auf
generationenübergreifendes Engagement
Duisburg, 2.
Juni 2025 - Am 14. Juni ist Weltblutspendetag – ein Tag, der
allen unermüdlichen Spenderinnen und Spendern gewidmet ist.
Ihr Einsatz ist ein Ausdruck gelebter Solidarität und ein
unverzichtbarer Beitrag zur medizinischen Versorgung in
Deutschland.
Wem hilft meine Blutgruppe
Der
Weltblutspendetag ist ein Tag, der allen unermüdlichen
Blutspenderinnen und Blutspendern gewidmet ist. Ihr Einsatz
ist ein Ausdruck gelebter Solidarität und ein unverzichtbarer
Beitrag zur medizinischen Versorgung in Deutschland.
Angesichts dieses großen Engagements sprechen die
DRK-Blutspendedienste, auch im Namen aller Patientinnen und
Patienten, ihren herzlichen Dank für den herausragenden und
selbstlosen Einsatz zum Wohle der Gemeinschaft aus.

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels gewinnt
dieses unersetzliche Engagement zusätzlich an Bedeutung:
Während die Bevölkerung insgesamt altert, sinken insbesondere
in den jüngeren Altersgruppen die Spenderzahlen – eine
Entwicklung, die langfristig zur Herausforderung für die
Versorgungssicherheit werden kann.
„Unser
Versorgungssystem ist auf das dauerhafte Mitwirken vieler
angewiesen – über Generationen hinweg“, betont Georg Götz,
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der
DRK-Blutspendedienste. „Ob Grippewelle, Sommerferien oder
demografischer Wandel – je mehr Menschen regelmäßig spenden,
desto stabiler bleibt die Versorgung. Blutspenderinnen und
Blutspender sind echte Leuchttürme der Gemeinschaft. Sie
zeigen Haltung, Verantwortung und Solidarität.“
Im
Jahr 2024 kamen rund 3,16 Millionen Menschen zu einem der
bundesweit 40.696 DRK-Blutspendetermine. Sie alle tragen zur
Versorgung von Patientinnen und Patienten in Kliniken bei –
an 365 Tagen im Jahr. Doch mit Blick auf die Zukunft reicht
dieses Engagement allein nicht aus. Nur mit einer dauerhaft
breiten Basis an Spenderinnen und Spendern kann die
Versorgung auch künftig gesichert werden. Eine alternde
Gesellschaft macht deutlich: Jede Spende zählt!
Blutspende braucht Planung – besonders im Sommer
Erfahrungsgemäß kommt es in den Sommermonaten immer wieder zu
einem Rückgang bei der Spendenbereitschaft – etwa durch
Urlaubszeiten oder Hitzewellen. Gleichzeitig bleibt der
Bedarf an Blutpräparaten konstant hoch: Täglich werden in
deutschen Kliniken tausende Präparate für Operationen, zur
Behandlung schwerer Krankheiten oder in Notfällen benötigt.
Die DRK-Blutspendedienste appellieren daher eindringlich:
Blutspenden retten Leben – regelmäßig,
generationenübergreifend und zu jeder Jahreszeit.
DRK-Blutspende in Deutschland in Zahlen – Vergleich 2024 /
2023
Anzahl DRK-Blutspendetermine
2024: 40.696
2023:
40.031
Veränderung: +1,6 %
Spendewillige
2024:
3.160.254
2023: 3.171.009
Veränderung: –0,3 %
Erstspendewillige
2024: 288.524
2023: 307.164
Veränderung: –6,0 %
Regional (Nordrhein-Westfalen /
Rheinland-Pfalz / Saarland)
"Der Blutspendedienst-West
steht für eine sichere Versorgung von rund 23 Millionen
Menschen und damit rund 28 Prozent der bundesdeutschen
Bevölkerung. Allein in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz
und dem Saarland werden täglich bis zu 3.500 Blutkonserven
benötigt, so Stephan David Küpper, Pressesprecher des
DRK-Blutspendedienst West."
Diesen besonderen Auftrag
erfüllen die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden des
DRK-Blutspendedienstes West täglich auf rund 50
Blutspendeterminen. "Ohne den freiwilligen und
kontinuierlichen Einsatz derer, die durch ihre Blutspenden
das medizinische Gemeinwohl unterstützen, wäre dies nicht zu
leisten, so Küpper weiter." Mit einer Blutspende kann bis zu
drei kranken oder verletzten Menschen geholfen werden. Eine
Blutspende ist Hilfe, die ankommt und schwerstkranken
Patienten eine Überlebenschance gibt.
Das DRK bittet
alle Bürger, die Blut spenden möchten, sich vorab online
einen persönlichen Termin zu reservieren. Alle Termine sowie
eventuelle Änderungen, aktuelle Maßnahmen und Informationen
rund um das Thema Blutspende sind unter 0800 11 949 11 oder
unter www.blutspende.jetzt tagesaktuell abrufbar.
|
|
Pflegekraft im Hospiz? „Die beste Entscheidung meines
Lebens“ |
|
Duisburg-Huckingen. „Du arbeitest im
Hospiz? Das könnte ich nicht!“ An Reaktionen wie diese sind
Christiane Thomas (57) und Manuela Suler (55) inzwischen
gewöhnt. Schließlich sind sie seit zehn bzw. sieben Jahren in
der Betreuung schwerkranker Menschen ohne Heilungschancen
tätig. Und auf Basis dieser Erfahrung versichern sie
glaubhaft, dass sie sich keine schönere Aufgabe im
Pflegebereich vorstellen können – was viele Menschen
erstaunt.
Christiane Thomas und Manuela Suler
haben viele Jahre im Krankenhaus gearbeitet. Dann wechselten
die Krankenschwestern in den Hospizbereich. Hier werde der
Mensch als Mensch gesehen, sagen sie. „Mit all seinen
Ängsten, Nöten und Bedürfnissen“.

Manuela Suler (l.) und Christiane Thomas berichten von ihren
Erfahrungen im Malteser Hospizzentrums St. Raphael. Foto:
Malteser
Die beiden Mitarbeiterinnen des Malteser
Hospizzentrums St. Raphael haben als examinierte
Krankenschwestern viele Jahre in Krankenhäusern gearbeitet.
Und beide haben irgendwann festgestellt, dass sie einen
Wechsel brauchen. „Ich wollte nicht mehr im Rückwärtsgang in
Patientenzimmern unterwegs sein“, so fasst es Manuela Suler
zusammen. „Mein Ziel war es, wieder mehr Zeit für die
Patientinnen und Patienten zu haben. Und das habe ich im
Hospiz gefunden.“
Die Menschen, denen sie sich widmet,
haben „die diagnostischen und therapeutischen Mühlen“ hinter
sich, wie sie es formuliert. „Jetzt stehen essenzielle Themen
im Vordergrund: Wie sieht meine Lebensbilanz aus? Was möchte
ich aus dem Rest meines Lebens machen?“ Wer ins Hospiz geht,
vertraut dem Team die Mitgestaltung des letzten
Lebensabschnitts an. „Das ist eine große Verantwortung, aber
auch ein großer Ansporn“, findet Suler. „Wir dürfen mit all
unserer professionellen Nähe nicht nur die Betroffenen,
sondern auch ihre Familien begleiten.“
Die Pflege im
Hospiz umfasst einerseits die typischen Bereiche wie
Körperpflege, Versorgung mit Essen und Trinken sowie
Medikamentengabe, vor allem zur Schmerzlinderung. Hinzu kommt
die psychosoziale Begleitung, das Sprechen, Zuhören und das
„Einfach-da-sein“.
„Das kann unter anderem bedeuten,
in schweren Phasen solange beruhigend auf der Bettkante zu
sitzen, bis es dem Patienten oder der Patientin wieder besser
geht“, sagt Manuela Suler. „Unsere Aufgabe ist es, Ängste und
Schmerzen zu nehmen oder zumindest bestmöglich zu lindern.
Auch bei Übelkeit oder Appetitlosigkeit helfen wir.“ Wichtig
ist dem Team, niemanden allein zu lassen, der es nicht will.
„Das funktioniert, weil bei uns nicht an Fachpersonal gespart
wird“, sagt Suler.
„Im Hospiz wird der Mensch als
Mensch gesehen, mit all seinen Ängsten, Nöten und
Bedürfnissen“, sagt Christiane Thomas. Sie ist
stellvertretende Pflegedienstleiterin in der
Malteser-Einrichtung. „Natürlich kommen die Menschen
letztlich zum Sterben zu uns. Aber zunächst geht es darum,
die verbleibende Zeit zu leben und vielleicht auch noch ein
wenig zu genießen.“ Sie sehe oft in glückliche Gesichter.
„Die Wertigkeit und die Prioritäten verändern sich eben in
dieser Situation.“
Der Wechsel in den Palliativ- bzw.
Hospizbereich sei „die beste Entscheidung meines Lebens“,
gewesen“, sagt Christiane Thomas. Dabei wollen weder sie noch
ihre Kollegin Manuela Suler bestreiten, dass ihnen die
erlebten Schicksale mitunter auch sehr nahegehen. Christiane
Thomas: „Man lernt, den richtigen Umfang damit zu finden.
Hinzu kommt die Unterstützung des gesamten Teams.“ Und die
körperliche Belastung? „Für anstrengende Pflegetätigkeiten
wie etwa das Umlagern stehen inzwischen diverse moderne
Hilfsmittel zur Verfügung“, sagt Christiane Thomas.
Allen jungen Menschen, die über einen Einstieg in die Pflege
nachdenken, aber auch älteren Quereinsteigerinnen und
-einsteigern empfiehlt sie, sich über die
Arbeitsmöglichkeiten im Hospizbereich zu informieren. „Es
kann eine wunderbare Aufgabe sein.“
Malteser
Hospizzentrum St. Raphael
Das Malteser Hospizzentrum St.
Raphael umfasst einen ambulanten Palliativ- und Hospizdienst
sowie ein stationäres Hospiz mit zwölf Plätzen für
schwerstkranke Menschen in der letzten Lebensphase. Zudem
unterstützt der Kinder- und Jugendhospizdienst „Bärenstark“
lebensverkürzend erkrankte Kinder und Jugendliche sowie ihre
Familien in der Häuslichkeit. Hinterbliebenen stehen die
geschulten und erfahrenen Mitarbeitenden des Hospizzentrums
im Rahmen der Trauerberatung und -begleitung mit
unterschiedlichen Beratungsangeboten für Erwachsene und
Kinder zur Seite.
|
|
Deutschlands beste Krankenhäuser: BG Klinikum
Duisburg ist ausgezeichnet
|
|
F.A.Z.-Institut vergibt erneut Gütesiegel für die
Gesamtklinik und für drei Fachabteilungen
Duisburg, 21. Mai 2025. Ausgezeichnete 88,3 von 100
möglichen Punkten: Auch in diesem Jahr gehört das BG Klinikum
Duisburg wieder zu „Deutschlands besten Krankenhäusern.“ Das
geht aus der im Mai erschienenen neuen Studie des
F.A.Z.-Instituts hervor, in der die Spezialistinnen und
Spezialisten aus dem Duisburger Süden in der Kategorie
Kliniken mit 300 bis 500 Betten das Zertifikat erhalten
haben. Bewertet wurden in dem umfangreichen F.A.Z.-Ranking
unter anderem Patientenbewertungen und Qualitätsberichte. Im
Vergleich zu 2024 hat das BG Klinikum dabei sein ohnehin
gutes Ergebnis noch einmal um über neun Punkte verbessert.

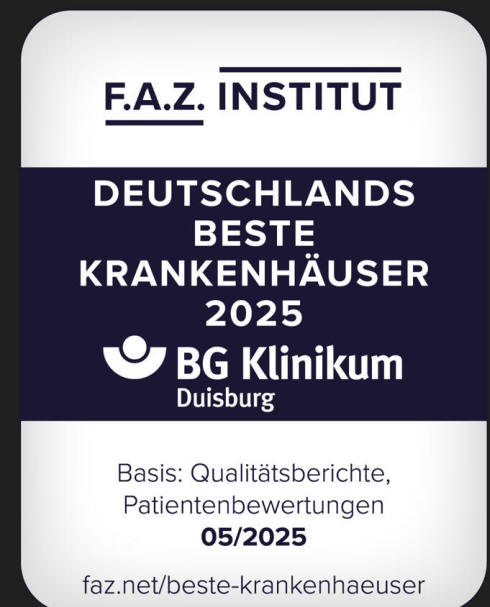
Geschäftsführerin Brigitte Götz-Paul und Univ.-Prof. Dr. med.
Marcel Dudda, Ärztlicher Direktor. (Bild: BG Klinikum
Duisburg)
„Unsere herausragende Qualität und unsere
exzellente Versorgung im Bereich der Unfallmedizin sind von
der F.A.Z.-Bestenliste angemessen eingeschätzt worden“,
freuten sich Brigitte Götz-Paul, die Geschäftsführerin des BG
Klinikums, und Univ.-Prof. Dr. med. Marcel Dudda, Ärztlicher
Direktor der Unfallklinik, nach Bekanntwerden der Ergebnisse.
„Möglich gemacht haben dies unsere engagierten,
hochqualifizierten Beschäftigten in allen Berufsgruppen und
die kontinuierliche Weiterentwicklung des Hauses auf allen
Ebenen mit dem Ziel, Vorbild für das Krankenhauswesen in
Deutschland zu sein.“ Die langjährige Strategie, die
Gesundheit und das Wohlbefinden der Patientinnen und
Patienten an die erste Stelle zu setzen, habe sich nun schon
zum wiederholten Male bewährt.
Bestes Krankenhaus und
drei ausgezeichnete Fachabteilungen
Zu den ausgezeichneten
Siegern in der FAZ-Studie zählen auch drei der
Fachabteilungen des BG Klinikums. Während die Orthopädie und
Unfallchirurgie (96,1 von 100 Punkten) und die Handchirurgie,
Plastische Chirurgie und Zentrum für Schwerbrandverletzte“
(91,8 von 100 Punkten) ihren Erfolg aus dem letzten Jahr
bestätigten und ihre Punktezahl deutlich weiter verbesserten,
erhält die Schmerzmedizin des BG Klinikums Duisburg (79,8 von
100 Punkten) zum ersten Mal das Gütesiegel.
„Hervorragende Fachkenntnisse, modernste technische Geräte,
ein ganzheitlicher und patientenorientierter Ansatz sowie ein
exzellenter Ruf – das sind Werte, die nicht nur die drei
spezialisierten Bereiche auszeichnen, sondern auch alle
anderen Abteilungen im BG Klinikum ausmachen“, erklären
Brigitte Götz-Paul und Prof. Dr. med. Marcel Dudda zufrieden.
2.300 Krankenhausstandorte im Fokus
In der neuen
Studie hat das F.A.Z.-Institut die Leistungsdaten von über
2.300 Krankenhausstandorten in Deutschland unter die Lupe
genommen und ausgewertet. Nur die besten davon sind in der
Liste der zertifizierten Krankenhäuser und Fachabteilungen
auf der offiziellen Website des F.A.Z.-Institutes unter
https://www.faz.net/asv/beste-krankenhaeuser/ zu finden.
Das F.A.Z.-Ranking ist für viele Patientinnen und
Patienten ein wichtiges Entscheidungskriterium, um die beste
Klinik für die eigene Erkrankung zu finden.

Marktführer in der Unfallmedizin: BG Klinikum Duisburg.
(Bild: BG Klinikum Duisburg)
|
|
Hohe Qualität in der
Krebsbehandlung – Brustzentrum Duisburg erneut zertifiziert
|
|
Duisburg, 19. Mai 2025 - Das
interdisziplinäre Team des Brustkrebszentrums am Helios
Standort St. Anna in Huckingen wurde von der
Prüfungskommission der Ärztekammer (ÄKzert®) erneut für
höchste Qualität in der Tumorbehandlung ausgezeichnet.
In Deutschland erhalten jährlich mehr als 70.000 Frauen
die schwere Diagnose „Brustkrebs“. Wird die Tumorerkrankung
jedoch frühzeitig erkannt, lässt sie sich häufig gut
behandeln. Daher spielen sowohl die Vorsorge als auch die
unabhängige Begutachtung und Bewertung der Behandlung eine
zentrale Rolle.
Auch das Duisburger Brustzentrum am
Helios Standort St. Anna in Huckingen stellt sich regelmäßig
dieser anspruchsvollen Prüfung durch die renommierte
Zertifizierungsstelle ÄKzert® der Ärztekammer Westfalen – und
hat den Test nun erneut erfolgreich mit einer offiziellen
Rezertifizierung bestanden. Seit 2008 beweist es damit
dauerhaft die höchstmögliche Behandlungsqualität.

Teambild u.a. mit Chefarzt Dr. Alejandro Corral (ganz rechts)
und oberärztlicher Zentrumsleiterin Anke Pollmanns (mittig in
Jeansjacke).
„Unser Ziel ist es auch zukünftig, in
Duisburg und der Region die bestmögliche Versorgung bei
Brustkrebs anzubieten“, erklärt Dr. Alejandro Corral, der
gynäkologische Chefarzt und Leiter des Brustzentrums.
„Deshalb ist die kontinuierliche Bewertung unserer Arbeit
durch die Ärztekammer ein sehr wichtiger Maßstab für uns und
vor allem hilfreicher Wegweiser für Patientinnen.“ Dieser
Erfolg sei dem großartigen Team zu verdanken, so Corral.
Einem Team, das sich nach der Neuorganisation an den Helios
Standorten schnell wieder zu einer starken Einheit
zusammengefunden habe.
Im Huckinger Brustzentrum
profitieren betroffene Frauen konstant von der Expertise und
Erfahrung eines interdisziplinären Teams aus Gynäkolog:innen,
Radiolog:innen, Onkolog:innen, Patholog:innen,
Strahlentherapeut:innen, Psycholog:innen,
Brustpflegeschwestern und weiteren Partner:innen – und das
rund um die Uhr. Zudem besteht für Patientinnen die
Möglichkeit, an Studien teilzunehmen und somit Zugang zu den
neuesten Therapieansätzen zu erhalten.
In den
regelmäßigen Tumorkonferenzen werden alle Krankheitsverläufe
mit den beteiligten Spezialist:innen individuell besprochen.
„Wir erarbeiten gemeinsam die besten Therapiemöglichkeiten
und planen die Behandlung in enger Abstimmung mit der
Patientin“, erklärt Anke Pollmanns, Senologin und
oberärztliche Leitung des Brustzentrums.
Der
Standort St. Anna ist dabei der operative Hauptstandort, doch
egal, ob Betroffene im Norden oder Süden Duisburgs wohnen:
Sie können am nächstgelegenen Helios Standort mit der
Behandlung beginnen. Das übergreifende Team sorgt dann für
eine nahtlose, effektive Weiterbehandlung mit allen
Therapieoptionen.
|
|
FOCUS-Ärzteliste 2025: 7
Mediziner des Klinikverbundes EVKLN & BETHESDA ausgezeichnet
|
|
Duisburg, 19. Mai
2025 - Wer krank wird, sucht nicht nur Hilfe, sondern die
bestmögliche medizinische Versorgung. Orientierung bietet
hier die FOCUS-Ärzteliste 2025, in der der Klinikverbund
Evangelisches Klinikum Niederrhein und BETHESDA Krankenhaus
Duisburg auch in diesem Jahr wieder vertreten ist. Sieben
Experten aus den Kliniken in Duisburg, Dinslaken und
Oberhausen wurden als Top-Mediziner in die Liste aufgenommen.
Prof. Dr. Daniel Vallböhmer, Chefarzt der Klinik für
Allgemein- und Viszeralchirurgie am Evangelischen Klinikum
Niederrhein, ist dreimal in der Ärzteliste vertreten. Er ist
ausgewiesener Spezialist für Tumoren des Verdauungstraktes,
Hernienchirurgie und Proktologie und deckt ein breites
operatives Spektrum ab. Seine Expertise reicht von komplexen
onkologischen Eingriffen bis hin zu minimal-invasiven
Operationen.

Prof. Dr. Daniel Vallböhmer (Quelle: EVKLN)
Ebenfalls drei Mal empfohlen wird Prof. Dr. Jan Fichtner,
Chefarzt der Klinik für Urologie am Johanniter Krankenhaus
Oberhausen. Der Experte auf dem Gebiet der Uroonkologie wird
in den Fachgebieten Blasenkrebs, Nierenkrebs und
Prostatakrebs aufgeführt. Seit vielen Jahren begleitet er
Patientinnen und Patienten mit onkologischen Erkrankungen
kompetent und mit einem ganzheitlichen Blick.

Prof.
Dr. Jan Fichtner (Quelle: EVKLN)
Am Herzzentrum
Duisburg freuen sich drei Chefärzte über ihre Platzierungen
in der FOCUS-Ärzteliste. Prof. Dr. Alexander Jánosi,
stellvertretender Chefarzt der Klinik für Kardiologie,
Angiologie und Elektrophysiologie, wird für seine Expertise
in der Angiologie empfohlen. Prof. Dr. Jochen Börgermann,
Chefarzt der Klinik für Herzchirurgie, zählt zu den
Spezialisten in der Herzchirurgie. Und Dr. Gleb Tarusinov,
Chefarzt der Klinik für Kinderkardiologie und angeborene
Herzfehler, wird für seine Arbeit in der Kinderkardiologie
gewürdigt.
Harald Krentel, Chefarzt der Klinik für
Gynäkologie und Frauenheilkunde am BETHESDA Krankenhaus
Duisburg, wird in der Ärzteliste 2025 zweimal empfohlen. Er
überzeugt sowohl im Bereich gynäkologischer Operationen als
auch bei der Behandlung gynäkologischer Tumoren mit seiner
hohen fachlichen Kompetenz und langjährigen Erfahrung.
Für seine Leistungen auf dem Gebiet der endokrinen
Chirurgie wurde Prof. Dr. Dietmar Simon in die
FOCUS-Ärzteliste aufgenommen. Der erfahrene Senioroperateur
am BETHESDA Krankenhaus ist spezialisiert auf Eingriffe an
Schilddrüse, Nebenniere und Bauchspeicheldrüse.
Die
FOCUS-Ärzteliste 2025 wurde vom unabhängigen
Rechercheinstitut FactField im Auftrag von FOCUS-Gesundheit
erstellt. Grundlage sind über 1,1 Millionen Datensätze,
strukturierte Selbstauskünfte, Empfehlungen aus dem
Kollegenkreis sowie die Auswertung von 2,3 Millionen
wissenschaftlichen Publikationen.
Die Platzierungen
von sieben Medizinern aus dem Klinikverbund Evangelisches
Klinikum Niederrhein und BETHESDA Krankenhaus Duisburg
spiegeln die fachliche Breite und das kontinuierliche
Engagement an den Verbundstandorten in Duisburg, Dinslaken
und Oberhausen wider. Für Patientinnen und Patienten bietet
die Ärzteliste eine hilfreiche Orientierung bei der Suche
nach qualifizierten Experten in der medizinischen Versorgung.
|
|
Maßarbeit bei künstlichen Hüft-, Knie- und
Schultergelenken
|
|
Informationsabend
Endoprothetik am 27. Mai 2025 im BG Klinikum Duisburg
Duisburg, 16. Mai 2025 - Über 400.000 Menschen in Deutschland
erhalten jedes Jahr ein künstliches Hüft-, Knie- oder
Schultergelenk. Doch wann benötige ich so eine Prothese
wirklich? Was erwartet mich bei dieser Operation? Und wann
bin ich danach wieder fit für den Beruf oder Alltag?
Antworten auf diese und viele andere Fragen zum Thema
Endoprothetik geben Expertinnen und Experten des BG Klinikums
Duisburg beim „Informationsabend Gelenkersatz“ am 27. Mai
2025 in der Mehrweckhalle des Hauses.
Das Team des
zertifizierten EndoProthetikZentrums (EPZ) der Klinik hat an
diesem Tag zwischen 17:00 und 19:00 Uhr für potenzielle
Patientinnen und Patienten sowie alle anderen Interessierten
ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet.
Zuhören
und mitmachen
Dazu gehören u.a. informative Vorträge zum
Thema künstliche Gelenke sowie ein spannender Workshop zum
Mitmachen für alle Teilnehmenden. „Bei letzterem zeigen wir
an Knochenmodellen wie ein künstliches Gelenk eingebaut wird
und natürlich auch wie es funktioniert“, beschreibt Dr. med.
Nikolaus Brinkmann, Stellv. Ärztlicher Direktor und Chefarzt
der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie im BG Klinikum
den Ablauf.
Wichtig ist den Ärztinnen und Ärzten
aus dem EPZ zu zeigen, dass es sich um Maßarbeit handelt –
ausgiebig messen, bohren, sägen und hämmern inklusive.
Schließlich soll am Ende für die Patientin bzw. den Patienten
alles passen und das künstliche Gelenk sicher „sitzen“.

1. Das EPZ-Team des BG Klinikums Duisburg (von links nach
rechts: Dr. med. Sebastian Eichberger, Leitender Arzt im EPZ,
Dr. med. Nikolaus Brinkmann, Stellv. Ärztlicher Direktor und
Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, Dr.
med. Svenja Petersen, EPZ-Koordinatorin und Oberärztin).
(Bild: BG Klinikum Duisburg)
Maßgeschneiderte
Versorgung
„In die Rolle einer Ärztin bzw. eines Arztes
schlüpfen und beim Einbau der Implantate an Knochenmodellen
mithelfen dürfen auch die Besuchenden der Infoveranstaltung“,
verrät Dr. med. Sebastian Eichberger, Leitender Arzt der
Sektion Endoprothetik und Alterstraumatologie, der wie auch
der Rest seines Teams große Erfahrung und Kompetenz im
Bereich Gelenkersatz besitzt.
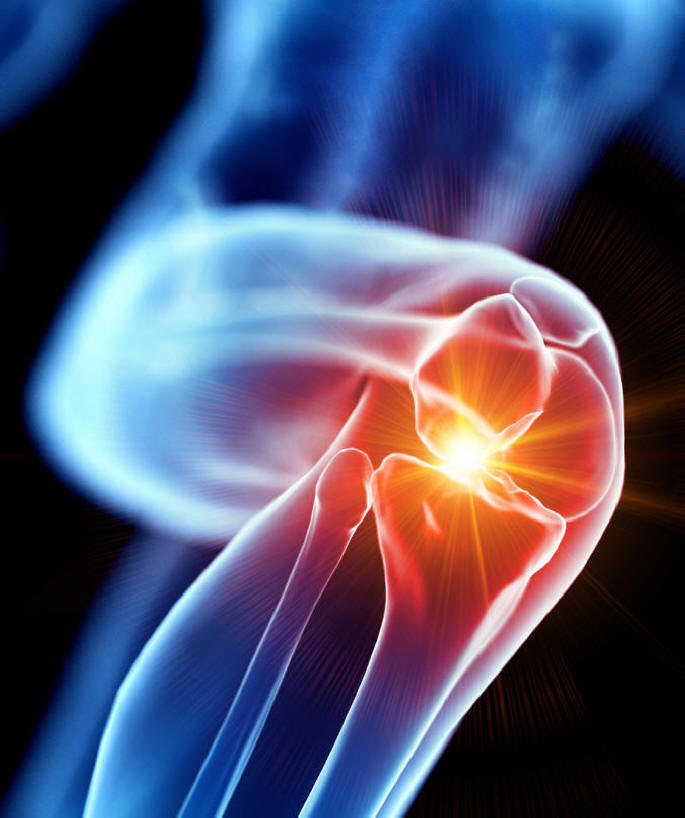
„Wir wollen in diesem Workshop informieren, aber auch den
Betroffenen die Angst vor einer ggf. notwendigen Operation
nehmen“, ergänzt EPZ-Koordinatorin und Oberärztin Dr. med.
Svenja Petersen. Denn die Endoprothetik habe in den letzten
Jahren große Fortschritte gemacht – sowohl was die
verwendeten Materialien und Techniken betrifft als auch die
eingesetzten Operationsmethoden.
So wählt
beispielsweise heute die behandelnde Ärztin bzw. der
behandelnde Arzt zusammen mit der bzw. dem Betroffenen aus
den verschiedenen vorhandenen Gelenkmodellen das aus, was am
besten für die jeweilige Patientin bzw. den jeweiligen
Patienten geeignet ist.
Präzise Antworten auf alle
Fragen
Doch was passiert eigentlich im Anschluss an die
Gelenkersatz-OP? Wann darf ich wieder normal laufen oder die
Schulter bewegen? Und was kann ich selbst dafür tun, die
Heilung nach Möglichkeit weiter zu beschleunigen? Auch darum
geht es beim Infoabend am 27. Mai.
Die
Therapieleitung im BG Klinikum Duisburg, Maike Schrader, und
die Bereichsleitung Reha Ulrich Suttmeier, berichten
ausführlich darüber, wie die Nachbehandlung abläuft. Sie
geben aber auch Tipps und beantworten – genau wie das
Ärztinnen- und Ärzte-Team – gerne die Fragen der
Teilnehmenden. Ein Get together mit einem Currywurst-Imbiss
rundet die Veranstaltung ab.
Der Informationsabend
findet in der Mehrzweckhalle des BG Klinikums Duisburg statt.
Der Eintritt ist frei. Eine Voranmeldung ist unter der
Telefonnummer 0203-76883399 gewünscht.
|
|
- Früherkennung: G-BA erweitert
Neugeborenen-Screening auf Vitamin-B12-Mangel und weitere
Stoffwechselerkrankungen
- Kinderuntersuchungsheft enthält
künftig auch Ergebnisse der zahnärztlichen Früherkennung
|
|
Früherkennung: G-BA erweitert
Neugeborenen-Screening auf Vitamin-B12-Mangel und weitere
Stoffwechselerkrankungen
Berlin, 15. Mai 2025 –
Das Screening auf Vitamin-B12-Mangel sowie auf die sehr
seltenen angeborenen Stoffwechselerkrankungen Homocystinurie,
Propionazidämie und Methylmalonazidurie wird künftig
Bestandteil der Früherkennungsuntersuchungen bei
Neugeborenen. Unbehandelt gefährden diese Erkrankungen die
körperliche und geistige Entwicklung des Kindes.
Den
Beschluss zur Ergänzung des erweiterten
Neugeborenen-Screenings traf der Gemeinsame Bundesausschuss
(G-BA) in seiner heutigen Plenumssitzung. Damit können
voraussichtlich ab Mai 2026 drei weitere angeborene Störungen
des Stoffwechsels sowie ein Vitamin-B-12-Mangel frühzeitig
entdeckt werden.
Dazu Prof. Josef Hecken,
unparteiischer Vorsitzender des G-BA: „Neue Zielerkrankungen
können vom G-BA immer erst nach Abschluss eines aufwendigen
Prüfprozesses in das Neugeborenen-Screening aufgenommen
werden.
Denn jede Früherkennungsuntersuchung hat auch
ein Schadenspotenzial – falsche Testergebnisse können
beispielsweise zu unnötigen Sorgen bei den Eltern führen und
zu überflüssigen Folgeuntersuchungen. Beim Vitamin-B12-Mangel
und den drei sehr seltenen Stoffwechselerkrankungen
überwiegen die Vorteile. Da die betroffenen Neugeborenen
anfangs meist symptomfrei sind, wird nur durch das Screening
ein früher Therapiebeginn ermöglicht.“
Wie läuft das
erweiterte Neugeborenen-Screening ab?
Beim erweiterten
Neugeborenen-Screening werden Neugeborenen am zweiten oder
dritten Lebenstag – also in der Regel bei der zweiten
Vorsorgeuntersuchung (U2) – aus der Ferse einige Tropfen Blut
entnommen und auf eine spezielle Filterpapierkarte gegeben.
Die Trockenblutkarte wird sofort zur Analyse in ein
Screening-Labor geschickt.
In den allermeisten Fällen
ist das Screening-Ergebnis unauffällig und die Eltern müssen
nichts weiter tun. Ist bei einem Neugeborenen das
Screening-Ergebnis auffällig, wird die Laborärztin oder der
Laborarzt die Eltern innerhalb von maximal 72 Stunden direkt
kontaktieren. Sie werden darüber informiert, dass eine
zeitnahe Kontrolle notwendig ist oder für eine
Abklärungsuntersuchung mit ihrem neugeborenen Kind ggf. an
eine für die Erkrankung spezialisierte Einrichtung
vermittelt.
In einer Broschüre, die den Eltern bei der
U2 übergeben wird, informiert der G-BA über den Ablauf und
das Ziel des erweiterten Neugeborenen-Screenings. Sie wird
nach Inkrafttreten des aktuellen Beschlusses um die
Erläuterung der vier neuen Zielerkrankungen ergänzt.
Die neuen Zielerkrankungen im Einzelnen
Vitamin-B12-Mangel
bei Neugeborenen kann verschiedene Ursachen haben: Er kann
erworben sein aufgrund eines Vitamin-B12-Mangels der Mutter.
Da Vitamin-B12-Mangel häufiger bei vegetarischer oder veganer
Ernährung auftreten kann, wird empfohlen, auf eine
ausreichende Aufnahme von Vitamin B12 während der
Schwangerschaft zu achten. Weitaus seltener ist ein genetisch
bedingter Vitamin-B12-Mangel.
Ein unbehandelter
Vitamin-B12-Mangel kann z.B. zu Entwicklungsstörungen und
Blutarmut führen. Die Behandlung besteht aus der
Vitamin-B12-Gabe, die bei mütterlichem Vitamin-B12-Mangel nur
kurzzeitig, bei genetischer Ursache lebenslang erfolgen muss.
Homocystinurie: Es existieren verschiedene
Krankheitstypen, die alle durch erhöhtes Homocystein, einem
Zwischenprodukt des Aminosäurestoffwechsels im Blut und im
Urin gekennzeichnet sind. Homocystinurie ist eine sehr
seltene, genetisch bedingte Stoffwechselerkrankung, die z.B.
Entwicklungsstörungen, Sehprobleme und Krampfanfälle
verursachen kann. Die Behandlung umfasst lebenslang die Gabe
von Vitaminen, eine proteinarme Ernährung und die Einnahme
von Betain, um das Homocystein zu senken.
Propionazidämie und Methylmalonazidurie sind sehr seltene
Stoffwechselerkrankungen, die unbehandelt z.B. zu
Herzerkrankungen, Entwicklungsstörungen und
Niereninsuffizienz führen können. Unter anderem mit Hilfe
spezieller Diäten sollen in der Behandlung
Stoffwechselentgleisungen vermieden werden.
Inkrafttreten und Anwendung
Bei G-BA-Beschlüssen, die eine
genetische Reihenuntersuchung regeln, muss die
Gendiagnostik-Kommission (GEKO) einbezogen werden. Die
Stellungnahme der GEKO wird der G-BA zusammen mit dem
Beschluss an das Bundesministerium für Gesundheit (BMG)
übermitteln. Der Beschluss tritt dann nach Nichtbeanstandung
durch das BMG und Veröffentlichung im Bundesanzeiger in
Kraft.
Da die Screening-Labore Zeit für die
erforderliche apparative Ausstattung benötigen, sind die
beschlossenen Änderungen erst nach Ablauf von zwölf Monaten
ab Beschlussfassung, ab Mai 2026 anzuwenden. Bis zu diesem
Zeitpunkt gilt die Kinder-Richtlinie in ihrer vor dem
Inkrafttreten dieses Beschlusses geltenden Fassung.
Hintergrund: Früherkennungsuntersuchungen
Kinder und
Jugendliche haben bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
gemäß § 26 SGB V Anspruch auf Untersuchungen zur
Früherkennung von Krankheiten, die ihre körperliche oder
geistige Entwicklung in nicht geringfügigem Maße gefährden.
Alle Früherkennungsmaßnahmen für Kinder, die als reguläre
Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung angeboten
werden, sind Bestandteil der Kinder-Richtlinie des G-BA.
Das Beratungsverfahren zum Neugeborenen-Screening auf
Früherkennung eines Vitamin-B12-Mangels und weiterer
Zielerkrankungen (Homocystinurie, Propionazidämie und
Methylmalonazidurie) geht zurück auf einen Antrag der
Patientenvertretung im G-BA. Bei seinen Beratungen
berücksichtigte der G-BA die Ergebnisse des Instituts für
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen sowie
einer Expertenanhörung.
Kinderuntersuchungsheft enthält künftig auch Ergebnisse der
zahnärztlichen Früherkennung
Berlin, 15. Mai 2025
– Frühkindliche Karies oder andere zahnmedizinische Probleme
bei Kindern nehmen in Deutschland seit Jahren stetig ab.
Damit diese Erfolgsgeschichte fortgesetzt wird und Eltern
noch besser über die vorhandenen zahnärztlichen
Früherkennungsangebote informiert sind, hat der Gemeinsame
Bundesausschuss (G-BA) das Kinderuntersuchungsheft
umfangreich angepasst: Künftig werden auch die Ergebnisse der
sechs zahnärztlichen Früherkennungsuntersuchungen in einem
eigenen Abschnitt dokumentiert und mit Hinweisen für die
Eltern ergänzt.
Bisher erfolgte das gesondert in
eigenen Heften der Zahnärzteschaft, den sogenannten
Kinderzahnpässen. Auf der Umschlagseite des
Kinderuntersuchungshefts sehen die Eltern zudem alle
Zeitfenster für die sechs zahnärztlichen Früherkennungen.
Das gehört zur bestehenden zahnärztlichen Früherkennung
Zwischen dem sechsten Lebensmonat und dem vollendeten
sechsten Lebensjahr haben Kinder Anspruch auf sechs
zahnärztliche Früherkennungsuntersuchungen. Zum
Leistungsumfang gehört insbesondere, dass die Zahnärztin oder
der Zahnarzt die Mundhöhle untersucht, das Kariesrisiko des
Kindes einschätzt, zu Ernährungsrisiken durch zuckerhaltige
Speisen und Getränke und zur richtigen Mundhygiene berät
sowie gegebenenfalls fluoridhaltige Zahnpasta empfiehlt.
Geregelt sind die Details in der Richtlinie über die
Früherkennungsuntersuchungen auf Zahn-, Mund- und
Kieferkrankheiten. Diese Richtlinie hat der G-BA mit seinem
heutigen Beschluss ebenso angepasst wie die
Kinder-Richtlinie, die die Inhalte zum
Kinderuntersuchungsheft definiert. Die Änderungen treten am
1. Januar 2026 in Kraft. Diese recht große Zeitspanne ist
notwendig, um Druck und Versand von Dokumentationsbögen als
Einleger für die bereits vorhandenen Kinderuntersuchungshefte
zu gewährleisten.
Außerdem werden Aufkleber für die
Kinderuntersuchungshefte bereitgestellt, auf denen die
Zeitfenster für die zahnärztlichen Früherkennungen vermerkt
sind. Der G-BA wird gesondert informieren, wenn
Kassenärztliche Vereinigungen, Krankenhäuser und
Hebammenverbände die Dokumentationsbögen und die Aufkleber
bestellen können.
Weitere Informationen zur
zahnärztlichen Früherkennung für Kinder und Jugendliche
finden Sie auf der Website des G-BA unter: Prophylaxe und
Früherkennung von Zahnerkrankungen
|
|
Vermeidung des postoperativen Delirs |
|
Evangelisches Klinikum Niederrhein und
AOK Rheinland/Hamburg arbeiten zusammen
Duisburg, 14.
Mai 2025 - Die Symptome reichen von leichter Verwirrtheit bis
hin zu völliger räumlicher und zeitlicher Desorientierung mit
schweren Sinnestäuschungen – das Postoperative Delir ist eine
häufige Begleiterscheinung nach operativen Eingriffen, die
insbesondere im höheren Lebensalter auftritt und mehrere Tage
anhalten kann.
Um diese unerwünschten Folgen einer
Operation nach Möglichkeit zu vermeiden, haben der
Klinikverbund Evangelisches Klinikum Niederrhein/BETHESDA
Krankenhaus Duisburg und die Krankenkasse AOK
Rheinland/Hamburg eine Zusammenarbeit vereinbart und einen
Qualitätsvertrag abgeschlossen. Ziel der Maßnahme ist es,
geeignete Gegenmaßnahmen zur Verhinderung des Postoperativen
Delirs zu erproben und die Ergebnisse der gemeinsamen
Initiative zu dokumentieren.
Dazu hat das Evangelische
Klinikum Niederrhein an seinem Standort Evangelisches
Krankenhaus Duisburg-Nord jetzt zwei sogenannte Delir Nurses.
Vanessa Zelinski und Andrea Zerbe haben bereits vorher als
leitende Pflegekräfte im Klinikverbund gearbeitet und wissen
von daher, wie herausfordernd die Arbeit mit deliranten
Patientinnen und Patienten sein kann.

Ihre Kenntnisse nutzen sie als Delir Nurses nicht nur zur
bestmöglichen Betreuung der Patientinnen und Patienten, sie
geben sie auch an ihre Kolleginnen und Kollegen auf den
Stationen weiter.
Hauptziel der Initiative von
EVKLN und AOK Rheinland/Hamburg ist es, das postoperative
Delir nach Möglichkeit zu verhindern und eine
Pflegebedürftigkeit der meist älteren Patientinnen und
Patienten zu vermeiden. Um mögliche Risiken frühzeitig zu
erkennen, werden zum Beispiel regelmäßige Delir-Screenings
durchgeführt. Sowohl die Patientinnen und Patienten als auch
ihre Angehörigen werden umfassend über Risiken,
Präventionsmaßnahmen und ihre aktive Rolle in diesem Prozess
informiert. Die Angehörigen werden postoperativ u.a. durch
das Mitbringen persönlicher Gegenstände (z.B. Bilder) und
erweiterte Besuchszeiten aktiv in den Betreuungsprozess
eingebunden.
„Wir freuen uns sehr, dass dieses
Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit einer so renommierten
Krankenkasse wie der AOK Rheinland/Hamburg hier in unserem
Klinikum startet.“, sagt Franz Hafner, Vorsitzender der
Geschäftsführung des Klinikverbunds Evangelisches Klinikum
Niederrhein/BETHESDA Krankenhaus Duisburg. „Die Verhinderung
des postoperativen Delirs wird in den kommenden Jahren noch
weiter an Bedeutung gewinnen. Mit unseren bestens geschulten
Delir Nurses sind wir in der Position, in diesem wichtigen
Themenbereich eine Vorreiterrolle zu übernehmen – zum Wohle
gerade unserer älteren Patientinnen und Patienten.“
Die Erprobungsphase des Projekts startet im Mai 2025 und
läuft bis Ende Oktober 2028. Angestrebt ist, neben der AOK
Rheinland/Hamburg weitere Krankenkassen zu beteiligen, damit
möglichst viele Patientinnen und Patienten von der Maßnahme
profitieren können.
|
|
Herzkissen - eine Herzensangelegenheit für den
Inner Wheel Club Duisburg! |
|
Duisburg, 12. Mai 2025 - Zum 14. Mal
übergaben die Damen des Inner Wheel Clubs Duisburg Herzkissen
an das Brustkrebszentrum im Helios St. Anna Krankenhaus. Um
jeder Patientin und jedem Patienten, die an Brustkrebs
erkrankt und operiert wurden, ein Herzkissen als
Hilfestellung zu kommen zu lassen, werden in jedem Jahr durch
den Inner Wheel Club 250 Herzkissen und mehr (inklusive einer
Drainagetasche und einem kleinen Herzen für den Port)
ehrenamtlich angefertigt und an das Brustzentrum gespendet.
Herzkissen lindern den Lagerungsschmerz und sind
hilfreich beim Anlegen des Autogurtes. Außerdem sind sie ein
liebevolles Symbol an alle Erkrankten im tristen
Klinikalltag. Die hochwertige Füllwatte, die eine 60°C-Wäsche
und den Trockner gut übersteht, wird seit vielen Jahren vom
Bettenhersteller Frankenstolz gespendet.
Das Kissen
darf selbstverständlich mit nach Hause genommen werden. Am
7.0 Mai 2025 wurde die diesjährige Lieferung freudig an die
Verantwortlichen im Helios St. Anna Krankenhaus überreicht.

Auf dem Bild v.l.n.r.: Mechthild Hassler-von Scheven, Ruth
Stromberg (beide Inner Wheel Duisburg), Dr. Bettina tides,
Breast Care Nurse Sr. Justine, Dr. Alejandro Corral, Sr.
Katja und Sr. Petra (beide Breast Care Nurses)
|
|
Mit Herz und Kompetenz – Medizin im Revier hautnah
erleben |
|
Tag der offenen Tür im
Evangelischen Klinikum Niederrhein am 24. Mai 2025
Duisburg, 12. Mai 2025 - Wie fühlt es sich an, mit einem
OP-Roboter zu operieren? Was verrät ein Überraschungsei unter
dem Röntgengerät? Und wie kommt eigentlich der
Rettungshubschrauber aufs Klinikdach?
Am Samstag, den
24. Mai 2025, öffnet das Evangelische Klinikum Niederrhein am
Fahrner Standort seine Türen für alle, die neugierig auf
moderne Medizin und engagierte Pflege sind. Von 12 bis 18 Uhr
verwandeln sich Klinik und Gelände in eine Erlebniswelt für
Groß und Klein rund um moderne Medizin, Pflege und
Gesundheit.
Rund ein halbes Jahr ist seit dem Umzug
des Herzzentrums Duisburg auf das Gelände des Evangelischen
Krankenhauses Duisburg-Nord vergangen. Zeit genug, um
zusammenzuwachsen und dies nun gemeinsam mit der Bevölkerung
zu feiern. Der Tag der offenen Tür bietet dazu die ideale
Gelegenheit, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.
Der Eintritt ist frei.
Erleben, entdecken, mitmachen
An zahlreichen Mitmachstationen können die Besucherinnen und
Besucher selbst aktiv werden: Reanimation üben, OP-Roboter
testen, Gummibärchen laparoskopieren oder Überraschungseier
röntgen. Für zusätzliches Staunen sorgen begehbare
Organmodelle und kleine „Operationen“ an Kokosnüssen. Dazu
vermitteln Expertinnen und Experten des Klinikverbundes in
kompakten Kurzvorträgen medizinisches Wissen aus erster Hand.
Außerdem stehen exklusive Führungen durch das neue
Herzkatheterlabor auf dem Programm.
Ein besonderes
Highlight erwartet die Besucherinnen und Besucher auf dem
Dach des Verwaltungsgebäudes: Hier kann der
Rettungshubschrauber Christoph 9 aus nächster Nähe besichtigt
werden. Die Führungen zum Hubschrauberlandeplatz finden um
14.15 Uhr, 14.45 Uhr, 15.15 Uhr und 15.45 Uhr statt. Da die
Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung per E-Mail an
veranstaltungen@evkln.de bis zum 21. Mai 2025 gebeten. Bitte
geben Sie dabei Ihre Kontaktdaten und die gewünschte Uhrzeit
an.
Kostenlose Gesundheitsangebote
Im Rahmen des
Aktionstages bietet das Klinikum kostenlose Checks für
Blutdruck, Blutzucker und Lungenfunktion an. Darüber hinaus
stehen Pflegekräfte, Selbsthilfegruppen, Krankenkassen und
das Deutsche Rote Kreuz für persönliche Gespräche und
Beratungen zur Verfügung. Auch der Infobus der Initiative
„Herzenssache Lebenszeit“ wird vor Ort sein.
Karrierechancen im Gesundheitswesen
Wer sich für eine
berufliche Zukunft im Gesundheitswesen interessiert, kann
sich am Tag der offenen Tür direkt über Ausbildung,
Quereinstieg oder Weiterbildung im Klinikverbund informieren.
Auch die Feuerwehr Duisburg ist mit dabei und informiert über
die Akademie für Notfallmedizin und Rettungswesen und die
Ausbildung zum Notfallsanitäter.
Spaß und Genuss für
Klein und Groß
Während die Großen entdecken und
ausprobieren, kommen auch die Kleinen auf ihre Kosten: Im
Teddybärkrankenhaus werden Kuscheltiere liebevoll
„verarztet“. Hüpfburg, Kinderschminken, Glücksrad und ein
echtes Feuerwehrfahrzeug laden zum Spielen und Staunen ein.
EVA, das neue Maskottchen des Klinikums, sorgt als knuffiger
Fotopartner für gute Laune. Foodtruck, Grillstation und
Getränkestand bieten Stärkung für zwischendurch. Und ein DJ
sorgt den ganzen Tag über für entspannte musikalische
Begleitung.

Foto EVKLN.
Eckdaten der Veranstaltung:
Titel: Mit Herz und
Kompetenz – Medizin im Revier hautnah erleben. Tag der
offenen Tür im Evangelischen Klinikum Niederrhein
Datum:
Samstag, 24. Mai 2025
Uhrzeit: 12.00 bis 18.00 Uhr
Adresse: Fahrner Straße 133, 47169 Duisburg
Eintritt ist
frei.
Das komplette Programm gibt es online auf
https://www.evkln.de/aktionstag.html
|
|
Herzzentrum Duisburg setzt neue Herzklappe ein |
|
Schonende
Alternative zur großen Operation
Duisburg,
8. Mai 2025 - Am Herzzentrum Duisburg wurde erstmals eine
neue Generation von künstlichen Herzklappen eingesetzt, die
ohne eine große Operation über einen Katheter ins Herz
gebracht werden kann.
Die Harmony™-Pulmonalklappe stammt
vom Medizintechnikunternehmen Medtronic und ist speziell für
Patientinnen und Patienten mit einem großen Ausflusstrakt an
der rechten Herzkammer entwickelt worden, also dem Bereich,
über den das Blut vom Herzen in die Lungenarterie gepumpt
wird.

Die neue Pulmonalklappe ermöglicht bei bestimmten angeborenen
Herzfehlern eine kathetergestützte Behandlung, die eine
Operation überflüssig macht. (Quelle: EVKLN)
Bei manchen Menschen mit angeborenem
Herzfehler ist dieser Bereich stark erweitert oder
ungewöhnlich geformt. Bisher konnte dort keine Herzklappe
minimalinvasiv eingesetzt werden, sodass meist nur eine
Operation bei geöffnetem Brustkorb mit Herz-Lungen-Maschine
infrage kam.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden
wird die neue Pulmonalklappe nicht chirurgisch eingesetzt,
sondern per Katheter über die Leiste ins Herz geführt. Dort
entfaltet sie sich selbstständig und nimmt direkt ihre
Funktion auf. Der Eingriff ist minimalinvasiv und dauert in
der Regel nur ein bis maximal zwei Stunden. „Für viele
unserer Patientinnen und Patienten bedeutet das: keine große
Operation, keine Narbe über dem Brustbein, kein wochenlanger
Krankenhausaufenthalt.
Stattdessen können sie häufig
schon nach wenigen Tagen wieder nach Hause“, sagt Dr. Gleb
Tarusinov. Er leitet die Klinik für Kinderkardiologie und
angeborene Herzfehler. Gemeinsam mit seinem Team betreut er
sowohl Kinder als auch Erwachsene, die mit einem Herzfehler
geboren wurden.

Präzision im Einsatz: Dr. Gleb Tarusinov (rechts) und
Oberarzt Paul Hacke (Leitender Oberarzt) führen gemeinsam
einen Kathetereingriff durch. Es ist einer der ersten mit der
neuen Pulmonalklappe, die seit kurzem Patientinnen und
Patienten in Duisburg zugutekommt. (Quelle: EVKLN)
Die
neue Pulmonalklappe ist seit Januar 2025 in Deutschland
zugelassen. Klinische Erfahrungen mit ihr gibt es jedoch
bereits aus den USA, wo sie seit mehreren Jahren erfolgreich
eingesetzt wird. In Deutschland gehört das Herzzentrum
Duisburg nun zu den ersten Herzzentren, neben München, Berlin
und Bad Oeynhausen, die diese moderne Technik anwenden.
Der Einsatz der Harmony™-Pulmonalklappe erweitert somit
das Behandlungsspektrum am Herzzentrum Duisburg für Menschen
mit komplexen angeborenen Herzfehlern und ermöglicht eine
neue, schonendere Versorgungsoption.
|
|
Wenn das Herz aus dem Takt gerät |
|
Patientenveranstaltung zu
Vorhofflimmern am Herzzentrum Duisburg
Duisburg,
30. April 2025 - Vorhofflimmern ist eine häufige
Herzrhythmusstörung, bei der das Herz unregelmäßig und zu
schnell schlägt. Neben Symptomen wie Herzrasen oder Atemnot
kann es auf lange Sicht zu schwerwiegenden Komplikationen
kommen: Im linken Vorhof können sich Blutgerinnsel bilden,
die über den Blutkreislauf ins Gehirn gelangen und einen
Schlaganfall auslösen. Vorhofflimmern betrifft ältere
Menschen, kann aber auch durch Bluthochdruck oder starkes
Übergewicht begünstigt werden.
Um über Ursachen,
Risiken und moderne Behandlungsmöglichkeiten zu informieren,
lädt das Herzzentrum Duisburg am Dienstag, 6. Mai 2025, von
17 bis 19 Uhr zu einer Patientenveranstaltung ein. Dr. med.
Ute Ruprecht, Leitende Oberärztin der Klinik für Kardiologie,
Angiologie und Elektrophysiologie, erläutert verständlich und
praxisnah aktuelle Entwicklungen in der Therapie und steht
für persönliche Fragen zur Verfügung.

Dr. med. Ute Ruprecht, Leitende Oberärztin des Fachbereichs
Elektrophysiologie am Herzzentrum Duisburg (Quelle: EVKLN)
Modernste Therapien
Vorhofflimmern entsteht oft durch
Veränderungen im Gewebe des Herzvorhofes. Die elektrischen
Impulse, die den Herzschlag steuern, geraten dadurch aus dem
Takt. Zur Behandlung wird in vielen Fällen eine
Katheterablation durchgeführt, bei der das betroffene Gewebe
gezielt verödet wird – klassisch mit Hitze oder Kälte. Am
Herzzentrum Duisburg kommt zusätzlich die moderne Pulsed
Field Ablation zum Einsatz: Sie nutzt elektrische Felder, die
besonders präzise wirken und gleichzeitig umliegende
Strukturen schonen. Eine begleitende 3D-Bildgebung sorgt für
höchste Genauigkeit und Sicherheit während des Eingriffs.
Adipositas im Blick – Herzrhythmusstörungen ganzheitlich
behandeln
Adipositas gilt als wichtiger Risikofaktor für
Vorhofflimmern und kann die Behandlung erschweren. Das
Herzzentrum Duisburg verfügt über besondere Erfahrung in der
Betreuung adipöser Patientinnen und Patienten und verfolgt
einen ganzheitlichen Ansatz: Neben dem Eingriff werden auch
Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck, Schlafapnoe oder
Übergewicht konsequent mitbehandelt. Moderne Medikamente wie
GLP-1-Rezeptoragonisten unterstützen zusätzlich die
Gewichtsreduktion und verbessern die elektrische Stabilität
des Herzens, indem sie das Fettgewebe rund um den Herzmuskel
verringern.
Datum & Uhrzeit: 6. Mai 2025, 17.00-19.00
Uhr
Ort: Herzzentrum Duisburg, Konferenzzentrum im
Verwaltungsgebäude Raum CE.01, Fahrner Str. 133, 47169
Duisburg
Eintritt: Frei, eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.
|
|
Biopsie bei Krebs: Metastasen durch abgelöste
Tumorzellen? |
|
Heidelberg, 28. April 2025 - Bei einer
Biopsie entnehmen Ärztinnen und Ärzte Zellen oder eine
Gewebeprobe aus einem auffällig veränderten Körperbereich.
Diese Untersuchung ist wichtig für die Diagnose vieler
Krebserkrankungen.
Zum Thema Biopsie erreichen den
Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums
immer wieder Fragen. Zum Beispiel: „Bei mir soll durch eine
Stanzbiopsie eine Gewebeprobe aus der Brust entnommen werden.
Können sich dabei Tumorzellen ablösen, die dann irgendwo im
Körper Metastasen bilden?“ Der Krebsinformationsdienst klärt,
ob diese Sorge berechtigt ist.
Eine Biopsie ist ein
fester und wichtiger Bestandteil der Diagnostik von Tumoren.
Das Verfahren ermöglicht eine genaue Diagnose zu stellen,
spezifische Merkmale des Tumors zu analysieren und
entsprechend personalisierte Therapieansätze zu planen.
Angesichts dieser Relevanz werden die Risiken als sehr gering
angesehen. Zudem gibt es bisher keine Hinweise darauf, dass
eine regelrecht durchgeführte Biopsie die Prognose einer
Krebserkrankung verschlechtert.
Grundsätzlich gilt:
Bei einer Biopsie oder Operation könnten theoretisch
Krebszellen mechanisch vom Tumor gelöst werden und in
umliegende Gewebe gelangen, um dort Metastasen zu bilden.
Aber, und das ist wichtig zu wissen: Bei vielen Krebsarten
ist dies höchst unwahrscheinlich, denn den meisten abgelösten
Zellen fehlen die notwendigen Eigenschaften, um im Körper zu
überleben.
Wie entstehen Metastasen?
Normale Zellen
haben ihren festen Platz im Körper. Krebszellen dagegen
breiten sich in umgebendes Gewebe aus. Manche Tumorzellen
lösen sich zudem aus dem Zellverband des Tumors und verteilen
sich über die Blut- oder Lymphbahnen im Körper. So kann es
vorkommen, dass sich einige von ihnen in anderen Organen
ansiedeln. Dort vermehren sie sich und können
Tochtergeschwülste des ursprünglichen Tumors bilden –
sogenannte Metastasen.
Fachleute schätzen, dass das
nur einem sehr kleinen Bruchteil der Tumorzellen gelingt.
Denn die Entstehung von Metastasen ist komplex und setzt
besondere Fähigkeiten der Tumorzellen voraus: So müssen sie
in der Lage sein, den ursprünglichen Gewebeverband zu
verlassen, in benachbarte Gefäße einzudringen und sich dort
festzusetzen.
Susanne Weg-Remers, Leiterin des
Krebsinformationsdienstes ergänzt: „Über all diese
Eigenschaften verfügen die bei einer Biopsie abgelösten
Tumorzellen meistens nicht.“ Fragen rund um Krebs beantworten
Ärztinnen und Ärzte des Krebsinformationsdienstes kostenlos,
verständlich und auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft –
telefonisch unter 0800-420 30 40 oder unter der E-Mail
krebsinformationsdienst@dkfz.de. Umfangreiche Informationen
liefert auch die Website www.krebsinformationsdienst.de.
Sehr selten: Metastasen als Folge einer Biopsie
Wie
häufig auf mechanische Weise abgelöste Krebszellen Metastasen
bilden, hängt in erster Linie von der Krebsart ab. Bei vielen
Krebsarten haben diese Zellen keinen Einfluss auf den
weiteren Krankheitsverlauf. Dagegen haben Studien gezeigt,
dass sich bei sehr wenigen Tumorarten, wie etwa dem
Weichteilsarkom, Metastasen infolge einer Biopsie bilden
können. In diesen Fällen treffen Ärztinnen und Ärzte
besondere Vorsichtsmaßnahmen, zum Beispiel wird dann der
Biopsiekanal komplett enfernt. Darüber hinaus spielt das
Biopsie-Verfahren eine wichtige Rolle.
Verschiedene
Biopsie-Verfahren
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine
Biopsie durchzuführen. Die Stanzbiopsie wird beispielsweise
zur Untersuchung von krebsverdächtigen Veränderungen der
Brust, der Leber, der Prostata oder der Haut eingesetzt. Bei
diesem Verfahren führen Ärztinnen und Ärzte eine Biopsienadel
durch eine Führungskanüle in den auffälligen Gewebebereich
ein.
Damit stanzen sie eine oder mehrere zylinderförmige
Proben aus dem Gewebe aus. Je nach Größe der Biopsienadel
haben die Gewebezylinder einen Durchmesser von oft nur ein
bis zwei Millimetern und sind ein bis zwei Zentimeter lang.
Anschließend untersuchen Fachleute die Gewebestanzen unter
dem Mikroskop.
Durch den Einsatz der Führungskanüle
lassen sich bei diesem Verfahren durch eine Einstichstelle
mehrere Gewebeproben entnehmen. Dadurch ist die
Wahrscheinlichkeit für ein Verschleppen abgelöster
Tumorzellen in umgebendes Gewebe oder Gefäße gering. Welches
Biopsie-Verfahren zum Einsatz kommt, entscheiden die
behandelnden Ärztinnen und Ärzte individuell.
Die
Wahl des Verfahrens hängt auch vom zu untersuchenden Organ,
von der Gewebeart, von der Verdachtsdiagnose und von der
Größe des verdächtigen Bereichs ab. Außerdem kommt es darauf
an, ob für eine sichere Diagnose ein vollständiges
Gewebestück benötigt wird oder ob einzelne Zellen für die
medizinische Begutachtung ausreichen.
|
|
Ärztlicher Notdienst in Nordrhein an Ostern
einsatzbereit |
|
Düsseldorf/Duisburg, April 2025 - Die niedergelassenen Ärzte in
Nordrhein versorgen ihre Patienten auch an den bevorstehenden
Ostertagen. Wer zwischen Karfreitag und Ostermontag akute
gesundheitliche Beschwerden hat, kann den kassenärztlichen
Bereitschaftsdienst kontaktieren.
Erste Anlaufstelle ist der
telefonische Patientenservice 116 117. Dieser kann eine medizinische
Ersteinschätzung vornehmen und bei Bedarf an eine der rund 90
Notdienstpraxen der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO)
verweisen. Informationen zu Adressen und Öffnungszeiten gibt es auch
im Netz unter www.kvno.de/notdienst.
Der Patientenservice 116
117 ist rund um die Uhr erreichbar und hat seine Telefon-Kapazitäten
zu den Feiertagen verstärkt. Patienten, die nicht gehfähig oder
bettlägerig sind, können über den Patientenservice einen ärztlichen
Hausbesuch erfragen. Außerdem erhalten Anrufende auf Wunsch Hinweise
über die Erreichbarkeiten der fachärztlichen Notdienste im Rheinland
(Augen-, HNO-, Kinder-Notdienst).
Videosprechstunden für
erkrankte Kinder und Erwachsene
Zusätzlich haben sowohl Eltern
erkrankter Kinder als auch Erwachsene die Möglichkeit, eine
Videosprechstunde im Notdienst durchzuführen. Im Rahmen der
digitalen Konsultation können Symptome abgeklärt und
Behandlungsmaßnahmen besprochen werden. Sollte die Gabe von
verschreibungspflichtigen Medikamenten notwendig sein, ist das
Ausstellen eines E-Rezeptes möglich.
Die kinderärztliche
Videosprechstunde ist samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 22
Uhr verfügbar. Das Videosprechstunde für Erwachsene samstags,
sonntags und feiertags von 9 bis 21 Uhr. Angefragt werden können
beide Videosprechstunden-Angebote der KVNO entweder über die
Servicenummer 116 117 oder über www.kvno.de/kinder bzw.
www.kvno.de/erwachsene
Nachdem das gesundheitliche Beschwerdebild erfasst
ist, erhalten Anrufende per E-Mail einen Termin-Link.
Wichtig: Patienten sollten unbedingt ihre Versichertendaten
bzw. die des erkrankten Kindes zur Hand haben. Um die
Videosprechstunde zu nutzen, wird neben einer stabilen
Internetverbindung ein Smartphone, Tablet, Notebook oder
einen Computer mit Kamera und Mikrofon benötigt. Während des
digitalen Arzt-Patienten-Gesprächs sollte eine möglichst
ruhige Umgebung ohne weitere anwesende Personen aufgesucht
werden.
|
|
Helios St. Anna: Neuer Chefarzt
für die renommierte HNO-Abteilung
|
|
Dr. med. Florian
Sack übernimmt ab sofort die Leitung der HNO-Abteilung am
Huckinger Helios Standort St. Anna. Er tritt dabei in die
großen Fußstapfen seines langjährigen Mentors Prof. Dr. med.
Stephan Remmert (rechts, / Copyright Helios), der sich nach
über 40 Berufsjahren in den (Teil-)Ruhestand verabschiedet.

Duisburg, 16. April
2025 - Wiederkehrende Auszeichnungen, dazu überregionale
Bekanntheit aufgrund der qualitativ hochwertigen
Patientenversorgung und besondere Expertise in der
plastisch-rekonstruktiven Tumorchirurgie: Der Fachbereich für
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde an der Helios St. Anna Klinik in
Duisburg-Huckingen hat sich im Laufe der letzten Jahre einen
Namen gemacht. Das liegt vor allem an der Expertise des
dortigen Teams, zu dem auch der baldige neue Chefarzt Dr.
med. Florian Sack (46) seit dem Beginn seiner Karriere vor 21
Jahren gehört.
Jetzt übernimmt der Kettwiger den
Staffelstab von seinem langjährigen Mentor und Wegbegleiter
Prof. Dr. med. Stephan Remmert (70), der sich, nach sehr
erfolgreichen Jahrzehnten an der Klinik, Ende des Monats
offiziell in den (Teil-)Ruhestand verabschiedet. Die beiden
kennen und schätzen sich schon lange, arbeiteten über die
Jahre immer vertrauensvoll zusammen. Für Florian Sack eine
mehr als wertvolle Erfahrung: „Durch die tägliche
Zusammenarbeit über mehr als zwei Jahrzehnte hat er meine
chirurgische Ausbildung und auch meine Führungskompetenz
maßgeblich geprägt.“
Denn bereits seit fünf Jahren ist
der Wahl-Kettwiger als leitender Oberarzt ohnehin schon eng
in die Führung der Abteilung eingebunden. Florian Sack begann
seine Karriere direkt nach dem Studium am damaligen Malteser
Standort St. Anna als Arzt im Praktikum, absolvierte auch
seinen HNO-Facharzt hier und ging seinen Weg bis zum
leitenden Oberarzt. Er kennt die Abteilung wie kaum jemand
und weiß daher auch um die Potentiale.
„Durch die
ausgezeichnete Expertise von Stephan Remmert, der die
plastisch-rekonstruktive Tumorchirurgie im Kopf-Hals-Bereich
selbst aufgebaut und geprägt hat, liegt hier auch der
Schwerpunkt der Abteilung.“ Aufgrund der hohen Fallzahlen und
der jahrelangen Erfahrung strebe das Team nun als nächsten
Schritt die Zertifizierung der Deutschen Krebsgesellschaft
(DKG) zum spezialisierten Kopf-Hals-Tumorzentrum an.
Mit wie viel Engagement und Herzblut Florian Sack seine
neue Aufgabe angehen will merkt man ihm schon nach den ersten
Sätzen an. „Ich mag meinen Beruf sehr, er ist genauso
großartig wie das Team hier,“ schmunzelt der gebürtige
Münchner. Dass sie sich in der Abteilung aufeinander
verlassen können, auf Augenhöhe miteinander kommunizieren und
sich über alle Berufsgruppen hinweg als ein Team empfinden,
sei ihm schon immer ein Anliegen gewesen. Dabei soll es auch
in der neuen Rolle bleiben. Strukturelle Veränderungen durch
zusätzliche Anforderungen etwa den neuen Krankenhausplan oder
die zunehmende Digitalisierung stehen dabei ebenfalls auf
seiner Agenda.

v.l. Klinikgeschäftsführer Birger Meßthaler, Ärztliche
Direktorin Dr. Claudia Peters, Chefarzt Dr. Florian Sack,
Klinikgeschäftsführerin Claudia Meßthaler / Copyright Helios
Dass er all das sehr gut meistern wird, da ist sich auch sein
„Ziehvater“ Stephan Remmert sicher: „Ich vertraue ihm
vollkommen und weiß die Abteilung bei ihm in besten Händen.“
Der renommierte Hals-Nasen-Ohren-Spezialist übernahm 2003 die
Leitung der Klinik, Florian Sack stieß 2004 dazu und erlebte
direkt vor Ort, wie sein Chef den Fachbereich immer weiter
ausbaute und hochqualitative Medizin sowie moderne Verfahren
etablierte.
Mittlerweile suchen Patient:innen aus ganz Europa
die Huckinger Klinik auf, vor allem für die Behandlung von
Zungenkrebs, die auch immer ein Spezialgebiet des nun
scheidenden Chefarztes war. Sogar eine Operationsmethode in
der plastisch-rekonstruktiven Tumorchirurgie ist nach ihm
benannt, der sogenannte Remmert-Lappen.
Durch diese von
ihm entwickelte Technik kann das Volumen der Zunge in einem
aufwendigen mehrstündigen Eingriff rekonstruiert werden. Und
auch auf einem medizinischen Lehrbuch zur „Wiederherstellung
der oberen Luft- und Speisewege“ steht sein Name. Wer sich
seiner Profession so verschrieben hat, dem fällt auch der
Abschied aus der Klinik nach über 40 Berufsjahren und von
seinem Team nicht leicht. „Es wird eine Umstellung für mich,
das steht fest. Und so ganz ohne Medizin wird es nicht
gehen.“ Als Senior Consultant geht sein Wirken daher noch
weiter, wenn auch außerhalb Duisburgs.
Klinikgeschäftsführerin Claudia Meßthaler findet ebenfalls
nur warme Worte: „Mit Prof. Remmert verlässt uns ein wirklich
herausragender Mediziner, der das Profil dieser Abteilung und
des gesamten Standortes maßgeblich geprägt und
weiterentwickelt hat. Als international ausgewiesener Experte
ist es ihm zudem gelungen, einen weit über die Stadtgrenzen
hinaus sichtbaren klinischen Leuchtturm zu etablieren. Wir
danken ihm sehr für seine exzellente Arbeit und die vielen
gemeinsamen Jahre.“ Genauso sicher ist aber: Florian Sack ist
ein starker Nachfolger und kann zum einen auf beste
„Lehrjahre“, genauso wie auf sein eigenes großes Talent und
Spezialwissen zurückgreifen. Daran besteht für Claudia
Meßthaler kein Zweifel: „Sein Schwerpunkt liegt ebenfalls in
der plastisch-rekonstruktiven Tumorchirurgie, zusammen mit
dem Team deckt die Abteilung daher weiterhin das gesamte
Spektrum der HNO-Heilkunde in hochqualitativer Weise ab. Wir
sind daher absolut überzeugt, dass er die Abteilung großartig
weiterführen wird.“
Die wichtigsten Kennzahlen
rund um die HNO-Klinik am Standort St. Anna
Die seit
mehreren Jahrzehnten bestehende und mehrfach ausgezeichnete
Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde an der Helios St.
Anna Klinik Duisburg hat sich beständig weiterentwickelt und
versorgt aktuell jährlich etwa 4000 stationäre Fälle im Jahr,
darunter sind um die 800 operativen Eingriffe an Kindern.
Zusätzlich behandelt die Abteilung mehr als 2000
Patient:innen über ambulante Wege, etwa anhand von
Kurz-Eingriffen oder über die bekannte Ambulanz am Haus. Mit
jährlich rund 150 primären Tumorfällen liegt das Team zudem
weit über der geforderten Mindestmenge eines zertifizierten
Kopf-Hals-Tumorzentrums.
|
|
Baby Noah hatte es eilig: Geburt
vor Drogeriemarkt in Duisburg-Hochfeld
|
|
Versorgung von Mutter und Kind
anschließend im BETHESDA Krankenhaus
Duisburg, 14. April 2025 - Das Duisburger BETHESDA
Krankenhaus hat – ausgerechnet am 1. April – eine der
ungewöhnlichsten Geburten der jüngeren Vergangenheit
verzeichnet. Paulina Grabowska aus Duisburg-Meiderich ist an
diesem Tag im Rahmen ihrer Schwangerschaft zu einer
Routineuntersuchung ins BETHESDA gekommen. Anschließend
entschließt sie sich spontan, ihrer Mutter, die auf der
Wanheimer Straße über der dortigen Filiale der
Drogeriemarkt-Kette Rossmann wohnt, einen Besuch abzustatten.
Auf dem Weg dorthin spürt Frau Grabowska, die in der 39.
Schwangerschaftswoche ist und zuvor bereits ein Kind zur Welt
gebracht hat, das Einsetzen der Wehen. „Ich dachte: Da tut
sich was.“, erinnert sich die 26-jährige, „Aber es hat sich
anders angefühlt als sonst…“. Bei ihrer Mutter angekommen,
entscheidet sie sich um 11:43 Uhr dazu, ein Taxi zu rufen, um
sich ins BETHESDA zurückfahren zu lassen, und geht hinunter
auf die Straße.
Während sie auf das Taxi wartet, nehmen die Wehen an
Heftigkeit zu – was letztlich auch den Passantinnen und
Passanten vor dem Drogeriemarkt nicht verborgen bleibt. Eine
von ihnen ruft einen RTW, während sich die anderen um Paulina
Grabowska kümmern, ihre Hand halten und sie vor neugierigen
Blicken schützen. Um 11:50 Uhr wird ihr Sohn Noah im Stehen
vor dem Eingang der Rossmann-Filiale geboren, mit einer Größe
von 52 Zentimetern und einem Gewicht von 3.500 Gramm.
Nach der Erstversorgung im RTW werden Mutter und Kind im
BETHESDA vom Team der Frauenklinik und des Kreißsaals in
Empfang genommen und weiter betreut – erschöpft, aber
glücklich und überraschend gelassen. „Macht mit mir, was ihr
wollt.“, sind die ersten Worte der jungen Mutter gegenüber
den Ärzten und Hebammen.

Paulina Grabowska mit Baby Noah
Wie sich schnell herausstellt, haben Noah und Paulina
Grabowska die ungewöhnliche Geburt auf offener Straße
vollkommen unbeschadet überstanden. Sie werden auf die
Wochenstation verlegt, wo kurze Zeit später auch Noahs Vater
eintrifft, um seinen Sohn willkommen zu heißen.
Das Team des BETHESDA Krankenhauses freut sich mit Noah und
seinen Eltern über diese problemlose Geburt unter ganz
besonderen Umständen.
|
|
Schockraum-Erlebnis macht
Jugendliche nachdenklich P.A.R.T.Y.-Tag zur Unfallprävention
im BG Klinikum Duisburg
|
|
Duisburg, 11. April 2025 - „Mein Ziel ist es, so schnell wie
möglich wieder in meinem Job als Gerüstbauer zu kommen“,
sagte Carsten Steffens. Die 46 anwesenden Schülerinnen und
Schüler des Julius-Stursberg-Gymnasiums Neukirchen-Vluyn beim
sog. P.A.R.T.Y.-Tag im BG Klinikum Duisburg waren erstaunt
und beeindruckt zugleich. Denn der Traumapatient, der da
munter vor ihnen stand, hatte zuvor von seinem schweren
Arbeitsunfall in Köln berichtet.

Aus acht Meter Höhe war Steffens abgestürzt und hatte
sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen – von
einer komplizierten Beckenfraktur über Brüchen eines
Wirbelkörpers, des Ellbogens und der Handwurzel bis hin zu
schweren Einblutungen.
Nach mehreren Notoperationen und
einigen Wochen im Rollstuhl wird er gerade in der
Rehabilitation der Unfallklinik wieder fit gemacht für den
Job auf dem Gerüst und den normalen Alltag.

Schülerinnen und Schüler als Teil des Schockraum-Teams.
(Fotos BG Klinikum Duisburg)
Die
Erfolgsgeschichte des (Poly-)Traumapatienten war jedoch nur
eines von vielen Highlights des rund 5,5-stündigen Aktions-
und Informationsprogrammes an diesem Tag. Denn das BG
Klinikum Duisburg hatte sich in eine Art riesiges
Klassenzimmer verwandelt.

Schüler erprobt unter sachkundiger Anleitung das Exoskelett.
„Auf dem Stundenplan standen aber nicht Deutsch oder
Mathe, sondern die Folgen, die Unfälle etwa im Straßenverkehr
infolge von Alkohol und Drogen, Selbstüberschätzung oder
Nachlässigkeit haben können“, erklärt Dr. med. Nikolaus
Brinkmann.

Zufriedene Organisatoren. (von linksDr. med. Nikolaus
Brinkmann, Dr. med. Sabrina Janoud, Dr. med. Christian
Illian, Dr. med. Christiane Fried; Bild: BG Klinikum
Duisburg)
Der Stellv. Ärztliche Direktor des BG
Klinikums Duisburg hatte 2016 den P.A.R.T.Y.-Tag im Hause
initiiert, der aktuell zwei Mal im Jahr durchgeführt wird.


Einblicke in den Rettungswagen - Rollstuhltraining
|
|
Malteser Hospizzentrum St.
Raphael: Infoabend zum Ehrenamt in der Malteser Hospizarbeit
|
|
Duisburg-Huckingen, 9. April 2025 - In der Malteser
Hospizarbeit für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gibt es
vielfältige Möglichkeiten, ehrenamtlich Zeit zu schenken und
lebensbegrenzt erkrankte Menschen und ihre Angehörigen zu
begleiten. „Viele Menschen spüren aufgrund eigener
Erfahrungen schon länger den Impuls, sich im Bereich der
Hospizarbeit zu engagieren, sind sich aber unsicher, ob sie
dafür geeignet sind“, sagt Katja Arens, Leiterin des Malteser
Hospizzentrums.
Die Infoveranstaltung am Montag, 28.
April um 11 Uhr im Malteser Hospizzentrum St. Raphael in der
Remberger Str. 36 in 47259 Duisburg-Huckingen bietet Raum,
die Einsatzmöglichkeiten für Ehrenamtliche kennenzulernen,
Fragen loszuwerden und Klarheit zu finden, ob eine solche
Aufgabe in Frage kommt.
Der Vorbereitungskurs für
Ehrenamtliche, der im September zum 30. Mal auf der rechten
Rheinseite startet, befähigt die Teilnehmenden, Patientinnen
und Patienten des Malteser Hospizzentrums St. Raphael und
ihre Zugehörigen gut zu begleiten. Weitere Informationen und
Anmeldung bei Katja Arens, E-Mail: katja.arens@malteser.org,
Tel. 0160 4709813
Malteser Hospizzentrum St. Raphael
Das Malteser Hospizzentrum St. Raphael umfasst einen
ambulanten Palliativ- und Hospizdienst sowie ein stationäres
Hospiz mit zwölf Plätzen für schwerstkranke Menschen in der
letzten Lebensphase. Zudem unterstützt der Kinder- und
Jugendhospizdienst „Bärenstark“ lebensverkürzend erkrankte
Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien in der
Häuslichkeit. Hinterbliebenen stehen die geschulten und
erfahrenen Mitarbeitenden des Hospizzentrums im Rahmen der
Trauerberatung und -begleitung mit unterschiedlichen
Beratungsangeboten für Erwachsene und Kinder zur Seite.
Die fachlich kompetenten und erfahrenen Mitarbeitenden
des Hospizzentrums werden in allen Bereichen von geschulten
Ehrenamtlichen unterstützt. Zur Vorbereitung, Begleitung und
Integration der ehrenamtlich Mitarbeitenden betreibt das
Hospizzentrum ein professionelles Ehrenamtsmanagement.
In enger Zusammenarbeit mit dem Malteser Ambulanten
Palliativpflegedienst ist das Hospizzentrum fester Partner in
der Sicherung der SAPV-Versorgung. Träger des Malteser
Hospizzentrums St. Raphael ist die Malteser Wohnen & Pflegen
gGmbH mit Sitz in Duisburg. Sie betreibt neben dem
Hospizzentrum deutschlandweit 34 Wohn- und
Pflegeeinrichtungen, von denen einige neben umfassenden
Pflegeleistungen der Altenhilfe über spezielle
Schwerpunktpflegebereiche verfügen.
|
|
Duisburgs St. Hildegardis-Gymnasium sagt steigenden
Hautkrebszahlen den Kampf an! |
|
Schul-Projekt „The BIG BURN Theory“ für gesunde Haut und
weniger Hautkrebs
Duisburg, 3. April 2025 -
Der aktuelle Arztreport der Krankenkasse BARMER spricht eine
deutliche Sprache: Bei weißem Hautkrebs haben sich die
Fallzahlen seit 2005 nahezu verdreifacht. Und auch beim der
deutlich gefährlicheren schwarzen Hautkrebs (malignes
Melanom) hat sich die Zahl der Betroffenen verdoppelt.
Die jetzt auftretenden Krankheitsfälle sind meist auf
Sonnenbrände in früheren Jahren zurückzuführen. Denn die Haut
vergisst nichts, das wissen die Schüler*innen des „10 AB
Wahlpflicht Kurs Naturwissenschaften“ des St.
Hildegardis-Gymnasiums sehr genau. Mit der Teilnahme am
Hautkrebspräventionsprojekt „The BIG BURN Theory“ von
Krebsgesellschaft Nordrhein-Westfalen e.V. und BARMER haben
sie sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Das Ziel:
In der Schule mehr über UV-Strahlung lernen und die Haut
schützen, um in späteren Jahren nicht an Hautkrebs zu
erkranken.
Highlight des Projekts ist die „BIG BURN
Challenge“. Hier können die teilnehmenden Schulen ihr zuvor
im Projekt erarbeitetes Wissen testen und gegeneinander
antreten. Mit großem Einsatz haben die Duisburger
Schüler*innen den ersten Platz geholt und sich gegen 75
weitere Klassen durchgesetzt. Clemens Kraemer, Projektmanager
bei der Krebsgesellschaft NRW e.V., ist stolz auf die
siegreichen Schüler*innen: „Das Thema wurde lebendig und sehr
erfolgreich in der Schule umgesetzt.“ Im Rahmen einer
feierlichen Preisübergabe erhielten die Sieger*innen die
hochverdiente Ehrung für ihr Engagement.
10 Jahre „BIG
BURN“: Wettbewerb als digitales Lernprogramm
Bei „The BIG
BURN Theory“ dreht sich alles um UV-Strahlung,
Sonnenverhalten und Hautschutz. Um Jugendliche im Alter von
13 bis 16 Jahren für diese Themen zu sensibilisieren,
entwickelte die Krebsgesellschaft NRW e.V. gemeinsam mit der
BARMER interaktive Lerninhalte, die sich nach dem Vorbild der
bekannten amerikanischen TV-Serie „The Big Bang Theory“
schwierigen Themen auf gewitzte Art nähern.
Die
Strategie ist einfach: Nerds und uncoole Themen können
interessant sein, wenn die Performance stimmt. Mit dem
gewonnenen Wissen können die Klassen dann an der „BIG BURN
Challenge“ teilnehmen und gegen andere Schulen antreten. Das
Projekt feiert in diesem Jahr das zehnjährige Bestehen und
blickt insgesamt auf rund 10.000 teilnehmende Schüler*innen
aus ganz NRW zurück. Mehr Infos unter www.bigburn.de.
Hautschutz so selbstverständlich wie Zähneputzen!
„Wenn es
um die Vermeidung von Hautkrebs geht, ist der Schutz junger
Haut besonders wichtig. Zu viel UV-Strahlung schädigt vor
allem die Haut von Kindern und Jugendlichen. Sie sind
besonders gefährdet, da ihre Haut noch dünner ist“, so Heike
Kluitmann, Vertragsreferentin für Prävention und Selbsthilfe
bei der BARMER in NRW.
Im Jahr 2022 erkrankten rund
25.500 Menschen neu an einem malignen Melanom der Haut.* „Die
Anzahl der Hautkrebsfälle zeigt, wie wichtig es ist, Kinder
und Jugendliche für den achtsamen Umgang mit der Sonne zu
gewinnen. Das kann nur gelingen, wenn wir ihnen das Wissen
zur Vorsorge interessant und altersgerecht vermitteln“,
ergänzt Kraemer.
NRW-Schulen können sich noch
anmelden!
Das Lernprogramm ist multimedial durchführbar:
als Präsenzunterricht mit digitalen Elementen wie der Website
www.bigburn.de oder in Form einer Projektstunde. Anmeldungen
sind per E-Mail möglich: bigburn@krebsgesellschaft-nrw.de.

Drei Schülerinnen nehmen stellvertretend für den „10 AB
Wahlpflicht Kurs Naturwissenschaften“ die Preise für das
Schul-Engagement entgegen.
Ganz links: Clemens Kraemer,
Krebsgesellschaft NRW e.V. Ganz rechts: Heike Kluitmann,
BARMER. Foto: Krebsgesellschaft NRW e.V.
*Quelle:
https://www.krebsdaten.de/Krebs/DE/Content/Krebsarten/Melanom/melanom_node.html
|
|
„PFLEGEhautnah“: authentische
Einblicke in den Pflegeberuf
|
|
Duisburg, 1. April
2025 - Kaum ein Beruf ist so vielseitig wie die Pflege. Um
mehr Bewusstsein für die Berufsgruppe zu schaffen, hat Helios
zentral mit „PFLEGEhautnah“ ein neues Social-Media-Format ins
Leben gerufen. Vier Pflegekräfte – darunter ein Duisburger –
begleiten ihren Alltag auf Station mit Kameras und geben
Einblicke in ihren Job.

Foto mit Tobias Matfeld - Copyright: Helios
Ab April
produzieren und veröffentlichen Alesja (43 Jahre), Felicia
(28), Laura (23) und Tobias (38) auf den Social-Media-Kanälen
der Helios Kliniken eigene Inhalte. Sie berichten über ihre
Arbeit, Erfahrungen sowie Begegnungen mit Patientinnen und
Patienten und Herausforderungen im Alltag. Die drei Frauen
arbeiten auf der Neonatologischen und Pädiatrischen
Kinderintensivstation der Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken
Wiesbaden, während Tobias Matfeld als Onkologischer
Fachpfleger die pflegerische Leitung des Tumorzentrums in der
Helios St. Johannes Klinik Duisburg innehat.
Klischees
des eigenen Berufs entkräften – das ist ein Grund, warum sich
die vier Helios Pflegekräfte für die Teilnahme an dem neuen
Format entschieden haben. Denn Pflegekräfte tragen nicht nur
viel Verantwortung, sie steuern auch Projekte und haben viele
Möglichkeiten, sich persönlich und beruflich
weiterzuentwickeln.
„Der
Pflegeberuf erhält immer wieder viel Aufmerksamkeit in den
Medien, allerdings werden dabei vor allem negative Punkte
hervorgehoben und Vorurteile bedient. Das entspricht nicht
der Realität und wird diesem vielseitigen und anspruchsvollen
Beruf nicht gerecht. Ich freue mich, dass wir so viele
engagierte Pflegekräfte im Team haben und dass Tobias Matfeld
in diesem neuen Format mitmacht, um einen realistischen und
menschlichen Einblick in den Pflegeberuf zu geben“, sagt
Carolina Korioth, Pflegedirektorin der Helios Standorte in
Duisburg.
Um den Pflege-Alltag so authentisch wie
möglich abzubilden, filmt Tobias Matfeld mit einer Handkamera
selbst. In manchen Situationen übernimmt ein Kollege oder
eine Kollegin, um besser zu zeigen, wie und was er ausführt.
Was bei den Videos schnell klar wird: Die tägliche Arbeit auf
Station erfordert von Pflegekräften Professionalität und
Flexibilität, denn jeder Tag bringt neue Herausforderungen.
Und die meistern Tobias und auch seine Kolleginnen in
Wiesbaden mit Herz und Sachverstand.
|
|
#sicherimDienst – BG Klinikum Duisburg setzt ein
Zeichen gegen Gewalt |
|
Duisburg,
1.4.2025. „Das BG Klinikum Duisburg ist stolz darauf, ab
sofort Teil der Kampagne #sicherimDienst des Landes
Nordrhein-Westfalen zur Gewaltprävention zu sein. Mit der
Initiative möchten wir ein starkes Signal senden: Gewalt hat
keinen Platz in unserem Arbeitsalltag“, sagte Brigitte
Götz-Paul, Geschäftsführerin der Unfallklinik, gestern im
Rahmen der feierlichen Unterzeichnung der Beitrittserklärung
zu #sicherimDienst.

Brigitte Götz-Paul (vorne links; Geschäftsführerin) und Pia
Austrup (vorne rechts; Stabsstelle #sicherimDienst) besiegeln
den offiziellen Beitritt des BG Klinikums Duisburg zu
#sicherimDienst mit ihrer Unterschrift.
Im hinteren
Bereich von links nach rechts: Oliver Crone (Pflegedirektor),
Claudia Kästner (Stellvertretende Pflegedirektorin), Tobias
Kraft (Kaufmännischer Direktor), Dirk Eßer
(Koordinierungsgruppe) und Dr. med. Nikolaus Brinkmann
(Stellv. Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für
Orthopädie und Unfallchirurgie) Bild: BG Klinikum
Duisburg/#sicherimDienst)
„Unsere Mitarbeitenden
leisten täglich wertvolle Arbeit für die Gesundheit und das
Wohl unserer Patientinnen und Patienten. Dabei verdienen sie
Respekt und Sicherheit“, so Brigitte Götz-Paul weiter.
Gemeinsam mit dem Präventionsnetzwerk #sicherimDienst setze
sich das BG Klinikum dafür ein, dass Übergriffe und
Aggressionen nicht toleriert werden. Durch gezielte Maßnahmen
und Handlungsempfehlungen wird ein Umfeld geschaffen, in dem
sich die BG Klinikum-Teams im Hause sicher fühlen und ihre
Aufgaben mit vollem Engagement erfüllen können. „Denn
Sicherheit ist nicht nur ein Grundbedürfnis, sondern auch die
Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit“, konstatierte
Brigitte Götz-Paul.
Gewaltprävention hat Tradition
Bereits vor rund zehn Jahren hat die Unfallklinik auf
Initiative der hauseigenen AG Gewaltprävention einen
Maßnahmenplan zum Thema erarbeitet. Dieser sieht u.a.
Deeskalationstrainings für Beschäftigte vor, die in direktem
Publikums- und Patientinnen- bzw. Patientenkontakt stehen.
Hochqualifizierte Deeskalationstrainerinnen aus dem BG
Klinikum bieten seitdem jedes Jahr bis zu zehn Schulungen für
Beschäftigte an. Darin geht es zum einen darum, Möglichkeiten
für einen professionellen und sicheren Umgang mit
Gewaltereignissen aufzuzeigen.
Die
Deeskalationstrainerinnen üben mit den Teilnehmenden zum
anderen das Erkennen von aggressionsauslösenden Reizen und
schulen die Eigen- und Fremdwahrnehmung. Auch konkrete Tipps
für den Arbeitsalltag wie das Erlernen von
Kommunikationstechniken zur verbalen Deeskalation oder
Flucht- und Abwehrtechniken bei körperlichen Übergriffen
spielen dort eine wichtige Rolle.
Nachsorge bei
erfolgten Übergriffen
Aktuell wird derzeit zudem ein
Konzept für eine professionelle Nachsorge bei erfolgten
Übergriffen entwickelt, die bislang im Hause allerdings
erfreulicherweise noch selten auftreten. „Wir planen zudem
eine Mitarbeitenden-Befragung zur Häufigkeit und zum Umfang
von psychischer und physischer Gewalt gegen Beschäftigte“,
sagte Brigitte Götz-Paul. Diese konkreten Zahlen und die
übrigen Ergebnisse sollen dazu beitragen, die
Gewaltprävention im Hause noch gezielter und effektiver zu
gestalten.
„Diese Kooperation kommt genau zum
richtigen Zeitpunkt“, betonte Pia Austrup von der Stabsstelle
von #sicherimDienst. Gemeinsam mit Dirk Eßer aus der
Koordinierungsgruppe überreichte sie den Verantwortlichen des
BG Klinikums die Beitrittsurkunde. „Im Januar haben wir uns
beim Runden Tisch des Gesundheitsministeriums mit Akteurinnen
und Akteuren aus dem Gesundheitswesen zum Thema Gewaltschutz
ausgetauscht.
Viele Bereiche arbeiten aktiv an
Lösungen, um die Handlungssicherheit und den Schutz der
Beschäftigten zu erhöhen. Dass das BG Klinikum bereits viele
der Themen aktiv angeht, ist ein großer Gewinn. So können
Herangehensweisen und Maßnahmen auch anderen
Kooperationspartnern als Orientierung dienen.“
Das
landesweite Netzwerk #sicherimDienst fördert den Austausch
zum Thema Gewaltschutz und stellt praxisnahe
Handlungsempfehlungen sowie bewährte Maßnahmen bereit. ein
großer Gewinn. So können Herangehensweisen und Maßnahmen auch
anderen Kooperatonspartnern als Orienterung dienen.“ Das
landesweite Netzwerk #sicherimDienst fördert den Austausch
zum Thema Gewaltschutz und stellt praxisnahe
Handlungsempfehlungen sowie bewährte Maßnahmen bereit.
|
|
Darmkrebs-Vorsorge – Darmspiegelung jetzt auch für
Frauen ab 50 Jahren möglich |
|
Berlin, 1. April 2025 – Die
Änderungen des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) an seinem
Programm zur Darmkrebs-Früherkennung treten heute am 1. April
2025 in Kraft. Damit können nun Frauen und Männer ab 50
Jahren die gleichen Angebote zur Darmkrebsvorsorge nutzen:
Darmspiegelung: Frauen und Männer ab 50 Jahren können zweimal
eine Darmspiegelung (Koloskopie) im Abstand von zehn Jahren
durchführen lassen.
Stuhltest: Alternativ zur
Darmspiegelung können Frauen und Männer ab 50 Jahren alle
zwei Jahre einen Stuhltest machen. Dr. med. Bernhard van
Treeck, unparteiisches Mitglied des G-BA und Vorsitzender des
Unterausschusses Methodenbewertung: „Bei der Darmspiegelung
können auch bereits Vorstufen von Darmkrebs früh entdeckt und
direkt entfernt werden.
Mit dem Stuhltest soll nicht
sichtbares, sogenanntes okkultes Blut im Stuhl entdeckt
werden, das auf Polypen im Darm hinweisen kann. Ist der
Befund des Stuhltests auffällig, besteht immer ein Anspruch
auf eine Darmspiegelung zur weiteren Abklärung.“
Einladung zur Vorsorge durch die Krankenkasse
Alle
Versicherten werden mit Erreichen des Alters von 50 Jahren
von ihrer Krankenkasse zur Teilnahme am Darmkrebs-Screening
per Post eingeladen. Weitere Briefe folgen, wenn Versicherte
das Alter von 55, 60 und 65 Jahren erreichen und dem
Einladungsverfahren nicht widersprechen. Dem Schreiben der
Krankenkassen liegt eine ausführliche Versicherteninformation
des G-BA bei, die Fragen rund um die Darmkrebsvorsorge
beantwortet.
Die Broschüre enthält Informationen zu
Darmkrebs, zur Früherkennung sowie zum Ablauf der
Darmspiegelung und des Stuhltests. Außerdem fasst sie die
Vor- und Nachteile der Untersuchungen zusammen und
unterstützt bei der Entscheidungsfindung. Der G-BA hat auch
den Widerspruch zur Datenverarbeitung vereinfacht,
Informationen dazu stehen am Ende der Broschüren.
Zu den Onlineversionen der Infobroschüre:
Darmkrebs-Früherkennung für Frauen ab 50 Jahren
Darmkrebs-Früherkennung für Männer ab 50 Jahren
In
Leichter Sprache: Darm-Krebs
früh erkennen (für Frauen ab 50 Jahren)
Darm-Krebs früh erkennen (für Männer ab 50 Jahren)
Beschluss zu dieser Meldung Richtlinie
für organisierte Krebsfrüherkennungsprogramme: Angleichung
der geschlechtsspezifischen Anspruchsberechtigung und
iFOBT-Intervalle in der Darmkrebsfrüherkennung sowie
Anpassung der Formerfordernisse zum Widerspruchsrecht
|
|
Blut wird JETZT benötigt! |
|
Duisburg, 31. März 2025 - Blutpräparate
sind nur begrenzt haltbar. Besonders Thrombozyten, die z.B.
für Krebspatienten lebenswichtig sind, müssen innerhalb von
vier Tagen nach der Spende beim Patienten eingesetzt werden.
Daher ist der kontinuierliche Nachschub von Blutspenden
unerlässlich. Täglich werden allein in Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz und dem Saarland bis zu 3.500 Blutkonserven
benötigt. Doch gerade in den Ferienzeiten sinkt die
Spendenbereitschaft – mit direkten Folgen für die
medizinische Versorgung.

Blutpräparate werden für den Transport in die Klinik
vorbereitet
Mit den ersten warmen Tagen wächst die
Reiselust – viele Menschen nutzen die Osterferien für Urlaub,
Ausflüge und Outdoor-Aktivitäten. Aber wer unterwegs ist,
geht nicht zur Blutspende. Und während aktuell die
Spenderzahlen schon sinken, bleibt der Bedarf an
Blutpräparaten in den Kliniken unverändert hoch. Der
DRK-Blutspendedienst steht daher vor einer besonderen
Herausforderung: Ohne regelmäßige Blutspenden kann die
Versorgung vieler schwerkranker Menschen nicht gesichert
werden.
Blut wird JETZT benötigt!
Blutpräparate
sind nur begrenzt haltbar. Besonders Thrombozyten, die z.B.
für Krebspatienten lebenswichtig sind, müssen innerhalb von
vier Tagen nach der Spende beim Patienten eingesetzt werden.
Daher sind kontinuierliche Blutspenden unerlässlich. Täglich
werden allein in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem
Saarland rund 3.500 Blutkonserven benötigt. Doch gerade in
den Ferienzeiten sinkt die Spendenbereitschaft – mit direkten
Folgen für die medizinische Versorgung.
„Jede
Blutspende zählt – gerade in den Ferienzeiten. Noch reichen
die Bestände, wenn die Spenden aber ausbleiben, geraten
Kliniken schnell in eine kritische Versorgungslage. Besonders
für Notfälle und Krebspatienten ist eine stabile
Blutversorgung lebenswichtig“, erklärt Stephan David Küpper,
Pressesprecher des DRK-Blutspendedienstes West.
Deshalb ruft das Rote Kreuz alle gesunden Menschen auf:
Nehmen Sie sich Zeit und spenden Sie Blut!
Allergiker
dürfen spenden – wenn sie symptomfrei sind
Mit dem
Frühling beginnt für viele Menschen die Heuschnupfenzeit. Die
gute Nachricht: Wer unter einer Allergie leidet, darf Blut
spenden, sofern er aktuell symptomfrei ist. Das gilt auch für
Menschen, die keine Symptome haben, weil sie
Allergiemedikamente einnehmen.
Wer unsicher ist, ob eine
Blutspende – zum Beispiel wegen der Einnahme bestimmter
Medikamente – möglich ist, kann sich kostenfrei bei der
Hotline des DRK-Blutspendedienstes unter 0800 11 949 11
beraten lassen. Alternativ steht unter www.blutspende.jetzt
ein praktischer Online-Check zur Verfügung.
Warum ist
die Blutspende beim DRK so wichtig?
Der
DRK-Blutspendedienst West gewährleistet eine sichere
Versorgung für mehr als 23 Millionen Menschen in seinem
Einzugsgebiet. Insgesamt stellt das DRK über 75 Prozent des
gesamten Blutbedarfs bereit.
Blutspende-Termin
reservieren und Leben retten
Um Wartezeiten zu vermeiden
und die Abläufe optimal zu gestalten, bittet das Rote Kreuz
darum, sich vorab unter www.blutspende.jetzt oder über die
Hotline einen Termin zu reservieren.
Blut spenden kann
jeder ab 18 Jahren, der sich gesund fühlt. Eine obere
Altersgrenze gibt es nicht mehr. Zum Termin bitte den
Personalausweis oder Führerschein mitbringen. Die eigentliche
Blutspende dauert nur etwa fünf bis zehn Minuten – und kann
bis zu drei Schwerkranken oder Verletzten helfen.
Storchentreff – Infoabend zur Geburt für werdende
Eltern
Am kommenden Montag, den 07. April, um 18
Uhr bietet die Helios St. Johannes Klinik Duisburg wieder den
Storchentreff an, einen Informationsabend für werdende
Eltern. Das bewährte Konzept bleibt: An diesem Abend
vermitteln Ärzt:innen aus Geburtshilfe und Neonatologie
(Neugeborenenmedizin) sowie eine Hebamme wissenswerte
Informationen rund um Schwangerschaft, Geburt und die erste
Zeit von Mutter und Kind nach der Geburt.


Das Team geht aber auch auf die Abläufe der
Schwangerschaft und der Entbindung im Klinikum ein. Außerdem
stehen die Expert:innen für individuelle Fragen zur
Verfügung. Die Veranstaltung findet an der Helios St.
Johannes Klinik im Veranstaltungsraum neben der Cafeteria
statt (Dieselstraße 185 in 47166 Duisburg). Da die
Teilnahmeplätze begrenzt sind, ist eine kurze Anmeldung per
Telefon unter (0203) 546-30701 oder per E-Mail:
frauenklinik.hamborn@helios-gesundheit.de erforderlich.
|
|
Renommierte Nachfolge für
Innere Medizin am Helios Standort St. Anna
|
|
Duisburg, 28. März
2025 - Zum 1. April übernimmt Prof. Dr. med. Thomas Frieling
die Leitung der Medizinischen Klinik für Innere Medizin am
Helios Klinikstandort St. Anna in Huckingen. Der
international bekannte Experte tritt damit die Nachfolge des
im Januar verstorbenen Chefarztes Prof. Martin Wegener an.
Es brauchte etwas Zeit, bis sich die Abteilung der
Medizinischen Klinik am St. Anna wieder sortiert und mit
neuer Zuversicht ausgestattet hatte. Der Verlust von Chefarzt
Prof. Martin Wegener, der Anfang des Jahres überraschend
verstorben war, wog schwer. „Es war uns wichtig, allen
Beteiligten genug Zeit zu geben und dann eine geeignete und
erfahrene Nachfolge zu finden, die dem Team eine motivierende
Perspektive gibt“, sagt Claudia Meßthaler,
Klinikgeschäftsführerin der Duisburger Helios Standorte.

Bei der Verkündung des neuen Namens an Bord steht schnell
fest, dass das gelungen ist: Mit Prof. Thomas Frieling
verschlägt es zum 1. April ein medizinisches Schwergewicht
über den Rhein. Der renommierte Experte verfügt über mehr als
30 Jahre Klinikerfahrung und war bis Ende letztes Jahres
Chefarzt der Inneren Medizin am Helios Klinikum Krefeld, dem
er immer noch beratend verbunden ist. Vor allem bei der
Behandlung und Forschung zum „Bauchhirn“, in der Endoskopie
sowie in der Neurogastroenterologie hat sich der gebürtige
Kölner im Laufe seiner beeindruckenden Karriere einen Namen
gemacht.
Er ist Gründer der Stiftung für
Neurogastroenterologie und des Instituts für
Neurogastroenterologie-Bauchberatung (INGA), hat mehrere
Wissenschaftspreise erhalten und mehr als 500 Publikationen
veröffentlicht. Sogar ein Spiegel-Bestseller („Darm an Hirn“)
steht in seinem Lebenslauf.
Nach dem Medizinstudium
in Düsseldorf verschlug es den heute gefragten Experten
zunächst in die USA, dann kehrte er an die Klinik der
Heinrich-Heine-Universität zurück, wo er nach oberärztlicher
Tätigkeit schließlich seinen Ruf als Professor für die Innere
Medizin erhielt. Im Jahr 2000 übernahm er den Chefarztposten
in Krefeld.
Im Rahmen seiner Tätigkeit lernte
Prof. Thomas Frieling auch Prof. Martin Wegener kennen und
schätzen: „Es ist mir deshalb ein großes Bedürfnis, die
Abteilung in Duisburg in seinem Sinne weiterzuführen. Er hat
sie mit enormem Fachwissen und Herzblut hervorragend auf- und
ausgebaut.“
Diese Arbeit will er nun fortsetzen und
sich dabei vor allem auf die Schwerpunkte der
Interventionellen Endoskopie sowie auf den ganzheitlichen
Ansatz funktioneller Magen-Darm-Beschwerden im Rahmen der
Neurogastroenterologie fokussieren. Auch der Ausbau von
Kooperationen mit den niedergelassenen Kolleg:innen sowie die
umfassende Aus- und Weiterbildung der Assistenzärzt:innen ist
ihm ein Anliegen.
„Ein gutes Teamgefüge und die
vertrauensvolle Zusammenarbeit hat für mich immer Priorität.“
Das Ziel soll sein, die Abteilung langfristig
weiterzuentwickeln und auch die fächerübergreifende
Zusammenarbeit mit anderen Fachrichtungen zu fördern. „Dass
der Kern meines Fachgebiets, der Magen-Darm-Trakt, eng mit
allen anderen Bereichen des Körpers verbunden ist, sollte
schon lange kein Geheimnis mehr sein. Damit einher geht, dass
wir regelmäßig über den eigenen Tellerrand schauen,“
schmunzelt Thomas Frieling.
Dass er für den
Duisburger Standort ein Glücksgriff ist, daraus macht auch
der zweite Geschäftsführer Birger Meßthaler keinen Hehl: „Wir
haben uns wirklich sehr gefreut, als wir die Zusage von Prof.
Frieling erhalten haben. Er bringt so viel exzellentes
Fachwissen und Führungserfahrung mit, dass es eine absolute
Bereicherung für unseren Standort sein wird.“
Bei
seinem neuen Team vorgestellt hat sich Thomas Frieling schon,
offiziell starten wird er dann in der kommenden Woche.
|
|
Ein Jahr Sektion Kardiologie am
BETHESDA – Insta Live am 2. April
|
|
Duisburg, 27. März
2025 - Im April 2024 hat das BETHESDA Krankenhaus in
Duisburg-Hochfeld mit der Eröffnung einer neuen
kardiologischen Abteilung sein medizinisches Spektrum
erweitert. Seitdem ist es das Ziel der Sektion Kardiologie
unter der Leitung von Dr. Reza Rezwanian-Amiri, im BETHESDA
für Patientinnen und Patienten mit Herz- und
Kreislauferkrankungen insbesondere aus dem Duisburger Süden
und der Stadtmitte ein umfassendes Versorgungsangebot auf dem
neuesten Stand der Medizin bereitzustellen.
Die
Sektion Kardiologie ist integraler Bestanteil des Zentrums
für Innere Medizin am BETHESDA Krankenhaus und bietet alle
gängigen kardiologischen Untersuchungsverfahren an. Die
medizinischen Schwerpunkte liegen dabei in der
Echokardiographie, der Schrittmacher- und
Defibrillatorkontrolle sowie der Diagnostik und Therapie von
Bluthochdruckerkrankungen.
Für weitergehende
Eingriffe wie Stentimplantationen, kathetergestützten
Herzklappenersatz oder die Katheterbehandlung von
Herzrhythmusstörungen arbeitet die Abteilung eng mit dem
renommierten Herzzentrum Duisburg zusammen, das ebenfalls zum
Klinikverbund gehört und in dem Dr. Rezwanian zuvor tätig
war.
Zum Jubiläum blickt der Sektionsleiter auf
ein erfolgreiches Jahr in Hochfeld zurück: „Wir haben uns
hier im BETHESDA sehr gut etabliert. Ich möchte dabei
betonen, dass unsere Abteilung von den Kolleginnen und
Kollegen der anderen Disziplinen absolut freundlich
aufgenommen worden ist und dass man uns ganz schnell und
unkompliziert integriert hat. Wir genießen diese kollegiale
und wertschätzende Atmosphäre sehr – und freuen uns darauf,
nach dem guten Start noch viele Dinge anzustoßen, die die
Versorgung der Patientinnen und Patienten des BETHESDA weiter
voranbringen.“

Aus Anlass des einjährigen Bestehens der Kardiologie am
BETHESDA Krankenhaus findet am Mittwoch, dem 2. April, ab 18
Uhr auf dem Instagram-Account des Evangelischen Klinikum
Niederrhein (@evklinikumniederrhein) ein Kardiologie-Talk mit
Dr. Reza Rezwanian-Amiri statt. Dr. Rezwanian-Amiri gibt dann
eine Stunde lang Infos zu Herz- und Kreislauferkrankungen und
beantwortet live die Fragen der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer.
|
|
Helios: Sinnvolle Konzentration
der Geburtshilfe
|
|
Duisburg, 25. März 2025 - Die
Geburtshilfe an der Duisburger Helios St. Anna Klinik soll
zum 1. Juli an den Nordstandort St. Johannes umziehen und das
dortige Leistungsspektrum mit einem hebammengeführten
Kreißsaal kompetent ergänzen. Hintergrund sind veränderte
Bedürfnisse werdender Eltern sowie die seit Jahren stark
rückläufigen Geburtenzahlen in Huckingen.
Individuellere Betreuung, angenehmere Atmosphäre und dabei
trotzdem das ärztliche Sicherheitsnetz im Rücken – eine
Entbindung im sogenannten hebammengeführten Kreißsaal wird
bei werdenden Eltern immer beliebter, bietet sie doch eine
natürliche und selbstbestimmte Geburtserfahrung, die sich vor
allem auf die individuellen Bedürfnisse und Wünsche der
Mutter konzentriert. Doch noch nicht alle Krankenhäuser
bieten diese Option an, denn es erfordert unter anderem eine
spezielle Teamstärke von Hebammen und die entsprechenden
Raumkapazitäten.
Am Helios Standort St. Johannes
wird sich bald beides realisieren lassen, denn zum 1. Juli
soll die Geburtshilfe dort Verstärkung aus dem Süden der
Stadt bekommen: das Hebammenteam der Helios St. Anna Klinik
soll an den Klinikstandort im Norden umziehen, um das dortige
Leistungsspektrum mit einem hebammengeführten Kreißsaal zu
ergänzen. Damit wird gleichzeitig das Entbindungsangebot in
Huckingen zum Sommer wegfallen. „Wir sind am St. Anna schon
seit Jahren mit niedrigen Geburtenzahlen konfrontiert.
In 2024 wurden bei uns nur noch 433 Kinder geboren, das
ist ein Rückgang von ganzen 12 Prozent im Vergleich zu den
Vorjahren, Tendenz weiter sinkend“, erklärt Geschäftsführerin
Claudia Meßthaler die Planungen. Die Entwicklung spiegelt
unter anderem die veränderten (Sicherheits-)Bedürfnisse
werdender Eltern wider: Sie bevorzugen zunehmend größere
Krankenhäuser mit angeschlossenen Kinderkliniken. Zugleich
wird aber hier auch vermehrt die selbstbestimmte Geburt in
einem hebammengeführten Kreißsaal nachgefragt – ergänzt durch
die pädiatrische Versorgung für Notfälle.
„Daher
passt es sehr gut, dass wir all dies künftig im St. Johannes
bündeln können“, sagt Birger Meßthaler, der zweite
Geschäftsführer der Duisburger Helios Standorte. „Wir werden
die Schritte auf diesem Weg mit den Mitarbeitenden eng
abstimmen.“ Die drei im engen Umkreis des St. Anna
angesiedelten Kliniken anderer Träger mit Geburtshilfe wurden
ebenfalls bereits über die Pläne informiert.
Künftig
sollen alle stationären Leistungen der Helios Geburtshilfe im
Norden der Stadt am Standort St. Johannes zentralisiert und
erweitert werden, etwa um den hebammengeführten Kreißsaal.
Hier arbeiten die Geburtshelfer:innen zudem sehr eng mit der
am selben Standort vorhandenen großen Kinderklinik inklusive
Perinatalzentrum Level 2 zusammen und können damit alle
Formen der Risikoschwangerschaft sowie Notfälle umfassend
versorgen.
Das Angebot der Gynäkologie am Standort St.
Anna bleibt von den Planungen unberührt. Chefarzt Dr. Martin
Rüsch und sein Team sind weiter wie bisher umfassend für die
Belange ihrer Patientinnen da und wollen vor allem die
Senologie und den gynäkologisch-onkologischen Schwerpunkt
noch weiter ausbauen.
|
|
Schockraum-Erlebnis macht Jugendliche nachdenklich |
|
P.A.R.T.Y.-Tag zur Unfall-Prävention am
3. April 2025 im BG Klinikum Duisburg
Duisburg, 24. März
2025 - „Don’t Risk Your Fun!“: Das ist das Motto des sog.
P.A.R.T.Y.-Tages, der am 3. April 2025 im BG Klinikum
Duisburg durchgeführt wird.
Von 09:00 bis 14:20 Uhr
sind dann wieder Schülerinnen und Schüler aus der Region zu
Gast. Sie werden mit eigenen Augen sehen, welche Folgen
Unfälle im Straßenverkehr infolge von Alkohol und Drogen,
Selbstüberschätzung oder bewusster Nachlässigkeit haben
können.
Von der Rettung bis zur Reha
Im Rahmen
des gut 5-stündigen Aktionsprogrammes demonstrieren
(Not-)Ärztinnen und Ärzte sowie Therapie- und Pflegekräfte
des BG Klinikums Duisburg u.a. wie die Rettung nach einem
Unfall abläuft und welche Stationen ein schwer verletztes
(„polytraumatisiertes“) Unfallopfer innerhalb der Klinik
durchläuft (Rettungstransporthubschrauber Christoph 9 und
Rettungswagen, Notaufnahme, Schockraum, Intensiv- und
Normalstation, Reha usw.).
Die Jugendlichen lernen
darüber hinaus die oftmals gravierenden Konsequenzen kennen,
die verschiedene Verletzungsmuster haben können. Ein Gespräch
mit einer Ex-Traumapatientin bzw. einem Ex-Traumapatienten
und Mitmach-Aktionen wie „Dress like Trauma“ und
„PromilleBrille“ runden den P.A.R.T.Y.-Tag ab.
Dieser
Blick hinter die Kulissen der modernen Unfallmedizin soll die
Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen, gefährliche
Lebensweisen zu überdenken und clevere Entscheidungen für
sich selbst zu treffen. Ziel des P.A.R.T.Y.-Tages ist es,
Verkehrsunfälle u.a. durch Drogen oder Leichtsinn in Zukunft
möglichst zu vermeiden.
Im Rahmen des P.A.R.T.Y.-Tages
können die Jugendlichen auf dem Weg durch die Klinik
begleitet und an den verschiedenen Stationen Fotos / Filme
gemacht werden. Die an der Veranstaltung beteiligten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BG Klinikums Duisburg
stehen zudem gerne für Nachfragen oder Interviews zur
Verfügung.
Bundesweites Unfallpräventionsprogramm
P.A.R.T.Y. ist ein bundesweites Unfallpräventionsprogramm der
Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) an dem viele
renommierte Unfallkliniken teilnehmen. P.A.R.T.Y. steht für:
• Prävention
• Alkohol
• Risiko
• Trauma


|
|
Gedenkgottesdienst für die im Krankenhaus
verstorbenen Patientinnen und Patienten
|
|
Duisburg, 21. März 2025 - Die
Krankenhausseelsorge des Evangelischen Krankenhauses
Dinslaken, des Evangelischen Krankenhauses Duisburg-Nord und
des Herzzentrum Duisburg laden zu Gedenkgottesdiensten für
die im Krankenhaus Verstorbenen des letzten Jahres ein.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses werden die
Gottesdienste gestalten. Jetzt in der Passionszeit soll
besonders den Angehörigen Kraft und Zuversicht auf Ihrem Weg
durch die Trauer gegeben werden. Es ist eine Gelegenheit sich
gemeinsam zu vergewissern, dass das Leben eines Menschen
nicht mit dem Tod verlischt: „Ich habe Dich bei Deinem Namen
gerufen…“, diesem Zuspruch Gottes wird in diesen
Gottesdiensten nachgespürt.
Die Gedenkgottesdienste
finden statt für das Evangelische Krankenhaus Dinslaken:
am Sonntag, dem 30. März 2025, um 17.00 Uhr in der
Stadtkirche, Duisburger Str. 9, 46535 Dinslaken.
Für
das Evangelische Krankenhaus Duisburg-Nord und das
Herzzentrum Duisburg:
am Sonntag, dem 30. März 2025, um
17.00 Uhr in der Ev. Kreuzeskirche Marxloh,
Kaiser-Friedrich-Straße 40, 47169 Duisburg.
Zu den
Gottesdiensten sind alle Angehörigen und alle Anteilnehmenden
herzlich willkommen.
|
|
Vertragsärztliche Bedarfsplanänderung
wegen drohender Unterversorgung bei Kinder- und Jugendärzten
|
|
Berlin, 20. März
2025 - Gemeinsamer Bundesausschuss und Inkrafttreten von
Beschlüssen.
Folgender Beschluss vom 16. Januar 2025 wurde
im Bundesanzeiger veröffentlicht und tritt am 20. März 2025
in Kraft:
Verfahrensordnung: Änderung zum 5. Kapitel –
Feststellung zum Anteil der Prüfungsteilnehmer im
Geltungsbereich des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V)
Bedarfsplanungs-Richtlinie: Anpassung der Anhaltspunkte für
Unterversorgung und in absehbarer Zeit drohende
Unterversorgungersorgungrsorgung für Kinder- und
Jugendärzte
1.
Rechtsgrundlage
Der Gesetzgeber hat durch die §§ 92
Absatz 1 Satz 2 Nummer 9 und 101 SGB V dem Gemeinsamen
Bundesausschuss die Befugnis zur Normkonkretisierung im
Bereich der vertragsärztlichen Bedarfsplanung durch Erlass
von Richtlinien übertragen. Der Gemeinsame Bundesausschuss
ist beauftragt, die erforderlichen Vorschriften für eine
funktionsfähige und deren Sinn und Zweck verwirklichende
Bedarfsplanung zu schaffen.
2. Eckpunkte der
Entscheidung Kinder- und Jugendärzte, die gemäß § 101 Absatz
5 Satz 1 SGB V eine eigene Arztgruppe bilden, sind nach § 12
Absatz 1 Nummer 9 der Bedarfsplanungs-Richtlinie der
allgemeinen fachärztlichen Versorgung zugeordnet. Dies hat
zur Folge, dass eine Prüfung auf (drohende) Unterversorgung
derzeit erst ab einem Versorgungsgrad von unter 50 Prozent
stattfindet (§ 29 Satz 1 Bedarfsplanungs-Richtlinie) und
nicht wie in der hausärztlichen Versorgung im Sinne von § 11
Bedarfsplanungs-Richtlinie ab einem Versorgungsgrad von unter
75 Prozent.
Mit Blick auf den absehbaren
Nachbesetzungsbedarf in der Arztgruppe der Kinder- und
Jugendärzte sowie offenkundiger Zugangsprobleme sorgt eine
frühzeitige Feststellung von (drohender) Unterversorgung
dafür, dass die Sicherstellungs- und Förderinstrumente der
Kassenärztlichen Vereinigungen rechtzeitig ihre Wirkung
entfalten können. Deshalb wird die hierfür maßgebliche Grenze
für Kinder- und Jugendärzte von unter 50 Prozent auf unter 75
Prozent angehoben.
Die Niederlassungsförderung
orientiert sich stark an den Versorgungsgraden der
Bedarfsplanung und kann aufgrund der Anpassung frühzeitiger
erfolgen. 3. Bürokratiekostenermittlung Durch den
vorgesehenen Beschluss entstehen keine neuen bzw. geänderten
Informationspflichten für Leistungserbringer im Sinne von
Anlage II zum 1. Kapitel VerfO und dementsprechend keine
Bürokratiekosten.

|
|
Helios Duisburg: Neues Zentrum für Alterstraumatologie |
|
Duisburg, 20. März 2025 - An den
Duisburger Helios Standorten Marien und St. Johannes haben
sich zwei Fachabteilungen die gemeinsame bestmögliche
Versorgung von älteren Unfallpatienten zum Ziel gesetzt. Mit
Erfolg: Das daraus entstandene neue Zentrum für
Alterstraumatologie wurde nun bereits auf Herz und Nieren
geprüft und zertifiziert.

v.l.: CA Thomas Zeile, CA, Alexandros Anastasiadis, ÄD Marco
Das
Ein einfacher Sturz kann für ältere Menschen
oftmals gravierende Folgen haben. Denn meist kommen dabei
mehr als blaue Flecken zustande. Wenn sie dann mit einem
Bruch oder anderen traumatologischen Verletzungen in die
Notaufnahme eingeliefert werden, beginnt eine komplexe Reise:
Es geht nicht nur um die Behandlung der physischen
Verletzungen, sondern auch um die ganzheitliche Betrachtung
der Bedürfnisse eines älteren Menschen.
Wie ist seine
Lebenssituation? Welche Vorerkrankungen sind zu
berücksichtigen?
Wie kann der Heilungsprozess so
gestaltet werden, dass der Alltag wieder sicher und
selbstbestimmt möglich ist?
Eine spezialisierte
Versorgung verschiedener Fachbereiche ist hier entscheidend –
und genau diesem Ziel haben sich die Abteilungen der
Geriatrie und Frührehabilitation sowie der Orthopädie und
Unfallchirurgie an den Duisburger Helios Standorten Marien
(Hochfeld) und St. Johannes (Hamborn) verschrieben.
„Die Behandlung von älteren Menschen nach einem Sturz
erfordert nicht nur orthopädische Expertise, sondern auch das
Wissen um die geriatrischen Bedürfnisse, die weit über die
bloße Verletzung hinausgehen“, erklärt Dr. Thomas Zeile,
Chefarzt der Geriatrie und Frührehabilitation an den
Duisburger Helios Standorten.
Der erfahrene
Altersmediziner hat deshalb gemeinsam mit seinem Kollegen,
dem orthopädischen Chefarzt Dr. Alexandros Anastasiadis ein
umfassendes Konzept entworfen und eingeführt, welches die
Besonderheiten der Betroffenen berücksichtigt: Sie reichen
von der sofortigen, optimalen Schmerzbehandlung über die
operative und physiotherapeutische Betreuung bis hin zur
präventiven Nachsorge, die einen erneuten Sturz verhindern
soll.
Dass das Projekt kein Schnellschuss,
sondern medizinisch relevant und von hoher Qualität ist,
konnten die Experten dann auch vor kurzem in einem
umfangreichen Audit der GeriZert-Kommission nachweisen. Die
unter anderem vom Bundesverband Geriatrie sowie der Deutschen
Gesellschaft für Geriatrie getragene Initiative zeichnet nur
Kliniken aus, die den strengen Anforderungskatalog für die
alterstraumatologische Versorgung bis ins Details erfüllen.
Im Fokus standen dabei die hohe Qualität der
Behandlung, die enge Zusammenarbeit der Fachbereiche
Geriatrie und Orthopädie sowie die speziell ausgerichteten
Therapieansätze, die älteren Patienten zugutekommen. „Mit
dieser Zertifizierung unterstreichen wir unser Engagement,
geriatrische Patienten bestmöglich zu betreuen – von der
akutmedizinischen Behandlung bis hin zur langfristigen
Rehabilitation,“ freut sich Alexandros Anastasiadis und ist
stolz auf die beiden Teams. „Unser Ziel ist es, älteren
Menschen eine schnelle und sichere Genesung zu ermöglichen,
sodass sie möglichst schnell in ihr gewohntes Umfeld
zurückkehren können.“
|
|
„Ein Baum für Ihr Kind“: Hamborner Geburtenwald wächst
|
|
Duisburg, 18. März 2025 - Im
nördlichen Stadtwald konnten nun junge Familien beim
Geburtenwald wieder je einen Baum für ihre im vergangenen
Jahr in der Helios St. Johannes Klinik geborenen Kinder
pflanzen.
Das Wetter meinte es am vergangenen
Freitag gut mit den Anwesenden und pünktlich um 14 Uhr lugt
die Sonne zwischen den Woken hervor. Die beiden Chefärzte Dr.
Alejandro Corral (Frauenklinik) und Dr. Benjamin Berlemann
(Kinderklinik) begrüßten die rund 60 angemeldeten Familien
herzlich zum bereits siebten Helios Geburtenwald in Hamborn.
Die Eltern mit ihrem Nachwuchs und so manchem
Geschwisterkind waren der Einladung der benachbarten Helios
St. Johannes Klinik gefolgt, um symbolisch einen Baum für
ihren Nachwuchs zu pflanzen und Duisburg damit ein bisschen
grüner zu machen.
Nach den Grußworten übernahm
wie üblich Stadtförster Stefan Jeschke das Austeilen der
bereits dreijährigen Jungbuchen und -tannen und lieferte
zudem noch ein paar spannende Waldfakten: „Wenn diese Bäume
groß sind, kann jeder einzelne bis zu 20 Menschen täglich mit
Sauerstoff versorgen.“ Zudem leben viele heimische Vögel wie
Waldkauz, Buntspecht und Kleiber in den Kronen.“

Begrüßung durch Chefarzt Dr. Corral - Fotos HKD
Mit diesen und vielen weiteren Infos begeisterte er die
Anwesenden und sorgte für noch größere Vorfreude auf den
eigenen „Familienbaum“. Er und sein Team hatten den
Waldabschnitt schon mit Pflanzlöchern vorbereitet und halfen
auch beim Einsetzen. Gesponsert werden die zukünftigen
Schatten- und Luftspender vom Helios Klinikum. Und noch ein
Gast bereitete den kleinen Gästen viel Spaß:
Klinik-Maskottchen Heli, seines Zeichens kuscheliger grauer
Drache, stand für zahlreiche Fotos gerne zur Verfügung.

Familie Lopian pflanzt einen Baum für das jüngste
Familienmitglied
Damit alle Familien die Bäume
wiedererkennen, notierten sie den Namen und das Geburtsdatum
ihrer kleinen Neu-Duisburger auf Etiketten, um damit „ihren“
Baum zu kennzeichnen. Danach gab es zum Aufwärmen kleine
Leckereien und Getränke.
Ins Leben gerufen
wurde die Klinik-Aktion „Ein Baum für Ihr Kind“ im Jahr 2017,
damals hatten Familien bereits rund 80 Bäume an einem anderen
freien Stück im Stadtwald gepflanzt. Mittlerweile sind es
über 600, die bei dieser Aktion schon neu gesetzt werden
konnten.
Ein extra angefertigtes Metallschild
informiert Spaziergänger seitdem darüber, was es mit dem
Geburtenwald auf sich hat. Auch im kommenden Jahr soll die
Veranstaltung stattfinden. Bei im Durschnitt rund 900 bis
1000 Geburten im Jahr am Helios Klinikum wird es an neuen
Baumpat:innen bestimmt nicht mangeln.
|
|
Spitzenqualität im Gynäkologischen
Krebszentrum am BETHESDA Krankenhaus Duisburg
|
|
Seit 2012
bewährt – Rezertifizierung bestätigt
Duisburg, 18. März 2025 - Das Gynäkologische Krebszentrum
BETHESDA Duisburg hat erneut die Rezertifizierung durch die
Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) erfolgreich bestanden. Seit
der Erstzertifizierung im Jahr 2012 steht das Gynäkologische
Krebszentrum des BETHESDA Krankenhauses für kontinuierlich
hohe Versorgungsqualität. Die erneute Zertifizierung
bestätigt, dass das Zentrum seine anspruchsvollen Standards
seit über einem Jahrzehnt erfolgreich umsetzt und stetig
weiterentwickelt.
„Die kontinuierliche Überprüfung
unserer Arbeitsweise und der regelmäßige Austausch zwischen
den Fachbereichen führen dazu, dass wir seit mehr als zehn
Jahren beständig auf hohem Niveau agieren können“, sagt Dr.
Harald Krentel, Leiter des Gynäkologischen Krebszentrums und
Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe.
„Die Rezertifizierung ist für uns ein weiterer Beleg dafür,
dass unser langjähriges Engagement und unsere
kontinuierlichen Qualitätsmaßnahmen Früchte tragen.“
Im Zentrum des Erfolges steht ein interdisziplinäres Team,
das individuelle Therapiepläne zur Behandlung von bösartigen
Erkrankungen der Gebärmutter, der Eierstöcke, der Eileiter,
des Bauchfells, der Vagina und des äußeren Genitales
erarbeitet.
Um den unterschiedlichen
Krankheitsverläufen gerecht zu werden, können chirurgische
Eingriffe, Chemotherapie, Strahlentherapie oder deren
gezielte Kombination eingesetzt werden. Therapeutisch bietet
das Zentrum sowohl operative als auch medikamentöse
Behandlungen an – einschließlich minimal-invasiver
laparoskopischer Verfahren und der Anwendung des
DaVinci-Robotersystems für präzise Operationen.

v.l.: Martina Bergmann (Qualitätsmanagementbeauftragte
BETHESDA Duisburg), Olga Ebertz (Netzkoordinatorin und
Leitung Dysplasie-Sprechstunde), Dr. Anna Broich (Leitung
Stabsstelle Qualitätsmanagement EVKLN) und Dr. Harald Krentel
(Leitung Gynäkologisches Krebszentrum BETHESDA Duisburg)
freuen sich über die erneute Rezertifizierung durch die
Deutsche Krebsgesellschaft.
Ein besonderer
Schwerpunkt liegt auf der Prävention. In der von der
Deutschen Krebsgesellschaft zertifizierten
Dysplasie-Sprechstunde werden Veränderungen des
Gebärmutterhalses, der Vagina und des äußeren Genitales
mittels Kolposkopie und Gewebeprobe abgeklärt. Ziel ist es,
Krebserkrankungen zu vermeiden, indem Vorstufen rechtzeitig
erkannt und behandelt werden.
Über die exzellente
medizinische Versorgung hinaus legt das Zentrum großen Wert
auf eine ganzheitliche Betreuung. Fachkräfte aus den
Bereichen Psychologie, Sozialarbeit, Seelsorge und
Palliativmedizin stehen den Betroffenen während und nach der
Behandlung zur Seite. Auch die Kooperation mit
Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen bildet einen
wichtigen Baustein, um in allen Phasen der Therapie
verlässliche Hilfe zu gewährleisten.
Das
Gynäkologische Krebszentrum ist Teil des Onkologischen
Zentrums BETHESDA Duisburg. Diese Vernetzung ermöglicht einen
raschen fachlichen Austausch und sorgt dafür, dass
Patientinnen und Patienten stets von der aktuellsten
Expertise profitieren.
Mit der erneuten
Zertifizierung, die bis zum Jahr 2028 gültig ist, bekräftigt
das BETHESDA Krankenhaus sein langjähriges Engagement,
kontinuierlich höchste Qualitätsstandards zu erfüllen und
Patientinnen eine individuell abgestimmte, moderne Versorgung
zu garantieren – ein entscheidender Beitrag im Kampf gegen
gynäkologische Krebserkrankungen.
|
|
CityPalais 22. März: Männergesundheit im Fokus |
|
Duisburg, 14. März 2025 - Die Deutsche
Gesellschaft für Mann und Gesundheit e.V. bietet anlässlich
der Gesundheitsmesse NRW, Duisburg - CityPalais, Königstr.
55a im 1 OG, am Samstag, 22. März 2025 in der Zeit von 10.00
Uhr bis 14:30 Uhr den Besuchern kostenlose Testosteron-Checks
an.
Männer können im Rahmen der bundesweiten
Aufklärungskampagne ihren Testosteronspiegel kostenlos
bestimmen lassen und sich über die Bedeutung des männlichen
Hormons informieren. Testosteron gilt in der Wissenschaft als
das Königshormon des Mannes. Das Team der Deutschen
Gesellschaft für Mann und Gesundheit e.V. steht im
Aktionszeitraum für alle Fragen rund um das Thema
Männergesundheit zur Verfügung.
„Frauen
betreiben Vorsorgemedizin, Männer Reparaturmedizin. Sie gehen
oft erst zum Arzt, wenn die Erkrankung schon ausgebrochen
ist. Dabei ist der Gang zur Vorsorgeuntersuchung keineswegs
ein Zeichen von Schwäche“, sagt Prof. Dr. Frank Sommer
Hamburg, Präsident der DGMG und weltweit einziger Professor
für Männergesundheit. Denn auch Männer kommen in die
Wechseljahre: Dazu gehört, dass der Testosteronspiegel im
Blut ab dem 40. Lebensjahr abnimmt. Bei manchen Männern wird
das Hormon dann nicht mehr in ausreichender Menge produziert.
Besonders wenn Männer unter Schlaflosigkeit,
Antriebslosigkeit oder depressiven Verstimmungen leiden, kann
es ratsam sein, einen Testosteron-Check durchzuführen.
Oftmals liegt diesen Symptomen ein Testosteronmangel
zugrunde. Geringes Bewusstsein über „Männerkrankheiten“
„Endlich wird jetzt mal die Männergesundheit in den
Mittelpunkt gerückt.
Viele von uns Männern
gehen erst zum Arzt, wenn das „Kind schon in den Brunnen
gefallen ist“, sagt ein Teilnehmer der Aktion. Und
tatsächlich wacht der Vorsorgemuffel „Mann“ langsam auf: Seit
2011 kamen über 25.000 Männer zu den bundesweiten
Aktionstagen, nahmen am kostenlosen Testosteron-Check teil
und informierten sich umfassend über Symptome, Ursachen und
Folgen eines Testosteronmangels.
Darüber hinaus
bietet die DGMG umfassende Informationsmaterialien wie z. B.
Aufklärungsfilme, Männergesundheitspass, Daten und Fakten zur
Thematik, Vorsorgebroschüren sowie Fortbildungen und
Social-Media- Aktivitäten an. Eine große Bedeutung liegt in
zielorientierter PR-Arbeit, um möglichst viele Männer zur
Vorsorge zu motivieren und frühzeitig mit ihrem Männerarzt
Kontakt aufzunehmen.
80 Prozent der deutschen
Männer gehen nicht regelmäßig zur Vorsorge Erschreckende
Zahlen ziehen sich wie ein roter Faden durch das Leben der
deutschen Männer: Sie sterben im Schnitt 4,4 Jahre früher
als Frauen. Die häufigste Todesursache sind
Herz-Kreislauferkrankungen, an zweiter Stelle stehen
Krebserkrankungen, an dritter Unfälle, Verletzungen und
Vergiftungen. Zwischen dem 45. und 64. Lebensjahr sterben ein
Drittel weniger Frauen an Herz-Kreiskauferkrankungen als
Männer. Ab dem 45. Lebensjahr sterben 1,5- bis 2-mal so viele
Männer an Tumorerkrankungen wie Frauen.
|
|
Alles mit links |
|
BG-Klinikum-Duisburg-Mitarbeiterin kämpft
sich nach Querschnittverletzung zurück ins Leben
Duisburg, 12. März 2025 - Wenn man Jessica Zwiest bei ihrer
Arbeit als Pflegekraft im BG Klinikum Duisburg erlebt, glaubt
man nicht, dass sie eine dramatische Krankengeschichte hinter
sich hat. Ein heftiger Autounfall, schwerste Verletzungen,
Diagnose Querschnittlähmung. Von einer Sekunde auf die
nächste war ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt.
Doch mithilfe einer exzellenten medizinischen Behandlung
und einer maßgeschneiderten Rehabilitation im BG Klinikum
Duisburg hat Zwiest längst ein glanzvolles Comeback geschafft
– im Alltag und im Job. Nur macht sie jetzt fast alles mit
„links“, genauer gesagt mit dem linken Daumen.
20.
Juli 2016: Gut gelaunt fährt Jessica Zwiest mit dem Auto von
der Arbeit im Pflegeheim nach Hause. Plötzlich verliert sie
das Bewusstsein und prallt mit hohem Tempo frontal gegen
einen Baum. Als die Rettungskräfte am Unfallort eintreffen,
stehen sie vor einer Herausforderung: Die damals 29-jährige
ist so stark eingeklemmt in ihrem Pkw, dass sie 1,5 Stunden
lang aufwändig aus den Trümmern herausgeschnitten werden
muss.
Erst dann kann sie medizinisch notbetreut
werden. Bestmöglich stabilisiert wird sie anschließend in den
wartenden Rettungstransporthubschrauber Christoph 9 gebracht
und ins BG Klinikum Duisburg geflogen – einer der Schockräume
des Hauses ist bereits für Zwiest vorbereitet.

Jessica Zwiest im Austausch mit einer Kollegin auf der
Station 1b. (Bild: BG Klinikum Duisburg)
Erste
Hoffnungsschimmer und viel Willen
Dort angekommen, wird
schnell das ganze Ausmaß der Verletzungen sichtbar. Zwiest
hat einen gefährlichen Genickbruch erlitten, aber auch andere
Frakturen und schwere Prellungen. Ihr Glück im Unglück: „Das
Rückenmark im Bereich der Halswirbelsäule ist beim Crash
nicht vollständig durchtrennt worden“, erklärt Dr. med.
Stefan Hobrecker, Leitender Arzt der Sektion für
Rückenmarkverletzte der Unfallklinik.
Die
Ärztinnen und Ärzte sprechen von einer „inkompletten“
Querschnittverletzung. Trotzdem sind bei Zwiest zunächst die
Arme und Beine gelähmt, die Blase funktioniert nicht und sie
ist erblindet. „Als ich nach der Notoperation an der
Halswirbelsäule auf der Intensivstation aufgewacht bin und
die Diagnose erfahren habe, war ich erstmal schockiert“,
meint Zwiest. Doch Hobrecker konnte sie beruhigen. Zwar
musste die Patientin nach der Operation noch einige Zeit auf
der Intensivstation bleiben, eine weitere operative
Behandlung des Genickbruchs war aber nicht nötig.
„Es war bei Frau Zwiest zur Quetschung des Rückenmarks mit
Schwellung und Einblutung im zentralen Teil des Rückenmarks
gekommen. Dort laufen die Nervenbahnen entlang, die vor allem
die oberen Extremitäten und insbesondere die Hände
ansteuern“, berichtet Stefan Hobrecker. Weitere Folgen der
Nervenschädigungen sind verminderte oder veränderte
Empfindungen für Berührungen, Wärme oder Schmerzen in einigen
Körperbereichen.
Auch Funktionen wie das Wasserlassen
oder der Stuhlgang können gestört sein. „Bei inkompletten
Verletzungen des Rückenmarks im Bereich der Halswirbelsäule
erholen sich die Beinfunktionen oft schneller und
umfangreicher als die Arm- und Handfunktionen, wo häufig
chronische Einschränkungen bleiben“, erklärt Hobrecker.
Schnell zeigten sich erste Hoffnungsschimmer bei der
Patientin. Die Sehkraft und das Gefühl in den unteren
Extremitäten kamen allmählich zurück. Sie musste „nur“ die
Muskulatur neu aufbauen. Zwiests Mindestziel für die
Rehabilitation war klar: „Einen Rollstuhl hätte ich noch
akzeptiert. Aber ich wollte mich unbedingt wieder alleine
versorgen können: essen, zur Toilette gehen, usw.“
Im BG Klinikum tat man alles dafür, dass dieser Wunsch
Wirklichkeit wurde. Sie bekam nicht nur einen
maßgeschneiderten Therapieplan, sondern auch eine optimale
Hilfsmittelversorgung über die zuständige
Berufsgenossenschaft. Zum Beispiel einen Besteckhalter, der
an der Hand fixiert wird, oder einen Griffadapter für die
Zahnbürste. Das Motto des BG Klinikums „Von der Rettung bis
zur Reha – mit allen geeigneten Mitteln“ war für sie ein
Segen.
Viele Hürden im Alltag
„Ich habe zudem
über die regulären Therapieverordnungen hinaus viel selbst
trainiert“, erklärt Zwiest. Irgendwann war sie soweit, dass
sie wieder laufen lernen konnte. Zunächst mit viel
Unterstützung durch die erfahrenen Therapiekräfte, dann
selbstständig an einem Gehwagen. Ihr Motto dabei:
Hartnäckigkeit und eiserner Wille. Nach fast einem halben
Jahr im BG Klinikum Duisburg „kassierte“ das Therapieteam
dann alle Gehhilfen ein und sagte: „Du kannst das!“ Und in
der Tat: es ging.
Direkt nach Weihnachten konnte
sie auf eigenen Beinen die Klinik verlassen und zurück in
ihre Wohnung in Geldern. Allerdings – wie von Hobrecker
befürchtet – mit einigen Handicaps. Zum Beispiel war und ist
die Funktion der rechten Hand dauerhaft stark eingeschränkt.
Beispielsweise eine Milchpackung festhalten, kann sie damit
nicht. Aus der Rechtshänderin wurde daher notgedrungen mit
viel Übung eine Linkshänderin.
Kein Wunder, dass
es in den eigenen vier Wänden zunächst Höhen und Tiefen gab.
Im BG Klinikum hatte sie bei Problemen immer jemanden, den
sie ansprechen konnte. Daheim musste sie selber zusehen, wie
sie klarkommt. „Da hätte ich manchmal verzweifeln können“, so
Zwiest. Stattdessen fing sie an, Strategien zu entwickeln.
Wie kann ich ein Marmeladenglas öffnen? Welche Hilfsmittel
benötige ich, um alleine Strümpfe anzuziehen? Zwiest fand für
fast alles eine Lösung und kämpfte sich langsam zurück ins
Leben.
Im Februar 2018 stand der nächste
Meilenstein an: Sie konnte wieder zurück in den Job. Für die
Fahrt zum Pflegeheim stand ihr ein speziell auf ihre
Bedürfnisse zugeschnittener Automatikwagen zur Verfügung –
eine Handgabel am Lenkrad, ein optimierter Blinkerhebel
u.v.a.m. inklusive. „Das Steuern mache ich eigentlich nur mit
dem linken Daumen, dem einzigen Finger an beiden Händen, der
noch normal funktioniert“, so Zwiest. Das Gleiche gelte etwa
für die Bedienung des Computers.
Trainingslager
unter sachkundiger Aufsicht
Um das mühsam Gelernte zu
festigen und weitere Fortschritte zu machen, kommt Zwiest
jedes Jahr für vier Wochen ins BG Klinikum auf die Station 1b
für Rückenmarkverletzte. Auf dem Programm des
„Trainingslagers unter sachkundiger Aufsicht“ steht dann u.a.
das Auftrainieren der Muskulatur und ein komplettes
Durchchecken. Das bislang letzte Mal war dies im April 2024
der Fall – mit unerwarteten Folgen.
„Ich war
schon lange unzufrieden mit meiner alten Arbeit und habe
einen Tapetenwechsel gebraucht. Das habe ich auch offen
gesagt“, berichtet Zwiest. Sofort wurde Viktoria Radic, die
Bereichsleitung Rückenmarkverletzte in der Pflege, hellhörig
und fragte nach. Welche Aufgaben sie denn in ihrem Job hätte?
Wie ihr Tagesablauf aussähe? Und vor allem: Ob sie sich
vorstellen könne, all dies auch in der Unfallklinik zu tun?
„Bei so einem Jobangebot musste ich nicht lange
überlegen und habe einfach zugesagt“, meint Zwiest – trotz 80
Kilometer Fahrt täglich zur Arbeit und zurück. „Ich wusste
ja, hier nimmt man Rücksicht auf Menschen mit Handicap. Und
ich darf tun, was ich gut kann: Die Arbeit mit und für
Kranke.“
Vorbild für Querschnittverletzte
„Längst hat Jessica Zwiest auf der 1b das Spritzensetzen
wieder gelernt, Infusionen vorbereiten ebenfalls und sie
hilft mit beim Transfer von Unfallverletzten“, zeigen sich
Pflegedirektor Oliver Crone und seine Stellvertreterin
Claudia Kästner sehr zufrieden mit der neuen Pflegekraft.
Weitere Aufgaben seien das Führen von elektronischen
Patientenakten, das Verteilen von Medikamenten, das
Vorbereiten von Rezepten etc. Feinheiten wie das Anstecken
einer Infusion sind dagegen (noch) nicht möglich.
„Was das angeht, bin ich eher eine Grobmotorikerin“, so
Zwiest lächelnd. Dafür fungiert sie aber als leuchtendes
Vorbild auf der Station. Sie weiß genau, wie
Rückenmarkverletzte „ticken“ und Zwiest spricht mit ihnen
über die Themen, die sie bewegen, zeigt viel Empathie und
gibt Insider-Tipps. Das macht vielen dort Mut und Hoffnung.
Ihre Botschaft: „Ich sage den Patientinnen und
Patienten immer: Man darf traurig oder wütend sein. Man darf
auch einen Durchhänger haben. Aber dann muss man sich selber
sagen: Niemals den Kopf in den Sand stecken, es muss vorwärts
gehen“, so die Pflegekraft. Dass das tatsächlich
funktioniert, dafür hat Jessica Zwiest mit ihrer
Erfolgsgeschichte ein Zeichen gesetzt.

Bild 2: Ein Arbeitsalltag mit vielen Aufgaben. (Bild: BG
Klinikum Duisburg)
|
|
Fünf Mediziner aus Duisburg und
Oberhausen in der neuen stern-Ärzteliste 2025 „Gute Ärzte für
mich“
|
|
Duisburg, 12. März 2025 - Fünf Mediziner
aus dem Verbund Evangelisches Klinikum Niederrhein und
BETHESDA Krankenhaus Duisburg gehören zu den besten Ärzten
Deutschlands. Sie wurden in die Liste „Gute Ärzte für mich
2025“ in einer Sonderausgabe des Magazins stern aufgenommen.
Die ausgezeichneten Ärzte des Verbunds sind Spezialisten aus
den Bereichen Herzchirurgie, Kardiologie,
Schilddrüsenchirurgie, Gynäkologie und Urologie. Sie sind
bereits zum wiederholten Male in die Ärzteliste aufgenommen
worden.
Das Magazin stern kürt jedes Jahr die besten
Ärzte Deutschlands. Die Auswahl erfolgt in Zusammenarbeit mit
dem unabhängigen Recherche-Unternehmen Munich Inquire Media
(MINQ). Die Auswahl basiert auf verschiedenen Kriterien wie
fachliche Reputation, Empfehlungen von Kolleginnen und
Kollegen und Patientenfeedback. Auch die Teilnahme an
Studien, das Engagement in Fachgesellschaften und
wissenschaftliche Publikationen spielten eine wichtige Rolle.
Die ausgezeichneten Ärzte und ihre Fachgebiete im
Überblick:
Herzzentrum Duisburg
Vom Herzzentrum
Duisburg werden zwei Chefärzte empfohlen.
Prof. Dr. med.
Wolfgang Schöls, Chefarzt der Klinik für Kardiologie,
Angiologie und Elektrophysiologie, wird als Spezialist für
interventionelle Kardiologie genannt.
Prof. Dr. med.
Jochen Börgermann, Chefarzt der Klinik für Herzchirurgie und
Kinderherzchirurgie, zählt zu den führenden Experten auf dem
Gebiet der Herzchirurgie.
BETHESDA Krankenhaus
Duisburg
Auch das BETHESDA Krankenhaus Duisburg ist in der
aktuellen stern-Ärzteliste vertreten.
Dr. med. Harald
Krentel, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe, wird für seine Leistungen bei gynäkologischen
Operationen gewürdigt.
Prof. Dr. med. Dietmar Simon,
Senioroperateur der Klinik für Allgemein- und
Viszeralchirurgie, gehört zu den Top-Spezialisten der
Schilddrüsenchirurgie. Er wird für seine Erfahrung in der
operativen Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen geschätzt.
Johanniter Krankenhaus Oberhausen
Das Johanniter
Krankenhaus Oberhausen darf sich über eine doppelte
Auszeichnung freuen:
Prof. Dr. med. Jan Fichtner, Chefarzt
der Klinik für Urologie, wird gleich in zwei Kategorien als
Top-Mediziner gelistet: Sowohl im Bereich urologische Tumoren
als auch beim benignen Prostatasyndrom zählt er zur
bundesweiten Spitze. Mit seiner umfassenden Expertise und dem
Einsatz modernster Techniken wie der roboterassistierten
Chirurgie hat er sich einen hervorragenden Ruf erarbeitet.
Die stern-Ärzteliste bietet Patientinnen und
Patienten eine wertvolle Orientierungshilfe bei der Wahl von
erfahrenen und qualifizierten Spezialisten. Wer sich für eine
Behandlung in den Kliniken des Verbunds entscheidet, weiß,
dass er in besten Händen ist – sowohl medizinisch als auch
menschlich.
#verbundenstark: Der Verbund
Evangelisches Klinikum Niederrhein und BETHESDA Krankenhaus
Duisburg deckt an insgesamt 4 Standorten mit 5 Krankenhäusern
und einer Vielzahl an Fachkliniken ein breites medizinisches
Spektrum ab. Zum Verbund gehören: das Evangelische
Krankenhaus Duisburg-Nord, das Herzzentrum Duisburg, das
Johanniter Krankenhaus Oberhausen, das Evangelische
Krankenhaus Dinslaken und das BETHESDA Krankenhaus Duisburg.
|
|
Welt-Delir-Tag am 12.03.: Wenn Künstliche Intelligenz
Leben retten hilft |
|
Duisburg, 11. März 2025 - Ein Delir kommt
oft schleichend. Erst wirkt ein Patient oder eine Patientin
ein wenig verwirrt, dann wird er oder sie unruhig,
halluziniert vielleicht – und plötzlich ist die Situation
ernst. Besonders ältere und schwerkranke Menschen sind
betroffen, doch oft wird die Gefahr erst erkannt, wenn es
schon zu spät ist. Aber was, wenn es eine Möglichkeit gäbe,
viel früher zu reagieren?
Genau hier kommt die
neue KI-gestützte Software „clinalytix Medical AI“ ins Spiel,
die das Evangelische Klinikum Niederrhein jetzt nutzt. Sie
beobachtet in Echtzeit die Patientendaten, erkennt
gefährliche Entwicklungen und warnt das medizinische Team,
bevor sich ein kritischer Zustand wie ein Delir oder eine
Sepsis verschlimmert.
„Unsere Ärztinnen und Ärzte
sind hochqualifiziert und erfahren, aber sie können nicht
rund um die Uhr jede kleinste Veränderung in den Vitalwerten
oder Laborergebnissen bemerken“, erklärt Dr. Andreas Sander,
Medizinischer Geschäftsführer im Evangelischen Klinikum
Niederrhein.
„Hier unterstützt uns die KI: Sie
wertet kontinuierlich alle relevanten Daten aus und gibt
rechtzeitig einen Hinweis, wenn sich ein Problem abzeichnet.“
Die Software agiert wie ein zusätzliches, wachsames Auge, das
niemals müde wird. Sie analysiert Vitalwerte,
Medikamentenpläne, Laborergebnisse und frühere Behandlungen
der Patientinnen und Patienten. Auf Basis dieser Daten kann
sie Risiken frühzeitig erkennen und dem medizinischen
Personal präzise Hinweise geben – bevor sich eine
Verschlechterung einstellt.
Künstliche
Intelligenz als wachsames Auge - mehr als nur Delir-Erkennung
Und die Software kann noch mehr: Neben Delir erkennt sie
auch andere ernsthafte Gesundheitsrisiken wie akutes
Nierenversagen, eine beginnende Lungenentzündung oder
Thrombosen. Besonders in stressigen
Krankenhausalltagssituationen kann das den entscheidenden
Unterschied machen.
Das Besondere an der KI? Sie
ist keine unverständliche „Blackbox“, sondern zeigt genau,
welche Daten zu ihrer Analyse geführt haben. Das bedeutet,
dass die Ärztinnen und Ärzte die Hinweise nicht nur erhalten,
sondern auch nachvollziehen können. Diese Transparenz
ermöglicht noch fundiertere, informierte Entscheidungen – mit
einem zusätzlichen, intelligenten Assistenten an ihrer Seite.
„Für unsere Patientinnen und Patienten bedeutet das weniger
Leid, weniger Komplikationen und eine schnellere Genesung“,
betont Sander.“
Ein unbehandeltes Delir kann
langfristige Folgen haben – von längeren
Krankenhausaufenthalten bis hin zu bleibenden kognitiven
Einschränkungen. Gerade deswegen ist es so wichtig, diese
Erkrankung nicht nur zu behandeln, sondern idealerweise zu
verhindern. Hier setzt die KI an: Sie bietet Ärztinnen und
Ärzten ein weiteres Werkzeug, um schnell und effektiv auf
sich anbahnende Probleme zu reagieren. Die Einführung dieser
Technologie ist Teil einer größeren
Digitalisierungs-Offensive im Evangelischen Klinikum
Niederrhein.
Möglich wird dies durch Fördermittel
aus dem Krankenhauszukunftsgesetz. „Gute Medizin basiert auf
Wissen, Erfahrung und Menschlichkeit“, sagt Sander. „Die KI
nimmt den Ärztinnen und Ärzten die Entscheidungen nicht ab,
aber sie hilft, noch präziser und schneller zu reagieren.“
Zum Welt-Delir-Tag setzt das Evangelische Klinikum
Niederrhein damit ein Zeichen: Moderne Technik kann Ärztinnen
und Ärzte dabei unterstützen, Patientinnen und Patienten noch
besser zu schützen – bevor ein Risiko zur Gefahr wird.
|
|
Endometriose – Hintergründe,
Diagnostik, Therapie |
|
Patientinnenveranstaltung am BETHESDA
Krankenhaus am 19. März 2025
Duisburg, 10. März
2025 - Starke Schmerzen während
der Menstruation, beim Wasserlassen, beim Stuhlgang oder beim
Geschlechtsverkehr, oft auch ein unerfüllter Kinderwunsch – die
Endometriose gehört zu den häufigsten gynäkologischen Erkrankungen.
Bei den betroffenen Patientinnen – alleine in Deutschland
schätzungsweise zwei Millionen Frauen und Mädchen – bilden sich
gutartige, aber oft schmerzhafte Wucherungen aus Gewebe, das der
Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutterhöhle.
Diese sogenannten Endometriose-Herde lagern sich unter
anderem im Bauchfell, an den Eierstöcken, an den Eileitern, am Darm
und an der Blase ab. Dadurch können die oben genannten Symptome und
viele weitere Beschwerden – wie ein Blähbauch, Durchfall und
Blutungsstörungen – entstehen und Organfunktionen beeinträchtigt
werden. Und oft vergeht ein langer Zeitraum, bis bei den betroffenen
Frauen die korrekte Diagnose gestellt wird.
Informationen zu den Hintergründen, zur Diagnostik und den
Behandlungsmöglichkeiten bei symptomatischer Endometriose und auch
bei unerfülltem Kinderwunsch bietet das BETHESDA Krankenhaus
Duisburg allen Betroffenen und Interessierten im Rahmen einer
Patientinnenveranstaltung: Termin: 19.03.2025, 19:00 – 20:30 Uhr
Ort: BETHESDA Krankenhaus Duisburg, Eventraum, Heerstraße 219
(Eingang: Königgrätzer Straße), 47053 Duisburg
ReferentInnen:
Dr. Harald Krentel (Foto, Chefarzt der Klinik für
Frauenheilkunde und Geburtshilfe am BETHESDA Krankenhaus), Dr.
Dimitrios Andrikos (Oberarzt der Klinik für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe am BETHESDA Krankenhaus), PD Dr. Céline Alt
(Niedergelassene Radiologin aus Bonn)

Darüber hinaus wird eine Patientin über ihre persönlichen
Erfahrungen mit dem Krankheitsbild Endometriose berichten. Moderiert
wird die Veranstaltung von Sabine Oehlrich, Gründerin und
Geschäftsführerin der Agentur Altmann PR aus Buchholz
(Niedersachsen), die sich auf den Medizin- und Gesundheitssektor
spezialisiert hat. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Voranmeldung
ist nicht nötig.
Hintergrund
Die Klinik für
Frauenheilkunde und Geburtshilfe am BETHESDA Krankenhaus Duisburg
verfügt seit vielen Jahren über große Erfahrung in der speziellen
Diagnostik und Therapie der Endometriose. Chefarzt Dr. Harald
Krentel ist ausgewiesener und international anerkannter Experte für
die sonographische Diagnostik und die laparoskopische und
robotisch-assistierte Behandlung der tief-infiltrierenden
Endometriose und Adenomyose. Im Vergangenen Jahr haben die
Europäische Endometriose Liga und die Stiftung
Endometriose-Forschung die Klinik als erste Institution in Duisburg
|
|
„Früh erkannt, besser behandelt“
– Patientenveranstaltung zum Thema Darmkrebs
am 12. März im Evangelischen Klinikum
Niederrhein
|
|
Duisburg, 5.
März 2025 - Darmkrebs gehört zu den
häufigsten Krebserkrankungen. Eine
frühzeitige Vorsorge und moderne
medizinische Verfahren bieten heute bessere
Heilungschancen als je zuvor. Um Betroffene,
Angehörige und Interessierte umfassend zu
informieren, lädt das Evangelische Klinikum
Niederrhein am 12. März um 16:00 Uhr zu
einer Patientenveranstaltung ein.
In mehreren
Kurzvorträgen erläutern Mediziner des
Klinikums die Möglichkeiten der Vorsorge,
der Darmkrebschirurgie und die
therapeutischen Fortschritte bei der
Behandlung von Darmkrebs.
Als Experten
stehen zur Verfügung: Prof. Dr. Daniel
Vallböhmer, Chefarzt der Klinik für
Allgemein- und Viszeralchirurgie und
Ärztlicher Direktor des Evangelischen
Klinikums Niederrhein, PD Dr. Purucker
Chefarzt der Klinik für Innere Medizin sowie
Dr. Samer Said, Chefarzt der Klinik für
Allgemeine Innere Medizin und
Gastroenterologie. Darüber hinaus wird Fritz
Elmer von der Selbsthilfevereinigung für
Stomaträger und Menschen mit Darmkrebs
(ILCO) über den Alltag mit einem künstlichen
Darmausgang und die Frage nach der
Lebensqualität berichten.
Im Anschluss an
die Vorträge bleibt ausreichend Zeit für
Fragen und eine offene Diskussion. Die
Veranstaltung bietet somit eine wertvolle
Gelegenheit, sich mit Fachleuten
auszutauschen und persönliche Anliegen zu
diskutieren.
Eckdaten der
Veranstaltung: Termin: Mittwoch, 12. März
2025, um 16.00 Uhr Ort: Evangelisches
Klinikum Niederrhein, Konferenzzentrum im
Verwaltungsgebäude, Raum CE01, Fahrner Str.
133, 47169 Duisburg
Die Teilnahme an
der Patientenveranstaltung ist kostenlos,
eine Voranmeldung ist nicht nötig. Die
Veranstaltung findet im Rahmen des
Darmkrebsmonats März statt, der jedes Jahr
von der Felix Burda Stiftung initiiert wird.
Der Monat März steht dabei im Zeichen der
Aufklärung und Sensibilisierung zum Thema
Darmkrebs. Ziel ist es, die Öffentlichkeit
über die Bedeutung von
Vorsorgeuntersuchungen zu informieren und
auf die Früherkennung von Darmkrebs
aufmerksam zu machen.
|
|
Einladung
zum 4. Vaskulitis-Tag an der Helios St. Johannes Klinik
|
|
Duisburg, 4. März 2025 - Seltene
Erkrankungen wie die Vaskulitis eint ein Defizit: Viele
Betroffene und auch Ärztinnen und Ärzte wissen oftmals
deutlich zu wenig darüber, deshalb ist Aufklärung und
Information ein entscheidendes Puzzleteil in der Versorgung.
Um Patient:innen, Angehörigen und Fachleuten
wertvolle Informationen zu vermitteln, lädt die Helios St.
Johannes Klinik am Samstag, 8. März 2025, von 10 bis 14 Uhr
gemeinsam mit der Selbsthilfegruppe Vaskulitis der
Rheuma-Liga NRW zum 4. Vaskulitis-Tag nach Duisburg-Hamborn
ein.
Im Rahmen der Veranstaltung können sich
Betroffene und Interessierte, aber auch Ärzt:innen über
aktuelle Forschungsergebnisse, Hilfestellungen bei der
Diagnose und über den Alltag mit Vaskulitis informieren.
Zudem gibt es ausreichend Möglichkeit zu Austausch und
Kontaktaufnahme, ob mit anderen Betroffenen oder den
Organisator:innen der Selbsthilfegruppe. Weitere
Informationen zu Programm und Veranstaltungsort gibt es
unter:
Vaskulitistag 2025 - Aktionstag für Betroffene und
Interessierte | Helios St. Johannes Klinik Duisburg
Marita Schröders Umweg zur Diagnose Rheuma ist ein
bekannter Krankheitsbegriff, doch darunter fasst die Medizin
zahlreiche rheumatische Störungen zusammen. Viele davon sind
höchst selten und spezifisch, so wie die Vaskulitis. Für
Betroffene mit dieser besonderen Gefäßerkrankung bedeutet das
meist einen langen Diagnoseweg. Marita Schröder hatte Glück
im Unglück, denn ihre behandelnden Ärzte holten schnell eine
Zweitmeinung ein.

Dr. Monika Klass mit Patientin Marita Schröder
Als
Marita Schröder (69) im Januar 2020 eine Mittelohrentzündung
mit Hörminderung bekam, ahnte sie nicht, dass dies der Beginn
einer langen und ungewissen Reise sein würde. Wenige Monate
später folgte eine Lungenentzündung, die nicht unter
Antibiotika, jedoch unter Kortisonbehandlung zunächst besser
wurde. Doch immer, wenn das Medikament reduziert wurde,
verschlechterte sich ihr Zustand wieder. Schließlich wurde
sie in ihrer Heimatstadt Oberhausen stationär aufgenommen,
zahlreiche Untersuchungen folgten.
Nach drei
Wochen ohne endgültiges Ergebnis ahnten die dortigen
Mediziner:innen, dass die Ursache weitreichender sein könnte.
Sie kontaktierten Dr. Monika Klass, Chefärztin der
Rheumatologie und Physikalischen Medizin an der Duisburger
Helios St. Johannes Klinik und Spezialistin für seltene
Diagnosen, die die Patientin mitbeurteilte und schließlich
entscheidende Hinweise fand: Ein spezifischer Antikörper im
Blut wies auf eine seltene Autoimmunerkrankung hin, die
sogenannte Granulomatose mit Polyangiitis, eine Form der
Vaskulitis.
Die damit einhergehenden
Gefäßentzündungen können zu einer Verengung oder sogar zum
Verschluss der Gefäße führen, wodurch die Durchblutung
beeinträchtigt wird und Organe wie Lunge und Niere oder das
HNO-System Schaden nehmen können. Diese spezielle
Vaskulitis-Form betrifft nur etwa fünf von 100.000 Menschen
und zählt damit zu den besonders seltenen
Autoimmunerkrankungen. Eine zusätzliche Nierenbiopsie
bestätigte die Diagnose, so dass das Team von Monika Klass
bei Marita Schröder schließlich eine spezifische Therapie in
der Helios St. Johannes Klinik Duisburg einleiten konnte.
Für die Rentnerin eine enorme Erleichterung: „Es ist
so wichtig, eine Ärztin oder einen Arzt zu haben, dem man
vertraut.“ Auch Monika Klass weiß, wie wichtig das
Vertrauensverhältnis ist, zu den Patient:innen genauso wie zu
unterstützenden Abteilungen: „Gerade die interdisziplinäre
Zusammenarbeit der verschiedenen Fachrichtungen ist
entscheidend für eine erfolgreiche Therapie.“
An
ihrem Duisburger Standort kann sie auf all diese Strukturen
zurückgreifen, zahlreiche andere Abteilungen wie die
Nephrologie, Pneumologie oder Radiologie sind vor Ort und
können jederzeit hinzugezogen werden. Auch die umfassende
Behandlung von Marita Schröder – unter anderem mit Kortison
und immunsuppressiven Medikamenten, die auch in der
Chemotherapie eingesetzt werden – fand im
fächerübergreifenden Setting statt.
Heute
befindet sich die fast 70-Jährige in Remission, doch
regelmäßige Medikamentengaben und Kontrolluntersuchungen sind
weiterhin notwendig. Sie achtet besonders auf Warnsignale wie
Fieber, Husten oder Luftnot. Kraft und Unterstützung findet
sie in einer Selbsthilfegruppe in Dinslaken, wo sich
Betroffene und ihre Angehörigen austauschen. Trotz der
Herausforderungen nimmt Marita Schröder das Leben mit Humor:
„Den ganzen Tag im Garten wühlen geht nicht mehr – aber den
halben!“
|
|
Neue Wege bei der Behandlung von Darmkrebs |
|
Patientenveranstaltung am 5. März
Duisburg, 28. Februar 2025 - Ob das Fast-Track-Verfahren
oder die onkologische Fachpflege – bei der Bekämpfung von
bösartigen Tumoren im Dickdarm oder Rektum bieten neue
Therapiewege, spezialisierte Pflegekräfte oder
personalisierte Medizin vielversprechende Fortschritte.
Was sich bei der Erkrankung von Darmtumoren in den
letzten Jahren getan hat und welche Möglichkeiten für welche
Patient:innen geeignet sind, darüber informieren die beiden
Expert:innen des Helios Darmkrebszentrums Dr. Daniel Busch
(Oberarzt, links) und Tobias Matfeld (Pflegerische
Zentrumsleitung) am kommenden Mittwoch, 5. März 2025, um 16
Uhr in kurzweiligen und laienverständlichen Vorträgen zum
Thema.
 
Die Veranstaltung findet am Standort Helios St. Johannes
Klinik (Dieselstraße 185, 47166 Duisburg) statt und ist
kostenfrei. Weitere Informationen sowie eine formlose
Anmeldung unter 0203 546 30301.
|
|
Neue Untersuchungen bestätigen
Zusammenhang zwischen Weichmachern in Kinderurin und
Verwendung von Sonnenschutzmitteln
|
|
Duisburg, 25. Februar 2025 -
Maßnahmenpaket eingeleitet: Hersteller und Überwachungsbehörden
arbeiten an Minimierung – bundesweites Monitoring –
Sonnenschutzcremes sollten weiter verwendet werden
Aktuelle
Untersuchungsergebnisse des Landesamtes für Natur, Umwelt und
Verbraucherschutz (LANUV) sowie der Chemischen und
Veterinäruntersuchungsämter (CVUÄ) in Nordrhein-Westfalen bestätigen
den Zusammenhang, dass der Weichmacher DnHexP (Di-n-hexyl-Phthalat)
aus Verunreinigungen im UV-Filter DHHB
(Diethylamino-hydroxybenzoyl-hexyl-benzoat) in Sonnenschutzmitteln
stammt.
Bisher untersuchte Sonnenschutzmittel wiesen
teilweise Verunreinigungen mit dem Weichmacher DnHexP auf. Dies
zeigt sich auch in den Kinderurin-Untersuchungen des LANUV. Die
Belastungen liegen jedoch für über 99 Prozent der 250 untersuchten
Kinder unterhalb der Schwelle für eine gesundheitliche Besorgnis.
Somit ist die Verwendung von Sonnenschutzmitteln in der Regel
sicher. Aus Gründen der Vorsorge muss aber sichergestellt sein, dass
Sonnenschutzmittel nicht mit DnHexP verunreinigt sind.
Die
nordrhein-westfälischen Behörden haben außerdem zusammen mit
Kosmetikherstellern, vertreten durch die Fachverbände,
herausgefunden, dass es möglich ist, Sonnenschutzmittel so
herzustellen, dass der UV-Filter DHHB frei von Verunreinigungen ist.
Deshalb wurden Hersteller dazu aufgefordert, vorsorglich ihre
Produktion so umzustellen, dass keine schädlichen Weichmacher mehr
messbar sind.
Alle Bewertungen sind weiterhin vorläufig, da
die bundesweit laufende Ursachenforschung noch nicht abgeschlossen
ist. Im laufenden Jahr soll es ein neues bundesweites Monitoring
geben, um einen neuen Orientierungswert für die technische
Vermeidbarkeit von DnHexP im UV-Filter DHHB abzuleiten.
•
Ergebnisse der Kinderurin-Untersuchungen des LANUV (KiSA-Studie)
Das LANUV untersucht regelmäßig im Auftrag des Umweltministeriums
Nordrhein-Westfalen den Urin von 250 Kindern im Alter von zwei bis
sechs Jahren auf verschiedene Schadstoffe wie Weichmacher, Pestizide
oder Konservierungsmittel. Im Januar 2024 hatte das Landesamt
erstmals Mono-n-hexyl-Phthalat (MnHexP), ein
Stoffwechselabbauprodukt des Weichmachers DnHexP, im Kinderurin
gefunden.
Der Weichmacher DnHexP darf seit 2019 nicht mehr
in kosmetischen Mitteln enthalten sein, weil er im Verdacht steht,
die Fruchtbarkeit zu schädigen. In einer früheren Auswertung des
LANUV vom März 2024 konnte bereits gezeigt werden, dass es einen
Zusammenhang zwischen der Nutzung von Sonnencreme und erhöhten
MnHexP-Belastungen im Urin der Kinder gibt.
Das LANUV hat
daraufhin im Jahr 2024 zwei weitere Nachweisverfahren geführt, die
zum einen bei einer erneuten Kontrolle ähnlich auffällige Werte
ergaben: In weiteren 250 Kinderurinproben von 2023/2024 wurde bei 55
Prozent der Proben MnHexP nachgewiesen.
• Bei zwei Proben wurden
MnHexP-Konzentrationen gemessen, die oberhalb des von der Kommission
Human-Biomonitoring im März 2024 abgeleiteten gesundheitlichen
Beurteilungswertes (HBM-I-Wert) von 60 Mikrogramm pro Liter lagen.
Dieser HBM-I-Wert stellt einen Vorsorgewert für die
Allgemeinbevölkerung dar. Bei einer Überschreitung sollte der
Messwert kontrolliert, nach Quellen für die Belastung gesucht und
diese minimiert werden.
Zum anderen hat das Landesamt in
Zusammenarbeit mit den für den gesundheitlichen Verbraucherschutz
zuständigen Behörden und Wirtschaftsbeteiligten Sonnenschutzmittel
als mögliche Quelle identifiziert.
• „Die neuen
Untersuchungsergebnisse bestätigen den Zusammenhang, dass der
Weichmacher aus dem verunreinigten UV-A-Filter DHHB in
Sonnenschutzmitteln stammt“, erklärt Elke Reichert, Präsidentin des
Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz. „Wir haben in
dieser Studienreihe nicht nur auf eine Belastung mit dem
Weichmachermetaboliten geschaut. Wir haben in den Urinproben der
Kinder auch nach Stoffwechselprodukten des verunreinigten UV-Filters
gesucht. Unsere Ergebnisse bestätigen für einen Großteil der Proben
den Zusammenhang zwischen dem Weichmacher und dem kontaminierten
UV-Filter.“
„Damit tragen die Ergebnisse des
Landesumweltamtes NRW wesentlich zur Aufklärung dieser bundesweiten
Problematik bei. Die KISA-Studie des LANUV ist wichtig, um
frühzeitig Hinweise auf mögliche Umweltbelastungen zu erhalten und
gegensteuern zu können. Je mehr Transparenz und Aufklärung wir
schaffen, desto mehr Schutz resultiert daraus am Ende für uns alle“,
erklärt Umweltminister Oliver Krischer.
Die Ergebnisse des
LANUV zeigen auch, dass mindestens ein Drittel der Kinder
Abbauprodukte des UV-Filters aufwiesen, ohne dass der
Weichmachermetabolit bei ihnen nachgewiesen wurde. Dies bestätigt,
dass die Herstellung von UV-Filtern ohne DnHexP-Verunreinigung
möglich ist und dass DnHexP-freie Sonnenschutzprodukte am Markt
verfügbar sind.
Ergebnisse der Untersuchungen von
Sonnenschutzmitteln durch die Chemischen und
Veterinäruntersuchungsämter
Seit Anfang 2024 werden in
Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern verstärkt
Untersuchungen von Sonnenschutzmitteln und von sog. UV-A-Filtern
durchgeführt. Die CVUÄ in Nordrhein-Westfalen, die für kosmetische
Mittel zuständig sind, untersuchten 42 Sonnenschutzmittel.
Die Ergebnisse zeigen, dass die gemäß EU-Kosmetikverordnung
festgelegte maximale Einsatzkonzentration von zehn Prozent des
UV-A-Filters DHHB in kosmetischen Mitteln bei keinem der
untersuchten Produkte überschritten wurde. In 31 (74 Prozent)
untersuchten Produkten wurden DHHB-Gehalte nachgewiesen, in elf
Sonnenschutzmitteln war kein DHHB nachweisbar. Bei sechs
Sonnenschutzmitteln (14 Prozent) wurden DnHexP-Gehalte zwischen 0,8
und 5,9 mg/kg bestimmt. Bei 86 Prozent war kein DnHexP nachweisbar.
Die in Nordrhein-Westfalen ermittelten Analyseergebnisse decken sich
mit denen anderer Bundesländer.
Neben Sonnenschutzmitteln
selbst wurden auch weitere zwölf Proben des Rohstoffes DHHB
(UV-A-Filter) analysiert. In allen Proben war DnHexP nachweisbar.
Bei zehn Proben lagen die Gehalte zwischen 9,9 bis 69,7 mg/kg; zwei
Proben wiesen Gehalte von über 100 mg/kg auf. Die ermittelten
Analysenergebnisse zeigen, dass sich die DnHexP-Gehalte im Rohstoff
unterscheiden können.
Das Bundesamt für Risikobewertung geht
davon aus, dass selbst bei höheren Verunreinigungen ein
hinreichender Sicherheitsabstand besteht und eine gesundheitliche
Beeinträchtigung daher sehr unwahrscheinlich ist.
Für
Verbraucherinnen und Verbraucher bedeuten die Ergebnisse, dass die
auf dem Markt bereitgestellten Sonnenschutzmittel sicher sind und
dass es auch Sonnenschutzmittel mit DHHB ohne nachweisbare
Verunreinigung mit DnHexP gibt.
Verbraucherschutzministerin
Silke Gorißen: „Die Chemischen und Veterinäruntersuchungsämter in
Nordrhein-Westfalen leisten mit ihren Untersuchungen einen
bedeutenden Dienst, um Verbraucherinnen und Verbraucher vor
gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung zu schützen."
Das Verbraucherschutzministerium Nordrhein-Westfalen schließt
sich weiterhin allgemein der geltenden Empfehlung an, dass
Verbraucherinnen und Verbrauchern keinesfalls auf Sonnenschutzmittel
verzichten sollen, denn UV-Strahlung ist nach wie vor die
Hauptursache für die Entstehung von Hautkrebs.
Umfangreiches
Maßnahmenpaket eingeleitet
Aufgrund der Zusammenhänge haben die
zuständigen Lebensmittelüberwachungsbehörden und die
Wirtschaftsbeteiligten Maßnahmen zur weiteren Minimierung der
Verunreinigungen eingeleitet.
Zentral wird dabei die
Herstellung von DHHB so umgestellt, dass das Vorkommen von
Verunreinigungen auf ein technisch machbares Minimum reduziert wird.
Die Umsetzung entsprechender Maßnahmen wird von den
Lebensmittelüberwachungsbehörden kontrolliert.
Beim bundesweiten
Monitoring 2025 soll ein analytisch ermittelter Orientierungswert
für die technische Vermeidbarkeit von DnHexP im UV-A-Filter DHHB
abgeleitet werden.
Auf EU-Ebene hat der wissenschaftliche
Ausschuss für Verbrauchersicherheit (SCCS) den Auftrag erhalten, die
Reinheit des UV-Filters in Sonnenschutzmittel neu zu bewerten.
Um die Bewertungsprozesse zu unterstützen, werden das
nordrhein-westfälische Umweltministerium und das
Verbraucherschutzministerium die aktuellen Untersuchungsergebnisse
einspeisen.
Das LANUV setzt die regelmäßigen Untersuchungen von
Kinderurin auf MnHexP im Rahmen der LANUV-KiSA-Studie fort.
Hintergrund
Weichmacher gehören zu den vom LANUV untersuchten
Stoffen. Eine wichtige Weichmacher-Gruppe sind die Phthalate. Diese
Stoffe werden im Körper des Menschen in sogenannte Metaboliten
umgewandelt und mit dem Urin ausgeschieden. Viele Phthalate sind für
die Gesundheit des Menschen schädlich, da sie Effekte auf das
Fortpflanzungssystem haben. Für eine Reihe von Phthalaten bestehen
deshalb umfangreiche Verwendungsbeschränkungen. Vom LANUV werden
aktuell insgesamt 35 Phthalat-Metaboliten im Urin von Kindern
untersucht.
• Allen an der
Studie teilnehmenden Erziehungsberechtigten bietet das LANUV eine
umfassende umweltmedizinische Beratung zu den ermittelten
Ergebnissen an. Kinder mit Überschreitungen können eine
Nachuntersuchung erhalten. Außerdem bietet das LANUV den
Erziehungsberechtigten an, nach den möglichen Quellen für die
erhöhte Belastung zu suchen.
Das LANUV untersucht regelmäßig
im Auftrag des NRW-Umweltministeriums die Schadstoffbelastung von
Kindern aus Nordrhein-Westfalen (KiSA-Studie NRW). Alle drei Jahre
wird seit 2011 der Urin von jeweils 250 Kindern im Alter von zwei
bis sechs Jahren auf verschiedene Schadstoffe wie Weichmacher,
Pestizide oder Konservierungsmittel analysiert.
Der nächste
reguläre Durchgang erfolgt in den Jahren 2026/27. Solche
Untersuchungen wie die KiSA-Studie NRW werden als
Human-Biomonitoring bezeichnet. Mit den LANUV-Daten aus dem
Human-Biomonitoring lassen sich zeitliche Veränderungen in der
Schadstoffbelastung der Kinder aufzeigen. Sie dienen als
Frühwarnsystem für das Erkennen von Belastungen mit Schadstoffen.
Informationen zur Studie des LANUV:
https://www.lanuv.nrw.de/themen/umwelt-und-gesundheit/umweltmedizin/umweltepidemiologie/schadstoffe-im-urin-von-kindern-bestimmung-von-schadstoffen-im-urin-von-kindern-aus-nrw
|
|
Ärztlicher Notdienst an Karneval einsatzbereit
|
|
Videosprechstunde auch für
Erwachsene möglich
Düsseldorf/Duisburg, 25.
Februar 2025 — Wer an den bevorstehenden
Straßenkarnevalstagen im Rheinland akute gesundheitliche
Beschwerden hat, kann den Notdienst der niedergelassenen
Ärztinnen und Ärzte kontaktieren. Erste Anlaufstellen
hierfür sind die ambulanten allgemeinen und
fachärztlichen Notdienstpraxen im Landesteil.
Informationen zu Adressen und Öffnungszeiten der insg.
gut 90 Notdienstpraxen der Kassenärztlichen Vereinigung
Nordrhein (KVNO) gibt es unter www.kvno.de/notdienst oder
über die kostenlose Servicenummer 116 117. Die Nummer ist
rund um die Uhr erreichbar. Die Telefon-Kapazitäten
werden zu Karneval noch einmal verstärkt.
Hausbesuche für nicht mobile Patientinnen und Patienten
Erkrankte, die den Weg in eine örtliche Notdienstpraxis
nicht auf sich nehmen können, haben die Möglichkeit, über
die 116 117 einen ärztlichen Hausbesuch zu erfragen. Die
Rufnummer gibt zudem Auskunft über die Erreichbarkeiten
der regionalen Augen-, HNO-, kinderärztlichen Notdienste
im Rheinland.
Neu: Videosprechstunde künftig
auch für Erwachsene
Analog zur bereits für erkrankte
Kinder und Jugendliche etablierten kinderärztlichen
Videosprechstunde startet die KVNO ab Samstag, den 1.
März, ein digitales Pendant für Erwachsene. Im Rahmen der
allgemeinmedizinischen Videosprechstunde haben dann auch
„große“ Erkrankte die Möglichkeit, online eine ärztliche
Erstmeinung zu erhalten. Oftmals lässt sich schon durch
diese digitale Arztkonsultation das Aufsuchen einer
ambulanten Notdienstpraxis inklusive Anfahrt vermeiden.
Sollte die Gabe von verschreibungspflichtigen
Medikamenten notwendig sein, ist - wie beim pädiatrischen
Angebot - das Ausstellen eines E-Rezeptes möglich.
Angefragt werden können beide Videosprechstunden-Formate
entweder telefonisch über die Servicenummer 116 117 oder
online über www.kvno.de/kinder bzw.
www.kvno.de/erwachsene
Nach Erfassung des
jeweiligen gesundheitlichen Beschwerdebildes erhalten
Anrufende per E-Mail einen Termin-Link. Wichtig:
Patientinnen und Patienten sollten unbedingt ihre
Versichertendaten bzw. die des erkrankten Kindes zur Hand
haben. Um die Videosprechstunde zu nutzen, wird neben
einer stabilen Internetverbindung ein Smartphone, Tablet,
Notebook oder einen Computer mit Kamera und Mikrofon
benötigt. Während des digitalen Arzt-Patienten-Gesprächs
sollte eine möglichst ruhige Umgebung ohne weitere
anwesende Personen aufgesucht werden.
Die
kinderärztliche Videosprechstunde ist samstags, sonntags
und feiertags (auch Rosenmontag) von 10 bis 22 Uhr
verfügbar. Das Online-Angebot für Erwachsene ab 1. März
in der Zeit von 9-21 Uhr an Samstagen, Sonntagen sowie an
Feiertagen, ebenfalls an Rosenmontag.
Praxis-Vertretungen zwischen Altweiber und Aschermittwoch
Zwischen dem 27. Februar (Altweiber) und 5. März
(Aschermittwoch) werden einige Arztpraxen im Rheinland
urlaubsbedingt geschlossen bleiben. Während der
Sprechstundenzeiten übernehmen dann andere Praxen vor Ort
vertretungsweise die ambulante Versorgung. Patientinnen
und Patienten sollten rechtzeitig auf entsprechende
Praxis-Aushänge und Angaben auf den
Praxis-Anrufbeantwortern oder Homepages achten.
|
|
-
28.
Februar:
Tag der seltenen Erkrankungen
- 10 Jahre
Williams-Beuren-Zentrum an der St. Johannes Klinik
Duisburg
|
|
„Eine seltene
Erkrankung ist das Gegenteil von ärztlicher Routine“
Duisburg, 25. Februar 2025 - Ein Großteil der seltenen
Erkrankungen tritt im Kindesalter auf. Und mit den
meisten davon müssen die Betroffenen ein Leben lang
zurechtkommen, auch wenn sie erwachsen sind. Der Übergang
kommt bei der medizinischen Versorgung manchmal einem
Neuanfang gleich. Deshalb profitieren Patienten wie
Matthias Henke von der lebenslangen Anbindung an ein
spezialisiertes Zentrum, wo die Besonderheiten seines
seltenen Gendefekts bekannt sind.
Matthias Henke hat ein freundliches Gesicht und volles
graues Haar, ungewöhnlich für seine 34 Jahre, typisch für
seine Erkrankung. Er gehört zu den Betroffenen des
seltenen William-Beuren-Syndroms (WBS), das nur bei etwa
einer von 8000 Geburten auftritt. Die Ursache liegt in
einem spontanen Gendefekt, ein Stückverlust am langen Arm
des Chromosoms 7. Damit fehlen den Patient:innen rund 28
benachbarte Gene, unter anderem das für die Bildung des
Proteins Elastin.
Diese Veränderung kann
schwere Herz- und Gefäßfehlbildungen sowie die
Entwicklung eines Bluthochdrucks begünstigen und hat
neben den organischen Veränderungen auch kognitive
Beeinträchtigungen und besondere optische Merkmale zur
Folge, wie einen kleineren Kopf, pausbäckige Wangen und
eine geringere Körpergröße. Meist altern die Betroffenen
vorzeitig, deshalb hat auch Matthias Henke schon seit
vielen Jahren graue Haare.
Der Bochumer wird gerade
aufgenommen in der Helios St. Johannes Klinik Duisburg,
wo auch das einzige Williams-Beuren-Zentrum Deutschlands
beheimatet ist. Ein Routineeingriff in der
Allgemeinchirurgie steht an, Matthias Henke hat einen
Leistenbruch, der behandelt werden muss. Auf der Station
in Empfang nimmt den Mittdreißiger aber Kinderärztin und
Zentrumsleiterin Dr. Elke Reutershahn, die ihn seit
vielen Jahren kennt.
Sie legt ihm auch den
notwendigen Zugang und koordiniert die Behandlung, denn
WBS-Patient:innen sind vor allem bei Operationen
sogenannte High-Risk-Patienten. Sie vertragen die
Nebenwirkungen der Narkose oft schlechter, müssen länger
überwacht werden. Die zuständigen Anästhesist:innen
sollten sich daher bestmöglich mit den Besonderheiten
auskennen. In Duisburg wissen alle Beteiligten Bescheid.
Deshalb kommen Matthias und seine Mutter Angelika Henke,
die ihn oft begleitet, für solche Prozeduren aus Bochum
hierher, viele andere Betroffene noch von deutlich
weiter.

v.l. Angelika Henke, Matthias Henke, Elke Reutershahn
(Copyright: Helios)
Aus gutem Grund: „Mit
einer seltenen Erkrankung gerät man fast bei jedem neuen
Arztkontakt in einen Erklärungsstrudel, weil diejenigen
das Syndrom nicht kennen oder nur wenig darüber wissen.
Das macht vielen Patienten und ihren Familien zu schaffen
und birgt natürlich auch Risiken.“ Angelika Henke weiß
genau, wovon sie spricht, zum einen durch die Erfahrung
mit ihrem Sohn, aber auch als sogenannter
„Transitionscoach“ für den WBS-Bundesverband. Hier ist
sie Ansprechpartnerin für betroffene Jugendliche im
Übergang zum Erwachsenenalter.
Denn genau dieser Übergang von der kinder- und
jugendmedizinischen Versorgung in die Erwachsenenmedizin
stellt für viele Betroffene seltener Erkrankungen und
ihre Familien eine große Herausforderung dar. In der
Pädiatrie besteht häufig eine enge, vertrauensvolle
Beziehung zwischen Ärzt:innen und Patienten, die über
viele Jahre aufgebaut wird, die betreuenden
Mediziner:innen wissen nahezu alles über die
individuellen Bedürfnisse und die Geschichten ihrer
Schützlinge.
Der Wechsel in die
Erwachsenenmedizin geht dann oft mit einer neuen
Umgebung, unbekannten Ärzt:innen und dem Fehlen eines
spezialisierten Netzwerks, das den besonderen
Bedürfnissen gerecht wird, einher. Zusätzlich können sich
die Gesundheitsanforderungen im Erwachsenenalter ändern,
was eine Anpassung der Therapie und der Betreuung
erfordert.
„Das betrifft zwar auch Kinder mit
chronischen Erkrankungen, aber hier gibt es oftmals
bekannte Standards und deutlich mehr Therapieoptionen.
Eine seltene Erkrankung aber ist quasi das Gegenteil von
allgemeiner ärztlicher Routine und erfordert eine Menge
spezielles Wissen“, erläutert die Duisburger Oberärztin
Elke Reutershahn. Diese Fachkompetenz ist in einem
Zentrum wie in Duisburg dauerhaft gebündelt und auch
Therapien oder Eingriffe können, eingebettet in die
Strukturen einer großen Klinik, entsprechend sicherer
geplant werden.
„Wir stimmen mit den
Kolleg:innen der anderen Fachbereiche den Aufenthalt so
ab, dass es möglichst stressfrei abläuft und die
Besonderheiten von WBS überall gegenwärtig sind.“ Dass
sie als Kinderärztin dann auch erwachsene Patienten wie
Matthias Henke betreut, gehört für sie dazu, die
lebenslange Anbindung der Betroffenen ist ein wichtiger
Teil der Versorgung.
Matthias ist dankbar dafür, vor dem Eingriff vertraute
Gesichter zu sehen, es beruhigt ihn. Auch seine Mutter
hat volles Vertrauen in Elke Reutershahn und ihr Team.
Ohnehin strahlt die ehemalige Lehrerin eine besondere
Herzlichkeit und Entspanntheit aus. Nicht
selbstverständlich nach allem, was Betroffenen mit
seltenen Erkrankungen und ihre Angehörigen zum Teil im
Laufe der Zeit erleben: Lange Leidenswege bis zur
Diagnose, begrenzte Therapieansätze oder zu wenige
Spezialist:nnen.
„Wir hatten insofern Glück,
als dass eine aufmerksame Ärztin beim Gesundheitsamt
Matthias‘ Besonderheiten früh bemerkte. Da war er noch
kein Jahr alt. So hatten wir auch schnell eine umfassende
Diagnose.“ Vielen betroffenen Familien aber ergeht es
anders. Um ihnen zu helfen, setzt sich Angelika Henke
aktiv im WBS-Bundesverband ein und absolvierte zusätzlich
die besondere Coach-Ausbildung für den Übergang. Matthias
selbst braucht mittlerweile nur noch wenig Hilfe im
Alltag, auch wenn er dauerhaft bei seinen Eltern wohnt.
Er arbeitet über eine Werkstatt in einem
Lager für Biobedarf und ist begeisterte Karnevalist.
„Deshalb will ich unbedingt nächste Woche wieder auf den
Beinen sein“, schmunzelt er. Als Teil eines
Spielmannszugs sind die jecken Tage eines seiner
Highlights im Jahr. „Ich spiele die Snare, eine kleine
Trommel, und wir sind rund um Karneval aber auch sonst
viel in der Bundesrepublik unterwegs.“
Die
Begeisterung dafür merkt man ihm sofort an. Auch Elke
Reutershahn muss lächeln, als sie ihm zuhört, man spürt
die Vertrautheit zwischen den beiden. Dann aber zeigt sie
auf die Uhr und schaut augenzwinkernd streng, Matthias
muss pünktlich in der Radiologie sein, zum CT, das für
seinen Eingriff am nächsten Tag notwendig ist. Den
übersteht er gut und kann nach nur einer Nacht zur
Überwachung wieder nach Hause. Dort heißt es dann
ausruhen bis Donnerstag, wenn das jecke Treiben an
Altweiber endlich losgeht.
10 Jahre
Williams-Beuren-Zentrum an der Helios St. Johannes Klinik
Duisburg
Seit 2015 befindet sich an
der Helios St. Johannes Klinik Duisburg das
deutschlandweit einzige Zentrum für die Diagnostik und
Langzeitbetreuung von Patient:innen mit
Williams-Beuren-Syndrom (WBS). Die dortige Abteilung der
Kinder- und Jugendmedizin vereint alle dafür notwendigen
Fachbereich unter einem Dach und übernahm damals den
Staffelstab vom Heidekreis Klinikum aus Walsrode.
Das Team steht Betroffenen und ihren Familien
langfristig für alle Fragen rund um den seltenen
Gendefekt zur Verfügung. Leiterin und erste
Ansprechpartnerin des Zentrums ist Dr. Elke Reutershahn.
Die erfahrene Oberärztin sitzt auch zeitgleich dem
wissenschaftlichen Beirat des WBS-Bundesverbandes vor.
Eingebettet in das umfangreiche Leistungsspektrum
des Maximalversorgers bietet die Abteilung Betroffenen
und ihren Familien, die zumeist lebenslang in die
Betreuung eingebunden sind, die gesamte Bandbreite der
medizinischen Versorgung - von der internistischen über
die operative bis hin zur entwicklungsdiagnostischen
Betreuung. Heilbar ist WBS bislang nicht. Doch viele
Patienten können als Erwachsene zwar ein betreutes, aber
in vielen Dingen selbstständiges Leben führen.
Kontakt zum WBS-Zentrum: 0203 546 2631 //
Williams-Beuren-Zentrum | Helios St. Johannes Klinik
Duisburg
Tag
der seltenen Erkrankungen am 28. Februar 2025
Dieser weltweite Aktionstag
findet jährlich immer am letzten Februartag statt und
macht weltweit auf seltene Krankheiten und die
Herausforderungen aufmerksam, mit denen Betroffene und
ihre Familien konfrontiert sind. Seltene Erkrankungen
betreffen weniger als 5 von 10.000 Menschen, jedoch gibt
es weltweit Tausende solcher Erkrankungen.
Der
Tag soll das Bewusstsein für sie schärfen, den Austausch
zwischen Ärzt:innen, Patient:innen und der Öffentlichkeit
fördern und die Forschung unterstützen, um bessere
Diagnosen und Behandlungen zu ermöglichen.
|
|
BETHESDA Krankenhaus:
Engagierte Unterstützung gesucht
|
|
Die
Grünen Damen und Herren im BETHESDA Krankenhaus freuen
sich auf Verstärkung
Duisburg, 24. Februar 2025 - Mitmenschlichkeit und
Zuwendung sind im Krankenhausalltag von unschätzbarem
Wert. Im BETHESDA Krankenhaus Duisburg tragen die "Grünen
Damen und Herren" seit über fünfzig Jahren dazu bei,
Patientinnen und Patienten in schwierigen Zeiten
beizustehen. Nun sucht das engagierte Team nach weiteren
Freiwilligen, die mit Herz und Zeit einen wertvollen
Beitrag leisten möchten.
Die
Grünen Damen und Herren sind ehrenamtliche Helferinnen
und Helfer, die durch kleine Gesten und aufmerksame
Gespräche den Krankenhausaufenthalt erleichtern. Sie
hören zu, bringen eine Zeitung, organisieren kleine
Besorgungen oder nehmen sich einfach Zeit für einen
Spaziergang. Ihr Engagement macht den Unterschied – für
die Patientinnen und Patienten ebenso wie für die
Freiwilligen selbst.
Neue Ehrenamtliche werden
liebevoll in ihre Aufgabe eingeführt und zu Beginn von
erfahrenen Kolleginnen und Kollegen begleitet. Besondere
Qualifikationen sind nicht erforderlich – wichtiger sind
Einfühlungsvermögen, Humor, Zuverlässigkeit und die
Freude am Umgang mit Menschen.
Wer sich dem Team der Grünen
Damen und Herren anschließen möchte, kann sich bei
Pfarrerin Sara Randow melden: Telefon: 0208 45791139
E-Mail: sara.randow@ekir.de Jede helfende Hand ist
herzlich willkommen!
|
|
Darmkrebsmonat März:
Evangelisches Klinikum Niederrhein informiert über
Vorsorge, Diagnose und moderne Behandlungsmethoden
|
|
Insta-Live mit
Prof. Dr. Daniel Vallböhmer am Dienstag, 25. Februar
Duisburg, 18. Februar 2025 - Darmkrebs ist eine der
häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland – doch er ist
oft vermeidbar. Eine einfache Vorsorgeuntersuchung kann
helfen, Vorstufen frühzeitig zu entdecken und zu
entfernen. Trotzdem nehmen viele Menschen die
Möglichkeiten zur Früherkennung nicht wahr.
Warum ist die Darmspiegelung so wichtig? Welche neuen
Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Und wie sehen die
Heilungschancen aus? Diese und viele weitere Fragen
beantwortet Prof. Dr. Daniel Vallböhmer, Chefarzt der
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am
Evangelischen Klinikum Niederrhein, am Dienstag, 25.
Februar, ab 18 Uhr live auf Instagram
(@evklinikumniederrhein).

Vorsorge rettet Leben
„Viele Menschen schieben das
Thema Darmkrebs lieber beiseite – doch genau das kann
gefährlich werden“, sagt Prof. Dr. Vallböhmer. „Je früher
wir Auffälligkeiten entdecken, desto besser sind die
Heilungschancen.“ Das Darmkrebszentrum des Evangelischen
Klinikums Niederrhein arbeitet eng mit niedergelassenen
Fachärzten zusammen, um eine schnelle und lückenlose
Versorgung sicherzustellen. „Wer eine Auffälligkeit bei
der Vorsorge hat, kann alle weiteren Untersuchungen und
eine mögliche Behandlung direkt bei uns durchführen
lassen – ohne lange Wartezeiten oder unnötige Wege“,
erklärt der Experte.
Moderne Behandlung –
individuell abgestimmt
Wird Darmkrebs diagnostiziert,
stehen den Betroffenen am Klinikum alle medizinischen
Fachrichtungen zur Seite – von Gastroenterologie über
Chirurgie bis hin zu Onkologie und Strahlentherapie. In
interdisziplinären Tumorkonferenzen wird für jeden
Patienten ein individueller Behandlungsplan erstellt.
„Wir kombinieren modernste chirurgische Verfahren,
Chemotherapien und Strahlentherapien und richten uns
dabei nach den neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnissen“, so Prof. Dr. Vallböhmer.
Mitreden und Fragen stellen
Beim Insta-Live am 25.
Februar können alle Interessierten ihre Fragen direkt an
den Experten richten. „Wir wollen aufklären, Ängste
nehmen und zeigen, dass man selbst viel für seine
Gesundheit tun kann“, betont Prof. Dr. Vallböhmer. Das
Evangelische Klinikum Niederrhein lädt alle
Interessierten ein, sich zu informieren und aktiv
mitzudiskutieren – denn Wissen kann Leben retten!
|
|
Duisburger Helios Kliniken unterstützen soziale
Projekte mit großzügiger Spende |
|
Duisburg, 18. Februar 2025 - Im
Rahmen einer internen Aktion im letzten Herbst kam bei
den Helios Kliniken in Duisburg ein umfassender
Spendenbetrag zusammen. Die von den Standorten
bereitgestellten 18.900 Euro gehen nun an drei soziale
Projekte in der Region.
Die über 3000
Mitarbeitenden der fünf Helios Standorte in Duisburg
(Akut und Reha) konnten vergangenen Herbst bei einer
internen Aktion ihre Stimme abgeben und damit parallel
auch noch Gutes tun.
Je höher der teilnehmende
Prozentsatz unter der Belegschaft, desto mehr Geld
stellten die Kliniken an Spenden bereit. Die dabei
entstandene Gesamtsumme von 18.900 Euro kommt nun gleich
drei gemeinnützigen Organisationen zugute, die sich über
jeweils 6.300 Euro freuen dürfen: dem SOS-Kinderdorf
Niederrhein, dem Tiergnadenhof und Jugendfarm Duisburg e.
V. sowie der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft
(DLRG).
Die offizielle Spendenübergabe an
das SOS-Kinderdorf Niederrhein in Kleve übernahm
Klinikgeschäftsführer Birger Meßthaler und besuchte die
Einrichtung, um das Geld zu überreichen. Während einer
umfangreichen Führung und eines intensiven persönlichen
Gesprächs mit Einrichtungsleiter Peter Schönrock und
Katrin Wißen von der Stabsstelle Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit konnte er viele wertvolle Einblicke
in die Arbeit des Kinderdorfs gewinnen und war
beeindruckt:
„Es ist großartig, mit wie viel
Engagement und Herzblut die Mitarbeitenden hier Kinder
und Jugendliche unterstützen. Mit unserer Spende möchten
wir diese wertvolle Arbeit fördern und einen nachhaltigen
Unterschied im Leben der Menschen machen.“

Auch Peter Schönrock, Einrichtungsleiter des
SOS-Kinderdorfs Niederrhein, zeigte sich dankbar: „Die
großzügige Unterstützung ermöglicht es uns, unsere
Angebote weiter auszubauen und noch gezielter auf die
Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Wir freuen uns sehr
über diese Wertschätzung unserer Arbeit und danken der
Klinik und ihren Mitarbeitenden für ihr Engagement.“
|
|
Grippe- und Erkältungswelle
in Nordrhein – Was jetzt wichtig ist
|
|
Düsseldorf/Duisburg, 17. Februar 2025 — Die diesjährige
Grippe- und Erkältungssaison verläuft ungewöhnlich
heftig. Nach Auskunft des Robert Koch-Instituts (RKI)
liegt die Inzidenz in Nordrhein-Westfalen derzeit bei
knapp 2.500 pro 100.000 Einwohner – ein Niveau, das
zuletzt Ende 2023 erreicht wurde.
Entsprechend
hoch ist derzeit die Auslastung von Haus- und
Kinderarztpraxen sowie des ambulanten Notdienstes.
Besonders betroffen sind Kinder und Jugendliche, doch
auch unter Erwachsenen liegen die Infektionszahlen über
denen des Vorjahres. Laut RKI dominieren gegenwärtig vor
allem Influenza A- und B-Viren, gefolgt von RSV und
Rhinoviren.
„Die Lage ist aktuell zwar noch
nicht besorgniserregend, dennoch sollten wir insbesondere
mit Blick auf die Karnevalstage achtsam sein. Wer
Symptome verspürt, bleibt am besten zu Hause und kuriert
sich in Ruhe aus. Im öffentlichen Raum helfen
Hygienemaßnahmen wie das Einhalten der Husten- und
Niesetikette, regelmäßiges Händewaschen oder
Abstandhalten; vulnerable Gruppen sollten gerade doppelt
auf sich achten, damit sie unbeschadet durch die
Winterzeit kommen“, sagt der Vorstandsvorsitzende der
Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO), Dr. med.
Frank Bergmann.
Influenza: Wann ein
Arztbesuch sinnvoll ist
Bei gesunden Kindern sowie
Erwachsenen unter 60 Jahren verläuft eine Grippe meist
ohne größere Komplikationen. In diesen Fällen reicht es
in der Regel, sich zu schonen und die Erkrankungen
auszukurieren. Treten jedoch starke Symptome auf oder
verschlechtert sich der Zustand, sollte die Hausarzt-
oder Kinderarztpraxis kontaktiert werden – idealerweise
vorab telefonisch, um ggf. eine separate
Infektionssprechstunde anzufragen.
Wer
außerhalb der regulären Praxiszeiten medizinische Hilfe
benötigt, kann sich an den ambulanten Bereitschaftsdienst
der niedergelassenen Ärzte wenden. Informationen zu den
gut 90 Notdienstpraxen in Nordrhein gibt es unter
www.kvno.de/notdienst oder über die kostenlose Hotline
116 117. Patienten, die nicht mobil sind, können über die
Rufnummer zudem einen ärztlichen Hausbesuch anfragen.
Videosprechstunde für Kinder und Jugendliche
Für Eltern erkrankter Kinder und Jugendlicher bietet die
KV Nordrhein eine kinderärztliche Videosprechstunde an.
Dieser Service ist samstags, sonntags und feiertags
(inkl. Rosenmontag) von 10 bis 22 Uhr verfügbar. Termine
können telefonisch über die Patientenhotline 116 117 oder
auch online über www.kvno.de/kinder vereinbart werden.
|
|
Helios Kinder- und
Jugendklinik erhält begehrtes
Zweifach-Diabetes-Zertifikat
|
|
Junge
Patient:innen und ihre Familien umfassend behandeln
Duisburg, 10. Februar 2025 - Eine hohe Qualifikation
der Mitarbeitenden, die Erfüllung zahlreicher
diabetesspezifischer Leistungsmerkmale sowie ein klar
definiertes Behandlungsmanagement – unter anderem für
diese Kriterien hat die renommierte Kinder- und
Jugendklinik am Helios Standort St. Johannes in Duisburg
Alt-Hamborn nun neuerlich das Zertifikat
„Diabeteszentrum“ von der Deutschen Diabetes Gesellschaft
(DDG) erhalten. Dies gilt nun sowohl für die ambulante
als auch für die stationäre Versorgung von Kindern und
Jugendlichen.
Erkrankt ein Kind oder
Jugendlicher an Diabetes, ändert sich das Leben der
gesamten Familie auf einen Schlag. Vieles – wie die
Ernährung – muss umgestellt, anderes wie Spritzen setzen
oder spezielle Erste Hilfe neu erlernt werden. Zudem
spielen Faktoren wie langfristige Folgeerkrankungen oder
Wachstumsprozesse in der ohnehin bereits komplexen
medizinischen Behandlung eine noch größere Rolle.
An der Kinder- und Jugendklinik des Duisburger
Helios Standortes St. Johannes steht dafür ein ganzes
pädiatrisches Team bereit, denn eine erfolgreiche
Diabetestherapie erfordert geschultes und erfahrenes
Personal, sowohl von Seiten der Ärzt:innen und
Pflegekräfte als auch im Bereich der Diabetesberatung und
psychologischen Begleitung.
Für die nun
offiziell erfolgte (Re-)Zertifizierung zum
Diabeteszentrun der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG)
lag die Messlatte für das Duisburger Team aber noch weit
darüber. Denn die dazugehörige Prüfungskommission
zeichnet nur Einrichtungen aus, die eine hochwertige und
vor allem evidenzbasierte Versorgung und Betreuung
anbieten.
Wegweiser für Betroffene
Dazu
gehört auch, dass die Abteilung jährlich eine Vielzahl
von jungen Menschen mit Diabetes betreut und so die
nötige Erfahrung für die zuverlässige Diagnose, die
optimale Diabeteseinstellung, Patientenschulungen und
Behandlung vorhält. Das Qualitätssiegel ist somit auch
ein Wegweiser bei der Suche nach geeigneten
Behandlungseinrichtungen.

„Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung unseres
langjährigen Engagements“, sagt Dr. Benjamin Berlemann,
Chefarzt der Kinder- und Jugendklinik und Leiter der
Kinderdiabetologie. Im Duisburger Norden werden dauerhaft
ambulant etwa 80 und dazu jährlich stationär mehr als 100
junge Patient:innen mit Diabetes betreut.
Jeder einzelne davon kann sich auf die hohe Fachkompetenz
und die optimal strukturierten Behandlungsprozesse am
Standort verlassen, so der erfahrene Pädiater: „Das
Besondere an der Auszeichnung ist, dass nun neben der
Ambulanz auch unsere Klinik als zertifizierte stationäre
Einrichtung zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen
mit dem Gütesiegel der DDG ausgezeichnet wurde.“
Schulungen für das Umfeld
Zudem bietet das Team
regelmäßige Schulungen für die ganze Familie und sogar
für Betreuungskräfte wie Lehrer:innen oder Erzieher:innen
an. Hier wird Betroffenen vermittelt, wie man sich etwa
richtig Insulin spritzt, worauf bei der Ernährung zu
achten ist und was im Notfall zu tun ist. Die Duisburger
Expert:innen folgen auch hier den anspruchsvollen
Richtlinien der DDG: Die vermittelten Inhalte müssen dem
aktuellen Stand der Wissenschaft entsprechen, auf den
jeweiligen Diabetestyp zugeschnitten sein und die aktuell
empfohlene Diabetestechnologie berücksichtigen.
Ein zusätzlicher Faktor ist die Vernetzung mit
anderen Fachärzt:innen, erklärt Berlemann: „Bei Diabetes
ist es besonders wichtig, dass die verschiedenen
Fachrichtungen gut zusammenarbeiten, um gefürchtete
Folgeerkrankungen wie Sehbeeinträchtigungen,
Wundheilungsstörungen oder auch eine Niereninsuffizienz
zu verhindern.“
Das Siegel „Diabeteszentrum DDG“
gilt nun für drei Jahre, dann muss die Pädiatrie an der
Helios St. Johannes Klinik erneut nachweisen, dass sie
die strengen Kriterien der DDG auch weiterhin erfüllt.
Informationen zu Diabetes bei Kindern und
Jugendlichen
Mehrere zehntausend Kinder und
Jugendliche in Deutschland leiden unter Diabetes Typ 1
oder 2 – Tendenz steigend. Vor allem bei jungen
Patient:innen werden Symptome und Ausprägung der
Erkrankung aber stark individuell beeinflusst, etwa durch
Wachstumsschübe oder hormonelle Veränderungen. Zudem ist
immer die gesamte Familie mitbetroffen

Symbolbild
Arten von Diabetes:
Typ-1-Diabetes:
Autoimmunerkrankung, bei der die Insulinproduktion in der
Bauchspeicheldrüse gestoppt wird. Häufiger bei Kindern
und Jugendlichen.
Typ-2-Diabetes: Wird häufig durch
ungesunde Ernährung, Übergewicht und Bewegungsmangel
verursacht. Eigentlich eine Erkrankung des
Erwachsenenalters, tritt nun aber auch deutlich vermehrt
bei älteren Kindern und Jugendlichen auf.
Typ-3-Diabetes: inoffizielle Benennung, fasst die
selteneren Formen von Diabetes, die nicht den ersten
beiden Typen zuzuordnen sind, in einer Gruppe zusammen
Häufige Symptome bei Manifestation eins bis dato
nicht bekannten Typ-1-Diabetes:
Häufiges Wasserlassen,
übermäßiger Durst, unerklärlicher Gewichtsverlust,
Müdigkeit, verschwommenes Sehen.
Diagnose:
Blutzuckertests, HBA1c-Wert, Urintests. Bei Verdacht auf
Diabetes sind regelmäßige ärztliche Kontrollen wichtig.
Behandlung:
Typ-1-Diabetes: Insulintherapie,
Blutzuckermessung und eine ausgewogene Ernährung.
Typ-2-Diabetes: Gewichtsreduktion, gesunde Ernährung,
körperliche Aktivität und Medikamente
(Lifestyle-Intervention). Oft später auch Insulin
zusätzlich.
Typ-3-Diabetes: Je nach Typ sind die
Therapien unterschiedlich
Langzeitfolgen:
Unkontrollierter Blutzucker kann zu langfristigen Schäden
an Augen, Nieren, Nerven und Blutgefäßen führen.
Psychische Aspekte:
Kinder und Jugendliche mit
Diabetes können emotionale Herausforderungen durch die
ständige Überwachung des Blutzuckerspiegels und die
Anpassung des Lebensstils erfahren.
Die Manifestation
mit einem Diabetes ist eine lebensbestimmende Erkrankung
und belastet die gesamte Familie von Geschwistern über
Eltern bis hin zu anderen Anverwandten.
Auch das
Umfeld (Kindergarten, Schule, Freunde, etc.) sind ein
Faktor, der besonderer Aufmerksamkeit bedarf.
|
|
Konservative Therapien in der
Wirbelsäulenchirurgie |
|
Informationsveranstaltung für Betroffene und
Interessierte
Duisburg, 5. Februar 2025 -
Bei der Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen spielen
konservative Therapien eine zentrale Rolle, um
Beschwerden zu lindern und die Funktion der Wirbelsäule
zu erhalten. Durch gezielte Maßnahmen wie Physiotherapie,
Schmerztherapie und Stabilisierung kann in vielen Fällen
eine Operation vermieden und die Lebensqualität der
Betroffenen verbessert werden.
Welche
Möglichkeiten es genau gibt, darüber spricht Barbara
Tophoven-Bleckmann, leitende Oberärztin der Klinik für
Wirbelsäulenchirurgie am Helios Standort St. Johannes in
Alt-Hamborn. Die Veranstaltung findet am 12. Februar um
16:00 Uhr im Veranstaltungsraum der Helios St. Johannes
Klinik (neben der Cafeteria) in der Dieselstraße 185,
47166 Duisburg statt.
Sie richtet sich an
Betroffene und Interessierte und ist kostenlos, jedoch
muss aufgrund begrenzter Kapazitäten eine vorherige
Anmeldung erfolgen. Interessierte werden gebeten, sich
telefonisch unter (0203) 546-31801 oder per E-Mail an
Selina.Przybilla@helios-gesundheit.de an
zumelden.
|
|
Grippesaison 2025/26 – Neue Impfstoffalternative
für alle ab dem Alter von 60 Jahren
|
|
Folgender Beschluss vom 19. Dezember
2024 wurde im Bundesanzeiger veröffentlicht und tritt am
5. Februar 2025 in Kraft:
Berlin, 19. Dezember 2024 – Der
Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat die aktualisierte
Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) zur
Impfung gegen die saisonale Grippe in die
Schutzimpfungs-Richtlinie übernommen. Nach Einschätzung
der STIKO sind zwei wirkungsverstärkte Impfstofftypen
besser als der Standard-Impfstoff geeignet, eine Grippe
(Influenza) und mögliche Komplikationen zu verhindern.
Deshalb können alle Personen ab dem Alter von
60 Jahren in der Grippesaison 2025/26 entweder mit einem
Hochdosis-Influenza-Impfstoff oder mit einem
MF59-adjuvantierten Influenza-Impfstoff geimpft werden –
jeweils mit aktueller, von der
Weltgesundheitsorganisation empfohlener
Antigenkombination.
Mit der Änderung der
Schutzimpfungs-Richtlinie schafft der G-BA die
Planungsgrundlage für die Impfstoff-Beschaffung für die
Grippesaison 2025/26. Für die aktuelle Grippesaison
2024/2025 empfiehlt die STIKO allen Personen ab 60 Jahren
wie bisher eine Impfung mit dem Hochdosis-Impfstoff. Mit
Inkrafttreten der beschlossenen Änderung der
Schutzimpfungs-Richtlinie können Ärztinnen und Ärzte den
MF59-adjuvantierten Influenza-Impfstoff – sofern dieser
verfügbar ist – bereits in der aktuellen Grippesaison
2024/25 alternativ verwenden.
Der Beschluss wird
dem Bundesministerium für Gesundheit zur Prüfung
vorgelegt und tritt nach Nichtbeanstandung und
Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft.
Hintergrund: Leistungsansprüche auf Grippeschutzimpfungen
Voraussetzung für die Aufnahme einer Schutzimpfung in den
Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV) ist eine Empfehlung der beim Robert Koch-Institut
angesiedelten STIKO. Auf Basis der STIKO-Empfehlungen
legt der G-BA – spätestens zwei Monate nach deren
Veröffentlichung – die Einzelheiten zur Leistungspflicht
der GKV in der Schutzimpfungs-Richtlinie
fest.
|
|
Focus Gesundheit Klinikliste
2025: Evangelisches Klinikum Niederrhein und BETHESDA
Krankenhaus Duisburg gehören zu den besten Kliniken in
NRW
|
|
Auszeichnungen
auf den Fachgebieten Schilddrüsenchirurgie (BETHESDA
Krankenhaus Duisburg) und Prostatakrebs (Johanniter
Krankenhaus Oberhausen)
Duisburg, 4. Februar 2025
- Das Evangelische Klinikum Niederrhein und das BETHESDA
Krankenhaus Duisburg zählen laut der aktuellen Focus
Gesundheit Klinikliste 2025 zu den Top-Krankenhäusern in
Nordrhein-Westfalen. Besonders hervorgehoben wurden dabei
zwei Fachkliniken des Verbunds, die als Top-Adressen in
ihren medizinischen Fachgebieten gelten.
Die
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie im BETHESDA
Krankenhaus Duisburg wurde für ihre Leistungen in der
Schilddrüsenchirurgie ausgezeichnet. Ebenso überzeugte
die Klinik für Urologie im Johanniter Krankenhaus
Oberhausen, das Teil des Evangelischen Klinikums
Niederrhein ist, mit ihrer Expertise im Bereich
Prostatakrebs.
Beide Kliniken überzeugen mit hohen
Standards in allen bewerteten Kategorien. Grundlage für
die Auszeichnungen sind nicht nur fach- und
abteilungsspezifische Fallzahlen, sondern auch umfassende
Umfragen unter Krankenhäusern und Fachärzten.
Berücksichtigt wurden zudem Aspekte wie die Qualifikation
des Personals, pflegerische Versorgung, Zertifikate sowie
die Anzahl der in der Focus-Liste geführten
Top-Mediziner. Zusätzliche Hygienemaßnahmen, wie die
Teilnahme an der Initiative „Aktion Saubere Hände“,
gewährleisten ein Höchstmaß an Patientensicherheit.
Schilddrüsenchirurgie im BETHESDA Krankenhaus
Duisburg
Die Klinik für Allgemein- und
Viszeralchirurgie unter der Leitung von Prof. Dr. Simon
Schimmack bietet spezialisierte Behandlungen für
Erkrankungen der Schilddrüse, Nebenschilddrüse,
Bauchspeicheldrüse und Nebenniere. Erkrankungen wie
Schilddrüsenkrebs, Schilddrüsenüberfunktion oder
vergrößerte Schilddrüsen werden durch hochpräzise
Eingriffe behandelt – darunter Resektionen und
Radiojodtherapie.
Neben einer modernen technischen
Ausstattung überzeugt die Klinik durch langjährige
Erfahrung, auch bei Operationen an Kindern. Darüber
hinaus ist sie auf die Behandlung von Tumoren im
Bauchraum spezialisiert. Die Zertifizierung als
Onkologisches Zentrum und Viszeralonkologisches Zentrum
durch die Deutsche Krebsgesellschaft unterstreicht die
medizinische Kompetenz der Einrichtung.
Behandlung von Prostatakrebs im Johanniter Krankenhaus
Oberhausen
Die Klinik für Urologie unter der Leitung
von Prof. Dr. Jan Fichtner bietet modernste Diagnostik
und Therapie für Erkrankungen der Nieren, Harnwege und
männlichen Geschlechtsorgane. Als langjährig
zertifiziertes Prostatakarzinomzentrum arbeitet die
Klinik in einem eng verzahnten medizinischen Netzwerk,
das eine frühzeitige Diagnostik und individuell
abgestimmte Behandlung ermöglicht.
Ein besonderer
Schwerpunkt liegt auf der robotergestützten Chirurgie.
Mit dem hochmodernen DaVinci-System können präzise und
nervschonende Eingriffe durchgeführt werden. Auch bei
fortgeschrittenen Tumorstadien ist die Klinik bestens
aufgestellt und gewährleistet durch ihre
Weiterbildungsberechtigung in der medikamentösen
Tumortherapie eine umfassende Versorgung.
Hintergrund zur Focus Gesundheit Klinikliste 2025
Die
Focus Gesundheit Klinikliste gilt als eine der
wichtigsten Orientierungshilfen für Patientinnen und
Patienten in Deutschland. In Zusammenarbeit mit dem
Rechercheinstitut FactField wurden Daten aller 1629
Krankenhäuser in Deutschland ausgewertet. Grundlage der
Bewertung sind unter anderem gesetzlich vorgeschriebene
Qualitätsberichte, Umfragen unter Fachärzten und Kliniken
sowie Analysen von Patientenzufriedenheitsdaten aus
Online-Bewertungen.
|
|
Storchentreff – Infoabend zur Geburt für
werdende Eltern |
|
Duisburg, 29. Januar 2025 - Am
kommenden Montag, den 3. Februar, um 18 Uhr bietet die
Helios St. Johannes Klinik Duisburg wieder den
Storchentreff an, einen Informationsabend für werdende
Eltern.
Das bewährte Konzept bleibt: An diesem
Abend vermitteln Ärzt:innen aus Geburtshilfe und
Neonatologie (Neugeborenenmedizin) sowie eine Hebamme
wissenswerte Informationen rund um Schwangerschaft,
Geburt und die erste Zeit von Mutter und Kind nach der
Geburt.


Das Team geht aber auch auf die Abläufe der
Schwangerschaft und der Entbindung im Klinikum ein.
Außerdem stehen die Expert:innen für individuelle Fragen
zur Verfügung. Die Veranstaltung findet an der Helios St.
Johannes Klinik im Veranstaltungsraum neben der Cafeteria
statt (Dieselstraße 185 in 47166 Duisburg).
Da
die Teilnahmeplätze begrenzt sind, ist eine kurze
Anmeldung per Telefon unter (0203) 546-30701 oder per
E-Mail:
frauenklinik.hamborn@helios-gesundheit.de
erforderlich.
|
|
Händehygiene: Goldenes Siegel für Duisburger
Helios Kliniken |
|
Duisburg, 28. Januar 2025 - Der
Verbund erhielt von der „Aktion Saubere Hände“ das
goldene Zertifikat für die stetige Verbesserung der
Händehygiene bei seinen Mitarbeiter:innen. Das große Ziel
dabei: die Übertragung und Ausbreitung von Infektionen im
Klinikalltag nachhaltig zu vermeiden.
Etwas
flapsig und im doppelten Wortsinn könnte man sagen, dass
da an den Duisburger Helios Standorten St. Johannes und
Marien „jemand sehr sauber gearbeitet hat.“ Denn um mit
dem Gold-Zertifikat der Aktion Saubere Hände
ausgezeichnet zu werden, bedarf es der Einhaltung
zahlreicher Qualitätskriterien: Unter anderem muss die
Gesundheitseinrichtung seine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter wiederkehrend in der Händedesinfektion
schulen, die Einhaltung der Vorgaben sicherstellen, den
Händedesinfektionsmittelverbrauch messen und Aktionstage
zur Thematik durchführen. Alle Vorgaben müssen für
mindestens zwei Jahre erfüllt sein.
Für die
Duisburger Chefärztin der Krankenhaushygiene vor Ort,
Priv.-Doz. Dr. med. Marzia Bonsignore, ein lohnender
Aufwand: „Eine ausgezeichnete Händehygiene ist
maßgeblich, damit wir unsere Patienten möglichst schnell
wieder gesund in den Alltag entlassen können. Umso
stolzer sind wir, dass unser Engagement in diesem Bereich
und damit der Kampf gegen Infektionen Wirkung zeigt und
gewürdigt wird."

Chefärztin Priv.-Doz. Dr. med.
Marzia Bonsignore (2 v. r. mit Urkunde) mit ihrem
Hygiene-Team.
Die Aktion „Saubere Hände“
wurde 2008 mit Unterstützung des Bundesministeriums für
Gesundheit ins Leben gerufen. Sie basiert auf der
WHO-Kampagne „Clean Care is Safer Care", die die
Verbesserung der Patientensicherheit zum Ziel hat. Seit
2014 ist die Aktion eigenständig und zeichnet unter
anderem Krankenhäuser in Deutschland für besondere
Hygienequalität aus.
|
|
|
|
Medizin im Revier: Probleme mit der Schilddrüse?
Patientenveranstaltung zu Schilddrüsenerkrankungen im
BETHESDA Krankenhaus Duisburg am 11. Februar 2025
Duisburg, 28. Januar 2025 - Schluckbeschwerden,
Müdigkeit, unerklärliche Gewichtszunahme oder Herzrasen?
Solche und andere unspezifische Beschwerden können auf
eine Erkrankung der Schilddrüse hinweisen – einer kleinen
Drüse mit großer Wirkung auf den gesamten Körper.
Um Betroffene und Interessierte umfassend zu
informieren, lädt der Klinikverbund Evangelisches
Klinikum Niederrhein/BETHESDA Krankenhaus Duisburg am 11.
Februar 2025 zur nächsten Veranstaltung der Reihe
„Medizin im Revier“ ein.
Unter dem Titel „Probleme mit
der Schilddrüse?“ widmet sich die Klinik für Allgemein-
und Viszeralchirurgie des BETHESDA Krankenhauses den
vielfältigen Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten.
„Schilddrüsenerkrankungen wie Knotenbildungen oder
Funktionsstörungen sind weit verbreitet, bleiben aber
häufig lange unerkannt. Wir möchten mit dieser
Veranstaltung aufklären, wie Symptome richtig eingeordnet
werden können und welche modernen Behandlungsansätze zur
Verfügung stehen“, erklärt Prof. Dr. Simon Schimmack,
Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
und Leiter des Onkologischen Zentrums BETHESDA Duisburg.

Prof. Dr. Simon
Schimmack (Foto EVKLN).
Die Veranstaltung stellt
aktuelle Ansätze in Diagnostik und Therapie vor. Dr. Timo
Bartel, Oberarzt der Nuklearmedizin am
Universitätsklinikum Essen, gibt einen Einblick in die
Möglichkeiten der nuklearmedizinischen Diagnostik. Prof.
Dr. Simon Schimmack präsentiert moderne chirurgische
Behandlungsmethoden, die bei Erkrankungen der Schilddrüse
zum Einsatz kommen.
Die beiden Experten werden im
Anschluss an ihre Vorträge ausreichend Zeit einplanen, um
auf Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer einzugehen.
Ein besonderes Angebot der Veranstaltung ist außerdem die
Möglichkeit, vor Ort eine Ultraschalluntersuchung der
Schilddrüse durchführen zu lassen.
Eckdaten
der Veranstaltung: Titel: Probleme mit der Schilddrüse?
Datum & Uhrzeit: Dienstag, 11. Februar 2025, 17.00-19.00
Uhr
Ort: BETHESDA Krankenhaus Duisburg, Eventraum (vom
Haupteingang aus ausgeschildert), Heerstraße 219, 47053
Duisburg
Die Teilnahme ist kostenlos, eine
Voranmeldung ist nicht erforderlich.
Über die
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
Die Klinik
für Allgemein- und Viszeralchirurgie am BETHESDA
Krankenhaus Duisburg ist spezialisiert auf die Behandlung
von Erkrankungen der endokrinen Organe, darunter die
Schilddrüse, die Nebenschilddrüse, die Bauchspeicheldrüse
und die Nebenniere. Ein besonderer Fokus liegt auf der
viszeralonkologischen Chirurgie, die sich der Therapie
bösartiger Tumoren im Bauchraum widmet. Darüber hinaus
ist die Klinik von der Deutschen Krebsgesellschaft als
Onkologisches Zentrum und Viszeralonkologisches Zentrum
für Bauchspeicheldrüsen- und Darmkrebs zertifiziert – ein
Beleg für höchste medizinische Kompetenz und Qualität.
|
|
Telenotarztsystem
Niederrhein: Duisburg und Partnerkommunen unterzeichnen
Vertrag
|
|
Duisburg/Niederrhein, 23. Januar 2025
- Wer in eine Notsituation gerät, möchte schnellstmöglich
die bestmögliche Hilfe bekommen. Doch nicht immer kann
gewährleistet werden, dass mit dem Rettungsdienst sofort
ein Notarzt zur Stelle ist. Das neue Telenotarztsystem
Niederrhein, das in Kooperation von
Gesundheitsministerium, Ärztekammern,
Krankenkassenvertretern und kommunalen Spitzenverbänden
auf den Weg gebracht wurde, soll diese Situation künftig
verbessern.

Vertragsunterzeichnung Telenotarztsystem Niederrhein -
Stadt Krefeld, Presse und Kommunikation, Andreas Bischof
Die Trägergemeinschaft Telenotarztsystem Niederrhein,
vertreten durch Oberbürgermeister Sören Link, seinen
Amtskollegen Frank Meyer (Krefeld) und Felix Heinrichs
(Mönchengladbach), die Landräte Christoph Gerwers (Kreis
Kleve) und Dr. Andreas Coenen (Kreis Viersen) sowie Dr.
Lars Rentmeister (Verwaltungsvorstand Kreis Wesel),
unterzeichnete gestern im Krefelder Rathaus die
öffentlich-rechtliche Rahmenvereinbarung.
„Mit dem Start des gemeinschaftlichen Telenotarztsystems
setzen wir als Partnerkommunen einen Meilenstein für eine
effiziente und vernetzte Notfallversorgung. Modernste
Technologien gepaart mit der Expertise erfahrener
Rettungskräfte sorgen dafür, dass medizinische Hilfe
schneller und zielgerichteter bei den Menschen ankommt“,
betont Oberbürgermeister Sören Link.

„Das
System Telenotarzt ist ein gutes Beispiel, wie technische
Innovationen in den Kommunen einen unmittelbaren
Unterschied im Leben der Menschen machen können: Ich bin
überzeugt, dass dieses System die Versorgung im Notfall
weiter verbessern und Leben retten wird“, erklärt
Krefelds Oberbürgermeister Frank Meyer.
„Dieses Projekt wird nur durch enge interkommunale
Zusammenarbeit möglich. Es wäre kaum zu leisten, wenn
eine Stadt allein ein solches System aufbauen wollte –
aber gemeinsam kriegen wir das hin. Dank unserer
hochmodernen und bestens ausgerüsteten Feuerwache konnten
wir die Zentrale für alle sechs Städte und Landkreise
hier in Krefeld ansiedeln.“
Was sind die
nächsten Schritte?
Es wird nun damit begonnen, die
technische Ausstattung festzulegen und anzuschaffen.
Parallel dazu beginnt die Personalakquise von
Telenotärztinnen und Telenotärzten sowie deren
Dienstplanung. Nach dem Aufbau der Telenotarztzentrale
startet der Probebetrieb, in dem die Zentrale zeitlich
begrenzt besetzt wird. Dabei sollen mögliche
Schwierigkeiten unter Realbedingungen frühzeitig erkannt
und behoben werden.
Bei reibungslosem Ablauf
werden die Betriebszeiten der Telenotarzt-Bereitschaft
schrittweise erweitert und schließlich auf einen 24/7-
Vollbetrieb umgestellt. „Durch die Einführung einer
Telenotarztzentrale verbessern wir die hochwertige
medizinische Unterstützung für unsere Bürgerinnen und
Bürger. Für mich ist das nicht nur ein gutes Beispiel für
gelebte interkommunale Zusammenarbeit, sondern auch
exemplarisch für die vielen Potenziale, die in der
Verwaltung durch Digitalisierung gehoben werden können“,
so Stadtdirektor, Feuerwehr- und
Digitalisierungsdezernent Martin Murrack.
Das
Telenotarztsystem ermöglicht dem Rettungsdienst am
Einsatzort, einen erfahrenen Notarzt digital zu
konsultieren. Es gibt drei Einsatzspektren:
Primäreinsätze: Das Rettungsdienstpersonal vor Ort
alarmiert den Telenotarzt in der Zentrale, der via
Echtzeit-Vitaldaten, Sprach- und ggf. Sichtkontakt die
Diagnostik absichert und Therapien wie Medikamentengaben
initiiert oder begleitet.
Unterstützende und
überbrückende Einsätze: Stellt der Rettungsdienst vor Ort
fest, dass ein Notarzt physisch benötigt wird und von der
Leitstelle nicht direkt mitalarmiert wurde, überbrückt
der Telenotarzt die Zeit bis zum Eintreffen des Kollegen
bzw. der Kollegin. Er kann sie zudem auch mit einer
Zweitmeinung unterstützen.
Verlegungsmanagement: Bei geforderten
Patientenverlegungen führt der Telenotarzt ein
standardisiertes Gespräch mit dem Klinikarzt, um die Wahl
des passenden Rettungsmittels/Fahrzeugs zu prüfen und so
Fehlplanungen zu vermeiden. Den Zustand kranker oder
verletzter Menschen aus der Ferne zu beurteilen und
Einsatzkräften vor Ort in akuten Notfallsituationen ein
verlässlicher und besonnener Begleiter zu sein, stellt
hohe Ansprüche an Telenotärzte.
Die
Bezeichnung unterliegt deshalb strengen Vorgaben des
Curriculums Telenotarzt der Bundesärztekammer (BÄK).
Voraussetzungen für die Tätigkeit als Telenotarzt sind
die Anerkennung als Facharzt sowie die
Zusatzweiterbildung Notfallmedizin, mindestens zwei Jahre
regelmäßige und andauernde Tätigkeit als Notarzt mit
wenigstens 500 eigenständig absolvierten Notarzteinsätzen
und Erfahrung in der eigenverantwortlichen Führung von
Personen.
Darauf aufbauend kann die
Qualifikation zum Telenotarzt im Rahmen eines speziellen
Lehrgangs erworben werden. Die Stadt Krefeld ist
Kernträgerin des Projekts, da die 2016 eröffnete
integrierte Leitstelle in Krefeld optimale technische und
räumliche Bedingungen für eine Telenotarztzentrale
bietet. Neben dem Betrieb des Standorts übernimmt sie
unter anderem die Projektkoordination, Abrechnung und
Dienstplanung und führt Verhandlungen mit den
Kostenträgern.
Des Weiteren organisiert sie
die Öffentlichkeitsarbeit und das Marketing für den
Telenotarzt Niederrhein. Außerdem ist Krefeld für die
Aus- und Fortbildung der Telenotärzte sowie die
Personalgewinnung und -verwaltung zuständig. Das Projekt
wird kollektiv von allen Mitgliedern der
Trägergemeinschaft vorangetrieben.
|
|
Treffen des Arbeitskreises
der Pankreatektomierten (AdP) Rhein-Ruhr Duisburg
im
BETHESDA Krankenhaus
|
|
Diagnostik von Pankreasrankungen
Duisburg, 17. Januar 2025 - Die Bauchspeicheldrüse ist
eines der zentralen Organe des menschlichen Körpers und
erfüllt lebenswichtige Aufgaben – von der Produktion von
Verdauungsenzymen bis hin zur Regulation des
Blutzuckerspiegels. Erkrankungen wie chronische
Entzündungen, zystische Tumoren oder
Bauchspeicheldrüsenkrebs können diese Funktionen stark
beeinträchtigen und stellen oft eine große
Herausforderung dar.
Um Betroffenen und
Interessierten wertvolle Unterstützung zu bieten, lädt
der „Arbeitskreis der Pankreatektomierten (AdP)
Rhein-Ruhr Duisburg“ am BETHESDA Krankenhaus Duisburg am
27. Januar 2025 zu seinem zweiten Treffen ein. Die
Veranstaltung bietet ein breit gefächertes Programm mit
Vorträgen von Experten des BETHESDA sowie eine offene
Fragerunde. Die Themen reichen von modernen
Diagnoseverfahren bis hin zu praxisnahen Informationen
über Diabetes, Enzymtherapie, Ernährung und
Krebstherapien. Ziel ist es, den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern praxisnahe Informationen und konkrete
Hilfestellungen zu bieten, um die Herausforderungen im
Alltag besser bewältigen zu können.
Vor Ort
stehen Experten des BETHESDA Krankenhauses für Vorträge
und eine offene Fragerunde zur Verfügung. Mit dabei sind:
Dr. med. Abdurrahman Sagir (Chefarzt der Klinik für
Gastroenterologie), Dr. med. Gernot Rott (Leitender
Oberarzt der Zentralen Abteilung für Radiologie), Hüseyin
Aladag (Leitung Sektion Allgemeine Innere Medizin und
Endokrinologie) und Ralf Hartwig (Leitung Sektion
Onkologie). Die Moderation übernehmen Prof. Dr. Simon
Schimmack, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und
Viszeralchirurgie sowie Leiter des Onkologischen Zentrums
und des Pankreaskrebszentrums, und Rüdiger Schwenn,
Regionalgruppenleiter des Arbeitskreises der
Pankreatektomierten.
Eckdaten der Veranstaltung
Titel: 2. Treffen Arbeitskreis der Pankreatektomierten
Rhein-Ruhr Duisburg: Diagnostik von Pankreaserkrankungen
Datum & Uhrzeit: Montag, 27. Januar 2025, 17.00-19.00 Uhr
Ort: Eventraum im BETHESDA Krankenhaus Duisburg (vom
Haupteingang ausgeschildert), Heerstraße 219, 47053
Duisburg
Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung
ist nicht erforderlich.
Mit dieser Veranstaltung
setzt der Arbeitskreis der Pankreatektomierten Rhein-Ruhr
Duisburg seine Aufgabe fort, eine vertrauensvolle
Anlaufstelle für Betroffene zu schaffen und den Austausch
zwischen Betroffenen und Experten zu fördern.
Über
den Arbeitskreis der Pankreatektomierten
Der
Arbeitskreis der Pankreatektomierten (AdP) Rhein-Ruhr
Duisburg wurde im April 2024 am BETHESDA Krankenhaus
gegründet und versteht sich als Plattform für
Information, Austausch und gegenseitige Unterstützung.
Die Initiative richtet sich nicht nur an Patientinnen und
Patienten, die eine teilweise oder vollständige
Entfernung der Bauchspeicheldrüse (Pankreatektomie)
hinter sich haben oder vor einem solchen Eingriff stehen,
sondern auch an alle, die mit anderen Erkrankungen der
Bauchspeicheldrüse konfrontiert sind.
#verbundenstark: Der Verbund Evangelisches Klinikum
Niederrhein und BETHESDA Krankenhaus deckt an insgesamt
vier Standorten mit fünf Krankenhäusern und einer
Vielzahl an Fachkliniken ein breites medizinisches
Spektrum ab. Zum Verbund gehören: Das BETHESDA
Krankenhaus Duisburg, das Evangelische Krankenhaus
Duisburg-Nord, das Herzzentrum Duisburg, das Johanniter
Krankenhaus Oberhausen und das Evangelische Krankenhaus
Dinslaken.
|
|
Feingefühl auf vier Pfoten –
Besuchshund Hannes begleitet Palliativpatient:innen
|
|
Duisburg, 15.
Januar 2025 - Seit kurzem sorgt ein besonderes
Teammitglied auf der Palliativstation der Helios St. Anna
Klinik für bewegende Momente: Besuchshund Hannes. Jeden
Mittwoch ist er nun vor Ort und schenkt Patient:innen
wertvolle Augenblicke der Ruhe und Wärme.
Das
graue Fell glänzt, seine feine Nase vibriert – Hannes
macht sich ein „Geruchs“-Bild von seiner Umgebung und
setzt sich dann entspannt neben Isabel Meßthaler, seine
Besitzerin. Alles gut hier auf dem Stationsflur, scheint
er sagen zu wollen. Hannes ist ein speziell ausgebildeter
Besuchshund und seit kurzem Teil des Teams der
Palliativstation an der Helios St. Anna Klinik in
Duisburg-Huckingen. Dafür braucht der freundliche
Mittelpudel spezielle Voraussetzungen wie innere
Gelassenheit, Neugier auf Menschen und vor allem
tierisches Feingefühl.
Diese Attribute
brachte Hannes schon von Beginn an mit, verstärkt und
ergänzt wurden sie dann in speziellen
Besuchshund-Lehrgängen, die er und sein Frauchen
besuchten. Nach der offiziell bestandenen Prüfung begann
für Hannes seine neue Berufung, die ihn nun einmal
wöchentlich in die Huckinger Klinik führt. Bevor er dort
immer mittwochs auf Patient:innen trifft, darf er sich
bei ausgiebigen Spaziergängen mit seinem Frauchen
ordentlich austoben, um ausgeglichen auf der Station zu
starten. Nach seiner Ankunft wird im Team besprochen,
welche Patient:innen von seinem Besuch heute besonders
profitieren könnten.

Dann geht es los in die jeweiligen Zimmer. Und dort
entfaltet sich immer wieder ein besonderer Zauber: Hannes
schafft es auf einzigartige Weise, sich ganz auf die
individuellen Bedürfnisse und Situationen der erkrankten
Menschen einzulassen. Auch Isabel Meßthaler, die ihren
Hund schon lang kennt, ist es jedes Mal wieder aufs Neue
erstaunlich: „Mal setzt er sich nur behutsam an die Seite
eines Patientenbettes, mal fordert er zum aktiven
Streicheln auf. Hannes hat ein unglaubliches Gespür für
die jeweilige Situation.“
Eine Fähigkeit, die
vor allem bei palliativen Patient:innen in ihren letzten
Stunden viel bewirkt und ihnen Trost und Geborgenheit
schenkt. Seine Anwesenheit wirkt beruhigend und spendet
Kraft – nicht nur bei den Sterbenden selbst, sondern auch
für die Angehörigen, die ihre Liebsten auf diesem
schweren Weg begleiten. Besonderes Licht in den Alltag
bringt Hannes nicht zuletzt auch für die
Mitarbeiter:innen der Palliativstation, sie freuen sich
jede Woche auf das fellige Teammitglied, das stets für
gute Stimmung sorgt. Dabei genießt auch Hannes verzückt
die ausgiebigen Streicheleinheiten, die ihm die
Kolleg:innen nur zu gerne zukommen lassen.
Der
Einsatz eines Besuchshundes ist Teil der Erweiterung des
Angebots auf der Palliativstation der Helios St. Anna
Klinik. Neben der tiergestützten Therapie soll es bald
zudem die Möglichkeit zur Musiktherapie geben, um
Patientinnen und Patienten noch besser begleiten zu
können. Zusätzlich wird der palliative Konsildienst, der
bereits seit vielen Jahren in der Helios St. Anna Klinik
etabliert ist, auf die anderen Duisburger
Helios-Standorte ausgeweitet werden, um so auch
klinikübergreifend eine bestmögliche palliative
Versorgung zu gewährleisten.
Hannes hat dabei
einen festen Platz in diesem Team gefunden – so sehr,
dass er bereits auf der Fotowand der Palliativstation
verewigt wurde. Eine kleine Geste, die zeigt: Der
Besuchshund ist gekommen, um zu bleiben und wird auch in
Zukunft viele Leben bereichern.
Mehr erfahren:
Palliativmedizin | Helios St. Anna Klinik Duisburg
|
|
Neue Selbsthilfegruppe für
Schlaganfallbetroffene am Ev. Krankenhaus Duisburg-Nord
|
|
Duisburg, 13.
Januar 2025 - Ein Schlaganfall kommt meist plötzlich und
verändert das Leben vieler Betroffener und ihrer
Angehörigen grundlegend. Neben der medizinischen
Behandlung stehen viele von ihnen vor der
Herausforderung, die emotionalen, körperlichen und
sozialen Folgen zu bewältigen. Um in dieser schwierigen
Zeit Unterstützung zu bieten, hat das Evangelische
Krankenhaus Duisburg-Nord eine neue Selbsthilfegruppe ins
Leben gerufen.
Das Angebot der Klinik für
Neurologie soll Betroffenen und ihren Angehörigen helfen,
sich auszutauschen, wertvolle Informationen zu erhalten
und gemeinsam neue Wege für den Alltag nach einem
Schlaganfall zu finden.
Die
Selbsthilfegruppe bietet die Möglichkeit, sich in
entspannter und wertschätzender Atmosphäre auszutauschen,
Unterstützung zu finden und gemeinsam Antworten auf
wichtige Fragen zu erhalten. „Mit diesem Angebot wollen
wir mehr als nur Informationslücken schließen. Wir
schaffen einen Raum, in dem sich Betroffene und
Angehörige verstanden und gut aufgehoben fühlen können“,
sagt Dr. Corina Kiesewalter, Chefärztin der Klinik für
Neurologie. „Unser Ziel ist es, gemeinsam die Versorgung
und die Lebensqualität nach einem Schlaganfall spürbar zu
verbessern“.

Dr. Corina Kiesewalter, Chefärztin der Klinik für
Neurologie am Ev. Krankenhaus Duisburg-Nord (Quelle:
EVKLN)
Vielfältiges Angebot für Betroffene und
Angehörige
Die Selbsthilfegruppe trifft sich jeden
ersten Dienstag im Monat von 16.30 bis 18.00 Uhr
(erstmalig am 4. Februar 2025). Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer erhalten viele Möglichkeiten, um ihre
persönlichen Anliegen zu besprechen, wie z.B.
•
Erfahrungsaustausch mit anderen Betroffenen,
• Aufbau
eines unterstützenden Netzwerkes,
• Informationen über
neue Therapieansätze und Medikamente,
• Vorträge von
Expertinnen und Experten zu therapeutischen und
rehabilitativen Themen.
Details zur
Selbsthilfegruppe Schlaganfall
Wann: jeden ersten
Dienstag von 16.30 bis 18.00 Uhr (erstmalig am 4. Februar
2025)
Wo: Evangelisches Krankenhaus Duisburg-Nord,
Klinik für Neurologie – Konferenzraum U208/209 (neben dem
Sekretariat der Klinik), Fahrner Straße 133, 47169
Duisburg
Kostenfrei und ohne Anmeldung.
Unterstützung durch Schlaganfalllotse
Darüber hinaus
ergänzt das Krankenhaus sein Versorgungsangebot durch
eine neue Sprechstunde auf der Stroke Unit der Klinik für
Neurologie, die jeden Dienstag von 16 bis 18 Uhr
stattfindet. Der Schlaganfall-Lotse Erich Beyers, der vor
einigen Jahren selbst einen Schlaganfall erlitten hat,
unterstützt Betroffene und Angehörige mit seinen
persönlichen Erfahrungen und fachlichem Rat.
Die
Stroke Unit des Evangelischen Krankenhauses Duisburg-Nord
ist eine Spezialstation zur Akutbehandlung von
Schlaganfallpatientinnen und -patienten. Hier arbeitet
ein interdisziplinäres Team aus Medizin, Pflege und
Therapie eng zusammen, um mit modernster Diagnostik und
Therapie schnell lebensrettende Maßnahmen einzuleiten und
Folgeschäden zu minimieren.
|
|
Gute Vorsätze: auch an Früherkennung denken
Weniger Süßes, mehr Sport |
|
Heidelberg/Duisburg, 7. Januar 2025 -
Der Jahreswechsel ist für viele ein guter Anlass, die
eigene Gesundheit in den Blick zu nehmen. Neben einem
gesunden Lebensstil bietet die Krebsfrüherkennung
gesundheitliche Chancen. Zu den Angeboten informieren der
Krebsinformationsdienst des Deutschen
Krebsforschungszentrums (DKFZ) und der
Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Stefan
Schwartze, MdB. Krebsfrüherkennungsuntersuchungen richten
sich an Menschen, die keine Beschwerden haben.
Das Ziel ist es, den Krebs so früh zu erkennen, dass
er erfolgreich behandelt werden kann. Das Screening
erhöht somit die Heilungschancen. Oft sind bei frühem
Krebs Therapien möglich, die weniger belastend sind. Das
hilft, die Lebensqualität zu bewahren. Stefan Schwartze
weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig
Früherkennungsuntersuchungen sind: „Im vergangenen
Frühjahr habe ich anlässlich des Hautkrebsmonats Mai an
einer Hautkrebsfrüherkennung teilgenommen – der ersten
für mich überhaupt. Ein auffälliger Befund führte zu
einem kurzen operativen Eingriff.“
•
Ab 35 Jahren kann jeder alle zwei Jahre eine
Hautkrebsfrüherkennung in Anspruch nehmen. Angebote zur
Krebsfrüherkennung – für jeden In Deutschland gibt es ein
gesetzliches Krebsfrüherkennungsprogramm. Jeder
gesetzlich Versicherte kann ab einem bestimmten Alter und
in festgelegten Zeitabständen die einzelnen
Untersuchungen wahrnehmen. Die Teilnahme an den
Untersuchungen auf Gebärmutterhalskrebs, Darmkrebs,
Brustkrebs, Hautkrebs und Prostatakrebs ist freiwillig
und kostenlos.
•
Für Frauen: Ab 20 Jahren können sie regelmäßig an
gynäkologischen Untersuchungen zur Früherkennung von
Gebärmutterhalskrebs teilnehmen, ab 35 Jahre wird
zusätzlich ein Test auf Humane Papillomviren (HPV) alle 3
Jahre angeboten. In Bezug auf Brustkrebs kann ab 30
Jahren jährlich das Abtasten der Brust wahrgenommen
werden und zwischen 50 und 75 Jahren alle zwei Jahre ein
Mammographie-Screening.
•
Für Männer: Ab 45 Jahren können sich Männer jährlich im
Hinblick auf Prostatakrebs untersuchen lassen. Für Alle:
Ab 35 Jahren kann jeder alle zwei Jahre seine Haut im
Hinblick auf Hautkrebs betrachten lassen. Zur
Früherkennung von Darmkrebs haben Männer ab 50 Jahren und
Frauen ab 55 Jahren Anspruch auf eine Darmspiegelung.
Alternativ kann ab 50 Jahren regelmäßig ein Test auf
verborgenes Blut im Stuhl durchgeführt werden.
•
Zu den Früherkennungsuntersuchungen von Brustkrebs,
Darmkrebs und Gebärmutterhalskrebs laden die gesetzlichen
Krankenkassen in regelmäßigen Abständen persönlich und
schriftlich ein. Mit der Einladung erhalten die
Versicherten ein Informationsschreiben, das über Nutzen
und Risiken der jeweiligen Untersuchung aufklärt. Das
Krebsfrüherkennungsprogramm ist nicht starr: Gibt es
neuere Erkenntnisse aus aussagekräftigen Studien, können
sich die Empfehlungen daran anpassen.
So
wurde zum Beispiel erst im letzten Jahr das
Mammographie-Screening für Frauen im Alter von 70 bis 75
Jahren erweitert. Früherkennung kann auch Vorsorge sein
Von Krebsvorsorge spricht man, wenn durch die
Früherkennungsuntersuchung bereits Vorstufen von Krebs
erkannt werden, etwa erste Gewebeveränderungen. Solche
Untersuchungen sind bislang nur bei der Früherkennung von
Gebärmutterhalskrebs, Hautkrebs und Darmkrebs möglich.
Besonders überzeugend ist die Darmspiegelung:
Während der Untersuchung können nicht nur Darmkrebs und
Krebsvorstufen (Polypen) erkannt werden – zudem ist eine
Entfernung der noch gutartigen Polypen direkt möglich.
Das verhindert wirksam, dass bösartiger Darmkrebs
entsteht. „In Deutschland sind die
Darmkrebs-Neuerkrankungen seit Einführung der
Vorsorge-Koloskopie im Jahr 2002 bereits um etwa 30
Prozent zurückgegangen. Dennoch erkranken pro Jahr immer
noch ca. 55.000 Menschen an Darmkrebs. Bei einer besseren
Nutzung der Darmkrebs-Vorsorge könnten noch sehr viel
mehr Darmkrebsfälle verhindert werden“, sagt Dr. Susanne
Weg-Remers. Sie leitet den Krebsinformationsdienst des
Deutschen Krebsforschungszentrums.
Über die
Hälfte der Erwachsenen im Alter ab 50 Jahren hat in
Deutschland innerhalb der letzten zehn Jahre eine
Koloskopie in Anspruch genommen (52,6 %); etwa 15 % zur
Früherkennung, der überwiegende Anteil zur Abklärung von
Beschwerden. Als nachteilig wird der relativ hohe
Aufwand, vor allem auch bei der Vorbereitung
(Darmreinigung am Vorabend) empfunden. Zudem besteht ein
sehr geringes Risiko von Komplikationen bei der
Untersuchung.
„Ich möchte alle Menschen
ausdrücklich dazu ermutigen, eine Darmspiegelung in
Anspruch zu nehmen. Auch wenn der Gedanke daran zunächst
abschreckend wirken mag, ist es eine wichtige und
effektive Maßnahme zur Vorsorge und Früherkennung von
ernsthaften Erkrankungen“, betont Stefan Schwartze.
Informieren und dann? Neben den Vorteilen der
Früherkennung können mit ihr auch Nachteile und
Belastungen verbunden sein. Keine Methode ist
hundertprozentig zuverlässig: Fehlalarm und Überdiagnose
kommen vor und führen zu weitergehenden Untersuchungen
und unter Umständen sogar Krebstherapien.
Auch wenn eine frühe Diagnose die Aussicht auf Heilung
erhöht, eine Garantie für Heilung bietet sie nicht.
Neutrale, wissenschaftlich abgesicherte und gut
verständliche Informationen können bei der Entscheidung
für oder gegen eine Krebsfrüherkennungsmaßnahme helfen.
Umfassende Informationen bieten:
Krebsinformationsdienst:
Krebsvorsorge und Krebsfrüherkennung
Bundesministerium für Gesundheit:
Krebsfrüherkennung
Früherkennung kann Leben
retten Eine regelmäßige Teilnahme an
Früherkennungsuntersuchungen erhöht die Chancen für den
Einzelnen, dass eine Krebserkrankung geheilt werden kann
– da sie rechtzeitig entdeckt wurde. Und für das neue
Jahr: Eine gesunde Ernährung und Bewegung fördern die
Gesundheit zusätzlich!
|
|
Patientenfürsprecher bzw.
Patientenfürsprecherin für das BETHESDA Krankenhaus
Duisburg gesucht
|
|
Duisburg, 7. Januar 2025 - Für den
Verbund Evangelisches Klinikum Niederrhein und BETHESDA
Krankenhaus Duisburg hat das Wohl seiner Patientinnen und
Patienten oberste Priorität. Um eine zusätzliche,
unabhängige Anlaufstelle für Anregungen oder Beschwerden
zu schaffen, sucht der Verbund eine ehrenamtliche
Patientenfürsprecherin bzw. einen ehrenamtlichen
Patientenfürsprecher für den Standort BETHESDA
Krankenhaus in Duisburg-Hochfeld. Dieses Ehrenamt
übernimmt eine wichtige Rolle im Dialog zwischen
Patientinnen und Patienten und dem Krankenhaus.
Der Patientenfürsprecher bzw. die
Patientenfürsprecherin agiert unabhängig und neutral,
arbeitet ehrenamtlich und ist nicht beim Krankenhaus
angestellt. Ziel der Tätigkeit ist es, Patientinnen und
Patienten bei der Wahrnehmung ihrer Rechte zu
unterstützen, bei Konflikten zu vermitteln und Defizite
offen anzusprechen. Eine regelmäßige Anwesenheit im
Krankenhaus ist erforderlich, um den direkten Kontakt mit
den Patientinnen und Patienten auf den Stationen zu
ermöglichen.
Die Tätigkeit erfordert keine
medizinische Vorbildung, jedoch ein hohes Maß an
Einfühlungsvermögen, Kommunikationsstärke und
Objektivität. Wichtig ist die Fähigkeit, sachlich und
lösungsorientiert zu vermitteln. Das BETHESDA Krankenhaus
Duisburg möchte mit diesem Aufruf seiner gesetzlichen
Verpflichtung nach § 5 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW
nachkommen, wonach Krankenhäuser verpflichtet sind,
unabhängige Beschwerdestellen für Patientinnen und
Patienten einzurichten. Rückfragen beantwortet Herr Ronny
Schneider, Patientenfürsprecher im Verbund Evangelisches
Klinikum Niederrhein.
Die Kontaktdaten
lauten: Ronny Schneider, Tel.: 0178-9374887
E-Mail:
mail@ronnyschneider.info
#verbundenstark: Der
Verbund Evangelisches Klinikum Niederrhein und BETHESDA
Krankenhaus deckt an insgesamt 4 Standorten mit einer
Vielzahl an Fachkliniken ein breites medizinisches
Spektrum ab. Zum Verbund gehören: Das BETHESDA
Krankenhaus Duisburg, das Evangelische Krankenhaus
Duisburg-Nord, das Herzzentrum Duisburg, das Johanniter
Krankenhaus Oberhausen und das Evangelische Krankenhaus
Dinslaken.
|
|