|

|
|
|
|
Land senkt die Hürden für Volksbegehren |
|
Innenminister Jäger: "Instrumente unmittelbarer
politischer Einflussnahme tragen dazu bei, dass Demokratie
lebendig bleibt"
Düsseldorf/Duisburg 22. Dezember 2011 - Für die Bürgerinnen
und Bürger in NRW wird es künftig einfacher, sich auf
Landesebene unmittelbar an der politischen Willensbildung zu
beteiligen: Der nordrhein-westfälische Landtag hat jetzt ein
Gesetz beschlossen, das die formalen Hürden für
Volksbegehren senkt.
„Volksbegehren eröffnen den Bürgerinnen und Bürgern in NRW
die Möglichkeit, den Gesetzgeber auf direktem Wege zu einem
konkreten Gesetzesvorhaben zu veranlassen“, erklärte
Innenminister Ralf Jäger heute (22.12.) in Düsseldorf. „Als
Instrument unmittelbarer politischer Einflussnahme tragen
sie dazu bei, dass Demokratie lebendig bleibt.“
Für ein wirksames Volksbegehren müssen die Initiatoren in
NRW Unterstützungsunterschriften von etwa einer Million
Stimmberechtigten vorlegen. Das verabschiedete Gesetz
erleichtert die Unterschriftensammlung: So wird die Frist
für deren Erfassung in amtlichen Listen von bisher acht auf
achtzehn Wochen verlängert. Daneben wird eine freie
Unterschriftensammlung zugelassen, für die den Initiatoren
ein ganzes Jahr zur Verfügung steht.
„Diese Erleichterungen machen es künftig einfacher, die
notwendige Unterstützung für das eigene Anliegen zu finden“,
erklärte der Minister.
Die kurze Eintragungsfrist und der zwingende Gang zum Amt
hätten in der Vergangenheit für viele eine hohe Hemmschwelle
dargestellt. Laut Jäger sind die neuen Erleichterungen ein
erster Schritt, Volksbegehren zu vereinfachen.
„Unser mittelfristiges Ziel muss es bleiben, auch die hohe
Unterschriftenhürde zu senken“, betonte der Minister. Das
derzeit geforderte Quorum von etwa einer Million Stimmen sei
zu groß. Absenken lässt sich das Quorum aber nur durch eine
Änderung der nordrhein-westfälischen Verfassung.
„Dafür ist ein breiter parlamentarischer Konsens
erforderlich“, führte der Minister aus. „Wir werden weiter
daran arbeiten.“
Seit der Übernahme der Regierungsgeschäfte im Juli 2010
setzt sich die Landesregierung dafür ein, dass die
Beteiligungsmöglichkeiten von Bürgerinnen und Bürgern
gestärkt werden. Anfang Dezember hatte der
nordrhein-westfälische Landtag die Hürden für kommunale
Bürgerbegehren und Bürgerentscheide gesenkt. „Nicht
theoretische Optionen entscheiden über die Qualität von
Demokratie, sondern die tatsächliche Beteiligung der
Menschen“, betonte der Minister.
Anmerkungen der Redaktion:
Schon im Vorfeld des Bürgerbegehrens zur Abwahl des
umstrittenen Oberbürgermeisters Adolf Sauerland in Duisburg
war in einem Gespräch dem Minister die demokratisch wenig
nachvollziehbare hohe Hürde zur Abwahl eines
Oberbürgermeisters, die weit über der Zahl lag, die den OB
in Duisburg 2009 gewählt hatten, dargestellt worden. Es
solle keine "lex specialis" (Sauerland) geben, sagte der
Minister damals und konstruierte eine abenteuerliche
Möglichkeit.
Es ist immer wieder erstaunlich, wie Politiker Meinungen des
Bürgers dermaßen falsch einschätzen. Was bleibt ist die
Erkenntnis, dass der stete Tropfen doch den Stein der
Erkenntnis höhlen kann, wobei es egal sein kann, woher diese
Tropfen kamen. Harald Jeschke
|
|
Stärkungspaktgelder werden in dieser Woche ausgezahlt |
|
Düsseldorf/Duisburg 21. Dezember 2011 - Erstmals in der
Geschichte des Landes hilft die Landesregierung gezielt 34
Städten und Gemeinden, die überschuldet sind oder denen die
Überschuldung bis zum Jahr 2013 droht. Heute (21.12.) haben
die Kommunen ihre Bescheide von den Bezirksregierungen
erhalten. Morgen werden die Mittel ausgezahlt.
„Wir haltenWort: Die Kommunen, deren Not am größten ist,
können sofort mit unserer Hilfe rechnen“, sagte
Kommunalminister Jäger in Düsseldorf bei der Einbringung des
Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2012 in den Landtag.
Jäger erneuerte das Versprechen der Landesregierung, die
Kommunen nach Kräften bei der Sanierung ihrer Haushalte zu
unterstützen.
„Die Zuweisungen aus dem GFG, die alle Kommunen in
Nordrhein-Westfalen erhalten, sind mit 8,4 Milliarden Euro
so hoch wie noch nie in der Geschichte des Landes. Mit der
neuen Systematik sorgen wir für mehr Gerechtigkeit bei der
Verteilung der Gelder.“Die Modellrechnung für das GFG hatte
die Landesregierung bereits im Oktober bekannt gegeben,
damit die Kommunen besser für ihre Haushalte planen konnten.
„Mit der zusätzlichen Unterstützung durch den Stärkungspakt
haben auch 34 hoch belastete Städte und Gemeinden wieder die
Chance, zu einer selbstbestimmten Haushaltspolitik
zurückzukommen“, erklärte Jäger. Die 34
Stärkungspakt-Kommunen haben nun die Aufgabe, mit Hilfe der
Landesmittel einen ausgeglichenen Haushalt zu erzielen.
„Wir werden uns nicht damit abfinden, dass in immer mehr
Kommunen die Aufsichtsbehörden Haushaltsentscheidungen
treffen. Wir wollen die kommunale Demokratie stärken und die
Räte wieder in die Lage versetzen, eigenverantwortlich für
die Bürgerinnen und Bürger zu handeln“, machte Jäger
deutlich.
80 Prozent des Geldes auf der Grundlage einer
finanzwissenschaftlichen Berechnung der Professoren Dr.
Martin Junkernheinrich und Dr. Thomas Lenk verteilt. 20
Prozent der Landeshilfe werden als Grundbetrag über einen
Einwohnerschlüssel gezahlt. Dadurch wird erreicht, dass auch
die kleineren Gemeinden ausreichende Leistungen aus dem
Stärkungspakt erhalten.
|
|
Raum der Stille im Landtag Nordrhein-Westfalen |
|
Düsseldorf/Duisburg 20. Dezember 2011 - Ein Raum der Stille
wurde heute im Landtag Nordrhein-Westfalen feierlich seiner
Bestimmung übergeben. Er steht nicht nur den Abgeordneten
und den Beschäftigten der Fraktionen und der
Landtagsverwaltung, sondern auch Besucherinnen und Besuchern
als Ort der Nachdenklichkeit und der Besinnung zur
Verfügung, wie Landtagspräsident Eckhard Uhlenberg in seiner
Begrüßungsansprache vor geladenen Gästen sagte. Neben
aktuellen und ehemaligen Abgeordneten, Vertretern der
Landesregierung und weiteren Vertretern des öffentlichen
Lebens nahmen auch Rolf Krebs, Leiter des Evangelischen
Büros, und Martin Hülskamp, Direktor des Katholischen Büros,
sowie Dr. Fritz Behrens, Präsident der Kunststiftung, an der
Veranstaltung teil.
Der Landtagspräsident dankte Prof. Gotthard Graubner, der
den Raum der Stille in Ausführung, Ausstattung und Bildern
künstlerisch gestaltet habe. Der international renommierte
Künstler habe mit zurückhaltenden bildnerischen und
ansprechenden architektonischen Ausdrucksmitteln einen Raum
geschaffen, der zu Meditation und innerer Einkehr anrege.
Als Ort der Sammlung für Menschen mit ganz unterschiedlichen
Anschauungen sei der Raum der Stille nicht unmittelbar
religiös bestimmt oder gar konfessionsgebunden, stehe aber
natürlich allen Glaubensgemeinschaften für Gebet und
Begegnung offen, so Uhlenberg weiter. Der Raum der Stille
sei im hektischen Parlamentsbetrieb mit seiner Flut von
Nachrichten und Meinungen, Dokumenten und Beschlüssen,
Forderungen und Kontroversen ein Ort des Innehaltens. Das
individuelle Bedürfnis nach Abstand und Vergewisserung finde
hier die willkommene Chance.
Biographische Angaben zu Prof. Gotthard Graubner:
Geb.: 13. Juni 1930 in Erlbach, Vogtland
1947 bis 1948 Studium an der Hochschule für Bildende Künste,
Berlin (West)
1948 bis 1951 Dresdner Kunstakademie
1954 bis 1959 Kunstakademie Düsseldorf
1964 bis 1965 Kunsterzieher Lessing-Gymnasium, Düsseldorf
1965 bis 1976 Hochschule für bildende Künste, Hamburg, bis
1969 Lehrauftrag,
danach Professur
1973 Mitglied der Akademie der Bildenden Künste in Berlin
ab 1976 Professor für Freie Malerei, Staatliche
Kunstakademie Düsseldorf
1988 schuf Graubner für den Amtssitz des Bundespräsidenten
im Schloss Bellevue in Berlin ein Gemälde. Für die
Protokoll- und Sitzungsräume des Bundestags kreierte er
einen großen, querformatigen Farbraumkörper, sogenannte
„Kissenbilder“.
Graubner hat mehrere Auszeichnungen erhalten; er lebt und
arbeitet in Düsseldorf und auf der Museumsinsel Hombroich in
Neuss-Holzheim.
|
|
Bürgerbegehren in NRW werden einfacher |
|
Düsseldorf/Duisburg 9. Dezember 2011 - Bürgerinnen und
Bürger in NRW haben es künftig einfacher, unmittelbar an der
politischen Willensbildung mitzuwirken: Der
nordrhein-westfälische Landtag hat gestern Abend (8.
Dezember) beschlossen, die Hürden für kommunale
Bürgerbegehren und Bürgerentscheide zu senken.
„Eine lebendige Demokratie lebt von aktiven
Mitwirkungsmöglichkeiten. Sie bieten die Chance, aus
Betroffenen Beteiligte zu machen“, betonte Kommunalminister
Ralf Jäger in Düsseldorf. Die Anforderungen an das
erforderliche Quorum für einen Bürgerentscheid wurden
gesenkt: Bislang war die Zustimmung von 20 Prozent der
Stimmberechtigten erforderlich. Künftig ist das Quorum nach
Größe der Städte gestaffelt. In Städten mit über 50.000 bis
zu 100.000 Einwohnern müssen mindestens 15 Prozent der
Stimmberechtigten zustimmen. Für Großstädte mit mehr als
100.000 Einwohnern sinkt das Quorum auf zehn Prozent der
Stimmberechtigten.
„Bürgerinnen und Bürger, die ein Bürgerbegehren initiieren,
haben künftig eine realistische Chance, ihr Anliegen auch
durchzusetzen“, erklärte Jäger. Der Katalog der Themen, über
die ein Bürgerbegehren bisher unzulässig war, wurde
bereinigt und gestrafft. So dürfen die Bürgerinnen und
Bürger über die Frage, ob ein Bauleitplanverfahren
durchgeführt wird, in Zukunft entscheiden. Sie können eine
erwünschte Planung anstoßen, haben aber auch die
Möglichkeit, eine nicht konsensfähige Planung zu verhindern.
„Es ist ein Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger, in
wesentlichen Fragen städtischer Entwicklung mit zu
entscheiden.
Jetzt stärken wir ihren Einfluss zu Beginn eines
Planungsprozesses“, führte der Minister aus. Eine weitere
Erleichterung liegt darin, dass der bisher erforderliche
Vorschlag zur Deckung der Kosten eines Bürgerbegehrens
entfällt.
An seine Stelle tritt eine Kostenschätzung der Verwaltung.
Sie wird die nötigen Informationen über den Aufwand des
geplanten Vorhabens liefern. „Ich bin davon überzeugt, dass
die Bürgerinnen und Bürger ein gutes Gespür für die
finanzielle Machbarkeit von kommunalen Projekten haben“,
unterstrich der Minister.
|
|
|
|
Hilfspaket für überschuldete Städte und Gemeinden ist
geschnürt |
|
Düsseldorf/Duisburg 8. Dezember 2011 - Das
Stärkungspaktgesetz der Landesregierung ist heute (8.
Dezember) vom Landtag beschlossen worden. Für notleidende
Städte und Gemeinden steht damit fest, dass sie in den
kommenden zehn Jahren mit finanzieller Hilfe des Landes bei
der Sanierung ihrer Haushalte rechnen können.
„Heute ist ein guter Tag für die NRW-Kommunen. Gemeinsam
schlagen wir einen klaren Kurs ein mit dem Ziel, die
kommunale Selbstverwaltung zu stärken“, betonte
Kommunalminister Jäger in Düsseldorf. Das Land hilft
überschuldeten und von Überschuldung bedrohten Städten und
Gemeinden mit Finanzspritzen. Hierfür werden bis zum Jahr
2020 insgesamt 5,85 Milliarden Euro aufgebracht. Im Gegenzug
müssen die Städte und Gemeinden ihre Haushalte bis zum Jahr
2020 sanieren. „Der Haushaltsausgleich ist machbar. Es wird
ein gemeinsamer Kraftakt, aber er lohnt sich“, sagte Jäger .
34 Städte und Gemeinden, die bereits überschuldet sind oder
bis 2013 überschuldet sein werden, erhalten noch im Dezember
ihre ersten Zahlungen. Bis zum 30. Juni 2012 müssen sie
einen Haushaltssanierungsplan erstellen, der aufzeigt, wie
der Haushaltsausgleich mit Hilfe des Landes spätestens bis
zum Jahr 2016 erreicht wird. In dieser ersten Phase zahlt
das Land eine Konsolidierungshilfe.
Spätestens im Jahr 2021 muss der Haushaltsausgleich ohne die
Konsolidierungshilfe des Landes erzielt sein. In dieser
zweiten Phase werden die Landesmittel schrittweise
reduziert. „Für Kommunen in dieser schwierigen
Haushaltssituation ist die Teilnahme zwingend. Im Interesse
aller Kommunen darf uns keine einzige Gemeinde aus dem Boot
kippen“, erläuterte der Kommunalminister. Gemeinden, denen
eine Überschuldung bis zum Jahr 2016 droht, können ihre
Teilnahme an der zweiten Stufe des Stärkungspakts bis zum
31. März 2012 beantragen. Ihre Haushaltssanierungspläne
müssen bis zum 30. September 2012 fertig sein. Darin muss
der Haushaltsausgleich mit Konsolidierungshilfe des Landes
bis zum Jahr 2018 dargestellt sein. Auch bei ihnen muss
spätestens im Jahr 2021 der Haushaltsausgleich ohne die
Konsolidierungshilfe des Landes erreicht werden.
Ab Ende 2013 sollen die Ergebnisse des Stärkungspakts
überprüft werden. „Dabei werden wir entscheiden, ob es eine
dritte Stufe mit weiteren teilnehmenden Städten und
Gemeinden gibt“, erläuterte Jäger. Die Landesregierung sorgt
mit einem breit angelegten Aktionsplan dafür, dass die
Kommunen ihre Finanzen konsolidieren können. Hierfür stellte
sie bislang rund eine Milliarde Euro bereit.
Kommunalminister Jäger: „Wir erwarten vom Bund, dass er auch
seine Verantwortung für die Kommunen stärker wahrnimmt. Er
muss die Kommunen beim enormen Anstieg der Soziallasten,
insbesondere bei der Eingliederungshilfe für behinderte
Menschen, finanziell unterstützen.“
|
|
Konsens hilft Kommunen aus der Schuldenfalle:
350 Millionen Euro könnten noch in 2011 ausgezahlt werden -
Duisburger Anteil 51,8 Mio. Euro |
|
Düsseldorf/Duisburg 29. November 2011 - Für die 34
nordrhein-westfälischen Kommunen in der größten finanziellen
Not könnten schon bald die ersten Mittel aus dem
Stärkungspakt Stadtfinanzen ausgezahlt werden. „Wenn der
Gesetzesentwurf mit den jetzt vorgelegten Änderungsanträgen
in der kommenden Woche vom Landtag beschlossen wird, kann
das Gesetz noch in diesem Jahr in Kraft treten“, erklärte
Kommunalminister Ralf Jäger heute (29. November) in
Düsseldorf das weitere Verfahren.
Die bereitgestellten 350 Millionen Euro Landesmittel würden
dann noch im Dezember ausgezahlt werden. „Die heutige
Einigung beweist: Die Landespolitik zeigt Verantwortung“,
sagte Jäger.
Die Mittel aus dem Stärkungspakt, mit denen Kommunen - die
überschuldet sind oder denen Überschuldung droht - in den
kommenden Jahren rechnen können, ergeben sich aus einer
Modellrechnung, die der Kommunalminister vorgestellt hat.
Danach bekommt die Stadt Oberhausen in den nächsten Jahren
65,5 Millionen Euro. Die kreisangehörige Stadt
Castrop-Rauxel erhält 12,7 Millionen Euro jährlich und die
Gemeinde Welver 405.000 Euro. Grundlage dafür ist der
Kompromiss, auf den sich die rot-grüne Koalition und die
FDP-Fraktion im Landtag geeinigt haben und der nach den
Worten Jägers einen „Durchbruch in der Bewältigung der
Finanzkrise der NRW-Kommunen“ darstellt.
Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes ist es jetzt
möglich, zielgerichtet den am stärksten verschuldeten
Kommunen zu helfen. Denn wer sich nicht mehr selbst aus der
Schuldenfalle befreien kann, der braucht Hilfe. „Wir halten
Wort: Die Kommunen, deren Not am größten ist, können sofort
mit unserer Unterstützung rechnen. Wir werden gezielt helfen
und nicht Geld mit der Gießkanne verteilen“, erklärte
Kommunalminister Jäger.
Doch die Hilfen gibt es nicht ohne Gegenleistung. Wie im
Stärkungspakt Stadtfinanzen vorgesehen, müssen die
Bürgermeister und Räte ihren Beitrag leisten. „Jetzt sind
die Kommunen am Zug“, stellte Jäger fest. „Die Kämmerer
müssen Vorschläge erarbeiten, wie in Zukunft ein
ausgeglichener Haushalt erzielt werden kann. Dann ist der
Rat in der Pflicht. Denn wir setzen auf eine selbstbestimmte
Haushaltspolitik und die Eigenverantwortung der Kommunen“,
unterstrich Jäger. Beim Erarbeiten der jeweiligen
Konsolidierungspläne vor Ort bietet das Land zur
Unterstützung eine professionelle Beratung durch eine
Task-Force an.
Das Konzept des Stärkungspaktes Stadtfinanzen basiert
wesentlich auf wissenschaftlichen Ergebnissen. So werden 80
Prozent des Geldes auf der Grundlage einer
finanzwissenschaftlichen Berechnung der Professoren Dr.
Martin Junkernheinrich und Dr. Thomas Lenk verteilt, die im
Februar 2011 ihr Gutachten „Haushaltsausgleich und
Schuldenabbau“ vorgelegt hatten. Das Gutachten war noch von
der Vorgängerregierung in Auftrag gegeben worden. 20 Prozent
der Landeshilfe werden als Grundbetrag über einen
Einwohnerschlüssel gezahlt. Dadurch wird erreicht, dass auch
die kleineren Gemeinden ausreichende Leistungen aus dem
Stärkungspakt erhalten.
Die Gutachter haben einen Mehrjahresdurchschnitt der
Haushaltsdaten der Jahre 2004 bis 2007 gebildet und bei den
Soziallasten auch noch die Daten des Jahres 2008
berücksichtigt. Ebenfalls eingerechnet wurde eine Prognose
zur Höhe und Entwicklung der Zinslast für
Liquiditätskredite. Auf diese Weise ergibt sich ein
konkretes und besonders umfassendes Bild der
Kommunalfinanzen. „Die Mittelverteilung wird hierdurch auf
eine breite Datengrundlage gestellt. So können wir
Einzelereignisse und konjunkturbedingte Schwankungen
ausgleichen“, betonte Jäger.
Der Stärkungspakt Stadtfinanzen ist bereits das zweite große
Hilfspaket, das die Landesregierung zur Unterstützung der
Kommunen auf den Weg gebracht hat. In einem ersten Schritt
hatte das Land unmittelbar nach dem Regierungswechsel den
kommunalen Steuerverbund um mehr als 300 Millionen Euro
jährlich aufgestockt. Hiervon profitieren alle Kommunen. Für
die 34 Gemeinden in der ersten Stufe des Stärkungspaktes
bedeutet dies jährliche Verbesserungen von 41,7 Millionen
Euro. Insgesamt erhalten sie im nächsten Jahr rund 1,6&
Milliarden Euro aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Für die
Stadt Oberhausen bedeutet dies 155 Millionen Euro, für
Castrop-Rauxel 51 Millionen Euro und Welver bekommt 3,8
Millionen Euro.
Außerdem können die Kommunen im Stärkungspakt Stadtfinanzen
die schrittweise ansteigende Übernahme der Soziallasten
durch den Bund einplanen. Der Bund wird ab 2014 die Ausgaben
im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung voll übernehmen. Träger dieser Aufgabe sind
die kreisfreien Städte und die Kreise. Sie können dann mit
zusätzlichen Einnahmen in Höhe von rund 78 Millionen Euro
jährlich rechnen. Für Oberhausen bedeutet dies
voraussichtlich elf Millionen Euro. Bei den kreisangehörigen
Kommunen werden indirekt Entlastungen bei der Kreisumlage
erwartet.
Dass eine Konsolidierung der Haushalte möglich ist, zeigt
ein Finanzgutachten für die Stadt Wuppertal, das Mitte
November veröffentlicht wurde. „Gemeinsam schaffen wir eine
realistische Perspektive. Es wird ein Kraftakt für Land und
Kommunen, aber er lohnt sich“, versicherte der
Kommunalminister.
Jäger appellierte erneut an den Bund: Denn gerade dessen
Gesetze haben dazu geführt, dass immer mehr Kommunen in
finanzielle Schwierigkeiten geraten: „Wir erwarten daher,
dass der Bund seine Verantwortung für die Kommunen stärker
wahrnimmt. Er muss die Kommunen beim enormen Anstieg der
Soziallasten, insbesondere bei der Eingliederung für
behinderte Menschen, finanziell unterstützen.“
Duisburger Anteil:
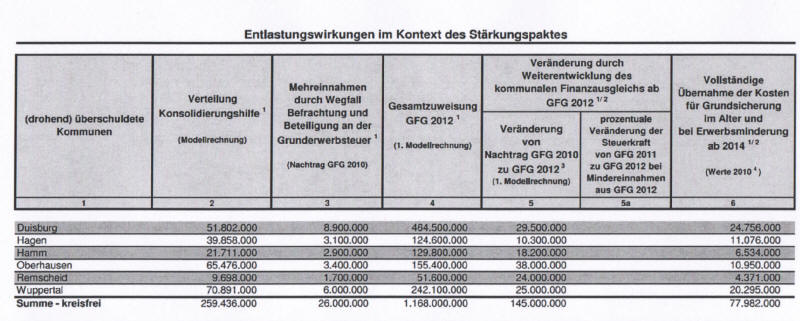 |
|
Konsens hilft Kommunen aus der Schuldenfalle:
350 Millionen Euro könnten noch in 2011 ausgezahlt werden -
Duisburger Anteil 51,8 Mio. Euro |
|
Düsseldorf/Duisburg 29. November 2011 - Für die 34
nordrhein-westfälischen Kommunen in der größten finanziellen
Not könnten schon bald die ersten Mittel aus dem
Stärkungspakt Stadtfinanzen ausgezahlt werden. „Wenn der
Gesetzesentwurf mit den jetzt vorgelegten Änderungsanträgen
in der kommenden Woche vom Landtag beschlossen wird, kann
das Gesetz noch in diesem Jahr in Kraft treten“, erklärte
Kommunalminister Ralf Jäger heute (29. November) in
Düsseldorf das weitere Verfahren.
Die bereitgestellten 350 Millionen Euro Landesmittel würden
dann noch im Dezember ausgezahlt werden. „Die heutige
Einigung beweist: Die Landespolitik zeigt Verantwortung“,
sagte Jäger.
Die Mittel aus dem Stärkungspakt, mit denen Kommunen - die
überschuldet sind oder denen Überschuldung droht - in den
kommenden Jahren rechnen können, ergeben sich aus einer
Modellrechnung, die der Kommunalminister vorgestellt hat.
Danach bekommt die Stadt Oberhausen in den nächsten Jahren
65,5 Millionen Euro. Die kreisangehörige Stadt
Castrop-Rauxel erhält 12,7 Millionen Euro jährlich und die
Gemeinde Welver 405.000 Euro. Grundlage dafür ist der
Kompromiss, auf den sich die rot-grüne Koalition und die
FDP-Fraktion im Landtag geeinigt haben und der nach den
Worten Jägers einen „Durchbruch in der Bewältigung der
Finanzkrise der NRW-Kommunen“ darstellt.
Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes ist es jetzt
möglich, zielgerichtet den am stärksten verschuldeten
Kommunen zu helfen. Denn wer sich nicht mehr selbst aus der
Schuldenfalle befreien kann, der braucht Hilfe. „Wir halten
Wort: Die Kommunen, deren Not am größten ist, können sofort
mit unserer Unterstützung rechnen. Wir werden gezielt helfen
und nicht Geld mit der Gießkanne verteilen“, erklärte
Kommunalminister Jäger.
Doch die Hilfen gibt es nicht ohne Gegenleistung. Wie im
Stärkungspakt Stadtfinanzen vorgesehen, müssen die
Bürgermeister und Räte ihren Beitrag leisten. „Jetzt sind
die Kommunen am Zug“, stellte Jäger fest. „Die Kämmerer
müssen Vorschläge erarbeiten, wie in Zukunft ein
ausgeglichener Haushalt erzielt werden kann. Dann ist der
Rat in der Pflicht. Denn wir setzen auf eine selbstbestimmte
Haushaltspolitik und die Eigenverantwortung der Kommunen“,
unterstrich Jäger. Beim Erarbeiten der jeweiligen
Konsolidierungspläne vor Ort bietet das Land zur
Unterstützung eine professionelle Beratung durch eine
Task-Force an.
Das Konzept des Stärkungspaktes Stadtfinanzen basiert
wesentlich auf wissenschaftlichen Ergebnissen. So werden 80
Prozent des Geldes auf der Grundlage einer
finanzwissenschaftlichen Berechnung der Professoren Dr.
Martin Junkernheinrich und Dr. Thomas Lenk verteilt, die im
Februar 2011 ihr Gutachten „Haushaltsausgleich und
Schuldenabbau“ vorgelegt hatten. Das Gutachten war noch von
der Vorgängerregierung in Auftrag gegeben worden. 20 Prozent
der Landeshilfe werden als Grundbetrag über einen
Einwohnerschlüssel gezahlt. Dadurch wird erreicht, dass auch
die kleineren Gemeinden ausreichende Leistungen aus dem
Stärkungspakt erhalten.
Die Gutachter haben einen Mehrjahresdurchschnitt der
Haushaltsdaten der Jahre 2004 bis 2007 gebildet und bei den
Soziallasten auch noch die Daten des Jahres 2008
berücksichtigt. Ebenfalls eingerechnet wurde eine Prognose
zur Höhe und Entwicklung der Zinslast für
Liquiditätskredite. Auf diese Weise ergibt sich ein
konkretes und besonders umfassendes Bild der
Kommunalfinanzen. „Die Mittelverteilung wird hierdurch auf
eine breite Datengrundlage gestellt. So können wir
Einzelereignisse und konjunkturbedingte Schwankungen
ausgleichen“, betonte Jäger.
Der Stärkungspakt Stadtfinanzen ist bereits das zweite große
Hilfspaket, das die Landesregierung zur Unterstützung der
Kommunen auf den Weg gebracht hat. In einem ersten Schritt
hatte das Land unmittelbar nach dem Regierungswechsel den
kommunalen Steuerverbund um mehr als 300 Millionen Euro
jährlich aufgestockt. Hiervon profitieren alle Kommunen. Für
die 34 Gemeinden in der ersten Stufe des Stärkungspaktes
bedeutet dies jährliche Verbesserungen von 41,7 Millionen
Euro. Insgesamt erhalten sie im nächsten Jahr rund 1,6&
Milliarden Euro aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Für die
Stadt Oberhausen bedeutet dies 155 Millionen Euro, für
Castrop-Rauxel 51 Millionen Euro und Welver bekommt 3,8
Millionen Euro.
Außerdem können die Kommunen im Stärkungspakt Stadtfinanzen
die schrittweise ansteigende Übernahme der Soziallasten
durch den Bund einplanen. Der Bund wird ab 2014 die Ausgaben
im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung voll übernehmen. Träger dieser Aufgabe sind
die kreisfreien Städte und die Kreise. Sie können dann mit
zusätzlichen Einnahmen in Höhe von rund 78 Millionen Euro
jährlich rechnen. Für Oberhausen bedeutet dies
voraussichtlich elf Millionen Euro. Bei den kreisangehörigen
Kommunen werden indirekt Entlastungen bei der Kreisumlage
erwartet.
Dass eine Konsolidierung der Haushalte möglich ist, zeigt
ein Finanzgutachten für die Stadt Wuppertal, das Mitte
November veröffentlicht wurde. „Gemeinsam schaffen wir eine
realistische Perspektive. Es wird ein Kraftakt für Land und
Kommunen, aber er lohnt sich“, versicherte der
Kommunalminister.
Jäger appellierte erneut an den Bund: Denn gerade dessen
Gesetze haben dazu geführt, dass immer mehr Kommunen in
finanzielle Schwierigkeiten geraten: „Wir erwarten daher,
dass der Bund seine Verantwortung für die Kommunen stärker
wahrnimmt. Er muss die Kommunen beim enormen Anstieg der
Soziallasten, insbesondere bei der Eingliederung für
behinderte Menschen, finanziell unterstützen.“
Duisburger Anteil:
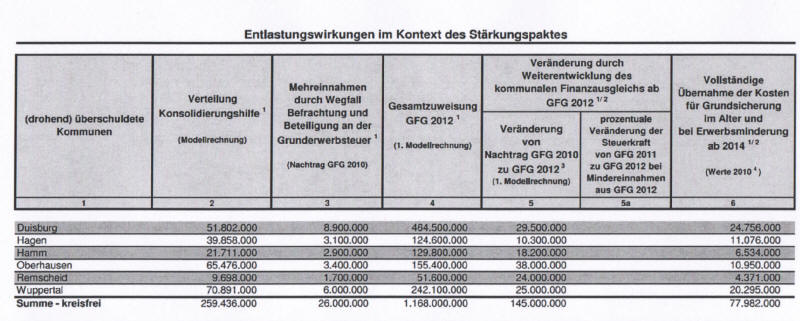 |
|
Landtagspräsident nimmt Unterschriften für den freien
Sonntag entgegen |
|
Düsseldorf/Duisburg 18. November 2011 - Zehntausend
Unterschriften für den freien Sonntag hat die Kölner Allianz
für den freien Sonntag bisher gesammelt und heute an
Landtagspräsident Eckhard Uhlenberg überreicht. Die Kölner
Allianz für den freien Sonntag, im März 2011 gegründet und
getragen vom DGB, der Evangelischen Kirche, dem
Katholikenausschuss, der Katholischen Arbeitnehmer Bewegung,
von ver.di (alle Köln) sowie der Evangelischen
Arbeitnehmerbewegung Rheinland, richtet sich gegen eine
weitere Aushöhlung der Sonn- und Feiertagsruhe.
Die Sprecherinnen und Sprecher der Allianz begründeten ihre
Initiative mit dem besonderen Wert des Sonntags in einer
christlichen Gesellschaft sowie dem Schutz der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Auch für die Familien
sei der freie Sonntag von hoher Bedeutung. Gegen die
ausufernde Nutzung des Sonntags für den Konsum habe nun eine
Gegenbewegung eingesetzt. In der Bevölkerung sei in dieser
Hinsicht ein Umdenken zu registrieren. Dies sei auch ein
deutliches Zeichen für die Parlamente.
Landtagspräsident Eckhard Uhlenberg begrüßte das Engagement
der Allianz für die Sonntagsruhe und teilte mit, dass sich
das NRW-Parlament mit dem Thema befassen werde. Der
Ausschuss für Wirtschaft, Mittelstand und Energie werde das
Thema Anfang 2012 beraten und in einer öffentlichen Anhörung
auch den Rat von Sachverständigen einholen.
|
|
Aktuelle Stunden zu „rechtem Terror“
Eilantrag Eingliederungshilfe für Jobvermittlung |
|
Düsseldorf/Duisburg 14. November 2011 -Der
rechtsextremistische Terrorismus wird durch drei Anträge
Thema der Aktuellen Stunde in der Plenarsitzung am
Donnerstag, 17. November 2011. Die Fraktionen von SPD und
Bündnis 90/DIE GRÜNEN verweisen darauf, dass die Ergebnisse
im Rahmen der Ermittlungen zur sogenannten „Zwickauer Zelle“
neue Formen von Gewalt und Terror verdeutlichten. Es häuften
sich die Hinweise, dass die rechtsextremistischen Täter für
zahlreiche Morde und Terroraktionen verantwortlich seien.
Auch die Fraktion DIE LINKE geht auf die Hinweise auf
Anschläge und Morde ein und stellt in diesem Zusammenhang
die Frage, ob der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz
über seine V-Leute nicht zumindest vage Hinweise erhalten
habe. Die FDP-Fraktion stellt mit der Bundesjustizministerin
fest, dass die Aufklärung „überhaupt nicht funktioniert“
habe. Es müsse darüber geredet werden, ob der
Verfassungsschutz mit 16 Landes- und einer Bundesbehörde
„optimal organisiert“ sei. Die Fraktionen sind sich einig,
dass der Landtag über die Gefahr durch Rechtsextremisten
debattieren müsse.
In ihrem Eilantrag „Eingliederungshilfe als erfolgreiches
Instrument der Jobvermittlung erhalten“, der in der
Plenarsitzung am Mittwoch, 16. November 2011 auf der
Tagesordnung steht, greift die FDP-Fraktion die Vorwürfe
gegenüber dem Internetversandhaus Amazon auf, denen sich
NRW-Arbeitsminister Schneider angeschlossen habe. Danach
sollen Mitarbeiter für das Weihnachtsgeschäft im Rahmen von
betrieblichen Trainingsmaßnahmen in einem
Probearbeitsverhältnis zwei Wochen lang ohne Bezahlung
eingesetzt werden.
Die NRW-Regionaldirektion der Agentur der Arbeit habe
unterdessen klargestellt, dass es sich bei den Praktika um
ein gängiges und seit Jahren angewandtes Instrument der
Jobvermittlung handele, bei dem Arbeitslose bis zu vier
Wochen auf Probe arbeiten und dafür keinen Lohn, sondern
weiter Arbeitslosengeld II erhalten. Dieses Verfahren sei
korrekt und biete große Chancen für Langarbeitslose. Dies
zeige sich darin, dass die meisten der Praktikanten später
eingestellt würden.
|
|
„Der Fahrradreifen verliert weiterhin Luft“ - Stärkungspakt
Stadtfinanzen im Expertenurteil |
|
Düsseldorf/Duisburg
11. November 2011 - Viel Lob für die Landesregierung: Dass
sie den Kommunen in ihrer finanziell schwierigen Lage helfen
wolle, sei ein ermutigendes Zeichen: So der Tenor der
Sachverständigen aus dem Kreis von Kommunen, Wissenschaft,
Banken, Wirtschaft und Gewerkschaften bei einer gemeinsamen
Anhörung von Haushalts- und Kommunalausschuss unter Leitung
von Carina Gödecke (SPD).
Die konkreten Vorschläge des Gesetzentwurfs fanden dann aber
deutlich weniger Zustimmung: Das veranschlagte Volumen sei
zu gering, und der ausgewählte Kreis von Hilfsempfängern
nicht zielführend, hieß es von einer Vielzahl der Experten.
So wurde neben einem raschen Einstieg noch in diesem Jahr
eine Neuausrichtung im Jahr 2012 empfohlen. Im Folgenden
eine Zusammenfassung der Stellungnahmen der kommunalen
Spitzenverbände sowie von Professor Dr. Martin
Junkernheinrich, Mitverfasser eines von der Landesregierung
in Auftrag gegebenen Gutachtens zur finanziellen Lage der
Kommunen.
Es sei ein „denkwürdiges“ Jahr, so Monika Kuban (Städtetag)
da das Land sich entschließe, den Kommunen in ihrer Lage zu
helfen. Einige befänden sich bereits seit Ende der 80er
Jahre in der Haushaltskonsolidierung. Als Folge der
jahrelangen strukturellen Unterfinanzierung lägen die Lasten
der Städte und Gemeinden in NRW deutlich über dem
Durchschnitt der anderen Kommunen in den alten
Bundesländern.
Dies beruhe nicht zuletzt auf den gestiegenen Soziallasten,
die der Bund den Kommunen auferlegt hätte, erläuterte Claus
Hamacher (Städte- und Gemeindebund).
Es sei wichtig, dass nunmehr ein Einstieg gelinge.
Allerdings reichten die zur Verfügung gestellten
Landesmittel nicht aus, um den Haushaltsausgleich aller
Kommunen sicherzustellen und ein Anwachsen der Kassenkredite
zu verhindern, so die kommunalen Spitzenverbände in einer
gemeinsamen Stellungnahme. Neben einer Aufstockung der
Hilfen forderten sie eine Gleichbehandlung aller Kommunen.
Beides könnte im Rahmen einer Überprüfung im Jahr 2012
vorgenommen werden, eine entsprechende Revisionsklausel sei
bereits jetzt festzuschreiben. „Mit den jetzt vorgesehenen
350 Millionen Euro kann es gelingen, den Fahrradreifen
notdürftig zu flicken, aber er verliert weiterhin Luft“,
kommentierte Dr. Martin Klein (Landkreistag).
Finanzielle Beiträge bestimmter Kommunen (Abundanzumlage)zu
einem Stärkungspakt schlossen die Kommunalen Spitzenverbände
nicht von vornherein aus, sofern das Land zu einem „seiner
finanziellen Verantwortung entsprechenden
Finanzierungsbeitrag im Rahmen einer nachhaltigen
Gesamtlösung“ bereit sei. Solche Zahlungen müssten
jedenfalls zeitlich befristet sein und dürften die
betroffenen Kommunen nicht in eine finanzielle Notlage
bringen.
„Schnelle Hilfe ist erforderlich“, mahnte auch Professor Dr.
Martin Junkernheinrich, Mitverfasser eines von der
Landesregierung in Auftrag gegebenen Gutachtens zur
finanziellen Lage der Kommunen. Analog zur Forderung der
kommunalen Spitzenverbände trat er für ein einjähriges
Soforthilfeprogramm und einer grundsätzlichen Überarbeitung
ab dem Jahre 2012 ein. Die in der ersten Stufe geplante
Fokussierung auf einen kleinen Kreis von 34 pflichtigen
Hilfeempfängern sei nicht zielführend. In einer zweiten
Stufe sollten zumindest die 138 Gemeinden mit einem
Nothaushalt erfasst werden. Eine solche breitere Auswahl
erleichtere auch die notwendige breite Zustimmung zum
geplanten Stärkungspakt.
Jedenfalls solle bei der Auswahl der Gemeinden auch die Höhe
der Liquiditätskredite sowie die Deckungslücke im
konjunkturbereinigten Mehrjahresdurchschnitt, die sogenannte
strukturelle Lücke, erfasst werden, forderte Junkernheinrich.
Die vom Land bereitgestellten Finanzmittel seien mindestens
zu verdoppeln. Ebenfalls seien die Kommunen von Aufgaben und
festgelegten Standards zu befreien, damit Sparanstrengungen
nicht in einer „Vergeblichkeitsfalle“ stecken blieben. Bei
der Ausgestaltung der interkommunalen Solidarität
(Abundanzumlage) müssten Doppelbelastungen der betroffenen
Gemeinden, vor allem aber nicht zielführende Belastungen von
Kommunen mit Nothaushalten vermieden werden.
|
|
Thema „U3-Betreuungsplätze“ im Ausschuss Familie, Kinder und
Jugend
Deutsch-Türkisches
Anwerbeabkommen vor 50 Jahren – Feier im Landtag NRW |
|
Thema „U3-Betreuungsplätze“ im Ausschuss Familie, Kinder und
Jugend
Düsseldorf/Duisburg
9. November 2011 -
Eine Aktuelle Viertelstunde zum Thema „U3-Betreuungsplätze
und –Ausbau“ wird es am Donnerstag, 10. November 2011, 10
Uhr, Raum E3 – A02 im Ausschuss für Familie, Kinder und
Jugend (Vorsitz: Margret Vosseler, CDU) auf Antrag der
FDP-Fraktion als Punkt 2 der Tagesordnung geben.
Zur Begründung für ihren Antrag verweist die FDP-Fraktion
auf die aktuellen statistischen Zahlen über die
Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren. Aus diesen
Zahlen gehe hervor, dass sich die Ausbaudynamik in NRW im
Vergleich zum Vorjahr verlangsamt habe. NRW sei bundesweit
Schlusslicht bei der Betreuung von Unterdreijährigen. Da das
Thema für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und für
die Umsetzbarkeit des Rechtsanspruches auf einen
Betreuungsplatz für Unterdreijährige sowie mit Blick auf das
mit dem Bund vereinbarte Ausbauziel einer
Bedarfsdeckungsquote von 32 Prozent für das Land NRW von
erheblicher Bedeutung sei, bestehe ein besonderes
öffentliches und parlamentarisches Interesse.
Thema
„Dichtheitsprüfung von privaten Abwasserrohren“ verschoben
Das Thema „Landesweite Dichtheitsprüfung von privaten
Abwasserrohren aussetzen – Kommunale Selbstverwaltung
stärken“ wird in der heutigen Sitzung des Ausschusses für
Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz (Vorsitz Friedhelm Ortgies, CDU) nicht
behandelt.
Der entsprechende Antrag der FDP-Fraktion sowie der
Entschließungsantrag der CDU-Fraktion sollen in der Sitzung
des Ausschusses im Dezember 2011 beraten werden.
Deutsch-Türkisches Anwerbeabkommen vor 50 Jahren – Feier im
Landtag NRW
An das deutsch-türkische Anwerbeabkommen, das vor 50 Jahren
geschlossen wurde, erinnerten der Landtag und die
Landesregierung NRW mit einer Feierstunde sowie einer
Ausstellung mit dem Titel „50 Jahre Migration aus der
Türkei: Geschichte, Gegenwart und Zukunft“.
Seit 1961, als das Anwerbeabkommen beschlossen wurde, haben
viele türkischstämmige Menschen in Nordrhein-Westfalen ihr
Zuhause gefunden. Heute leben mehr als 800.000 Frauen,
Männer und Kinder türkischer Herkunft in NRW – mittlerweile
ist das die dritte oder gar die vierte Generation. Die
Beziehungen zwischen Türken und Deutschen ist geprägt von
Sympathie, aber auch von Ängsten, von Missverständnissen,
aber auch von Harmonie und Freundschaft, von traurigen und
schönen Ereignissen und Erlebnissen.
Landtagspräsident Eckhard Uhlenberg begrüßte gemeinsam mit
dem nordrhein-westfälischen Minister für Arbeit, Integration
und Soziales, Guntram Schneider, und dem Generalkonsul der
Republik Türkei, Firat Sunel, die 250 Festgäste, darunter
auch zahlreiche Einwanderer der ersten Stunde, im Plenarsaal
des Landtags. Uhlenberg wies darauf hin, dass 50 Jahre
Anwerbeabkommen ein bedeutsamer Anlass und ein menschlich
wie politisch zwingender Grund zu Rückblick und Perspektive
sei. Er sprach sich aus für ein „aufgeschlossenes
Zusammenleben, für kulturellen Dialog, für gute Geschäfte,
für mehr Chancen, dass Menschen in Nordrhein-Westfalen –
gleich welcher Herkunft – ihren persönlichen Traum vom Glück
wahr machen können.“ Und er rief den türkischstämmigen
Menschen zu: „Sie gehören zu uns in Nordrhein-Westfalen, ob
schon mit oder (noch) ohne deutschen Pass. Das ist natürlich
eine ganz persönliche, freie Entscheidung. Unser
Zusammenleben: Das ist unsere Gegenwart und unser Tor in die
Zukunft.“
Der Landtagspräsident zog eine stolze Bilanz für die
türkische Gemeinschaft in NRW: „Sie alle gehören ganz
zweifellos zum „Schatz der Köpfe“ in NRW, der für unser
Industrieland jetzt in der Zeit nach Kohle und Stahl
Rohstoff Nummer Eins ist.“ Dies werde in der Ausstellung „50
Jahre Migration aus der Türkei. Geschichte, Gegenwart und
Zukunft“ deutlich, die von Carina Gödecke, 1.
Vizepräsidentin des Landtags NRW, eröffnet werde.
Die Ausstellung erzählt mit lebensgroßen Fotoporträts, mit
historischem Film- und Tonmaterial sowie einer Fülle von
Objekten und Fotos die Geschichte von nunmehr drei
Generationen, die ihre Wurzeln in der Türkei und ein neues
Zuhause in Deutschland haben.
Die Ausstellung kann vom 9. November bis 4. Dezember 2011,
montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr, besichtigt werden.
Bitte melden Sie sich unter Telefon 0211/884-2129 an.
|
|
Anhörungen zu Sozialticket, Intensivmastanlagen,
Integration, Stärkungspakt |
|
Düsseldorf/Duisburg
4. November 2011 -
In vier öffentlichen Anhörungen ist in der kommenden Woche
der Rat von Experten gefragt:
Ein landesweites einheitliches Sozialticket will die
Fraktion DIE LINKE. Gemeinsam mit den Kommunen und den
Verkehrsverbünden soll das Land so Geringverdienern und
Menschen unterhalb der Armutsgrenze das Recht auf Mobilität
geben und den Zugang zu kulturellen, sozialen und
sportlichen Angeboten ermöglichen. Das Sozialticket dürfe
monatlich nicht mehr als 15 Euro kosten. Die Einführung des
Sozialtickets soll mindestens mit 100 Millionen Euro
unterstützt werden. Die Anhörung im Ausschuss für Arbeit,
Gesundheit, Soziales und Integration (Vorsitz Günter
Garbrecht, SPD) zu dem Antrag „Mobilität und soziale
Teilhabe sind Grundrechte – Ein landesweites Sozialticket
ist eine Notwendigkeit“ ist am Dienstag, 8. November 2011,
15 Uhr in Raum E3 – A02.
„Intensivmastanlagen belasten ländliche Regionen in NRW –
Bäuerliche Landwirtschaft stärken“ lautet der Antrag der
Fraktionen von SPD und GRÜNEN, der am Mittwoch, 9. November
2011, 10 Uhr in Raum E3 – A02 Gegenstand einer
Expertenanhörung im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt,
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Vorsitz
Friedhelm Ortgies, CDU) ist. Nach Ansicht der beiden
Fraktionen nimmt die Akzeptanz gegenüber großen
Tierhaltungsanlagen aus Gründen des Tier-, Gesundheits- und
Umweltschutzes ab. Strengere Regeln im Baurecht, im
Immissionsschutz sowie der Gesundheitsvorsorge sollen für
Begrenzungen sorgen, die bäuerliche Landwirtschaft gestärkt
werden.
Mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung „zur Förderung der
gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in
Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung anderer gesetzlicher
Vorschriften“ soll die bereits bestehende
integrationspolitische Infrastruktur in NRW gesichert und
optimiert werden. Eine vorausschauende, aktivierende und
unterstützende Integrationspolitik soll ermöglicht und als
bedeutendes Ziel der Landespolitik verankert werden. Die
Stellungnahmen der Sachverständigen nimmt der Ausschuss für
Arbeit, Gesundheit, Soziales und Integration (Vorsitz Günter
Garbrecht, SPD) am Mittwoch, 9. November 2011, 13.30 Uhr in
Raum E3 – A02 entgegen.
Die Haushaltskonsolidierung der Kommunen ist Thema der
Anhörung im Ausschuss für Kommunalpolitik (Vorsitz Carina
Gödecke, SPD) sowie im Haushalts- und Finanzausschuss
(Vorsitz Manfred Palmen, CDU) am Freitag, 11. November 2011,
10 Uhr, Plenarsaal. Dazu liegen vor der Entwurf des
Stärkungspaktgesetzes der Landesregierung sowie zwei Anträge
der Fraktion DIE LINKE. Ziel des Gesetzentwurfs ist es, den
Gemeinden mit besonders schwieriger Haushaltslage einen
nachhaltigen Haushaltsausgleich zu ermöglichen. Dafür stellt
das Land diesen Gemeinden von 2011 bis 2020
Konsolidierungshilfen zur Verfügung, an deren Finanzierung
sich die Kommunen durch einen Abzug bei der
Finanzausgleichsmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze sowie
ab 2014 durch eine Solidaritätsumlage beteiligen sollen. Die
Fraktion DIE LINKE fordert „Echte Entschuldung der Kommunen
statt kaputtsparen“ und verlangt, dass die Landesregierung
ab 2012 einen Landes-Entschuldungsfonds einrichtet. In ihrem
zweiten Antrag setzt sich die Fraktion dafür ein, dass die
Verteilung der in diesem Jahr eingestellten
Konsolidierungshilfen in Höhe von 350 Mio. Euro an die am
meisten bedürftigen Kommunen ohne Auflagen und
Zwangsmaßnahmen geregelt wird.
|
|
Städte, Gemeinden und Kreise erhalten 500 Millionen Euro
mehr vom Land
2012 höchste Zuweisung aller Zeiten - Steigerung um 6,3 % auf
8,4 Milliarden Euro |
|
Düsseldorf/Duisburg
21. Oktober 2011 -
Die Landesregierung wird den Kommunen mit dem
Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2012 rund 8,4 Milliarden
Euro auszahlen. Der Betrag steigt gegenüber 2011 um rund 500
Millionen Euro oder 6,3 Prozent. „Das ist die höchste Summe,
die in der Geschichte des Landes an die Kommunen gezahlt
wird. Wir stehen zu unserem Versprechen und unterstützen die
Kommunen nach Kräften bei der Sanierung ihrer Haushalte“,
sagte Kommunalminister Ralf Jäger heute (21. Oktober) in
Düsseldorf.
Die gute Steuerentwicklung der vergangenen Monate ist ein
Grund für den Anstieg der Zuweisungen. Zusätzlich werden die
Kommunen seit dem Regierungswechsel nicht mehr zur
Konsolidierung des Landeshaushalts herangezogen und wieder
am Aufkommen des Landes an der Grunderwerbsteuer beteiligt.
Dadurch erhalten sie seit 2010 jährlich rund 300 Millionen
Euro zusätzlich.
Die 350 Millionen Euro Landesmittel im Stärkungspakt
Stadtfinanzen eingerechnet, zahlt das Land den Kommunen im
nächsten Jahr rund 8,75 Milliarden Euro. „Wir gehen damit an
die äußerste Grenze der finanziellen Möglichkeiten des
Landeshaushaltes“, betonte Jäger. Mit dem GFG 2012 werden
die Kriterien für den kommunalen Finanzausgleich an die
aktuellen Entwicklungen angepasst.
Die Änderungen gehen auf Vorschläge des ifo-Gutachtens aus
dem Jahr 2008 und Beratungsergebnisse der ifo-Kommission
zurück. „Die neue Systematik sorgt dafür, dass das Geld da
ankommt, wo es am dringendsten benötigt wird. Dies ist aus
verfassungsrechtlicher Sicht auch zwingend geboten. Mit der
zusätzlichen Unterstützung durch den Stärkungspakt haben
auch hoch belastete Städte und Gemeinden wieder die Chance,
zu einer selbstbestimmten Haushaltspolitik zurückzukommen“,
erklärte Jäger. Eine wesentliche Neuerung ist die stärkere
Gewichtung der sozialen Lasten. Sie sind in den vergangenen
zehn Jahren um 50 Prozent auf fast 13 Milliarden Euro
angestiegen.
Neu eingeführt wird ein Flächenansatz. Er berücksichtigt die
besonderen Ausgaben von Flächengemeinden mit einer geringen
Einwohnerzahl. Schließlich soll in das
Finanzausgleichssystem auch ein Demografiefaktor eingefügt
werden, der die Folgen rückläufiger Einwohnerzahlen in
einzelnen Kommunen abmildert. Für einzelne Kommunen können
die Gewinne und Verluste im kommunalen Finanzausgleich
erheblich sein. „Die Entwicklung der Steuerkraft sieht von
Kommune zu Kommune höchst unterschiedlich aus“, erläuterte
Jäger. „Wer Steuerzuwächse hat, verliert zwangsläufig bei
den Schlüsselzuweisungen. Wo Steuern weggebrochen sind, kann
hingegen mit mehr Schlüsselzuweisungen gerechnet werden.“
Es gebe allerdings auch Kommunen, die im Verhältnis zum GFG
2011 systembedingt verlieren. Für diese Kommunen sollen im
GFG 2012 einmalig Abmilderungshilfen in Höhe von insgesamt
rund 69 Millionen Euro vorgesehen werden. Der Gesetzentwurf
der Landesregierung soll im Dezember in Landtag eingebracht
werden. „Wir geben die Modellrechnung bereits jetzt bekannt,
damit die Kommunen besser für ihre eigenen Haushalte planen
können“, erläuterte Jäger. Aus der heute veröffentlichten
Modellrechnung ist für jede Kommune ersichtlich, welche
Mittel sie nach den derzeitigen Planungen im kommenden Jahr
aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten soll.
Vorläufige Liste der Städte und Gemeinden, die an Stufe 1
des Stärkungspakts teilnehmen werden (Änderungen nach
Vorlage der endgültigen Haushaltsdaten möglich):
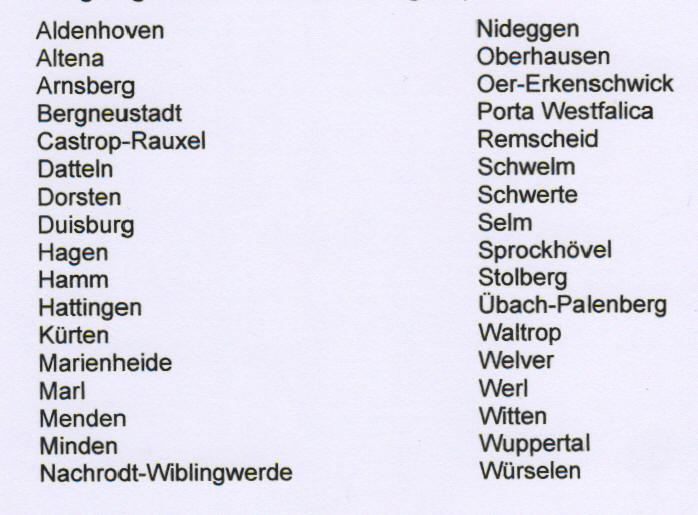
|
|
Landtag beschließt neues Schulgesetz |
|
Düsseldorf/Duisburg
20. Oktober 2011 -
Zum sechsten Mal in der Geschichte der
nordrhein-westfälischen Bildungspolitik hat der Landtag
heute eine Änderung des Schulgesetzes beschlossen (Drs.
15/2767). Damit können Kommunen die sogenannte
Sekundarschule einführen. Zudem werden gegliederte und
integrierte Schulformen künftig in der NRW-Verfassung
verankert, während der bisher garantierte Bestand der
Hauptschule entfällt (Drs. 15/2768). Auf diesen Konsens
hatten sich die Fraktionen von CDU, SPD und Grünen bereits
vor der Sommerpause verständigt und als Ende der jahrelangen
schulpolitischen Auseinandersetzung gefeiert.
„Es ist durch die Verfassungsänderung gelungen, ein
Nebeneinander von gegliederten und integrierten Schulen
festzulegen“, betonte Klaus Kaiser (CDU). Zudem bringe der
Schulkonsens endlich Ruhe in die Schullandschaft: Jede
Schule, die genügend Schülerinnen und Schüler habe, könne
weiterexistieren und sich weiterentwickeln. Und auch die
Kommunen hätten ausreichend Zeit, ohne Eile Entscheidungen
für die Strukturen vor Ort zu treffen, so Kaiser. Dabei
ermögliche ihnen die Sekundarschule, auf demografischen
Wandel und verändertes Eltern-Schulwahl-Verhalten zu
reagieren. Laut Kaiser besonders wichtig in diesem Prozess:
gerade Hauptschullehrkräften neue Perspektiven eröffnen.
Renate Hendricks (SPD) lobte den Schulkonsens als Abschluss
einer 40-jährigen Auseinandersetzung über die Schulstruktur
in NRW. Die Verfassungsänderung gebe nun einen Rahmen vor,
unter dem gemeinsam mit dem neuen Schulgesetz
Schulentwicklung vor Ort passieren könne. Dabei müssten die
Kommunen die Eltern mitnehmen und befragen. „Es ist eine
demokratische Form von Schulentwicklung“, betonte Hendricks
daher. Gleichzeitig erhielten mit dem neuen Schulgesetz auch
die kleinen Grundschulen – gerade im ländlichen Raum –
Planungssicherheit. Insgesamt bedauerte die SPD-Politikerin
jedoch, dass FDP und Linke den Konsens nicht mittrügen.
Der Schulkonsens sei nicht nur eine Chance für die
Schülerinnen und Schüler, meinte Sigrid Beer (Grüne). „Er
ist auch eine Chance für die Lehrerinnen und Lehrer in
Nordrhein-Westfalen.“ Es müsse eine neue Schulgemeinde
entstehen, in der auch die mitgenommen würden, die heute in
möglichweise auslaufenden Schulen arbeiteten. „Es soll etwas
zusammenwachsen, nicht auseinanderdividiert werden“, machte
die Grüne deutlich. Auch betonte sie, dass die Kommunen nun
ausreichend Zeit für die Schulentwicklung vor Ort hätten –
jede Hektik sei unnötig. Und bei allem gelte: „Die Schule
ist für die Schülerinnen und Schüler da. Nicht für die
Politik, nicht für die Verbände.“
„Es ist der Tag der verpassten Chancen“, kritisierte Ingrid
Pieper von Heiden (FDP). Ein umfassender Schulkonsens werde
verhindert. Die von CDU, SPD und Grünen unterstützte
Gesetzesänderung gefährde die hohe Qualität der
differenzierten Bildungsgänge durch verpflichtenden
integrierten Unterricht. Dieser überfordere in den meisten
Fällen sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrerinnen
und Lehrer. Hinzu komme, dass die Sekundarschule fast
deckungsgleich sei mit der rot-grünen Gemeinschaftsschule.
Zwar unterstütze die FDP das Konzept wohnortnaher
Grundschulen. Dem neuen Schulgesetz werde sie jedoch nicht
zustimmen, da es bestehende Schulformen benachteilige.
Gunhild Böth (Linke) ging der integrierte Unterricht
hingegen nicht weit genug. „Es gibt kein Recht auf längeres
gemeinsames Lernen“, kritisierte sie. Das hätte ihrer
Meinung nach jedoch zu einem Schulkonsens dazugehört.
Mangelhaft in Sachen Sekundarschule sei auch: „Es ist nicht
zwingend vorgeschrieben, Elternbefragungen zu machen.“ Die
Stadträte würden damit bei der Ausgestaltung der neuen
Schulform einseitig gestärkt. Insofern sei der Schulkonsens
auf halber Strecke stehen geblieben, meinte die Linke.
Problematisch sei zudem: Die Sekundarschule habe anders als
eine Gesamtschule keine eigene Oberstufe, was den Übergang
und damit den Weg zum Abitur erschwere.
„Nicht wir vertun eine historische Chance, sondern sie
vertun eine historische Chance“, reagierte Schulministerin
Sylvia Löhrmann (Grüne) auf die Kritik der FDP. Das Ergebnis
der Beratungen der vergangenen Wochen sei mehr als nur ein
Kompromiss zwischen drei politischen Fraktionen, es sei ein
großer Konsens für die ganze Gesellschaft. Er schreibe die
Schulstruktur für die kommenden zwölf Jahre fest, erläuterte
Löhrmann: „Wir machen den Weg frei für eine
zukunftsgerichtete, innovative und pragmatische
Schulentwicklung vor Ort.“ Insgesamt bestimme die Nachfrage
der Eltern entscheidend das Schulangebot vor Ort – ihnen
habe die Verfassung eine starke Rolle zugewiesen.
Infokasten: Sekundarschule
An der Sekundarschule mit den Klassen fünf bis zehn können
Schülerinnen und Schüler alle Abschlüsse der Sekundarstufe I
erreichen. Darüber hinaus ermöglicht sie ihnen auch den
Erwerb der allgemeinen Hochschulreife über mindestens eine
verbindliche Kooperation mit einem Gymnasium, einer
Gesamtschule oder einem Berufskolleg. Zudem setzt die
Sekundarschule auf längeres gemeinsames Lernen.
„Gefahr für Demokratie“
Bankenkrise: Einigkeit in Analyse, Unterschiede bei
Lösungswegen
Das Thema Bankenkrise stand auf Antrag von SPD und Grünen in
Verbindung mit einem Antrag der Linken im Mittelpunkt einer
Aktuellen Stunde. Politiker aller Fraktionen zeigten dabei
Verständnis für die weltweiten Proteste gegen die Banken und
Finanzmärkte. Diese seien Ausdruck der Sorge der Menschen,
auch der Sorge um die Demokratie.
Vor diesem Hintergrund forderte Hans-Willi Körfges (SPD)
eine stärkere Handlungsfähigkeit des Staates ein und
kritisierte „Ignoranz“ und „Fatalismus“ auf Seiten der
Bundesregierung. Es dürfe nicht sein, dass derjenige, der
auf Staatsbankrotte spekuliere, dann auch noch den Staat zu
Hilfe rufe.
„Zaudern und Zögern verlängert die Krise“, erklärte auch
Stefan Engstfeld (Grüne). Heute herrsche ein Diktat der
Märkte, befürchtete er und forderte die Schaffung einer
europäischen Wirtschaftsunion mit einer einheitlichen
Wirtschafts-, Finanz-, Haushalts- und Sozialpolitik. Banken
müssten einer einheitlichen Aufsicht unterliegen, was
Deutschland bislang gebremst habe.
Heute seien die Parlamente entmachtet, erklärte Rüdiger
Sagel (Linke). Banken entschieden über Staatshaushalte und
hätten sich für den Notfall selbst verstaatlicht. Dies sei
eine existentielle Bedrohung des Staates. Der
Linken-Sprecher forderte einen Kurswechsel hin zu
öffentlich-rechtlich organisierten Banken, wie dies auch der
IWF unterstütze.
Es könne nicht sein, dass 63 Billionen Dollar, die in der
Realwirtschaft erarbeitet würden, 955 Billionen Dollar auf
den Finanzmärkten gegenüberstünden, meinte Armin Laschet
(CDU). Daher müsse man die Soziale Marktwirtschaft wieder
handlungsfähig machen. Die Deregulierung der Finanzmärkte
sei allerdings zu einem großen Teil unter einer rot-grünen
Bundesregierung erfolgt.
Vor diesem Hintergrund verwahrte sich auch Angela Freimuth
(FDP) gegen einseitige populistische Kampagnen. Mit Blick
auf die WestLB warnte sie vor einer Verstaatlichung von
Banken. Die diskutierte Trennung von Geschäftsbanken und
Investmentbanken werde Kreditbedingungen verschlechtern und
gebe keine Sicherheit, wie die Auswirkungen des
Zusammenbruchs der Investmentbank Lehman zeigten.
Man habe nicht mehr nur eine Wirtschafts- und Bankenkrise,
sondern eine Systemkrise, so Finanzminister Dr. Norbert
Walter-Borjans (SPD). Die Banken hätten aus den
Entwicklungen seit 2008 keine Lehren gezogen, also müsse man
handeln. Angesichts des neuen Währungsraums rund um China
warnte der Minister vor einer „D-Mark Nostalgie“; selbst die
Schweiz sei gezwungen, sich an den Euro zu koppeln.
Vor einer „Krise der Demokratie“ warnte Ministerpräsidentin
Hannelore Kraft (SPD). Diese lasse sich nur durch große
Einigkeit verhindern. Kraft wandte sich gegen die Macht der
drei großen Ratingagenturen, die gleichzeitig bewerteten und
an ihren Bewertungen verdienten. Banken müssten kleiner
werden, damit deren Stützung nicht immer wieder als
„alternativlos“ hingestellt werde. T.W.
|
|
Aktuelle Stunden zur Kreditklemme der Kommunen und zur
Finanz- und Bankenkrise - Eilantrag zum Betreuungsgeld |
|
Düsseldorf/Duisburg
17. Oktober 2011 -
„Sieht die Landesregierung eine Kreditklemme der Kommunen in
Nordrhein-Westfalen?“ will die CDU-Fraktion im Rahmen einer
Aktuellen Stunde in der Plenarsitzung am Mittwoch, 19.
Oktober 2011, wissen. Zur Begründung ihres Antrags verweist
die CDU-Fraktion auf die Aussage der Landesregierung in der
Sitzung des Ausschusses für Kommunalpolitik in der
vergangenen Woche, eine Kreditklemme sei nicht bekannt,
Sorgen um die Kreditvergabe für Kommunen seien unbegründet.
Demgegenüber habe die Ministerpräsidentin in einem aktuellen
Interview erklärt, dass es eine sehr gefährliche Situation
sei, „wenn jetzt erste Banken Kommunen mit Nothaushalten
keine Kredite mehr geben“. Da es offensichtliche keine
einheitliche Haltung der Landesregierung gebe, müsse der
Landtag dieses Thema debattieren.
Der Aktuellen Stunde in der Plenarsitzung am Donnerstag, 20.
Oktober 2011, liegen Anträge der Fraktionen von SPD und
Bündnis 90/DIE GRÜNEN sowie der Fraktion DIE LINKE zugrunde,
die miteinander verbunden werden. Beide Anträge greifen die
bankenkritischen Demonstrationen des Wochenendes auf und
äußern die Befürchtung, dass die Banken- und Finanzkrise
sich nicht nur auf den Bund, sondern auch direkt auf Länder
und Kommunen auswirke. Die Linke führt in diesem
Zusammenhang aus, dass sich dadurch die Kreditklemme der
Kommunen erneut verschärfen werde. Während die
Landesregierung die Abwicklung der West LB mit Milliarden
finanziere, würden die Kommunen zu Kürzungsorgien gezwungen.
Für die ersatzlose Streichung des Betreuungsgeldes soll sich
die Landesregierung auf Bundesebene einsetzen. Das ist der
Tenor eines Eilantrags „Fernhalteprämie
verhindern – CSU-‚Herzensprojekt‘ beenden“ der Fraktionen
von SPD und GRÜNEN für die Plenarsitzung am Mittwoch, 19.
Oktober 2011. Das Betreuungsgeld sei ein „Herzensprojekt“
der CSU. Die familienpolitische Leistung in Höhe von
voraussichtlich 150 Euro monatlich sollen Eltern erhalten,
die ihre ein- bis dreijährigen Kinder nicht in einer
Kindertagesstätte oder Kindertagespflege betreuen lassen.
SPD und GRÜNE wenden sich grundsätzlich gegen das
Betreuungsgeld, das zentrale Anliegen einer präventiven
Bildungs- und Familienpolitik hintertreibe. So liefere es
gerade einkommensschwachen Eltern einen Anreiz, ihren
Kindern frühe Förderangebote in Bildungseinrichtungen wie
der Kita vorzuenthalten und sich stattdessen für die
Geldleistung zu entscheiden. Das Betreuungsgeld sei außerdem
– verfassungsrechtlich prekär - geeignet, die traditionelle
Rollenverteilung zwischen Mann und Frau fortzuschreiben.
Nicht zuletzt sei es nicht finanzierbar und müsse aus diesen
guten Gründen abgelehnt werden, so SPD und GRÜNE
|
|
Aktuelle Viertelstunde über Kreditvergabe an Kommunen
im Nothaushaltsrecht
|
|
Düsseldorf/Duisburg
13. Oktober 2011 -
Über den Vorstandsbeschluss der WL-Bank zur Kreditvergabe an
Kommunen im Nothaushaltsrecht hat die CDU-Fraktion für die
Sitzung des Ausschusses für Kommunalpolitik (Vorsitz: Carina
Gödecke, SPD) am Freitag, 14. Oktober 2011, Raum E3 – D01
nach der öffentlichen Anhörung eine Aktuelle Viertelstunde
beantragt.
Die CDU-Fraktion stützt sich bei ihrem Antrag auf eine
Mitteilung der Presse. Danach hat die WL-Bank in Münster
einen grundsätzlichen Vorstandsbeschluss gefasst, nach dem
die Bank künftig Städten und Gemeinden im Nothaushaltsrecht
ohne genehmigte Finanzierungspläne keine weiteren Kredite
gewähren werde. Einer bisher ungenannten Kommune aus dem
Münsterland soll die Verlängerung des (Liquiditätssicherungs-)Kredits
verweigert worden sein. Das Innenministerium soll zu dem
Vorgang Stellung nehmen.
Die Ausschuss-Vorsitzende Carina Gödecke weist darauf hin,
dass „wegen überwiegender Belange des öffentlichen Wohls und
der öffentlichen Sicherheit oder schutzwürdiger Interessen
Einzelner die Öffentlichkeit“ bei bestimmten Informationen
ausgeschlossen werden könnte.
|
|
Anhörungen: Landesaltenpflegegesetz, politische Bildung,
Kreislaufwirtschaftsgesetz und demokratische Beteiligungsrechte |
|
Düsseldorf/Duisburg
7. Oktober 2011 -
In der kommenden Woche stehen vier öffentliche Anhörungen
auf der Tagesordnung der Fachausschüsse im Landtag NRW.
„Gesetz zur Änderung des Landesaltenpflegegesetzes“ lautet
der Gesetzentwurf der Landesregierung, der der Anhörung im
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Integration
(Vorsitz: Günter Garbrecht, SPD) am Mittwoch, 12.10.2011,
10.00 Uhr in Raum E 3 – A 02 zugrunde liegt. Um dem Mangel
an Ausbildungsplätzen in der Altenpflegeausbildung
entgegenzuwirken, der auch durch die besondere Belastung der
ausbildenden Pflegeeinrichtungen mit den Kosten der
Ausbildungsvergütung zu tun hat, soll eine
Umlagefinanzierung eingeführt werden. Mit dieser sollen die
Wettbewerbsnachteile der ausbildenden gegenüber den
nichtausbildenden Pflegeeinrichtungen ausgeglichen werden.
Der Entwurf einer Verordnung über die Erhebung von
Ausgleichsbeiträgen zur Finanzierung der
Ausbildungsvergütungen in der Altenpflege ist ebenfalls
Gegenstand der Anhörung.
Ebenfalls am Mittwoch, 12.10.2011, 13.00 Uhr in Raum E 3 – D
01 findet im Ausschuss für Schule und Weiterbildung
(Vorsitz: Wolfgang Große Brömer, SPD) eine Anhörung zum
Antrag der Fraktion FDP „Die politische Bildung in
nordrhein-westfälischen Schulen stärken – Schülerinnen und
Schüler noch stärker über die Gefahren für Demokratie durch
Rechts- und Linksextremismus aufklären“ und zu dem Antrag
der Fraktionen von SPD und Grüne „Politische Bildung stärken
– Pluralität fördern“ statt. Beide Anträge fordern die
Verstärkung der Aufklärungsarbeit an Schulen und die
Förderung des politischen Bewusstseins von Kindern und
Jugendlichen. Der Schwerpunkt soll bei der Aufklärung über
den Nationalsozialismus gesetzt werden, verlangt wird aber
auch die kritische Aufarbeitung der DDR-Geschichte.
Im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Vorsitz: Friedhelm
Ortgies, CDU) werden am Donnerstag, 13.10.2011, 11.00 Uhr im
Plenarsaal in der Anhörung zum Antrag der Fraktionen von SPD
und Grüne „Privat vor Staat verhindern – Röttgens
Kreislaufwirtschaftsgesetz ablehnen“ Experten gehört. Die
Fraktionen sprechen sich gegen den Gesetzentwurf von
Bundesumweltminister Röttgen aus und fordern u.a., dass die
Prinzipien der EU-Abfallrahmenrichtlinie, vor allem das der
Nachhaltigkeit, konsequent umgesetzt werden, die Einführung
einer flächendeckenden Bioabfallentsorgung vorgeschrieben
wird und die Kommunen weiterhin die Entscheidungshoheit
darüber haben, ob gewerbliche Abfallsammlungen ausgeführt
werden.
Am Freitag, 14.10.2011, um 10.00 Uhr in Raum E 3 – D 01
setzt sich der Ausschuss für Kommunalpolitik (Vorsitz:
Carina Gödecke, SPD) im Rahmen einer Anhörung mit dem Antrag
der Fraktion FDP „Demokratische Beteiligungsrechte der
Bürgerinnen und Bürger stärken – Kumulieren und Panaschieren
bei Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen einführen“
auseinander. Um die demokratischen Beteiligungsmöglichkeiten
der Bürgerinnen und Bürger substanziell zu stärken, soll in
NRW, wie schon in anderen Bundesländern, auf kommunaler
Ebene das Kumulieren und Panaschieren ermöglicht werden |
|
|








