|
|
|
Clean Air Forum,
Batterierecycling und Forschung: Umweltkommissarin
Roswall in Bonn und Krefeld
|
|
1. Dezember 2025 - Die für Umwelt,
resiliente Wasserversorgung und wettbewerbsfähige
Kreislaufwirtschaft zuständige EU-Kommissarin Jessika
Roswall ist gemeinsam mit Bundesumweltminister Carsten
Schneider und anderen hochrangigen Teilnehmenden in Bonn
beim 5. EU-Forum für saubere Luft.
Vorab sagte sie: „In saubere Luft zu investieren heißt,
in unsere Widerstandsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit
zu investieren. Maßnahmen zur Verringerung der
Luftverschmutzung haben Vorteile gebracht, die ihre
Kosten bei weitem überwiegen. Jeder Euro, der für saubere
Luft ausgegeben wird, bringt mindestens das Vierfache an
Nutzen.
Die Politik der EU zur Verringerung der Luftverschmutzung
zeigt solide Ergebnisse. Die Luftqualität hat sich in den
letzten Jahrzehnten stetig verbessert, und die EU ist auf
dem besten Weg, die gesundheitlichen Auswirkungen der
Luftverschmutzung bis 2030 um mehr als 55 Prozent
gegenüber 2005 zu senken.“
Am Vormittag war Roswall bei der Accurec Recycling GmbH
in Krefeld bei der Inbetriebnahme einer europaweit
einzigartigen Anlage, mit der das Unternehmen Lithium aus
alten Akkus zurückgewinnen kann. Am Nachmittag diskutiert
sie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn mit Forschenden des PhenoRob Clusters, das die
nachhaltige und technologie-getriebene Transformation der
Landwirtschaft zum Thema hat.
Bewertung der NEC-Richtlinie heute veröffentlicht
Im Mittelpunkt des Clean Air Forum steht unter anderem
die Bewertung der Richtlinie über nationale
Emissionsreduktionsverpflichtungen (NEC), die die
Kommission heute veröffentlicht hat. Sie zeigt, dass die
Emissionen der fünf wichtigsten Luftschadstoffe
(Schwefeldioxid, Feinstaub, Stickoxide und flüchtige
organische Verbindungen außer Methan und Ammoniak) in der
EU während des Bewertungszeitraums trotz
Wirtschaftswachstums stetig zurückgegangen sind. Dies
deutet auf eine erfolgreiche Entkopplung von
Wirtschaftstätigkeit und Luftverschmutzung hin. In den
vergangenen zwei Jahrzehnten wurden die
Schwefeldioxidemissionen am stärksten reduziert (85
Prozent im Vergleich zu 2005).
Besuch der Accurec GmbH in Krefeld
Bei der Accurec GmbH in Krefeld nahm die Kommissarin an
einem Meilenstein teil, nämlich der Inbetriebnahme der
ersten industriellen Rückgewinnung von Lithium aus
Altbatterien. Das von Accurec entwickelte,
thermochemische Verfahren überführt mit geringstem
Aufwand an Energie und Betriebsmitteln die kritischen
Rohstoffe in eine hervorragend trennbare Form und
extrahiert diese.
Kommissarin Roswall sagte: „Die Unterstützung
strategischer Projekte und Anlagen wie dieser ist für die
Europäische Kommission und für mich persönlich von
entscheidender Bedeutung. Denn sie ist entscheidend für
die Zukunft Europas und für das, was ich für die
Generation meiner Enkelkinder erreichen möchte. In der
heutigen instabilen Welt ist die Sicherung der
strategischen Autonomie Europas wichtiger denn je“.
Kommission fördert Energieverbundfähigkeit in
Europa und darüber hinaus durch Unterstützung von 235
grenzüberschreitenden Projekten
Heute hat die Kommission 235 grenzüberschreitenden
Energieprojekten den Status von Vorhaben von gemeinsamem
Interesse (PCI) und Vorhaben von gegenseitigem Interesse
(PMI)gewährt – die zweite derartige Liste seit ihrer
Einführung im Jahr 2023. Die ausgewählten Projekte können
EU-Mittel aus der Fazilität „Connecting Europe“
beantragen und profitieren von beschleunigten
Genehmigungs- und Regulierungsverfahren für eine rasche
Durchführung und Umsetzung.
Diese projektübergreifenden Projekte werden die
Energiekonnektivität auf dem gesamten Kontinent stärken
und die Vollendung der Energieunion näher bringen. Durch
die Ermöglichung wichtiger Verbindungsleitungen in der
gesamten EU und mit Nachbarländern können diese Projekte
eine strategische Rolle bei der Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit der EU, der Dekarbonisierung und der
Verbesserung der Energieversorgungssicherheit und
-unabhängigkeit Europas spielen.
Einer aktuellen Studie der Kommission zufolge wird sich
der Investitionsbedarf für die europäische
Energieinfrastruktur – Strom-, Wasserstoff- und CO2-Netze
– von 2024 bis 2040 auf 1,5 Billionen EUR belaufen. Diese
Projektstruktur und die damit verbundenen erwarteten
Investitionsvolumina werden dazu beitragen, den für 2040
ermittelten Bedarf zu decken.
Die Liste der ausgewählten PCI und PMI umfasst:
113 Strom-, Offshore- und intelligente Stromnetzprojekte,
die für die Integration des wachsenden Anteils
erneuerbarer Energien von wesentlicher Bedeutung sein
werden.
100 Wasserstoff- und Elektrolyseurprojekte, die eine
wichtige Rolle bei der Integration und Dekarbonisierung
des Energiesystems der EU spielen werden.
17 CO2-Transportinfrastrukturprojekte, die die
Entwicklung des Marktes für CO2-Abscheidung und
-Speicherung vorantreiben werden.
3 Projekte für intelligente Gasnetze zur Digitalisierung
und Modernisierung des Erdgasnetzes.
die fortgesetzte Einbeziehung von zwei langjährigen
Projekten, die Malta und Zypern mit dem europäischen
Festlandgasnetz verbinden.
Die Kommission wird die Durchführung dieser Projekte
durch eine verstärkte politische Koordinierung mit den
betreffenden Mitgliedstaaten unterstützen und sich dabei
auf die Taskforce Energieunion und die regionalen
hochrangigen Gruppen stützen, die die Entwicklung der
Energieinfrastruktur in Schlüsselregionen, auch mit
Partnerländern, unterstützen sollen.
Wie im Aktionsplan der Kommission für erschwingliche
Energie hervorgehoben, ist ein effizientes Energienetz
von entscheidender Bedeutung, um die Energiewende zu
ermöglichen und sicherzustellen, dass Energie sowohl für
Industrien als auch für Haushalte in ganz Europa
zugänglich und erschwinglich ist.
Die Gewährleistung eines gut integrierten und optimierten
europäischen Energienetzes ist ebenso entscheidend für
die Beschleunigung einer kosteneffizienten und sauberen
Energiewende. Die Kommission wird demnächst das
europäische Netzpaket vorlegen, um den Aufbau der
notwendigen Energieinfrastruktur in Europa weiter zu
beschleunigen. Sie wird auch auf die Initiative
„Energieautobahnen“ eingehen, die von Präsidentin von der
Leyen in ihrer jüngsten Rede zur Lage der Europäischen
Union ins Leben gerufen wurde und mit der Engpässe bei
der grenzüberschreitenden Energieinfrastruktur dringend
angegangen und die Widerstandsfähigkeit des
Energiesystems der EU insgesamt erhöht werden sollen.
Nächste Schritte
Nach der heutigen Annahme wird die PCI- und PMI-Liste dem
Europäischen Parlament und dem Rat in Form eines
delegierten Rechtsakts zur Kontrolle gemäß der
TEN-E-Verordnung vorgelegt. Beide gesetzgebenden Organe
haben zwei Monate Zeit, um die Liste entweder vollständig
anzunehmen oder abzulehnen, dürfen sie jedoch nicht
ändern. Dieses Verfahren kann auf Antrag der beiden
gesetzgebenden Organe um zwei Monate verlängert werden.
Sobald die Liste angenommen ist, wird die Kommission ihre
Zusammenarbeit mit den Projektträgern und den
Mitgliedstaaten weiter verstärken, um sicherzustellen,
dass die ausgewählten Projekte so reibungslos und schnell
wie möglich durchgeführt werden.
Diese Woche veranstaltet die Europäische Kommission die
PCI Energy Days, die sich der praktischen Umsetzung von
PCI und PMI widmen. Der für Energie und Wohnungswesen
zuständige EU-Kommissar Dan Jørgensen wird an der
Veranstaltung teilnehmen.
Hintergrund
PCI sollen den EU-Energiemarkt vollenden und zu den
Zielen der Klimaneutralität beitragen und sicherstellen,
dass alle Europäer Zugang zu erschwinglicher,
zuverlässiger und erneuerbarer Energie haben. PMI
umfassen grenzüberschreitende Infrastrukturen zwischen
EU- und Nicht-EU-Ländern, die zu den Energie- und
Klimazielen der EU, einschließlich ihrer kürzlich
angenommenen globalen Vision, beitragen.
Bei der heute angenommenenListe handelt es sich um die
zweite Unionsliste von PCI und PMI, die im Rahmen der
überarbeiteten Verordnung über transeuropäische
Energienetze (TEN-E) ab 2022 erstellt wurde, wobei der
Schwerpunkt weg von fossilen Brennstoffen hin zu
CO2-armen, widerstandsfähigen und effizienten
grenzüberschreitenden Infrastrukturen verlagert wird. In
der Verordnung werden die Kriterien für die Unterstützung
grenzüberschreitender Energieinfrastrukturprojekte
festgelegt, die der Union helfen können, ihr Klima- und
Energieziel der Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen.
Diese Listen werden alle zwei Jahre nach umfassenden
Konsultationen der Interessenträger in regionalen Gruppen
und öffentlichen Konsultationen angenommen.
Mit dem Instrument der Fazilität „Connecting Europe“
(CEF-Energie) wurden seit 2014 8 Mrd. EUR für
Leitprojekte bereitgestellt. Ein Paradebeispiel für
grenzüberschreitende wegweisende Projekte ist die
baltische Synchronisation, mit der die baltischen Staaten
ihre Unabhängigkeit vom russischen Stromnetz
wiedererlangt und die drei Länder vollständig in das
Energiesystem der EU integriert haben. Im Rahmen des
mehrjährigen Finanzrahmens 2028-2034 schlug die
Kommission eine fünffache Aufstockung des CEF-Haushalts
für Energie von 5,84 Mrd. EUR auf 29,91 Mrd. EUR vor.
Für weitere Informationen
|
|
Vereinfachung der
Digitalgesetzgebung: Einsparungen: bis 2029: 5 Mrd
Verwaltungskosten - 150 Mrd für Unternehmen
|
|
Brüssel, 19. November 2025 -
Unternehmen in der EU sollen weniger Zeit mit
Verwaltungsarbeit verbringen und dafür mehr Zeit für
Innovation und Skalierung haben. Das ist der Kern des
Digitalpakets, das die Europäische Kommission vorgelegt
hat.
Es umfasst a) einen sogenannten „Omnibus“, mit dem die
Vorschriften für künstliche Intelligenz (KI),
Cybersicherheit und Daten gestrafft werden,
b) eine Strategie für eine Datenunion zur Erschließung
hochwertiger Daten für KI und 3) die Einführung von
European Business Wallets, dank derer Unternehmen
mithilfe einer einzigen digitalen Identität weniger
Verwaltungsaufwand haben werden und leichter
grenzüberschreitend tätig sein können.
Hohes Einsparpotential
Die Vereinfachungen der Gesetzgebung sollen bis 2029 fünf
Milliarden Euro Verwaltungskosten einsparen helfen, die
business wallets sollen weitere Einsparungen von 150
Milliarden Euro für die Unternehmen bringen.
Europa hat alle nötigen Zutaten für den Erfolg
Henna Virkkunen, Exekutiv-Vizepräsidentin für
Technologische Souveränität, Sicherheit und Demokratie,
sagte: „Wir haben in der EU alles, was es braucht, um
erfolgreich zu sein. Wir haben Talent, Infrastruktur,
einen großen Binnenmarkt. Aber unsere Unternehmen, vor
allem unsere Start-ups, Klein- und Kleinunternehmen
werden oft durch starre Regeln zurückgehalten.
Durch den Abbau von Bürokratie, Vereinfachung der
EU-Rechtsvorschriften, Öffnung des Zugangs zu Daten und
Einführung eines gemeinsamen europäischen Business
Wallets geben wir Raum für Innovationen und ihre
Vermarktung in Europa. Wir tun dies auf die europäische
Art: indem wir sicherstellen, dass die Grundrechte der
Nutzerinnen und Nutzer vollständig geschützt bleiben.“
Valdis Dombrovskis, EU-Kommissar für Wirtschaft und
Produktivität; Umsetzung und Vereinfachung, sagte: „Die
Schließung der Innovationslücke und der Abbau von
Bürokratie sind wichtige Triebkräfte für Steigerung der
Produktivität der EU. Der Vorschlag stellt einen
wichtigen ersten Schritt in unserer Agenda für digitale
Vereinfachung dar und zielt auf günstigere
Rahmenbedingungen für europäische Unternehmen ab.“
Michael McGrath, EU-Kommissar für Demokratie, Justiz,
Rechtsstaatlichkeit und Verbraucherschutz, sagte: „Die
gezielten Änderungen an der Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) soll die Wirksamkeit und Integrität dieser
wegweisenden Regulierung wahren und gleichzeitig den
Forderungen der Interessenträger Rechnung tragen, die
DSGVO klarer, einfacher und harmonisierter zu gestalten.“
Digitaler Omnibus
Strategie für die Datenunion
European Business Wallets
Mit dem heutigen digitalen Omnibus schlägt die Kommission
vor, die bestehenden Vorschriften für Künstliche
Intelligenz, Cybersicherheit und Daten zu straffen.
Innovationsfreundliche KI-Regeln: Die Kommission schlägt
vor, den Beginn der Anwendung der Vorschriften für Hoch-
und Hochrisiko-KI-Systeme mit der Verfügbarkeit von
Unterstützungsinstrumenten, einschließlich der
erforderlichen Standards, zu verknüpfen. Der Zeitplan für
die Anwendung von Hochrisikoregeln wird auf maximal 16
Monate angepasst: Die Anwendung der Vorschriften beginnt,
sobald die Kommission die erforderlichen Standards und
Unterstützungsmaßnahmen bestätigt hat.
Die Kommission schlägt außerdem gezielte Änderungen des
KI-Gesetzes vor, um insbesondere Dokumentationspflichten
für kleinere Unternehmen abzubauen, Compliance-Maßnahmen
auszuweiten und die Befugnisse des AI Offices auszudehnen
und so für einheitliche Governance zu sorgen.
Vereinfachung der Berichterstattung zur Cybersicherheit:
Der Omnibus führt auch einen Single-Entry-Punkt ein, mit
dem Unternehmen alle Verpflichtungen zur Meldung von
Vorfällen erfüllen können. Derzeit sind Unternehmen
verpflichtet, Cybersicherheitsvorfälle unter
verschiedenen Gesetzen zu melden.
Ein innovationsfreundlicher Datenschutzrahmen: um
Innovation zu fördern, schlägt die Kommission gezielte
Änderungen an der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) vor.
Das Herzstück der DSGVO, nämlich das höchste Schutzniveau
in Bezug auf personenbezogene Daten, bleibt bestehen.
Modernisierung der Cookie-Regeln zur Verbesserung der
Online-Erfahrung der Nutzerinnen und Nutzer: die
vorgeschlagenen Änderungen bedeuten weniger Auftauchen
von Cookie-Bannern und ermöglichen es Benutzern, ihre
Zustimmung mit einem einzigen Klick auszudrücken und ihre
Cookie-Präferenzen durch zentrale Einstellungen in
Browsern und Betriebssystemen zu speichern.
Verbesserung des Zugangs zu Daten: Das digitale Paket
zielt darauf ab, den Zugang zu Daten als Schlüsselfaktor
für Innovation zu verbessern. Es vereinfacht Datenregeln
und macht sie für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie
Unternehmen praktikabler.
Die neue Strategie für die Datenunion enthält zusätzliche
Maßnahmen zur Erschließung hochwertigerer Daten für KI,
zum Beispiel über Data Labs. Ein Helpdesk soll bei der
Umsetzung des Data Acts unterstützen. Die Strategie
stärkt auch die Datensouveränität Europas durch einen
strategischen Ansatz für die internationale Datenpolitik:
Anti-Leakag-Toolbox, Maßnahmen zum Schutz sensibler nicht
personenbezogener Daten und Leitlinien zur Bewertung der
Behandlung von EU-Daten im Ausland.
Die vorgeschlagenen Business Wallets bieten europäischen
Unternehmen ein digitales Instrument, das es ihnen
ermöglicht, Vorgänge zu digitalisieren, die in vielen
Fällen derzeit noch persönlich umgesetzt werden müssen.
Unternehmen werden in der Lage sein, Dokumente digital zu
signieren, mit Zeitstempeln und -siegeln zu versehen, sie
sicher zu erstellen, speichern und auszutauschen und auf
sicherem Weg mit anderen Unternehmen oder öffentlichen
Verwaltungen in ihrem eigenen und den übrigen 26
Mitgliedstaaten zu kommunizieren.
Fitness-Check der Digitalgesetzgebung
Die heutigen Vorschläge sind ein erster Schritt der
Kommission zur Vereinfachung und Wirksamkeit des
digitalen Regelwerks der EU. Die Kommission hat zudem
auch den zweiten Schritt der Vereinfachungsagenda
eingeleitet, und zwar mit einer breit angelegten
Konsultation zum digitalen Fitness-Check, die bis zum 11.
März 2026 läuft.
Es wird geprüft, wie das Regelwerk sein Ziel der
Wettbewerbsfähigkeit erreicht und ob die Kohärenz und die
kumulative Wirkung der digitalen Vorschriften der EU
gewahrt sind.
Nächste Schritte
Die Legislativvorschläge für den digitalen Omnibus werden
nun dem Europäischen Parlament und dem Rat der EU-Staaten
vorgelegt.
|
|
EU-Kommission begrüßt Einigung auf EU-Haushalt
für 2026 |
|
Brüssel, 17. November 2024 - Die
Europäische Kommission begrüßt die Einigung zwischen
Europäischem Parlament und den EU-Staaten auf den
EU-Jahreshaushalt für 2026. Haushaltskommissar Piotr
Serafin sagte: „Die rechtzeitige Einigung zwischen den
beiden gesetzgebenden Organen gewährleistet die
Vorhersehbarkeit eines EU-Haushalts, mit dem die
gemeinsamen politischen Prioritäten der Union weiter
vorangebracht werden.“
Knapp 193 Milliarden Euro
Das Budget wird sich auf insgesamt 192,77 Milliarden Euro
belaufen. Es ist Teil des Finanzrahmens von 2021 bis
2027. Schwerpunkte sind die stabile und vorhersehbare
Finanzierung der Ukraine über die Ukraine-Fazilität, eine
Aufstockung der Mittel für humanitäre Hilfe und
Nachbarschaftspolitik sowie für Sicherheit und
Verteidigung.
Haushaltskommissar Serafin sagte: „Dieses
Haushaltsverfahren hat gezeigt, dass wir durch
Zusammenarbeit auf kosteneffizientere Weise mehr
erreichen können. Wir haben mehr in externe Sicherheit,
Verteidigung, Innovation, aber auch in Programme
investiert, die unseren Bürgerinnen und Bürgern,
Studierenden und Landwirten unmittelbar zugutekommen.“
Geld fließt zurück in die Mitgliedsstaaten
Größte Posten sind wie in den vergangenen Jahren auch die
Bereiche „Zusammenhalt, Resilienz und Werte“ mit etwa 72
Milliarden Euro und „Natürliche Ressourcen und Umwelt“
mit etwa 57 Milliarden Euro.
Im Bereich „Zusammenhalt, Resilienz und Werte“ sind
beispielsweise die Regionalfonds enthalten, mit denen die
EU regionale Projekte in den Mitgliedsstaaten stärkt. Der
Bereich „Natürliche Ressourcen und Umwelt“ beinhaltet vor
allem die Zahlungen an Europas Landwirtinnen und
Landwirte.
Nächste Schritte
Der Jahreshaushaltsplan für 2026 sollte nun vom Rat der
Europäischen Union und vom Europäischen Parlament
förmlich angenommen werden. Die Abstimmung im Plenum, mit
der das Verfahren abgeschlossen wird, ist derzeit für den
26. November 2025 geplant.
|
|
Verstößt Google gegen den DMA? EU-Kommission
startet Verfahren |
|
13. November 2025 - Die Europäische
Kommission hat ein Verfahren gegen Alphabet eingeleitet.
Es soll geprüft werden, ob Google faire, angemessene und
diskriminierungsfreie Bedingungen für den Zugang zu den
Websites von Herausgebern in der Google-Suche anwendet.
Das ist eine Verfplichtung nach dem Gesetz über Digitale
Märkte (DMA).
Inhalte in den Google-Suchergebnissen herabgesetzt
Die Überwachungsarbeit der Kommission hat Hinweise darauf
ergeben, dass Google auf der Grundlage seiner „Richtlinie
zum Missbrauch des Rufs von Websites“ die Websites und
Inhalte von Nachrichtenmedien und anderen Verlagen in den
Google-Suchergebnissen herabsetzt, wenn diese Websites
Inhalte von kommerziellen Partnern enthalten. Nach
Angaben von Google zielt diese Politik darauf ab,
Praktiken zu bekämpfen, die angeblich darauf abzielen,
das Ranking in den Suchergebnissen zu manipulieren.
Teresa Ribera, Exekutiv-Vizepräsidentin für einen
sauberen, fairen und wettbewerbsfähigen Wandel sagte:
„Wir befürchten, dass die Richtlinien von Google es nicht
zulassen, dass Nachrichtenverlage in ihren
Suchergebnissen fair, angemessen und diskriminierungsfrei
behandelt werden. Wir werden untersuchen, um
sicherzustellen, dass Nachrichtenverlage in einer für die
Branche schwierigen Zeit keine wichtigen Einnahmen
verlieren, und um sicherzustellen, dass Google das Gesetz
über digitale Märkte einhält.“
Die Untersuchung
Die Untersuchung der Kommission konzentriert sich
speziell auf Googles Politik des Missbrauchs der
Reputation von Websites und darauf, wie diese Politik für
Verlage gilt. Diese Richtlinie scheint sich direkt auf
eine gemeinsame und legitime Möglichkeit für Publisher zu
auswirken, ihre Websites und Inhalte zu monetarisieren.
Henna Virkkunen, Exekutiv-Vizepräsidentin für
technologische Souveränität, Sicherheit und Demokratie
sagte: „Das Gesetz über digitale Märkte sorgt für fairere
Märkte und Innovationen in der EU – für Unternehmen und
Verbraucher. Alphabet muss die Verpflichtungen erfüllen,
Publishern faire, angemessene und diskriminierungsfreie
allgemeine Zugangsbedingungen zur Google-Suche zu bieten.
Unsere gezielte Untersuchung zielt darauf ab, die
Finanzierung der Verlage, ihre unternehmerische Freiheit
und letztlich den Medienpluralismus und unsere Demokratie
zu schützen.“
Daher untersucht die Kommission, ob Alphabets
Degradierung von Websites und Inhalten von Verlagen in
der Google-Suche die Freiheit von Verlagen
beeinträchtigen kann, legitime Geschäfte zu tätigen,
Innovationen zu entwickeln und mit Drittanbietern von
Inhalten zusammenzuarbeiten.
Die Einleitung eines Verfahrens greift einer Feststellung
der Nichteinhaltung nicht vor. Sie deutet lediglich
darauf hin, dass die Kommission den Fall weiterverfolgen
wird.
Die nächsten Schritte
Sollte die Kommission Beweise für eine Nichteinhaltung
finden, wird sie Alphabet über ihre vorläufigen
Feststellungen unterrichten und die Maßnahmen erläutern,
die sie in Betracht zieht oder die Alphabet ergreifen
sollte, um die Bedenken der Kommission wirksam
auszuräumen.
Die Kommission wird bestrebt sein, ihre Untersuchung
innerhalb von zwölf Monaten nach Einleitung des
Verfahrens abzuschließen.
Im Falle einer Zuwiderhandlung kann die Kommission
Geldbußen in Höhe von bis zu 10 Prozent des weltweiten
Gesamtumsatzes des Unternehmens verhängen. Solche
Bußgelder können bei wiederholtem Verstoß bis zu 20
Prozent betragen. Darüber hinaus kann die Kommission im
Falle systematischer Verstöße zusätzliche
Abhilfemaßnahmen ergreifen, wie z. B. die Verpflichtung
eines Gatekeepers, ein Unternehmen oder Teile davon zu
verkaufen, oder das Verbot des Erwerbs zusätzlicher
Dienstleistungen im Zusammenhang mit der systembedingten
Nichteinhaltung.
Hintergrund
Ziel des DMA ist es, bestreitbare und faire Märkte im
digitalen Sektor zu gewährleisten. Es regelt Gatekeeper,
bei denen es sich um große digitale Plattformen handelt,
die ein wichtiges Zugangstor zwischen gewerblichen
Nutzern und Verbrauchern darstellen, deren Position ihnen
die Möglichkeit geben kann, einen Engpass in der
digitalen Wirtschaft zu schaffen.
Am 6. September 2023 benannte die Kommission die
Online-Suchmaschine Google Search von Alphabet als
zentralen Plattformdienst im Rahmen des Gesetzes über
digitale Märkte. Alphabet musste alle DMA-Verpflichtungen
für seine Online-Suchmaschine Google Search bis zum 7.
März 2024 vollständig erfüllen.
Die heutige Einleitung des Verfahrens gegen Alphabet ist
auf Bedenken zurückzuführen, dass Alphabet möglicherweise
nicht den Verpflichtungen nach Artikel 6 Absatz 12 DMA
und Artikel 6 Absatz 5 DMA zur Anwendung transparenter,
fairer und diskriminierungsfreier Bedingungen auf das
Ranking von Google Search nachkommt.
|
|
- Kommission begrüßt Einigung der EU-Staaten auf
neue Klimaziele
- Neue EU-Pläne für Hochgeschwindigkeitszüge und
nachhaltige Kraftstoffe für Luft- und Schiffsverkehr
|
|
Kommission begrüßt Einigung der EU-Staaten auf
neue Klimaziele
Brüssel, 5. November 2025 - Die
Europäische Kommission begrüßt die Einigung der
EU-Staaten über den nationalen Klimabeitrag (nationally
determined contribution, NDC) der EU im Rahmen des
Pariser Klimaabkommens. Er sieht vor, die
Netto-Treibhausgasemissionen bis 2035 um 66,25 bis 72,5
Prozent verglichen mit dem Stand von 1990 zu senken.
Vor der COP30, der Klimakonferenz der Vereinten Nationen
in Belém (Brasilien), sendet die EU so ein starkes und
geeintes Signal an die Weltgemeinschaft. Sie ist weiter
fest entschlossen, die Ziele des Übereinkommens von Paris
zu erreichen und mit globalen Partnern
zusammenzuarbeiten, um die Treibhausgasemissionen zu
senken.
Der neue NDC der EU ist ein ehrgeiziger Meilenstein auf
dem Weg zu einer Nettoreduktion der Treibhausgasemission
um 90 Prozent bis 2040 (verglichen mit dem Stand von
1990) und auf dem Weg zur Klimaneutralität der EU bis
2050.
Klimaziel 2040
Die Kommission begrüßt zudem die Fortschritte, die die
EU-Mitgliedstaaten bei der Einigung auf eine allgemeine
Ausrichtung zum EU-Klimaziel für 2040 erzielt haben. Sie
haben sich auf ein rechtsverbindliches Kernziel für 2040
von 90 Prozent geeinigt. Dies umfasst ein nationales Ziel
von 85 Prozent und bis zu 5 Prozent der internationaler
CO2-Gutschriften.
Die Kommission ist bereit, zu einer raschen Einigung
beizutragen, betont jedoch gleichzeitig, wie wichtig es
ist, den Kern des Vorschlags beizubehalten. Die
Kommission hat einen pragmatischen und flexiblen Fahrplan
bis 2040 vorgelegt, der den heutigen wirtschaftlichen,
sicherheitspolitischen und geopolitischen Gegebenheiten
Rechnung trägt.
Gleichzeitig bietet er Investoren und Unternehmen die
nötige Planungssicherheit, um den Übergang zu einer
sauberen Wirtschaft und die industrielle
Wettbewerbsfähigkeit der EU voranzutreiben.
Neue EU-Pläne für Hochgeschwindigkeitszüge und
nachhaltige Kraftstoffe für Luft- und Schiffsverkehr
In vier statt sieben Stunden von Berlin nach Kopenhagen -
das ist eines der Ziele des neuen Aktionsplanes für den
Hochgeschwindigkeits-Schienenverkehr, den die
EU-Kommission vorgelegt hat. Bis 2040 soll ein
schnelleres, interoperableres und besser vernetztes
europäisches Netz geschaffen werden. Der zweite Plan, den
die Kommission vorgestellt hat, soll Investitionen in
erneuerbare und kohlenstoffarme Kraftstoffe fördern,
insbesondere im Luft- und Schiffsverkehr.
„Das heutige Paket zielt darauf ab, die
Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken und gleichzeitig
entschlossen auf eine klimaneutrale Zukunft
hinzuarbeiten“, sagte EU-Verkehrskommissar Apostolos
Tzitzikostas. „Durch Investitionen in ein schnelleres,
besser vernetztes Schienennetz und den Ausbau
erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe machen wir
das Verkehrssystem Europas sauberer, widerstandsfähiger
und für die Bürgerinnen und Bürger erschwinglicher.“
Aktionsplan für den Hochgeschwindigkeitsverkehr
Der neue Aktionsplan für den Hochgeschwindigkeitsverkehr
legt die Schritte fest, die erforderlich sind, um bis
2040 ein schnelleres, interoperableres und besser
vernetztes europäisches Netz zu schaffen. Er zielt darauf
ab, die Reisezeiten zu verkürzen und den Schienenverkehr
zu einer attraktiveren Alternative zum
Kurzstreckenflugverkehr zu machen, um so die Zahl der
Fahrgäste zu erhöhen und die regionale Wirtschaft und den
Tourismus anzukurbeln. Aufbauend auf dem
transeuropäischen Verkehrsnetz (TEN-V) sieht der Plan
vor, wichtige Knotenpunkte mit Geschwindigkeiten von 200
km/h und mehr zu verbinden.
Beispiele für kürzere Reisezeiten
Passagiere werden dann in vier statt wie bisher sieben
Stunden von Berlin nach Kopenhagen und in sechs statt wie
bisher 13 Stunden und 40 Minuten von Sofia nach Athen
reisen können. Neue grenzüberschreitende Verbindungen
werden auch schnellere und einfachere Reisen ermöglichen,
beispielsweise von Paris über Madrid nach Lissabon, und
die Anbindung der baltischen Hauptstädte verbessern.
Vier Hauptaktionsbereiche
Um diese Vision zu verwirklichen, schlägt die Kommission
vier Hauptaktionsbereiche vor:
Beseitigung grenzüberschreitender Engpässe durch
verbindliche Fristen, die bis 2027 festgelegt werden
sollen, und die Ermittlung von Möglichkeiten für höhere
Geschwindigkeiten, einschließlich Geschwindigkeiten von
deutlich über 250 km/h, sofern dies wirtschaftlich
rentabel ist.
Entwicklung einer koordinierten Finanzierungsstrategie,
einschließlich eines strategischen Dialogs mit den
Mitgliedstaaten, der Industrie und den Finanziers, der zu
einem Hochgeschwindigkeitsbahn-Abkommen führt, um die
erforderlichen Investitionen zu mobilisieren.
Verbesserung der Bedingungen für die Eisenbahnindustrie
und die Eisenbahnbetreiber, um zu investieren, innovative
Lösungen zu entwickeln und wettbewerbsfähig zu agieren,
unter anderem durch ein attraktiveres regulatorisches
Umfeld, durch die Verbesserung grenzüberschreitender
Fahrkarten- und Buchungssysteme, die Unterstützung eines
Gebrauchtmarktes für Schienenfahrzeuge, die
Beschleunigung der Einführung der digitalen
Managementsysteme der EU und die Förderung von Forschung
und Entwicklung sowie der Zusammenarbeit bei skalierbaren
Lösungen.
Stärkung der Governance auf EU-Ebene, indem
Infrastrukturbetreiber zur Koordinierung der Kapazitäten
für grenzüberschreitende Fernverkehrsdienste verpflichtet
werden und Standardisierungen und Genehmigungen
erleichtert werden.
Neben kürzeren Reisezeiten wird der Plan die Überlastung
verringern und Kapazitäten auf konventionellen Strecken
freisetzen, wodurch Nachtzüge, Güterverkehr und
militärische Mobilität erleichtert und gleichzeitig die
Wettbewerbsfähigkeit Europas im Tourismus und in der
Industrie gestärkt werden.
Ausweitung der Investitionen in erneuerbare und
kohlenstoffarme Kraftstoffe
Die zweite verabschiedete Initiative – der Plan für
Investitionen in nachhaltigen Verkehr (Sustainable
Transport Investment Plan, STIP) – legt einen gemeinsamen
Ansatz zur Förderung von Investitionen in erneuerbare und
kohlenstoffarme Kraftstoffe mit Schwerpunkt auf dem Luft-
und Wassertransport fest.
Um die Ziele von RefuelEU Aviation und FuelEU Maritime zu
erreichen, werden bis 2035 rund 20 Millionen Tonnen
nachhaltige Kraftstoffe (Biokraftstoffe und
E-Kraftstoffe) benötigt. Um dies zu erreichen, sind
Investitionen in Höhe von schätzungsweise 100 Milliarden
Euro erforderlich.
Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen
Zu den wichtigsten Investitionsmaßnahmen, mit denen bis
2027 mindestens 2,9 Milliarden Euro über EU-Instrumente
mobilisiert werden sollen, gehören:
Mindestens 2 Milliarden Euro für nachhaltige alternative
Kraftstoffe im Rahmen des EU-Förderprogramms InvestEU.
300 Millionen Euro über die Europäische Wasserstoffbank
zur Förderung von wasserstoffbasierten Kraftstoffen für
die Luft- und Schifffahrt.
446 Millionen Euro für Projekte im Bereich synthetischer
Flugkraftstoffe und Schiffskraftstoffe im Rahmen des
Innovationsfonds.
133,5 Millionen Euro für Forschung und Innovation im
Bereich Kraftstoffe im Rahmen des EU-Forschungsprogramms
Horizon Europe.
Synthetische Flugkraftstoffe
Zusätzlich zu diesen Maßnahmen bereitet die Kommission
gemeinsam mit den Mitgliedstaaten die Einführung eines
Pilotprojektes bis Ende 2025 vor, mit dem mindestens 500
Millionen Euro für Projekte im Bereich synthetischer
Flugkraftstoffe mobilisiert werden sollen. Die Kommission
wird sich auch dafür einsetzen, die Rahmenbedingungen für
Marktinvestitionen zu verbessern, um die
Investitionslücke zu schließen.
Zusammenarbeit und Partnerschaften
Mittelfristig wird die Kommission auf die Einrichtung
eines Mechanismus hinarbeiten, der Kraftstoffproduzenten
und -abnehmer miteinander verbindet, Einnahmesicherheit
bietet und das Investitionsrisiko verringert. Der Plan
wird auch internationale Partnerschaften stärken, um die
weltweite Kraftstoffproduktion auszuweiten und Importe
anzuziehen, die den Nachhaltigkeitskriterien der EU
entsprechen, und gleichzeitig einen fairen Wettbewerb für
EU-Produzenten und -Verbraucher gewährleisten.
|
|
DiscoverEU feiert 40 Jahre Schengen mit 40.000
Tickets für junge Reisende |
|
Brüssel/Duisburg, 30. Oktober 2025 -
Junge Europäerinnen und Europäer erhalten ab heute die
nächste Chance auf ein kostenloses Zug-Reiseticket. Da in
diesem Jahr das 40-jährige Bestehen des Schengener
Abkommens gefeiert wird, also die Grundlage für das
heutige grenzfreie Reisen, stellt die Europäische
Kommission gleich 40.000 Reisetickets zur Verfügung.
Um sich für ein Reiseticket zu bewerben, müssen junge
Menschen, die zwischen dem 1. Januar 2007 und dem 31.
Dezember 2007 geboren sind, ein kurzes Quiz über die EU
auf dem Europäischen Jugendportal ausfüllen. Erfolgreiche
Bewerberinnen und Bewerber haben die Möglichkeit,
zwischen dem 1. März 2026 und dem 31. Mai 2027 bis zu 30
Tage lang kostenlos zu reisen und erhalten eine
Ermäßigungskarte für öffentliche Verkehrsmittel, Kultur,
Unterkunft, Essen, Sport und andere Dienstleistungen in
36 europäischen Ländern.
Vorschläge für Reiserouten: Städte des Neuen Europäischen
Bauhauses und grüne Hauptstädte Europas Junge Reisende
können ihre eigenen Routen planen oder sich von
bestehenden Routen wie der Route
des Neuen Europäischen Bauhauses inspirieren lassen,
die im Einklang mit der Initiative des Neuen
Europäischen Bauhauses Haltestellen in schönen,
nachhaltigen und inklusiven Städten umfasst.
Eine weitere ist die „Green
Route“ von DiscoverEU, die junge Reisende zu einigen
der nachhaltigsten und umweltfreundlichsten Reiseziele
auf dem gesamten Kontinent führt, wie den
Gewinnerstädten der
Auszeichnung „Grüne Hauptstädte Europas“ und „Grüne
Hauptstädte“ oder den Städten, die die Mission
„Klimaneutrale und intelligente Städte“ leiten. Die
besten grünen
Reisetipps von DiscoverEU helfen den Teilnehmern bei
der Planung ihrer grünen Routen.
So läuft die Bewerbung: Die DiscoverEU-Aufforderung wird
am 30. Oktober um 12:00 Uhr MEZ eröffnet und läuft bis
zum 13. November 2025 um 12:00 Uhr MEZ. Es steht
Bewerbern aus der Europäischen Union und mit
dem Programm Erasmus+ assoziierten Drittländern offen.
Teilnehmer mit Behinderungen oder gesundheitlichen
Problemen werden auf ihren Reisen im Einklang mit den
Werten des Programms Erasmus+ und der
DiscoverEU-Inklusionsaktion unterstützt.
Dazu gehört auch die Möglichkeit, mit Begleitpersonen zu
reisen. Das Jugendinformationsnetzwerk Eurodesk
beantwortet alle Fragen zu DiscoverEU und informiert auch
über Alternativen. Eurodesk Deutschland hat ein Infoblatt
über DiscoverEU und über weitere Reisestipendien für
junge Menschen produziert. Die Infoblätter können hier kostenlos
angefordert werden. Eurodesk-Telefon: 0228 9506 250,
E-Mail: rausvonzuhaus@eurodesk.eu.
Hintergrund
Die Kommission hat DiscoverEU im
Juni 2018 auf Initiative des Europäischen Parlaments ins
Leben gerufen. Heute ist es Teil des Programms
Erasmus+ 2021-2027.Seit 2018 haben sich mehr als 1,6
Millionen junge Menschen für 391.000 Reisepässe beworben.
DiscoverEU hat jungen Menschen ein besseres Verständnis
anderer Kulturen und der europäischen Geschichte
vermittelt und ihre Sprachkenntnisse verbessert.
|
|
Europa unabhängiger machen, Zugang zu kritischen
Rohstoffen sichern
|
|
Brüssel, 27. Oktober 2025 -
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat mit Blick auf
die geoökonomische Entwicklung die Notwendigkeit betont,
dass die EU ihre Lieferketten sowie den Zugang zu
kritischen Rohstoffen sichert. Bei ihrer Keynote zum
Abschluss des Berlin Global Dialogue (BGD) 2025 am
Samstag kündigte sie den neuen Plan RESourceEU an.
„Die Welt von heute ist unerbittlich. Und die
Weltwirtschaft ist eine völlig andere als noch vor
wenigen Jahren. Europa kann nicht länger einfach so
weitermachen. Diese Lektion mussten wir bei der Energie
schmerzlich lernen. Wir werden bei den kritischen
Rohstoffen nicht den gleichen Fehler machen. Deshalb ist
es an der Zeit, einen Gang höher zu schalten und die
notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Ob bei Energie oder
Rohstoffen, bei der Verteidigung oder beim Digitalen,
Europa muss versuchen, unabhängig zu werden. Und es ist
an uns, das genau jetzt zu tun.“
Auswirkungen der Ausführkontrollen Chinas auf Europa
Ursula von der Leyen verwies auf die drastische
Verschärfung der Ausfuhrkontrollen für Seltene Erden und
Batteriematerialien durch China und den Einfluss der
Entscheidungen auf Europa: „Wir alle wissen, wie wichtig
Seltene Erden für unsere Industrie sind – ob für Autos,
Halbleiter oder militärisches Gerät. Die Entscheidungen,
die die chinesische Regierung am 9. Oktober verkündet
hat, stellen eine erhebliche Gefahr dar. Im Kern würden
es diese Maßnahmen anderen Länder erheblich erschweren,
einen eigenen Wirtschaftszweig für Seltene Erden
aufzubauen“.
Dies gefährde die Stabilität weltweiter Lieferketten, mit
unmittelbaren Auswirkungen auf europäische Unternehmen:
„Wenn man bedenkt, dass wir mehr als 90 Prozent unseres
Bedarfs an Magneten aus Seltenen Erden durch Einfuhren
aus China decken, sieht man, welche Risiken hier für
Europa und seine strategisch wichtigsten
Industriesektoren bestehen.
Von der Automobilindustrie bis Industriemotoren, von
Verteidigung bis Raumfahrt und von KI-Chips bis
Datenzentren. Kurzfristig konzentrieren wir uns darauf,
Lösungen mit unserem chinesischen Gegenüber zu finden.
Aber wir sind bereit, alle uns zur Verfügung stehenden
Instrumente einzusetzen, wenn es notwendig wird. Und wir
werden zusammen mit unseren G7-Partnern eine koordinierte
Reaktion ausarbeiten.“
Neuer Plan RESourceEU
Die Kommissionspräsidentin verwies auf die strukturelle
Herausforderung, vor den Europa steht: „Unsere Antwort
muss dem Ausmaß der Risiken angemessen sein, denen wir
auf diesem Gebiet ausgesetzt sind. Deshalb kann ich
ankündigen, dass wir an einem neuen Plan RESourceEU
arbeiten – nach dem Vorbild der Initiative REPowerEU,
durch die es uns gelungen ist, die Energiekrise gemeinsam
zu bewältigen. Ziel ist es, unserer europäischen
Industrie kurz-, mittel- und langfristig den Zugang zu
alternativen Quellen für kritische Rohstoffe zu
sichern.“
Von der Leyen ging auf einige Details ein, konkret die
Kreislaufwirtschaft und internationale Partnerschaften:
Kreislaufwirtschaft: nachhaltiger Umgang mit Ressourcen
Partnerschaften und Global Gateway „Das beginnt bei der
Kreislaufwirtschaft“, unterstreicht Ursula von der
Leyen.
„Nicht aus ökologischen Gründen. Sondern um kritische
Rohstoffe aus Produkten zu nutzen, die bereits in Europa
im Umlauf sind. Einige Unternehmen können bis zu
95 Prozent der kritischen Rohstoffe aus Batterien
recyceln. Dadurch werden wertvolle Rohstoffe gewonnen,
Abfall reduziert und ein nachhaltiger Umgang mit
Ressourcen gefördert. Wir werden alle Möglichkeiten
nutzen – von gemeinsamer Beschaffung bis zu Lagerhaltung.
Wir werden Investitionen in strategische Projekte zur
Herstellung und Verarbeitung kritischer Rohstoffe hier in
Europa ankurbeln.“
„Wir werden die Arbeit an Partnerschaften im Bereich der
kritischen Rohstoffe mit Ländern wie der Ukraine,
Australien, Kanada, Kasachstan, Usbekistan, Chile oder
Grönland voranbringen. Und wir werden im Rahmen von
Global Gateway weltweit in Projekte investieren, von
denen Europa profitieren kann. Global Gateway ist in
unserem Interesse, aber auch gut für unsere Partner und
unser gemeinsames weltweites Warenangebot.“
Rasch handeln, Mut zeigen, Unabhängigkeit anstreben
Abschließend bekräftigte von der Leyen, dass Europa einen
Plan hat und von Partnern weltweit als verlässlicher und
attraktiver Markt gesehen werde. Sie verwies auf den
Abschluss diverser Handelsabkommen, mit dem Mercosur, mit
Mexiko, Indonesien und der Schweiz, und den laufenden
Verhandlungen mit diversen weiteren Ländern.
„Diese neuen Partnerschaften werden neue aufstrebende
Märkte erschließen, die wirtschaftliche Sicherheit
stärken und Engpässe in unseren Lieferketten verhindern.
Der Punkt hier ist: Europa muss sein geoökonomisches
Gewicht zu seinem Vorteil und für seine eigenen
Interessen einsetzen. Das ist letztlich der Weg, wie
Europa seinen Platz in der heutigen Weltwirtschaft finden
kann. Und wie es in diesem neuen Zeitalter der auf
Konfrontation ausgerichteten Geoökonomie prosperieren
kann.
Europa hat alles, was es dazu braucht. Aber wir müssen
unsere Einstellung verändern – gefragt sind rasches
Handeln, Unabhängigkeit und Mut. Gemeinsam wird uns das
gelingen.”
Hintergrund
Der BGD ist ein hochrangiges Forum für den Austausch über
wirtschaftliche, geopolitische und gesellschaftliche
Fragen mit internationalen Führungspersönlichkeiten aus
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Es findet ein Mal
im Jahr in Berlin statt.
|
|
Vorläufige Feststellung der EU: TikTok und Meta
haben gegen DSA-Transparenzpflichten verstoßen
|
Brüssel, 24. Oktober 2025 - Die EU-Kommission hat
vorläufig festgestellt, dass sowohl TikTok als auch Meta
gegen ihre Verpflichtungen gemäß dem Gesetz über digitale
Dienste (DSA) verstoßen haben.
Die Verstöße betreffen den angemessenen Zugang zu
öffentlichen Daten für Forscherinnen und Forscher.
Außerdem hat Meta sowohl für Instagram als auch für
Facebook gegen die Verpflichtung verstoßen, Nutzerinnen
und Nutzern einfache Mechanismen zur Meldung illegaler
Inhalte zur Verfügung zu stellen und es ihnen zu
ermöglichen, Entscheidungen über die Moderation von
Inhalten wirksam anzufechten.
„Unsere Demokratien sind auf Vertrauen angewiesen. Das
bedeutet, dass Plattformen die Nutzer stärken, ihre
Rechte respektieren und ihre Systeme der Kontrolle öffnen
müssen“, sagte Henna Virkkunen, Exekutiv-Vizepräsidentin
für technologische Souveränität, Sicherheit und
Demokratie. „Der DSA macht dies zu einer Pflicht, nicht
zu einer Wahl.
Mit den heutigen Maßnahmen haben wir nun vorläufige
Ergebnisse zum Zugang von Forschern zu Daten auf vier
Plattformen veröffentlicht. Wir stellen sicher, dass die
Plattformen für ihre Dienste gegenüber den Nutzern und
der Gesellschaft rechenschaftspflichtig sind, wie dies im
EU-Recht vorgesehen ist.“
|
|
EU-Kommission vergibt
Schülerzeitungspreis in Deutschland: Einsendeschluss: 15.
Januar
|
|
Brüssel, 23.
Oktober 2025 - Der Schülerzeitungswettbewerb der
Länder geht in eine neue Runde, gesucht werden die besten
Schülerzeitungen Deutschlands. In diesem Rahmen vergibt
die Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland
ihren Schülerzeitungspreis „Europa“.
Mit der Auszeichnung würdigt sie Schülerzeitungen, die
sich mit Europa im Alltag ihrer jugendlichen Leserinnen
und Leser beschäftigen. Sie bittet junge
Medienmacherinnen und Medienmacher an deutschen Schulen
aller Schulkategorien, die über aktuelle europäische
Themen schreiben, Podcasts oder Videos über europäische
Projekte erstellen oder über Erfahrungen mit Europa an
ihrer Schule bloggen, ihre Beiträge bei der
Jugendpresse oder direkt bei der Vertretung der
Europäischen Kommission einzureichen.
Der Einsendeschluss ist der 15. Januar 2026.
Bewerbungen, Preise und Jury Die Schulkategorien umfassen
die Grund-, Haupt-, Real- und Förderschulen, die
Gymnasien sowie die beruflichen Schulen. Im Februar
werden die Preisträgerinnen und Preisträger auf einer
Jurysitzung ausgewählt. Der Sonderpreis „Europa“ ist mit
einem Preisgeld von 1.000 Euro ausgestattet.
Neben Preisgeldern ist eine feierliche Preisverleihung im
Bundesrat und der Schülerzeitungskongress mit einem
vielfältigen Weiterbildungsprogramm durch Workshops,
unter anderem zu europäischen Themen, Teil der Ehrung der
Redaktionen. Die Bewerbung auf einen oder mehrere
Sonderpreise können über das Bewerbungsportal Mitmachen
- Schülerzeitung oder direkt in der Vertretung der
Europäischen Kommission eingereicht werden.
Jugendpresse Deutschland
Die Jugendpresse sucht jedes Jahr die besten
Schülerzeitungen Deutschlands. Damit sollen die Leistung
und das Engagement junger Journalistinnen und
Journalisten öffentlich präsentiert und gewürdigt und sie
auch vernetzt und finanziell belohnt werden.
Gewinner 2025
Die Schülerzeitung „PEER plus“ des Egbert-Gymnasium
Münsterschwarzach in Bayern gewann
den Schülerzeitungpreis der Europäischen Kommission in
diesem Jahr. Die Zeitung „PEER plus“ hat mit
verschiedenen journalistischen Formaten zum Thema Europa
überzeigt. Neben Berichten über europapolitische
Diskussionen in der Schule wurden drei Themen tiefer
behandelt: Populismus in Europa, das
europäische Asylsystem und die Absenkung des Wahlalters.
Bei allen Beiträgen wurde zwischen Berichterstattung und
Kommentar unterschieden.
2026 wird die Vertretung der Europäischen Kommission in
Deutschland den Preis zum siebzehnten Mal vergeben.
|
|
EU-Staaten beschließen 19. Sanktionspaket gegen
Russland
|
|
Brüssel, 23.
Oktober 2025 - Die Europäische Kommission begrüßt die
Annahme des 19. Sanktionspakets gegen Russland durch die
EU-Mitgliedstaaten. Das neue Sanktionspaket erhöht den
Druck auf die russische Kriegswirtschaft erheblich.
Kaja Kallas, Hohe Vertreterin der Union für Außen- und
Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin der Kommission,
sagte:„Wir haben gerade unser 19. Sanktionspaket
verabschiedet. Es richtet sich unter anderem gegen
russische Energieunternehmen, Banken, Kryptobörsen und
Unternehmen in China. Die EU reguliert auch die
Bewegungen russischer Diplomaten, um
Destabilisierungsversuchen entgegenzuwirken. Für Putin
wird es immer schwieriger, seinen Krieg zu finanzieren.
Jeder Euro, den wir Russland vorenthalten, ist ein Euro,
den es nicht für den Krieg ausgeben kann. Das 19. Paket
wird nicht das letzte sein.“
Die Maßnahmen im Detail Die neuen Maßnahmen konzentrieren
sich auf Schlüsselsektoren wie Energie, Finanzen, die
militärisch-industrielle Basis, Sonderwirtschaftszonen
sowie auf die Ermöglicher und Profiteure des russischen
Angriffskrieges: Ein vollständiges Verbot von russischem
Flüssigerdgas (LNG) und ein weiteres Vorgehen gegen die
Schattenflotte sind die bisher schärfsten Sanktionen
gegen Russlands Energiesektor.
Die Maßnahmen zielen auch auf Finanzdienstleistungen und
Infrastruktur (einschließlich erstmals Kryptowährungen)
sowie auf den Handel ab. Auch der Dienstleistungssektor
ist Gegenstand der Maßnahmen, und die Instrumente zur
Bekämpfung von Umgehungen werden gestärkt. Mit diesem
Paket steigt die Zahl der gelisteten Schiffe in Russlands
Schattenflotte auf insgesamt 557.
Verbot von russischem Flüssigerdgas
Maria Luís Albuquerque, EU-Kommissarin für
Finanzdienstleistungen und die Spar- und
Investitionsunion, erklärte: „Mit diesem 19. Paket setzen
wir eine breite Palette zusätzlicher Maßnahmen ein, um
die schwächelnde russische Wirtschaft noch weiter zu
schwächen. Ein Verbot von Flüssiggas wird dort ansetzen,
wo es am meisten weh tut, während zusätzliche Maßnahmen
zu Finanzdienstleistungen - einschließlich
Kryptowährungen - und strengere Maßnahmen zur Bekämpfung
von Umgehungen ebenfalls eine starke Wirkung haben
werden.
Der Umfang und die Tiefe dieser Maßnahmen unterstreichen
unsere unermüdliche Entschlossenheit, die Ukraine zu
unterstützen. Wir werden weiterhin neue Maßnahmen
entwickeln und umsetzen, solange es nötig ist.“
Dan Jørgensen, EU-Kommissar für Energie und
Wohnungswesen, ergänzte: „Europa hat eine historische
Entscheidung getroffen. Wir werden alle Einfuhren von
russischem Flüssiggas bis Ende 2026 stoppen und gegen die
Öl-Schattenflotte vorgehen. Dies ist ein beispielloser
Schritt, den die EU in Einigkeit und voller Solidarität
mit der Ukraine unternimmt. Er wird Putins Kriegsmaschine
einen schweren Schlag versetzen und die
Friedensbemühungen für Kiew unterstützen. Europa muss
seine Energieunabhängigkeit zurückgewinnen. Die Ukraine
muss sich durchsetzen.“
Eine ausführliche Liste der beschlossenen Sanktionen
finden Sie in Kürze im Amtsblatt
der EU.
|
|
Erklärung zum Frieden in der Ukraine
|
|
Brüssel, 21. Oktober 2025 - Der
ukrainische Präsident Selenskyj hat mit dem britischen
Ministerpräsidenten Starmer, Bundeskanzler Merz, dem
französischen Präsidenten Macron, der Premierministerin
von Italien Meloni, dem polnischen Premierminister Tusk,
Kommissionspräsidentin von der Leyen, Ratspräsident
Costa, dem norwegischen Premierminister Støre, dem
finnischen Präsidenten Stubb und der Ministerpräsidentin
von Dänemark Frederiksen ein Statement zum Frieden in der
Ukraine abgegeben.
In der gemeinsamen Erklärung heißt es: „Wir alle sind in
unserem Wunsch nach einem gerechten und dauerhaften
Frieden, den das ukrainische Volk verdient, vereint. Wir
unterstützen nachdrücklich den Standpunkt von Präsident
Trump, dass die Kämpfe unverzüglich beendet werden
sollten und dass die derzeitige Kontaktlinie der
Ausgangspunkt der Verhandlungen sein sollte. Wir setzen
uns weiterhin für den Grundsatz ein, dass internationale
Grenzen nicht gewaltsam verändert werden dürfen.“
|
|
EU-Fahrplan zur Wahrung des Friedens –
Verteidigungsbereitschaft 2030
|
|
Brüssel, 17. Oktober 2025 -
Die
Europäische Kommission und die Hohe Vertreterin der EU
für Außen und Sicherheitspolitik Kaja Kallas haben den
EU-Mitgliedstaaten den „Fahrplan zur Wahrung des Friedens
– Verteidigungsbereitschaft 2030“ vorgeschlagen. Dieser
Plan soll die europäischen Verteidigungsfähigkeiten
stärken.
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte: „Die
jüngsten Bedrohungen haben gezeigt, dass Europa in Gefahr
ist. Wir müssen alle Bürgerinnen und Bürger und jeden
Quadratzentimeter unseres Territoriums schützen. Europa
muss mit Einheit, Solidarität und Entschlossenheit
reagieren. Der Verteidigungsfahrplan enthält einen klaren
Plan mit gemeinsamen Zielen und konkreten Meilensteinen
auf unserem Weg bis 2030. Denn nur was sich messen lässt,
wird auch getan.“
Vier Leitinitiativen für die europäische Bereitschaft In
dem Fahrplan werden vier Leitinitiativen für die
europäische Bereitschaft vorgeschlagen: Europäische
Drohnen-Verteidigungsinitiative, Eastern Flank Watch,
Europäischer Luftschild und Verteidigungsraumschild.
Diese vier Initiativen werden die Verteidigungsindustrie
stärken, die Produktion beschleunigen und die
Unterstützung für die Ukraine aufrechterhalten.
Wie vom Europäischen Rat im Juni gefordert, werden im
Verteidigungsfahrplan klare Ziele und Etappenziele zur
Schließung von Fähigkeitslücken, zur Beschleunigung der
Verteidigungsinvestitionen in allen Mitgliedstaaten und
als Richtschnur für die Fortschritte der EU auf dem Weg
zur vollständigen Verteidigungsbereitschaft bis 2030
festgelegt. Die Stärkung der Verteidigung Europas
bedeutet auch, fest gegenüber der Ukraine zu stehen.
|
|
Ab 2028:
Energieeffizientere Ladegeräte für Laptops, Smartphones
und andere elektronische Geräte
|
|
Brüssel, 14. Oktober 2025 - Viele der
gängigsten elektronischen Geräte werden künftig
energieeffizienter, weniger umweltschädlich und
verbraucherfreundlicher. Eine entsprechende Änderung der
Ökodesign-Anforderungen für externe Netzteile (external
power supplies, EPS) hat die Europäische Kommission
angenommen.
Die Entscheidung ist Teil der Bemühungen hin zu einem
gemeinsamen Ladegerät für elektronische Geräte. Sie sieht
neben höheren Energieeffizienzstandards auch eine größere
Interoperabilität vor, beispielsweise durch
obligatorische USB-C-Anschlüsse für alle USB-Ladegeräte
für Geräte wie Laptops, Smartphones, Router und
Computermonitore.
Dan Jørgensen, EU-Kommissar für Energie und
Wohnungswesen, erklärte: „Gemeinsame Ladegeräte für
unsere Smartphones, Laptops und andere Geräte, die wir
täglich verwenden, sind ein kluger Schachzug: die
Verbraucherinnen und Verbraucher stehen an erster Stelle,
gleichzeitig werden Energieverschwendung und Emissionen
reduziert werden.“
Die Regeln werden Ende 2028 in Kraft treten; die
Hersteller haben also drei Jahre Zeit, um sich auf die
Änderungen vorzubereiten.
Einsparpotential von 100 Millionen Euro pro Jahr
Es wird erwartet, dass die Änderungen bis 2035 jährliche
Einsparungen von rund 3 Prozent des Energieverbrauchs
während eines EPS-Lebenszyklus bewirken, die
Treibhausgasemissionen um 9 Prozent und die
Schadstoffemissionen um 13 Prozent sinken werden. Für die
Verbraucher bedeutet dies Einsparpotenziale von rund 100
Millionen Euro pro Jahr.
Neues Logo
Darüber hinaus wird ein neues gemeinsames
EU-Ladegerät-Logo den Verbrauchern helfen, kompatible
Geräte zu identifizieren und fundierte Entscheidungen zu
treffen. Diese Initiative baut auf früheren Bemühungen
zur Standardisierung von Ladeanschlüssen und
-technologien für elektronische Geräte auf.
|
|
Schutz Minderjähriger im
Netz: EU-Kommission leitet Untersuchungen zu Snapchat,
YouTube, Apple und Google ein
|
|
Brüssel, 10. Oktober 2025 - Die
Europäische Kommission hat erstmals Ermittlungen unter
den Leitlinien zum Schutz Minderjähriger im Rahmen des
Gesetzes über digitale Dienste (DSA) eingeleitet. Konkret
fordert die Kommission Snapchat, YouTube, Apple und
Google auf, Informationen über ihre
Altersüberprüfungssysteme bereitzustellen.
Die Kommission fragt auch nach Informationen dazu, wie
die Plattformen verhindern, dass Minderjährige auf
illegale Produkte, einschließlich Drogen oder Vapes, oder
schädliches Material wie Inhalte zur Förderung von
Essstörungen zugreifen können.
Henna Virkkunen, Exekutiv-Vizepräsidentin für
Technologische Souveränität, Sicherheit und Demokratie,
erklärte: „Wir werden alles in unserer Macht Stehende
tun, um das körperliche und geistige Wohlbefinden von
Kindern und Jugendlichen im Internet zu gewährleisten. Es
beginnt mit Online-Plattformen. Die Plattformen sind
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Minderjährige in
ihren Diensten sicher sind – sei es durch Maßnahmen, die
in den Leitlinien zum Jugendschutz enthalten sind, oder
durch ebenso wirksame Maßnahmen ihrer Wahl. Heute prüfen
wir gemeinsam mit den nationalen Behörden in den
Mitgliedstaaten, ob die bisher von den Plattformen
ergriffenen Maßnahmen tatsächlich Kinder schützen.“
Einzelheiten Die Kommission fordert Snapchat auf,
Informationen darüber vorzulegen, wie sie Kinder unter 13
Jahren daran hindert, ihre Dienste in Anspruch zu nehmen,
wie durch ihre eigenen Nutzungsbedingungen vorgegeben.
Die Kommission fordert Snapchat außerdem auf,
Informationen über die Funktionen bereitzustellen, über
die es verfügt, um den Verkauf illegaler Waren für Kinder
wie Vapes oder Drogen zu verhindern.
In Bezug auf YouTube erfragt die Kommission zusätzlich zu
den Informationen über die Alterssicherung weitere
Einzelheiten zu Empfehlungen auf der Plattform, nachdem
sie gemeldet hat, dass schädliche Inhalte an
Minderjährige verbreitet wurden.
Für den Apple App Store und Google Play erfragt die
Kommission Informationen darüber, wie sie mit dem Risiko
umgehen, dass Nutzer, einschließlich Minderjähriger,
illegale oder anderweitig schädliche Apps herunterladen
können, einschließlich Glücksspiel-Apps und Tools zur
Erstellung nicht einvernehmlicher sexualisierter Inhalte,
die sogenannten „nudify apps“. Die Kommission versucht
auch zu verstehen, wie die beiden App-Stores die
Alterseinstufungen der Apps anwenden.
|
|
EU-Einreise-/Ausreisesystem startet
schrittweise ab dem 12. Oktober |
|
Brüssel, 10. Oktober 2025 - Ab dem 12.
Oktober beginnen die Mitgliedstaaten mit der Einführung
von Europas neuem digitalen Grenzsystems an ihren
Außengrenzen, dem Einreise-/Ausreisesystem EES. Das EES
ist ein vollständig digitales System für die Ein- und
Ausreise von Nicht-EU-Bürgerinnen und Bürgern, die für
Kurzaufenthalte in 29 europäische Länder reisen,
einschließlich der assoziierten Schengen-Staaten.
Es wird biometrische Daten wie Fingerabdrücke,
Gesichtsbilder und andere Reiseinformationen erfassen.
Mit dem EES wird das Abstempeln von Reisepässen
schrittweise ersetzt. Die sechsmonatige Einführungsphase
gibt Mitgliedstaaten, Reisenden und Unternehmen Zeit,
sich an das neue System anzupassen. Das EES wird die
Verwaltung der Grenzen modernisieren und verbessern.
Es wird zuverlässige Daten über Grenzübertritte liefern
und systematisch Aufenthaltsüberzieher sowie Fälle von
Dokumenten- und Identitätsbetrug aufdecken. Somit trägt
EES dazu bei, irreguläre Migration zu verhindern und die
Sicherheit der europäischen Bürgerinnen und Bürger zu
schützen.
Darüber hinaus wird durch den verstärkten Einsatz
automatisierter Grenzkontrollen das Reisen für alle
reibungsloser und sicherer. Das neue System entspricht
den höchsten Standards für den Schutz von Daten und
Privatsphäre und gewährleistet, dass die persönlichen
Daten der Reisenden geschützt bleiben.
Hintergrund
Das EES ist Teil des EU-Pakets „Intelligente
Grenzen“, mit dem das Management der EU-Außengrenzen
durch den Einsatz modernster Technologien und innovativer
Lösungen verbessert werden soll. Das Paket umfasst das
EES, das Europäische
Reiseinformations- und -genehmigungssystem (ETIAS)
und eine erweiterte und stärker harmonisierte Nutzung der
von den Mitgliedstaaten genutzten Systeme der automatischen
Grenzkontrolle (ABC). Zusammen werden diese Systeme
allen Reisenden in die und aus der EU ein effizienteres,
sichereres und bequemeres Reiseerlebnis ermöglichen.
Schutz Minderjähriger im Netz: EU-Kommission leitet
Untersuchungen zu Snapchat, YouTube, Apple und Google ein
Die Europäische Kommission hat erstmals Ermittlungen
unter den Leitlinien zum Schutz Minderjähriger im Rahmen
des Gesetzes über digitale Dienste (DSA) eingeleitet.
Konkret fordert die Kommission Snapchat, YouTube, Apple
und Google auf, Informationen über ihre
Altersüberprüfungssysteme bereitzustellen. Die Kommission
fragt auch nach Informationen dazu, wie die Plattformen
verhindern, dass Minderjährige auf illegale Produkte,
einschließlich Drogen oder Vapes, oder schädliches
Material wie Inhalte zur Förderung von Essstörungen
zugreifen können. Henna Virkkunen,
Exekutiv-Vizepräsidentin für Technologische Souveränität,
Sicherheit und Demokratie, erklärte: „Wir werden alles in
unserer Macht Stehende tun, um das körperliche und
geistige Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen im
Internet zu gewährleisten. Es beginnt mit
Online-Plattformen. Die Plattformen sind verpflichtet,
dafür zu sorgen, dass Minderjährige in ihren Diensten
sicher sind – sei es durch Maßnahmen, die in den
Leitlinien zum Jugendschutz enthalten sind, oder durch
ebenso wirksame Maßnahmen ihrer Wahl. Heute prüfen wir
gemeinsam mit den nationalen Behörden in den
Mitgliedstaaten, ob die bisher von den Plattformen
ergriffenen Maßnahmen tatsächlich Kinder schützen.“
Einzelheiten Die Kommission fordert Snapchat auf,
Informationen darüber vorzulegen, wie sie Kinder unter 13
Jahren daran hindert, ihre Dienste in Anspruch zu nehmen,
wie durch ihre eigenen Nutzungsbedingungen vorgegeben.
Die Kommission fordert Snapchat außerdem auf,
Informationen über die Funktionen bereitzustellen, über
die es verfügt, um den Verkauf illegaler Waren für Kinder
wie Vapes oder Drogen zu verhindern. In Bezug auf
YouTube erfragt die Kommission zusätzlich zu den
Informationen über die Alterssicherung weitere
Einzelheiten zu Empfehlungen auf der Plattform, nachdem
sie gemeldet hat, dass schädliche Inhalte an
Minderjährige verbreitet wurden. Für den Apple App Store
und Google Play erfragt die Kommission Informationen
darüber, wie sie mit dem Risiko umgehen, dass Nutzer,
einschließlich Minderjähriger, illegale oder anderweitig
schädliche Apps herunterladen können, einschließlich
Glücksspiel-Apps und Tools zur Erstellung nicht
einvernehmlicher sexualisierter Inhalte, die sogenannten
„nudify apps“. Die Kommission versucht auch zu verstehen,
wie die beiden App-Stores die Alterseinstufungen der Apps
anwenden.
|
|
Vorteile für Bankkunden: Überweisungen jetzt schneller und
sicherer
|
|
Brüssel, 9. Oktober 2025 - Neue
EU-Vorschriften machen Überweisungen im Euro-Raum ab
sofort schneller und sicherer. Die Vorschriften
verpflichten Zahlungsdienstleister, wie zum Beispiel
Banken, Sofortüberweisungen anzubieten. Diese dürfen
nicht teurer sein als eine herkömmliche Überweisung, die
in der Regel kostenfrei ist.
Maria Luis Albuquerque, EU-Kommissarin für
Finanzdienstleistungen und die Spar- und
Investitionsunion, sagte: „Heute beginnt eine neue Ära
für Zahlungen in Europa. Die Verordnung über
Sofortzahlungen wird das tägliche Leben unserer
Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen erheblich
verbessern, indem sie es ihnen ermöglicht, Zahlungen
sofort rund um die Uhr zu versenden und zu empfangen.“
Überweisungen im Euro-Raum werden nicht nur schneller,
sondern auch sicherer. Denn die Vorschriften verlangen
von den Zahlungsdienstleistern eine Empfängerprüfung, um
Fehlüberweisungen zu verhindern. EU-Kommissarin
Albuquerque sagte zu den Vorschriften zur
Empfängerprüfung: „Dadurch werden die Transaktionen
sicherer, wobei Zahlungsdienstleister verpflichtet sind,
den vorgesehenen Begünstigten zu überprüfen und im Falle
eines Fehlers oder mutmaßlichen Betrugs eine Warnmeldung
an den Zahler zu senden.“
|
|
Kollegiumssitzung zur Sicherheitslage in Europa
|
|
Brüssel, 30. September 2025 - Vor der
fünften Sitzung des sogenannten Sicherheitskollegs hat
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Beisein
von NATO-Generalsekretär Mark Rutte eine Erklärung
abgegeben. „Ich habe diese Sitzung einberufen, um die
Sicherheitslage in Europa zu erörtern und Ihre Ansichten
zu hören. Die Wahrung des Friedens ist seit jeher eine
zentrale Aufgabe der Europäischen Union, und auch wenn
sich die Instrumente dafür im Laufe der Zeit gewandelt
haben, ist das Ziel dasselbe geblieben.“
Mit Entschlossenheit das Blatt wenden Mit Blick auf die
Invasion Russlands in die Ukraine sagte von der
Leyen: „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in diesem
Konflikt an einem Punkt angelangt sind, wo sich das Blatt
wenden kann, wenn wir entschlossen handeln.“ Die Ukraine
leiste seit drei Jahren und sieben Monaten Widerstand und
habe 2025 praktisch kein Territorium eingebüßt.
Mehr als eine Viertel Million Russen sei auf dem
Schlachtfeld gestorben, der wirtschaftliche Druck in
Russland wachse – mit Zinssätzen bei 17 Prozent und einer
Inflation deutlich über 10 Prozent. Beispiellose Schritte
unternommen Von der Leyen verwies auf die Schritte der
Kommission in den vergangenen Monaten: „In unserem
„Weißbuch“ wurden die strategische Ausrichtung und die
Prioritäten skizziert. Und wir haben neue Möglichkeiten
der Finanzierung unserer Verteidigung vorgeschlagen.
Unser Ad-hoc-Instrument SAFE wurde in Rekordzeit
einsatzbereit.“
Über das weitere Vorgehen wird morgen auf der informellen
Tagung des Europäischen Rates beraten. Kernbereiche der
europäischen Verteidigung Die Kommissionspräsidentin
sprach konkret drei relevante und zentrale Themen an, die
sich auch im Fahrplan „Bereitschaft 2030“ wiederfinden,
das in zwei Wochen vorgestellt wird:
Kapazitätsfrage: „Wir verfügen über ein einziges
Kräftedispositiv, das unterschiedliche Missionen erfüllt
– im Rahmen der NATO, der EU, der Vereinten Nationen oder
im Rahmen von Koalitionen der Willigen. Deshalb benötigen
wir interoperable Fähigkeiten in enger Zusammenarbeit mit
der NATO. Dazu müssen wir die gemeinsame Beschaffung von
Verteidigungsgütern ausbauen.“
Vorzeigeprojekte: „Das Vorzeigeprojekt „Eastern Flank
Watch“ zum Beispiel muss jetzt vorangebracht werden.
Europa muss entschlossen und geeint auf die
Drohnenvorstöße Russlands an unseren Grenzen reagieren.
Deshalb werden wir Sofortmaßnahmen vorschlagen, um im
Rahmen von Eastern Flank Watch einen Drohnenwall zu
errichten. Das müssen wir rasch auf den Weg bringen -
gemeinsam mit der Ukraine und in enger Abstimmung mit der
NATO.“
Industrielle Bereitschaft: „Eine rasch ausgebaute,
widerstandsfähige und innovative europäische
Verteidigungsindustrie ist der Schlüssel zur
Verteidigungsbereitschaft der EU. Die Industrie muss
schnell und im nötigen Umfang liefern und modernste
Verteidigungsgüter herstellen.“
Blick auf die Ukraine – den Täter Russland zur
Verantwortung ziehen
Von der Leyen betonte, dass die Sanktionen gegen
Russland funktionieren und der Druck weiter erhöht werden
müsse, etwa über das vorgeschlagene 19. Sanktionspaket.
Es sieht robuste Maßnahmen in den Bereichen Energie,
Finanzdienstleistungen und Handel vor, ein
Schlüsselelement ist das Verbot von LNG-Einfuhren aus
Russland.
Auch die militärische Unterstützung für die Ukraine müsse
verstärkt werden: „Konkret haben wir uns mit der Ukraine
darauf geeinigt, insgesamt 2 Milliarden Euro für Drohnen
zur Verfügung zu stellen. Dies ermöglicht es der Ukraine,
ihre Produktionskapazitäten für Drohnen auszuweiten, und
die EU wird von dieser Technologie profitieren können.“
Für eine erfolgreiche asymmetrische
Verteidigungsstrategie sei eine strukturiertere Lösung
für die militärische Unterstützung notwendig: „Aus diesem
Grund habe ich ein Reparationsdarlehen auf der
Grundlage von eingefrorenem russischen
Staatsvermögen vorgeschlagen. Das Darlehen würde nicht in
einem Zug ausgezahlt werden. Die Auszahlung würde in
Tranchen und mit Auflagen erfolgen.“
Die Vermögenswerte werden nicht beschlagnahmt, die
Ukraine muss das Darlehen zurückzahlen, wenn Russland
Entschädigung leistet. Ein Teil des Darlehens soll für
Beschaffungen in Europa und gemeinsam mit Europa
herangezogen werden, zur Stärkung der europäischen
Verteidigungsindustrie.
|
|
Von
der Leyen in New York: Europa hält bei Klimazielen Kurs
|
New York, 25. September 2025 - Die Welt kann weiter auf
Europa als Vorreiter beim Klimaschutz zählen. Das hat
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beim
Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York
bekräftigt.
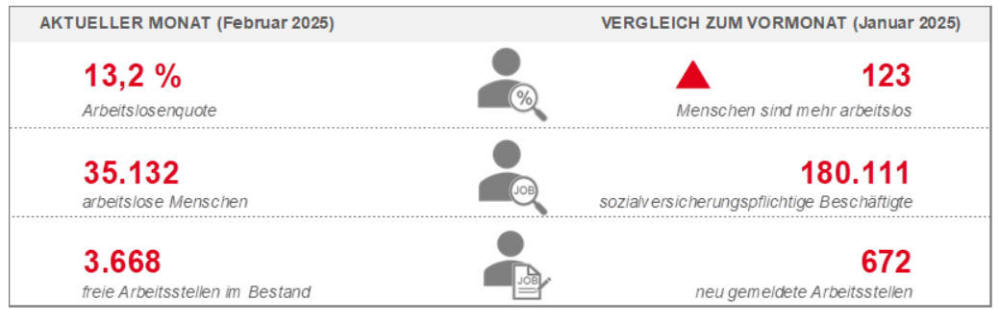
Sie sagte: „Ich versichere Ihnen: Europa hält bei seinen
Klimazielen Kurs. Seit 1990 sind unsere Emissionen um
fast 40 Prozent gesunken. Sie entsprechen jetzt sechs
Prozent der weltweiten Emissionen. Wir sind auf dem
besten Weg, unser Ziel von 55 Prozent weniger Emissionen
bis 2030 zu erreichen.“ Für 2040 peile die EU eine
Senkung der Emissionen um 90 Prozent an, so die
Kommissionspräsidentin. „Das ist unser Weg zur
Klimaneutralität bis 2050.“
Die EU werde ihren national festgelegten Beitrag im
Vorfeld der COP30 förmlich vorlegen. Entwicklungen seit
dem Pariser Klimaabkommen Die Kommissionspräsidentin
erklärte: „Vor zehn Jahren haben wir das Übereinkommen
von Paris geschlossen. Seitdem hat sich die Welt
verändert. Ich möchte Ihnen nur drei Zahlen nennen. Die
erneuerbaren Energien haben um 140 Prozent zugenommen.
Die Investitionen in saubere Energie sind um fast 80
Prozent gestiegen. Und die Länder mit CO2-Bepreisung
haben sich von 40 auf 80 verdoppelt. Die Energiewende
kommt voran.“
Mehr in globale Partnerschaften investieren
Von der Leyen betonte zudem: „Wir wollen uns noch mehr in
globalen Partnerschaften engagieren. Denn die Frage
lautet nicht mehr, ob und wie schnell diese Wende
stattfindet, sondern wer davon profitiert. Europa hat da
eine klare Antwort: Alle Länder – weltweit – sollten
Nutznießer sein, vor allem aber die schwächsten. Darum
bleiben wir der weltweit größte Anbieter von
Klimafinanzierung.
Zusätzlich dazu werden wir bis zu 300 Milliarden Euro zur
weltweiten Unterstützung der Energiewende durch Global
Gateway-Investitionsprogramm mobilisieren, und wir werden
unsere kollektive Übereinkunft, die erneuerbaren Energien
bis 2030 zu verdreifachen, in die Tat umsetzen. Dies
geschieht durch Projekte.
So unterstützen wir mehr als 300 Millionen Menschen in
Afrika, damit sie Zugang zu Elektrizität haben und sauber
kochen können. Dabei geht es nicht nur ums Klima. Es geht
um elementare Menschenwürde. Denn keine Mutter, kein Kind
sollte sterben, nur weil sie unter entsetzlichen
Bedingungen kochen muss.“
Bekenntnis zum Multilateralismus
Die nächste Klimakonferenz in Belém (Brasilien), COP30,
sei der beste Ort für ein ausdrückliches Bekenntnis zum
Multilateralismus. „Packen wir's an!“, so von der Leyen.
|
|
Handelsabkommen EU-Indonesien steht
|
|
Brüssel, 23. September 2025 - Die
Europäische Union und Indonesien haben ihre Verhandlungen
über ein umfassendes Wirtschaftspartnerschaftsabkommen
und ein Investitionsschutzabkommen abgeschlossen. Dies
folgt auf eine entsprechende politische
Einigung zwischen Kommissionspräsidentin von der
Leyen und Präsident Prabowo Subianto vom 13. Juli.
„Unser Abkommen mit Indonesien schafft neue Möglichkeiten
für Unternehmen, Landwirtinnen und Landwirte,“ erklärte
von der Leyen. „Es bietet uns auch eine stabile und
vorhersehbare Versorgung mit kritischen Rohstoffen, die
für Europas saubere Technologie und die Stahlindustrie
von wesentlicher Bedeutung sind.“
Senkung von Zöllen
Das Handelsabkommen (CEPA) schafft eine Freihandelszone
mit über 700 Millionen Verbraucherinnen und Verbrauchern.
Es wird den europäischen Landwirtinnen und Landwirten
erheblich zugutekommen, da die Zölle auf Agrar- und
Lebensmittelerzeugnisse gesenkt und traditionelle
EU-Erzeugnisse sowie wichtige Industriezweige wie die
Automobil-, Chemie- und Maschinenbaubranche geschützt
werden. Insgesamt werden die EU-Exporteure jährlich rund
600 Millionen Euro an Zöllen einsparen, die derzeit auf
Waren entrichtet werden, die auf den indonesischen Markt
gelangen. Europäische Produkte werden für indonesische
Verbraucherinnen und Verbrauchern erschwinglicher.
Das Abkommen ist auch ein wichtiger Meilenstein für die
EU und Indonesien, um nachhaltiges Wachstum und den
ökologischen Wandel zu fördern.
Privilegierter Zugang für große und kleine europäische
Unternehmen
Das Abkommen wird EU-Unternehmen einen privilegierten
Zugang zum indonesischen Markt gewähren, indem
die Einfuhrzölle auf 98,5 Prozent der Zolltarifpositionen
abgeschafft und Verfahren für EU-Warenausfuhren nach
Indonesien, einschließlich wichtiger Ausfuhren wie Pkw
und Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse, vereinfacht
werden; die Erbringung von Dienstleistungen in
Schlüsselsektoren wie IT und Telekommunikation durch
EU-Unternehmen ermöglicht wird;
neue Möglichkeiten für EU-Investitionen in Indonesien
erschlossen werden, insbesondere in strategischen
Sektoren wie Elektrofahrzeuge, Elektronik und
Arzneimittel, wodurch die Integration der Versorgungs-
und Wertschöpfungsketten beider Seiten gefördert wird;
geistiges Eigentum wie Marken geschützt wird, und es
EU-Unternehmen so ermöglicht wird, ihre Markenidentität
und ihren Ruf zu schützen.
Ein großer Gewinn für die europäischen Landwirte
Dank der Abschaffung der Zölle auf wichtige EU-Ausfuhren
wie Milchprodukte, Fleisch, Obst und Gemüse und eine
breite Palette verarbeiteter Lebensmittel werden die
Landwirte in der EU wesentlich bessere Möglichkeiten
erhalten, ihre Erzeugnisse in Indonesien zu verkaufen.
Außerdem werden 221 geografische Angaben für die EU und
72 geografische Angaben für indonesische Produkte
geschützt. Schließlich werden besonders sensible Agrar-
und Lebensmittelerzeugnisse wie Reis, Zucker und frische
Bananen geschützt, indem die bestehenden Zölle
aufrechterhalten werden, und für der Zugang bestimmter
anderer Erzeugnisse gelten Quoten für den Zugang zum
EU-Markt.
Ein Deal für nachhaltiges Wachstum und Entwicklung
Das Abkommen EU-Indonesien verfügt über eine starke
Nachhaltigkeitssäule. So wird mit dem Abkommen das
Pariser Klimaschutzabkommen als wesentliches Element
festgelegt und der Handel mit und Investitionen in
Produkte gefördert, die für Umwelt- und Klimaziele von
entscheidender Bedeutung sind, einschließlich
erneuerbarer Energien und CO2-armer Technologien.
Das CEPA bietet eine Plattform für Zusammenarbeit, Dialog
und Handelserleichterungen in einer Reihe von
handelsbezogenen Umwelt- und Klimafragen, auch im
Palmölsektor. Dies bietet Möglichkeiten, die Gespräche
über Nachhaltigkeit zwischen der EU und Indonesien
voranzubringen und sicherzustellen, dass mehr Handel,
Sozialschutz und eine solide Umweltpolitik Hand in Hand
gehen.
Sichere und nachhaltige Versorgung mit kritischen
Rohstoffen
Indonesien ist ein weltweit führender Hersteller von
Rohstoffen, von denen viele für den grünen und digitalen
Sektor von entscheidender Bedeutung sind. Das Abkommen
stärkt berechenbare, zuverlässige und nachhaltige
Lieferketten, unter anderem durch ermäßigte Zölle,
Exporterleichterungen, Umweltverträglichkeitsprüfungen
und erweiterte Zusammenarbeit.
Nächste Schritte
Die ausgehandelten Textentwürfe werden in Kürze
veröffentlicht. Diese Texte werden rechtlich überarbeitet
und in alle EU-Amtssprachen übersetzt. Die Europäische
Kommission wird dann dem Rat ihren Vorschlag für die
Unterzeichnung und den Abschluss des CEPA und des IPA
vorlegen. Nach der Annahme durch den Rat können die EU
und Indonesien die Abkommen unterzeichnen.
Nach der Unterzeichnung werden die Texte dem Europäischen
Parlament zur Zustimmung übermittelt. Nach Zustimmung des
Europäischen Parlaments und nach deren Ratifizierung
durch Indonesien können das CEPA und das IPA in Kraft
treten.
|
|
EU-Wettbewerb für
Nachwuchswissenschaftler 2025: Vier Preise an junge
Forschende aus Deutschland verliehen
|
|
Brüssel,
22. September 2025 - Beim 36. EU-Wettbewerb für
Nachwuchswissenschaftler (EUCYS) haben Mia Maurer und
Misha Hedge aus Deutschland für ihre Forschung zu
Bakterien einen dritten Preis erhalten, Johanna Freya
Pluschke und Vincent Engelbrecht bekamen zwei
Sonderpreise für ihre Arbeiten zu elektrischen
Antriebssystemen und zu Zoo-Management.
In Riga (Lettland) hatten sich die vielversprechendsten
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler im
Alter von 14 bis 20 Jahren aus 40 Ländern fünf Tage lang
gemessen, um die prestigereichen EUCYS-Preise zu
erhalten. Ekaterina Sachariewa, Kommissarin für
Start-Ups, Forschung und Innovation, gratulierte den
Gewinnerinnen und Gewinnern von EUCYS 2025.
Ihr Talent und ihr Engagement zeige, warum Europa
weiterhin in junge Wissenschaftler investieren müsse.
Kreativität und Exzellenz der nächsten Generation werden
Europa an der Spitze von Forschung und Innovation halten
Die Projekte, die den ersten Preis in Höhe von jeweils
7000 Euro erhielten, gingen an junge Forschende aus
Kanada, der Tschechischen Republik, aus Polen und aus
Schweden.
Der zweite und dritte Preis (jeweils 5.000 Euro und 3.500
Euro) wurde verliehen für Projekte aus der Türkei,
Portugal, Griechenland, Kanada, Dänemark, Deutschland,
Ungarn und den USA. Der Sonderpreis der Jury in Höhe von
2.500 Euro ging an Georgien. Die Gewinnerprojekte teilen
sich ein Preisgeld von insgesamt 64.500 Euro. Der European
Union Contest for Young Scientists (EUCYS) ist der
wichtigste wissenschaftliche Wettbewerb für angehende
Forschende in der EU und wurde 1989 von der Europäischen
Kommission ins Leben gerufen.
Jedes Jahr kommen die besten jungen Forschenden im Alter
von 14 bis 20 Jahren aus der EU und darüber hinaus
zusammen, um ihre Projekte einer internationalen Jury
vorzustellen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten
zuvor alle erste Preise bei nationalen
Wissenschaftswettbewerben ihrer Heimatländer in ihren
Fachgebieten gewonnen. Ihre Projekte decken ein breites
Spektrum wissenschaftlicher Disziplinen ab, von Biologie,
Chemie, Umwelt und Materialien über Informatik,
Ingenieurwesen, Mathematik und Physik bis hin zu Medizin
und Sozialwissenschaften.
Teilnahme junger Wissenschaftlerinnen wird gefördert
EUCYS will die Karriere junger Forschender aus Europa und
darüber hinaus fördern, indem es ihnen die Möglichkeit
bietet, sich mit Gleichaltrigen auf internationaler Ebene
zu messen und auszutauschen, während sie von einigen der
bekanntesten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
Europas beraten und angeleitet werden.
Ein weiteres Hauptziel von EUCYS ist die Förderung der
Teilnahme junger Wissenschaftlerinnen an Forschung und
Innovation, da sie in STEAM immer noch unterrepräsentiert
sind. In diesem Jahr sind 60 der 132 Teilnehmer Mädchen,
was eine Verbesserung von fast 5 Prozent gegenüber dem
Wettbewerb 2024 bedeutet. EUCYS findet 2026 in Kiel statt
EUCYS wird jedes Jahr in einem anderen europäischen Land
veranstaltet. 2026 wird die Veranstaltung im Rahmen des
von der EU finanzierten Großprojekts „Science Comes to
Town“ in Kiel stattfinden.
|
|
EU-Kommission schlägt
Aussetzung von Handelszugeständnissen mit Israel und
Sanktionen gegen extremistische Minister und gewalttätige
Siedler vor
|
|
Brüssel, 17.
September 2025 - Nach der Ankündigung von
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in ihrer Rede
zur Lage der Union hat die Europäische Kommission dem
Rat ihren Vorschlag zur Aussetzung bestimmter
handelsbezogener Bestimmungen des Assoziierungsabkommens
zwischen der EU und Israel sowie ihre Vorschläge für
Sanktionen gegen die Hamas, extremistische Minister und
gewalttätige Siedler vorgelegt.
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte: „Die
schrecklichen Ereignisse, die sich täglich in Gaza
abspielen, müssen aufhören. Es muss einen sofortigen
Waffenstillstand geben, ungehinderten Zugang für
humanitäre Hilfe und die Freilassung aller von der Hamas
festgehaltenen Geiseln. Die Europäische Union bleibt der
größte Geber humanitärer Hilfe und ein unermüdlicher
Verfechter der Zwei-Staaten-Lösung.
In Anbetracht dieser grundsätzlichen Verpflichtungen und
unter Berücksichtigung der schwerwiegenden jüngsten
Entwicklungen im Westjordanland schlagen wir vor, die
Handelszugeständnisse mit Israel auszusetzen,
extremistische Minister und gewalttätige Siedler zu
sanktionieren und die bilaterale Unterstützung Israels
auf Eis zu legen, ohne unsere Arbeit mit der israelischen
Zivilgesellschaft oder Yad Vashem zu beeinträchtigen.“
Keine bilaterale Unterstützung für Israel mehr (mit
Ausnahmen)
Die Kommission stellt auch ihre bilaterale Unterstützung
für Israel ein, mit Ausnahme der Unterstützung für die
Zivilgesellschaft und Yad Vashem. Konkret betrifft dies
künftige jährliche Mittelzuweisungen zwischen 2025 und
2027, laufende Projekte der institutionellen
Zusammenarbeit mit Israel sowie Projekte, die im Rahmen
der regionalen Kooperationsfazilität EU-Israel finanziert
werden.
Verstoß Israels gegen Menschenrechte und demokratische
Grundsätze
Die Vorschläge folgen auf eine Überprüfung der Einhaltung
von Artikel 2 des Abkommens durch Israel. Dabei wurde
festgestellt, dass die Maßnahmen der israelischen
Regierung einen Verstoß gegen wesentliche Elemente in
Bezug auf die Achtung der Menschenrechte und der
demokratischen Grundsätze darstellen. Dies berechtigt die
EU zur einseitigen Aussetzung des Abkommens.
Konkret bezieht sich dieser Verstoß auf die sich rapide
verschlechternde humanitäre Lage im Gazastreifen infolge
der israelischen Militärintervention, die Blockade der
humanitären Hilfe, die Intensivierung der
Militäroperationen und die Entscheidung der israelischen
Behörden, den Siedlungsplan im so genannten E1-Gebiet des
Westjordanlandes voranzutreiben.
Das untergräbt eine Zweistaatenlösung weiter. Die
Aussetzung betrifft die wichtigsten handelsbezogenen
Bestimmungen des Abkommens und bedeutet in der Praxis,
dass Einfuhren aus Israel ihren präferenziellen Zugang
zum EU-Markt verlieren. Auf diese Waren werden daher
Zölle in der Höhe erhoben, die für jedes andere Drittland
gelten, mit dem die EU kein Freihandelsabkommen
geschlossen hat.
Nächste Schritte: Aussetzung der handelsbezogenen
Bestimmungen
Die Kommission schlägt einen Beschluss des Rates über die
Aussetzung bestimmter handelsbezogener Bestimmungen des
Abkommens vor, die unter die gemeinsame Handelspolitik
der Union fallen. Der Rat muss den Beschluss mit
qualifizierter Mehrheit annehmen.
Der Beschluss wird am Tag seiner Annahme in Kraft treten.
Sobald der Beschluss angenommen ist, wird der
Assoziationsrat EU-Israel über die Aussetzung
unterrichtet. Die Aussetzung wird 30 Tage nach der
Notifizierung an den Assoziationsrat wirksam.
Sanktionen gegen die Hamas, extremistische Minister der
israelischen Regierung und gewalttätige Siedler Konkret
besteht das Paket aus vier Entwürfen für Rechtsakte mit
neun Listenvorschlägen gegen die Minister und Siedler (im
Rahmen des globalen Sanktionsregimes der EU im Bereich
der Menschenrechte) sowie aus einem verstärkten Paket von
Listen gegen zehn Mitglieder des Hamas-Politbüros, das
auf einem neuen Listenkriterium im Rahmen des
Hamas-Sanktionssystems beruht. Der Rat muss den Beschluss
nun einstimmig billigen.
|
|
Verteidigungsbereitschaft
Europas: Vorläufige Zuweisung von 150 Mrd. Euro über SAFE
ohne Beteiligung Deutschlands
|
|
Brüssel, 9.
September 2025 - Die Europäische Kommission hat die
vorläufige Mittelzuweisung von 150 Milliarden Euro aus
dem Programm „Sicherheitsaktion für Europa“ (SAFE)
angenommen. Ziel ist, die Verteidigungsfähigkeiten der EU
zu stärken und die Mitgliedstaaten dabei zu unterstützen,
kritische Lücken zu schließen und gemeinsam
Verteidigungsgüter zu erwerben.
Die vorläufige Mittelzuweisung für die einzelnen
Mitgliedstaaten finden Sie hier.
Deutschland hat keine Absicht bekundet, sich zu
beteiligen. In eine sichere Zukunft investieren,
potentielle Angreifer abschrecken Henna Virkkunen,
Exekutiv-Vizepräsidentin für Tech-Souveränität,
Sicherheit und Demokratie sagte: „Der heutige Beschluss
zeigt das Engagement der Europäischen Union für die
Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich und ihre
Entschlossenheit, in eine sicherere Zukunft zu
investieren.“
Verteidigungskommissar Andrius Kubilius sprach von einem
historischen Erfolg für die EU: „Mit dem Weißbuch zur
Verteidigungsbereitschaft haben wir uns verpflichtet, die
Aufrüstungsbemühungen der Mitgliedstaaten und der Ukraine
zu unterstützen. Weniger als sechs Monate später ist das
nun Realität. Dieser beträchtliche Betrag wird dazu
beitragen, potenzielle Angreifer abzuschrecken und die
europäische Verteidigung zu stärken.“
Kostengünstige Darlehen mit einer Laufzeit von 10 Jahren
Nach seiner Annahme durch den Rat im Mai 2025 hat das
SAFE-Programm großes Interesse geweckt. SAFE wird
langfristige, kostengünstige Darlehen bereitstellen, um
die Mitgliedstaaten bei der Beschaffung dringend
benötigter Verteidigungsgüter zu unterstützen.
SAFE wird es der EU auch ermöglichen, die Ukraine weiter
zu unterstützen, indem sie die ukrainische
Verteidigungsindustrie von Anfang an mit dem Instrument
verbindet. Das Programm sieht eine Frist von zehn Jahren
für die Rückzahlung von Darlehen, wettbewerbsfähige
Zinssätze und Optionen für bilaterale Abkommen mit
Drittländern zur Ausweitung der Förderfähigkeit vor.
Vorlage der nationalen Investitionspläne bis November
2025
Die Mitgliedstaaten können nun ihre nationalen
Investitionspläne ausarbeiten, in denen die Verwendung
des möglichen finanziellen Beistands beschrieben wird.
Diese Pläne sind bis Ende November 2025 vorzulegen. Die
Kommission wird dann diese nationalen Pläne bewerten, um
die ersten Auszahlungen Anfang 2026 vorzunehmen.
SAFE ist ein wichtiges EU-Instrument zur Stärkung von Resilienz und
Sicherheit. Es unterstützt Investitionen in Bereichen wie
Verteidigung, Infrastruktur mit doppeltem
Verwendungszweck, Cyberfähigkeiten und strategische
Lieferketten.
|
|
EU schlägt Zollsenkungen zur Umsetzung des
Abkommens mit den USA vor |
|
Brüssel, 29. August 2025 - Die
Europäische Kommission hat zwei Vorschläge vorlegt, die
den Weg für die Umsetzung der gemeinsamen
EU/USA-Erklärung zum transatlantischen Handel vom 21.
August 2025 ebnen. Diese Vorschläge gewährleisten eine
rückwirkende Zollentlastung durch die USA für den
wichtigen Automobilsektor der EU ab dem 1. August.

Umsetzung in beiderseitigem Interesse
EU-Handelskommissar Maros Šefčovič sagte: „Das Abkommen
zwischen der EU und den USA ist mehr als nur ein Schritt
in Richtung Stabilität. Es schafft die Grundlage für eine
engere Zusammenarbeit bei gemeinsamen Herausforderungen
und setzt gemeinsame Ziele – beispielsweise im
Stahlbereich – in konkrete Ergebnisse um. Es liegt in
unserem beiderseitigen Interesse, dass beide Seiten ihre
Verpflichtungen einhalten und die vollständige Umsetzung
des Abkommens sicherstellen. Ich begrüße insbesondere die
Senkung der Zölle auf Autos und Autoteile auf 15 Prozent
ab dem 1. August, die dazu beitragen wird, dass unsere
Automobilindustrie auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig
bleibt.“
Details zu den beiden Vorschlägen
Der erste Rechtsakt betrifft einen Vorschlag zur
Abschaffung der Zölle auf US-Industriegüter und zur
Gewährung eines präferenziellen Marktzugangs für eine
Reihe von US-Meeresfrüchten und nicht sensiblen
Agrargütern.
Mit dem zweiten Vorschlag wird vorgeschlagen, die
Zollfreiheit für Hummer zu verlängern, die nun auch für
verarbeiteten Hummer gilt.
Die Kommission wird weiterhin mit den USA
zusammenarbeiten, um die Zölle zu senken, auch im Rahmen
der Verhandlungen über ein künftiges Abkommen zwischen
der EU und den USA über gegenseitigen, fairen und
ausgewogenen Handel.
Nächste Schritte
Die Vorschläge der Kommission sind der notwendige
legislative Schritt, um die in Abschnitt 1 der
Gemeinsamen Erklärung der EU und der USA genannten
Zollsenkungen der EU in Kraft zu setzen.
Das Parlament und der Rat müssen die beiden Vorschläge
nun im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens
genehmigen, bevor die Zollsenkungen der EU in Kraft
treten können.
Gemäß Abschnitt 3 der Gemeinsamen Erklärung der EU und
der USA wird erwartet, dass die USA die vereinbarte
US-Zollobergrenze von 15 Prozent auf Autos und Autoteile
aus der EU umsetzen. Das wird voraussichtlich am ersten
Tag desselben Monats in Kraft treten, in dem die
Legislativvorschläge der Europäischen Union eingeführt
werden, d. h. am 1. August 2025. Das erspart den
Automobilherstellern Zölle in Höhe von mehr als 500
Millionen Euro, die andernfalls für Ausfuhren in nur
einem Monat zu entrichten gewesen wären.
Die USA haben sich außerdem verpflichtet, ab dem 1.
September für bestimmte Warenkategorien, für die nur der
Meistbegünstigungszollsatz gilt, keine oder nahezu keine
Zölle zu erheben (nicht verfügbare natürliche Ressourcen,
einschließlich Kork, alle Flugzeuge und Flugzeugteile,
generische Arzneimittel und ihre Bestandteile sowie
chemische Grundstoffe). Beide Seiten haben sich darauf
geeinigt, diese Liste weiter auszudehnen.
Hintergrund
Am 21. August gaben die EU und die USA eine gemeinsame
Erklärung zum transatlantischen Handel und zu
Investitionen ab. Diese Gemeinsame Erklärung bestätigt
die von Präsidentin von der Leyen und Präsident Trump am
27. Juli erzielte politische Einigung und baut auf ihr
auf.
Die transatlantische Partnerschaft ist eine
Hauptschlagader des Welthandels und die bedeutendste
bilaterale Handels- und Investitionsbeziehung der Welt.
Der Waren- und Dienstleistungsverkehr zwischen der EU und
den USA hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt
und wird im Jahr 2024 ein Volumen von 1,6 Billionen Euro
erreichen, wobei der Warenhandel 867 Milliarden Euro und
der Dienstleistungsverkehr 817 Milliarden Euro beträgt.
Diese tiefgreifende und umfassende Partnerschaft wird
durch gegenseitige Investitionen untermauert. Im Jahr
2022 investierten Unternehmen aus der EU und den USA 5,3
Billionen Euro in die Märkte der jeweils anderen Seite.
|
|
Gemeinsame EU/USA-Erklärung zu
transatlantischem Handel und Investitionen
|
Brüssel, 21. August 2025 - Die EU und die USA haben eine
Gemeinsame Erklärung veröffentlicht, die einen Rahmen für
einen fairen, ausgewogenen und für beide Seiten
vorteilhaften transatlantischen Handel und Investitionen
schafft. Sie baut auf der politischen Einigung von
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und
US-Präsident Donald Trump vom 27. Juli auf. Die Erklärung
(engl.) ist hier verlinkt.
Die transatlantischen Beziehungen sind mit 1,6 Billionen
Euro jährlich die wertvollsten Wirtschaftsbeziehungen der
Welt. Das Abkommen sichert diese Beziehungen und
Millionen Arbeitsplätze in der EU. Vorhersehbarkeit,
Stabilität, Sicherheit Die Kommissionspräsidentin
betonte, dass die EU stets das Beste für ihre
Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen anstrebt:
„Im Angesicht einer schwierigen Situation haben wir
unseren Mitgliedstaaten und unserer Industrie geholfen
und Klarheit und Kohärenz im transatlantischen Handel
wiederhergestellt. Das ist nicht das Ende des Prozesses,
sondern wir arbeiten weiterhin mit den USA zusammen, um
mehr Zollsenkungen zu vereinbaren, um weitere Bereiche
der Zusammenarbeit zu ermitteln und mehr Potential für
das Wirtschaftswachstum zu schaffen.“
Strategisches Abkommen, von dem viele Sektoren
profitieren EU-Handelskommissar Maros Šefčovič sagte mit
Blick auf die intensive und konstruktive Zusammenarbeit
mit der US-amerikanischen Seite: „Die Gemeinsame
Erklärung hat in einer Zeit, in der sich die globale
Handelslandschaft grundlegend verändert, echtes Gewicht.
Es ist ein ernstzunehmendes, strategisches Abkommen – und
wir stehen voll und ganz hinter ihm.“
Šefčovič betonte, dass ein breites Spektrum von Sektoren
profitieren wird – dazu gehören auch strategische
Wirtschaftszweige wie Autos, Arzneimittel, Halbleiter und
Holz. Ein Handelskrieg hätte viel Schaden angerichtet
Der Handelskommissar fügte hinzu: „Die Alternative – ein
Handelskrieg mit Hochzöllen und politischer Eskalation –
würde Arbeitsplätze, Wachstum und Unternehmen auf beiden
Seiten des Atlantiks schädigen. Stattdessen müssen die EU
und die USA einen Weg der Zusammenarbeit einschlagen, der
auf unser gemeinsames Ziel der Reindustrialisierung und
Stärkung der wirtschaftlichen Resilienz abgestimmt ist.“
Erster Schritt in einem fortlaufenden Prozess In der
Gemeinsamen Erklärung wird die Verpflichtung beider
Seiten dargelegt, auf die Wiederherstellung von
Stabilität und Berechenbarkeit im Handel und bei den
Investitionen zwischen der EU und den USA zum Nutzen von
Unternehmen und Bürgern hinzuarbeiten. Das ist der erste
Schritt in einem Prozess, der den Handel steigern und den
Marktzugang in weiteren Sektoren verbessern wird.
Details Für die überwiegende Mehrheit der EU-Ausfuhren,
einschließlich strategischer Sektoren wie Kraftfahrzeuge,
Arzneimittel, Halbleiter und Holz, gilt ein Zollsatz
von maximal 15 Prozent (all-inclusive, beinhaltet also
auch bestehende MFN-Zölle). Sektoren, für die bereits
Meistbegünstigungstarife von 15 Prozent oder mehr gelten,
unterliegen keinen zusätzlichen Zöllen.
Für Personenkraftwagen und Kraftfahrzeugteile werden die
15 Prozent parallel zum Start des EU-Verfahrens für
Zollsenkungen für US-Erzeugnisse gelten. Ab dem 1.
September wird eine Reihe von Produktgruppen von
einer Sonderregelung profitieren, bei der nur
Meistbegünstigungstarife gelten. Dazu gehören nicht
verfügbare natürliche Ressourcen (z. B. Kork), alle
Flugzeuge und Luftfahrzeugteile, Generika und ihre
Inhaltsstoffe sowie chemische Ausgangsstoffe.
Beide Seiten unternehmen ehrgeizige Anstrengungen, um
diese Regelung auf andere Produktkategorien auszuweiten –
ein wichtiges Ergebnis für die EU. Die EU und die USA
beabsichtigen, ihre Volkswirtschaften vor Überkapazitäten
im Stahl- und Aluminiumsektor zu schützen und an sicheren
Lieferketten zu arbeiten. Dazu gehört eine
Zollkontingentslösung für EU-Ausfuhren von Stahl und
Aluminium und deren Derivaten.
Nächste Schritte
Die Kommission wird mit Unterstützung der
EU-Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments und im
Einklang mit den einschlägigen internen Verfahren rasch
die wichtigsten Aspekte der Vereinbarung umsetzen. Die EU
wird sich auch an der Aushandlung eines Abkommens über
einen fairen, ausgewogenen und für beide Seiten
vorteilhaften Handel mit den USA im Einklang mit dem
vereinbarten Rahmen und den geltenden Verfahren
beteiligen.
Im Anschluss an das politische Abkommen zwischen der EU
und den USA hat die EU mit Wirkung vom 7. August auch die
am 24. Juli 2025 angenommenen Maßnahmen zur
Wiederherstellung des Gleichgewichts ausgesetzt.
Hintergrund Die transatlantische Partnerschaft ist eine
Schlüsselfunktion des Welthandels und die bedeutendste
bilaterale Handels- und Investitionsbeziehung weltweit.
Der Waren- und Dienstleistungsverkehr zwischen der EU und
den USA hat sich in den vergangenen zehn Jahren
verdoppelt und lag 2024 bei über 1,6 Billionen Euro. Der
Warenhandel betrug 867 Milliarden Euro, der Handel mit
Dienstleistungen 817 Milliarden Euro. Das sind täglich
mehr als 4,2 Milliarden Euro an Waren und
Dienstleistungen über den Atlantik.
Diese vertiefte und umfassende Partnerschaft wird durch
gegenseitige Investitionen untermauert. Im Jahr 2022
investierten Unternehmen aus der EU und den USA in die
Märkte der jeweils anderen Seite 5,3 Billionen Euro.
|
|
Waldbrände in Europa: Länder nutzen
EU-Katastrophenschutzverfahren |
|
Brüssel, 14. August 2025
- In den vergangenen Tagen haben
Griechenland, Spanien, Bulgarien, Montenegro
und Albanien das
EU-Katastrophenschutzverfahren aktiviert.
Über Europa verteilt treten derzeit gehäuft
Waldbrände auf, die bewältigt werden müssen,
und die EU hilft dabei.
Überblick über betroffene Länder und
bereitgestellte Leistungen
Gestern hat Spanien das
EU-Katastrophenschutzverfahren aktiviert,
zum ersten Mal für die gemeinsame Bekämpfung
von Waldbränden. Die Europäische Kommission
hat rasch zwei rescEU-Flugzeuge mobilisiert,
die in Frankreich stationiert sind und heute
eingesetzt werden sollen. (rescEU wurde als
strategische Reserve europäischer
Katastrophenabwehrkapazitäten und -vorräte
eingerichtet und wird vollständig von der EU
finanziert.)
Griechenland hat das Verfahren vorgestern,
am 12. August, aktiviert. Als Reaktion
darauf werden die beiden schwedischen
rescEU-Hubschrauber, die derzeit in
Bulgarien eingesetzt werden, dorthin
verlegt. Feuerwehrleute aus Tschechien,
Moldau und Rumänien helfen vor Ort bei der
Brandbekämpfung. Sie sind Teil der Kräfte
aus verschiedenen Ländern, die für die Dauer
der Saison pro-aktiv an strategisch wichtige
Standorte geschickt wurden, um bei Bedarf
schnell die örtlichen Kräfte unterstützen zu
können.
In Bulgarien haben sechs Länder –
Tschechien, die Slowakei, Frankreich,
Ungarn, Rumänien und Schweden –
Luftfahrzeuge über das
Katastrophenschutzverfahren mobilisiert,
einschließlich der in Schweden stationierten
rescEU-Hubschrauber.
In Albanien hat die Kommission
rescEU-Luftressourcen aus Kroatien,
Bulgarien, Italien, Tschechien und der
Slowakei mobilisiert.
In Montenegro mobilisierte die Kommission
rescEU-Mittel in Tschechien, Kroatien und
Italien. Serbien, Ungarn und Bosnien und
Herzegowina haben im Rahmen bilateraler
Angebote auch Flugzeuge eingesetzt,
Österreich bot Löschteams am Boden an.
16 Bitten um Unterstützung in der aktuellen
Brandsaison Das
EU-Katastrophenschutzverfahren wurde in der
aktuellen Brandsaison bereits 16 Mal
aktiviert. Die Länder in Europa kämpfen mit
einer Hitzewelle, die mit einer hohen Zahl
katastrophaler Waldbrände auf dem gesamten
Kontinent einhergeht.
Die Zahl der Aktivierungen für 2025
entspricht bereits den gesamten
Aktivierungen für Waldbrände im Jahr 2024
während der gesamten Brandsaison. Auch
Copernicus, das Erdbeobachtungsprogramm der
EU, wurde aktiviert, und zwar konkret für
die Brände in Griechenland, Spanien und
Bulgarien.
|
|
Erklärung vor dem geplanten Treffen
der Präsidenten Trump und Putin |
|
Brüssel, 11. August 2025 - Die Europäische
Kommission hat gemeinsam mit Frankreich,
Italien, Deutschland, Polen, dem Vereinigten
Königreich und Finnland ein Statement
abgegeben zum geplanten Treffen von
US-Präsident Trump und dem russischen
Präsidenten Putin.
Darin heißt es: „Wir begrüßen Präsident
Trumps Bemühen, dem Töten in der Ukraine ein
Ende zu setzen, den Angriffskrieg der
Russischen Föderation zu beenden und einen
gerechten und dauerhaften Frieden und
Sicherheit in der Ukraine herbeizuführen.“
Kombination aus Diplomatie, Unterstützung
der Ukraine und Druck auf Russland Präsident
Macron, Ministerpräsidentin Meloni,
Bundeskanzler Merz, Ministerpräsident Tusk,
Premierminister Starmer, Präsidentin von der
Leyen und Präsident Stubb betonten
weiter: „Wir sind davon überzeugt, dass nur
eine Kombination von aktiver Diplomatie,
Unterstützung der Ukraine und Druck auf die
Russische Föderation, ihren unrechtmäßigen
Krieg zu beenden, zum Erfolg führen kann.
Wir sind bereit, diese Bemühungen zu
unterstützen, und zwar diplomatisch, durch
die weitere umfassende militärische und
finanzielle Unterstützung der Ukraine –
unter anderem im Rahmen der Koalition der
Willigen – und durch die Beibehaltung und
weitere Verhängung restriktiver Maßnahmen
gegen die Russische Föderation.“
Vitale Sicherheitsinteressen der Ukraine und
Europas „Wir sind der Überzeugung, dass eine
diplomatische Lösung die vitalen
Sicherheitsinteressen der Ukraine und
Europas schützen muss. Wir sind uns einig,
dass diese vitalen Interessen robuste und
glaubwürdige Sicherheitsgarantien umfassen,
die es der Ukraine ermöglichen, ihre
Souveränität und territoriale Integrität
effektiv zu verteidigen.
Die Ukraine bestimmt selbst über ihr
Schicksal. Sinnvolle Verhandlungen können
nur im Rahmen einer Waffenruhe oder eines
Rückgangs der Feindseligkeiten stattfinden.
Über den Weg zum Frieden in der Ukraine kann
nicht ohne die Ukraine entschieden werden.
Wir halten weiterhin an dem Grundsatz fest,
dass internationale Grenzen nicht gewaltsam
verschoben werden dürfen. Die derzeitige
Kontaktlinie sollte der Ausgangspunkt für
Verhandlungen sein.“
Europa steht der Ukraine weiter fest zur
Seite
Die Unterzeichner des Statements
bekräftigen, dass die unprovozierte und
völkerrechtswidrige russische Invasion der
Ukraine einen eklatanten Verstoß gegen die
Charta der Vereinten Nationen, die
Schlussakte von Helsinki, das Budapester
Memorandum und weitere Zusagen Russlands
darstellt.
„Wir bekräftigen unser unerschütterliches
Engagement für die Souveränität,
Unabhängigkeit und territoriale Integrität
der Ukraine. Wir stehen der Ukraine
weiterhin fest zur Seite. Wir sind als
Europäerinnen und Europäer geeint und
entschlossen, gemeinsam unsere Interessen zu
wahren. Und wir werden weiterhin eng mit
Präsident Trump und den Vereinigten Staaten
von Amerika sowie mit Präsident Selenskyj
und der ukrainischen Bevölkerung
zusammenarbeiten, um einen Frieden in der
Ukraine zu erreichen, der unsere vitalen
Sicherheitsinteressen schützt.“
|
|
|







