






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 45. Kalenderwoche:
4. November
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Dienstag, 5. November 2024
Beginn der Hochwassersaison:
Diese Angebote informieren bei Gefahr
Übersicht der Webseiten,
Apps und Abo-Dienste
Im November beginnt traditionell
die Saison möglicher Winterhochwasser, deshalb weist das
Umweltministerium Nordrhein-Westfalen auf das breite Angebot hin,
mit dem sich Bürgerinnen und Bürger über steigende Pegel informieren
können und gewarnt werden. Die Basis für alle Angebote liefert das
Pegelnetz des Landesamtes für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz
(LANUV).
Es kann auf aktuell 304 Pegel landesweit
zugreifen, davon 98 eigene Hochwassermeldepegel, 76 Pegel externer
Betreiber sowie 130 gewässerkundliche Pegel des LANUV, über die
zusätzliche Daten über Wasserstände erhoben werden. Das Netz wird
derzeit weiter ausgebaut: 25 neue Standorte wurden bereits
festgelegt und der erste neue Hochwasser-Meldepegel bereits im
Sommer in Betrieb genommen. Vier weitere sollen noch in diesem Jahr
folgen.
„Durch die Klimakrise werden Extremwetter- und
Hochwasserereignisse Nordrhein-Westfalen künftig häufiger treffen.
Deshalb ist es existenziell, dass wir die Bevölkerung noch besser
informieren und uns vor solchen Katastrophen schützen“, sagt
Umweltminister Oliver Krischer. „Die großen Hochwasserereignisse der
vergangenen Jahre haben bei uns deutliche Spuren in vielen Lebens-,
Wirtschafts- und Umweltbereichen hinterlassen“, erklärte Elke
Reichert, Präsidentin des LANUV in Duisburg.
„Die
Hochwasserinformationen werden weiter verbessert, um Schäden so
gering wie möglich zu halten.“ Um den Hochwasserschutz zu stärken,
setzt das Land gemeinsam mit seinen Partnern den „10-Punkte
Arbeitsplan Hochwasserschutz in Zeiten des Klimawandels“ um. Für die
Umsetzung stellt das Land den Kommunen und Deichverbänden
umfangreiche Mittel zur Verfügung. Zum Vergleich: 2015 standen rund
30 Millionen Euro Landesmittel für Maßnahmen des Hochwasserschutzes
aus zur Verfügung, in den Jahren 2023 und 2024 jeweils mehr als 80
Millionen Euro. Schutzmaßnahmen können mit bis zu 80 Prozent der
Gesamtkosten vom Land gefördert werden.
•
Übersicht der Informationsangebote für Bürgerinnen und Bürger:
1. Hochwasserportal NRW Um die Öffentlichkeit schnell bei einer
Gefahrenlage zu informieren, betreibt das LANUV das
Hochwasserportal.NRW, auf dem fortlaufend Messdaten von derzeit 304
Pegeln in NRW veröffentlicht werden.
Bei bevorstehenden und
aktuellen Hochwasserlagen werden auch hydrologische Lageberichte zur
Entwicklung der Situation zur Verfügung gestellt.
https://hochwasserportal.nrw/lanuv/webpublic/index.html#/Start
2. Hochwasserinformationen über die Warn-App NINA
Wer
die App installiert und unter Hochwasserwarnungen
„Benachrichtigungen erhalten“ aktiviert, erhält entsprechende
Hochwasserinformationen des LANUV. Nutzerinnen und Nutzer können
wahlweise Daten für den aktuellen Standort oder für selbst
festgelegte Orte abonnieren.
Seit diesem Jahr werden in NRW
bei drohendem oder eingetretenem Hochwasser regionale
Hochwasserinformationen für 17 Flusseinzugsgebiete in NRW
bereitgestellt und die Bevölkerung aktiv informiert. Informationen
und Download:
Warn-App-NINA
3. Umweltportal NRW
Das
Umweltportal NRW ist die erste Anlaufstelle für behördliche Daten,
Fakten und Informationen. Es bietet Zugang zu Hunderten von
Webseiten, Messergebnissen, Übersichts-Karten, Umweltindikatoren,
Berichten und Dokumenten. Auch aktuelle Warnmeldungen zu
Umweltereignissen können abonniert werden.
www.umweltportal.nrw.de
4. Hochwasserinformationen über die MeinePegel-App
„Meine Pegel“ ist die gemeinsame Wasserstands- und
Hochwasser-Informations-App aller Bundesländer. Zusätzlich können in
dieser App benutzerdefinierte Schwellenwerte für persönlich
relevante Pegel eingerichtet werden, bei deren Überschreitung dann
eine Benachrichtigung über das Smartphone erfolgt. Informationen und
Download über https://www.hochwasserzentralen.info/meinepegel/
5. Hochwassergefahren- und -risikokarten
Für
Gewässer, an denen ein signifikantes Hochwasserrisiko für
Gesundheit, Umwelt, Kulturerbe oder wirtschaftliche Tätigkeiten
besteht (Risikogewässer), werden in Nordrhein-Westfalen sogenannte
Hochwassergefahren- und ‑risikokarten erstellt. Nordrhein-Westfalen
hat 456 Risikogewässer mit einer Gesamtlänge von ca. 6000 Kilometer
ausgewiesen.
Die Karten zeigen an, wo in einer Region
oder Stadt konkret Gefahren durch Hochwasser bestehen. Auf dieser
Basis kann das individuelle Risiko bewertet und vorgebeugt werden.
Die veröffentlichten Karten finden Sie unter: hochwasserkarten.nrw.de.
Hintergrundinformationen zu den Hochwassergefahren‑ und
‑risikokarten finden Sie unter: flussgebiete.nrw.de/hochwasserthemen
Erste Anhaltspunkte zur Abschätzung der
Starkregengefahren am jeweiligen Wohnort kann die
Starkregengefahrenhinweiskarte Nordrhein-Westfalen bieten, die wie
die Hochwassergefahrenkarte die Auswirkungen bestimmter
vordefinierter Szenarien darstellt:
Geoportal NRW Vielfach gibt es zudem detaillierte Angebote und
Informationen der Städte, Kreise und Gemeinden:
Kommunale Starkregengefahrenkarten Daneben informiert der
Deutsche Wetterdienst (DWD) über Wettergefahren.
6.
FloodCheck-App
Mit der FloodCheck-App können Bürgerinnen und
Bürger durch die Eingabe ihrer Wohnadresse und die Beantwortung
zusätzlicher Fragen zur baulichen Beschaffenheit ihres Wohnobjektes
ermitteln, ob und wie stark das Risiko potentieller Starkregen- und
Hochwassergefahren für das entsprechende Objekt ist.
Das
regionale Angebot von den Wasserverbänden Emschergenossenschaft und
Lippeverband (EGLV) soll in den nächsten Monaten landesweit
ausgedehnt werden. Bisher besteht das Angebot für die Städte Bochum,
Bottrop, Essen, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herne und Herten.
https://floodcheck.net/
KontaktPressestelle Andrey Popov/ panthermedia.net Pressestelle MUNV
E-Mail: presse@munv.nrw.de
Previous
Vereidigung von Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern
Oberbürgermeister Sören Link hat am Donnerstag, 31.
Oktober, rund 200 neue Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter im
Rathaus der Stadt Duisburg zu ihrer Vereidigung begrüßt. Die neuen
Lehrkräfte werden ab heute ihren Dienst an Gymnasien, Gesamtschulen
und Berufskollegs im Großraum Duisburg antreten und damit unsere
Schulen tatkräftig unterstützen.

Vereidigung durch Oberbürgermeister Sören Link, Bildungsdezernentin
Astrid Neese und Angela Cornelissen, Leiterin der Zentren für
schulpraktische Lehrerausbildung des Landes Nordrhein-Westfalen.
Auch weiterhin hält die GEBAG für Lehrerinnen und Lehrer, die
nach Duisburg kommen, ein besonderes Angebot bereit: Die ersten
sechs Monate übernimmt die GEBAG die Netto-Kaltmiete und die neuen
Lehrer zahlen lediglich die Betriebskosten. Weitere Informationen
gibt es im Internet unter
www.gebag.de/mieten/angebot-fuer-lehrer

Fotos Malte Werning / Stadt Duisburg
Umbau des
Calaisplatzes ist abgeschlossen
Die Bauarbeiten am
Calaisplatz sind abgeschlossen. Neben dem Platz wurden auch
Teilbereiche von Unter-, Münz- und Schwanenstraße umgestaltet.
Oberbürgermeister Sören Link wird gemeinsam mit Pascal Pestre,
Beigeordneter der Stadt Calais, sowie Vertreterinnen und Vertreter
aus Politik und Verwaltung den umgestalteten Bereich am Freitag, 8.
November, offiziell freigeben.
Spannende
Einblicke in Pflegeberufe
600 Achtklässler haben sich beim Tag
der Pflege über Ausbildung in der Pflege informiert
Bereits zum 11. Mal hat die Zukunftsinitiative Pflege mit
Unterstützung der Agentur für Arbeit und dem jobcenter Duisburg zum
„Tag der Pflege“, einer großen Berufsorientierungsmesse, ins
Berufsinformationszentrum (BIZ) eingeladen. Ziel der Messe war es,
junge Menschen, die vor der Berufsentscheidung stehen, über die
Vielfalt der Berufe in der Pflege, Ausbildungsmöglichkeiten und
Berufschancen zu informieren.
Bei 15 Ausstellern konnten
die Schülerinnen und Schüler ganz praktisch einzelne Tätigkeiten im
Pflegebereich kennenlernen. Dazu gehörte unter anderem das Laufen
mit dem Alterssimulationsanzug, ein Demenzparcours, Blutdruck
messen, die Simulation eines Wundverschlusses oder auch die
Säuglingspflege. Bei dem Rundgang durch die Stände wurden die
Schülerinnen und Schüler durch Auszubildende Pflegefachkräfte
begleitet, denen sie ganz persönliche Fragen zur Ausbildung stellen
konnten. Natascha Berk, Sprecherin der Zukunftsinitiative Pflege,
betont wie wichtig es ist, früh für den Pflegeberuf zu begeistern.
„Der Bedarf an Fachkräften steigt stetig an. Anstatt uns
jedoch entmutigen zu lassen, möchten wir den jungen Menschen unsere
Begeisterung für den Pflegeberuf zeigen und so für die spätere
Berufswahl Weichen setzen.“

Von links nach rechts: Diana Trojan (Sprecherin der ZIP), Sebastian
Schill (Teamleitung Agentur für Arbeit Duisburg), Nathalie Berk
(Sprecherin der ZIP), Bengt Bringmann (Agentur für Arbeit Duisburg),
Melanie Strauß-Staigis (Stabsstelle Gesundheitsförderung und
-planung), Levent Tomicki (Kommunale Koordinierungsstelle | KAoA)
Aktionsmonat Wärmepumpen: Stadtwerke Duisburg
helfen bei Anschaffung und Förderung Der Wärmepumpe kommt
eine zentrale Rolle im Rahmen der Energiewende zu. Und immer mehr
Eigenheimbesitzer rüsten ihre Heizungsanlage auf Wärmepumpen um.
Hierbei unterstützen die Stadtwerke Duisburg durch zahlreiche
Fördermittel- und Energiesparangebote. Im November bieten die
Stadtwerke im Rahmen der Wärmepumpenwochen jetzt attraktive Rabatte
auf die Anschaffung von Wärmepumpen und den staatlich geförderten
individuellen Sanierungsfahrplan.
Rabatt auf
Wärmepumpe und Sanierungsfahrplan Im Aktionszeitraum vom 4. bis 30.
November 2024 erhalten Kundinnen und Kunden beim Kauf einer
Wärmepumpe der Stadtwerke Duisburg einen Aktionsrabatt in Höhe von
1.000 Euro auf den Brutto-Kaufpreis. Voraussetzung ist die Vorlage
eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) für die entsprechende
Immobilie. Auch für die Erstellung eines iSFP gewähren die
Stadtwerke im November einen Rabatt. Für Ein- und Zweifamilienhäuser
reduziert der 650 Euro-Rabatt die Kosten von 1.649 Euro auf 999
Euro.
Bei Mehrfamilienhäusern wird ein Rabatt von 850
Euro gewährt, der die Kosten von 2.349 Euro auf 1.499 Euro
reduziert. Zusätzlich können die Kosten des iSFP durch die aktuelle
Förderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA) bis zu 50 Prozent erstattet werden. Alle Details zur
Wärmepumpenaktion der Stadtwerke Duisburg sind unter
www.swdu.de/wp-aktion zu
finden.
Fördermöglichkeiten prüfen und nutzen
Die
Fördermittel- und Energiespar-Angebote der Stadtwerke sind zentral
unter www.swdu.de/foerderung
zusammengestellt. Als Duisburgs kompetenter Ansprechpartner für
Photovoltaik, Wärmelösungen, Elektromobilität sowie viele weitere
Energiedienstleistungen treiben die Stadtwerke die Energiewende in
Duisburg aktiv voran.
Alle Infos zum umfangreichen
Produkt- und Beratungsangebot haben die Stadtwerke unter den
Themenseiten Wärme, Elektromobilität, Photovoltaik und Wärmepumpen
auf ihrer Internetseite stadtwerke-duisburg.de zusammengestellt.
Dort ist zum Beispiel eine erste Kalkulation für PV-Anlagen möglich.
Eine erste Einschätzung über die Eignung von Wärmepumpen als
alternative Heizungsart erhalten Immobilienbesitzer über den
Online-Wärmepumpen-Check. Individuelle Fragen beantworten die
Energieberaterinnen und Energieberater des lokalen
Energiedienstleisters gerne unter 0203 604 1111 (Mo. - Fr. 8 bis 16
Uhr).

Foto: Stadtwerke Duisburg
Ehrenamtliche Unterstützung gesucht: Patientenfürsprecher
bzw. Patientenfürsprecherin für das BETHESDA Krankenhaus Duisburg
Der Verbund Evangelisches Klinikum Niederrhein und
BETHESDA Krankenhaus setzt sich intensiv für das Wohl seiner
Patientinnen und Patienten ein und legt großen Wert auf eine
optimale medizinische sowie pflegerische Versorgung. Um eine
zusätzliche, unabhängige Anlaufstelle für Anregungen oder
Beschwerden zu schaffen, sucht der Verbund eine
Patientenfürsprecherin oder einen Patientenfürsprecher für den
Standort BETHESDA Krankenhaus in Duisburg-Hochfeld.
Die
Tätigkeit ist ein Ehrenamt. Mit dieser Position wird eine wichtige
Rolle im Dialog zwischen Patientinnen, Patienten und der Klinik
besetzt. Der Patientenfürsprecher bzw. die Patientenfürsprecherin
agiert unabhängig und neutral, arbeitet unentgeltlich und ist nicht
beim Krankenhaus angestellt. Ziel der Tätigkeit ist es, Patientinnen
und Patienten in der Wahrnehmung ihrer Rechte zu unterstützen, bei
Konflikten zu vermitteln und Defizite offen anzusprechen.
Eine regelmäßige Anwesenheit im Krankenhaus ist erforderlich, um
den direkten Kontakt mit den Patientinnen und Patienten auf den
Stationen zu ermöglichen. Die Tätigkeit erfordert keine medizinische
Vorbildung, jedoch ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen,
Kommunikationsstärke und Objektivität. Wichtig ist, dass die Person
in der Lage ist, sachlich und lösungsorientiert zu vermitteln.
Das BETHESDA Krankenhaus Duisburg möchte mit diesem Aufruf
seiner gesetzlichen Verpflichtung gemäß § 5
Krankenhausgestaltungsgesetz NRW nachkommen, das Krankenhäuser dazu
verpflichtet, unabhängige Beschwerdestellen für Patientinnen und
Patienten einzurichten. Für Rückfragen und nähere Auskünfte steht
Herr Ronny Schneider, Patientenfürsprecher im Verbund Evangelisches
Klinikum Niederrhein, zur Verfügung. Die Kontaktdaten: Ronny
Schneider, Tel.: 0178-9374887. E-Mail:
mail@ronnyschneider.de
„Wenn der Wirbel bricht“ – Informationsveranstaltung für
Betroffene und Interessierte
Bei den sogenannten
Wirbelkörperfrakturen sind schnelle Diagnostik und zielgerichtete
Therapie entscheidend, um Schmerzen zu lindern und Folgeschäden wie
Instabilität oder neurologische Ausfälle zu verhindern. Wie der
aktuelle Stand der Dinge bei der Behandlung ist, darüber informiert
Dr. Georg Kakavas, Oberarzt der Klinik für Wirbelsäulenchirurgie an
der Helios St. Johannes Klinik in Duisburg.
Der
Mediziner verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Behandlung von
Rückenleiden und wird im Rahmen seines Vortrags aufzeigen, wie
moderne Therapiemethoden Patient:innen möglichst schonend helfen
können. Die Veranstaltung findet am 5. November um 16:00 Uhr im
Veranstaltungsraum der Helios St. Johannes Klinik (neben der
Cafeteria) in der Dieselstraße 185, 47166 Duisburg statt.
Sie
richtet sich an Betroffene und Interessierte und ist kostenlos,
jedoch muss aufgrund begrenzter Kapazitäten eine vorherige Anmeldung
erfolgen. Interessierte werden gebeten, sich telefonisch unter
(0203) 546-31801 oder per E-Mail an
Selina.Przybilla@helios-gesundheit.de anzumelden.
VHS Duisburg:
Bürgerstammtisch Energiewende
Die Energiewende ist in
vollem Gange, aber es herrscht noch Unsicherheit darüber, welche
Technologien sich am Ende durchsetzen werden. Vor diesem Hintergrund
startete am 3. September, der Energiestammtisch mit
Bürgerinnen und Bürgern, die sich für Fragen des Klimaschutzes, der
klimafreundlichen Energieerzeugung und der Elektromobilität
interessieren, einmal im Monat zusammen. Die Folgetermine finden
jeweils am ersten Dienstag im Monat statt: 5. November und 3.
Dezember.

photographyMK, Bild-ID #20227801, depositphotos.com
Besprochen werden unter anderem
Entscheidungshilfen für eine autarke Energieversorgung und eine
nachhaltige und wirtschaftliche Heizungsmodernisierung. Es wird über
Wasserstoff gesprochen als Chancen für eine CO2-freie
Energiezukunft, über Fördermöglichkeiten Energie sowie die
Entwicklung der E-Mobilität.
Der Erfahrungsaustausch dient
als Entscheidungshilfe und Ort der Begegnung und Bestärkung – und
damit als Impulsgeber für Bewusstseinsbildung und Weiterentwicklung
im Bereich Energie und Klimaschutz und richtet sich an alle, die
sich für diese Technologien und Themen interessieren. Vorerfahrung
ist nicht erforderlich.
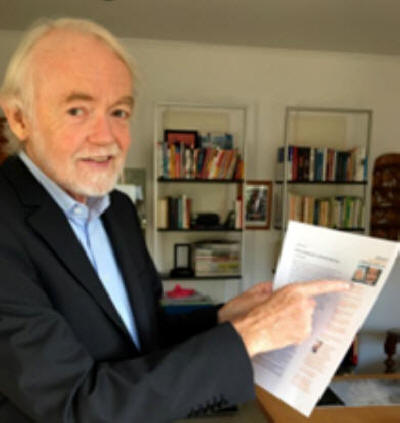
Geleitet wird die Reihe von Johannes Hegmans (Foto privat). Er verfügt über langjährige Erfahrungen im Bereich
erneuerbare Energien. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine vorherige
Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen und
Anmeldemöglichkeiten gibt es bei Marissa Turac telefonisch unter
0203-283-3220 oder per E-Mail an m.turac@stadtduisburg.de sowie bei
Stefan Wewer telefonisch unter 0203-283-2286.
Ikea plant Neubau in Essen
Das Einrichtungshaus Ikea hat
seine Pläne für einen Neubau in Essen wieder aufgenommen. Der
aktuelle Standort an der Altendorfer Straße soll perspektivisch von
einem Geschäft auf dem von Ikea erworbenen Gelände an der Bottroper
Straße abgelöst werden.
Der schwedische Möbelriese steht im
Dialog mit der Stadt Essen, um Fragen der Nachhaltigkeit,
Gestaltung, Mobilität und der Nachnutzung des bisherigen Standorts
zu klären. idr
Weiter Weg zur Entgeltgleichheit: Aktueller Überblick leuchtet
Gründe für und Strategien gegen die geschlechtsspezifische
Entgeltlücke aus
Der Fortschritt ist bisweilen eine
Schnecke – besonders in Sachen Geschlechtergleichheit. Wie weit der
Weg dahin auf dem deutschen Arbeitsmarkt noch ist, welche
Hindernisse es gibt und wie sie sich überwinden lassen, hat die
Wirtschaftswissenschaftlerin und Beraterin Dr. Andrea Jochmann-Döll
analysiert. Ihr neuer, von der Hans-Böckler-Stiftung geförderter
Bericht gibt einen aktuellen Überblick.* Dafür hat Jochmann-Döll
Literatur ausgewertet sowie die Verantwortlichen für Frauen- und
Gleichstellungspolitik des DGB und der Mitgliedsgewerkschaften
befragt.

Ihr Bericht ist Teil eines Projekts zum Stand der
Entgeltgleichheit in den nordischen Staaten und in Deutschland, das
der Rat der nordischen Gewerkschaften, die Friedrich-Ebert-Stiftung
und der DGB initiiert haben. Ziel: Durch Beispiele guter Praxis
zeigen, wie sich die Lohnlücke schließen lässt und daraus
Empfehlungen für die nationale und europäische Politik ableiten.
„Die Studie macht deutlich, dass Entgeltgleichheit von
Frauen und Männern kein Wunschtraum ist, denn es gibt erprobte
Mittel gegen Lohnungleichheit“, so Christina Schildmann, Leiterin
der Abteilung Forschungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung. „Doch
der Weg dorthin ist vielerorts noch weit.“ Der Gender Pay Gap ist
der Auswertung zufolge in Deutschland „im Vergleich zu anderen
europäischen Ländern konstant hoch“, 2022 entsprach der Abstand
zwischen den Geschlechtern beim durchschnittlichen Stundenlohn 18
Prozent oder 4,46 Euro.
Als eine Ursache für die
klaffende Lohnlücke macht Jochmann-Döll unzureichende gesetzliche
Regelungen und fehlende Sanktionen aus. Das
Entgelttransparenzgesetz, das seit 2017 in Kraft ist, habe nur wenig
gebracht; einer Evaluation zufolge ist es nur einem Drittel der
Beschäftigten bekannt, nur vier Prozent haben ihr Recht auf
individuelle Auskunft bislang in Anspruch genommen. Grundsätzlich
spiegele die geschlechtsspezifische Bewertung von Arbeit hartnäckige
stereotype Überzeugungen wider, die unter anderem dazu führen, dass
soziale oder Sorgeberufe, in denen viele Frauen arbeiten, bei der
Bezahlung trotz einiger Verbesserungen in den vergangenen Jahren
immer noch unterbewertet sind.
Hinzu komme, dass
sinkende Tarifbindung und fehlende Mitbestimmung zu intransparenten
Entgeltstrukturen führen, die den Nachweis von Diskriminierung
erschweren. Die Autorin illustriert anhand von „Beispielen guter
Praxis“, was zu mehr Lohngerechtigkeit beitragen könnte. Sinnvoll
sind demnach zum einen Aktionen zur Sensibilisierung der
Öffentlichkeit wie der „Equal Pay Day“ oder der „German Equal Pay
Award“.
Von den Bundesländern tut sich etwa Bremen durch
die „Landesstrategie für Gendergerechtigkeit und Entgeltgleichheit“
hervor, Hessen und Nordrhein-Westfalen durch einen „Lohnatlas“ mit
geschlechtsspezifischen Daten. In der betrieblichen Praxis können
kostenlose Prüfinstrumente wie der „Entgeltgleichheits-Check“
helfen, der mit Unterstützung der Hans-Böckler-Stiftung entwickelt
wurde. Dass die Gewerkschaften eine wichtige Rolle spielen, belegt
unter anderem die „Initiative Lohngerechtigkeit“ der NGG.
Ein Ergebnis ist die neue Entgeltstruktur für das Bäckerhandwerk
in Berlin-Brandenburg, in der erstmals die männerdominierte
Berufsgruppe der Bäcker*innen und die frauendominierte Gruppe der
Verkäufer*innen gleichgestellt sind. Eine weitere Dimension der
Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt sei die „sektorale Segregation“,
schreibt Jochmann-Döll. Sie verweist auf eine WSI-Studie von 2023,
der zufolge in acht von 16 Sektoren des produzierenden Gewerbes
sowie der Land- und Forstwirtschaft die Beschäftigten zu mehr als 70
Prozent Männer sind.
•
Die einzigen drei frauendominierten Sektoren – das
Gesundheitswesen, das Sozialwesen sowie der Bereich Erziehung und
Unterricht – gehören zu den Dienstleistungen. Von 14 Berufssegmenten
waren 2022 sieben männerdominiert. Auf einen Frauenanteil von mehr
70 Prozent kamen drei: die Gesundheitsberufe, soziale und kulturelle
Dienstleistungsberufe sowie Reinigungsberufe. Seit 2013 hat sich an
dieser Unwucht wenig geändert.
Auch in der
Berufsausbildung zeichnet sich kein Umbruch ab: Bei den MINT-Berufen
betrug der Frauenanteil 2021 elf Prozent, im Gesundheits- und
Sozialwesen 89 Prozent. Verantwortlich für diese Situation sind dem
Bericht zufolge unter anderem vorherrschende Geschlechterbilder, die
die Berufswahl beeinflussen. Frauen in atypischen Berufen würden oft
diskriminiert und hätten laut einer aktuellen Studie sogar
schlechtere Karten auf dem Dating-Markt.
•
Auf Seiten der Unternehmen kämen Vorurteile in vielen
Stellenanzeigen oder Einstellungsverfahren zum Ausdruck. Auch in
dieser Hinsicht sei die Erosion des Tarifsystems ein Problem: Wenn
alte Tarifverträge mit historischen Stellenbeschreibungen weiter
gelten, würden Stereotype reproduziert. Zu den vorbildlichen
Gegenmaßnahmen zählt die Expertin den „Girls‘ Day“, der Mädchen
ermöglicht, männerdominierte Berufe kennenzulernen, den analogen
„Boys‘ Day“ sowie die „Initiative Klischeefrei“, ein vom
Bundesfamilienministerium ins Leben gerufenes Bündnis unter anderem
von Ministerien, Unternehmen, Gewerkschaften und Schulen.
Auch dass Informatik in diversen Bundesländern mittlerweile
Pflichtfach ist, könnte der Segregation bei der Berufswahl
entgegenwirken. Ungleichheit zwischen den Geschlechtern herrscht
laut der Analyse auch bei den familiären Verpflichtungen: Laut Daten
des Statistischen Bundesamtes von 2022 kommen Frauen im Schnitt auf
knapp 30 Stunden pro Woche, die sie mit unbezahlter Arbeit im
Haushalt, Kindererziehung oder der Pflege von Angehörigen
verbringen, Männer auf 21 Stunden. Der Gender Care Gap entspricht
damit etwa 44 Prozent, zehn Jahre zuvor waren es gut 52 Prozent.
Neben stereotypen Einstellungen zu Haushalt und Pflege trage
auch die Lohnlücke zu diesem Missstand bei, erklärt Jochmann-Döll.
Sie lasse es vielen Paaren wirtschaftlich vernünftig erscheinen,
dass die Frau den Löwenanteil der Sorgearbeit übernimmt und dafür
beruflich kürzertritt. Hinzu kämen Defizite bei der institutionellen
Kinderbetreuung – 2023 fehlten rund 400000 Kita-Plätze und 125000
Fachkräfte in diesem Bereich – und das Ehegattensplitting, das große
Einkommensunterschiede bei Paaren belohnt.
•
Gegensteuern ließe sich der Wissenschaftlerin zufolge mit
Kampagnen wie dem „Equal Care Day“ sowie mit der im
Koalitionsvertrag angekündigten „Familienstartzeit“, die nach der
Geburt eines Kindes unabhängig von der Elternzeit Freistellungen
vorsieht. Auch die Tarifpolitik könne einen Beitrag leisten: Die IG
Metall etwa habe 2018 für die Beschäftigten der Metall- und
Stahlindustrie eine Wahlmöglichkeit zwischen mehr Geld oder mehr
Urlaub ausgehandelt. Die EVG habe Regelungen unter anderem zu
familienfreundlicher Arbeitszeitgestaltung und Chancengleichheit von
Beschäftigten mit familiären Verpflichtungen durchgesetzt.
Zuletzt geht der Bericht auf die „gläserne Decke“ in deutschen
Firmen ein. Mit 29 Prozent Frauenanteil in Führungspositionen lag
Deutschland 2022 unter dem EU-Schnitt. In den Vorständen der
Top-200-Unternehmen beträgt der Anteil 18 Prozent. Lediglich in den
Aufsichtsräten ist er höher, weil hier zum einen eine gesetzliche
Quote gilt und zum anderen die Gewerkschaften in mitbestimmten
Unternehmen traditionell Wert auf mehr Geschlechtergleichheit legen.
•
Als Hindernisse, mit denen Frauen auf dem Weg in die
Chefetage rechnen müssen, nennt Jochmann-Döll verbreitete Klischees,
denen zufolge Führungskompetenz und strategisches Denken
Männerdomänen sind. Das Bild der idealen Arbeitskraft orientiere
sich nach wie vor an traditionell männlichen Erwerbsbiografien.
Zudem gebe es in vielen Konzernen Männer-Netzwerke, die die
Karrieren von Geschlechtsgenossen fördern. Auf ein Durchbrechen der
gläsernen Decke ziele unter anderem die Initiative „Frauen in die
Aufsichtsräte“ ab, heißt es in der Analyse. Auch freiwillige
Frauenquoten bei Gewerkschaften und einzelnen Unternehmen seien
begrüßenswert, ebenso Programme für mehr Teilzeit in
Führungspositionen bei einigen Konzernen.
•
Alles in allem stelle die systematische Unterbewertung
frauendominierter Berufe und Branchen das größte Hindernis auf dem
Weg zu mehr Geschlechtergleichheit auf dem Arbeitsmarkt dar, so
Jochmann-Döll. Um Abhilfe zu schaffen, bedürfe es unter anderem
einer Stärkung der Tarifbindung. Die Bundesregierung müsse das
Entgelttransparenzgesetz vollumfänglich an die Vorgaben der EU
anpassen. Es gelte, die Sichtbarkeit von Frauen in männerdominierten
und von Männern in frauendominierten Berufen zu erhöhen, damit
Jugendliche sich an Vorbildern orientieren können.
•
Das Ehegattensplitting sollte abgeschafft, das Elterngeld vom
individuellen Einkommen entkoppelt und mit mehr verpflichtenden
Partnermonaten verbunden werden. Zusätzlich empfiehlt die Autorin,
die Familienstartzeit umsetzen, die Betreuung von Kleinkindern zu
verbessern, eine Entgeltersatzleistung für pflegende Beschäftigte
einzuführen, die Quotenvorgaben für Führungspositionen auszubauen
und auf mehr Teilzeit im Management hinzuwirken.
Gemeinde lädt zum Vasen-Tauschtag in die Friedenskirche ein
Die Evangelische Kirchengemeinde Duisburg Hamborn lädt
zum Vasen-Tauschtag in die Friedenskirche, Duisburger Straße 174,
ein. Dort können Interessierte am Freitag, 8. November 2024 von 15
bis 17 Uhr für eigene Vasen die anderer erhalten. Erwartet wird eine
große Auswahl an Vasen aller Stil-, Farb-, Material-, und
Designrichtungen - alle mit dem Zweck, Blumen oder Gräser
aufzunehmen oder einfach nur schön zu sein.
Die Idee zu
dem Tauschtag hatten Engagierte der Gemeinde, denn sie und viele
anderen kennen das Problem genau: Im Laufe der Jahre passen die
Vasen nicht mehr zur Inneneinrichtung oder man/frau hat sich satt
daran gesehen. Daher lädt das Team um Edith Bauer (Tel. 0203 554460
oder Handy 0178-3148068) nach dem Tauschen von Osterdeko und Tassen
jetzt zum fröhlichen Vasentauschen ein: „Kommen Sie, tauschen Sie!
Vielleicht sehen Sie etwas ganz Neues, was Sie fasziniert.“
Der
Eintritt ist frei; Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter
www.friedenskirche-hamborn.de.
Podiumsdiskussion und
Fragerunden zum Thema Strategien und Maßnahmen gegen den
Fachkräftemangel
Was können und müssen Unternehmen
gegen den Fachkräftemangel tun, was können Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer erwarten? Um dieses Thema geht es bei der
Podiumsdiskussion mit Fragerunde am Dienstag, 5. November 2024 um
18.30 Uhr im Ungelsheimer Gemeindezentrum der Evangelischen
Versöhnungsgemeinde Duisburg-Süd, Sandmüllersweg 31.

Das Gemeindezentrum Ungelsheim (Foto: https://www.evgds.de).
Die in einem thematischen Input
vorgestellten Daten und Fakten zum Fachkräftemangel sind Grundlage
für die Statements von Vertreter der Firmen Friedrich Tonscheidt
KG, Anton Köther Sanitär – Heizung, IKKE gGmbH sowie HKM. In der
Fragerunde geht es dann um Einschätzungen zu den zukünftigen
Entwicklungen im Hinblick auf die Fachkräfteentwicklung und die
notwendigen Stellschrauben, die den Mangel beheben könnten.
Mit dabei an dem Abend sind auch Auszubildende vom Bertolt
Brecht Berufskolleg, die ihre Fragen und Gedanken mit einbringen.
Gegen 20 Uhr ist die Fragen- und Gesprächsrunde auch für das
Publikum geöffnet. Der Eintritt ist frei, Anmeldungen sind bei
Dieter Zisenis (Mail: laboratorium@ekir.de) vom dem „laboratorium“,
dem evangelischen Zentrum für Arbeit, Bildung und betriebliche
Seelsorge der Evangelischen Kirchenkreise Dinslaken, Duisburg, Moers
und Wesel (www.ev-laboratorium.de) möglich und nötig bis zum
4.11.2024.
Romantische Prachtmusiken für Chor und Orchester
Kartenvorverkauf für das Salvatorkonzert ist gestartet
Große Chorsymphonik bietet der Philharmonische Chor Duisburg
unter dem Titel „Romantische Pracht“ am Sonntag, den 10. November
um 17 Uhr in der Salvatorkirche. Zu hören sind in der Duisburger
Citykirche drei Perlen der großen romantischen
Chor-Orchesterliteratur: Zum einen der fast schon zur ungarischen
Nationalmusik gewordene „Psalmus hungaricus“ von Zoltan Kodaly,
ein Werk, das zum Besten gehört was die Chormusik im frühen 20.
Jahrhundert hervorgebracht hat.
Außerdem sind das
bekannte Schicksalslied von Johannes Brahms sowie der 13. Psalm
von Liszt zu hören - ebenfalls ein Werk, welches der Komponist
als eins seiner besten bezeichnete und eine Paradepartie für
Solotenöre ist. Hierfür steht der in der Region bekannte Corby
Welch zur Verfügung. Sein heldischer Tenor passt wunderbar zu den
beiden Psalmvertonungen von Liszt und Kodaly. Begleitet wird der
philharmonische Chor von einem großen Orchester aus Mitgliedern
der Duisburger Philharmoniker, die Leitung hat
Kirchenmusikdirektor Marcus Strümpe.
Alle drei Werke
des 70minütigen Konzertes beschäftigen sich mit den Höhen und
Tiefen des menschlichen Daseins, alle drei enden hoffnungsvoll
und zukunftsgewandt und alle drei Komponisten gaben für diese
Hoffnung ihr Bestes: Chorsymphonik auf allerhöchstem Niveau.
Karten zu 26 Euro (ermäßigt 16 Euro) gibt es unter westticket.de
und an der Abendkasse ab 16.15 Uhr. Infos zur Salvatorkirche gibt
es im Netz unter
www.salvatorkirche.de.

Kirchenmusikdirektor Marcus Strümpe(Foto: André Weyers).

Einzelhandelsumsatz im September 2024 real um 1,2 %
höher als im Vormonat Einzelhandelsumsatz, September
2024 (vorläufig, kalender- und saisonbereinigt) +1,2 % zum
Vormonat (real) +0,6 % zum Vormonat (nominal) +3,8 % zum
Vorjahresmonat (real) +3,9 % zum Vorjahresmonat (nominal)
Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland
haben im September 2024 nach vorläufigen Ergebnissen des
Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und
saisonbereinigt real (preisbereinigt) 1,2 % und nominal (nicht
preisbereinigt) 0,6 % mehr umgesetzt als im August 2024. Die
Differenz zwischen dem nominalen und realen Ergebnis ist in
diesem Monat besonders auf die rückläufigen Preise bei
Mineralölprodukten zurückzuführen.
Im Vergleich zum
Vorjahresmonat September 2023, der zusammen mit dem Februar 2024
den niedrigsten Wert seit Februar 2021 aufwies, verzeichnete der
Einzelhandel ein Umsatzplus von real 3,8 % und nominal 3,9 %.
Zuletzt hatte der Einzelhandel im September 2022 einen höheren
Umsatz erzielt als im September 2024.

Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln sank im
September 2024 kalender- und saisonbereinigt real um 0,8 % und
nominal um 0,5 % gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum
Vorjahresmonat September 2023 verzeichnete der Umsatz einen
Anstieg von real 0,3 % und nominal 2,2 %.
Der reale
kalender- und saisonbereinigte Umsatz im Einzelhandel mit
Nicht-Lebensmitteln stieg im September 2024 um 1,7 % gegenüber
dem Vormonat und um 6,1 % gegenüber dem Vorjahresmonat September
2023. Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der reale
Umsatz im September 2024 einen Zuwachs von 3,1 % zum Vormonat und
lag damit 17,9 % über dem Umsatz des Vorjahresmonats September
2023.
Importpreise im September 2024: -1,3 %
gegenüber September 2023
Importpreise, September 2024
-1,3 % zum Vorjahresmonat -0,4 % zum Vormonat Exportpreise,
September 2024 +0,4 % zum Vorjahresmonat -0,1 % zum Vormonat
Die Importpreise waren im September 2024 um 1,3 % niedriger
als im September 2023. Im August 2024 hatte die Veränderungsrate
gegenüber dem Vorjahresmonat bei +0,2 % gelegen, im Juli 2024 bei
+0,9 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter
mitteilt, sanken die Einfuhrpreise im September 2024 gegenüber
dem Vormonat August 2024 um 0,4 %.
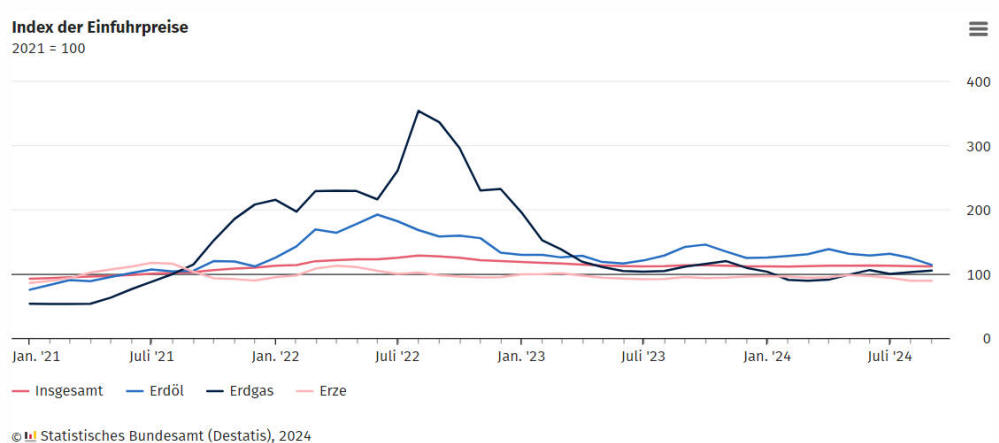
Die Exportpreise lagen im September 2024 um
0,4 % über dem Stand von September 2023. Im August und Juli 2024
hatte die Jahresveränderungsrate jeweils bei +0,8 % gelegen.
Gegenüber dem Vormonat August 2024 sanken die Exportpreise um
0,1 %.
Rückgang der Importpreise im Vergleich zu
September 2023 durch niedrigere Energiepreise Den größten
Einfluss auf die Gesamtentwicklung der Importpreise im September
2024 hatte der Rückgang der Energiepreise um 16,1 % gegenüber dem
Vorjahresmonat. Die Einfuhr von Erdöl war 19,9 % günstiger als im
Vorjahresmonat (-8,7 % gegenüber August 2024). Diesel war im
Vorjahresvergleich 34,2 % günstiger (-8,8 % gegenüber August
2024) und die Importpreise für Motorenbenzin sanken um 30,9 %
(-9,9 % gegenüber August 2024).
Die Einfuhrpreise von
Erdgas sanken gegenüber September 2023 um 5,6 %, gegenüber August
2024 stiegen sie allerdings um 2,4 %. Elektrischer Strom war
22,2 % günstiger als im Vorjahresmonat und 4,0 % günstiger als im
August 2024. Ohne Berücksichtigung der Energiepreise waren die
Importpreise im September 2024 um 0,6 % höher als im September
2023. Gegenüber August 2024 blieben sie unverändert.
Lässt man nur Erdöl und Mineralölerzeugnisse außer Betracht,
stieg der Importpreisindex um 0,2 % gegenüber dem Stand des
Vorjahres (unverändert gegenüber August 2024). Gestiegene Preise
bei Konsumgütern Die Importpreise für Konsumgüter stiegen im
September 2024 um 1,9 % gegenüber dem Vorjahresmonat (+0,1 %
gegenüber August 2024).
Gebrauchsgüter verteuerten
sich gegenüber September 2023 leicht um 0,4 % (-0,3 % gegenüber
August 2024), der Import von Verbrauchsgütern war 2,4 % teurer
als im September 2023 (+0,1 % gegenüber August 2024). Bei den
Verbrauchsgütern musste insbesondere für Nahrungsmittel mit
+6,5 % mehr bezahlt werden als im September 2023. Geflügelfleisch
war im Import 8,4 % teurer als im Vorjahresmonat, Rindfleisch
verteuerte sich um 5,7 %.
Gestiegene Preise auch
bei landwirtschaftlichen Gütern
Die Preise für importierte
landwirtschaftliche Güter verteuerten sich zum Vorjahr um 7,3 %.
Insbesondere Rohkakao (+107,8 %) war deutlich teurer als vor
einem Jahr, gegenüber dem Vormonat sanken die Preise für Rohkakao
jedoch um 5,0 %. Die Preise für Rohkaffee waren um 37,3 % höher
als im September 2023 und stiegen auch im Vormonatsvergleich
(+2,2 %). Avocados waren 35,9 % teurer als im September 2023.
Dagegen waren unter anderem Zwiebeln (-41,6 %) und
lebende Schweine (-13,7 %) preiswerter als vor einem Jahr. Leicht
gesunkene Preise für Vorleistungsgüter und Investitionsgüter Die
Preise für Vorleistungsgüter sanken im Vorjahresvergleich um
0,4 %. Gegenüber dem Vormonat sanken die Preise um 0,3 %. Die
Preise für Investitionsgüter sanken gegenüber dem Vorjahr um
0,3 % und gegenüber dem Vormonat August 2024 um 0,1 %.
Bei den Vorleistungsgütern waren unter anderem Akkus und
Batterien (-5,2 %) sowie Eisen, Stahl und Ferrolegierungen
(-3,6 %) preiswerter als ein Jahr zuvor, während beispielsweise
Nicht-Eisen-Metalle und deren Halbzeug (+6,5 %) teurer waren. Bei
den Investitionsgütern waren insbesondere Kraftwagen und
Kraftwagenmotoren um 2,5 % teurer, während Elektronische
Bauelemente im Vorjahresvergleich um 6,3 % billiger importiert
wurden.
Preissteigerungen bei Exporten von
Investitions- und Konsumgütern
Bei der Ausfuhr hatten im
September 2024 die Preissteigerungen bei Investitionsgütern den
größten Einfluss auf die Preisentwicklung. Diese verteuerten sich
gegenüber September 2023 um 1,5 % (+0,1 % gegenüber August 2024).
Einen wesentlichen Einfluss hatten hier die gegenüber dem Vorjahr
gestiegenen Preise für Kraftwagen und Kraftwagenteile (+2,0 %)
sowie für Maschinen (+1,8 %). Exportierte Konsumgüter wurden im
Vergleich zu September 2023 um 2,5 % teurer.
Während
Gebrauchsgüter im Vorjahresvergleich nur um 1,0 % teurer waren,
lagen die Preise für Verbrauchsgüter 2,8 % über denen von
September 2023. Energieexporte waren 21,3 % billiger als im
Vorjahresmonat (-2,0 % gegenüber August 2024). Erheblich
günstiger im Vorjahresvergleich waren Mineralölerzeugnisse
(-23,7 %) und Erdgas (-18,7 %).
Während gegenüber dem
Vormonat August 2024 die Preise für Mineralölerzeugnisse sanken
(-5,6 %), wurde Erdgas teurer exportiert (+3,1 %). Auch der
Export landwirtschaftlicher Güter war im Vergleich preiswerter
(-2,2 % gegenüber September 2023 und -2,9 % gegenüber August
2024). Die Preise für exportierte Vorleistungsgüter blieben
gegenüber dem Vorjahr unverändert. Gegenüber dem Vormonat sanken
sie leicht um 0,2 %.