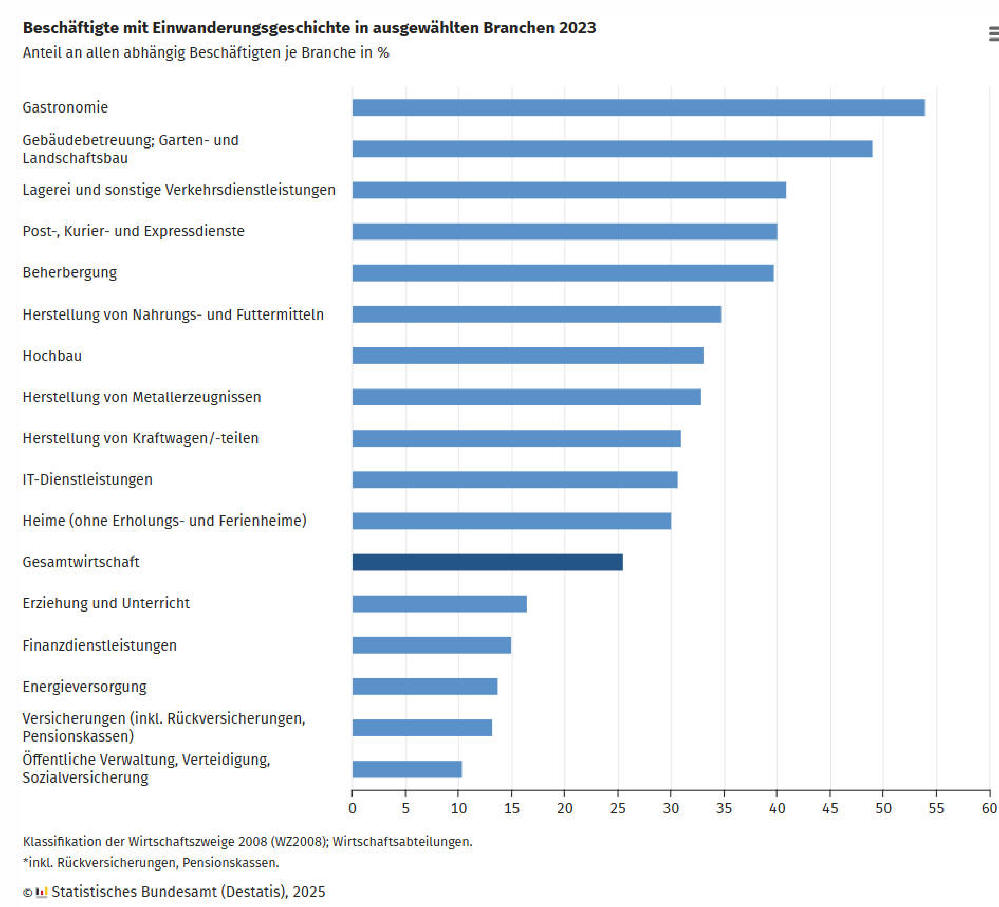|
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 9. Kalenderwoche:
28. Februar
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Samstag, 1., Sonntag, 2. März 2025 - Zero Discrimination Day am 1. März
VRR lichtet den Tarifdschungel
Der
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) hat seine angekündigte Tarifreform
umgesetzt und das Ticketsortiment um rund 75 Prozent reduziert.
Künftig bietet der Verbund statt bisher sieben nur noch drei
Preisstufen an. Rund 500 von 650 Ticketoptionen fallen künftig weg.
Tragende Säulen der Reform sind das DeutschlandTicket und das
digitale Angebot eezy.nrw.
Der NRW-weit gültige Tarif
eezy.nrw ist eine Alternative für Fahrgäste, die nur gelegentlich
mit Bus und Bahn unterwegs sind und kein Abo eingehen möchten. Hier
werden digital nur die jeweils zurückgelegten Luftlinienkilometer
berechnet. Nach eigenen Angaben vereinfacht der VRR als erster
Verbund in Deutschland seine Tarife und Strukturen.
Die
Reform sei eine Konsequenz aus der Einführung des
DeutschlandTickets. Über 95 Prozent der Stammkundinnen und -kunden
sind laut Verbund in die DeutschlandTicket-Produktfamilie
gewechselt. idr - Informationen:
https://www.vrr.de/
Wenig Bewegung auf dem
Arbeitsmarkt im Ruhrgebiet
Arbeitsmarkt bleibt stabil:
Im Februar 2025 sind im Ruhrgebiet insgesamt 282.024 Personen
arbeitslos gemeldet. Das sind im Vergleich zum Vorjahresmonat
(Februar 2024) 11.670 Personen mehr ohne Arbeit, was einer Zunahme
von 4,3 Prozent entspricht. Im Vergleich zum Januar 2024 sank die
Zahl der Arbeitslosen um 893 Personen, was einem Rückgang von 0,3
Prozent entspricht.
Ursächlich für die Stagnation auf
dem Arbeitsmarkt ist die anhaltend schwache Konjunktur und die
daraus resultierende verhaltene Einstellungsbereitschaft vieler
Betriebe. Erschwerend kommen Passungsprobleme hinzu. So suchen viele
Unternehmen nach wie vor gut qualifizierte Arbeitskräfte, welche
jedoch nicht zur Verfügung stehen. Gleichzeitig fällt es vielen
Arbeitssuchenden zunehmend schwer, eine passende Stelle zu finden.
Die Arbeitslosenquote bleibt im Vergleich zum Vormonat
unverändert und liegt im Ruhrgebiet aktuell bei 10,3 Prozent. Die
höchsten Arbeitslosenquoten verzeichnen dabei unverändert die
kreisfreien Städte Gelsenkirchen (15,4 Prozent) und Duisburg (13,2
Prozent). Mit 7,4 Prozent weist der Ennepe-Ruhr-Kreis
ruhrgebietsweit die niedrigste Arbeitslosenquote auf.
Unter den kreisfreien Städten sind es Bottrop (8,3 Prozent) und
Mülheim an der Ruhr (8,1 Prozent). In NRW ist die Zahl der
Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 629 Personen gestiegen.
Die Arbeitslosenquote in NRW liegt im Februar bei 7,9 Prozent. idr
Pädagogische Mitarbeiter*innen aus Duisburg für den
Kinderschutz an Schulen fit gemacht
Insgesamt 20
Lehrer*innen, Schulsozialarbeiter*innen, Sonderpädagogen*innen und
Erzieher*innen im Ganztag haben die neuntägige Ausbildung zur
Fachkraft für Intervention und Prävention bei sexualisierter Gewalt
an Schulen (FFIPS) erfolgreich absolviert.
Die
Teilnehmer*innen aus Bottrop, Gelsenkirchen, Duisburg,
Kamp-Lintfort, Mülheim und Oberhausen durchliefen ein
Schulungskonzept aus fünf Modulen mit den Themen "Basiswissen
sexualisierte Gewalt", "Schutzkonzept", "Intervention bei
sexualisierter Gewalt", "Prävention" und "Reflektion und Prüfung".
Durchgeführt wurden die Module durch Fachberater*innen aus
verschiedenen Beratungsstellen aus dem Ruhrgebiet.
Die
Fortbildung ist eine Initiative der Deutschen Kinderschutzstiftung
Hänsel + Gretel und wird gefördert durch die Stiftung der
Sparda-Bank West. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im
Schulungsort Haus Ripshorst in Oberhausen erhielten die
Teilnehmer*innen ihre Abschlusszertifikate und können nun in ihren
eigenen Schulen die Themen als Multiplikatoren*innen ins Kollegium
tragen.

Bildnachweis: © Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel + Gretel
Auslöser für FFIPS waren u.a. Umfragen, die gezeigt haben, dass
die mit der Fortbildung angesprochenen Zielgruppen zumeist keine
ausreichenden Vorkenntnisse im Bereich des präventiven Schutzes von
Kindern vor sexualisierter Gewalt oder auch in der Intervention
haben, sagt der ehemalige Lehrer und für die FFIPS-Organisation
verantwortliche Alfred Seidensticker, Deutsche Kinderschutzstiftung
Hänsel + Gretel.
"Sowohl in der universitären Ausbildung,
als auch in der zweiten Ausbildungsphase in den Studienseminaren bei
den Lehrer*innen sind diese Inhalte nicht fest verankert", ergänzt
Anja Krebs, eine der FFiPS-Coaches.
FFIPS vermittelte mit
dieser Fortbildung über mehrere Monate verteilt, fundiertes
Fachwissen zum Themenkomplex der sexualisierten Gewalt. Vom
notwendigen Basiswissen über Präventionskonzepte zur Intervention
werden alle für Schulpraktiker*innen relevanten Themen gelehrt.
Dabei bleibt FFIPS nicht stehen, sondern zeigt auch konkrete
Schritte auf, wie ein Schutzkonzept für die eigene Schule aussehen
kann. Es wird zudem ein Praxisprojekt realisiert, das in der eigenen
Schule zum Einsatz kommen kann.
Die Teilnehmenden erhielten
jetzt ihr Zertifikat zur "Fachkraft für Intervention und Prävention
bei sexualisierter Gewalt an Schulen". Die nächste Fortbildung
startet nach den Sommerferien wieder im Haus Ripshorst.
Interessierte finden Informationen auf der Webseite www.ffips.net
Die Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West
Die Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West
engagiert sich bereits seit 2004 in Nordrhein-Westfalen. Seit ihrer
Gründung hat sie insgesamt fast 700 gemeinnützige Projekte mit mehr
als 24 Millionen Euro gefördert. Allein im vergangenen Jahr
unterstützte sie mit 1,16 Millionen Euro 33 Projekte.
Das soziale Engagement der Stiftung leitet sich nicht zuletzt aus
dem Anspruch ab, die Gemeinschaft heute und in Zukunft zu stärken.
Ziel ist immer, das Gemeinwohl zu fördern und sich in den drei
Bereichen Kunst, Kultur und Soziales langfristig für die Menschen
vor Ort einzusetzen.
Im Fokus steht dabei die Unterstützung
von Kindern, Jugendlichen sowie älteren Menschen. Motivation ist es,
die verschiedenen Projekte als Partner mit voranzubringen. Mehr über
die Sparda-Stiftung und ihre Werte unter www.stiftung-sparda-west.de
und bei Social Media.
Stadtbibliothek eröffnet
weitere „Bibliothek der Dinge“
In der Zentralbibliothek
im Stadtfenster, Steinsche Gasse 26, steht ab Freitag, 28. Februar,
auch eine „Bibliothek der Dinge“ zur Verfügung. Zahlreiche
Musikinstrumente und Zubehör wie Stimmgeräte, Verstärker und
Notenständer können hier ab sofort ausgeliehen werden. Zur Auswahl
stehen Gitarren und Ukulelen, E-Bass und E-Gitarre, Geigen, eine
Veeh-Harfe, Bratsche, Cello und Cajons.
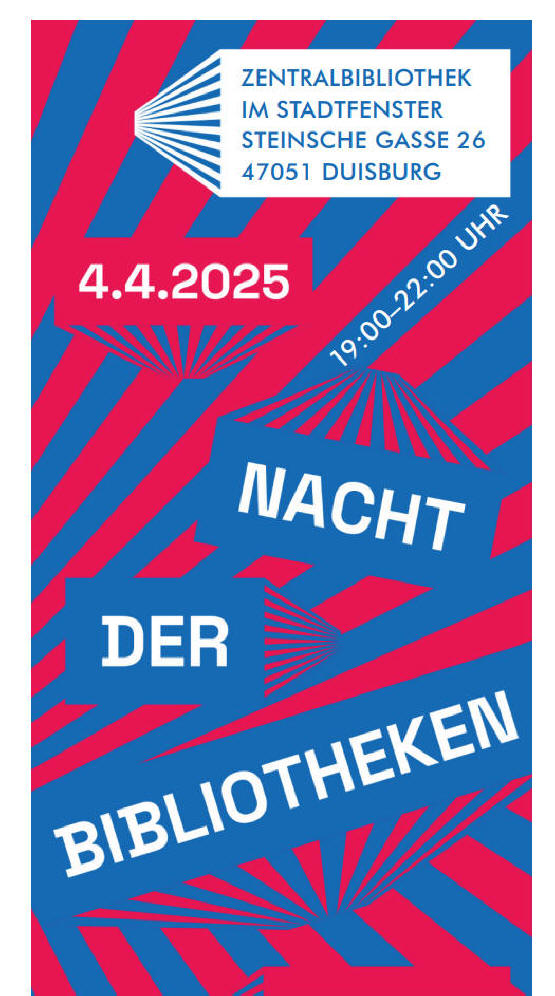
Mit diesem Sortiment ermöglicht die Bibliothek einen
niederschwelligen Zugang zu Musikinstrumenten. Viele Menschen würden
gerne ein Instrument ausprobieren, sind aber unsicher, ob die
Begeisterung dauerhaft anhält. In der „Bibliothek der Dinge“ ist ein
unkomplizierter Einstieg möglich. Jedes Instrument wird zusammen mit
einem passenden Lehrbuch verliehen, damit zuhause sofort mit dem
Spielen begonnen werden kann.
In den Leihpaketen gibt es
jeweils auch eine Kurzanweisung für das Instrument, Pflegeutensilien
und teilweise auch Stimmgeräte. Die Instrumente können wie alle
„Dinge“ für 28 Tage an der Information im Erdgeschoss entliehen und
zurückgegeben werden. Voraussetzung ist ein gültiger
Bibliotheksausweis. Eine Vormerkung oder Verlängerung ist nicht
möglich. Weitere Kosten entstehen nicht.
Wenn das
Angebot gut angenommen wird, ist eine Erweiterung mit weiteren
Instrumenten wie Akkordeon oder Keyboard geplant. Das
Musik-Sortiment ergänzt den Bestand der bereits bestehenden
„Bibliothek der Dinge“ in Rheinhausen, Buchholz und der Gesamtschule
Süd. Diese wurden bereits im vergangenen Jahr eröffnet und haben
auch jeweils einen anderen Schwerpunkt – von technisch orientiert
über kreative Freizeitgestaltung bis hin zu Bewegungsspielen und
Sportgeräten.
Das Sortiment kann einfach über den
Medienkatalog recherchiert werden. Mit dem Service setzt die
Zentralbibliothek ein Zeichen für kulturelle Teilhabe und
nachhaltige Ressourcennutzung. Leihen schont nicht nur den eigenen
Geldbeutel, sondern auch Ressourcen. Bei Fragen steht das Team der
Bibliothek gerne persönlich oder telefonisch unter 0203 283-4218 zur
Verfügung.
Geöffnet hat die Zentralbibliothek montags von 13
bis 19 Uhr, dienstags bis freitags von 11 bis 19 Uhr sowie samstags
von 11 bis 16 Uhr. Alle Informationen finden sich auch im Internet
auf
www.stadtbibliothek-duisburg.de.
Informationsveranstaltung: Umgestaltung der Moerser Straße in
Hochheide Die Stadt Duisburg informiert über die geplante
Umgestaltung der Moerser Straße in Hochheide. Hierzu findet am
Mittwoch, 5. März, eine Informationsveranstaltung mit Vertreterinnen
und Vertretern der Stadt Duisburg und der Wirtschaftsbetriebe
Duisburg in den Räumen des Gemeinschaftsbüros der Stadt Duisburg und
Hochheide Fresh, Glückaufstraße 8 in Hochheide, statt.
Es geht dabei um den Bereich zwischen Kirchstraße und Ottostraße.
Die Baumaßnahme ist Teil des „Integrierten Handlungskonzeptes
Hochheide“ (ISEK Hochheide). Alle Interessierten sind herzlich
eingeladen, sich über die geplante Umgestaltung zu informieren. Die
Veranstaltung beginnt um 16.30 Uhr. Eine Teilnahme ist ohne
vorherige Anmeldung möglich.
Aktion Mensch-Studie zum Zero Discrimination Day am 1. März:
Jugendliche mit Beeinträchtigung besonders häufig von Mobbing
betroffen
Mehr als ein Drittel der jungen Menschen mit
Beeinträchtigung hat bereits Erfahrung mit Cybermobbing gemacht –
bei jungen Menschen ohne Beeinträchtigung ist es nur ein Fünftel
Mobbingerfahrung am Lernort Schule: Jugendliche mit Beeinträchtigung
werden deutlich häufiger von Mitschüler*innen oder Lehrkräften
gemobbt
Aktion Mensch fordert Sensibilisierungs- und
Aufklärungsangebote für junge Menschen, die eine Kultur des
inklusiven Miteinanders fördern
Ausgrenzung findet häufig dort statt, wo sich die Generation Z im
Alltag regelmäßig aufhält – wie in sozialen Medien oder der Schule.
So gibt mehr als ein Drittel der Jugendlichen mit Beeinträchtigung
(35 Prozent) an, bereits Erfahrungen mit Cybermobbing gemacht zu
haben. Dagegen bestätigt das nur rund ein Fünftel der Befragten ohne
Beeinträchtigung (22 Prozent). Am häufigsten mit Cybermobbing
konfrontiert sehen sich weibliche Befragte mit Beeinträchtigung.
Auf diese alarmierenden Ergebnisse aus dem
Inklusionsbarometer Jugend, der ersten bundesweiten Vergleichsstudie
zu Teilhabechancen von jungen Menschen im Alter von 14 bis 27 Jahren
mit und ohne Beeinträchtigung, macht die Aktion Mensch anlässlich
des Zero Discrimination Day am kommenden Samstag aufmerksam. Der
Aktionstag wurde von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen und
soll auf Diskriminierung und Vorurteile aufmerksam machen sowie dazu
aufrufen, sich für Toleranz und Akzeptanz aller Menschen
starkzumachen.
Mobbing an Schulen: Jugendliche mit
Beeinträchtigung deutlich häufiger betroffen
Dass junge Menschen
mit Beeinträchtigung häufiger Opfer von Mobbing werden, spiegelt
sich auch in den Erfahrungen am Lernort Schule wider. So geben 44
Prozent an, bereits von Schüler*innen oder Lehrkräften gemobbt
worden zu sein. Bei den Befragten ohne Beeinträchtigung sind es im
Vergleich nur 16 Prozent.
Beeinträchtigungsspezifisch
werden dabei Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen wesentlich
weniger gemobbt, als wenn eine Beeinträchtigung in den Bereichen
Psyche oder Sucht vorliegt. Hier berichtet jeweils ein Anteil von 65
beziehungsweise 52 Prozent von Mobbingerfahrungen. Ebenso wird oder
wurde fast die Hälfte der jungen Menschen mit einer Beeinträchtigung
beim Sprechen, Bewegen oder einer kognitiven Beeinträchtigung
gemobbt (47 Prozent, 46 Prozent und 46 Prozent).
Aktion
Mensch fordert Inklusion und Teilhabe von Anfang an
Nur etwas
mehr als die Hälfte (55 Prozent) der befragten jungen Menschen mit
Beeinträchtigung fühlt sich von Gleichaltrigen akzeptiert und
unterstützt. Bei den Befragten ohne Beeinträchtigung geben dies fast
drei Viertel an (71 Prozent). „Die Zahlen verdeutlichen: Solange der
Umgang mit Vielfalt keine Selbstverständlichkeit ist, können
zwischen jungen Menschen Vorurteile entstehen, die Ausgrenzung und
Mobbing befördern“, erklärt Christina Marx, Sprecherin der Aktion
Mensch.
„Wenn junge Menschen jedoch früh in ihrem Leben
mit inklusiven Umfeldern in Berührung kommen, wachsen sie deutlich
selbstverständlicher in eine gleichberechtigte Gesellschaft hinein.
Wer von klein auf lernt, sich mit Respekt und Empathie zu begegnen
und Vielfalt als Mehrwert begreift, tut dies auch mit großer
Wahrscheinlichkeit in späteren Phasen des Lebens.“ Neben dem
Elternhaus sind auch Schulen, Freizeit- und Sportvereine sowie
Akteure der außerschulischen Jugendarbeit gefragt,
Anti-Mobbing-Angebote – online wie offline – sicherzustellen und ein
inklusives Miteinander proaktiv zu fördern.
Inklusionsbarometer Jugend
Im Rahmen der ersten bundesweiten
Vergleichsstudie befragte die Aktion Mensch 1.442 junge Menschen im
Alter von 14 bis 27 Jahren, davon 718 mit Beeinträchtigung und 724
ohne Beeinträchtigung. Die persönlichen Befragungen wurden in
Zusammenarbeit mit Ipsos Public Affairs zwischen November 2023 und
Februar 2024 durchgeführt. Aus den Umfrageergebnissen wurde ein
Teilhabeindex errechnet.
Ziel der partizipativ angelegten Studie ist
es, ungleiche Teilhabechancen von jungen Menschen mit und ohne
Beeinträchtigung zu identifizieren, um auf Basis der gewonnenen
Erkenntnisse Inklusion weiter voranzutreiben. Auf unserer
Landingpage finden Sie die vollständige Studie:
www.aktion-mensch.de/inklusion/bildung/inklusionsbarometer-jugend
Aktion Mensch e.V.
Die Aktion Mensch ist die größte
private Förderorganisation im sozialen Bereich in Deutschland. Seit
ihrer Gründung im Jahr 1964 hat sie mehr als fünf Milliarden Euro an
soziale Projekte weitergegeben. Ziel der Aktion Mensch ist, die
Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung, Kindern und
Jugendlichen zu verbessern und das selbstverständliche Miteinander
in der Gesellschaft zu fördern.
Mit den Einnahmen aus ihrer
Lotterie unterstützt die Aktion Mensch jeden Monat bis zu 1.000
Projekte. Möglich machen dies rund vier Millionen
Lotterieteilnehmer*innen. Zu den Mitgliedern gehören: ZDF,
Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie,
Paritätischer Gesamtverband und die Zentralwohlfahrtsstelle der
Juden in Deutschland. Seit Anfang 2014 ist Rudi Cerne ehrenamtlicher
Botschafter der Aktion Mensch.
www.aktion-mensch.de
Start Bewerbungsphase
Förderpreis Helfende Hand 2025
Das Bundesministerium des Innern und für Heimat ruft bundesweit
zur Bewerbung um den Förderpreis Helfende Hand 2025 auf Von Anfang
März bis Ende Juni können Bewerbungen in den Kategorien Innovative
Konzepte, Nachwuchsarbeit sowie Unterstützung des Ehrenamtes für den
Förderpreis eingereicht werden.
In diesem Jahr wird zudem
ein Sonderpreis zum Thema Inklusion im Bevölkerungsschutz ausgelobt.
Eine Jury aus Expertinnen und Experten des Bevölkerungsschutzes
wählt die Nominierten aus. Dieses Jahr wird die Helfende Hand zum
17. Mal verliehen. Ab dem 1. März 2025 können sich Ehrenamtliche im
Bevölkerungsschutz mit ihrem Projekt auf den Förderpreis Helfende
Hand bewerben, der in diesem Jahr vom Bundesministerium des Innern
und für Heimat (BMI) bereits zum 17. Mal verliehen wird.

Die Bewerbungsphase läuft bis zum 30. Juni 2025. Mit der
Auszeichnung werden jährlich Projekte von Organisationen,
Unternehmen sowie Einzelpersonen gewürdigt, die sich auf besondere
Weise ehrenamtlich im Bevölkerungsschutz engagiert haben. Online
bewerben Grundsätzlich können sich alle Organisationen, Unternehmen
oder Einzelpersonen mit ihrem Projekt auf die Helfende Hand
bewerben, sofern sie mit ihrem Einsatz das Ehrenamt im
Bevölkerungsschutz stärken.
Die Bewerbung kann einfach
online unter
http://www.helfende-hand-foerderpreis.de/ eingereicht werden.
Als Hilfestellung für das Ausfüllen des Formulars stehen eine
Musterbewerbung sowie ein Erklärvideo auf der Website zur Verfügung.
Drei Kategorien, ein Sonderpreis und ein Publikumspreis Der
Förderpreis Helfende Hand wird in den Kategorien Innovative
Konzepte, Nachwuchsarbeit und Unterstützung des Ehrenamtes
verliehen.
Die Jury wählt unter allen Einreichungen in
jeder Kategorie fünf Nominierte aus. Zusätzlich wird in 2025 ein
Sonderpreis für Inklusion im ehrenamtlichen Bevölkerungsschutz
vergeben. Projekte, die das Thema Inklusion im Bevölkerungsschutz
stärken, sichtbar machen oder erfolgreich umsetzen, können sich auf
die besondere Auszeichnung bewerben. Außerdem wird unter allen
Nominierungen ein Publikumspreis verliehen.
Alle
Informationen zu den Kategorien sind auf der Website der Helfenden
Hand zu finden. Die Bedeutung des Ehrenamtes Mit dem Förderpreis
würdigt das Bundesministerium des Innern und für Heimat jährlich die
im Bevölkerungsschutz aktiven Ehrenamtlichen und fördert das
Bewusstsein für ehrenamtliches Engagement als Treiber für den
Zusammenhalt in der Gesellschaft.
Der Förderpreis bietet
die Möglichkeit, sich bei ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern zu
bedanken und die Begeisterung für das Ehrenamt zu fördern. Im Jahr
2024 wurden insgesamt 15 Projekte mit dem Förderpreis ausgezeichnet.
Eine Übersicht über alle Gewinnerprojekte gibt es hier. Der Film zur
Verleihung zeigt außerdem Eindrücke der Veranstaltung und stellt die
Gewinnerinnen und Gewinner vor. Neuigkeiten rund um die Helfende
Hand gibt es auch auf Facebook und Instagram.
MSV Duisburg – Fortuna Köln: DVG setzt zusätzliche
Busse ein
Für Gäste des Fußballspiels MSV Duisburg gegen
Fortuna Köln am Samstag, 1. März, um 14 Uhr in der
Schauinsland-Reisen Arena, setzt die Duisburger Verkehrsgesellschaft
AG (DVG) die Sportlinie 945 ein.
Abfahrtszeiten Buslinie 945
Richtung MSV Arena:
ab „Salmstraße“ (Meiderich) Abfahrt um 12.06,
12.16, 12.26 Uhr
ab „Bergstraße“ um 12.11, 12.21 und 12.31 Uhr
ab „Meiderich Bahnhof“ ab 12.15 bis 12.40 Uhr alle fünf Minuten
ab „Großenbaum Bahnhof Ost“ um 12.50 und 13.05 Uhr
ab
„Betriebshof am Unkelstein“ ab 11.58 bis 12.23 Uhr alle fünf Minuten
ab Hauptbahnhof (Verknüpfungshalle) ab 12.15 bis 13.35 Uhr alle fünf
Minuten
ab „Businesspark Nord“ (Asterlagen) um 12.33 Uhr
Nach Spielende stehen am Stadion Busse für die Rückfahrt bereit.
Gäste des Fußballspieles, die eine Tageseintrittskarte im Vorverkauf
erworben haben oder eine Dauerkarte besitzen, können kostenlos die
öffentlichen Verkehrsmittel für die Hin- und Rückfahrt benutzen. Für
die Gäste, die sich an der Stadionkasse ihre Eintrittskarte kaufen,
ist die Rückfahrt mit Bus und Bahn kostenlos.
Photovoltaik-Anlagen: Oberhausen und Duisburg mit höchsten
Wachstumsraten
Die Zahl der Photovoltaik-Anlagen in der
Region wächst rasant: Im Jahr 2024 sind im Regierungsbezirk
Düsseldorf mehr als 48.000 neue Anlagen in Betrieb gegangen. Das
sind 36,8 Prozent mehr als noch Ende des Jahres 2023. Die größten
prozentualen Zuwachsraten verzeichnen Oberhausen und Duisburg. In
absoluten Zahlen liegt der Kreis Wesel mit fast 6.800 neuen Anlagen
im Jahr 2024 ganz vorn.
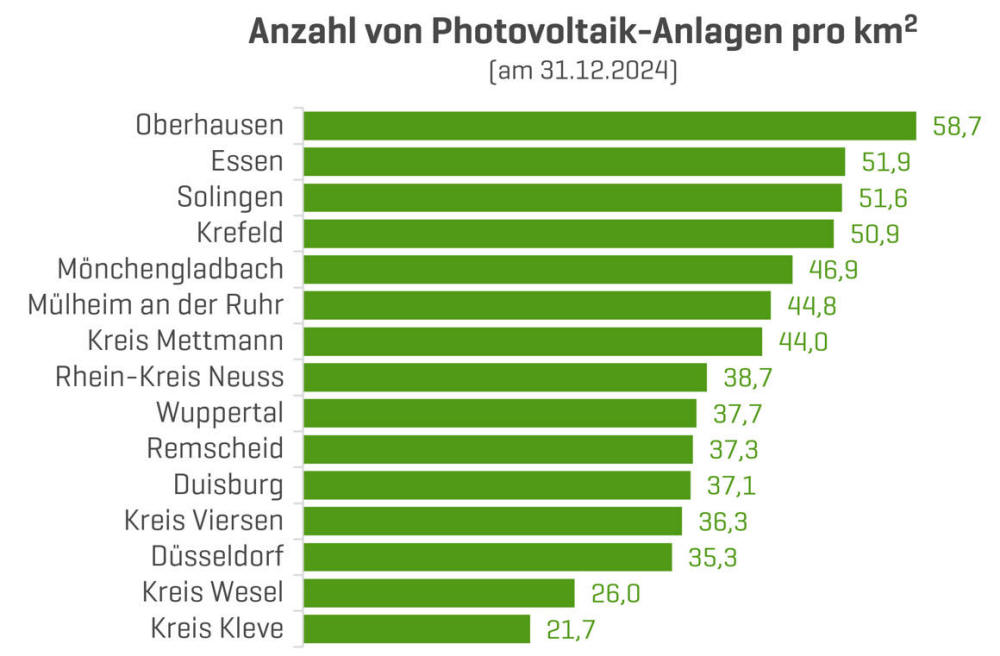
Alle Grafiken Stadtwerke Duisburg
Das zeigt
eine Regionalanalyse der Stadtwerke Duisburg, die dazu Daten aus dem
Marktstammdatenregister sowie des Statistischen Bundesamtes
ausgewertet haben. In die Statistik fließen alle Anlagen ein, die
solare Strahlung als Energieträger zur Stromerzeugung nutzen. Dazu
zählen sowohl alle registrierten Kleinanlagen wie Balkonkraftwerke
als auch große Anlagen mit Leistungen jenseits der Marke von 1
Megawatt Peak (MWp).
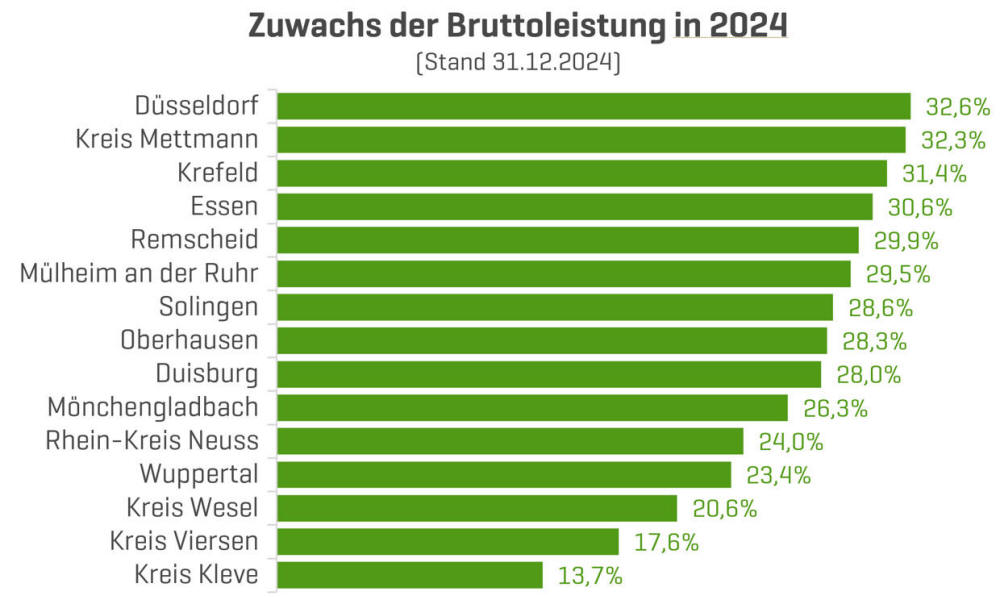
Spitzenreiter bei der Wachstumsrate sind Oberhausen und
Duisburg. In Oberhausen sind im vergangenen Jahr 1.566 neue Anlagen
ans Netz gegangen, das entspricht einem Zuwachs von 52,9 Prozent im
Vergleich zum Vorjahr. In Duisburg sind 2.892 neue
Photovoltaik-Anlagen in Betrieb gegangen, was einem Zuwachs von 50,3
Prozent entspricht.
Die Stadt an Rhein und Ruhr befindet
sich im Aufbruch und hat sich ambitionierte Klimaziele gesetzt:
Duisburg will bis zum Jahr 2035 in der städtischen Infrastruktur
komplett CO2-neutral unterwegs sein. Photovoltaik spielt dabei bei
der Energieerzeugung eine bedeutende Rolle.
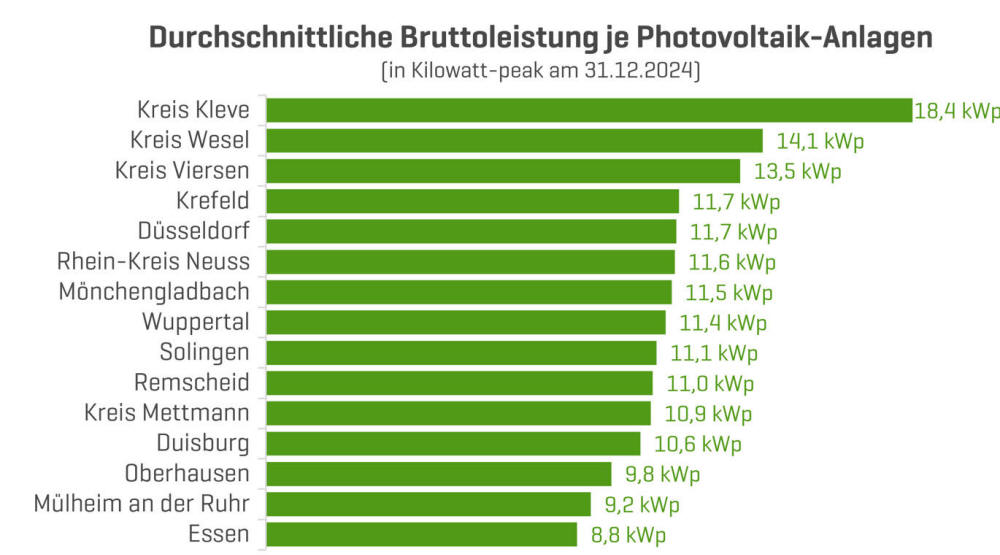
Nach absoluten Zahlen hat im Jahr 2024 der Kreis Wesel die Nase
vorn: 6.774 neue Anlagen sind dort in Betrieb gegangen, die
insgesamt eine Bruttoleistung von 65,4 Megawatt peak (MWp) liefern.
Der Kreis Kleve dagegen weist mit Abstand die höchste
Pro-Kopf-Leistung auf Basis solarer Strahlungsenergie auf: 1,5
Kilowatt Peak (kWp) sind das umgerechnet pro Einwohner, der darauf
folgende Kreis Viersen mit einer vergleichbaren Einwohnerzahl kommt
auf 0,9 kWp. Im Kreis Kleve ist aktuell die meiste solare
Erzeugungskapazität installiert. Die Anlagen dort haben insgesamt
eine Leistung von 491,8 MWp. Zum Vergleich: Die Stadt Düsseldorf mit
fast doppelt so vielen Einwohnern kommt auf eine PV-Bruttoleistung
von 89,3 MWp.
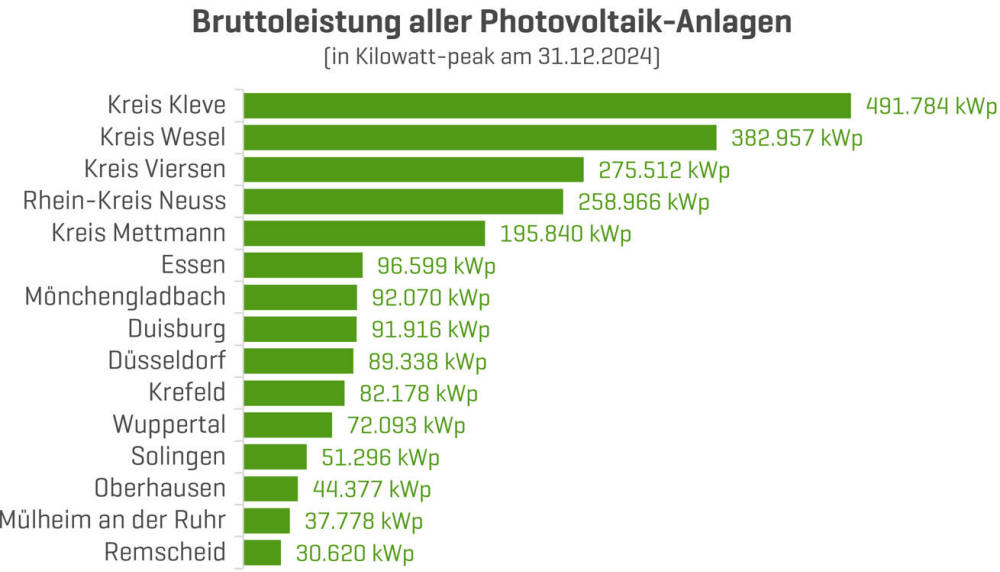
Anlagen in Kreisen größer als in den Städten
Der
Unterschied zwischen kreisfreien Städten und Kreisen lässt sich auch
an der Zahl der Anlagen nach Fläche erkennen: So kommt die Stadt
Oberhausen aktuell auf 58,7 PV-Anlagen pro Quadratkilometer, während
es im Kreis Kleve mit 21,7 Anlagen weniger als die Hälfte sind.
Dementsprechend sind die Anlagen in den Kreisen im Schnitt größer
dimensioniert als in den Städten: Während der Kreis Kleve auf eine
durchschnittliche Bruttoleistung von 18,4 kWp pro Anlage kommt und
damit das Ranking anführt, liegt der Durchschnitt in Essen am
unteren Ende der Vergleichsskala dieser Kategorie mit 8,8 kWp pro
Anlage bei weniger als der Hälfte.
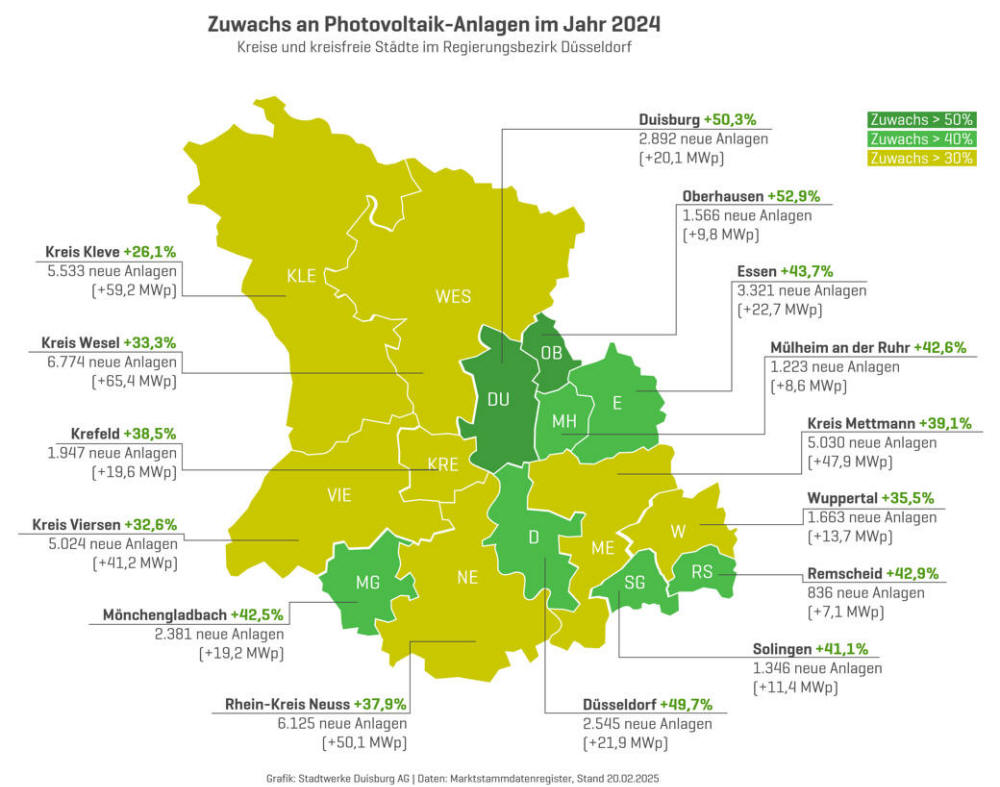
Insgesamt wurden im Regierungsbezirk Düsseldorf im Jahr 2024 rund
1.111 MWp an Photovoltaik zugebaut, so dass sich alle zum Stichtag
31. Dezember 2024 in Betrieb befindlichen Anlagen auf eine
Gesamt-Bruttoleistung von 2,3 Gigawatt (GW) summieren.
Die Stadtwerke Duisburg sind als Energieversorger erster
Ansprechpartner für Photovoltaik in Duisburg und der Region. Sie
bieten von der Beratung, Planung und Hilfe bei der Finanzierung über
die Installation bis zum Service während des Betriebs alle Schritte
aus einer Hand an.
Das Spektrum reicht von
Balkonkraftwerken, Solar-Carports und PV-Komplettpaketen bis zu
Ergänzungslösungen wie Batteriespeicher, Wärmepumpen und Wallboxen.
Auf der Internetseite swdu.de/pv finden sich neben allen Infos rund
um das Thema Photovoltaik auch ein Selbstcheck mit Zugriff auf das
Solardachkataster sowie auf die Fördermitteldatenbank.
Mercator Matinée im Stadtmuseum: Autorenlesung mit Gert
Heidenreich
Die nächste Mercator Matinée findet am
kommenden Sonntag, 2. März, um 11.15 Uhr im Kultur- und
Stadthistorischen Museum am Johannes-CorputiusPlatz (Innenhafen) mit
einer Autorenlesung von Gert Heidenreich statt. In der Lesung
befasst sich der Autor mit dem Werk „Das Meer – Atlantischer
Gesang“.
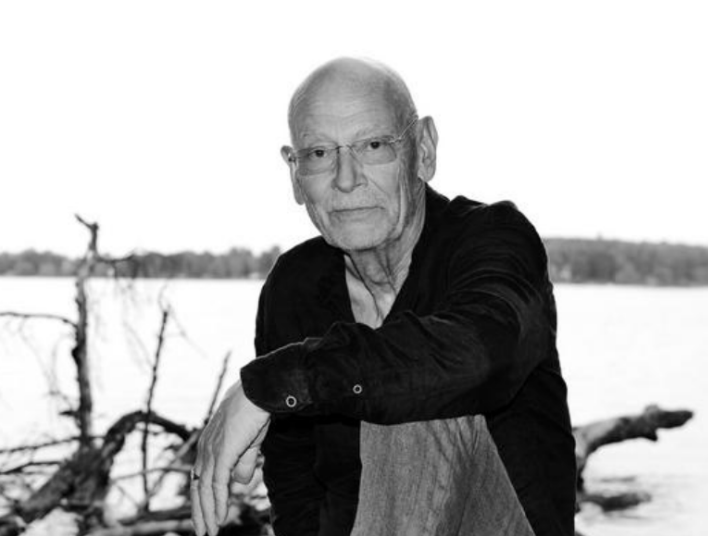
Foto Isolde Ohlbaum
Gert Heidenreichs poetisches Werk „Das
Meer – Atlantischer Gesang“ ist ein großes Langgedicht über die See
und die Kreidefelsen der leuchtenden Côte d’Albâtre in der
Normandie. Seit 1976 verbringt der Schriftsteller jedes Jahr mehrere
Monate an der französischen Atlantikküste zwischen Étretat und
Dieppe. Vor allem die Bucht von Les Petites-Dalles ist längst
wichtiger Teil seiner Biografie.
Seine Eindrücke und
Erfahrungen am Meer, seine Empfindungen und Gedanken, Erlebnisse und
Reflexionen hat er in seinem Werk „Das Meer“ gesammelt. Es erzählt
drastisch von der Verseuchung der Meere, doch die Schönheit der
Wellen und des Lichts, der Klippen, der Wolken, der Stürme
beherrscht diese Poesie, die aus naturlyrischen Betrachtungen
existentielle Fragen ableitet und mit selbstironischen Brechungen
arbeitet.
„Das Meer“ lebt von dichterischer Tradition
und zeitgenössischen Assoziationen und ist in weiten Teilen eine
geradezu erotische Feier der See. Es ist Gert Heidenreichs lyrisches
Tagebuch mit genauem, liebendem Blick auf das Meer, zugleich eine
poetische Reise zum Ursprung des Lebens.
Die Teilnahme
kostet für Erwachsene sechs Euro, ermäßigt vier Euro. Eine vorherige
Kartenreservierung telefonisch unter (0203) 283-2640 oder per EMail
an ksm-service@stadt-duisburg.de wird empfohlen. Das gesamte
Programm ist unter www.stadtmuseum-duisburg.de abrufbar.
Kinderprogramm in der Hamborner Bibliothek
In der Hamborner Bibliothek im Rathauscenter Schreckerstraße
finden auch im März viele Kinderveranstaltungen statt. Kinder ab
fünf Jahren sind am Samstag, 1. März, um 10 Uhr zum Vorlesespaß mit
Frau Cengiz eingeladen. Nach einer spannenden Geschichte wird noch
gebastelt. Am gleichen Tag um 11 Uhr können Grundschulkinder der
zweiten bis vierten Klasse sich bei den Duisburger UmweltKids
treffen.
Beim Thema „Wertstoffprofi“ geht es um das
richtige Sortieren von Müll und warum dies so wichtig für die Umwelt
ist. Die beliebte Geschichtenzeit für Kinder zwischen 6 und 12
Jahren findet am Freitag, 14. März, um 16.30 Uhr statt. Hier sind
alle richtig, die Geschichten mögen, gerne zuhören oder auch lesen.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Mehr Informationen zu diesen
und weiteren Terminen und die Anmeldung finden sich auf
www.stadtbibliothekduisburg.de. Fragen beantwortet das Team der
Bibliothek gerne persönlich oder telefonisch unter 0203 2835373. Die
Öffnungszeiten sind dienstags bis freitags von 10.30 bis 13 Uhr und
von 14 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr.
Impro-Predigten, Chor- und
Dudelsackmusik beim Gottesdienst der Nordgemeinden am Tulpensonntag
Am Tulpensonntag feiern die sechs Nordgemeinden im Evangelischen
Kirchenkreis Duisburg mit Chor- und Dudelsackmusik und mit kurzen
Improvisationspredigten zu Bibelstellen, die die Gläubigen vorgeben,
einen außergewöhnlichen Gottesdienst im Vorfeld des Rosenmontags.
Die Gemeinden laden herzlich zum Mitfeiern und Mitsingen am 2. März
im Obermeiderich Gemeindezentrum an der Emilstraße ein.

Los geht es um 11 Uhr mit live gespielter Dudelsackmusik (u.a. „Mull
of Kintyre“) auf dem Kirchplatz. Im Gottesdienst, der um 11.11 Uhr
beginnt, ist das Instrument auch zu hören – mit „Amazing Grace“ und
weiteren Liedern, die mit den Stimmen des Chores zusammen erklingen
(wie „You raise me up“. Wer Ohrstöpsel braucht und vergisst, bekommt
Gehörschütz am Eingang.
Besonders ist zudem, dass es keine
klassische Predigt geben wird: Pfarrerin Sarah Süselbeck und Pfarrer
im Ruhestand Dr. Stephan Kiepe-Fahrenholz werden sechs Mal je zwei
Minuten improvisiert predigen. Worüber, bestimmten die
Gottesdienstbesucherinnen und -besucher. Sie können vor 11.11 Uhr
eine ihre Wunsch-Bibelstelle auf einen Zettel schreiben.
Diese werden gesammelt und dann lottomäßig im Gottesdienst gezogen
und dienen als Grundlage für die spontane Zwei-Minuten-Predigt. Bis
nach der Ziehung ein Lied gesungen wird, haben Predigerin und
Prediger Zeit, die passenden Inhalte und Worte für ihre
Kurzpredigten zu finden. Nach dem Gottesdienst öffnet das
Kirchencafé und eventuell gibt es draußen noch Karnevalsschlager zu
hören und zum Mitsingen.
Vor 10 Jahren in der BZ: Veranstaltung zum
Geburtstag Gerhard Mercators
Die
Initiative „Mercator bei Nachbarn“ lädt anlässlich des
503. Geburtstags Gerhard Mercators am Donnerstag, 5. März,
ab 18 Uhr, alle die sich für das Leben und Werk des
berühmten Gelehrten interessieren zu einer kleinen Feier
ein.
Die Initiative „Mercator bei Nachbarn“ hat sich
im Vorfeld der Duisburger Akzente 2012 zum 500. Geburtstag
Mercators aus interessierten Bürgern gegründet, um über
das Leben des weltberühmten Kosmographen zu forschen. Die
Initiative pflegt Kontakte zu Gleichgesinnten in Belgien
und den Niederlanden, den einstigen Wirkungsstätten des
Universalgelehrten.
Um 18.15 Uhr beginnt die
Veranstaltung in der Salvatorkirche (Treffpunkt um 18 Uhr
vor dem Mercatorbrunnen am Rathaus/Burgplatz). Dort wird
Pfarrer Martin Winterberg die theologischen Überlegungen,
die Mercator in seiner Kosmographie ausgeführt hat,
erläutern.
Gegen 18.40 Uhr wird das Programm in der
Mercator-Werkstatt des Kultur- und Stadthistorischen
Museums am Johannes-Corputius-Platz
1 in Duisburg-Mitte fortgesetzt: Imke Alers (Oboe),
Friedemann Pardall (Cello) und Rafael Sars (Pauke,
Schlagwerk) von den Duisburger Philharmonikern lassen
Musik des 16. Jahrhunderts erklingen und der neu
gegründete Gerhard-Mercator-Chor erhebt seine Stimmen zu
einem alten flämischen Liebeslied.

Die Sänger werden sich
dann, zum Teil historisch gewandet, vorstellen: Gerhard
Mercator und seine Tochter Dorothea, Bürgermeister Walter
Ghim und der Student Johannes Corputius. Mit Gesprächen
und einem kleinen Imbiss wird der Abend gegen 20 Uhr
ausklingen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung
nicht erforderlich. - Mercator-Portrait auf dem Epitaph in
der Salvatorkirche (Foto: KSM)
Die Citykirche kennenlernen -
Kostenfreie Führung durch Salvator
Die Salvatorkirche
am Burgplatz gehört zu Duisburgs bekanntesten und imponierendsten
Gotteshäusern. An jedem ersten Sonntag im Monat informieren
geschulte Gemeindeleute, meist Ehrenamtliche, über die Geschichte,
den Baustil und die besonderen Fenster der über 700 Jahre alten
Stadtkirche neben dem Rathaus.
Am Sonntag, 2. März 2025
um 15 Uhr macht Folker Nießalla mit Interessierten an
verschiedensten Stellen der Kirche halt und berichtet dazu
Wissenswertes und Kurzweiliges. Eine Anmeldung ist nicht notwendig,
alle Kirchenführungen in der Salvatorkirche sind kostenfrei. Infos
zum Gottesshaus gibt es unter
www.salvatorkirche.de.
Karnevalsgottesdienst
mit kölschen Liedern im Duisburger Süden
Wenn am ersten
März-Sonntag ganz Duisburg Karneval feiert und alles schon auf den
Rosenmontag schaut, zeigen Pfarrerin Ute Sawatzki und Pop-Kantor
Daniel Drückes in der Evangelischen Gemeinde Trinitatis, dass auch
Kirche und Karneval gut zusammenpassen.
Wer sich davon
überzeugen will, kommt am Tulpensonntag, 2.3.2025 zum jecken
Karnevalsgottesdienst in die Jesus-Christus-Kirche, Arlberger Str.
6, in Buchholz. Predigt und Gedankenimpulse zeigen dabei die
Verbindung von Karneval und dem christlichen Glauben auf. Davon
erzählen auch die kölschen Lieder, die im Karneval oft und gerne
gesungen werden und in denen oftmals eine durchaus christliche
Botschaft mitschwingt.
Ein Projektchor aus 15
Sängerinnen und Sängern hat für den Gottesdienst extra einige
kölsche Lieder einstudiert. So gibt es Musik von den Bläck Fööss,
Brings und Miljö. Pfarrerin Sawatzki und Popkantor Drückes laden
herzlich zum Mitfeiern und Mitsingen ein. Wer gerne in Kostüm kommen
möchte, ist auch herzlich gerne gesehen - Verkleidung ist aber kein
Muss. Der Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr. Infos zur Gemeinde gibt
es im Netz unter www.trinitatis-duisburg.de.

NRW-Inflationsrate liegt im Februar 2025 bei 1,9 Prozent
Der Verbraucherpreisindex für Nordrhein-Westfalen ist
von Februar 2024 bis Februar 2025 um 1,9 Prozent gestiegen
(Basisjahr 2020 = 100). Wie Information und Technik
Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, stieg der
Preisindex gegenüber dem Vormonat (Januar 2025) um 0,4 Prozent.
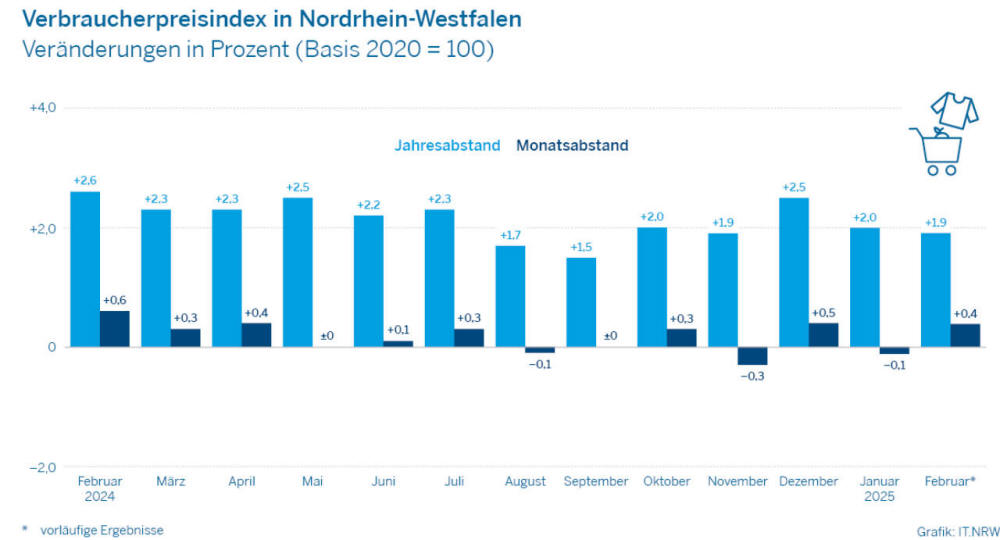
Vormonatsvergleich: Paprika sind um 15,4 Prozent teurer als im
Januar 2025 Zwischen Februar 2024 und Februar 2025 stiegen u. a. die
Preise für Nahrungsmittel (+2,0 Prozent). Hier verteuerten sich
insbesondere Butter (+25,6 Prozent), Tomaten (+22,2 Prozent),
Schokoladentafeln (+21,8 Prozent), Gurken (+19,3 Prozent) und
Paprika (+17,2 Prozent). Günstiger waren Möhren (−15,7 Prozent) und
Kartoffeln (−11,9 Prozent).
Die Energiepreise
(Kraftstoffe und Haushaltsenergien) sanken im Vergleich zum
Vorjahresmonat im Durchschnitt um 2,0 Prozent. Überdurchschnittliche
Preissteigerungen verzeichneten die Dienstleistungen für
Altenwohnheime und ähnliche Einrichtungen (+9,9 Prozent).
Vormonatsvergleich: Paprika sind um 15,4 Prozent teurer als im
Januar 2025 Zwischen Januar 2025 und Februar 2025 verteuerten sich
Nahrungsmittel um durchschnittlich 1,2 Prozent. Die Preise für
Paprika (+15,4 Prozent), Tomaten (+13,6 Prozent) und
Schokoladentafeln (+12,5 Prozent) zogen überdurchschnittlich an.
Preisrückgänge verzeichneten u. a. Gurken (−4,4 Prozent) sowie
verschiedene Bekleidungsartikel, u. a. Damennachthemd/-schlafanzug
(−4,6 Prozent) sowie Strümpfe, Socken oder Strumpfhosen für Damen
(−4,3 Prozent).
Gemüseernte 2024 um 6 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen
• Zahl der Betriebe gegenüber 2020 um gut 4 % gesunken,
gegenüber 2012 um 19 % • 15 % der gesamten Gemüseanbaufläche wurden
ökologisch bewirtschaftet WIESBADEN – Im Jahr 2024 haben die
landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland insgesamt 4,2 Millionen
Tonnen Gemüse geerntet.
Die Gesamterntemenge ist damit
um 6,1 % gegenüber 2023 gestiegen und lag auf dem zweithöchsten
Stand seit 2012. Nur im Jahr 2021 wurde mit 4,3 Millionen Tonnen
mehr Gemüse geerntet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
weiter mitteilt, stieg die gesamte Anbaufläche für Gemüse um 3,2 %
gegenüber dem Vorjahr auf 126 800 Hektar.
Die Anbaufläche
von 2024 lag damit 2,9 % über dem langjährigen Mittel (2012 bis
2023). Die Zahl der Gemüse erzeugenden Betriebe nahm gegenüber der
letzten Vollerhebung im Jahr 2020 von 6 100 auf 5 830 ab (-4,4 %).
Seit 2012 ist die Anzahl dieser Betriebe um 19,0 % gesunken.
Freilandanbauflächen um gut 3 % gewachsen
Im Freiland
erzeugten 5 630 Betriebe im Jahr 2024 auf 125 550 Hektar Gemüse.
Dies entsprach einem Anstieg der Freilandanbauflächen um 3,3 %
gegenüber dem Vorjahr. Regional wurden 2024 die größten Anbauflächen
im Freiland in Nordrhein-Westfalen mit 28 200 Hektar, Niedersachsen
mit 24 400 Hektar, Bayern mit 16 500 Hektar und Rheinland-Pfalz mit
16 400 Hektar bewirtschaftet. Karotten mit größter Erntemenge vor
Speisezwiebeln und Weißkohl – Spargel mit größter Anbaufläche Möhren
beziehungsweise Karotten waren im Freiland mit 850 600 Tonnen im
Jahr 2024 wie in den Vorjahren die Gemüseart mit der größten
Erntemenge in Deutschland.
Bei einer Ausweitung der
Anbaufläche um 2,3 % gegenüber dem Vorjahr nahm die Erntemenge um
6,8 % zu. Die Gemüseart mit der zweitgrößten Erntemenge waren erneut
Speisezwiebeln mit 744 400 Tonnen (+11,7 % gegenüber 2023), gefolgt
von Weißkohl mit 427 100 Tonnen (+7,2 %), Einlegegurken mit 213 700
Tonnen (+10,3 %) und Eissalat mit 127 800 Tonnen (+5,4 %).
Im Hinblick auf die gesamte Gemüseanbaufläche im Freiland lagen
Karotten 2024 mit einer Fläche von 13 800 Hektar an dritter Stelle
hinter Spargel mit 19 760 Hektar ertragsfähiger Fläche (-3,0 %), und
Speisezwiebeln mit 17 700 Hektar (+17,4 %). Danach folgten Weißkohl
mit 6 150 Hektar (+15,9 %), und Speisekürbisse mit 5 260 Hektar
(-0,7 %).
Ökologische Gemüseernte um gut 10 % gestiegen
Ökologisch
wirtschaftende Betriebe erzeugten auf 19 350 Hektar insgesamt
529 800 Tonnen Gemüse. Das entspricht 15,3 % der gesamten
Gemüseanbaufläche und 12,7 % der gesamten Erntemenge. Gegenüber 2023
stieg die ökologisch bewirtschaftete Anbaufläche um 5,0 % und die
zugehörige Erntemenge um 10,4 %. Die größte Anbaufläche im
ökologischen Gemüseanbau entfiel auch 2024 auf Karotten mit
3 350 Hektar (17,3 %).
Speisekürbisse wurden auf 2 020
Hektar (10,4 %) angebaut und Speisezwiebeln auf 1 880 Hektar
(9,7 %), gefolgt von Spargel (im Ertrag) mit einer Anbaufläche von
1 780 Hektar (9,2 %). Besonders hohe Anteile ökologischer Erzeugung
an der Gesamterntemenge zeigten sich bei den Gemüsearten Rote Bete
mit 40,8 %, Speisekürbisse mit 36,3 %, Zucchini mit 33,0 % sowie
Frischerbsen mit 23,4 % und Karotten mit 22,8 %.
Tomaten und
Salatgurken mit den größten Anbauflächen in Gewächshäusern
Die
Anbauflächen von Gemüse unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen,
zum Beispiel in Gewächshäusern oder unter hohen Folienabdeckungen,
sind 2024 im Vorjahresvergleich um 2,6 % gesunken. Dennoch haben
1 540 Betriebe auf 1 240 Hektar mit 210 000 Tonnen Gemüse die größte
Erntemenge seit 2012 erzielt.
In den letzten 12 Jahren
ist die Anzahl der Betriebe, die Gemüse unter hohen begehbaren
Schutzabdeckungen anbauen, um nahezu ein Viertel (-24,1 %) gesunken,
während die entsprechenden Gemüseanbauflächen in dieser Zeit
zwischen 1 200 und 1 320 Hektar schwankten. Die größten Anbauflächen
entfielen 2024 auf Tomaten mit 390 Hektar und Salatgurken mit 240
Hektar.
Während der Anbau von insbesondere Feldsalat
(-46,9 % auf 150 Hektar) und Kopfsalat (-27,9 % auf 60 Hektar) seit
2012 immer weiter reduziert wurde, nahm der Anbau von Tomaten
(+22,4 %), Salatgurken (+10,1 %) und vor allem Paprika (+84,9 % auf
120 Hektar) deutlich zu. Parallel ist die Erntemenge von Tomaten um
76,5 % auf 108 000 Tonnen und von Paprika um 214,8 % auf 16 500
Tonnen gestiegen. Dies zeigt eine erhebliche Intensivierung des
Anbaus dieser Kulturen in den letzten Jahren.
Beschäftigte mit Einwanderungsgeschichte in vielen
Mangelberufen überdurchschnittlich stark vertreten
Anteil im Aus- und Trockenbau 2023 bei 67 %, in der
Lebensmittelproduktion bei 51 %, bei Bus- und
Straßenbahnfahrer/-innen bei 46 % – gegenüber 26 % in der
Gesamtwirtschaft
Ob im Bau, in der Lebensmittelindustrie,
der Gastronomie, der Pflege oder im Personen- und Güterverkehr: In
vielen Engpassberufen sind Beschäftigte mit Einwanderungsgeschichte
überdurchschnittlich stark vertreten. So hatten zwei von drei (67 %)
Beschäftigten im Aus- und Trockenbau 2023 eine
Einwanderungsgeschichte, wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
auf Basis von Ergebnissen des Mikrozensus mitteilt.
In
der Lebensmittelherstellung traf dies auf mehr als die Hälfte der
Beschäftigten zu (51 %). Überdurchschnittlich hoch war der Anteil
auch in der Berufsgruppe der Fliesenleger/-innen (47 %), unter den
Fahrer/-innen von Bussen und Straßenbahnen (46 %) sowie unter
Servicekräften in der Gastronomie (45 %).
In der
Gesamtwirtschaft hatte gut ein Viertel (26 %) aller abhängig
Beschäftigten eine Einwanderungsgeschichte, war also selbst seit dem
Jahr 1950 nach Deutschland eingewandert oder beide Elternteile waren
seither zugewandert. In sogenannten Engpassberufen herrscht oder
droht laut Engpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit (BA) ein
Fachkräftemangel.
Knapp ein Drittel der Beschäftigten in der
Altenpflege hat eine Einwanderungsgeschichte
Deutlich über dem
gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt liegt der Anteil der
Beschäftigten mit Einwanderungsgeschichte auch in weiteren
Mangelberufen: so etwa in der Fleischverarbeitung (42 %), im Verkauf
von Lebensmitteln (41 %), bei Berufskraftfahrer/-innen im
Güterverkehr (37 %), in der Altenpflege (31 %) sowie im Metallbau
oder der Elektrotechnik (je 30 %).
Den Engpassberuf mit
dem geringsten Anteil an Beschäftigten mit Einwanderungsgeschichte
stellten Versicherungskaufleute dar (13 %). Auch wenn es sich im
Folgenden nicht um Mangelberufe laut Engpassanalyse der BA handelt,
sind Menschen mit Einwanderungsgeschichte in einigen Berufsgruppen
noch stärker unterrepräsentiert: Das trifft vor allem auf den
Polizeivollzugsdienst (6 %), die Berufe in der öffentlichen
Verwaltung (9 %), auf Lehrkräfte (Primarstufe: 9 %, Sekundarstufe:
11 %) sowie die kaufmännische und technische
Betriebswirtschaft (12 %) zu.
Beschäftige mit
Einwanderungsgeschichte in ausgewählten Engpassberufen 2023 Bar
chart with 16 bars. Anteil an allen abhängig Beschäftigten je Beruf
in % Klassifikation der Berufe 2010 (KldB 2010); Berufsuntergruppen.
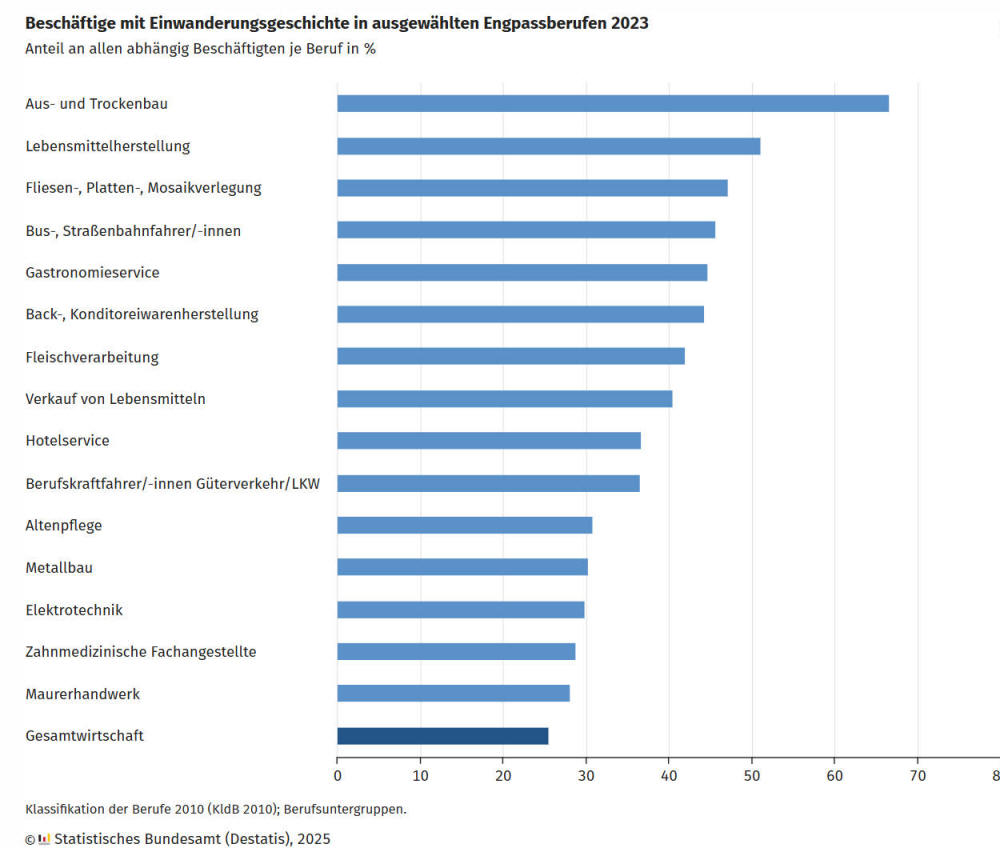
Branchen: Gastronomie und Gebäudebetreuung anteilig mit den meisten
Beschäftigten mit Einwanderungsgeschichte
Nicht allein in vielen
Mangelberufen ist der Anteil der Menschen mit
Einwanderungsgeschichte hoch. Einige Branchen sind insgesamt in
besonderem Maße auf Arbeitskräfte angewiesen, die selbst oder deren
beide Elternteile zugewandert sind. Das ist vor allem in der
Gastronomie der Fall – gefolgt von der Gebäudebetreuung sowie der
Lagerei und den sonstigen Verkehrsdienstleistungen.
2023
hatte mehr als die Hälfte (54 %) aller abhängig Beschäftigten in der
Gastronomie, unabhängig vom jeweils ausgeübten Beruf, eine
Einwanderungsgeschichte. In der Gebäudebetreuung, die zum Großteil
aus Gebäudereinigung besteht, zu der aber auch Garten- und
Landschaftsbau zählen, hatte knapp die Hälfte (49 %) der
Beschäftigten eine Einwanderungsgeschichte.
Im Bereich
Lagerei und sonstige Verkehrsdienstleistungen waren es 41 %. Einen
überdurchschnittlich großen Anteil hatten Beschäftigte mit
Einwanderungsgeschichte auch in Post-, Kurier- und Expressdiensten
sowie in der Beherbergung (jeweils 40 %). In der
Kraftwagenproduktion (31 %) sowie in Alten- und Pflegeheimen und
ähnlichen Einrichtungen (30 %), beides beschäftigungsstarke Bereiche
mit jeweils mehr als einer Million Beschäftigten, lag der Anteil
ebenfalls deutlich über dem Durchschnitt in der
Gesamtwirtschaft (26 %).
Deutlich unterrepräsentiert
waren Menschen mit Einwanderungsgeschichte 2023 dagegen im Bereich
öffentliche Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung (10 %),
bei Versicherungen (13 %), in der Energieversorgung (14 %), in
Finanzdienstleistungen (15 %) sowie in Erziehung und
Unterricht (17 %).