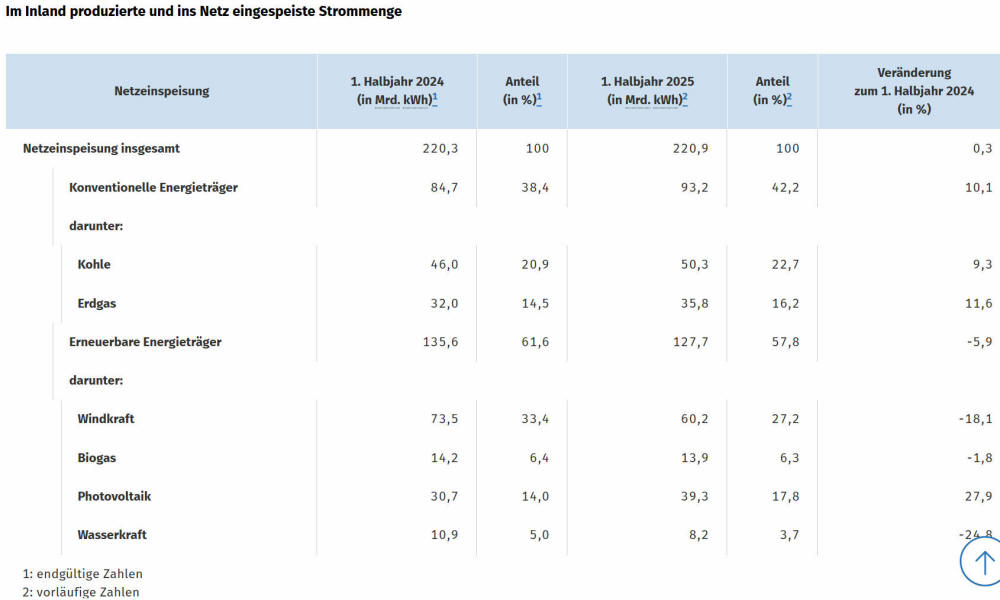|
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 37. Kalenderwoche:
8. September
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Dienstag, 9. September 2025
Wetterwarnung
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat ein "Unwettervideo"unter
www.dwd.de, auf YouTube unter
www.youtube.com/DWDderWetterdienst und in der DWD WarnWetter-App
(https://www.dwd.de/DE/service/dwd-apps/dwdapps_artikel.html)
veröffentlicht.
Steigende Pegel im Regierungsbezirk
Düsseldorf – Lage aktuell unkritisch, Entspannung im Tagesverlauf
erwartet
Die anhaltenden Niederschläge seit der vergangenen Nacht haben zu
steigenden Pegelständen in den Flüssen des Regierungsbezirks
Düsseldorf geführt. Besonders betroffen sind derzeit Erft und Niers.
Durch die Verlagerung der Regenfront in Richtung Nordosten kann es
im Laufe des Tages auch an weiteren Gewässern zu vorübergehenden
Pegelerhöhungen kommen.
Aktuell am Niederrhein 46
Liter/Quadratmeter

Foto
Pixabay
Nach den aktuellen Prognosen der Hochwasserzentrale ist jedoch
davon auszugehen, dass sich die Lage im Tagesverlauf entspannt. Die
Regenfälle lassen zunehmend nach, ab dem Nachmittag wird mit einer
vorübergehend regenfreien Wetterlage gerechnet. Die derzeitigen
Wasserstände sind nach Einschätzung unkritisch.
Die
Bezirksregierung Düsseldorf steht in engem Austausch mit den
zuständigen Wasserwirtschaftsverbänden und verfolgt die Entwicklung
kontinuierlich. Lokal aufgetretene Überschwemmungen werden von den
Einsatzkräften vor Ort abgearbeitet. Die Bevölkerung wird gebeten,
sich fortlaufend über die regionale Betroffenheit im
Hochwasserportal NRW und bei der Hochwasserzentrale zu informieren.
Einzug ins Torhaus Süd VBG-Bezirksverwaltung am neuen
Duisburger Standort eingeweiht
Duisburg, 9. September 2025 – Nach dem Richtfest im April letzten
Jahres hat die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) gestern die
Einweihung ihrer neuen Bezirksverwaltung im Torhaus Süd an der
Düsseldorfer Straße gefeiert. Mit dem modernen Neubau in zentraler
Lage unterstreicht die VBG ihre langfristige Verbundenheit mit
Duisburg, präsentiert sich als attraktive Arbeitgeberin – und ist
erreichbar als gesetzliche Unfallversicherung für die
Mitgliedsunternehmen und die Versicherten.

Zwei Jahre nach dem
Einzug in den Übergangsstandort an der Düsseldorfer Landstraße
sollen die rund 200 VBG-Beschäftigten der Bezirksverwaltung Duisburg
am 17. September im Torhaus Süd ihre Arbeit aufnehmen. Im
sechsgeschossigen Bürogebäude mit Tiefgarage werden künftig auch
Weiterbildungen für die Mitgliedsunternehmen, Ausstellungen und
Veranstaltungen zum sicheren und gesunden Arbeiten stattfinden.
Oberbürgermeister Sören Link würdigte auf der Festveranstaltung die
Entscheidung der VBG, sich im Zentrum Duisburgs anzusiedeln: „Die
neue Bezirksverwaltung der VBG ist eine Bereicherung für unsere
Stadt. Sie stärkt den Einzelhandel und die Gastronomie im
Dellviertel und gibt wichtige Impulse für die Entwicklung der
Innenstadt.“

BZ-Foto Baje
Investition in moderne Arbeitswelten und
offene Unternehmenskultur Volker Enkerts, Vorstandsvorsitzender
der VBG, bezeichnete den Neubau als Investition in moderne
Arbeitswelten und eine offene Unternehmenskultur: „Unser neues
Gebäude steht für Innovation, Nachhaltigkeit und Teamgeist – Werte,
die wir als Arbeitgeberin leben und weiterentwickeln möchten. Wir
schaffen hier ein barrierefreies Umfeld, in dem sich unsere
Mitarbeitenden wohlfühlen und ihr Potenzial entfalten können.“
Die Vorteile für das Team hob auch Hendrik Hillebrand-Hüter,
Geschäftsführer der VBG-Bezirksverwaltung Duisburg, hervor: „Durch
die zentrale Lage im Dellviertel sind wir für unsere
Mitgliedsunternehmen und Versicherten bestens erreichbar.
Gleichzeitig profitieren unsere Mitarbeitenden von modernen Büros,
einem einladenden Bistro und zahlreichen Kommunikationszonen, die
den Austausch und das Miteinander fördern. Das neue Gebäude ist ein
echter Gewinn – für unsere Arbeit und das tägliche Miteinander.“
Duisburg ist eine von bundesweit elf
VBG-Bezirksverwaltungen, an denen die Beschäftigten der VBG
Unternehmen und Versicherte aus der Region beraten und
betreuen. Auch für Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger bietet
die VBG viele Möglichkeiten am Standort Duisburg. So starten jedes
Jahr zwischen sechs und acht duale Studierende und Auszubildende
ihre berufliche Laufbahn in der Bezirksverwaltung. Interessierte
finden weitere Informationen unter vbg-karriere.de.

Eröffnung: VBG-Vorstandsvorsitzender Volker Enkerts,
stellvertretende VBG-Hauptgeschäftsführerin Nada Göltzer und
Oberbürgermeister der Stadt Duisburg Sören Link eröffnen die
VBG-Bezirksverwaltung Duisburg, Quelle: VBG/harderphoto
Bildunterschrift VBG-Gebäude: Der neue Sitz der
VBG-Bezirksverwaltung in Duisburg in zentraler Lage, Quelle:
Zech/Renger
Sondervermögen: Großer Anteil muss an
Städte und Gemeinden gehen
Berlin hat 100 Milliarden Euro für Länder und Kommunen vorgesehen –
doch, wie diese verteilt werden, ist bisher offen. Das
Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte“ verweist darauf, dass
die Kommunen in allen Ländern mindestens zwei Drittel der
Investitionen stemmen, in NRW sogar 78 Prozent.
Die
Umsetzung des Sondervermögens Infrastruktur nimmt Formen an.
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat nun ein Gremium einberufen,
das ihn bei der Verteilung der insgesamt 500 Milliarden Euro berät.
Dabei geht es auch um die Frage, wie mit den 100 Milliarden Euro
verfahren wird, die für Länder und Kommunen vorgesehen sind. Das
Aktionsbündnis
„Für die Würde unserer Städte“ richtet einen
klaren Appell an den Beirat: Mindestens zwei Drittel müssen an die
Kommunen gehen. Das Aktionsbündnis verweist auf harte Fakten: Rund
zwei Drittel aller öffentlichen Investitionen stammen von Städten
und Gemeinden. Daher sollte die Vergabe auch in dieser Größenordnung
an die Kommunen erfolgen.
Die Länder sollten zudem
verpflichtet werden, interne Verteilungen an der tatsächlichen
Investitionslast und nicht etwa an Fläche oder Einwohnerzahl
auszurichten. Im Referentenentwurf zum Sondervermögen hatte der Bund
eine Mindestens-60- Prozent-Regelung vorgesehen. Doch in den
weiteren Verhandlungen wurde diese Klausel gestrichen.
„Bei
allem Respekt für die Finanzsorgen der Länder: Das ist unangemessen
und ungerecht“, betonen Martin Murrack (Duisburg) und Silke
Ehrbar-Wulfen, Sprecher des Aktionsbündnisses „Für die Würde unserer
Städte“. Sie erinnern daran, dass der Bund den Ländern durch den
neuen Verschuldungsspielraum hilft, ihre Haushalte aufstellen zu
können.
Diese Möglichkeit haben die Kommunen nicht. Für
Nordrhein-Westfalen schließt sich das Aktionsbündnis der Forderung
des Städtetags NRW an: „78 Prozent ist der kommunale Anteil der
Investitionen in NRW – daher muss dieser Anteil auch an die Kommunen
weitergeleitet werden.
Während es in vielen anderen
Bundesländern schon Regelung für die Verteilung der Bundesmittel
gibt, hüllt sich die Landesregierung des größten Bundeslandes mit
den größten kommunalen Finanzproblemen in Schweigen. Die Zeit
drängt“, sagt Martin Murrack, Sprecher des Aktionsbündnisses „Für
die Würde unserer Städte“.
„Für die Würde unserer Städte“
vertritt die finanzschwachen Kommunen in Deutschland. Diese haben
einen besonders hohen Investitionsbedarf. Wegen der ungleichen
Finanzverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen, den massiv
gestiegenen Sozialausgaben sowie Altschulden in Höhe von rund 35
Milliarden Euro haben die Betroffenen dringend erforderliche
Investitionen immer weiter aufgeschoben.
Das gilt sowohl für
Investitionen in die Infrastruktur vor Ort als auch in
Zukunftsthemen wie Digitalisierung oder Klimaschutz. Die KfW hat
jüngst für alle Kommunen in Deutschland einen Investitionsrückstand
von 215,7 Milliarden Euro errechnet. Wenn Finanzministerium und
Beirat keinen Mindest-Anteil der Kommunen festlegen, werden Städte
und Gemeinden zum zweiten Mal benachteiligt.
So sieht der
Koalitionsvertrag zwar 250 Millionen Euro pro Jahr für die kommunale
Altschuldenlösung vor – zugleich aber 400 Millionen Euro jährlich
zur Entlastung der Geberländer.
Im Aktionsbündnis „Für die
Würde unserer Städte“ haben sich 74 Kommunen aus acht Bundesländern
zusammengeschlossen. In den Städten und Kreisen leben rund zehn
Millionen Menschen. Die Kommunen sind besonders vom Strukturwandel
betroffen, deshalb haben sie geringe Einnahmen aus Steuern und hohe
Ausgaben, insbesondere im Sozialbereich.
Die Mitglieder
sind: Bacharach, Bad Schmiedeberg, Bergkamen, Bischofsheim, Bochum,
Bottrop, Castrop-Rauxel, Cottbus, Landkreis Cuxhaven, Cuxhaven,
Dietzenbach, Dinslaken, Dorsten, Dortmund, Duisburg, Ennepetal,
Ennepe-Ruhr-Kreis, Essen, Frankenthal, Frankfurt am Main, Geestland,
Gelsenkirchen, GinsheimGustavsburg, Gladbeck, Kreis Groß-Gerau,
Hagen, Hamm, Hamminkeln, Hattingen, Herne, Herten, Kaiserslautern,
Koblenz, Krefeld, Lahnstein, Leverkusen, Löhne, Ludwigshafen, Lünen,
Mainz, Mayen, Mettmann, Moers, Mönchengladbach, MörfeldenWalldorf,
Mülheim an der Ruhr, Neustadt an der Weinstraße, Neuwied,
Oberhausen, Obertshausen, Oer-Erkenschwick, Offenbach, Pirmasens,
Recklinghausen, Kreis Recklinghausen, Remscheid, Saarbrücken,
Salzgitter, Schwerin, Schwerte, Solingen, Trier, Kreis Unna, Unna,
Voerde, Völklingen, Waltrop, Werne, Wesel, Witten, Worms, Wülfrath,
Wuppertal und Zweibrücken. www.fuerdiewuerde.de
Bezirksbibliothek Buchholz schließt vorübergehend
Die Bezirksbibliothek Buchholz auf der Sittardsberger Allee 14
bleibt aufgrund umfangreicher Sanierungs- und
Modernisierungsmaßnahmen von Dienstag, 9. September bis
voraussichtlich Montag, 20. Oktober, geschlossen.
In den
Räumlichkeiten werden aufgrund eines undichten Daches
Feuchtigkeitsschäden beseitigt und der Bodenbelag erneuert.
Gleichzeitig sollen Kundinnen und Kunden nach der Wiedereröffnung
eine modernisierte Bezirksbibliothek vorfinden. Alle Arbeitsplätze
werden elektrifiziert, so dass es dann deutlich mehr
Lademöglichkeiten von Mobilgeräten geben.
Die Abtrennung
zwischen Lesesaal und Bibliotheksbereich wird zu einer
Schallschutzwand umgebaut, um Veranstaltungen, Gruppenarbeiten und
den Publikumsbetrieb besser voneinander zu trennen. Der
Gamingbereich wird modernisiert und zeitgemäß ausgestattet. Im
Rahmen der energetischen Sanierung werden Lichtkuppeln gedämmt und
die Beleuchtung auf LED umgestellt.
Die Leihfristen für in
Buchholz entliehene Medien werden entsprechend angepasst. Kundinnen
und Kunden können während der Schließung auf die Bibliothek in der
Gesamtschule Süd auf der Großenbaumer Allee 168-174 ausweichen
(Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10.30 bis 13 Uhr und von 14
bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr).
Selbstverständlich
können auch alle anderen Zweigstellen der Stadtbibliothek genutzt
werden. Der Medienbote bringt Bücher und anderes auf Wunsch
kostenlos bis an die Wohnungstür und holt die Medien auch wieder ab.
Alle Informationen finden sich auf
www.stadtbibliothek-duisburg.de.
Bis zur Schließung
steht das Team in Buchholz gerne persönlich oder telefonisch unter
(0203) 283-7284 für Auskünfte zur Verfügung. Die Öffnungszeiten sind
dienstags bis freitags von 10.30 bis 13 Uhr und von 14 bis 18.30 Uhr
sowie samstags von 10 bis 13 Uhr.
Sascha Prehn ist
neuer Bezirksdienstmitarbeiter für den Stadtbezirk Walsum
Der Bezirksdienst beim Städtischen Außendienst des Bürger- und
Ordnungsamtes hat seinen Dienst aufgenommen. Sascha Prehn ist als
einer der Ersten ab sofort für den Stadtbezirk zuständig, der Walsum
umfasst: „Ich freue mich, als direkter Ansprechpartner für die
großen und kleinen Probleme der Bürgerinnen und Bürger unterwegs zu
sein“, sagt Sascha Prehn.
„Mein Ziel ist es, miteinander ins
Gespräch zu kommen und Vertrauen aufzubauen.“ Walsum ist der
nördlichste Stadtbezirk von Duisburg und dort leben über 50.000
Einwohnerinnen und Einwohner auf rund 21 Quadratkilometern. „Meinen
Stadtbezirk würde ich weitestgehend als grün und idyllisch
beschreiben. Die Rheinaue Walsum ist zum Beispiel ein schönes
Naturschutzgebiet“, so Prehn. „Insgesamt schätze ich an Duisburg die
Vielfältigkeit, dazu gehören die Industriekulissen, die Häfen, die
Kulturfestivals und die idyllischen Seelandschaften.“

Foto Ilja Höpping / Stadt Duisburg
Der 44-Jährige war von
2007 bis 2020 bei den Wirtschaftsbetrieben Duisburg beschäftigt,
bevor er im Jahr 2020 zum Städtischen Außendienst wechselte. Privat
lebt der Familienvater auf einem alten Bauernhof außerhalb Duisburgs
und kümmert sich am liebsten um die Pflege seines großen Gartens und
seine vier Kinder. Außerdem ist er als Trainer für Kinder in
Selbstverteidigung aktiv.
Der städtische Bezirksdienst Die
neuen Bezirksdienstmitarbeitenden sind ab sofort täglich,
weitestgehend zu Fuß und uniformiert, in den verschiedenen
Stadtteilen unterwegs, um aktiv auf Bürgerinnen und Bürger sowie
Vereine und Gewerbetreibende zuzugehen. Zukünftig sollen in allen
Duisburger Stadtbezirken insgesamt zwei Bezirksdienstmitarbeitende
unterwegs sein.
Neben der fußläufigen Sichtbarkeit der
Bezirksdienstmitarbeitenden im jeweiligen Stadtbezirk ist auch
geplant, regelmäßig Mobile Wachen, beispielsweise auf verschiedenen
Wochenmärkten sowie Infostände auf Stadtfesten anzubieten.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben dort die Möglichkeit ihre
Fragen und Anregungen loszuwerden. Außerdem soll die bestehende
Ordnungspartnerschaft durch gemeinsame Streifgänge mit den
Bezirksbeamten der Polizei weiter ausgebaut werden.
Sascha
Prehn kann – genau wie seine Kolleginnen und Kollegen vom
Bezirksdienst – jederzeit persönlich in den Stadtbezirken
angesprochen werden. Kontakt mit dem Bezirksdienst kann auch per
E-Mail an sad@stadtduisburg.de oder telefonisch unter 0203 283-3900
über die Führungs- und Koordinierungsstelle des Bürger- und
Ordnungsamtes aufgenommen werden. Weitere Informationen online unter
www.duisburg.de/bezirksdienst.
Vorhofflimmern: Wenn
das Herz aus dem Takt gerät
Patientenveranstaltung zu Ursachen, Risiken
und modernen Therapien am Herzzentrum Duisburg
Ein schneller Puls, Herzstolpern oder Atemnot:
Was viele als harmloses Herzrasen abtun, kann Vorhofflimmern sein.
In Deutschland ist es die häufigste behandlungsbedürftige
Herzrhythmusstörung. Unbehandelt kann Vorhofflimmern langfristig zu
schwerwiegenden Komplikationen führen, etwa zu Schlaganfällen oder
einer Herzschwäche.
Wie erkannt man erste Warnzeichen? Welche
Risikofaktoren spielen eine Rolle? Welche Therapien stehen zur
Verfügung? Antworten auf diese Fragen gibt eine
Patientenveranstaltung des Herzzentrums Duisburg am Mittwoch, 17.
September 2025, von 17 bis 19 Uhr.
Referentin ist Dr. med.
Ute Ruprecht, Leitende Oberärztin der Klinik für Kardiologie,
Angiologie und Elektrophysiologie. Sie informiert verständlich und
praxisnah über moderne Behandlungsmöglichkeiten, wie z.B. die
sogenannte Pulsed Field Ablation. Dieses moderne, besonders
schonende Verfahren nutzt elektrische Felder, um krankhaftes Gewebe
im Herzvorhof gezielt zu veröden, ohne umliegende Strukturen zu
schädigen. Auch begleitende Technologien wie die 3D-Bildgebung
kommen zum Einsatz und erhöhen die Sicherheit des Eingriffs.

Dr. Ute Ruprecht, Leitende Oberärztin Elektrophysiologie am
Herzzentrum Duisburg (Quelle: EVKLN)
Ein weiterer Fokus liegt
auf dem Thema Adipositas als Risikofaktor. Starkes Übergewicht kann
nicht nur das Risiko für Vorhofflimmern erhöhen, sondern auch die
Therapie erschweren. Das Herzzentrum Duisburg setzt hier auf einen
ganzheitlichen Ansatz: Neben kardiologischer Expertise fließen auch
internistische und lebensstilbezogene Aspekte in die Behandlung ein,
etwa der Einsatz moderner Medikamente zur Gewichtsreduktion.
Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, Fragen zu
stellen und mit der Expertin ins Gespräch zu kommen.
Eckdaten der Veranstaltung:
Titel: Wenn das Herz aus dem Takt
gerät - Patientenveranstaltung zu Vorhofflimmern am Herzzentrum
Duisburg
Datum & Uhrzeit: 17. September 2025, 17.00-19.00 Uhr
Ort: Herzzentrum Duisburg, Konferenzzentrum im Verwaltungsgebäude
(unter dem Hubschrauberlandeplatz), Raum CE.01, Fahrner Str. 133,
47169 Duisburg
Eintritt: Frei, eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.
Stadtführung: „Mit Mercators Azubi
durch Duisburg – Der Stadtplan des Johannes Corputius“
„Mercators Nachbarn“ und das Stadtarchiv Duisburg laden am Samstag,
13. September, um 15 Uhr zu einem zweistündigen Stadtrundgang durch
das Duisburg des 16. Jahrhunderts ein. Der Rundgang mit Dr. Jonas
Springer und Werner Pöhling gehört zur Veranstaltungsreihe
„Stadtgeschichte draußen“.
Startpunkt ist der
Mercatorbrunnen vor dem Rathaus, Burgplatz 19. Von dort geht es zu
einigen historischen Orten, die der junge Student Johannes Corputius
auf seinem Stadtplan anno 1566 vermessen, skizziert und beschrieben
hatte. Corputius hatte bei Gerhard Mercator in Duisburg
Vermessungstechnik und das Kupferstechen gelernt. Duisburg war im
16. Jahrhundert eine Stadt mit rund 3000 Einwohnern, die sich zu
jener Zeit von der Gründung einer Universität einen wirtschaftlichen
Aufschwung erhoffte.
Man kann annehmen, dass der
detailgetreue Stadtplan zur Werbung für Duisburg dienen sollte, mit
sauberen Straßen und Plätzen und reichlich grünem Baumbestand.
Während des Rundgangs erfahren die Teilnehmer zudem Wissenswertes
darüber, woher Duisburg die Steine für den Bau der Stadtmauer und
Wohnhäuser bezog, welche Gelehrten in direkter Nachbarschaft zu
Gerhard Mercator lebten und wo man das 16. Jahrhundert noch heute in
der Stadt entdecken kann. Der Rundgang ist kostenfrei.
Duisburg-Fringe - das Festival für die freie Szene
Das Programm für das Duisburg-Fringe 2025 steht. Mitte September
wird Ruhrort zum fünften Mal Bühne und Spielort für die freie
Kultur- und Theaterszene.
In diesem Jahr werden vier Spielorte
beteiligt sein, die allesamt am Eröffnungstag, Freitag, dem 12.
September 2025 mit Kurz-Performances präsentiert werden.

Eine lebhafte Prozession „Tour de Fringe“ wird, beginnend im
Lokal Harmonie und angeführt von Fiona Fabulous, durchs Quartier
ziehen und so den Trail für die nächsten beiden Tage legen. Um 18:00
Uhr geht es los mit der Modenschau mit Kreationen von Agnieszka
Dutkiewicz und musikalischer Begleitung durch Jola Wolters im Lokal
Harmonie.
Weiter geht es zum Neumarkt, wo um 18:30 Uhr
Improtheater mit den Rheinflippern im Das Plus am Neumarkt geboten
wird. Zur Fabrikstraße geht es um 19:15 Uhr zur Lesung von Ulrike
Anna Bleier im Studio 37.
Am Leinpfad vor dem Hübi gibt es
um 19:45 Uhr Feuerartistik mit Sonny Imperfektion und dann geht es
hinauf zum Hübi, wo ab 20:00 Uhr The Singer is Always Late Folkrock
für den Rest des Abends spielt.
Am Samstag und Sonntag
wird dann ein buntes Programm mit Kabarett, Impro, Poetry, Musik und
Theateraufführungen mit lokalen, regionalen und internationalen
Künstlerinnen und Künstlern, sowie Ensembles kreuz und quer im
Quartier geboten. Den genauen Ablauf findet ihr unter
https://duisburgfringe.de/events/
Der Eintritt zu
allen Veranstaltungen ist frei. Solidarische Hutsammlungen sollen
jedem die Möglichkeit geben, den Eintritt nach eigenem Vermögen
bemessen zu können, ohne die Wertschätzung für die künstlerischen
Darbietungen aus dem Auge zu verlieren.
Elektrisches Jahrhundert: Wie sich
Post-Fahrzeuge weiterentwickelt haben
- Meilensteine der
Entwicklung: Von ersten E-Dreirädern der Post in den 1910er Jahren
bis zur größten Elektro-Flotte weltweit
- Elektrische
Zustellfahrzeuge wurden in den vergangenen 100 Jahren immer
leistungsstärker und innovativer, heute prägen sie den Regelbetrieb

Bildquelle/Source: Museumsstiftung Post und Telekommunikation
Kein anderes Logistikunternehmen setzt weltweit so viele
Elektrofahrzeuge ein wie die DHL Group. Aus mehr als 42.000
elektrisch betriebenen Fahrzeugen besteht die E-Flotte des
Unternehmens für die Abholung und Zustellung von Sendungen. Deutsche
Post und DHL blicken dabei auf 100 Jahre Fortschritt in der
Elektromobilität zurück. Bereits in den 1910er Jahren setzte die
damalige Reichspost elektrisch betriebene Dreiräder ein. Eine
Entwicklung, die sich über die Jahrzehnte fortsetzte. In den 2010er
Jahren erreichte sie mit dem StreetScooter einen Höhepunkt; dank der
Innovationskraft prägen elektrische Zustellfahrzeuge heute den
Regelbetrieb.

© MKF / Bert Bostelmann | 1920s: Model BEL 2500
1910er
Jahre: das Dreirad B.E.F.
Gerade einmal 1,5 PS brachte das
Dreirad auf die Straße, das von der „Berliner Elektromobil-Fabrik“
hergestellt wurde und als „B.E.F.“-Wagen bekannt war. Um 1910 begann
die Reichspost mit seinem Einsatz. Damals sprach man noch nicht von
Einschreiben oder Express-Sendungen. In „Briefbeuteln“ wurden
Sendungen zur damaligen Zeit noch verschickt. Die sogenannte
„Eilpaketzustellung“ gab es ebenfalls. Vor allem auf kurzen Strecken
und bei wenig Transportlast hatten Elektrofahrzeuge Vorteile. Eher
moderat waren die Höchstgeschwindigkeit von 18 km/h sowie der
Aktionsradius von etwa 50 Kilometern. Dennoch haben sich die
Dreiräder bewährt: In den 1920er Jahren waren bereits etwa 200
Exemplare auf der Straße.
1920er Jahre: Schon zwei km/h
schneller
Immerhin zwei km/h schneller war der elektrisch
betriebene Paketwagen der Marke Bergmann, Modell BEL 2500. Er
erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h und hatte mit einer
vollständigen Batterieladung eine Reichweite von bis zu 60 km. Die
Motorleistung lag bei etwa 25 PS. Das E-Fahrzeug wurde speziell für
den Einsatz in Großstädten entwickelt, wo die täglichen Fahrstrecken
in der Regel kurz sind und die Höchstgeschwindigkeit weniger
entscheidend ist. Die Bezeichnung „BEL 2500“ leitet sich von der
Nutzlast ab, die bei diesem Modell etwa 2500 kg betrug.

© Museumsstiftung Post und Telekommunikation | 1950s: EL2500 E
1950er Jahre: EL2500 E in Freiburg
Auch in den 1950er Jahren
setzte die Post ihre Elektro-Fahrzeuge hauptsächlich im Orts- und
Vorortsverkehr ein. Das Post-Auto der Maschinenfabrik Esslingen,
Modell EL2500 E, ist wieder ein Beispiel für die Weiterentwicklung
der Fahrzeuge: Die durchschnittliche Tagesfahrstrecke betrug 18 km,
während die Höchstgeschwindigkeit mittlerweile auf 28 km/h gestiegen
war. Primär war der EL2500 E in der Region um Freiburg im Breisgau
im Einsatz. Die Bemühungen um umweltfreundlichen Transport waren in
der Nachkriegszeit in Deutschland groß – auch dafür steht der EL2500
E. Elektromobilität sollte für sauberere Luft im städtischen
Lieferverkehr sorgen.
2010er Jahre: Pionierarbeit beim
StreetScooter
Einen bedeutenden Schritt in der Elektrifizierung
der Flotte von Deutsche Post und DHL in Deutschland markierte der
StreetScooter Work. Das Unternehmen war Pionier, als es mit der
StreetScooter GmbH und der Rheinisch-Westfälischen Technischen
Hochschule (RWTH) Aachen ein eigenes Elektrofahrzeug entwickelte -
maßgeschneidert für die Bedürfnisse der Brief- und Paketzustellung.
2012 gab es den ersten Prototypen – und der bestand den Test.

© DHL Group | Ford E-Transit
Mit rund 65 PS und einer
Höchstgeschwindigkeit von 85 km/h war der StreetScooter Work
schneller unterwegs als die vorherigen E-Postfahrzeuge. Ab 2014 war
er in Deutschland flächendeckend auf den Straßen. Es folgten neue
Modelle, etwa die größeren StreetScooter Work L und XL, darunter
auch sogenannte Rechtslenker für einen sicheren Ein- und Ausstieg
auf der Gehwegseite. Heute stellt die DHL Group keine eigenen
Fahrzeuge mehr her.
Heute: Ford eTransit
Seit einigen
Jahren setzt die DHL Group auf bewährte Partnerschaften, um die
Flotte weiter zu elektrifizieren und die Logistik zu
dekarbonisieren. Ein Beispiel dafür ist der Ford E-Transit – ein
moderner Elektrotransporter, der zeigt, wie leistungsfähig und
alltagstauglich Elektromobilität heute sein kann: Mit bis zu 317
Kilometern Reichweite und 184 bis 269 PS bringt er die nötige
Ausdauer und Power für Abholung und Zustellung auf der letzten Meile
mit.
Die Fahrzeuge kommen vor allem dort zum Einsatz, wo
leises, lokal emissionsfreies Fahren besonders gefragt ist. Die
meisten E-Nutzfahrzeuge bezieht DHL Group weltweit von Ford und
Mercedes. Die neueste Innovation für den Fernverkehr ist ein
Elektro-Lkw mit „Range Extender“ (EREV = Extended Range Electric
Vehicle), den DHL gemeinsam mit Scania entwickelt hat. Dieser fährt
primär elektrisch, hat aber auch einen Dieselmotor, der als
Generator dient und die Batterie bei Bedarf lädt. Antriebskraft: bis
zu 400 PS.
Wie erkenne ich
„Fakes“ im Internet? Digitaler Dienstag zum Thema Desinformation im
Stadtfenster
Ist das Fake oder echt? Diese Frage lässt
sich im Digitalen zunehmend schwerer beantworten. Am Dienstag, 9.
September um 17 Uhr, geht es beim Digitalen Dienstag von
Stadtbibliothek und Volkshochschule um die Frage, wie man
Desinformationen im digitalen Zeitalter erkennen kann. Praxisnah,
verständlich und ohne Fachchinesisch wird gezeigt, wie sich
Desinformation verbreitet und was man dagegen tun kann.
Nach
einem kurzen thematischen Einstieg bleibt viel Raum für Fragen und
Austausch. Die Reihe „Digitaler Dienstag“ richtet sich vor allem an
Erwachsene mit wenig digitalen Vorkenntnissen. Alle, die neugierig
sind und Neues ausprobieren möchten, sind herzlich willkommen.
Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Anmeldung erfolgt online und
ist auf www.stadtbibliothek-duisburg.de unter dem Stichpunkt
„Veranstaltungen“ möglich. Fragen beantwortet das Team der
Bibliothek gerne persönlich oder telefonisch unter 0203 2834218. Die
Servicezeiten sind montags von 13 bis 19 Uhr, dienstags bis freitags
von 11 bis 19 Uhr und samstags von 11 bis 16 Uhr.
Literaturabend mit Geschichten über den Niederrhein
Die
Evangelische Kirchengemeinde Duisburg-Meiderich lädt zum nächsten
kulturellen Leckerbissen in das Begegnungscafé „Die Ecke“, Horststr.
44a: Dort erzählt am 16. September 2025 um 19 Uhr Yvonne de
Temple-Hannappel, die Leiterin des Begegnungscafés, von der
Geschichte des Niederrheins, geschmückt mit Texten verschiedener
Autoren.
Zudem nimmt sie das Publikum mit auf einen
spannenden Exkurs zu den Pfälzer Auswanderer, die Pfalzdorf
gründeten. Die Nähe zum Niederrhein ergibt sich bei Yvonne de
Temple-Hannappel aus ihrer Biografie: Sie ist geboren und groß
geworden am unteren Niederrhein, zwischen Goch und Kleve, bei
Pfalzdorf.
Interessierte sind herzlich zum Literaturabend
eingeladen, der Eintritt ist frei. Mehr Infos hat Yvonne de
Temple-Hannappel, die Leiterin des Begegnungscafés (Tel. 0203 45 57
92 70, E-mail: detemple-hannappel@gmx.de). Infos zur Gemeinde gibt
es im Netz unter www.kirche-meiderich.de.
Prof. Dr. Lorenz Narku Laing hielt
Kanzelrede in Salvator
Wer hat dem schwarzen Mann erlaubt, Doktor
zu werden in Deutschland?
Mit Prof. Dr. Lorenz Narku
Laing bestieg am vergangenen Sonntag ein profunder Kenner seines
Themas die Kanzel der Duisburger Salvatorkirche, um unter der
Überschrift :„Un.Wissen.Schafft.Rassismus“ zu sprechen.
Dr.
Laing ist Professor für Sozialwissenschaften und Rassismusforschung
an der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum
und Geschäftsführer der Vielfaltsprojekte GmbH. Der mehrfach
ausgezeichnete Experte wurde kürzlich von der Synode der
Evangelischen Kirche im Rheinland zum nebenamtlichen
Kirchenleitungsmitglied gewählt.
Aber als Deutscher mit
schwarzer Hautfarbe hat Dr. Laing auch reichlich Gelegenheit, am
eigenen Leibe ganz praktische Erfahrungen mit Rassismus zu machen.
Ein Taxi, dass auf Dr. Laing geordert wurde, hält nicht neben ihm,
auch wenn er stürmisch winkt. Der Fahrer teilt ihm abweisend mit, er
sei besetzt, weil er auf einen Dr. Laing warte.
„Wer hat dem
schwarzen Mann erlaubt, Doktor zu werden in Deutschland?“, fasst
Laing nachdenklich zusammen. Schlimmer noch, sogar Professor. Weil
das auch auf seiner Fahrkarte stand, flog der 33-Jährige einmal fast
aus einem Zug der deutschen Bahn. Wie bitte? Dieser schwarze Mann
mit dem jungenhaften Gesicht soll Professor sein?
Nie und
nimmer, der muss die Fahrkarte gefälscht haben! So dachte wohl der
Fahrkartenkontrolleur. Laing denkt in solchen Momenten an die vielen
von Rassismus betroffenen Menschen, die solche Angriffe nicht mit
einem Vorzeigen ihres Titels auf dem Personalausweis lösen können.
„Ich bin privilegiert“, führt er aus. Und erinnert an die
Menschen, die nicht zu Wohnungsbesichtigungen eingeladen werden,
schlechtere Noten bekommen, weniger Arzttermine, keine
Vorstellungsgespräche haben, weil ihr Name afrikanisch klingt, oder
arabisch oder schlicht ausländisch anmutet. „Rassismus ist beweisbar
und sehr gut in Studien belegt“, betont Laing, „Es ist kein Gefühl,
sondern wissenschaftlich zähl- und messbar.“ Man könne durchaus
sagen, um so dunkler die Haut, umso schlechter die Rechte. Es stimme
schlicht nicht, dass die Gesetze in Deutschland für alle gleich
gelten würden.
„Auch in unserer Kirche begegnet man Menschen
mit anderen Hautfarben zwar mit Liebe, aber auch so, als wären sie
Fremde“, stellt er fest. Und erlaubt sich den Wunschtraum von einer
diversen, lebendigen Kirche, in der die Menschen aller Farben
gemeinsam Gottesdienste feiern. „Da wären die Gottesdienste wieder
gut besucht und es würde lustig zugehen“, schwärmt er.
Laing
spricht auch über die beispiellose Erfolgsgeschichte des
Antirassismus. „Es ist besser geworden, keine Frage“, räumt er ein.
Und er erklärt, warum das Thema gerade durch die erreichten
Verbesserungen mehr in den Fokus gehört. Die Betroffenen finden
Solidarität und den Mut, ihre Erfahrungen zu teilen. „Gerade weil
Rassismus weniger wird, müssen wir uns mehr mit ihm beschäftigen“,
fordert er. Und erinnert an die globalen Auswirkungen, an die man
als Konsument ungerne erinnert wird.
„Wir profitieren alle
von Rassismus, wenn wir die billigen Bananen, T-Shirts und Laptops
kaufen, die irgendwo auf der Welt unter menschenunwürdigen
Bedingungen geentet, geschneidert und zusammengeschraubt werden“,
sagt er und macht seinem Publikum Mut, solche Strukturen zu erkennen
und sie nicht weiter zu unterstützen. Antirassismus bedeute auch
Verzicht zu üben, auf altgewohnte Vorteile und Privilegien. „Wir
hätten beispielsweise viele halbleere Museen hier, wenn wir wirklich
ernst machen würden, mit der Rückgabe von geraubter Kunst aus den
ehemaligen Kolonien“, macht er geltend.
„Rassismus ist
Gotteslästerung“, zitiert Laing den ehemaligen EKD-Ratsvorsitzenden
Heinrich Bedford-Strohm. Und er gibt seinem Publikum ein paar Fragen
mit auf den Heimweg. Wer darf hier im Ruhrgebiet leben? Wem gehören,
die Häuser? Wer verdient genug, um von seiner Arbeit zu leben? Wer
darf überhaupt arbeiten? Die Salvatorgemeinde antwortet auf sein
lebhaftes, kenntnisreiches und spannendes Plädoyer für den
persönlichen Antirassismus mit minutenlangem Applaus.
„Lieber Narku, du hast uns gefesselt“, stellt Dr. Christoph Urban,
Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Duisburg, als
Gastgeber nach der Kanzelrede beeindruckt fest. Sabine Merkelt-Rahm

Prof. Dr. Lorenz Narku Laing im Rahmen der Kanzelrede mit Dr.
Christoph Urban, dem Superintendenten des Evangelischen
Kirchenkreises Duisburg - Foto: Bartosz Galus
INFO: Das
Format „Kanzelreden“ hat der Evangelische Kirchenkreis Duisburg
anlässlich des 400-jährigen Jubiläums der 1. Reformierten
Generalsynode entwickelt, die vom 7. bis 11. September 1610 in der
Salvatorkirche tagte. Diese Synode hat nicht nur bleibend die
Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland geprägt,
sondern hat auch erstmals in der Geschichte der Kirchen
Nicht-Theologen auf Augenhöhe und gleichberechtigt in
Entscheidungsprozesse einbezogen.
Dieser Impuls wurde in den
Kanzelreden aufgenommen, wo gezielt Nicht-Theologen gebeten werden,
zu relevanten gesellschaftlichen Entwicklungen das Wort zu
ergreifen. Dies haben seit 2010 u. a. Charlotte Knobloch, Fritz
Pleitgen, Manni Breuckmann, Prof. Dr. Udo Di Fabio, Kai Magnus
Sting, Prof. Dr. Norbert Lammert, Dr. Gregor Gysi, Katrin
Göring-Eckardt sowie Dr. Mark Benecke und Gerald Knaus getan.

NRW: Knapp 118.000 Menschen wegen Wohnungslosigkeit
untergebracht
* Ende Januar 2025 wurden 12.765
untergebrachte Wohnungslose mehr gezählt als im Vorjahr.
*
Mehrheitlich Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit betroffen.
* Mehr als ein Viertel der untergebrachten Wohnungslosen waren
Kinder und Jugendliche. S
Zum Stichtag 31. Januar 2025 wurden
in NRW 117.885 wegen Wohnungslosigkeit untergebrachte Menschen
erfasst. Wie das Statistische Landesamt anlässlich des Tages der
wohnungslosen Menschen am 11. September 2025 mitteilt, waren dies
12.765 Menschen mehr als im Vorjahr.
88,2 % hatten eine
ausländische Staatsangehörigkeit
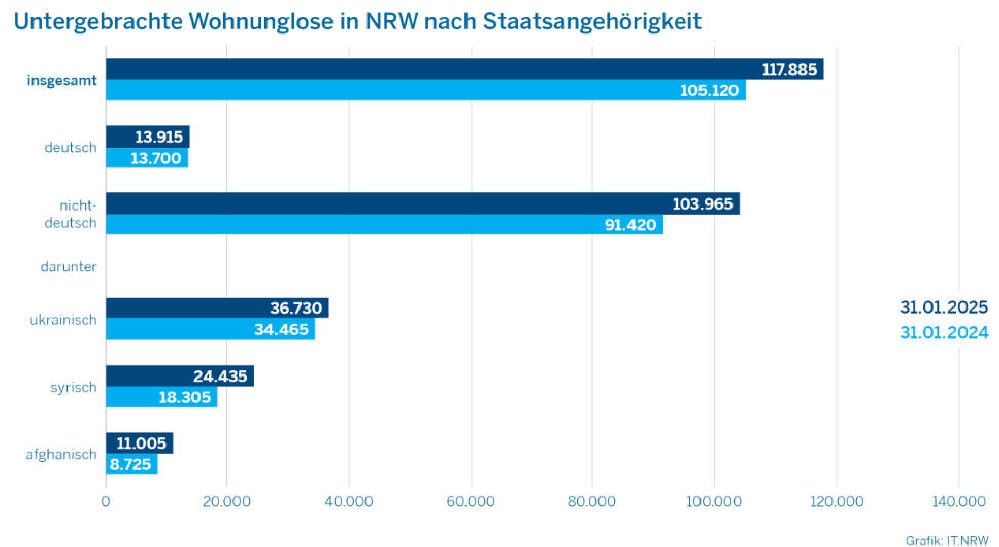
Die Zahl der untergebrachten Wohnungslosen mit deutscher
Staatsangehörigkeit lag zum Stichtag mit 13.915 um 1,6 % höher als
im Vorjahr. Die Zahl der Wohnungslosen mit ausländischer
Staatsangehörigkeit war mit einem Zuwachs von 13,7 % stärker
gestiegen. Dieser Anstieg ist zumindest teilweise auf Verbesserungen
der Datenmeldungen insbesondere bei den nichtdeutschen Wohnungslosen
zurückzuführen.
Ende Januar 2025 wurden 103.965
untergebrachte Wohnungslose mit ausländischer Staatsangehörigkeit
gezählt. Damit lag der Anteil der Nichtdeutschen an den
untergebrachten Wohnungslosen bei 88,2 %. Ukrainerinnen und Ukrainer
stellten die größte Gruppe Knapp ein Drittel aller Ende Januar 2025
untergebrachten Wohnungslosen hatte die ukrainische
Staatsangehörigkeit (36.730 Personen).
Es folgten Personen
mit syrischer und afghanischer Staatsangehörigkeit (24.435 bzw.
11.005 Personen). Mehr als ein Viertel der untergebrachten
Wohnungslosen waren Kinder und Jugendliche Ende Januar waren 31.740
Minderjährige wegen Wohnungslosigkeit untergebracht; das waren mit
26,9 % gut ein Viertel der erfassten Wohnungslosen insgesamt.
Mit 97,1 % waren die meisten von ihnen mit ihren Familien bzw.
in Mehrpersonenhaushalten untergebracht. Lediglich 0,4 % waren
alleinstehend. Bei 2,5 % der minderjährigen Wohnungslosen lagen
keine Informationen zum Haushaltstyp vor.
Rund die Hälfte
der Minderjährigen waren bereits zwei Jahre oder länger von
Wohnungslosigkeit betroffen
44,8 % der untergebrachten
Wohnungslosen lebten Anfang 2025 bereits seit mindestens zwei Jahren
ohne eigenen Wohnraum in der jeweiligen Unterbringung. Im Vorjahr
lag dieser Anteil mit 29,1 % noch deutlich niedriger. Bei den
Kindern und Jugendlichen war Ende Januar 2025 der Anteil derer, die
schon zwei Jahre oder länger aufgrund von Wohnungslosigkeit
untergebracht waren, mit 50,6 % höher als im Schnitt aller
untergebrachten Wohnungslosen. Ein Jahr zuvor traf dies auf 32,5 %
der minderjährigen Wohnungslosen zu.
Stromerzeugung
im 1. Halbjahr 2025: 5,9 % weniger Strom aus erneuerbaren Energien
•
Im Inland produzierte Strommenge wegen
Anstieg um rund 10 % bei fossilen Energieträgern insgesamt nahezu
unverändert zum Vorjahreszeitraum
•
Stromerzeugung aus Windkraft geht wegen
schwacher Windverhältnisse um rund 18 % zurück, Stromproduktion aus
Photovoltaik steigt dagegen um rund 28 %
•
Stromimporte steigen um 0,8 %,
Stromexporte um 6,5 % – insgesamt verfügbare und nachgefragte
Strommenge damit fast unverändert.
Im 1. Halbjahr 2025 wurden
in Deutschland 221 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt und in
das Netz eingespeist. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach
vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 0,3 % mehr als im 1.
Halbjahr 2024. Die Stromeinspeisung aus erneuerbaren Energiequellen
sank dabei um 5,9 % auf 127,7 Milliarden Kilowattstunden.
Damit stammten 57,8 % des inländisch produzierten Stroms aus
erneuerbaren Quellen (1. Halbjahr 2024: 61,6 %). Demgegenüber stieg
die Stromerzeugung aus konventionellen Energieträgern gegenüber dem
Vorjahreszeitraum um 10,1 % auf 93,2 Milliarden Kilowattstunden und
einen Anteil von 42,2 % der inländischen Stromproduktion (1.
Halbjahr 2024: 38,4 %).
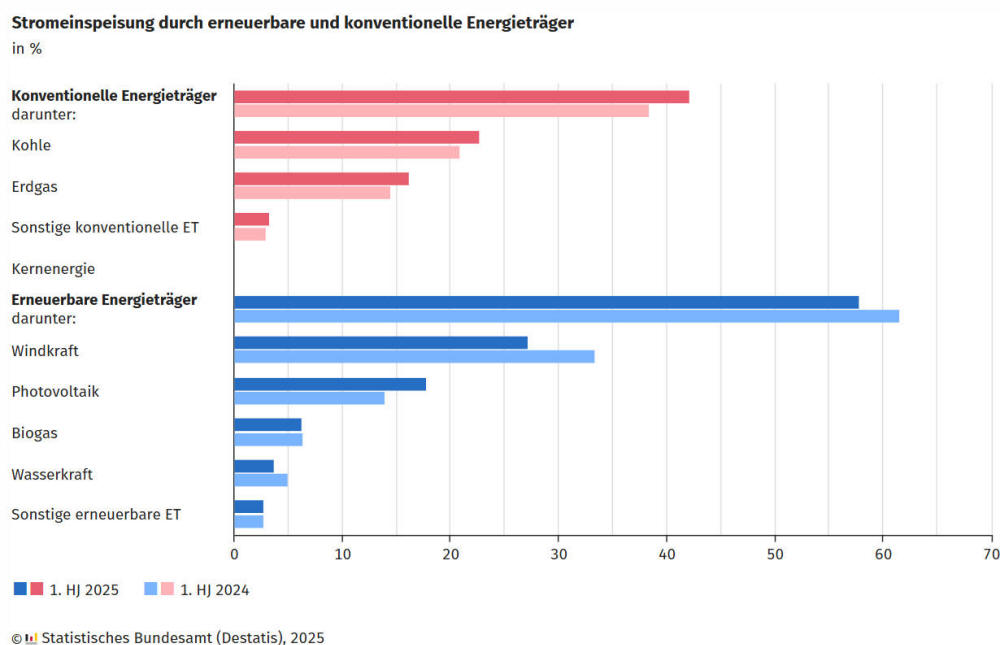
Photovoltaik drittwichtigster Energieträger vor Erdgas
Die
Stromerzeugung aus Windkraft sank im 1. Halbjahr 2025 gegenüber dem
1. Halbjahr 2024 um 18,1 % auf 60,2 Milliarden Kilowattstunden.
Dieser Rückgang war das Ergebnis ungewöhnlich schwacher
Windverhältnisse. Dennoch blieb die Windkraft mit einem Anteil von
27,2 % der wichtigste Energieträger in der inländischen
Stromproduktion.
Dagegen nahm die Stromproduktion aus
Photovoltaik stark zu: Mit einem Anstieg von 27,9 % im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum stieg die Einspeisung auf
39,3 Milliarden Kilowattstunden. Strom aus Photovoltaik machte damit
17,8 % der gesamten produzierten Strommenge aus und nahm den dritten
Platz in der inländischen Stromerzeugung ein.
Der Anstieg
der Einspeisung aus Photovoltaik erklärt sich vor allem durch den
Zubau neuer Anlagen sowie durch ungewöhnlich viele Sonnenstunden.
Kohle und Erdgas legen zu, Kohle weiterhin zweitwichtigster
Energieträger Die in Kohlekraftwerken erzeugte Strommenge stieg im
1. Halbjahr 2025 gegenüber dem 1. Halbjahr 2024 um 9,3 % auf
50,3 Milliarden Kilowattstunden.
Damit blieb Kohle mit einem
Anteil von 22,7 % des insgesamt produzierten Stroms der
zweitwichtigste Energieträger in der inländischen Stromerzeugung.
Auch die Stromerzeugung aus Erdgas legte zu, und zwar um 11,6 %
gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 35,8 Milliarden Kilowattstunden.
Der Zuwachs bei der Photovoltaik war allerdings so stark,
dass Erdgas mit einem Anteil von 16,2 % an der gesamten
Stromproduktion auf den vierten Platz der wichtigsten Energieträger
zurückfiel.
Importüberschuss sinkt auf
8,3 Milliarden Kilowattstunden
Die nach Deutschland importierte
Strommenge stieg im 1. Halbjahr 2025 im Vergleich zum 1. Halbjahr
2024 leicht um 0,8 % auf 37,8 Milliarden Kilowattstunden. Dagegen
stieg die exportierte Strommenge um 6,5 % auf
29,5 Milliarden Kilowattstunden. Damit wurden rund 28 % mehr Strom
aus dem Ausland importiert als dorthin exportiert.
Nachdem
im 1. Halbjahr 2024 ein Importüberschuss von
9,8 Milliarden Kilowattstunden verzeichnet worden war, schmälerte
sich dieser im 1. Halbjahr 2025 auf 8,3 Milliarden Kilowattstunden.
Dies führte zusammen mit der leichten Zunahme der inländischen
Produktion dazu, dass die in Deutschland verfügbare und nachgefragte
Strommenge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht um 0,4 % auf
229,2 Milliarden Kilowattstunden zurückging.