






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 45. Kalenderwoche:
5. November
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Donnerstag, 6. November 2025
Kommission begrüßt Einigung der
EU-Staaten auf neue Klimaziele
Die Europäische
Kommission begrüßt die Einigung der EU-Staaten über den nationalen
Klimabeitrag (nationally determined contribution, NDC) der EU im
Rahmen des Pariser Klimaabkommens. Er sieht vor, die
Netto-Treibhausgasemissionen bis 2035 um 66,25 bis 72,5 Prozent
verglichen mit dem Stand von 1990 zu senken.
Vor der COP30,
der Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Belém (Brasilien),
sendet die EU so ein starkes und geeintes Signal an die
Weltgemeinschaft. Sie ist weiter fest entschlossen, die Ziele des
Übereinkommens von Paris zu erreichen und mit globalen Partnern
zusammenzuarbeiten, um die Treibhausgasemissionen zu senken.
Der neue NDC der EU ist ein ehrgeiziger Meilenstein auf dem Weg
zu einer Nettoreduktion der Treibhausgasemission um 90 Prozent bis
2040 (verglichen mit dem Stand von 1990) und auf dem Weg zur
Klimaneutralität der EU bis 2050.
Klimaziel 2040
Die
Kommission begrüßt zudem die Fortschritte, die die
EU-Mitgliedstaaten bei der Einigung auf eine allgemeine Ausrichtung
zum EU-Klimaziel für 2040 erzielt haben. Sie haben sich auf ein
rechtsverbindliches Kernziel für 2040 von 90 Prozent geeinigt. Dies
umfasst ein nationales Ziel von 85 Prozent und bis zu 5 Prozent der
internationaler CO2-Gutschriften.
Die Kommission ist bereit,
zu einer raschen Einigung beizutragen, betont jedoch gleichzeitig,
wie wichtig es ist, den Kern des Vorschlags beizubehalten. Die
Kommission hat einen pragmatischen und flexiblen Fahrplan bis 2040
vorgelegt, der den heutigen wirtschaftlichen, sicherheitspolitischen
und geopolitischen Gegebenheiten Rechnung trägt.
Gleichzeitig bietet er Investoren und Unternehmen die nötige
Planungssicherheit, um den Übergang zu einer sauberen Wirtschaft und
die industrielle Wettbewerbsfähigkeit der EU voranzutreiben.
Landeskabinett billigt
NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036
Das Kabinett hat
das NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 gebilligt. Mit dem
Gesetzentwurf wird der rechtliche und finanzielle Rahmen gesetzt, um
die auf Basis des Sondervermögens des Bundes und zusätzlicher
Landesmittel möglichen Investitionen auf Ebene des Landes und der
Kommunen auf den Weg zu bringen.
Im nächsten Schritt erfolgt
die Einbringung des Entwurfs in den Landtag. Die Schwerpunkte des
Programms sind Kitas und Schulen und die Verkehrsinfrastruktur. Auch
in Gesundheitsversorgung, energetische Sanierung und Klimaschutz,
Sport und Digitalisierung sowie Wirtschaft, Forschung und
Wissenschaft wird investiert.
In den nächsten zwölf Jahren
sieht der Plan Investitionen in einer Höhe von insgesamt 31,2
Milliarden Euro vor. Davon entfallen 21,3 Milliarden Euro auf die
Kommunen in Nordrhein-Westfalen, was einem kommunalen Anteil von
rund 68 Prozent entspricht. Knapp zehn Milliarden Euro investiert
das Land in seine Infrastruktur.
"Der Bund hat ein Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität geschaffen. Hiervon müssen gerade Regionen wie das Ruhrgebiet partizipieren, die dringend Impulse für Wachstum und Beschäftigung brauchen, um zukunftsfähig zu sein. Jetzt müssen die Mittel auch dorthin fließen, wo sie akut gebraucht werden", fordert Garrelt Duin, Direktor des Regionalverbandes Ruhr (RVR). idr
„Duisburg ist echt…gefragt!“ – Start der Bürgerumfrage
2025
Die jährliche Bevölkerungsbefragung geht in die
nächste Runde. Ab heute, 5. November, werden wieder 25.000 zufällig
ausgewählte Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren angeschrieben und um
ihre persönliche Meinung gebeten. Inhaltlich wird bei der Umfrage
unter anderem die Zufriedenheit mit dem Leben in der Stadt, der
Politik und Verwaltung sowie der eigenen Wohnsituation abgefragt.
Ein Abschnitt befasst sich diesmal auch mit der Bildung
für nachhaltige Entwicklung, die Menschen dazu befähigt,
verantwortungsbewusst und zukunftsorientiert zu handeln – sowohl im
Umgang mit der Umwelt als auch im sozialen und wirtschaftlichen
Kontext. Die Teilnahme an der Bürgerumfrage kann digital auf einem
beliebigen Endgerät oder mittels eines auf Anforderung zugesandten
Papierfragenbogens erfolgen.
Die Portokosten übernimmt die
Stadt Duisburg. Die Erkenntnisse der Befragung werden
voraussichtlich zu Beginn des zweiten Quartals 2026 veröffentlicht.
Ergebnisse der letzten Befragung sind auf der Internetseite der
Stabsstelle für Statistik abrufbar:
https://duisburg.de/bevoelkerungsbefragung Die Befragung wird
jährlich mit einer neu gezogenen Stichprobe wiederholt, um zukünftig
neben der aktuellen Situation auch Entwicklungen und Trends
darstellen zu können.
Pestel-Institut legt
Wohnungsmarkt-Untersuchung für Duisburg vor - In Duisburg fehlen
7.800 Wohnungen – Neubau mit angezogener Handbremse

Wohnungsbau ankurbeln: „Günstiges Baugeld und Abräumen aller
Vorschriften der letzten 10 Jahre“ - Foto: Tobias Seifert
Wenn Bauen so kinderleicht wäre: Das Bauen von neuen Wohnungen ist
in Duisburg vor allem teuer und kompliziert. Dabei sind neue
Wohnungen gerade auch für die Wirtschaft in Duisburg wichtig: „Denn
wer arbeiten will, muss sich das Wohnen auch leisten können.
Wohnungsknappheit macht am Ende auch den Arbeitsmarkt kaputt“, so
der Chef-Ökonom des Pestel-Instituts, Matthias Günther.
Mangelware Wohnung: Duisburg hat ein Wohnungsdefizit. Aktuell fehlen
rund 7.800 Wohnungen. Gleichzeitig stehen in Duisburg 5.440
Wohnungen bereits seit einem Jahr oder länger leer. Wer eine Wohnung
sucht, sollte sich darauf aber keine Hoffnungen machen: Wohnungen,
die lange Zeit leer stehen, gehen kaum wieder in die Vermietung.
Die Zahlen für Duisburg gehen aus der aktuellen regionalen
Wohnungsmarkt-Untersuchung hervor, die das Pestel-Institut gemacht
hat. Die Wissenschaftler haben dabei den Wohnungsbestand, die
Bevölkerungsentwicklung sowie Prognosen für den Arbeitsmarkt und die
Beschäftigung in Duisburg analysiert.
„Vom
Arbeitskräftebedarf über die Geburten bis zu den Sterbefällen: Es
wird sich in Duisburg eine Menge tun – und auf dem Wohnungsmarkt tun
müssen. Das bedeutet konkret: In den nächsten fünf Jahren müssen
rund 1.510 neue Wohnungen in Duisburg gebaut werden – und zwar pro
Jahr“, sagt Matthias Günther.
Der Chef-Ökonom des
Pestel-Instituts hält dieses Wohnungsbaupensum für Duisburg
allerdings für „nur schwer machbar“. So habe es im ersten Halbjahr
dieses Jahres nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis)
lediglich 526 Baugenehmigungen für neue Wohnungen in Duisburg
gegeben. „Das reicht natürlich nicht. Der Neubau von Wohnungen in
Duisburg läuft mit angezogener Handbremse. Da muss vor allem
bundespolitisch mehr passieren, um den Neubau von Wohnungen wieder
anzukurbeln. Und das möglichst schnell“, so Matthias Günther.
Dabei gibt es für den Leiter des Pestel-Instituts vor allem ein
effektives Instrument, das den Wohnungsbau auch in Duisburg flott in
Fahrt bringen würde: „Dringend notwendig ist günstiges Baugeld. Der
Bund muss ein Zins-Programm auflegen: Maximal 2 Prozent Zinsen –
teurer darf die Finanzierung beim Wohnungsbau nicht sein.
Dann wären deutlich mehr private Bauherren, aber auch Investoren
endlich wieder in der Lage, neue Wohnungen in Duisburg zu bauen. Vor
allem würde das schnell einen Effekt bringen: Mit einem
Niedrigzins-Baugeld würde der Bund einen wirklichen Turbo für den
Neubau von Wohnungen starten“, ist der Chef-Ökonom des
Pestel-Instituts überzeugt.
Die Wissenschaftler haben die
regionale Wohnungsmarkt-Analyse im Auftrag des Bundesverbandes
Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB) durchgeführt. Dessen Präsidentin
fehlen klare Signale – Anreize, die kurzfristig wirken: „In Sachen
Wohnungsbau passiert bei der neuen Bundesregierung zu wenig. Nur das
Schlagwort ‚Wohnungsbau-Turbo‘ geistert seit Monaten durch die
Republik.
Doch von einem ‚Turbo‘ kann keine Rede sein. Die
Maßnahmen wirken nur mittel- bis langfristig. Jedenfalls ist von dem
versprochenen ‚Turbo-Effekt‘ in Duisburg und auch sonst nirgendwo
etwas zu merken“, sagt Katharina Metzger. Selbst da, wo es ein Plus
bei den Baugenehmigungen gebe, passiere dies auf „denkbar niedrigem
Niveau“.

Foto: Tobias Seifert
Dabei sei der Wohnungsbau ein wichtiger
Motor der Binnenkonjunktur: „Läuft der Wohnungsbau, dann läuft auch
die Wirtschaft. Deshalb ist es höchste Zeit, dass Bundeskanzler Merz
den Wohnungsbau jetzt zur Chefsache macht“, fordert die Präsidentin
des Baustoff-Fachhandels. Passiere nichts, dann sacke der Neubau
weiter ab. Schon jetzt verliere der Bau Tag für Tag Kapazitäten:
„Bauunternehmen gehen in die Insolvenz. Bauarbeiter verlieren ihre
Jobs“, so Metzger.
Außerdem sei das Bauen zu kompliziert und
zu teuer geworden, kritisiert der Baustoff-Fachhandel. Ein Punkt,
den auch das Pestel-Institut unterstreicht: „Deutschland muss
dringend wieder einfacher bauen. Wenn der Bund alle Auflagen und
Vorschriften der letzten zehn Jahre komplett zurücknehmen würde,
dann könnten in Duisburg ziemlich schnell wieder deutlich mehr und
deutlich günstigere Wohnungen gebaut werden. Und zwar Wohnungen mit
einem guten Standard. Manchmal ist weniger eben mehr“, sagt Matthias
Günther.
Der Chef des Pestel-Instituts wirft dem Bund vor,
dem Wohnungsbau „zehn Jahre lang durch immer schärfere Gesetze und
Verordnungen viel unnötigen Ballast zugemutet zu haben“. Das habe
die Kosten im Wohnungsbau und damit auch die Mieten regelrecht nach
oben getrieben, so der Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel.
„Vor allem völlig überzogene Energiespar-Auflagen beim Neubau haben
unterm Strich für die Umwelt wenig gebracht, das Wohnen aber enorm
viel teurer gemacht“, sagt BDB-Präsidentin Katharina Metzger.
Dokumentation „20 Jahre Spieltrieb – Jugendclub im
Theater Duisburg“
Anlässlich des 20-jährigen Bestehens
von „Spieltrieb“ war es den Förderern der Duisburger Theater-Kultur
e. V. ein besonderes Anliegen diese besondere Theaterarbeit mit
jungen Menschen in einer neuen 112 Seiten starken Publikation zu
dokumentieren und zu würdigen.
In Zusammenarbeit mit dem
Autor Hermann Kewitz ist ein einzigartiger Einblick in die
Geschichte und das Wirken von Spieltrieb entstanden, der nun am
Donnerstag, 6. November, um 11 Uhr Theater Duisburg vorgestellt
wird.
Gleichzeitig besteht Gelegenheit, die Entwicklung von
Spieltrieb, die kreative Arbeit mit jungen Talenten sowie unsere
Jubiläumsproduktion „Der gute Mensch von Sezuan“ von Bertolt Brecht
zu beleuchten.
„Stadtgeschichte donnerstags“: Neue Vortragsreihe startet
mit der geheimen Sprache der Sticker
Der nächste Turnus
der Vortragsreihe „Stadtgeschichte donnerstags“ beginnt. Zwischen
November und März 2026 präsentiert das Stadtarchiv Duisburg in
Kooperation mit der Mercator-Gesellschaft spannende Vorträge zur
Duisburger Stadtgeschichte. In angenehmer Atmosphäre stellen
Forschende ihre Ergebnisse aus verschiedenen Themengebieten und
Epochen vor: von der Beecker Kirmes über Obdachlosigkeit im frühen
20. Jahrhundert bis hin zu Duisburger Jüdinnen und Juden im
Nationalsozialismus.
Am 6. November um 18.15 Uhr startet der
Historiker Ferdinand Leuxner mit einem unkonventionellen Blick auf
die Stadtgeschichte Duisburgs, die seit Jahrzehnten an
Straßenlaternen, Stromkästen und auf Abfalleimern geschrieben wird.
Sticker entwickelten sich von einem Sprachrohr politischer Gruppen
zum vielfältigen Kommunikationsmedium.
Heutzutage bringen
MSV-Fans mit Aufklebern ihre Vereinsliebe zum Ausdruck, örtliche
Einzelhändler benutzen sie als Werbefläche im Stadtraum und namhafte
Kunstschaffende machen mit den kleinen Klebern auf ihre Arbeiten
aufmerksam. Der Vortrag entschlüsselt die geheime Sprache der
Aufkleber im Duisburger Stadtraum.
Er findet wie alle
Vorträge der Reihe in der „DenkStätte“ im Gebäude des Stadtarchivs,
Karmelplatz 5, 47051 Duisburg, statt. Die Teilnahme ist kostenfrei;
eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist auf
maximal 60 Personen beschränkt.
Nitrate: Regionale
Kooperation sichert gute Trinkwasserqualität der Stadtwerke Duisburg
Der Schutz des Grundwassers ist eine zentrale Voraussetzung für die
sichere und hochwertige Trinkwasserversorgung. Die Stadtwerke
Duisburg arbeiten seit vielen Jahren daran, die Nitratbelastung zu
senken und haben dabei große Erfolge erzielt. Durch verschiedene
Maßnahmen liegt die Nitratbelastung im Duisburger Trinkwasser weit
unterhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte.
Aktualität erfährt das Thema durch ein Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts, da der von der EU vorgeschriebene
Grenzwert an vielen Orten in Deutschland nicht eingehalten wird. Das
Bundesverwaltungsgerichts hat im Oktober entschieden, dass die
Bundesregierung ein nationales Aktionsprogramm zur Reduzierung der
Nitratbelastung im Grundwasser erarbeiten muss.
„Wir
unterstützen alle wirksamen Maßnahmen, die helfen, die
Nitratbelastung nachhaltig zu senken“, erklärt Felicitas Dudziak,
Leiterin Wassergewinnung. „Für uns ist die Einhaltung des
gesetzlichen Grenzwerts von 50 Milligramm pro Liter
selbstverständlich – und wir liegen seit Jahren deutlich darunter.“
Während die Trinkwasserverordnung einen Grenzwert von 50 mg Nitrat
pro Liter vorgibt, weisen die Gewinnungsgebiete von Duisburg weitaus
niedrigere Werte auf, die sich im Bereich zwischen 15,35 mg/l und
25,70 mg/l bewegen.
Diese Werte liegen im unbedenklichen Bereich und zeigen, dass das
Trinkwasser in der Region von hoher Qualität ist. „Selbst für
empfindliche Personengruppen wie Säuglinge oder Schwangere besteht
bei unseren Nitratwerten keinerlei Risiko“, betont Felicitas
Dudziak.
Enge Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft
Ein
wesentlicher Grund für die dauerhaft niedrigen Werte ist die gute
Kooperation mit den Landwirtinnen und Landwirten in der Region. Seit
vielen Jahren erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit der
Landwirtschaftskammer und den Betrieben, gezielt und bedarfsgerecht
zu düngen, um Belastungen des Grundwassers zu vermeiden.
„Unsere Partnerschaft basiert auf Vertrauen und Fachwissen.
Gemeinsam analysieren wir die Böden, prüfen die Düngemengen und
entwickeln Maßnahmen, um Einträge zu minimieren. Das ist ein
zentraler Baustein unseres Grundwasserschutzes“, sagt Patrycja
Friedrichs, Leiterin Qualitätssicherung Trinkwasser.
Seit
bereits über 30 Jahren arbeiten die Stadtwerke Duisburg mit
Landwirten und Gartenbaubetrieben im Sinne des Gewässerschutzes
partnerschaftlich zusammen. Das Ziel ist die Sicherung der
Trinkwasserversorgung bei gleichzeitiger Sicherung der
Existenzfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe. Diese
Kooperation mit derzeit über 130 Betrieben ist damit eine der
ältesten in ganz NRW.
Das Wasserschutzgebiet im
Einzugsbereich der Wasserwerke Wittlaer und Bockum hat eine Größe
von 64 Quadratkilometern. Es ist damit eines der größten
Wasserschutzgebiete in Nordrhein-Westfalen. Über 20 Quadratkilometer
im Wasserschutzgebiet werden landwirtschaftlich genutzt.
Durch die Arbeit innerhalb der Kooperation sinken die Nitratwerte im
Grundwasser nachhaltig. „Wir konnten den Nitratgehalt in den
vergangenen 24 Jahren von durchschnittlich 31 Milligramm pro Liter
im Jahr 1999 auf durchschnittlich 18,78 Milligramm pro Liter
Trinkwasser in 2023 absenken“, erläutert Patrycja Friedrichs. Damit
enthält das Trinkwasser der Stadtwerke Duisburg seit mehr als zwei
Jahrzehnten Nitrate nur in absolut unbedenklichen Maßen.
Bei
einem Besuch im Jahr 2017 lobt die damalige Bundes-Umweltministerin
Barbara Hendricks (SPD) die Bemühungen: „Solche Kooperationen wie
hier in Duisburg sind der richtige Weg für beide Seiten, um
nachhaltig erfolgreich zu sein. Partnerschaftliche Projekte wie
dieses können Vorbild sein, um im gesamten Bundesgebiet den
Herausforderungen durch Nitratbelastung des Grundwassers zu
begegnen.“
Auch wirtschaftlich ergeben die Vorsorgemaßnahmen
Sinn. So ist die Vermeidung einer Nitratbelastung um den Faktor 10
günstiger als nachträgliche Maßnahmen wie beispielsweise die
Nitratfilterung aus dem Grundwasser. Zur Vorsorge wird
beispielsweise ein Wasserschutzberater bei der Landwirtschaftskammer
durch die Stadtwerke Duisburg finanziert, der die Landwirte zu allen
Fragen des Wasserschutzes berät. Dabei geht es vor allem um den
Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln. Hier spielen die
optimale Dosierung und der richtige Zeitpunkt eine wesentliche
Rolle.
Kontinuierliche Kontrolle und Forschung
Das
Trinkwasser wird zudem engmaschig beprobt und überprüft. Jede
Veränderung der Nitratwerte wird genau analysiert. Sollten sich in
Einzugsgebieten Tendenzen abzeichnen, wird in Abstimmung mit den
Landwirten schnell gegengesteuert. Auch extreme Wetterereignisse wie
längere Trockenphasen oder Starkregen werden in die Auswertung
einbezogen, da sie die Nährstoffdynamik in den Böden beeinflussen
können.
„Leichte Schwankungen sind normal. Doch dank unserer
Kooperation und der konsequenten Überwachung können wir frühzeitig
reagieren und sicherstellen, dass die Qualität des Trinkwassers
dauerhaft auf höchstem Niveau bleibt. Nachhaltiger Grundwasserschutz
gelingt nur, wenn alle Akteure an einem Strang ziehen“, sagt
Felicitas Dudziak.
Hintergrund zur Wasserversorgung
Die
Stadtwerke Duisburg versorgen in Duisburg etwa 250.000 Haushalte mit
Trinkwasser. Im Jahr 2024 wurden rund 30,9 Milliarden Liter Wasser
von den Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Duisburg verbraucht.
Gewonnen wird das Wasser in zwei Wasserwerken, die sich im
Düsseldorfer Norden in den Stadtteilen Wittlaer und Bockum befinden.
Dabei wird Grundwasser über Brunnen gefördert, gefiltert,
aufbereitet und anschließend als Trinkwasser in Lebensmittelqualität
in das Duisburger Versorgungsnetz eingespeist.
Darüber
hinaus beziehen die Stadtwerke Duisburg auch Trinkwasser über zwei
große Leitungen aus dem Wasserwerk Haltern am See im Kreis
Recklinghausen, wo Grundwasser mit Wasser aus dem Halterner Stausee
angereichert wird. In Homberg und Baerl schließlich wird
aufbereitetes Grundwasser aus dem Binsheimer Feld in Duisburg
verteilt. Rund 2.200 Kilometer Rohrleitungen unterhalten die
Stadtwerke Duisburg in der Stadt.

Ein spezielles
Messgerät kann die Nitratwerte schnell auslesen. Foto Stadtwerke
Duisburg
Als Wasserversorgungsunternehmen sind die Stadtwerke
Duisburg für die Sicherung höchster Qualitätsstandards
verantwortlich. Täglich werden Wasserproben an zahlreichen Stellen
im gesamten Stadtgebiet und im Bereich der Wasserwerke entnommen.
Diese rund 8.000 Proben pro Jahr werden in einem akkreditierten
Trinkwasserlabor geprüft, um jederzeit die hohe Qualität des
Trinkwassers zu überwachen.
2025: Stadtwerke feiern 150
Jahre Wasserversorgung
Im Jahr 2025 feiert der lokale
Energiedienstleister außerdem ein besonderes Jubiläum: Die
Wasserversorgung in Duisburg wird 150 Jahre alt. Im Frühjahr 1875
begann die Erfolgsgeschichte mit den Arbeiten zur Errichtung des
ersten städtischen Wasserwerks an der Aakerfähre. Seitdem werden die
Bürger an Rhein und Ruhr zuverlässig mit sauberem Trinkwasser
versorgt. Einen Überblick über die historische Entwicklung der
Duisburger Trinkwasserversorgung mit zahlreichen Bildern haben die
Stadtwerke unter www.swdu.de/wasser-150 zusammengestellt.

Regelmäßig werden auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen rund
um die Wasserwerke Wasserproben aus dem Boden entnommen und auf die
Nitratwerte untersucht. Foto Stadtwerke Duisburg
MSV
Duisburg – Waldhof Mannheim: DVG setzt zusätzliche Busse ein
Für Gäste des Fußballspiels MSV Duisburg gegen Waldhof Mannheim am
Freitag, 7. November, um 19 Uhr in der Schauinsland-Reisen Arena,
setzt die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) die Sportlinie
945 ein.
Abfahrtszeiten Buslinie 945 Richtung MSV Arena:
•
ab „Salmstraße“ (Meiderich) Abfahrt um 17.06, 17.16, 17.26 Uhr
•
ab „Bergstraße“ um 17.11, 17.21 und 17.31 Uhr
• ab „Meiderich
Bahnhof“ ab 17.15 bis 17.40 Uhr alle fünf Minuten
• ab
„Großenbaum Bahnhof Ost“ um 17.50 und 17.05 Uhr
• ab „Betriebshof
am Unkelstein“ ab 16.58 bis 17.23 Uhr alle fünf Minuten
• ab
„Hauptbahnhof“ (Verknüpfungshalle) ab 17.15 bis 18.35 Uhr alle fünf
Minuten
• ab „Businesspark Nord“ (Asterlagen) um 17.33 Uhr.

DVG-Foto
Nach Spielende stehen am Stadion Busse für die Rückfahrt
bereit. Gäste des Fußballspieles, die eine Tageseintrittskarte im
Vorverkauf erworben haben oder eine Dauerkarte besitzen, können
kostenlos die öffentlichen Verkehrsmittel für die Hin- und Rückfahrt
benutzen. Für die Gäste, die sich an der Stadionkasse ihre
Eintrittskarte kaufen, ist die Rückfahrt mit Bus und Bahn kostenlos.
KSM: Museumsführung durch das mittelalterliche Duisburg
Das Kultur- und Stadthistorische Museum lädt am
Sonntag, 9. November, um 15 Uhr, am Johannes-Corputius-Platz 1 am
Innenhafen zu einer Führung durch das mittelalterliche Duisburg ein.
Thorsten Fischer nimmt die Teilnehmenden bei seiner Museumsführung
auf eine kleine Zeitreise mit und vermittelt ein umfassendes Bild
der Duisburger Geschichte im Mittelalter – über den Alltag und von
königlichem Prunk über politische Macht bis hin zu wachsenden
Reichtum und kulturellem Aufschwung.
Die Teilnahme an der
Führung ist bereits im Museumseintritt enthalten und beträgt für
Erwachsene 4,50 Euro, ermäßigt 2 Euro. Weitere Informationen und das
Programm des Kultur- und Stadthistorischen Museums sind online unter
www.stadtmuseum-duisburg.de abrufbar.
„Gehen oder
Bleiben – Duisburger Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus.
Eine empirische Untersuchung von Flucht, Migration und
Verfolgung“ Migration, Flucht und Vertreibung sind zentrale Themen
der Gegenwart und auch die Frage des Gehens oder Bleibens ist nicht
nur in Untersuchungen von Flucht und Emigration relevant, sondern
bis heute eine „Kernfrage der deutsch-jüdischen Existenz“.
Johanna Ritzel präsentiert am Donnerstag, 13. November, im Zuge der
Reihe „Stadtgeschichte donnerstags“ um 18.15 Uhr in der „DenkStätte“
im Gebäude des Stadtarchivs am Karmelplatz 5 die Ergebnisse ihrer
Masterarbeit über die Flucht- und Emigrationsbewegungen Duisburger
Jüdinnen und Juden mittels empirischer Datenauswertung.
Es
handelt sich um die erste systematische Erfassung seit der
Veröffentlichung der „Geschichte der Duisburger Juden“ von Günter
von Roden und Rita Vogedes von 1986. Zentrale Fragen der Arbeit
lauten: Wie viele der Jüdinnen und Juden in Duisburg flohen oder
emigrierten? Wann fanden Flucht- und Emigrationswellen statt? Wohin
führten diese und wie wirkten sich Herkunft, Alter und Geschlecht
darauf aus?
Gleichzeitig werden beispielhaft Biografien von
Duisburger Jüdinnen und Juden vorgestellt, um die individuellen
Lebenswege und Motivationen für „Gehen oder Bleiben“ einzubeziehen
und die Auswirkungen der Verfolgung auf das persönliche Leben und
die Selbstwahrnehmung sowie Bewältigungsstrategien darzustellen.
Die systematische Untersuchung von Emigration und Flucht kann
dazu beitragen, die dominante Vorstellung von Juden als reine Opfer
der Verfolgung zu korrigieren. Die Teilnahme ist kostenfrei; eine
Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist allerdings
auf maximal 60 Personen beschränkt.
Indoor-Adventströdelmarkt im „Sunny“ – Regionalzentrum Süd
Das Kinder- und Jugendzentrum „Sunny“ an der Mündelheimer Straße
117 in Hüttenheim veranstaltet am Sonntag, 30. November, einen
Adventströdelmarkt für Jung und Alt. In gemütlicher
vorweihnachtlicher Atmosphäre kann von 10 bis 16 Uhr Trödel jeder
Art nach Lust und Laune ver- und gekauft werden.
Eine
Standgebühr gibt es nicht. Im gemütlichen Café ist mit frischen
Waffeln, Gebäck, kalten und warmen Getränken für das leibliche Wohl
gesorgt. Der Aufbau der Stände erfolgt ab 9 Uhr, wobei die
Teilnehmenden bitte selbst für die Standausstattung (Tische, Decken
usw.) sorgen.
Aus organisatorischen Gründen sollten sich die
Teilnehmenden bis Dienstag, 25. November, 11.25 im „Sunny“ mit
Angabe von Telefonnummer und E-MailAdresse anmelden – entweder
montags bis freitags persönlich oder ab 12 Uhr telefonisch unter
0203 3637845, oder per E-Mail an
sunny@stadtduisburg.de.
Sicher unterwegs in der digitalen Gesundheitswelt
Neue Internetseite Digital+Vital bietet Orientierung
Die Gesundheitsversorgung wird immer digitaler, zum Beispiel mit der
elektronischen Patientenakte (ePA), dem E-Rezept oder
Gesundheits-Apps. Wer sich auskennt, kann von den Vorteilen
digitaler Gesundheitsangebote profitieren. Damit alle diese Angebote
und Anwendungen sicher nutzen können, ist gute Information wichtig.
Die BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der
Seniorenorganisationen hat dafür die Internetseite
www.digital-und-vital.de
entwickelt. Sie bietet Orientierung und Unterstützung für alle, die
digitale Gesundheitsinformationen und -anwendungen sicher und
informiert nutzen möchten. Auf der Internetseite finden Nutzerinnen
und Nutzer verlässliche Informationen rund um digitale
Gesundheitsanwendungen wie zum Beispiel die elektronische
Patientenakte und das E-Rezept.
Links führen zu
zuverlässigen Quellen für Gesundheitsthemen, z. B. Seiten des
Bundesministeriums für Gesundheit und der Gematik. Künftig werden
auch Schritt für Schritt-Anleitungen, Tipps zum einfachen Einstieg
in digitale Gesundheitsthemen sowie „Train-the-Trainer“-Angebote auf
der Seite veröffentlicht. Die Internetseite Digital+Vital richtet
sich insbesondere an Organisationen und Initiativen, die ältere
Menschen beim sicheren Umgang mit digitalen Gesundheitsangeboten
unterstützen möchten.
Neben Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren sind auch alle anderen Interessierten unabhängig vom
Alter eingeladen, die Seite zu nutzen. Die Internetseite wurde im
Rahmen des Projekts „Digital+Vital“ der BAGSO Service GmbH
entwickelt. Das Projekt wird von den Unternehmen Pfizer, Novartis
und MSD unterstützt. Zur
Internetseite
Mitnahmeverbot von
E-Scootern im ÖPNV ist unverhältnismäßig
In einigen
deutschen Städten dürfen keine E-Scooter im öffentlichen Nahverkehr
mitgenommen werden. Als Grund dafür wird meist die Brandgefahr
angeführt. Der ADAC hat aus diesem Grund sechs E-Scooter einem
technischen Stresstest unterzogen. Das Ziel: Den Grenzbereich der
Akkus elektrotechnisch und mechanisch auszuloten.
Bei den
Versuchen wurden die E-Scooter bewusst starken Belastungen
ausgesetzt: Auf einem Zweiradprüfstand wurden die Gefährte über 30
Minuten bei Höchstgeschwindigkeit über simuliertes Kopfsteinpflaster
gefahren, in der Klimakammer folgte ein Test bei Minusgraden sowie
ein Test bei starkem Regen von allen Seiten. Besonderes Augenmerk
galt aber der elektrotechnischen Untersuchung: Nach mehreren Tiefen-
und Selbstentladungen wurden die E-Scooter – wo möglich – über das
Batteriemanagement absichtlich getuned, um sie zusätzlichem Stress
auszusetzen.

ADAC setzt sechs Akkus Stresstest aus / Ergebnis: Brandgefahr ist
äußerst gering ©ADAC/Ralph Wagner
Nach jeder Testrunde
wurden die Kapazität und der Innenwiderstand der Akkus erfasst.
Zudem erfolgte eine Vorher-Nachher-Prüfung der Batteriepacks
mithilfe einer Wärmebildkamera, um signifikante
Temperaturunterschiede während der Entladung sowie während des
Ladevorgangs zu dokumentieren.
Das Ergebnis der Tests war
eindeutig: In keinem Fall ergaben sich Veränderungen an den
Batteriepacks, es gab keine Verformungen, Brände oder andere
Auffälligkeiten. Der ADAC kann allen getesteten Modellen ein hohes
Sicherheitsniveau bescheinigen. Durch die geplante Überarbeitung der
Elektrokleinstfahrzeugverordnung sollen E-Scooter an die
Sicherheitsstandards von Pedelecs angeglichen werden und somit ist
ein weiterer Sicherheitsschritt zu erwarten.
Unter all
diesen Aspekten erscheint das mancherorts bestehende Mitnahmeverbot
von E-Scootern im öffentlichen Nahverkehr in der aktuellen Form
unverhältnismäßig und sollte aus Sicht des ADAC überprüft werden.
Darüber hinaus gilt, dass die Gefahr eines Akkubrandes tendenziell
beim Ladevorgang am größten ist.
Eine simple und sinnvolle
Risikoreduzierung könnte man also bereits erreichen, wenn man das
Aufladen im ÖPNV vermeiden würde. Verbraucher können sowohl beim
Transport als auch bei Ladevorgängen auf eine Akkuschutztasche
zurückgreifen. Diese kann zwar keine Brände verhindern, die
Ausbreitung aber verzögern und so im unwahrscheinlichen Falle eines
Feuers wertvolle Zeit gewinnen.
Singnachmittage mit
Popkantor Daniel Drückes in Wanheim und Wanheimerort
Musiker und Popkantor Daniel Drückes lädt alle, die Lust auf
gemeinsames Singen in gemütlicher Runde in der Evangelischen
Rheingemeinde Duisburg haben, zweimal im Monat zum Mitmachen ein.
Das nächste Singen in Gemeinschaft gibt es am 12. November 2025 um
14 Uhr im Gemeindehaus Wanheimerort, Vogelsangplatz 1; der zweite
Singnachmittag in diesem Monat startet am 13. November 2025 um 15
Uhr im Gemeindehaus Wanheim, Beim Knevelshof 45.
Auf dem
Programm stehen wie immer bekannte Lieder, Popsongs und Evergreens.
Zwischen dem Singen ist Platz für Kaffee und Kekse. Die Idee zu den
Musiknachmittagen zum Mitmachen hatte Daniel Drückes gemeinsam mit
Ehrenamtskoordinatorin Maria Hönes: Mit dem zusätzlichen Angebot
gilt es ältere und junge Menschen beim Singen zusammen zu bringen,
ganz nach dem Motto „Singen verbindet Generationen“. Mitsingen darf
jede und jeder.

Foto: Maria
Hönes
Blockflöten-Workshop im
Advent In der Adventszeit
Blockflöte
gemeinsam mit anderen spielen, dazu laden Kirchenmusikerin Annette
Erdmann und die Evangelische Versöhnungsgemeinde Duisburg-Süd
Interessierte aller Generationen herzlich ein. Zum Einsatz kommen
können Sopran-, Alt-, Tenor- oder Bassflöten. Auf dem Programm steht
natürlich adventliche und weihnachtliche Musik - von der Barockzeit
bis in die Gegenwart, darunter vielfach bekannte Lieder.

Einige der Stücke werden beim Weihnachtssingen am 3. Advent, 14.
Dezember um 17 Uhr in der Großenbaumer Versöhnungskirche aufgeführt.
Zu den Proben kommen die Musikfans am 25.11., 2.12. und 9.12. von
16.45 bis 18.15 Uhr im Großenbaumer Gemeindehaus, Lauenburger Allee
21, zusammen. Der Workshop ist kostenfrei. Mehr Infos und Anmeldung
bis zum 15. November bei Kantorin Annette Erdmann (Foto Rolf
Schotsch, Tel.: 0203 / 76 77 09 oder annette.erdmann@ekir.de). Infos
zur Gemeinde gibt es im Netz unter www.evgds.de.
Taizé-Gebet zur Wochenmitte“ in
Alt-Duisburg
Am Mittwoch, 12. November 2025 feiert die Evangelische
Kirchengemeinde Alt-Duisburg um 19 Uhr in der Duisserner Notkirche
an der Martinstr. 35 ein „Taizé-Gebet zur Wochenmitte“. So heißt das
Gottesdienstformat, das Dagmar Brans, Pfarrer Stefan Korn, Helmut
Becker und Kirchenmusiker Andreas Lüken vorbereitet haben und zu dem
sie herzlich einladen.
Für das Taizé-Team liegt der Reiz an
der predigtlosen Gottesdienstform in der Erfahrung der sinn- und
kraftstiftenden Gemeinschaft von singenden, schweigenden und
betenden Menschen. Die einfachen, berührenden Gesänge von Taizé
werden mehrmals gesungen, sie schaffen die meditative Atmosphäre
dieser Andachtsform und führen in die Stille.
„Und die
Stille bereitet den Menschen auf eine neue Begegnung mit Gott vor“
heißt es in der Einladung zum Taizé-Gebet zur Wochenmitte im
Gemeindebrief von Alt-Duisburg. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz
unter www.ekadu.de. Zum Thema Taizé: In der „Communité de Taizé“,
gegründet 1940 von Frère Roger in Taizé / Burgund, haben
Nächstenliebe und Versöhnung eine wichtige Bedeutung.
Die
Einfachheit und die Konzentration auf das Wesentliche sind bedeutsam
für diese Gottesdienste. Nicht zuletzt durch die einfachen Gesänge,
die mit wenigen Worten auskommen und sich wiederholen, wurde die
Gemeinschaft von Taizé weltweit bekannt und verfügt bis heute über
eine große Ausstrahlungskraft in der gesamten Christenheit.
Die meditativen Gesänge von Taizé laden dazu ein, zur Ruhe zu kommen
und bei Gesang, Gebet, Stille und persönlichem Nachdenken sich der
Gegenwart Gottes im eigenen Leben zu öffnen und neu Kraft zu
schöpfen.

Kfz-Versicherung im September 2025 um 10,9 % teurer als
ein Jahr zuvor
Auch Pkw-Reparatur und -Inspektion
binnen Jahresfrist überdurchschnittlich verteuert
Den Herbst
nutzen viele Autobesitzerinnen und -besitzer zum Wechsel der
Autoversicherung oder für einen Werkstattbesuch. Die Preise dafür
sind zuletzt überdurchschnittlich gestiegen. Für die Versicherung
ihres Kraftfahrzeugs mussten Verbraucherinnen und Verbraucher im
September 2025 um 10,9 % höhere Preise als im Vorjahresmonat zahlen,
wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt.
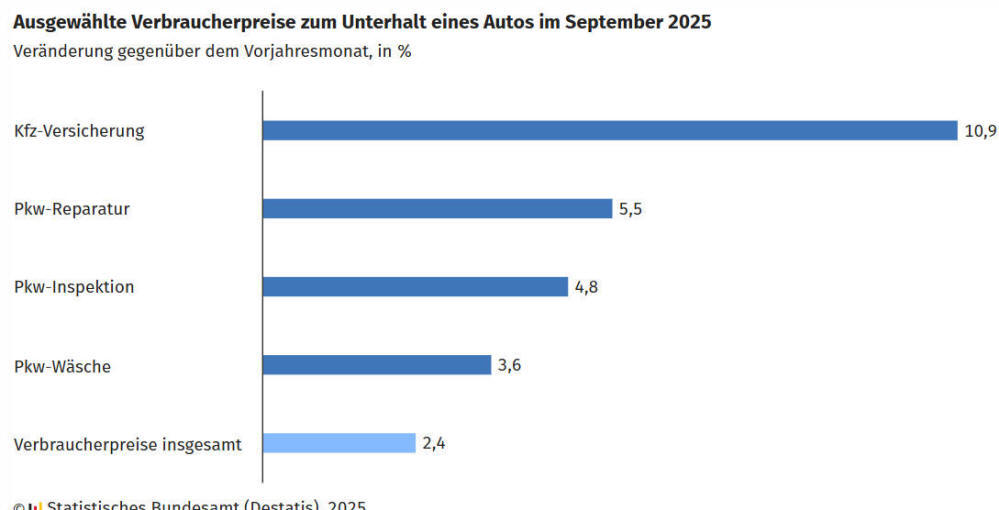
Die Pkw-Reparatur verteuerte sich gegenüber dem September 2024
um 5,5 %. Die weitere Pflege rund ums Auto wurde ebenfalls teurer:
Die Preise für die Pkw-Inspektion erhöhten sich um 4,8 % und die
Preise für die Pkw-Wäsche um 3,6 %. Zum Vergleich: Die
Verbraucherpreise insgesamt stiegen im selben Zeitraum um 2,4 %.
Kfz-Versicherung, Pkw-Inspektion und
-Reparatur auch mittelfristig überdurchschnittlich verteuert
Auch mittelfristig stiegen verschiedene Preise zum Unterhalt des
Autos deutlich. Im Jahr 2024 war die Kraftfahrzeugversicherung
43,6 % teurer als im Jahr 2020. Pkw-Inspektion (+28,3 %) und
Pkw-Reparatur (+27,0 %) verteuerten sich im selben Zeitraum
ebenfalls überdurchschnittlich.
Für die Pkw-Wäsche mussten
Verbraucherinnen und Verbraucher 2024 um 18,6 % höhere Preise als
2020 zahlen. Damit verteuerte sich die Pkw-Wäsche etwas
unterdurchschnittlich. Denn: Die Verbraucherpreise insgesamt
erhöhten sich im selben Zeitraum um 19,3 %.
6,5 Millionen Liter
wassergefährdende Stoffe im Jahr 2024 bei Unfällen ausgetreten
• Ausgetretene Schadstoffmenge gegenüber dem Vorjahr um mehr als
zwei Drittel verringert
• Zahl der Unfälle auf niedrigstem Stand
seit 2010
• 2,0 Millionen Liter ausgetretene Schadstoffe in der
Umwelt verblieben
Im Jahr 2024 sind in Deutschland bei
Unfällen rund 6,5 Millionen Liter wassergefährdende Stoffe
unkontrolliert in die Umwelt ausgetreten, das waren 69,1 % weniger
als im Vorjahr (2023: 21,0 Millionen Liter). Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, konnten etwa 2,0 Millionen
Liter (30,7 %) der ausgetretenen Stoffe nicht wiedergewonnen werden
und verblieben dauerhaft in der Umwelt. Im Jahr 2023 waren es noch
rund 3,3 Millionen Liter.
Starke Schwankungen in der
Zeitreihe sind nicht ungewöhnlich, da die ausgetretenen und in der
Umwelt verbliebenen Schadstoffmengen von der Art und Schwere der
Unfälle abhängig sind. Rund ein Drittel der im Jahr 2024
freigesetzten Schadstoffe gehen auf nur zwei Unfälle zurück. Die
Gesamtzahl der Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen sank mit 1 542
um 17,8 % gegenüber dem Vorjahr und bestätigt damit den Abwärtstrend
bei den Unfallzahlen.
1 800 Liter „stark wassergefährdende“
Stoffe mit Schadenspotenzial Wassergefährdende Stoffe werden nach
ihrem Schadenspotenzial als "allgemein wassergefährdend" deklariert
oder in eine von drei Wassergefährdungsklassen (WGK) eingeteilt.
Unter den im Jahr 2024 insgesamt 2,0 Millionen Litern dauerhaft in
der Umwelt verbliebenen Schadstoffen entfiel der größte Anteil mit
1,6 Millionen Litern (78,9 %) auf "allgemein wassergefährdende"
Stoffe.
Mit 1,4 Millionen Litern waren das insbesondere
Jauche, Gülle und Silagesickersaft. 42 100 Liter (2,1 %) bei
Unfällen ausgetretene "schwach wassergefährdende" Stoffe (WGK 1)
konnten nicht wiedergewonnen werden. Zu dieser
Wassergefährdungsklasse zählen Stoffe wie zum Beispiel Ethanol oder
Natronlauge.
Weitere 259 000 Liter (13,0 %) in der Umwelt
verbliebene Schadstoffe waren "deutlich wassergefährdende" Stoffe
(WGK 2). In dieser Kategorie sind Mineralölprodukte wie Heizöl oder
Dieselkraftstoff eingruppiert. Die gefährlichsten Stoffe sind die
"stark wassergefährdenden" Stoffe (WGK 3), darunter beispielsweise
Quecksilber oder Benzin.
Im Jahr 2024 konnten 41 800 Liter
(2,1 %) solcher Schadstoffe nicht wiedergewonnen werden und
verblieben mit potenziellen Schäden in der Umwelt. Die restlichen
Stoffmengen (3,9 %) konnten nicht eingestuft werden.
718 Gewässerverunreinigungen durch 610 Unfälle Im Jahr 2024
ereigneten sich 610 Unfälle, bei denen mindestens ein Gewässer
direkt von freigesetzten Schadstoffen verunreinigt worden ist.
In 359 Fällen gelangten Schadstoffe in ein Oberflächengewässer,
beispielsweise einen Fluss oder einen See. In 321 Fällen war die
Kanalisation betroffen. Insgesamt 35 Mal wurde das Grundwasser
verunreinigt und in drei Fällen unmittelbar die Wasserversorgung.
Insgesamt wurde demnach durch 610 Unfälle 718 Mal ein Gewässer
verunreinigt, da bei 107 Unfällen mehrere Gewässerarten gleichzeitig
betroffen waren.