






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 46. Kalenderwoche:
10. November
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Dienstag, 11. November 2025 - Hoppediz-Erwachen
6,2 Prozent mehr Ausbildungsverträge
bei den Freien Berufen
BFB-Präsident Dr. Hofmeister
stellt zum Spitzentreffen der Allianz für Aus- und Weiterbildung
exklusive Zahlen vor.
Beim Spitzentreffen der Allianz für Aus-
und Weiterbildung am 10. November 2025 präsentiert der BFB einen
Zuwachs von 6,2 Prozent bei neuen Ausbildungsverträgen bei den
Freien Berufen. Präsident Dr. Hofmeister fordert verlässliche
Rahmenbedingungen statt zusätzlicher Belastungen wie der
diskutierten Ausbildungsplatzabgabe.
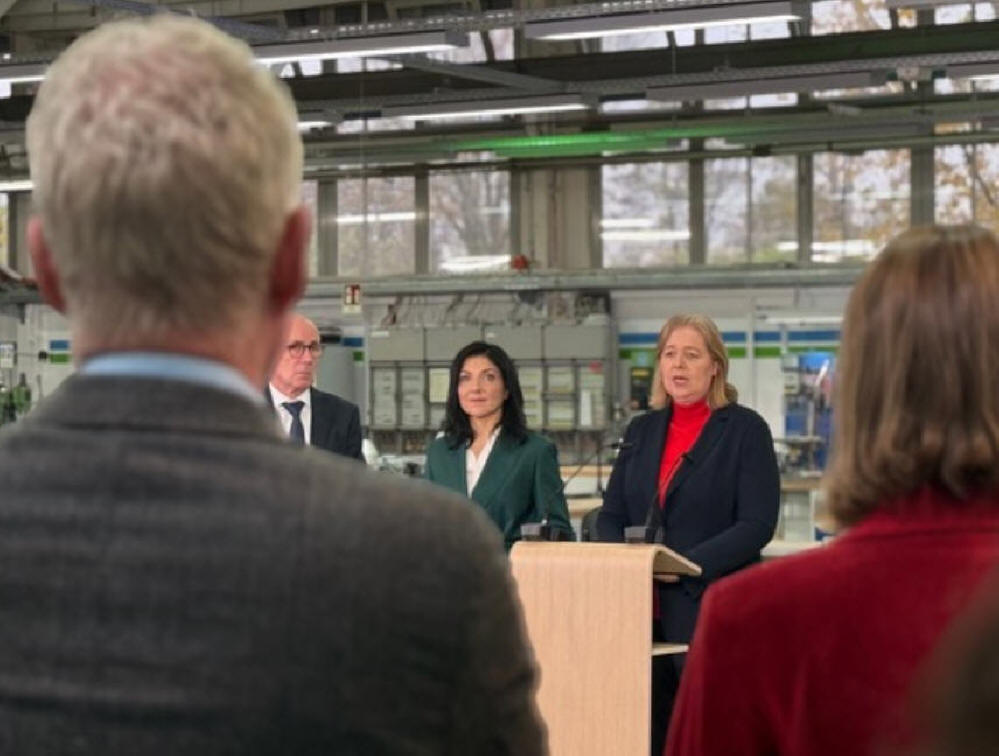
v.l. DIHK-Präsident Peter Adrian, Bundeswirtschaftsministerin
Katherina Reiche, Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas. (c) Luca
Samlidis
Zwischen 1. Oktober 2024 und 30.
September 2025 wurden bei den Freien Berufen 50.140 neue
Ausbildungsverträge abgeschlossen. Das entspricht einem Zuwachs von
6,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Dieses Wachstum ist ein
ermutigendes Signal in einem Umfeld, das von Nachwuchssorgen geprägt
ist“, sagt Dr. Stephan Hofmeister, Präsident des BFB. „Unsere
Ausbildungsbetriebe zeigen, dass persönliche Betreuung,
qualifizierte Ausbildung und gesellschaftliche Verantwortung zu den
Grundwerten der Freien Berufe gehören.“

Trotz der positiven Entwicklung bleibt der Fachkräftemangel
gravierend. Laut einer aktuellen Sonderauswertung des Instituts für
Freie Berufe im Auftrag des BFB fehlen in den Freien Berufen 211.000
Personen, davon 44.000 Auszubildende, 129.000 Fachkräfte und 38.000
angestellte Berufsträgerinnen und Berufsträger.
Verlässlichkeit für Ausbildungsbetriebe
„Jeder neue
Ausbildungsvertrag ist eine Investition in die Zukunft, für junge
Menschen genauso wie für unsere Wirtschaft“, betont Dr. Hofmeister.
„Wer ausbildet, braucht dafür stabile Rahmenbedingungen.
Die
aktuelle Debatte über eine Ausbildungsplatzabgabe, die in Berlin
geführt wird, setzt jedoch an der falschen Stelle an. Statt neuer
staatlicher Eingriffe braucht es Lösungen, die gemeinsam von den
Sozialpartnern entwickelt und getragen werden. Eine zusätzliche
Abgabe würde vor allem diejenigen treffen, die bereits Verantwortung
übernehmen. Angesichts von 44.000 fehlenden Auszubildenden sollte
unser Fokus auf Zusammenarbeit und praxistauglichen Ansätzen
liegen.“
Der BFB fordert verlässliche politische
Rahmenbedingungen für die Ausbildung, insbesondere für kleine
Betriebe. Dazu gehören bessere Berufsorientierung in den Schulen und
die Verstetigung bewährter Programme wie VerA Plus, das Jugendlichen
hilft, ihre Ausbildung erfolgreich abzuschließen. „Die Fortsetzung
der konstruktiven Zusammenarbeit in der Allianz für Aus- und
Weiterbildung ist zentral, damit diese Vorhaben nachhaltig
gelingen“, sagt Dr. Hofmeister.
Über den BFB:
Der
Bundesverband der Freien Berufe e. V. (BFB) vertritt als einziger
Spitzenverband der freiberuflichen Kammern und Verbände die
Interessen der Freien Berufe, darunter sowohl Selbstständige als
auch Angestellte, in Deutschland. Allein die rund 1,49 Millionen
selbstständigen Freiberuflerinnen und Freiberufler steuern knapp
zehn Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei.
Sie beschäftigen über
4,7 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – darunter ca.
129.000 Auszubildende. Die Bedeutung der Freien Berufe für
Wirtschaft und Gesellschaft geht jedoch weit über ökonomische
Aspekte hinaus: Die Gemeinwohlorientierung ist ein
Alleinstellungsmerkmal der Freien Berufe.
IMK:
Stabilisierung des Rentenniveaus ist generationengerecht und
finanzierbar
Die Stabilisierung des Rentenniveaus ist
sozialpolitisch notwendig, generationengerecht und finanziell
tragbar. Gerade mit Blick auf Generationengerechtigkeit sollte eine
Stabilisierung auf Dauer angelegt sein und nicht nur bis 2031, wie
es der aktuelle Gesetzesentwurf der Bundesregierung vorsieht.
Zusätzlich brauche es eine bessere Verzahnung aus Renten- und
Arbeitsmarktpolitik, um ungenutzte Potenziale für eine stärkere
Erwerbsbeteiligung zu erschließen.
Das betont Dr. Ulrike
Stein, Rentenexpertin des Instituts für Makroökonomie und
Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung in einer
Stellungnahme für die heutige Expert*innenanhörung im Ausschuss für
Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestags.*
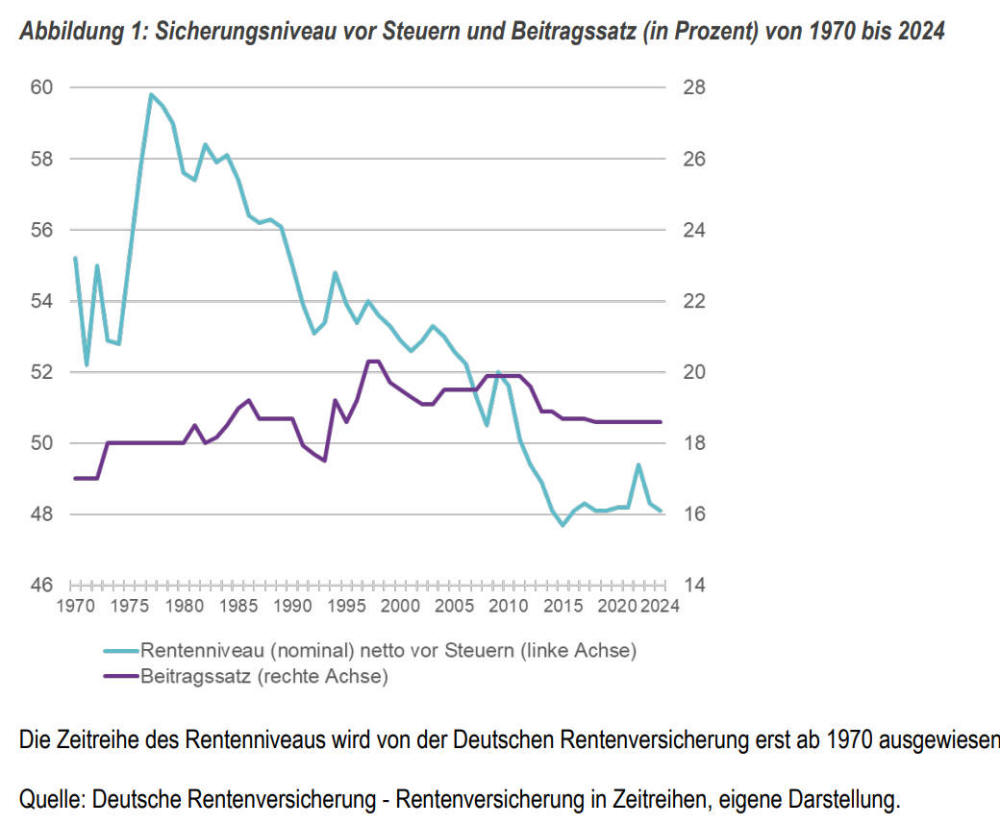
„Ein stabiles Rentenniveau ist entscheidend für die Sicherung
des Lebensstandards und stärkt das Vertrauen in die gesetzliche
Rentenversicherung – über Generationen hinweg“, so Stein. „Unsere
Analysen zeigen: Von der Stabilisierung profitieren Jung und Alt
gleichermaßen, jüngere Generationen werden nicht benachteiligt.“
Eine aktuelle IMK-Studie** zeigt detailliert, dass eine
langfristige Stabilisierung des Rentenniveaus, wie sie im
gescheiterten Rentenpaket II der Ampelkoalition vorgesehen war, für
Menschen aller Geburtsjahrgänge zwischen den 1940ern und 2010 die
interne Rendite der gesetzlichen Rente erhöht. Das heißt: Alle heute
Erwerbstätigen sowie junge Menschen, die aktuell kurz vor Eintritt
ins Berufsleben stehen und ein wesentlicher Teil der heutigen
Rentner*innen erhalten durch eine Stabilisierung im Verhältnis zu
ihren Beiträgen überproportional mehr Rente (Link zur Studie unten).
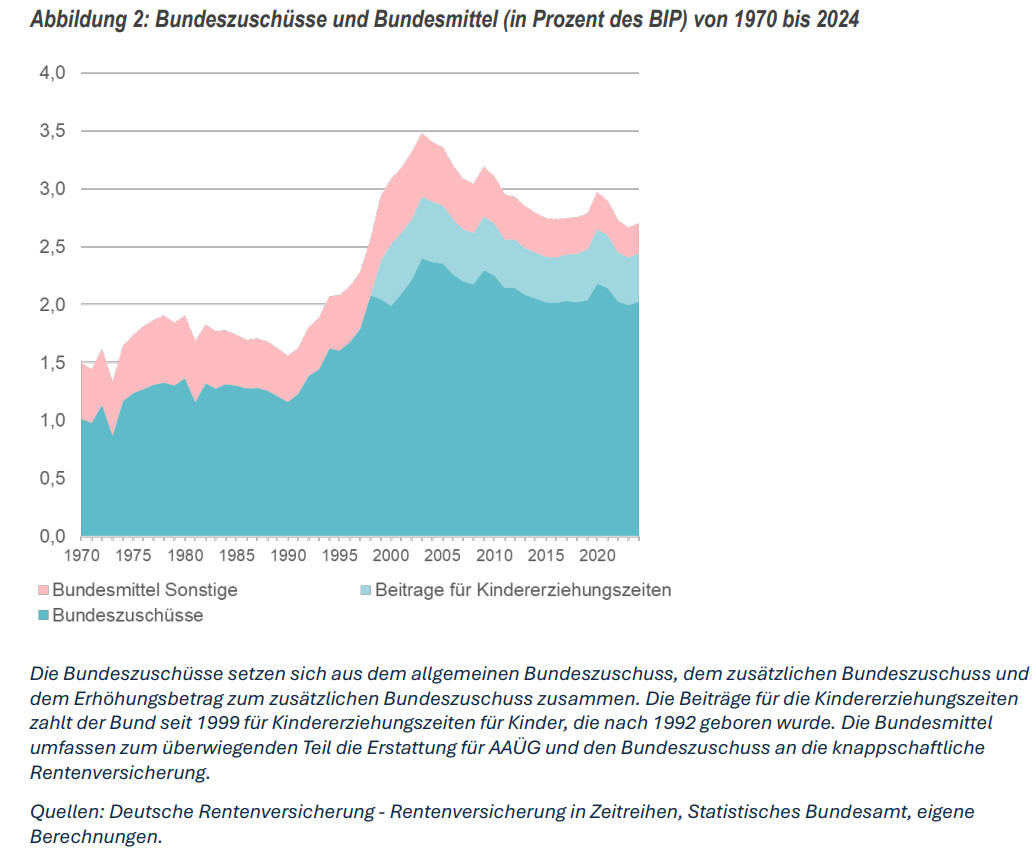
Seit den späten 1970er Jahren ist das Rentenniveau von knapp 60
Prozent auf rund 48 Prozent gesunken, wo es nach dem Gesetzentwurf
bis 2031 stabilisiert werden soll, zeigt Steins Analyse. Der
Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung hat sich dagegen
seit 1970 lediglich von 17 auf 18,6 Prozent erhöht.
Stein
betont, dass ein weiter sinkendes Rentenniveau nicht nur die
individuelle Lebensstandardsicherung vieler Menschen gefährde,
sondern einen wesentlichen Teil der Kosten für die Allgemeinheit
lediglich in die Grundsicherung verlagern würde. „Eine solide
Haltelinie wirkt der Zunahme von Armutsrisiken entgegen und sorgt
dafür, dass die gesetzliche Rente weiterhin eine tragende Säule des
Sozialstaats bleibt“, so Stein.
Die Stabilisierung sei zudem
grundsätzlich finanzierbar. Dass sich der Bund im Rahmen des
Rentenpakets 2025 stärker über Steuermittel an der Finanzierung
beteiligen möchte, ist ebenfalls ein akzeptabler Weg, analysiert die
IMK-Expertin. Seit 2003 ist der Anteil der Gesamtausgaben des Bundes
an der Finanzierung der Rentenversicherung, gemessen an der
Wirtschaftsleistung, von 3,5 auf 2,7 Prozent des BIP gesunken –
obwohl die Zahl der Altersrenten um 16 Prozent gestiegen ist.

Die Bundeszuschüsse und -mittel dienen dazu, Leistungen im
gesamtgesellschaftlichen Interesse zu finanzieren, die nicht über
Beiträge gedeckt sind. Dazu zählen etwa Folgekosten der deutschen
Wiedervereinigung. Allerdings decken die Bundeszuschüsse laut
Deutscher Rentenversicherung die nicht beitragsgedeckten Leistungen
längst nicht vollständig ab; allein 2023 betrug die
Finanzierungslücke rund 40 Milliarden Euro. „Die gesetzliche Rente
bleibt finanzierbar – wenn die Politik bereit ist, ihren
gesellschaftlichen Verpflichtungen nachzukommen“, so Stein.
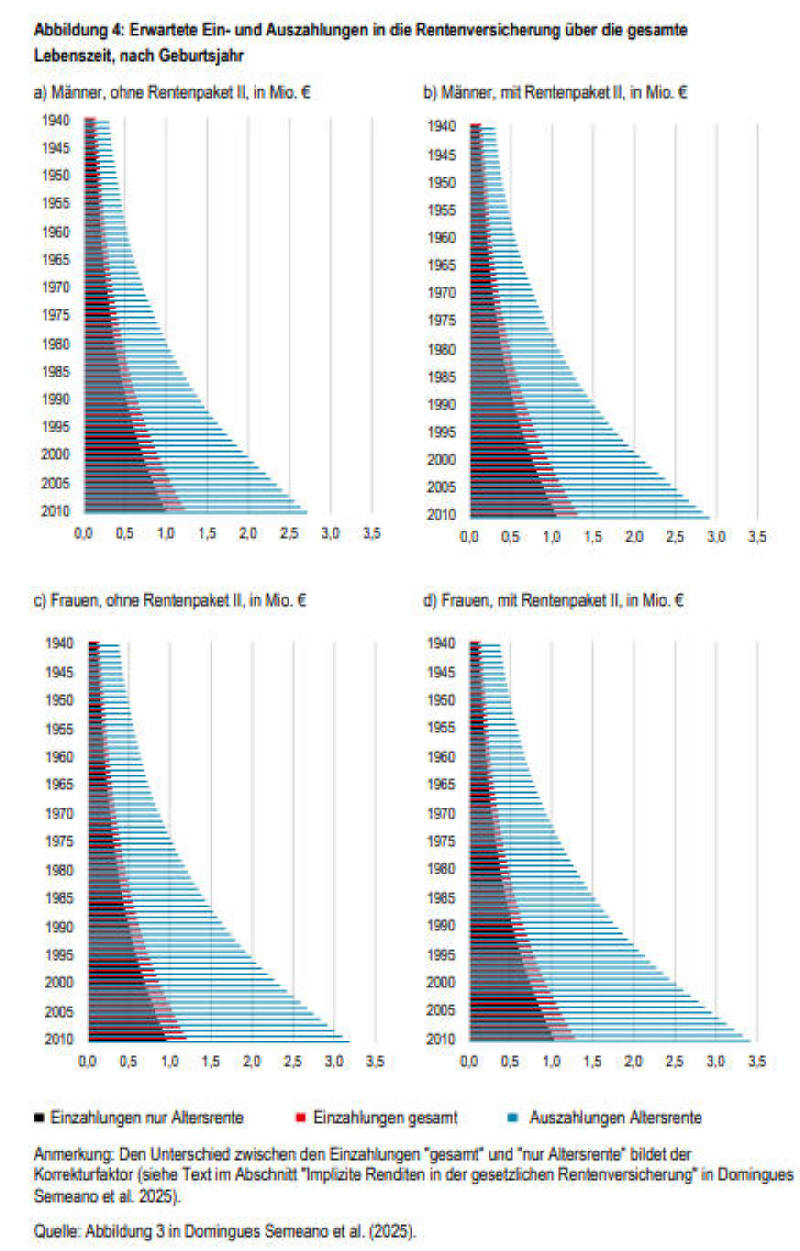
Das Rentenpaket 2025 enthält zudem die Einführung der
Mütterrente III, die eine vollständige Gleichstellung der
Kindererziehungszeiten vorsieht. Aus Gerechtigkeitsperspektive ist
diese Maßnahme laut IMK nachvollziehbar. Allerdings ist nach
Einschätzung von Stein der bürokratische Aufwand hoch, die
individuelle Entlastung gering, und die volkswirtschaftlichen Kosten
beträchtlich. Die Maßnahme koste rund fünf Milliarden Euro, bringe
den Betroffenen aber netto oft nur rund 15 Euro monatlich pro Kind.
Das Geld sei in anderen Bereichen sinnvoller eingesetzt.
Generell bewertet das IMK das Rentenpaket 2025 vor allem wegen der
Stabilisierung des Rentenniveaus als Schritt in die richtige
Richtung. An anderer Stelle scheue die Bundesregierung in ihrer
Rentenpolitik aber vor einer notwendigen Veränderung der
Schwerpunktsetzung zurück: „Anstatt zu diskutieren, wie
Rentner*innen mit befristeten Arbeitsverträgen weiterbeschäftigt,
die Regelaltersgrenze erhöht oder teure Anreize zum Weiterarbeiten
(Aktivrente) geschaffen werden können, sollte der Fokus darauf
liegen, ungenutzte Erwerbspotenziale unter Personen im
erwerbsfähigen Alter besser zu aktivieren“, schreibt die Forscherin
in ihrer Stellungnahme.
Besonders bei Frauen und jungen
Menschen mit niedrigem Bildungsabschluss gebe es erhebliche
Reserven. Stein verweist auf Defizite im Bildungssystem und
Fehlanreize im Steuer- und Abgabensystem, die eine Ausweitung des
individuellen Arbeitsvolumens behinderten. Wichtig sei zudem ein
besserer Ausbau der Betreuungsinfrastruktur für Kinder und
Pflegebedürftige. Nur so könnten mehr Menschen – insbesondere Frauen
– ihre Erwerbstätigkeit ausweiten und die soziale Sicherung
langfristig stabilisieren.
Vom Quartier in den Job:
Duisburger Integrationsprojekt - BIWAQ schafft Perspektiven für
Menschen in Hochfeld und Marxloh
Die alleinerziehende
Syrerin mit drei Kindern, der 33-jährige Afghane und ein 52 Jahre
alter Marokkaner – sie haben wie viele weitere Menschen aus Hochfeld
und Marxloh trotz großer Herausforderungen beruflich Fuß gefasst in
Duisburg. Gelungen ist ihnen das auch mit Hilfe des Projekts „BIWAQ
Duisburg – bildet, begleitet, bewegt“.
Das Förderprogramm
unterstützt Menschen in benachteiligten Quartieren, die zum Beispiel
langzeitarbeitslos sind oder einen Migrationshintergrund haben, und
integriert sie in den Arbeitsmarkt. Duisburg gehört zu den
bundesweit 47 Städten, die an der aktuellen BIWAQ-Förderrunde
teilnehmen.
Seit Januar 2023 wurden vor Ort insgesamt 827
Menschen betreut. 670 Personen waren arbeitslos, 417 davon
langzeitarbeitslos. 735 von ihnen haben einen Migrationshintergrund.
„Gerade für die Stadtteile Marxloh und Hochfeld ist die hier
geleistete Arbeit aus wirtschaftlicher und integrationspolitischer
Sicht enorm wichtig“ sagt Michael Rüscher, Beigeordneter des
Dezernats für Wirtschaft, Integration, Sicherheit und Ordnung, das
für die Koordination des Projekts in Duisburg zuständig ist.
Vor Ort umgesetzt wird das Programm durch die Einrichtungen
Duisburger Werkkiste (Marxloh) und die Gemeinnützige Gesellschaft
für Beschäftigungsförderung (Hochfeld). „Bundesweit gehören wir zu
den drei Projekten mit den meisten Teilnehmenden und zählen mit
einer Vermittlungsquote von durchschnittlich 25 Prozent zum oberen
Drittel aller Projekte“ sagt Projektleiter Ercan Idik.
Bisher haben 171 Personen eine Beschäftigung aufgenommen und 32
Teilnehmende eine berufliche Ausbildung begonnen. Weitere 222
Personen haben ihre Aussichten auf Beschäftigung signifikant erhöht.
Im Projekt erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine
individuelle und kostenlose Beratung und je nach persönlichen
Voraussetzungen werden sie in eine passgenaue Qualifizierung oder
Weiterbildung vermittelt.
„Wegen unseres langjährigen
Engagements im Stadtteil auch im sozialen Bereich kommen die
Menschen gerne zu uns“, sagt Lena Richter, Geschäftsführerin der
Duisburger Werkkiste. Die Teilnehmenden werden bei der Stellensuche,
bei der Erstellung von Lebenslauf und Bewerbungsschreiben
unterstützt und auf das Bewerbungsgespräch vorbereitet. Dazu gehört
auch das Erlernen des Umgangs mit digitalen Medien. Weiterhin
besteht die Möglichkeit einer betrieblichen Erprobung und der
Einsatz in statteilbezogenen Baumaßnahmen.
„Wir arbeiten für
unsere Teilnehmenden eng mit Duisburger Betrieben zusammen. Gerade
die aktuellen Arbeiten für die IGA in Hochfeld bieten hohes
Potenzial für deren Arbeitsmarktintegration,“ berichtet Stephanie
Schmiemann-Altenhoff, Geschäftsführerin der Gesellschaft für
Beschäftigungsförderung.
Bei Bedarf werden die Teilnehmenden
auch bei der Anerkennung ihrer Abschlüsse aus dem Ausland
unterstützt. Beispielsweise konnte eine alleinstehende Ingenieurin
aus der Ukraine zu Siemens oder ein 52 Jahre alter Mann aus Marokko
zu den Wirtschaftsbetrieben in Vollzeit vermittelt werden.
Eine 40-jährige Frau aus Syrien, alleinerziehende Mutter mit drei
Kindern, arbeitet jetzt in einer Kita. Ebenso in Vollzeit arbeitet
jetzt ein 33-jähriger Afghane als Altenpflegehelfer.
Die
Gesamtkoordination des BIWAQ-Projekts erfolgt über die Stabsstelle
für Wirtschafts-, Europa- und Fördermittelangelegenheiten des
Dezernats für Wirtschaft, Integration, Sicherheit und Ordnung. Eine
enge Kooperation besteht mit dem JobCenter Duisburg und den
Wirtschaftsbetrieben sowie den Stadtteilmanagements in Marxloh und
Hochfeld.
Kleiner Festakt für neue Staatsbürger in
der Mercatorhalle
Die Stadt Duisburg hat
Duisburgerinnen und Duisburgern, die zwischen April und September
dieses Jahres die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten haben, am
vergangenen Donnerstag, 6. November, in der Mercatorhalle feierlich
willkommen geheißen. Rund 250 Eingebürgerte waren der Einladung
gefolgt.
Stellvertretend für Oberbürgermeister Sören Link
empfing der Beigeordnete für Integration, Michael Rüscher, die neuen
Staatsbürgerinnen und Staatsbürger im Foyer der Halle zu einem
kleinen Festakt. Von Januar bis Mitte April 2025 wurden insgesamt
872 Menschen in Duisburg eingebürgert – die meisten von ihnen
stammen unter anderem aus der Türkei, Bosnien und Serbien.

Im Beisein von Dezernent Michael Rüscher findet im Foyer der
Mercatorhalle die Einbürgerungsfeier statt...Bild: Ilja Höpping /
Stadt Duisb
„Einbürgerung ist mehr als nur ein formaler Akt,
sondern ein starkes Bekenntnis zur Zugehörigkeit. Mit Ihrer
Entscheidung schlagen Sie Wurzeln – in unserer Stadt und in unserer
Gesellschaft“, so der Beigeordnete Michael Rüscher in seiner Rede.
Musikalisch begleitet wurde die Feierlichkeit vom Streichquartett
der Duisburger Philharmoniker.
Als Repräsentanten für alle
Eingebürgerten wurden einige Gäste geehrt, nachdem gemeinsam die
deutsche Nationalhymne angestimmt wurde. Im Anschluss bestand
Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich
auszutauschen.
Ein sichtbares Zeichen für Verwurzelung und
Zusammenhalt setzte einen Tag später, am 7. November, auch
Oberbürgermeister Sören Link: An einem Weg zwischen der Ackerstraße
und der Dahlingstraße in Duisburg-Friemersheim pflanzte er zwei
junge amerikanische Roteichen, Baum des Jahres 2025, als Auftakt für
die erste „Einbürgerungsallee“, die als Symbol für Integration und
Vielfalt wachsen soll.
Wie Oberbürgermeister Sören Link bei
den vergangenen Einbürgerungsfeiern bereits ankündigte, soll als
Zeichen und Symbol für Verwurzelung und Identität an einem
ausgewählten Ort stets ein Baum gepflanzt werden. Dieser symbolische
Impuls wurde heute umgesetzt..
Zwei Amerikanische Roteichen
sind der Auftakt der ersten Einbürgerungsallee. Die Roteiche ist
Baum des Jahres 2025 und wird an einem Weg zwischen der Ackerstraße
und der Dahlingstraße in Duisburg-Friemersheim gepflanzt. Die Kinder
der angrenzenden Dahlingschule haben bei der Pflanzung tatkräftig
geholfen.

Foto: Tanja Pickartz / Stadt Duisburg
„Jeder neue Baum steht
für eine persönliche Geschichte und für das Ankommen in unserer
Stadt“, betont Oberbürgermeister Sören Link. Schülerinnen und
Schüler der städtischen Förderschule Dahlingstraße packten
tatkräftig bei der Pflanzaktion mit an. Künftig soll zu jeder
Einbürgerungsfeier ein junger Baum gepflanzt werden.
Duisburger Filmwoche vergibt Preise im Wert von 28.000 Euro
Die Preise der Duisburger Filmwoche wurden vergeben - sechs
Auszeichnungen im Gesamtwert von 28.000 Euro. Den mit 6.000 Euro
dotierten 3sat-Dokumentarfilmpreis erhielt die Arbeit
"Palliativstation" von Philipp Döring.
Vier Stunden
begleitet das Publikum Ärzte, Pfleger und Therapeuten auf der
titelgebenden Station in einem Berliner Krankenhaus. Der ohne Team
und fast ohne Budget realisierte Film ist eine Auseinandersetzung
mit dem letzten Lebensabschnitt.
Ebenfalls mit 6.000 Euro dotiert ist der
Arte-Dokumentarfilmpreis, der zu gleichen Teilen an zwei Filme ging:
"Holler for Service" von Kathrin Seward und Ole Elfenkämper sowie
"Elbows in Shatters" von Danila Lipatov - zwei Beiträge, die von
Gemeinschaften, von der Arbeit mit und in Communities handeln.
Seward und Elfenkämper porträtieren Kellie, die queere Betreiberin
eines Baumarkts in den USA, die sich für ihre Nachbarschaft
engagiert.
Danila Lipatov fährt auf der Suche nach konkreten
Orten zu der Migrationserzählung seiner Tante nach Duschanbe in
Tadschikistan. Er findet Menschen, die sich in autoritären
Verhältnissen Freiräume geschaffen haben. Suse Itzel gewann für ihre
Arbeit "Ich hätte lieber einen anderen Film gemacht" über sexuellen
Missbrauch den Preis der Stadt Duisburg (5.000 Euro) sowie den
Publikumspreis (1.000 Euro).
Die Carte blanche, der
Nachwuchspreis des Landes NRW, ging an Max Kollers "Der Tag vor dem
Abend", der eine alte Frau in einem großen, leer gewordenen Haus
zeigt. Über den Andocken-Preis für dokumentarische Perspektiven der
Film- und Medienstiftung NRW und 5.000 Euro konnte sich Johannes
Lehmann für seine Projektidee "Casino" freuen. Er plant eine Doku
über Croupiers in der Ausbildung. idr - Infos:
http://www.duisburger-filmwoche.de
Müllauto
hautnah erleben – Familienaktion zur Europäischen Woche der
Abfallvermeidung
Wie funktioniert eigentlich ein
Müllwagen? Und was passiert mit unseren Abfällen, nachdem die Tonne
geleert wurde? Antworten auf diese Fragen gibt es am Freitag, 28.
November 2025, bei der Familienaktion „Müllauto-Schau und -Bau“ der
Wirtschaftsbetriebe Duisburg. Von 14.00 bis 17.00 Uhr haben Eltern
und Kinder die Gelegenheit, auf dem Gelände des Recyclingzentrums
Nord, Abfalllernpfad, Im Holtkamp 84, 47167 Duisburg, ein echtes
Müllauto aus nächster Nähe zu erleben.
Kleine und große
Besucherinnen und Besucher können das beeindruckende Fahrzeug von
innen und außen erkunden, auf dem Trittbrett stehen oder in der
Fahrerkabine Platz nehmen. Neben spannenden Einblicken in die Arbeit
der Müllabfuhr lernen Kinder spielerisch, wie sie sich sicher im
Straßenverkehr verhalten, wenn große Fahrzeuge unterwegs sind.

Fotos (C) Sarah Lampe / Wirtschaftsbetriebe Duisburg
Zum
Abschluss dürfen alle Teilnehmenden ihr eigenes kleines Müllauto
basteln und mit nach Hause nehmen – als Erinnerung an einen
lehrreichen und erlebnisreichen Nachmittag. Die Aktion richtet sich
an Familien mit Kindern im Alter von fünf bis zwölf Jahren und
findet im Rahmen der Europäischen Woche der Abfallvermeidung
(22.–30. November 2025) statt.

Das diesjährige Motto lautet: „Alte Elektrogeräte? Reparieren oder
richtig entsorgen!“. Besucherinnen und Besucher sind herzlich
eingeladen, alte Elektrogeräte mitzubringen und diese der
fachgerechten Entsorgung zuzuführen. Die Teilnahme ist kostenlos,
eine Anmeldung ist jedoch erforderlich. Interessierte Familien
können sich telefonisch unter (0203) 283 - 3000 oder per E-Mail an
abfallberatung@wb-duisburg.de anmelden.
Mein Blut kann Leben retten,
vielleicht das meiner Freunde
Blutspendetermin am 11. November im BG Klinikum Duisburg
Duisburg, 28. Oktober 2025. Claudia Hermes-Baumgart ist seit
einigen Jahren engagierte und regelmäßige Blutspenderin. „Es ist nur
ein kleiner Pieks, aber ein Neuanfang für viele andere Menschen“,
erklärt die Servicemanagerin im BG Klinikum Duisburg. Und allein
hier werden jedes Jahr rund 1.500 Blutkonserven für die Versorgung
der vielen schwer- und schwerstverletzten Patientinnen und Patienten
benötigt.

Spendetermin für Vollblut-Helden in der Mehrzweckhalle des BG
Klinikums Duisburg am 11. November 2025 von 13 bis 17 Uhr. (Bild:
DRK Blutspendedienst West)
„Daher geht unsere Klinik auch mit
gutem Beispiel voran. Gemeinsam mit dem Blutspendedienst West des
Deutschen Roten Kreuzes (DRK) veranstalten wir am 11. November 2025
von 13 bis 17 Uhr einen Blutspendetermin in der Mehrzweckhalle auf
dem Klinikgelände“, konstatieren Geschäftsführerin Brigitte
Götz-Paul, der Ärztliche Direktor Univ.-Prof. Dr. med. Marcel Dudda
und der Stellv. Ärztliche Direktor Dr. med. Nikolaus Brinkmann.

Ein Vorgespräch ist wichtig. (Bild: DRK Blutspendedienst West)
Zum Mitmachen aufgerufen sind an diesem Tag die Beschäftigten
des Hauses, aber auch die Patientinnen und Patienten – nur nach
Rücksprache mit der behandelnden Ärztin bzw. dem behandelnden Arzt
–, Besuchende sowie Bürgerinnen und Bürger aus der Region. Die
Anmeldung zum Blutspendetermin ist ab sofort möglich unter
https://www.blutspendedienst-west.de/blutspendetermine/termine/365308.
Große Bedeutung für die klinische Versorgung
Blut ist
eine wichtige Ressource für klinische Behandlungen und ein Mangel
ist immer eine immense Herausforderung für die Krankenhäuser. Nach
einem Sommer mit stabilen Blutspenderzahlen schlägt der
Blutspendedienst West jetzt sogar Alarm: „Die Blutspenden sind im
Herbst ins Stocken geraten“. Seit Ende der Sommerferien kommen
weniger Spenderinnen und Spender zu den frühzeitig angekündigten und
gut beworbenen Terminen.
Doch um das Leben schwer
verunfallter Menschen zu retten und geplante lebensnotwendige
Operationen durchzuführen, muss ausreichend Blut zur Verfügung
stehen. Das BG Klinikum hofft, mit möglichst vielen Teilnehmenden am
11. November einen Beitrag gegen Engpässe leisten zu können.
Was müssen potenzielle Spenderinnen und Spender beachten?
Spenderinnen und Spender müssen mindestens 18 Jahre alt sein und
sich gesund fühlen. Zum Blutspendetermin sollten Interessierte
unbedingt ihren Personalausweis oder Führerschein mitbringen und
sich rund eine Stunde Zeit für die Blutabgabe nehmen. Als Dankeschön
gibt es vom Blutspendedienst einen Gymbag mit dem Statement „Heute
einfach mal ein Leben gerettet“, gefüllt mit kleinen Überraschungen
aus dem BG Klinikum.
„Es wird viel geforscht, aber
künstliches Blut gibt es nun mal noch nicht. Ich kann aber meines
spenden und damit Leben retten – vielleicht sogar das meiner eigenen
Familie oder von Freunden“, sagt Claudia Hermes-Baumgart. „Deshalb
bin ich natürlich am 11. November dabei – und fühle mich gut und
wertvoll damit.“

Engagierte Blutspenderin: Claudia Hermes-Baumgart, Servicemanagerin
im BG Klinikum Duisburg. (Bild: BG Klinikum Duisburg)
„Das Experiment“: Wenn Film auf Kulinarik trifft – Kunst und
Küche im Dialog
Am 15. November 2025 präsentieren
Künstler Daniel Zerbst und Koch Christian Krüger in der Duisburger
Faktorei21 ein außergewöhnliches Format zwischen Leinwand und
Teller. Die Faktorei21 lädt an diesem Abend zu einer besonderen
Begegnung zweier Disziplinen ein: Der bildende Künstler Daniel
Zerbst zeigt seinen ausgezeichneten Film Witches of Everland in fünf
Kapiteln. Parallel dazu serviert Christian Krüger ein darauf
abgestimmtes 5-Gang-Menü – und schafft so einen Abend, an dem Bild
und Geschmack in einen Dialog treten.
Mit Das Experiment
wird ein künstlerischer Brückenschlag gewagt. Daniel Zerbst arbeitet
seit mehr als drei Jahrzehnten als bildender Künstler und
Filmemacher. Seine Werke wurden auf zahlreichen Festivals und
Ausstellungen in Europa gezeigt. Mit Witches of Everland hat er
einen Film geschaffen, der durch seine visuelle Dichte, den
experimentellen Erzählstil und die eigens von DJ Koze komponierte
Musik überregionale Aufmerksamkeit erhielt.
In fünf Kapiteln
entwirft Zerbst eine vielschichtige Bildsprache zwischen Fiktion und
Metapher. Christian Krüger, einst mit einem Michelin-Stern
ausgezeichnet, geht seit einiger Zeit in der Faktorei21 am
Duisburger Innenhafen neue Wege. Nach Stationen in der
Spitzengastronomie entwickelte er das Konzept, Kulinarik zugänglich,
regional verwurzelt und zugleich experimentierfreudig zu gestalten.
Seine Menüs sind geprägt von klaren Aromen, kreativen Verbindungen
und einem bewussten Umgang mit Produkten.
Im Rahmen von
Das Experiment beantwortet Krüger die fünf Kapitel von Zerbsts Film
jeweils mit einem Gang. So entsteht ein Abend, bei dem Projektion
und Komposition, Bild und Biss ineinandergreifen. Die Veranstaltung
ist damit weniger klassisches Dinner, sondern vielmehr ein
interdisziplinäres Erlebnis.
Die Teilnahme kostet 98 Euro
pro Person für das Menü, die optionale Weinbegleitung liegt bei 30
Euro. Beginn ist am Samstag, 15. November 2025, um 18:00 Uhr in der
Faktorei21 am Duisburger Innenhafen. Es sind noch wenige Restplätze
vorhanden. Anmeldungen sind möglich über die Website der Faktorei21.
Faktorei21 by Christian Krüger Philosophenweg 21 47051
Duisburg Tel: 0203 34 68 379 Mail:
info@faktorei.de Web:
www.faktorei.de
MGV „Union“ Bork begeistert im Schmidthorster Dom
Zum Abschluss eines erlebnisreichen Ausflugs nach Duisburg
gestaltete der Männergesangverein „Union“ Bork den Abendgottesdienst
im Schmidthorster Dom musikalisch mit. Unter der Leitung ihres
Vorsitzenden Friedrich Potthoff erfüllten die Männerstimmen das
Gotteshaus mit einem eindrucksvollen Klang und viel Gefühl.

Mit Liedern wie „Lobt den Herrn der Welt“ (Text und Bearbeitung:
Willy Trapp) und „Ich bete an die Macht der Liebe“ von D.
Bortniansky (Bearb. Jos. Schwartz) eröffneten die Sänger die Feier
festlich und eindrucksvoll. Das „Sanctus - Heilig, heilig, heilig“
von Franz Schubert ließ die Gemeinde ehrfürchtig mitsummen, bevor
das gefühlvolle „Vater unser“ (Hanne Haller, Arr. P. Thibaut) eine
besonders meditative Stimmung schuf. Mit Beethovens „Die Ehre Gottes
aus der Natur“ setzten die Sänger schließlich einen festlich
strahlenden Schlusspunkt.
Nach der Heiligen Messe blieben die
Gottesdienstbesucher in den Bänken sitzen und lauschten aufmerksam
dem anschließenden halbstündigen Konzert des Chores. Mit ihrer
warmen Klangfülle und spürbaren Freude am Gesang berührten die
Sänger die Herzen der Zuhörer. Der lange, herzliche Applaus am Ende
zeigte, wie sehr die musikalische Darbietung die Menschen bewegt und
begeistert hatte.
Vor dem Schlusssegen stellte Vorsitzender
Friedrich Potthoff den Chor kurz vor und erinnerte an die besondere
Verbindung zu Pater Tobias, dem Prämonstratenser-Chorherrn aus
Hamborn. Beim Neujahrsempfang der Stadt Selm, zu der Bork gehört,
wurde Pater Tobias mit der Ehrenmedaille „Freiherr vom Stein“
ausgezeichnet. Seit dem 1. April ist er zudem passives Mitglied im
MGV „Union“ Bork.
„Für uns war es eine große Freude, heute in
dieser wunderbaren Kirche zu singen und unseren Freund Pater Tobias
hier zu besuchen“, sagte Friedrich Potthoff. „Der Tag war voller
Herzlichkeit, Musik und Begegnung - das werden wir nicht vergessen.“
Auch Pater Tobias zeigte sich dankbar und bewegt:
„Musik ist
eine Sprache des Glaubens. Der Gesang des MGV ‚Union‘ Bork hat heute
Abend unsere Herzen geöffnet und diesen Gottesdienst zu einem
besonderen Erlebnis gemacht. Ich danke dem Chor und allen, die
gekommen sind, um gemeinsam zu beten und zu singen.“

Der Chor nutzte den Tag, um Pater Tobias in Duisburg zu besuchen.
Die 58 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erlebten ein
abwechslungsreiches Programm: Eine Hafenrundfahrt mit der Weißen
Flotte führte sie durch den größten Binnenhafen Europas. Nach einem
gemeinsamen Mittagessen in der Gaststätte „Zum Treffpunkt“
besichtigte die Gruppe die Abtei Hamborn, wo Pater Tobias zuhause
ist.
In zwei Gruppen aufgeteilt, erhielten die Gäste
spannende Einblicke in die über 900-jährige Geschichte der Abtei,
besichtigten Kirche, Kreuzgang und Schatzkammer und genossen
anschließend Kaffee und Kuchen im Abteizentrum.
Alle
Teilnehmer zeigten sich begeistert von der herzlichen
Gastfreundschaft und den vielen neuen Eindrücken. Der Tag endete mit
Musik, Glauben und Gemeinschaft - ein Erlebnis, das allen noch lange
in Erinnerung bleiben wird.
Hamborner Gemeinde lädt zum CD-Tauschtag in die
Friedenskirche ein
Die Evangelische Kirchengemeinde
Duisburg Hamborn lädt zum CD-Tauschtag in die Sakristei der
Friedenskirche, Duisburger Straße 174, ein. Dort können
Interessierte am Freitag, 14. November 2024 von 15 bis 17 Uhr für
eigene CD´s im Tausch die anderer erhalten. Erwartet wird eine große
Auswahl an Compact Discs - sie werden immer noch vielfach genutzt -
alle mit dem Zweck, mit Musik oder Hörspielen für Kurzweil zu
sorgen.
Vor Ort ist auch ein CD-Player, mit dem die Discs
der anderen getestet werden können. Die Idee zu dem Tauschtag – es
ging auch schon um Osterdeko und Vasen - hatten Engagierte der
Gemeinde, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen und es schade
finden, wenn Dinge, die anderen Freude machen könnten, einfach
entsorgt werden. Daher lädt das Team um Edith Bauer (Tel. 0203
554460 oder Handy 0178-3148068) zum CD-Tausch ein. Der Eintritt ist
frei; Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter
www.friedenskirche-hamborn.de.
Kirche Obermeiderich lädt wieder zu Emils Pub ein
Für Freitag, 14. November 2025 lädt die Evangelische
Kirchengemeinde Duisburg Obermeiderich in das Gemeindezentrum an der
Emilstraße 27 zu „Emils Pub“ ein. Bei dem beliebten
Gemeindetreffpunkt können Besucherinnen und Besucher ab 19 Uhr bei
Getränken aller Art und gutem Essen zum Wochenende hin ein wenig
abschalten und beim Klönen über Gott, die Welt, den Krieg und den
Frieden ins Gespräch kommen.
Diesmal gibt’s überbackenes
Räuberfleisch, dazu gibt es kräftiges Bauernbrot. Und wie immer ein
Dessert, diesmal Vanilleeis mit heißen Kirschen. Der Durst kann wie
immer mit verschiedenen Biersorten, Wein und Softgetränken gelöscht
werden. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter
www.obermeiderich.de.
Vermächtnis eines Freundes: Rheingemeinde lädt zum
Konzert in die Gnadenkirche Wanheimerort
Am 16.
November - dem Volkstrauertag - erklingt um 17 Uhr in der
Gnadenkirche Duisburg Wanheimerort das „Vermächtnis eines Freundes“.
Das Konzert gestalten ein Projektchor, Olaf Koch (E-Bass), Helmut
Lührsen (Perkussion) und Beate Hölzl (Tasteninstrumente) unter der
Leitung von Lothar Rehfuß.
Das zu hörende Werk von Gregor
Linßen beschreitet in acht Liedern und verbindenden Texten den Weg
aus der Verlusterfahrung heraus. Linßen verarbeitet in der
Komposition den Verlust eines tödlich verunglückten Freundes. Der
Eintritt ist frei.

Mitglieder von „Soul, Heart & Spirit“ mit ihrem Chorleiter in der
evangelischen Kirche in Wanheim (Foto: Chor „Soul, Heart &
Spirit“).

Karnevalsauftakt in NRW: Rund 51.500 Menschen feiern am
11.11. Geburtstag
* Seit 2000 wurden rund 10.900 Kinder
zum Karnevalsauftakt geboren.
* Am 11.11.2024 wurden 452 Kinder
in NRW geboren.
* Tagesscharfe Daten ab 2000 für alle Kreise und
kreisfreien Städte im Geburtenkalender NRW.
In
Nordrhein-Westfalen dürfen am kommenden Dienstag schätzungsweise
rund 51.500 Menschen nicht nur den Karnevalsauftakt, sondern auch
ihren Geburtstag feiern. Wie das Statistische Landesamt auf Basis
von Meldungen der Standesämter mitteilt, wurden im letzten Jahr am
11. November 452 Kinder geboren. In den Karnevalshochburgen Köln,
Düsseldorf und Bonn wurden 24 bzw. 19 und 10 Geburten am 11.11.2024
verzeichnet.
Seit dem Jahr 2000 sind insgesamt rund 10.900
Kinder in NRW zu Beginn der fünften Jahreszeit zur Welt gekommen.
Das macht einen Anteil von 0,29 % an allen Geburten in diesem
Zeitraum aus. Mit einem Klick auf den interaktiven Geburtenkalender
unter
https://statistik.nrw/service/veroeffentlichungen/geburtenkalender-nrw
können Sie für jedes Datum herausfinden, wie viele Kinder seit dem
Jahr 2000 in ganz NRW oder den nordrhein-westfälischen Kreisen und
kreisfreien Städten geboren wurden.
NRW: Anteil der Menschen mit Bezug
von Grundsicherung im Alter das vierte Jahr in Folge gestiegen
* 5,3 % der über 66-Jährigen bezogen Ende 2024
Grundsicherung im Alter.
* NRW-Quote um 1,2 Prozentpunkte höher
als der Bundesschnitt.
* In Köln und Düsseldorf bezog jeweils
mehr als jede zehnte Person über der Altersgrenze Grundsicherung.
Ende 2024 bezogen in NRW 5,3 % der über 66-Jährigen Menschen
Grundsicherung im Alter. Ein Jahr zuvor hatte ihr Anteil noch bei
5,0 % gelegen. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als
Statistisches Landesamt mitteilt, ist die Quote der Personen mit
Bezug dieser Leistung in Nordrhein-Westfalen das vierte Jahr in
Folge gestiegen.
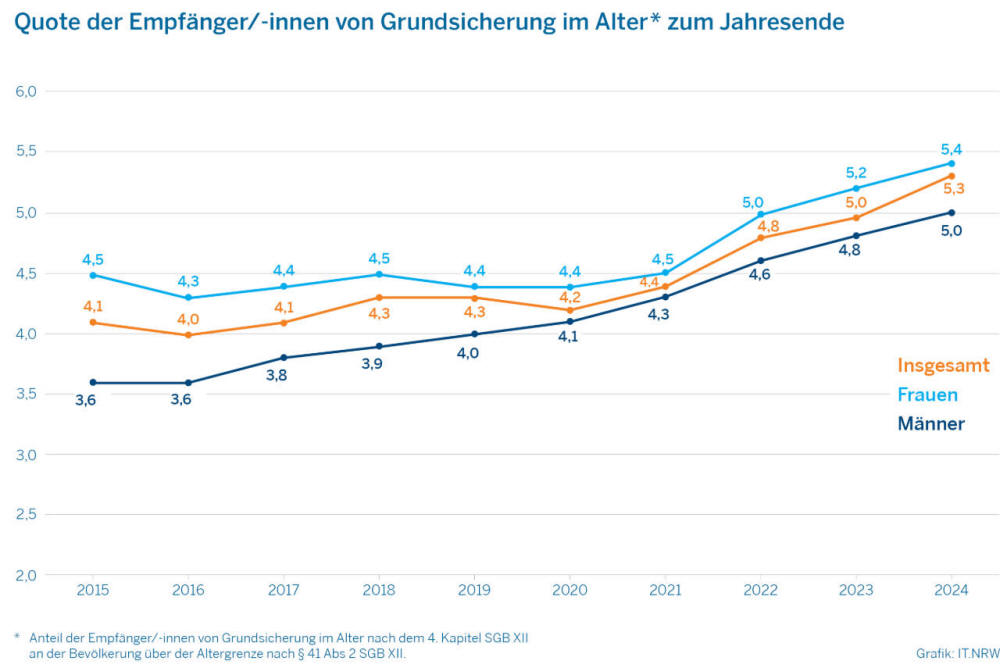
Die Quote in NRW lag um 1,2 Prozentpunkte höher als im gesamten
Bundesgebiet: Ende 2024 bezogen bundesweit 4,1 % der über
66-Jährigen Grundsicherung im Alter. Anspruch auf diese Leistung
haben Personen, die die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 SGB XII
erreicht haben und die ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen
und Vermögen bzw. dem ihres (Ehe)Partners nicht sicherstellen
können.
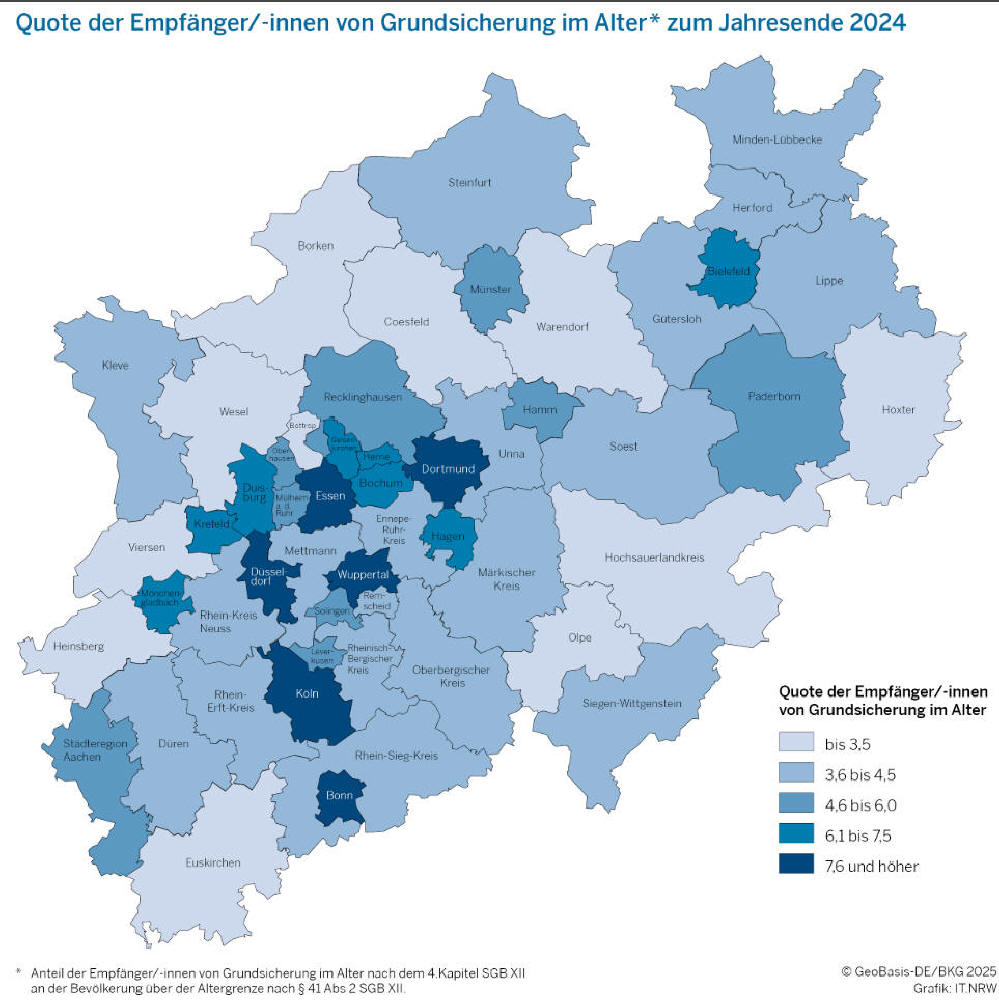
Die an dem gesetzlichen Renteneintrittsalter orientierte
Altersgrenze lag im Dezember 2024 bei 66 Jahren. Ende 2024 lag die
Zahl der Menschen in NRW die Grundsicherung im Alter erhielten bei
195.965. Bis Ende Juni 2025 stieg ihre Zahl weiter an auf insgesamt
199.020 Empfängerinnen und Empfänger.
Frauen beziehen
häufiger Grundsicherung im Alter als Männer
Über 66-jährige
Frauen bezogen Ende 2024 zu 5,4 % Grundsicherung im Alter. Bei den
Männern fiel die Quote mit 5,0 %, wie schon in den Vorjahren,
niedriger aus. Während die Quote bei den Männern jedoch in den
letzten zehn Jahren kontinuierlich gestiegen ist, stagnierte sie bei
den Frauen von 2015 bis 2021 auf einem Niveau von 4,3 % bis 4,5 %.
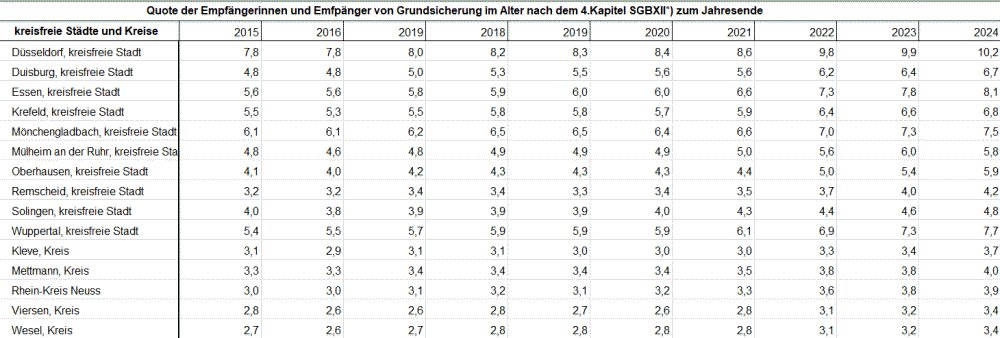
Nachdem ab Juni 2022 geflüchtete Menschen aus der Ukraine im
entsprechenden Alter bei Bedarf Leistungen der Grundsicherung im
Alter beantragen konnten, stieg die Quote auch bei den Frauen weiter
an. Ende 2024 lag die Zahl der Ukrainerinnen und Ukrainer mit Bezug
von Grundsicherung im Alter bei 21.600 Personen und damit 3,9-mal
höher als Ende 2021.
Höchste Quoten in den Großstädten Köln
und Düsseldorf
Am höchsten waren die Quoten der Empfängerinnen
und Empfänger von Grundsicherung im Alter in den Großstädten Köln
und Düsseldorf. Ende 2024 erhielt hier mit einem Anteil von 10,3 %
bzw. 10,2 % mehr als jede zehnte Person über der Altersgrenze
Grundsicherungsleistungen.
Im Kreis Olpe und im Kreis Höxter
bezogen anteilig die wenigsten älteren Menschen Grundsicherung im
Alter: Hier lagen die Quoten bei 2,5 % bzw. 2,8 %. Daten der
Abbildung
https://www.it.nrw/system/files/media/document/file/324k_25.xlsx
XLSX, 103,39 KB Überdurchschnittlich hohe Quoten finden sich vor
allem im städtischen Raum, wo bei angespannten Wohnungsmärkten oft
vergleichsweise hohe Wohnkosten anfallen. Dadurch reichen häufiger
die Alterseinkünfte nicht aus, um den Lebensunterhalt zu decken.