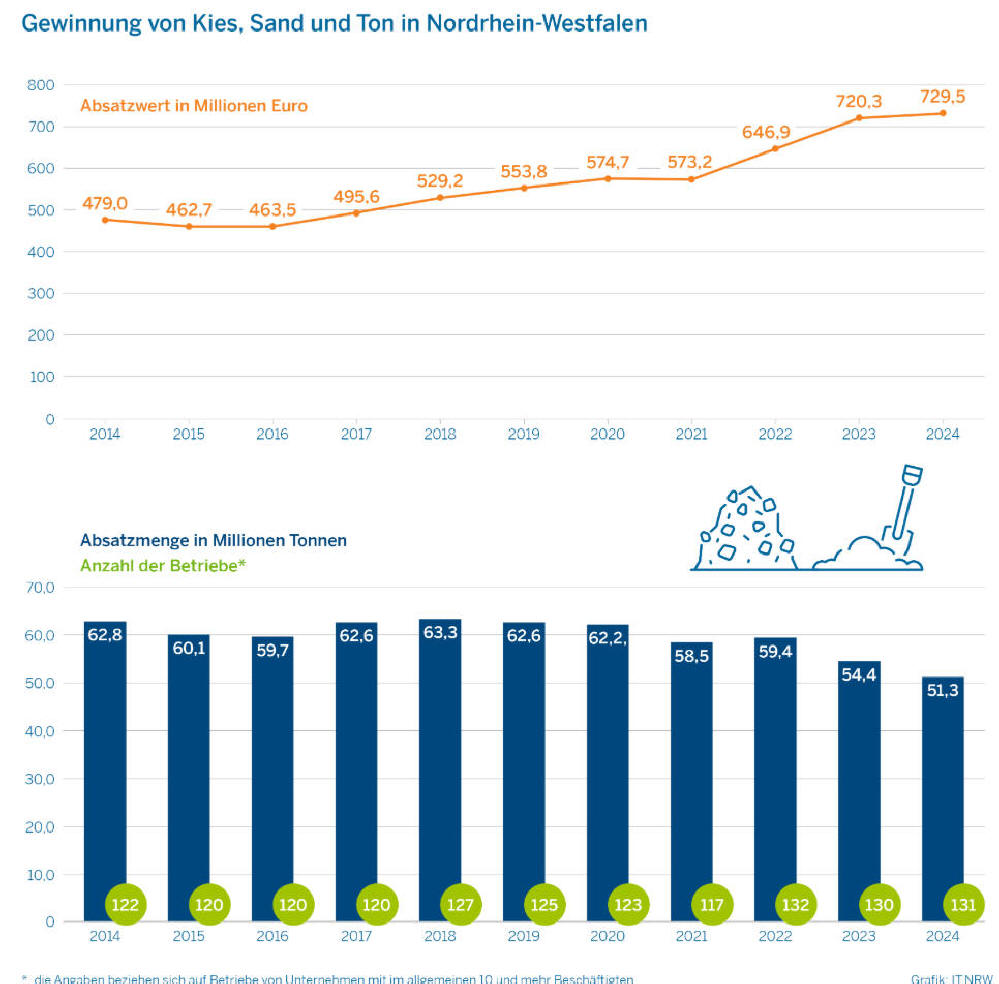|
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 20. Kalenderwoche:
12. Mai
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Dienstag, 13. Mai 2025
Bezirksregierung Düsseldorf erörtert Pläne für den Bau einer
Wasserstoffleitung zwischen Dorsten und Hamborn
Das Unternehmen Open Grid Europe hat im August 2024 bei der
Bezirksregierung Düsseldorf die Einleitung eines
Planfeststellungsverfahrens beantragt und Unterlagen für den Bau
einer Wasserstoffleitung zwischen Dorsten und Hamborn eingereicht.
Für das Bauvorhaben - die Rohrleitung selbst sowie alle
technischen Einrichtungen einschließlich der
landschaftspflegerischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - werden
Grundstücke in den Gemeinden Schermbeck und Hünxe sowie den Städten
Dinslaken, Oberhausen und Duisburg beansprucht.
Im Rahmen des
Planfeststellungsverfahrens wurden Einwendungen und Stellungnahmen
abgegeben, die nun diskutiert werden sollen. Diese Erörterung
beginnt am Dienstag, 20. Mai 2025, um 10:00 Uhr in der
Kathrin-Türks-Halle, Platz D’Agen 4, in Dinslaken. Sinn und Zweck
des Erörterungstermins ist neben der nochmals umfassenden
Information der Beteiligten über das Vorhaben die Klärung aller für
die Entscheidung erheblichen Fakten und Gesichtspunkte.
Den
Beteiligten wird Gelegenheit gegeben, sich mündlich zu äußern, ihre
bereits schriftlich eingebrachten Einwendungen und Bedenken zu
erläutern und mit dem Vorhabenträger unter Verhandlungsleitung der
Bezirksregierung Düsseldorf zu diskutieren.
Die Ergebnisse
des Termins werden in die weitere Entscheidungsfindung der
Planfeststellungsbehörde einbezogen. Im Erörterungstermin selbst
wird keine Entscheidung in der Sache getroffen. Die Erörterung wird,
wenn dies erforderlich ist, am 21. Mai 2025 ab 10:00 Uhr (Einlass ab
09:00 Uhr) an gleicher Stelle fortgesetzt.
Laar: Kinder- und Familienfest zum „Tag der
Städtebauförderung“
Auf dem Theo-Barkowski-Platz in Duisburg-Laar findet am Samstag, 17.
Mai, von 13 bis 18 Uhr ein Kinder- und Familienfest statt. Zum „Tag
der Städtebauförderung“ stellen verschiedene Ämter der Stadt
Duisburg ein buntes und kostenloses Programm für alle Familien aus
Laar und Umgebung auf die Beine.
Neben dem Spielmobil
„Schnelle Schnecke“ mit Hüpfburg, Kistenklettern und Rollenrutsche
werden das Tanzmobil von T.K.M. e.V., Stände mit Spiel- und
Bastelangeboten sowie die Polizei und Feuerwehr für gute Laune
sorgen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Zum „Tag der
Städtebauförderung“ werden den Bürgerinnen und Bürgern die Maßnahmen
präsentiert, die seit 2014 im Stadtteilprojekt Laar umgesetzt
wurden.

Dazu gehören zum Beispiel die Aufwertung etlicher Spielplätze in
Laar und die neu gestaltete Grün- und Spielfläche auf der früheren
Brache zwischen dem Pennymarkt und der Friedrich-Ebert-Straße. Eine
kleine Ausstellung auf dem Marktplatz wird diese Projekte zeigen. Um
14 und um 16 Uhr sind die Bürgerinnen und Bürger außerdem herzlich
eingeladen, die Projekte in einem geführten Stadtteilrundgang selbst
in Augenschein zu nehmen.
EU-Sondierung gestartet: Wie kann Wohnraum
erschwinglicher werden?
Die Europäische Kommission bitte um Meinungen dazu, wie Wohnraum in
Europa erschwinglicher werden kann. In Vorbereitung eines
europäischen Plans zur Bewältigung der Wohnungskrise bittet sie bis
zum 4. Juni um Beiträge von Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen,
Behörden, der Zivilgesellschaft und anderen Interessenträgern.
Auf diese erste Sondierung wird eine breite öffentliche
Konsultation zum Thema folgen; sie ist für Juni bis Oktober geplant.
Eine bessere Erschwinglichkeit von Wohnraum ist eine politische
Priorität für den ersten EU-Kommissar für Wohnungswesen, Dan
Jørgensen.
Die Europäische Kommission will das Jahr 2025
dafür nutzen, einen Dialog über erschwinglichen Wohnraum führen. Sie
geht damit ein Problem an, das Millionen von Europäerinnen und
Europäern betrifft. Bisherige Maßnahmen Im April hat die Kommission
vorgeschlagen, den Betrag der kohäsionspolitischen Mittel für
erschwinglichen Wohnraum zu verdoppeln.
Auch hat sie den
ersten Schritt hin zu einer europaweiten Investitionsplattform
eingleitet. Im Februar verabschiedete die Kommission den EU-Aktionsplan
für erschwingliche Energie mit kurzfristigen Maßnahmen zur
Senkung der Energiekosten und zur Verringerung der Energiearmut.
Parallel dazu richtet die Kommission einen Beirat zum Thema Wohnraum
ein, dessen 15 Mitglieder unabhängige politische Empfehlungen für
den Plan für erschwinglichen Wohnraum abgeben werden.
Neue Handy-App unterstützt Krebspatienten nach Klinikaufenthalt
Medizinerinnen der Universität Duisburg-Essen haben in einem
Gemeinschaftsprojekt ein hybrides Unterstützungssystem mit App und
Online-Gruppensitzungen für Menschen entwickelt, die eine
Krebsbehandlung hinter sich haben.
So sollen psychische und
körperliche Folgen einer Krebstherapie gelindert werden, zum
Beispiel Fatigue oder Depressionen. Mit der Smartphone-App können
Krebspatienten Fertigkeiten zum Umgang mit psychosozialen
Belastungen erwerben, Achtsamkeit trainieren sowie sport- und
bewegungstherapeutische Einheiten absolvieren.
Ergänzt wird
das Nachsorge-Programm durch wöchentliche Online-Gruppensitzungen,
in denen die Teilnehmer Sport treiben oder psychoonkologische
Unterstützung erhalten. Die Rekrutierung der Probanden soll im
Sommer starten. Das Vorhaben wird von der Deutschen Krebshilfe mit
rund 433.000 Euro gefördert. idr - Infos:
https://inspire.psm-essen.de
Verdacht auf Behandlungsfehler – TK-Versicherte in NRW
melden 1.687 Fälle
Eine falsche Diagnose gestellt oder
einen Tupfer im Körper vergessen: Immer wieder kommt es zu
schwerwiegenden Fehlern bei ärztlichen Behandlungen. In
Nordrhein-Westfalen (NRW) haben sich im vergangenen Jahr 1.687
Versicherte an die Techniker Krankenkasse (TK) gewandt, weil sie
eine Fehlbehandlung ihrer Ärztin oder ihres Arztes vermuteten.
Jede dritte Beschwerde in NRW richtete sich gegen eine
chirurgische Behandlung (33 Prozent), gefolgt von der
Zahnmedizin/Kieferorthopädie (14 Prozent) und der inneren Medizin (8
Prozent). Die restlichen Verdachtsfälle verteilten sich auf
Geburtshilfe und Gynäkologie (7 Prozent), Orthopädie (7 Prozent),
Pflege (5 Prozent), Allgemeinmedizin (5 Prozent), Augenheilkunde (4
Prozent) und Neurologie/Psychiatrie (3 Prozent).
Die
sonstigen Facharztgruppen kommen auf insgesamt 14 Prozent.
Gleichzeitig geht die TK davon aus, dass es noch eine hohe
Dunkelziffer an unentdeckten Behandlungsfehlern gibt. Meldepflicht
muss kommen Das Aufklären eines Verdachts auf Behandlungsfehler ist
für Betroffene häufig ein schwieriges und zeitintensives Verfahren.
Neben deutlich schnelleren Verfahren für die Entschädigung
von Patientinnen und Patienten, fordert die TK eine Meldepflicht für
Behandlungsfehler von allen medizinischen Einrichtungen. Aktuell
würden Fehler nur erfasst, wenn Patientinnen und Patienten sie
selbst meldeten. Dadurch bleiben viele Fehler unentdeckt und eine
systematische Auswertung von Fehlerquellen und Verbesserungen sei
kaum möglich.
Hilfe für Versicherte Die gesetzlichen
Krankenkassen unterstützen ihre Versicherten mit einem individuellen
Beratungsangebot. Wichtig in jedem Einzelfall: Betroffene sollten
schnellstmöglich ein Gedächtnisprotokoll des Behandlungsablaufs und
der beteiligten Ärztinnen und Ärzte bzw. Pflegerinnen und Pfleger
erstellen und sich im nächsten Schritt an ihre Krankenkasse wenden.
Erhärtet sich der Verdacht, kann die Krankenkasse beim
Medizinischen Dienst (MD) ein Gutachten in Auftrag geben.
Patientinnen und Patienten können die Gutachten für ihre eigenen
Schadensersatz-Verhandlungen mit der Ärztin oder dem Arzt, dem
Krankenhaus, der zuständigen Haftpflichtversicherung oder vor
Gericht nutzen, sofern sie diesen Weg beschreiten möchten.
Steffens: Datenschutz behindert teilweise bessere Aufklärung
"Theoretisch könnten Krankenkassen anhand von Datenanalysen mögliche
Behandlungsfehler erkennen und ihre Versicherten darüber
informieren. Derzeit dürfen wir aber, selbst wenn wir klare
Anhaltspunkte für einen Behandlungsfehler haben, die Betroffenen
nicht kontaktieren und sie darauf hinweisen", kritisiert Barbara
Steffens, Leiterin der TK-Landesvertretung NRW, die strengen
Datenschutzauflagen.
Kindersprechstunde mit Oberbürgermeister Sören Link
Wie differenziert Kinder das Stadtleben wahrnehmen, hat
Oberbürgermeister Sören Link bei seiner ersten Kindersprechstunde im
vergangenen Jahr erlebt. Dieser Austausch auf Augenhöhe war ein
Gewinn für Duisburg, sodass auch jetzt wieder junge Duisburgerinnen
und Duisburgern im Alter von sechs bis 13 Jahren zu Wort kommen
sollen: Am Dienstag, 27. Mai, erhalten Kinder die nächste
Möglichkeit, ihre Perspektiven einzubringen.

Die letzte Spechstunde im
November 2024 - Fotos Tanja Pickartz / Stadt
Duisburg
„Ich freue mich auf die
jungen Gäste im Rathaus. Bereits in meiner ersten Kindersprechstunde
habe ich gemerkt, dass die Ideen und Meinungen von Kindern uns alle
weiterbringen können“, sagt Oberbürgermeister Sören Link. „Kinder
geben unserer Stadt ein Gesicht und werden unsere Zukunft in
Duisburg maßgeblich gestalten. Deshalb ist mir der direkte Austausch
mit ihnen wichtig.“
Für die Kindersprechstunde am Dienstag,
27. Mai, in der Zeit von 14:30 bis 16:30 Uhr, können Eltern ihre
Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren anmelden: Termine
können bis zum 13. Mai per E-Mail unter
kindersprechstunde@stadt-duisburg.de oder auch telefonisch unter
(0203) 283-6111 angefragt werden.
Die Kindersprechstunde
wird in einem der Sitzungsräume des Duisburger Rathauses, Burgplatz
19, ohne Beteiligung der Eltern stattfinden. Die Kinder haben dann
die Möglichkeit, Oberbürgermeister Sören Link in offener Runde
Fragen zu stellen, zu erzählen, was ihnen gefällt oder nicht
gefällt, und können Vorschläge machen, was in Duisburg noch besser
gestaltet werden kann.
Verleihung der Ehrennadel des Bezirks Hamborn für
besonderes ehrenamtliches Engagement
Bezirksbürgermeisterin Martina Hermann verleiht am Dienstag, 13. Mai
2025, um 16.30 Uhr in der Bezirksverwaltung, Duisburger Str. 213,
47166 Duisburg, die die Ehrennadel des
Bezirks Hamborn für besonderes ehrenamtliches Engagement. Im Beisein
von Oberbürgermeister Sören Link werden Gabriele Haak für ihr
bürgerschaftliches kirchliches Engagement und Jörg Weißmann für sein
Verdienste in der Brauchtumspflege und im Heimatverein mit der
Auszeichnung geehrt.
IGBCE NRW: „Wir bleiben Schutz und Schild für die
Beschäftigten“
Im Rahmen ihrer Delegiertenkonferenzen
unter dem Motto „IGBCE: Zugkräftig – Weitsichtig – Zukunftsfähig“ am
9. und 10. Mai stellten sich die Landesbezirke Nordrhein und
Westfalen politisch für die kommenden vier Jahre auf. Die
Besonderheit bei dieser Konferenz: Es ist die letzte Konferenz, die
beide Landesbezirke formal getrennt abhalten.
Am 1.1.2026
werden die beiden Landesbezirke fusionieren. „In der Herzkammer der
IGBCE führen wir zwei erfolgreiche Landesverbände zu neuer Größe und
Stärke zusammen. Mit Blick auf die Herausforderungen in der größten
Chemieregion Europas stärken wir unsere Strukturen, konzentrieren
unsere Fähigkeiten und bauen unser Kompetenznetzwerk weiter aus.
Auch die gute Kooperation mit der Landesregierung wird so noch
einmal intensiviert“, erklärt Michael Vassiliadis, der Vorsitzende
der IGBCE.

Gruppenfoto der Konferenzdelegierten der IGBCE in
Nordrhein-Westfalen Fotograf: Stephen Petrat / IGBCE
Wie sich
die IGBCE in Nordrhein-Westfalen aufstellt, wird in den
demokratischen Gremien weiterdiskutiert. „Wir werden unsere Kräfte
in Nordrhein-Westfalen bündeln, um noch schlagkräftiger und
durchsetzungsfähiger zu werden. Wir verbinden unsere tief
verwurzelte Tradition mit modernen Arbeitsmethoden für eine gute und
positive Zukunft. Hierbei erproben wir völlig neue Formen der
Gewerkschaftsarbeit, die wir eng mit unseren Funktionären
erarbeiten“, so Thomas Meiers, Landesbezirksleiter der IGBCE
Westfalen.
Selbstverständlich spielte auch die Lage in der
Industrie eine herausragende Rolle auf den Konferenzen. „Es ist gut,
dass die Regierung jetzt steht. Sie muss jetzt klare Prioritäten
setzen. Die Wirtschaft muss zurück in die Wachstumsspur und
Arbeitsplätze in der Industrie müssen gesichert werden.
Energiepreise runter, Transformation mit Vernunft und Investitionen
in die Infrastruktur des Landes NRW. Die Zeit drängt, die Konzepte
dafür liegen auf dem Tisch, sie müssen jetzt konsequent umgesetzt
werden“, so der IGBCE-Vorsitzende Vassiliadis.
In seinem
Grußwort machte Ministerpräsident Hendrik Wüst deutlich, dass nun
schnell gehandelt werden müsse. „Wir in Nordrhein-Westfalen glauben
an die Stärke und das Potenzial unseres Wirtschaftsstandorts. Wir
haben alle Chancen für ein neues, solides Wirtschaftswachstum. Die
Industrie bleibt dabei unser Wohlstandsmotor. Damit das so bleibt,
ist jetzt die Zeit, entschlossen zu handeln.
Der
Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung bietet eine solide
Grundlage, um genau das zu tun: eine Vereinbarung der Vernunft in
einer Zeit weltweiter Unvernunft. Mit der Chemieagenda 2045 schlägt
der Bund ein neues Kapitel für die Industrie auf, das Arbeitsplätze
sichert, Innovation fördert und Nordrhein-Westfalen und ganz
Deutschland zurück auf die Erfolgsspur bringt. Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen wird gemeinsam mit unseren Partnern – den
Gewerkschaften und Unternehmen – den Bund bei der Umsetzung eng
begleiten“, so Wüst.
Von der Industriekrise ist vor allem
Nordrhein-Westfalen mit vielen energieintensiven Betrieben
betroffen. Ziel der IGBCE ist es weiterhin, Probleme abzuwenden
bevor sie bei der Belegschaft spürbar werden. „In
Nordrhein-Westfalen trifft uns die anhaltende Strukturkrise
besonders hart. Wir werden vor allem in dieser Situation weiterhin
Schutz und Schild für die Beschäftigten in unseren Branchen bleiben
– nicht nur mit guter Tarifpolitik, sondern auch mit effektivem
Schutz von Beschäftigung und dem politischen Einsatz für
Industriearbeitsplätze. Hierzu haben wir eine Reihe von Anträgen auf
den Konferenzen erarbeitet und beschlossen, die uns fokussieren und
die politische Leitlinie der nächsten vier Jahre ausmachen“,
erläutert Frank Löllgen, Landesbezirksleiter der IGBCE Nordrhein
abschließend.
Hochzeitsauto im Straßenverkehr: Was
ist erlaubt?
Ob mit Blumen geschmückt, von Blechdosen
begleitet oder als Teil eines Autokorsos – das Hochzeitsauto im
beliebten Hochzeitsmonat Mai ist bei vielen Trauungen ein echter
Blickfang und wird oft kreativ dekoriert. Doch sobald es am
öffentlichen Straßenverkehr teilnimmt, gelten die Vorschriften der
Straßenverkehrsordnung (StVO). Der ACV Automobil-Club Verkehr
beantwortet sieben häufige Fragen zu erlaubter Dekoration, hupenden
Konvois und besonderen Fahrzeugtypen.

Hochzeitsauto mit
'Just Married'-Schriftzug und traditionellem Autoschmuck aus
Blechdosen/GettyImages
1. Was ist bei Fahrzeugdekoration zu
beachten?
Grundsätzlich dürfen Autos geschmückt werden – wenn
bestimmte Bedingungen erfüllt sind: Der Schmuck muss sicher
befestigt sein
Rechtlich zählt der Autoschmuck als Ladung und
fällt damit unter die Vorschriften zur Ladungssicherung gemäß § 22
StVO. Dabei muss er so befestigt sein, dass er sich auch bei höheren
Geschwindigkeiten, einer Vollbremsung oder einem Ausweichmanöver
nicht löst, verrutscht oder herabfällt.
Wer den Schmuck
unsachgemäß befestigt, riskiert nicht nur Bußgelder, sondern bei
Gefährdung oder Unfall auch Punkte in Flensburg. Zudem kann die
Kfz-Versicherung im Schadensfall die Leistung verweigern, wenn die
Dekoration nicht ausreichend gesichert war. Verursacht herabfallende
Dekoration einen Unfall, haftet der Fahrzeughalter unter Umständen
auch zivilrechtlich – unabhängig vom Verschulden.
Kennzeichen
und Lichter müssen sichtbar bleiben
Laut § 23 Abs. 1 Satz 3 StVO
müssen Nummernschild und Leuchten jederzeit gut sichtbar und
funktionsfähig bleiben. Ein „Just Married“-Schild oder andere
Dekorationen dürfen daher weder das Kennzeichen noch die Beleuchtung
verdecken oder deren Funktion beeinträchtigen.
Die Sicht des
Fahrers darf nicht eingeschränkt werden
Bewegt sich der
Autoschmuck während der Fahrt so, dass er die Sicht des Fahrers
beeinträchtigt, liegt ein Verstoß gegen § 23 Abs. 1 Satz 1 StVO vor.
Es ist darauf zu achten, dass weder Blumenschmuck auf der Motorhaube
noch hängende Elemente Windschutzscheibe oder Spiegel verdecken.
2. Benötigt außergewöhnlicher Autoschmuck eine Genehmigung?
Fällt der Autoschmuck besonders üppig aus – etwa durch große
Blumengestecke, breite Schleifen, Luftballons oder andere Aufbauten
– und ragt dabei über die üblichen Fahrzeugmaße hinaus, kann eine
Sondergenehmigung nach § 46 Abs. 1 Nr. 5 StVO erforderlich sein.
Maßgeblich ist, ob Sicht oder Sicherheit beeinträchtigt werden
könnten. Man sollte die Genehmigung in diesen Fällen frühzeitig bei
der örtlichen Straßenverkehrsbehörde beantragen.
Grundsätzlich gilt:
Vorne darf die Dekoration nicht über die
äußersten Fahrzeugbegrenzungen hinausragen.
Nach hinten sind
Überstände bis 1,50 m erlaubt, bei Fahrten unter 100 km/h sogar bis
zu 3 m.
Sobald die Dekoration mehr als 1 m übersteht, muss sie
laut § 22 Abs. 4 StVO mit einer roten Fahne (mindestens 30 × 30 cm)
gekennzeichnet werden.
Liegt keine Genehmigung vor, obwohl
sie im Einzelfall erforderlich gewesen wäre, handelt es sich
grundsätzlich um eine Ordnungswidrigkeit. Geht vom Fahrzeug samt
Dekoration jedoch keine konkrete Gefährdung aus, kann die zuständige
Behörde im Rahmen des sogenannten Opportunitätsprinzips – also ihres
Ermessens – von einem Bußgeld absehen. Davon sollte man jedoch nicht
ausgehen – eine rechtzeitige Prüfung oder Beantragung einer
Genehmigung bleibt in jedem Fall empfohlen.
3. Welche
Vorschriften gelten für besondere Hochzeitsfahrzeuge?
Nicht nur
der Autoschmuck, auch das Hochzeitsfahrzeug muss bestimmte
Vorschriften erfüllen. Ob Oldtimer, Stretchlimousine, Kutsche oder
Traktor – sobald es im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs ist,
gelten die Regeln der Straßenverkehrsordnung (StVO). Je nach
Fahrzeugtyp gelten unterschiedliche Anforderungen, etwa zu
Führerschein, Zulassung, Versicherung oder Sondergenehmigung:
Oldtimer
Für private Hochzeitsfahrten ist die Nutzung eines
Oldtimers in der Regel unproblematisch, solange das Fahrzeug
zugelassen und versichert ist. Vermietet ein Anbieter das Fahrzeug
samt Fahrer gewerblich, gelten zusätzliche Anforderungen – etwa eine
Personenbeförderungsgenehmigung und ein erweiterter
Versicherungsschutz. Auch bei privaten Fahrten empfiehlt es sich, im
Zweifel die Versicherungsunterlagen zu prüfen oder eine schriftliche
Bestätigung vom Anbieter einzuholen.
Stretchlimousine
Für
Limousinen mit einer Länge von über acht Metern, die zur
Personenbeförderung genutzt werden, ist ein Führerschein der Klasse
D1 oder D erforderlich. Wird die Limousine samt Fahrer gebucht,
sollte geprüft werden, ob das Unternehmen gewerblich zugelassen ist
und den passenden Versicherungsschutz besitzt. Bei rein privaten
Fahrten ohne Vermietung reicht meist der normale Pkw-Führerschein
(Klasse B) aus.
Pferdekutsche
Für Fahrten mit der
Pferdekutsche im Straßenverkehr sollte ein Kutschenführerschein – A
für private, B für gewerbliche Nutzung – vorliegen. Zudem ist eine
Haftpflichtversicherung erforderlich. Wer eine Kutsche samt Fahrer
bucht, sollte auf entsprechende Zulassung und Versicherung achten.
Traktor
Für Hochzeitsfahrten mit einem Traktor ist ein
Führerschein der Klasse L oder T erforderlich. Traktoren dürfen
grundsätzlich auf öffentlichen Straßen fahren, ausgenommen sind
jedoch Autobahnen und Kraftfahrstraßen. Auch hier ist
sicherzustellen, dass das Fahrzeug ordnungsgemäß zugelassen und
versichert ist.
4. Sind Blechdosen am Hochzeitsauto erlaubt?
Das Befestigen von Blechdosen am Hochzeitsauto ist ein
traditioneller Brauch, der einst böse Geister vertreiben sollte –
heute sorgt er vor allem für Aufmerksamkeit und Lärm. Klappernde
Dosen, die an Schnüren hinter dem Fahrzeug hergezogen werden, können
laut § 30 Abs. 1 StVO als unnötiger Lärm gelten und eine
Ordnungswidrigkeit darstellen. Zudem besteht eine potenzielle
Verkehrsgefährdung – etwa wenn sich Dosen oder Schnüre lösen und auf
die Fahrbahn geraten.
Ob ein Bußgeld verhängt wird, liegt im
Ermessen der Polizei. In der Praxis wird der Brauch vielerorts
geduldet – sofern keine konkrete Gefährdung oder erhebliche
Belästigung entsteht. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte die
Dosen nur auf einem kurzen, verkehrsarmen Abschnitt einsetzen und
anschließend wieder entfernen.
5. Wann ist Hupen erlaubt?
Wie das Klappern von Blechdosen sorgt auch ein Hupkonzert im
Hochzeitskonvoi oft für Aufmerksamkeit und verursacht Lärm. Laut
§ 16 Abs. 1 StVO sind Schallzeichen wie die Hupe nur in zwei Fällen
zulässig: zur Warnung bei Gefahr oder außerhalb geschlossener
Ortschaften zur Ankündigung eines Überholvorgangs.
Ein
gemeinschaftliches Hupen aus Freude ist daher nicht erlaubt und kann
als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld geahndet werden. In der
Praxis wird ein kurzes Hupen nach der Trauung jedoch vielerorts
geduldet – solange niemand belästigt oder gefährdet wird. Wer auf
Nummer sicher gehen möchte, sollte es bei einem kurzen Signal
belassen.
6. Ist ein Hochzeitskorso überhaupt erlaubt?
Ein
Hochzeitskorso ist straßenverkehrsrechtlich nicht gesondert geregelt
und grundsätzlich zulässig – sofern keine Gefährdung oder
Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer erfolgt. Entscheidend ist das
Verhalten der Beteiligten: Wer andere behindert oder gefährdet,
begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld geahndet
werden kann. Damit es nicht zu Problemen kommt, sollten sich alle
Fahrzeuge rücksichtsvoll in den Verkehr einfügen, genügend Abstand
halten und die Verkehrsregeln beachten.
Wichtig zu wissen:
Ein Hochzeitskorso sollte nicht wie ein geschlossener Verband (§ 27
StVO) wirken – etwa durch enge Blockbildung oder gemeinsames
Überfahren roter Ampeln. Für solche Fahrten ist eine Genehmigung
erforderlich, ohne sie droht ein Bußgeld.
7. Welche Bußgelder
drohen bei Hochzeitsfahrten?
Bei Hochzeitsfahrten können
verschiedene Verstöße mit Bußgeldern geahndet werden. In zwei Fällen
drohen zusätzlich Punkte in Flensburg:
Unzureichend gesicherter
Schmuck mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer: 60 EUR, 1 Punkt
Unzureichend gesicherter Schmuck mit Unfallfolge: 75 EUR, 1 Punkt
Eine Übersicht möglicher Verstöße und Bußgelder stellt der ACV im
Ratgeber-Bereich seiner Website bereit.
Mit Herz und
Kompetenz – Medizin im Revier hautnah erleben
Tag der offenen Tür
im Evangelischen Klinikum Niederrhein am 24. Mai 2025
Wie fühlt es sich an, mit einem OP-Roboter zu operieren? Was verrät
ein Überraschungsei unter dem Röntgengerät? Und wie kommt eigentlich
der Rettungshubschrauber aufs Klinikdach?
Am Samstag, den
24. Mai 2025, öffnet das Evangelische Klinikum Niederrhein am
Fahrner Standort seine Türen für alle, die neugierig auf moderne
Medizin und engagierte Pflege sind. Von 12 bis 18 Uhr verwandeln
sich Klinik und Gelände in eine Erlebniswelt für Groß und Klein rund
um moderne Medizin, Pflege und Gesundheit.
Rund ein halbes
Jahr ist seit dem Umzug des Herzzentrums Duisburg auf das Gelände
des Evangelischen Krankenhauses Duisburg-Nord vergangen. Zeit genug,
um zusammenzuwachsen und dies nun gemeinsam mit der Bevölkerung zu
feiern. Der Tag der offenen Tür bietet dazu die ideale Gelegenheit,
um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Der Eintritt ist frei.
Erleben, entdecken, mitmachen
An zahlreichen Mitmachstationen
können die Besucherinnen und Besucher selbst aktiv werden:
Reanimation üben, OP-Roboter testen, Gummibärchen laparoskopieren
oder Überraschungseier röntgen. Für zusätzliches Staunen sorgen
begehbare Organmodelle und kleine „Operationen“ an Kokosnüssen. Dazu
vermitteln Expertinnen und Experten des Klinikverbundes in kompakten
Kurzvorträgen medizinisches Wissen aus erster Hand. Außerdem stehen
exklusive Führungen durch das neue Herzkatheterlabor auf dem
Programm.
Ein besonderes Highlight erwartet die Besucherinnen
und Besucher auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes: Hier kann der
Rettungshubschrauber Christoph 9 aus nächster Nähe besichtigt
werden. Die Führungen zum Hubschrauberlandeplatz finden um 14.15
Uhr, 14.45 Uhr, 15.15 Uhr und 15.45 Uhr statt. Da die Teilnehmerzahl
begrenzt ist, wird um Anmeldung per E-Mail an
veranstaltungen@evkln.de bis zum 21. Mai 2025 gebeten. Bitte geben
Sie dabei Ihre Kontaktdaten und die gewünschte Uhrzeit an.
Kostenlose Gesundheitsangebote
Im Rahmen des Aktionstages bietet
das Klinikum kostenlose Checks für Blutdruck, Blutzucker und
Lungenfunktion an. Darüber hinaus stehen Pflegekräfte,
Selbsthilfegruppen, Krankenkassen und das Deutsche Rote Kreuz für
persönliche Gespräche und Beratungen zur Verfügung. Auch der Infobus
der Initiative „Herzenssache Lebenszeit“ wird vor Ort sein.
Karrierechancen im Gesundheitswesen
Wer sich für eine berufliche
Zukunft im Gesundheitswesen interessiert, kann sich am Tag der
offenen Tür direkt über Ausbildung, Quereinstieg oder Weiterbildung
im Klinikverbund informieren. Auch die Feuerwehr Duisburg ist mit
dabei und informiert über die Akademie für Notfallmedizin und
Rettungswesen und die Ausbildung zum Notfallsanitäter.
Spaß
und Genuss für Klein und Groß
Während die Großen entdecken und
ausprobieren, kommen auch die Kleinen auf ihre Kosten: Im
Teddybärkrankenhaus werden Kuscheltiere liebevoll „verarztet“.
Hüpfburg, Kinderschminken, Glücksrad und ein echtes
Feuerwehrfahrzeug laden zum Spielen und Staunen ein. EVA, das neue
Maskottchen des Klinikums, sorgt als knuffiger Fotopartner für gute
Laune. Foodtruck, Grillstation und Getränkestand bieten Stärkung für
zwischendurch. Und ein DJ sorgt den ganzen Tag über für entspannte
musikalische Begleitung.

Foto EVKLN.
Eckdaten der Veranstaltung:
Titel: Mit Herz und
Kompetenz – Medizin im Revier hautnah erleben. Tag der offenen Tür
im Evangelischen Klinikum Niederrhein
Datum: Samstag, 24. Mai
2025
Uhrzeit: 12.00 bis 18.00 Uhr
Adresse: Fahrner Straße 133,
47169 Duisburg
Eintritt ist frei.
Das komplette Programm gibt
es online auf https://www.evkln.de/aktionstag.html
VHS: Führung durch das Museum St. Laurentius in der
Eisenbahnsiedlung Friemersheim
Die Volkshochschule bietet am Dienstag, 13. Mai, um 16 Uhr im Museum
St. Laurentius auf der Martinistraße 7 in Friemersheim eine Führung
durch die Dauerausstellung und die Wechselausstellung an. Zu sehen
sind frühe bildnerische Werke des Mülheimer Künstlers Heinrich
Siepmann sowie die Werke von Sándor Szombati, der in seinen Objekten
Klang, Gravitation und Magnetismus zum künstlerischen Ausdruckmittel
machte.
Die Teilnahme an der Führung kostet zehn Euro. Eine
vorherige Anmeldung ist notwendig und kann über die Homepage der VHS
unter www.vhsduisburg.de oder in den Geschäftsstellen der VHS
telefonisch unter (0203) 283-8475 oder per E-Mail an
vhs-west@stadt-duisburg.de erfolgen.
Dr. Manfred Lütz referiert übers Glücklichsein
„Wie Sie unvermeidlich glücklich werden“ – darüber
spricht der Kölner Psychiater, Psychotherapeut, Theologe und
Bestsellerautor Dr. Manfred Lütz in Duisburg: Am Dienstag, 13. Mai,
wird er in der Kulturkirche Liebfrauen referieren. Seine Thesen hat
er in seinem Buch „Wie Sie unvermeidlich glücklich werden“ bereits
ausführlich verarbeitet.

(C) Manfred Lütz
Das Publikum erwartet ein amüsanter, aber
auch nachdenklicher und kabarettistischer Abend. Der Eintritt zu
dieser Veranstaltung der VHS in Zusammenarbeit mit dem
Seniorenbeirat der Stadt Duisburg ist frei, eine vorherige Anmeldung
ist erforderlich:
https://www.vhs-duisburg.de/kurssuche/kurs/Wie-Sie-unvermeidlichgluecklich-werden/251SZ1126
Wir wollen Frieden - Evangelische und katholische Frauen
laden zum 24. gemeinsamen Gottesdienst
Um „Wir wollen
Frieden!“ als Forderung und Thema, das Nachdenklichkeit hervorruft,
geht es im Frauengottesdienst am 2. Juni um 18 Uhr in der Duisburger
Salvatorkirche neben dem Rathaus. Und mit dieser besonderen Ausgabe
geht das erfolgreiche ökumenische Gottesdienstformat von Frauen für
Frauen aus Duisburg und Umgebung bereits ins 24. Jahr.
Ins
Leben gerufen hatten es Engagierte der Evangelischen Frauenhilfen
und der kfd-Gruppen in Duisburg. Jährlich feiern sie diesen
Gottesdienst, der von einem festen Team aus evangelischen und
katholischen Frauen in Duisburg vorbereitet wird und im Anschluss
immer gemütlich ausklingt.

Salvatorkirche (Foto: Rolf Schotsch)

NRW: Rund ein Fünftel weniger Todesfälle durch
Schlaganfall als vor zehn Jahren
Im Jahr 2023 gab es in
Nordrhein-Westfalen 3,8 % weniger Todesfälle durch einen
Schlaganfall und dessen Folgen als ein Jahr zuvor. Im Vergleich zu
2013 lag der Rückgang sogar bei 17,9 %. Wie das Statistische
Landesamt anlässlich des Tages gegen den Schlaganfall am 10. Mai
2025 mitteilt, waren 9.958 Personen im Jahr 2023 an Schlaganfällen
oder deren Folgen gestorben.
Mit 55,5 % war etwas mehr als
die Hälfte der Gestorbenen Frauen (4.435 Männer und 5.523 Frauen).
Auch der Anteil der Sterbefälle durch einen Schlaganfall an allen
Gestorbenen hat sich in den vergangenen Jahren weiterhin verringert:
Im Jahr 2013 wurde in NRW noch bei 6,1 % der Todesfälle ein
Schlaganfall als Todesursache festgestellt; im Jahr 2023 lag dieser
Anteil wie auch schon im Jahr 2022 bei 4,4 %.

Zwei Drittel der an Schlaganfällen gestorbenen Menschen waren 80
Jahre oder älter Schlaganfälle mit Todesfolge traten in
Nordrhein-Westfalen auch im Jahr 2023 häufiger bei älteren als bei
jüngeren Menschen auf. Knapp zwei Drittel bzw. 65,7 % waren 80 Jahre
oder älter und nur 5,2 % waren noch keine 60 Jahre alt.
20,1 % der an Schlaganfall gestorbenen Männer waren unter 70 Jahre
alt, bei den Frauen betrug dieser Anteil 10,3 %. Das
durchschnittliche Sterbealter der an einem Schlaganfall Gestorbenen
lag im Jahr 2023 bei 81,5 Jahren (Männer: 78,9 Jahre, Frauen:
83,6 Jahre).
Niedrigste durch Schlaganfall bedingte
Sterberate verzeichnete die Stadt Köln Die kreisfreie Stadt Köln
verzeichnete 2023 die niedrigste Sterberate mit 41 Sterbefällen
durch Schlaganfall je 100.000 Einwohner. In Remscheid und Münster
hatte es 42 und 43 Sterbefälle durch Schlaganfall je 100.000
Einwohner gegeben.

Die höchste Rate wurde mit 74 Sterbefällen je 100.000 Einwohner
für den Kreis Herford ermittelt. Es folgten Mönchengladbach und
Krefeld mit 73 und 70 schlaganfallbedingten Sterbefällen je 100.000
Einwohner. Landesweit starben 55 Personen von jeweils 100.000
Einwohnern an einem Schlaganfall oder dessen Folgen.
NRW-Industrie: Gewinnung von Kies,
Sand und Ton 2024 auf dem niedrigsten Stand seit 2014
*
Absatzmenge innerhalb eines Jahres um 5,7 % gesunken
* Nominaler
Absatzwert pro Tonne seit 2014 um mehr als 86 % gestiegen
*
Gewinnung im Regierungsbezirk Arnsberg am größten
In
Nordrhein-Westfalen sind im Jahr 2024 in 131 Betrieben des
Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von
Steinen und Erden 51,3 Millionen Tonnen Kies, Sand und Ton gewonnen
worden. Das waren 5,7 % bzw. 3,1 Millionen Tonnen weniger als im
Jahr 2023. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, war der
Absatzwert mit 729,5 Millionen Euro nominal um 9,2 Millionen Euro
(+1,3 %) höher als ein Jahr zuvor.
Niedrigster
Gewinnungsstand seit 2014
Die Gewinnung von Kies, Sand und Ton
war im letzten Jahr auf dem niedrigsten Stand seit dem Jahr 2014.
Wurden damals noch 62,8 Millionen Tonnen gewonnen, so sank die Menge
demgegenüber um 11,5 Millionen Tonnen bzw. 18,3 %, während der
Absatzwert nominal von 479,0 Millionen Euro um 250,5 Millionen Euro
bzw. 52,3 % stieg.
Durchschnittlicher Absatzwert seit 2014
um über 86 % gestiegen
Der durchschnittliche Absatzwert je Tonne
erhöhte sich nominal von 13,24 Euro im Jahr 2023 um 7,4 % auf
14,22 Euro im Jahr 2024. Seit 2014 stieg der Absatzwert pro Tonne
Kies, Sand und Ton um 86,3 % (damals: 7,63 Euro).
Überwiegend Rückgänge bei allen gewonnenen Erzeugnissen
Im Jahr
2024 wurden in Nordrhein-Westfalen u. a. in 57 Betrieben
12,0 Millionen Tonnen (−11,4 % gegenüber 2023) Bau- und andere
natürliche Sande (ohne metallhaltige Sande) im Wert von
109,1 Millionen Euro (−7,3 %) gewonnen. Ebenfalls 57 Betriebe
gewannen 8,7 Millionen Tonnen (−2,7 %) Bau- und anderen Kies mit
einem Absatzwert von 117,9 Millionen Euro (+2,3 %).
Des
Weiteren wurden für den Beton-, Wege- oder Bahnbau in 14 Betrieben
6,9 Millionen Tonnen (−0,5 %) gebrochener Kalkstein und Dolomit im
Wert von 85,8 Millionen Euro (+9,0 %) und in 17 Betrieben
7,0 Millionen Tonnen (−6,4 %) Brechsande und Körnungen mit einem
Absatzwert von 137,3 Millionen Euro (+4,7 %) hergestellt.
25
Betriebe produzierten 5,1 Millionen Tonnen (−5,5 %) Körnungen und
Splitt von Natursteinen (ohne Marmor) im Wert von 66,3 Millionen
Euro (+0,3 %). NRW-Betriebe erzeugten über 22 % des gesamtdeutschen
Absatzwertes an Kies, Sand, Ton und Kaolin Beinahe ein Drittel
(29,6 %) der nordrhein-westfälischen Gewinnung von Kies, Sand und
Ton erfolgte 2024 von Betrieben im Regierungsbezirk Arnsberg,
gefolgt von Betrieben in den Regierungsbezirken Düsseldorf (28,7 %),
Köln (25,2 %), Münster (9,8 %) und Detmold mit 6,7 %.
Bundesweit wurden im Jahr 2024 Kies, Sand, Ton und Kaolin im Wert
von 3,3 Milliarden Euro gewonnen. Das waren 1,6 % mehr als 2023. Der
Anteil nordrhein-westfälischer Betriebe am gesamtdeutschen
Absatzwert war mit 22,3 % nahezu unverändert (2023: 22,4 %).