






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 22. Kalenderwoche:
31. Mai
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Montag, 2. Juni 2025
USA-Reise des Bundeskanzlers
Bundeskanzler
Friedrich Merz reist in die USA. Er trifft dort am Donnerstag, den
5. Juni 2025 den Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump,
im Weißen Haus zu einem Gespräch.
Es ist der Antrittsbesuch des
Bundeskanzlers und das erste persönliche Treffen der beiden
Staatsmänner. Daher werden unter anderem die Beziehungen der beiden
Länder und internationale Themen wie der russische Angriffskrieg
gegen die Ukraine, die Lage im Nahen Osten und die Handelspolitik im
Mittelpunkt des Gesprächs stehen.
„Aktionslabor“ gegen Fake News auf Tour in
Nordrhein-Westfalen
ZEIT STIFTUNG BUCERIUS,
Brost-Stiftung und Bibliotheken fördern digitale
Nachrichtenkompetenz für Erwachsene quasi „nebenbei“
Eine Art
Bällebad für Erwachsene: Interaktives Labor mit VR-Brille, Games und
Bonbons tourt durchs Ruhrgebiet in Duisburg, Gladbeck, Bottrop,
Dortmund und Essen; Stationen auch in Düsseldorf und Köln.
Viele Menschen fühlen sich im digitalen Raum und von der
Informationsflut überfordert. Gerade in Zeiten, in denen
Desinformation, Fake News und KI-generierte Bilder unser
Einschätzungsvermögen herausfordern, ist digitale Medien- und
Nachrichtenkompetenz besonders wichtig. Dies gilt umso mehr, um
informiert verantwortungsvolle Entscheidungen etwa bei Wahlen
treffen zu können.
Genau hier setzt das interaktive
„Aktionslabor“ der ZEIT STIFTUNG BUCERIUS an, das Besuchenden mit
VR-Station und digitalen Spielen einen völlig neuen Zugang zu
Nachrichten- und Informationsfragen bietet. Das Labor macht aus
Nachrichten-Theorie „Praxis zum Anfassen“ und steht niedrigschwellig
und unterhaltsam genau da zum aktiven Austesten, Informieren und
praktischen Erfahren zur Verfügung, wo sich Bürger:innen im
öffentlichen Raum aufhalten.
Hier sind unter anderem die
Bibliotheken/ Büchereien ein zentraler Ort. Dort können mit dem
multimedialen Konzept alle Interessierten quasi „nebenbei“ ihr
Nachrichten-Wissen und ihre digitalen Fähigkeiten testen und
spielerisch stärken. Kostenlos. Vorkenntnisse sind nicht
erforderlich. Und was „Süßes“ ist auch dabei…
Gefördert durch
die Essener Brost-Stiftung tourt das Aktionslabor derzeit durch
Nordrhein-Westfalen. Den Schwerpunkt bilden Stationen im Ruhrgebiet,
aber auch im Rheinland gastieren die mobilen Labor-Module: Nach dem
Start in Bochum (Langendreer, Gerthe und Zentralbibliothek),
Hattingen und Düsseldorf ist das Aktionslabor aktuell in Duisburg
(Zentralbibliothek Duisburg). Anschließend geht es weiter nach
Gladbeck, Bottrop, Mülheim an der Ruhr,Dortmund und Essen. Weitere
Stationen sind parallel in Köln geplant.
Stationen des
Aktionslabors u.a.:
aktuell – 18. Juni 2025: Zentralbibliothek
Duisburg
Adresse: Stadtfenster Steinsche Gasse 26, 47051 Duisburg
ZEIT STIFTUNG BUCERIUS
Die gemeinnützige ZEIT STIFTUNG
BUCERIUS mit Sitz in Hamburg ist Förderin einer offenen, aktiven
Zivilgesellschaft und schaut dort hin, wo es Spannungen oder
Umbrüche gibt. Ob in Wissenschaft, Kultur, Bildung, Politik,
Gesellschaft oder Medien – in über 400 Förderprojekten und eigenen
Initiativen verteidigt die Stiftung seit 1971 Freiheiten, schafft
Freiräume und gibt Orientierung, wo sie gebraucht wird.
So
befähigt sie Menschen, Mitstreitende für eine offene Gesellschaft zu
werden, ganz im Sinne des Stifterehepaares Gerd und Ebelin Bucerius.
Die Stärkung von Nachrichtenkompetenz und damit von aktiver Teilhabe
an Demokratie steht im Fokus der Förderarbeit – damals wie aktuell.
Brost-Stiftung
Die Brost-Stiftung mit Sitz in Essen wurde
2011 in Erfüllung des testamentarischen Willens von Anneliese Brost
gegründet. Für ihr soziales Engagement wurde sie noch zu Lebzeiten
mehrfach ausgezeichnet. Nach ihrem Willen fördert die Brost-Stiftung
heute Projekte mit Schwerpunkt in den Bereichen Kunst und Kultur,
Jugend- und Altenhilfe, Volks- und Berufsbildung, öffentliches
Gesundheitswesen und öffentliche Gesundheitspflege, Wohlfahrtspflege
sowie mildtätige Zwecke.
Der Fokus liegt dabei auf dem
Ruhrgebiet, der Heimat von Anneliese Brost, dessen Identität
gestärkt werden soll. Ziel der Stiftung ist, durch Kooperation das
Miteinander und die anpackende Selbsthilfe im Ruhrgebiet zu
unterstützen. Durch die Förderung wissensbasierter,
konzeptionsstarker und zukunftsweisender Projekte, soll eine Wirkung
über das Ruhrgebiet hinaus erzielt werden.
Freie
Berufe: Ausbildungszahlen gestiegen
ie Freien Berufe
verzeichnen einen Anstieg bei den neu abgeschlossenen
Ausbildungsverträgen. Besonders gefragt sind medizinische und
zahnmedizinische Ausbildungsberufe sowie die Ausbildung zum/zur
Steuerfachangestellten. BFB-Präsident Dr. Stephan Hofmeister sagt:
"Die jungen Leute wissen ganz genau: Wenn ich eine Ausbildung bei
den Freien Berufen beginne, mache ich unsere Gesellschaft
widerstandsfähiger." Dennoch bleibt die Fachkräftelücke mit 211.000
fehlenden Personen erheblich.
im April berichteten
zahlreiche Medien über einen Rückgang der neu abgeschlossenen
Ausbildungsverträge. Neue Zahlen zeigen, dass es in den Freien
Berufen, also u.a. bei Ärzten, Anwältinnen, Steuerberatern,
Zahnärztinnen und weiteren gemeinwohlorientierten Berufsgruppen,
einen gegenläufigen Trend gibt. Gute Nachrichten also für den
Wirtschaftsstandort Deutschland und den freiberuflichen Sektor, der
inzwischen mehr als sechs Millionen Beschäftigte in umfasst.
Die Freien Berufe sind der drittgrößte Ausbildungssektor.
Weiter
unten senden wir Ihnen eine einordnende Mitteilung dazu mit den
neuesten Zahlen. Das Portal MediaPioneer berichtete heute bereits
darüber.
Vor 10 Jahren in der BZ: Kita-Streik: OB
Sören Link will finanzielle Entlastung der Eltern -
'Eine Frage der Gerechtigkeit'
Angesichts des
anhaltenden Streiks im Erziehungswesen und der damit einhergehenden
Belastung für die Eltern setzt sich Oberbürgermeister Sören Link für
die finanzielle Entlastung der Eltern ein. In einem ersten Schritt
werden die Eltern nun das Essensgeld zurück bekommen.
OB
Sören Link: „Die Belastungen für die Eltern sind doch eh schon
enorm. Viele müssen für ihre Kinder nach alternativen
Unterbringungen suchen, fahren dafür weite Strecken und nehmen unter
Umständen auch Geld für alternative Betreuung in die Hand. Deshalb
wird die Stadt Duisburg die Beiträge für das Essensgeld zurück
erstatten. Bei der Erstattung der Kitagebühren sind uns dagegen im
Moment leider die Hände gebunden.
Da wir noch keinen
genehmigten Haushalt haben, wird die Kommunalaufsicht diese
freiwillige Leistung nicht zulassen. Ich werde mich aber auch hier
dafür einsetzen, dass die Eltern ihre Kitagebühren zurückbekommen –
auch wenn es dafür keinen Rechtsanspruch gibt: für mich ist das
einfach eine Frage der Gerechtigkeit.“ Die Rückerstattung des
Essensgeldes soll unbürokratisch vonstatten gehen: "Wir zahlen auch
ohne Antrag zurück. Es gilt die einfache Gleichung: Wo nichts
gegessen wird, muss auch nichts gezahlt werden."
Tipps für den Alltag - Mieter dürfen
Balkonkraftwerke installieren
Balkonkraftwerk: Mit Sonnenlicht
Portemonnaie entlasten
Balkonkraftwerke sind in Hausrat-
und Wohngebäudeversicherung eingeschlossen
In Zeiten steigender
Energiepreise und wachsendem Umweltbewusstsein suchen immer mehr
Menschen nach Möglichkeiten, ihren Strombedarf nachhaltig und
kostengünstig zu decken. Eine attraktive Lösung sind
Balkonkraftwerke, kleine Photovoltaikanlagen.
Lange Zeit
hatten Mieter keine Möglichkeit, ihre Energiekosten durch den Einbau
von Photovoltaik selbst zu reduzieren. Der Vermieter bestimmte, ob
eine Photovoltaikanlage auf das Dach kam. Seit es Balkonkraftwerke
gibt, sieht das anders aus. Mieter können sie jederzeit auf ihrem
Balkon oder ihrer Terrasse aufstellen. Die Erlaubnis ihres
Vermieters benötigen sie nicht. Nur bei Anlagen an der
Balkonaußenseite oder der Fassade befestigt werden, kann der
Vermieter mitreden.

Doch auf dem Balkon sind die Module Naturgewalten wie Sturm, Hagel
und Blitzschlag ausgesetzt. Lassen sich solche Schäden versichern?
Wie die HUK-COBURG sagt, werden diese Risiken in der
Hausratversicherung mit abgedeckt. Auch im Winter bei Eis und Schnee
können Balkonkraftwerke bedenkenlos draußen bleiben. Manche
Hausratversicherungen leisten auch, wenn das Balkonkraftwerk
gestohlen wird.
Eine andere Konstellation: Die
Minisolaranlage brennt wegen eines technischen Defekts und schädigt
einen Dritten. Solche Schäden reguliert normalerweise die
Privathaftpflichtversicherung, vorausgesetzt, dass die Anlage zu
einer selbst bewohnten Immobilie gehört. Dazu gehören nicht nur
Eigentumshäuser und -wohnungen, sondern auch Mietimmobilien. Art und
Umfang des Versicherungsschutzes können variieren: Ein persönliches
Gespräch mit dem eigenen Versicherer sorgt für Klarheit.
Doch
Balkonkraftwerke – an Außenwänden oder auf Garagendächern – sind
auch für viele Immobilienbesitzer inzwischen eine Option. Hängen sie
fest an der Außenwand, sind sie in der Wohngebäudeversicherung
mitversichert. Ausschlaggebend für den Umfang des
Versicherungsschutzes ist, welche Gefahren in der eigenen Police
versichert wurden. Am besten bespricht man auch diese Frage mit
seinem Versicherer.
Adobe InDesign: Bildungsurlaub an der Volkshochschule
Die VHS bietet einen viertägigen Kurs mit 32
Unterrichtsstunden für die Software Adobe InDesign an. Das Seminar
findet von Montag, 2. Juni, bis Donnerstag, 5. Juni, jeweils von 9
bis 16 Uhr in der VHS Duisburg-Nord, Parallelstraße 7, in Hamborn
statt. Interessierte können die Techniken zur Gestaltung von
Broschüren, Prospekten, Flyern, Plakaten oder Anzeigen vom Aufbau
einzelner Seiten bis hin zu umfangreichen Dokumenten für den Druck
oder das E-Publishing erlernen.
Sichere Windows-Kenntnisse
sind notwendig. Der Intensivkurs ist als Bildungsurlaub nach dem
ArbeitnehmerWeiterbildungsgesetz von Nordrhein-Westfalen anerkannt.
Zielgruppe sind auch Selbstständige, die eigene Werbemittel
herstellen möchten. Alle anderen Interessierten sind ebenfalls
willkommen.
Der Kurs kostet 184 Euro, Ermäßigungen sind
unter bestimmten Umständen möglich. Eine vorherige Anmeldung ist
erforderlich, die über die Homepage der VHS www.vhs-duisburg.de
erfolgen kann. Weitere Informationen gibt es bei Eva Fastabend
telefonisch unter 0203 283-4326 oder per E-Mail an
e.fastabend@stadt-duisburg.de.
TÜV-Verband Presseinfo: Sommerrodelbahnen: Fahrspaß
mit Risiken
Hohe Sicherheitsstandards und regelmäßige
Prüfungen gewährleisten hohes Schutzniveau. Eigenverantwortung der
Fahrgäste notwendig. TÜV-Verband warnt vor Unfällen durch
Leichtsinn. Was Insassen vor und während der Fahrt beachten sollten.
Sie heißen Alpine Coaster, Mountain Coaster, Trapper Slider oder
Bocksbergbob: Sommerrodelbahnen gelten als familienfreundlicher
Freizeitspaß mit Adrenalinkick. Doch auf den Bahnen kommt es immer
wieder zu Unfällen mit zum Teil schweren Verletzungen. In der Regel
sind technische Mängel selten die Ursache, sondern Fehlverhalten der
Nutzer:innen. Vor allem Auffahrunfälle sind ein Risiko.
„Fahrten in einer Sommerrodelbahn wirken harmlos, sind aber durchaus
anspruchsvoll“, sagt André Siegl, Experte für Anlagensicherheit beim
TÜV-Verband. „Häufig unterschätzen Fahrgäste die Dynamik, die ohne
Motor entstehen kann. Vermeintliche Kleinigkeiten wie zu dichtes
Auffahren, falsches Bremsen oder zu schnelle Kurvenfahrten können
auf der Strecke fatale Folgen haben.“
Zusätzlich wirken
Regen oder Nässe sich negativ auf Fahr- und Bremsverhalten aus. Je
nach Wetterlage müssen die Bahnbetreibenden die Anlage schließen,
bis sie soweit getrocknet ist, dass ein sicherer Betrieb möglich
ist. Der TÜV-Verband erklärt, woran Fahrgäste sichere Anlagen
erkennen und worauf es bei der Nutzung ankommt.
Unterschiedliche Systeme: Hohe Geschwindigkeiten auf
Schienenrodelbahnen
Bei Sommerrodelbahnen unterscheidet man zwei
Bauarten: Rinnen- oder Wannenrodelbahn und Schienenrodelbahn.
Rinnen- oder Wannenrodelbahnen bestehen aus offenen oder halboffenen
Wannen – meist aus Edelstahl, seltener aus Faserbeton oder
Kunststoff. Die Schlitten werden nicht geführt, sondern gleiten frei
in der Rinne. Das vermittelt ein intensives Fahrgefühl, birgt aber
auch Risiken.
„Bei zu hoher Geschwindigkeit besteht die
Gefahr, dass die Schlitten ins Schlingern geraten oder in Kurven
sogar aus der Bahn fliegen, selbst wenn die Kurven als Steilkurven
ausgeführt sind um den Schlitten in der Bahn zu halten“, sagt Siegl.
Gebremst wird per Handhebel: Wird der Hebel angezogen, drückt eine
Bremsklappe auf die Bahn – je nach Feingefühl genau richtig, zu
sanft oder zu heftig. „Wer abrupt abbremst oder gar mitten in der
Kurve bremst, riskiert Kontrollverlust oder einen Stillstand in der
Bahn“, erläutert Siegl. „Auffahrunfälle sind ein häufiges Problem,
da nachfolgende Fahrer nicht rechtzeitig reagieren können.“
Schienenrodelbahnen sind technisch anspruchsvoller. Die Schlitten
laufen fest auf einem zwangsgeführten Schienensystem. Ein
Herausschleudern oder Umkippen ist praktisch ausgeschlossen, sofern
die Insassen richtig angeschnallt sind. Die Schienen erlauben eine
dynamische Fahrweise mit Spitzengeschwindigkeiten bis zu 40 km/h.
Die Schattenseite: Auch hier sind Auffahrunfälle möglich,
zum Beispiel, wenn Fahrgäste unvermittelt bremsen oder den
Sicherheitsabstand nicht einhalten. Moderne Bahnen verfügen über
automatische Bremssysteme oder Überwachungseinrichtungen, um solche
Kollisionen zu verhindern. An den meisten Fahrstrecken sind gut
sichtbare Hinweisschilder, wie z. B. „Langsam Fahren“ oder „Bremsen“
angebracht, doch ein sicheres Verhalten der Nutzer:innen ist dadurch
nicht garantiert.
Sicherheitsstandards und unabhängige
Prüfungen
In Deutschland unterliegen Sommerrodelbahnen hohen
sicherheitstechnischen Anforderungen. Grundlage dafür ist seit 2018
die internationale Norm DIN ISO 19202. Sie regelt detailliert
Planung, Bau, Betrieb und Prüfung – jeweils angepasst an den
jeweiligen Bahntyp. Bevor eine Bahn erstmals in Betrieb gehen darf,
ist eine sicherheitstechnische Erstprüfung durch eine unabhängige
Prüfstelle, etwa ein TÜV-Unternehmen, gesetzlich vorgeschrieben.
Danach folgen jährlich wiederkehrende Prüfungen, meist vor
Saisoneröffnung.
Die Ergebnisse werden den zuständigen
Bauaufsichts- und Genehmigungsbehörden vorgelegt. Auf ihre
Funktionalität geprüft werden unter anderem Schlitten, Bremssysteme,
Rückhalteeinrichtungen (Sicherheitsbügel und Gurte),
Not-Stopp-Vorrichtungen, Lichtschranken und Rettungswege. Die
Betreibenden sind verantwortlich für die Beauftragung der Prüfungen
und den sicheren Betrieb der Anlagen.
„Ein Blick auf die
Prüfplakette am Einstieg zeigt, ob die Bahn regelmäßig kontrolliert
wurde“, sagt Siegl. „Doch Sicherheit liegt nicht nur in der Technik,
sondern auch in der Verantwortung jedes Einzelnen. Sommerrodelbahnen
erfordern Aufmerksamkeit, Rücksicht und Disziplin – nur so wird aus
einem Abenteuer ein sicheres Erlebnis.“
Was Fahrgäste
beachten sollten
So verlockend es auch ist, sich einfach
reinzusetzen und loszudüsen – ein Blick auf Regeln und Technik kann
den Unterschied zwischen einem unbeschwerten Abenteuer und einem
missglückten Ausflug ausmachen. Damit die Fahrt mit der
Sommerrodelbahn ein sicherer Nervenkitzel bleibt, empfiehlt der
TÜV-Verband folgende Sicherheitsmaßnahmen:
Hinweisschilder
ernst nehmen und Regeln befolgen: Vor jeder Fahrt sollten Fahrgäste
die Betriebsvorschriften und Sicherheitshinweise an der Anlage
aufmerksam lesen. Besonders wichtig sind Hinweise zur richtigen
Körperhaltung, zum Bremsverhalten und zur Nutzung von
Sicherungssystemen – diese variieren je nach Bauart der jeweiligen
Bahn.
Abstand halten – besonders auf Schienenanlagen: Auf
Schienenrodelbahnen gilt ein fester Sicherheitsabstand von
mindestens 25 Metern. Wenn der vordere Schlitten plötzlich stoppt,
erhöht sich das Auffahrunfallrisiko bei zu geringem Abstand.
Geschwindigkeit kontrollieren – vor allem in Rinnen- oder
Wannenbahnen: In Rinnen- oder Wannenrodelbahnen müssen die Fahrgäste
ihre Geschwindigkeit selbst steuern, da die Schlitten meist keine
automatische Begrenzung haben. Daher müssen Fahrende besonders in
Kurven und bei starkem Gefälle auf ihr Bremsverhalten achten.
Richtig sitzen und sichern: Bei Schienenrodelbahnen sind oft
Anschnallgurte vorgeschrieben, Rinnen- oder Wannenanlagen sind meist
mit Haltebügeln, manchmal zusätzlich noch mit Gurten ausgerüstet. In
beiden Fällen gilt: Rückhaltesysteme nutzen, ruhig sitzen bleiben,
Füße nicht aus dem Schlitten strecken und keinesfalls während der
Fahrt filmen.
Kinder altersgerecht begleiten: Achten Sie auf
die Alters- und Größenbeschränkungen der jeweiligen Bahn. Viele
Anlagen erlauben es Kindern bis sieben Jahren, nur in Begleitung
eines Erwachsenen zu fahren. Ab acht Jahren dürfen Kinder in der
Regel alleine fahren – aber nur, wenn sie zuvor gut eingewiesen
wurden, insbesondere zum richtigen Bremsen und Verhalten bei
Störungen.
Alkohol- und Drogenkonsum verboten: Alkohol- und
Drogen sowie in einigen Fällen auch Medikamente können geistige und
körperliche Koordination, Reaktionsfähigkeit und Urteilsvermögen der
Nutzer:innen beeinträchtigen. Um die eigene Sicherheit und die der
anderen Nutzer:innen nicht zu gefährden, gilt grundsätzlich ein
Verbot.
Ausstellung Stephan Runge "Wikinger im Weltraum“ in Duisburg-Ruhrort
Vernissage Samstag, 07.06.2025 um 18 Uhr
Der
renommierte und international bekannte Künstler Stephan Runge kehrt
in Ruhrort ein. Als Meisterschüler von Joseph Beuys hat er bereits
bei der documenta IX in Kassel und im Deutschen Pavillon bei der
Biennale di Venezia ausgestellt. Darüber hinaus ist er inzahlreichen
Museen und Sammlungen weltweit vertreten.
Er hat jahrelang
in Japan gearbeitet und sein umfangreiches sowie diverses Werk deckt
Malerei, Skulptur, Fotografie und Film ab, aber auch elektronische
Musik. Seine aktuellen Arbeiten aus dem Zyklus „Morphisches Feld“
sind im Zusammenhang mit seiner Performance bei der Eröffnung der
Goya-/Polke-Ausstellung im Museo del Prado in Madrid entstanden und
werden nun erstmals ausgestellt.


Ergänzt werden Runges Arbeiten durch ein textiles Werk der
polnischen Künstlerin Agnieszka Dutkiewicz, die sich mit Bildnissen
von Frauen auseinander setzt. Des Weiteren wird eine Zeichnung von
Miriam Tinguely zu sehen sein.
Die Vernissage findet am
Samstag, den 07.06.2025 um 18 Uhr in der Galerie ruhrKUNSTort,
Fabrikstr. 23 in 47119 Duisburg statt. Alle Interessierten sind
hierzu herzlich eingeladen. Anschließend besteht die Gelegenheit die
Ausstellung bis 06.07.2025 zu den regulären Öffnungszeiten des
ruhrKUNSTortes zu besuchen (Freitag 16-18 Uhr, Sonntag 15 bis 18
Uhr).
Wir wollen Frieden - Evangelische und
katholische Frauen laden zum 24. gemeinsamen Gottesdienst
Um „Wir wollen Frieden!“ als Forderung und Thema, das
Nachdenklichkeit hervorruft, geht es im Frauengottesdienst am 2.
Juni um 18 Uhr in der Duisburger Salvatorkirche neben dem Rathaus.
Und mit dieser besonderen Ausgabe geht das erfolgreiche ökumenische
Gottesdienstformat von Frauen für Frauen aus Duisburg und Umgebung
bereits ins 24. Jahr.
Ins Leben gerufen hatten es Engagierte
der Evangelischen Frauenhilfen und der kfd-Gruppen in Duisburg.
Jährlich feiern sie diesen Gottesdienst, der von einem festen Team
aus evangelischen und katholischen Frauen in Duisburg vorbereitet
wird und im Anschluss immer gemütlich ausklingt.

Salvatorkirche (Foto: Rolf Schotsch)
Arbeitszeit: Regierungspläne würden Arbeitstage von über 12 Stunden
erlauben – negative Folgen für Gesundheit und Vereinbarkeit
Bundeskanzler Friedrich Merz hat eine Debatte über die Arbeitszeit
in Deutschland angestoßen. Die Menschen müssten „wieder mehr und vor
allem effizienter arbeiten". Im Koalitionsvertrag kündigt die neue
Bundesregierung an, die Möglichkeit einer wöchentlichen anstatt
einer täglichen Höchstarbeitszeit zu schaffen. Das zielt in erster
Linie auf eine weitere Lockerung des Arbeitszeitgesetzes zur
Ausweitung der täglichen Höchstarbeitszeit ab.
Dabei erlaubt
bereits das geltende Gesetz längst eine tägliche Arbeitszeit von bis
zu 10 Stunden. Das Vorhaben der Bundesregierung würde tägliche
Höchstarbeitszeiten von über 12 Stunden erlauben, zeigt eine neue
Kurzstudie des Hugo Sinzheimer Instituts für Arbeitsrecht (HSI) der
Hans-Böckler-Stiftung.*
Die von der Bundesregierung
angeführten Ziele – wirtschaftliche Impulse, Interessen von
Beschäftigten an Flexibilität und Erhalt des Arbeitsvolumens trotz
demografischen Wandels – lassen sich durch weiter deregulierte
Arbeitszeiten nicht erreichen, warnen die HSI-Fachleute Dr. Amélie
Sutterer-Kipping und Dr. Laurens Brandt. Denn erstens könne eine
weitgehende Lockerung der täglichen Arbeitszeit bestehende
gesundheitliche Probleme in der Erwerbsbevölkerung verschärfen, was
das Arbeitspotenzial schwächt statt stärkt. Zweitens würde sich die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie weiter verschlechtern, was
insbesondere die Teilnahme von Frauen am Erwerbsleben einschränkt.
„Eine Arbeitszeitderegulierung, die Erkenntnisse von
Arbeitsmedizin und Arbeitsforschung ausblendet und an der sozialen
Realität vorbeigeht, dürfte wirtschaftlich sogar kontraproduktiv
wirken. Denn sie würde gerade jene Entwicklungen bremsen, die in den
vergangenen Jahren wesentlich zu Rekordwerten bei Erwerbstätigkeit
und Arbeitsvolumen beigetragen haben und gleichzeitig Probleme bei
Gesundheit und Demografie verschärfen“, sagt Expertin
Sutterer-Kipping.
Arbeitsvolumen auf Rekordniveau
Um sich
ein vollständiges Bild über die Entwicklung der Arbeitszeit in
Deutschland zu machen, müssen neben der durchschnittlichen
Jahresarbeitszeit auch die Entwicklung der Erwerbstätigkeit und das
Arbeitszeitvolumen betrachtet werden. Die HSI-Forschenden tun das
mit aktuellen Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB).
Die Zahlen der abhängig Beschäftigten
bzw. der Erwerbstätigen erreichten nach dem IAB im Jahr 2023 mit
einem Jahresdurchschnitt von 42,2 bzw. 46,0 Millionen Personen
Höchststände. Auch das Gesamtarbeitszeitvolumen verzeichnete
Rekordwerte. Insgesamt haben abhängig Beschäftigte in Deutschland
2023 rund 54,59 Milliarden Stunden geleistet, während es 1991 noch
52,20 Milliarden Stunden waren. Inklusive des Arbeitszeitvolumens
der Selbstständigen und mithelfenden Familienangehörigen stieg das
Arbeitszeitvolumen der Erwerbstätigen 2023 sogar auf 61,44
Milliarden Stunden.
Im Jahr 2024 blieben beide Größen sehr
nahe an diesen Rekordwerten: Die Zahl der Erwerbstätigen stieg noch
einmal minimal an, das Arbeitsvolumen der Erwerbstätigen ging
geringfügig um 0,1 Prozent auf 61,37 Milliarden Stunden zurück. Die
gestiegene Erwerbstätigenzahl und das gestiegene Arbeitszeitvolumen
sind wesentlich darauf zurückzuführen, dass heute mehr Frauen einer
Erwerbstätigkeit nachgehen. So ist die Erwerbsquote von Frauen
zwischen 1991 und 2022 um 16 Prozentpunkte auf 73 Prozent gestiegen.
„Die Entwicklung der Arbeitszeit zeigt, dass wir uns zunehmend
weg vom traditionellen Alleinverdienermodell zu einem
Zweiverdienerhaushalt hinbewegen“, analysieren Sutterer-Kipping und
Brandt. Dementsprechend steigt das Gesamtarbeitszeitvolumen
insgesamt, während die durchschnittlichen Jahresarbeitszeiten
gesunken sind. Die durchschnittlich geleistete Arbeitszeit der
Beschäftigten lag laut IAB 1991 noch bei rund 1.478 Stunden und im
Jahr 2023 bei 1.295 Stunden.
Der Rückgang ist stark auf die
kontinuierlich gestiegenen Teilzeitquoten zurückzuführen. Knapp ein
Drittel der Beschäftigten arbeitete 2023 in Teilzeit, unter den
erwerbstätigen Frauen sogar fast jede zweite, und das nicht immer
freiwillig. Gerade bei Müttern schränken unbezahlte Sorgearbeit und
unzureichende Betreuungsmöglichkeiten die Kapazitäten für den
Erwerbsjob ein. Rechnerisch senkt das die durchschnittliche
Jahresarbeitszeit pro Kopf, was zu einer im europäischen Vergleich
relativ geringen durchschnittlichen Arbeitszeit aller Beschäftigten
von 34,7 Stunden pro Woche führt. An diesen Zusammenhängen würde
eine Aufweichung des Arbeitszeitgesetzes nichts verbessern, im
Gegenteil.
Geltendes Recht sorgt für erhebliche Flexibilität
Den Arbeitgebern ermöglicht hingegen schon die geltende Rechtslage
eine erhebliche Flexibilität, betonen die HSI-Expert*innen. Der
Acht-Stunden-Tag ist zwar seit 1918 eine Konstante im
Arbeitszeitrecht, gleichwohl ist ohne weitere Voraussetzung eine
deutliche Verlängerung möglich. So kann die Arbeitszeit ohne
Rechtfertigung auf bis zu zehn Stunden täglich ausgeweitet werden,
wenn innerhalb von sechs Monaten ein Ausgleich erfolgt, also die
durchschnittliche Arbeitszeit von acht Stunden werktäglich nicht
überschritten wird.
Darüber hinaus lässt das geltende
Arbeitszeitgesetz zahlreiche branchen- bzw. tätigkeitsbezogene
Abweichungen und Ausnahmen durch Tarifvertrag, aufgrund eines
Tarifvertrages in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung oder durch
behördliche Erlaubnis zu, wobei im Regelfall ein entsprechender
Zeitausgleich gewährleistet sein muss. Das erklärt, warum z.B. in
Krankenhäusern längere Arbeitszeiten als acht bzw. zehn Stunden
möglich sind.
Überlange Arbeitszeiten gefährden die
Gesundheit
Trotz aller bereits bestehender
Flexibilisierungsmöglichkeiten: Dass der Erwerbs-Arbeitstag im
Prinzip nach acht Stunden enden soll, ist kein Zufall, sondern
Ergebnis wissenschaftlicher Erkenntnisse zum Gesundheitsschutz. Die
Einführung einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit würde aber faktisch
nach Abzug der Mindestruhezeit von 11 Stunden und der entsprechenden
Ruhepause von 45 Minuten eine tägliche Höchstarbeitszeit von 12
Stunden und 15 Minuten ermöglichen. Eine Begrenzung der täglichen
Arbeitszeit fände dann nur durch die Mindestruhezeiten und
Ruhepausen statt.
Arbeitsmedizinisch ist längst erwiesen,
dass Arbeitszeiten von mehr als acht Stunden die Gesundheit
gefährden. Langfristig kommt es häufiger zu stressbedingten
Erkrankungen, sowohl zu psychischen Leiden wie vermehrtes Auftreten
von Burnout-Symptomatik, physischen und psychischen
Erschöpfungszuständen, als auch zu körperlichen Erkrankungen, etwa
Schlaganfälle, Diabetes und erhöhtes Krebsrisiko. Psychische
Erkrankungen sind immer häufiger der Grund für Fehlzeiten und
vorzeitiges Ausscheiden aus dem Arbeitsleben.
Die
Krankheitsdauer bei psychischen Erkrankungen lag nach Daten der DAK
2023 bei durchschnittlich 33 Tagen. „Neben den fatalen Folgen für
Arbeitnehmende stellt dies langfristig auch das Gesundheitssystem
und Arbeitgebende vor enorme Herausforderungen“, betonen
Sutterer-Kipping und Brandt.
Neben höheren Krankheitsrisiken
zeigen arbeitsmedizinische Erkenntnisse auch negative Zusammenhänge
zwischen langen werktäglichen Arbeitszeiten und dem Unfallgeschehen
am Arbeitsplatz. Das Unfallrisiko steigt ab der 8. Arbeitsstunde
exponentiell an, sodass Arbeitszeiten über 10 Stunden täglich als
hoch riskant eingestuft werden. Nach einer Arbeitszeit von 12
Stunden ist die Unfallrate bei der Arbeit oder bei der
anschließenden Fahrt nach Hause im Vergleich zu 8 Stunden um das
Zweifache erhöht. Dieses Risiko betrifft nicht nur die
Arbeitnehmer*innen selbst, sondern auch Dritte, wie beispielsweise
Patient*innen bei medizinischen Tätigkeiten oder
Verkehrsteilnehmende.
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
leidet
Weiteres gravierendes Problem: Durch die Einführung einer
wöchentlichen Höchstarbeitszeit werden Betreuungskonflikte nicht
gelöst, sondern verschärft, so die Forschenden. „Die
Vorhersehbarkeit und Planbarkeit von Arbeitszeiten stellen wichtige
Schlüsselfaktoren für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie dar.
Es droht der Effekt einer weiteren Verringerung der Erwerbsarbeit
gerade bei Frauen.“
Das schwächt nicht nur das aktuelle
Arbeitsangebot. Langfristig verhindert die ungleiche Teilhabe am
Arbeitsmarkt die eigenständige Existenzsicherung im Lebenslauf,
schmälert nachweislich Aufstiegs- und Weiterbildungschancen und
erhöht das Risiko für Altersarmut.
Was Arbeitnehmer*innen
hingegen wirklich helfen würde, Erwerbsarbeit und Sorgearbeit unter
einen Hut zu bringen, sei mehr Arbeitszeitsouveränität, also
Einflussnahme auf die Verteilung der Arbeitszeit. Im
Koalitionsvertrag machen die Forschenden an diesem Punkt aber eine
Leerstelle aus. „Dort heißt es zwar, dass sich die Beschäftigten und
Unternehmen mehr Flexibilität wünschen, der Koalitionsvertrag sieht
aber keine Einflussnahme der Arbeitnehmenden auf die Verteilung der
Arbeitszeit vor.“
Nach geltender Rechtslage kann sich die
konkrete Lage der Arbeitszeit aus dem Arbeitsvertrag, einer
Betriebsvereinbarung oder tarifvertraglichen Regelungen ergeben.
Sofern hier keine Festlegungen getroffen worden sind, unterliegt die
Bestimmung der Lage der Arbeitszeit dem Direktionsrecht der
Arbeitgebenden. Sie haben also das letzte Wort.
Auch vor
diesem Hintergrund bewerten die Fachleute die Einführung einer
wöchentlichen statt einer täglichen Höchstarbeitszeit als „nicht
verantwortbar und die falsche Stellschraube zur Lösung des Problems
von gleichberechtigter Sorgearbeit“. Statt diesen Irrweg
einzuschlagen, solle sich die Bundesregierung an Reformen der
bislang letzten schwarz-roten Koalition orientieren. Mit der 2019
eingeführten Brückenteilzeit sei ein erster Schritt gemacht worden,
um der „Teilzeitfalle“ entgegenzuwirken.
„Doch bisher gibt es
noch zu viele Einschränkungen, als dass dieses Gesetz wirklich ein
Ende der Teilzeitfalle bedeuten würde“, schreiben die Forschenden.
Gleichzeitig müsse die institutionelle Kinderbetreuung weiter
gestärkt werden, denn die Verfügbarkeit von Betreuungsmöglichkeiten
sei ein zentraler Hebel für die gleichberechtigte Verteilung der
Sorgearbeit.

NRW-Inflationsrate liegt im Mai 2025 bei 2,0 %
* Preise für Übernachtungen höher als ein Jahr zuvor (+13,8 %)
* Preisrückgänge bei Kraftstoffen (–6,1 %)
Die
Inflationsrate in Nordrhein-Westfalen – gemessen als Veränderung des
Verbraucherpreisindex zum Vorjahresmonat – liegt im Mai 2025 bei
2,0 %. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als
Statistisches Landesamt mitteilt, stieg der Preisindex gegenüber dem
Vormonat (April 2025) um 0,2 %.
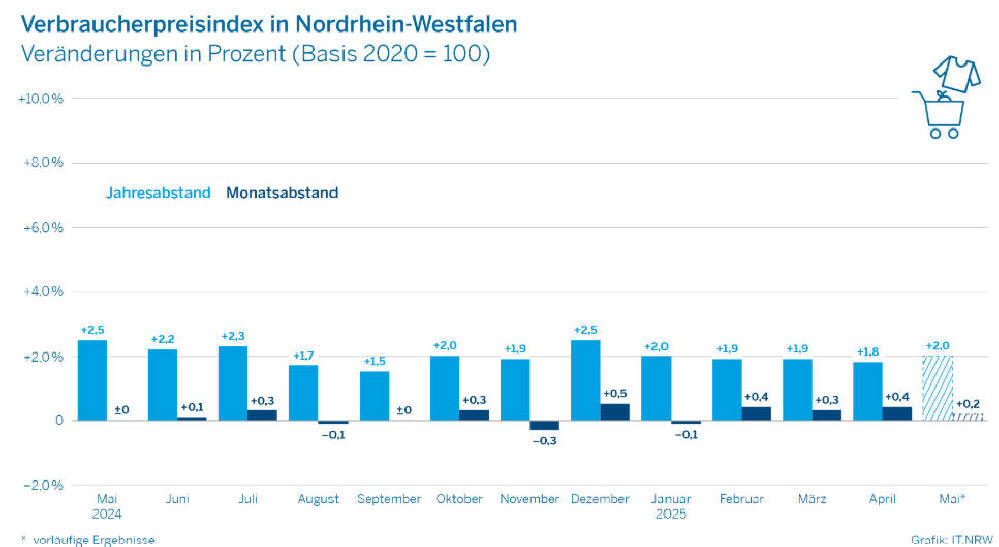
Vorjahresvergleich: Preise für Übernachtungen um 13,8 %
gestiegen
Zwischen Mai 2024 und Mai 2025 stiegen u. a. die
Preise für Übernachtungen um 13,8 % und für
Versicherungsdienstleistungen um 9,2 %. Alkoholfreie Getränke
verteuerten sich um 8,9 % und Obst um 8,6 %.
Die
Energiepreise sanken im Vergleich zum Vorjahresmonat um
durchschnittlich 3,1 %. Haushaltsenergien wurden um 1,0 % und
Kraftstoffe um 6,1 % günstiger angeboten. Die Preise für Telefone
u. a. Geräte für Kommunikation sanken um 6,7 %. Vormonatsvergleich:
Paprika um 27,5 % günstiger als im April 2025 Zwischen April 2025
und Mai 2025 verteuerten sich Schokoladentafeln um 10,6 %, Kaugummi,
Gummibärchen o. Ä. um 5,6 % und Kartoffeln um 5,4 %.
Verschiedene Gemüsesorten wie z. B. Paprika (–27,5 %), Tomaten
(–22,0 %), Kopf- oder Eisbergsalat (–12,3 %), Möhren (–5,8 %) und
Gurken (–5,6 %) verzeichneten Preisrückgänge. Wichtige
Preisveränderungen
https://www.it.nrw/system/files/media/document/file/149_25.xlsx