






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 34. Kalenderwoche:
17. August
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Montag, 18. August 2025
Bundeskanzler reist nach Washington
Bundeskanzler Friedrich Merz wird am Montag gemeinsam mit
dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und anderen
europäischen Staats- und Regierungschefs zu politischen Gesprächen
nach Washington reisen.
Die Reise dient dem
Informationsaustausch mit US-Präsident Donald Trump nach dessen
Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska.
Bundeskanzler Merz wird mit den Staats- und Regierungschefs den
Stand der Friedensbemühungen diskutieren und das deutsche Interesse
an einem schnellen Friedensschluss in der Ukraine unterstreichen.
Gegenstand der Gespräche sind unter anderem
Sicherheitsgarantien, territoriale Fragen und die fortdauernde
Unterstützung der Ukraine in der Abwehr der russischen Aggression.
Dazu gehört auch die Aufrechterhaltung des Sanktionsdrucks.
NATO-Generalsekretär besucht die USA
Am 18. August 2025 wird der NATO-Generalsekretär, Mark
Rutte, Washington DC besuchen Der Generalsekretär wird an einem vom
Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald J. Trump, ausgerichteten
Treffen mit dem Präsidenten der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, und
anderen europäischen Staats- und Regierungschefs teilnehmen.
Duisburg-Altstadt: Einschränkungen auf dem Sonnenwall
Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg führen ab Montag, 18.
August, Pflasterarbeiten in der Fußgängerzone im Bereich Sonnenwall
39 bis 47 in der Duisburger Altstadt durch. Aus diesem Grund ist
eine Einfahrt vom Friedrich-Wilhelm-Platz in den Sonnenwall nicht
möglich.
Die Schmale Gasse ist über die Wallstraße zu
erreichen. Eine Umleitung ist nicht ausgeschildert. Wer zu Fuß oder
mit dem Fahrrad unterwegs ist, kann den Bereich weiterhin passieren.
Die Maßnahme wird voraussichtlich Ende September abgeschlossen sein.
27 260 Kinder im Jahr 2024 bei Verkehrsunfällen
verunglückt
• Zahl der im Straßenverkehr getöteten
unter 15-Jährigen gegenüber 2023 von 44 auf 53 gestiegen
•
Risiko Schulweg: 6- bis 14-Jährige verunglücken am häufigsten
zwischen 7 und 8 Uhr • Die meisten verunglückten Kinder waren mit
dem Auto oder dem Fahrrad unterwegs
Alle 19 Minuten ist im
letzten Jahr ein Kind im Straßenverkehr verletzt oder getötet
worden. Rund 27 260 Kinder unter 15 Jahren verunglückten im Jahr
2024 bei Verkehrsunfällen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
mitteilt. Damit kamen in etwa so viele Kinder zu Schaden wie im Jahr
2023 (27 240).
Die Zahl der getöteten Kinder stieg 2024
gegenüber 2023 von 44 auf 53. Nach einem deutlichen Rückgang während
der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 war die Zahl der bei
Verkehrsunfällen verletzten und getöteten Kinder 2022 und 2023
wieder gestiegen.
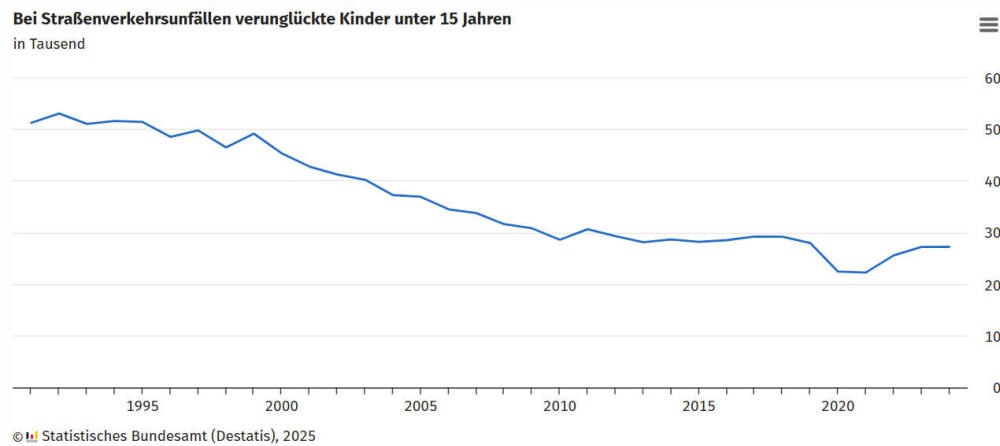
Ältere Kinder verunglücken besonders häufig morgens auf dem
Schulweg
Die 6- bis 14-Jährigen verunglücken montags bis
freitags besonders häufig in der Zeit von 7 bis 8 Uhr im
Straßenverkehr. Dies ist die übliche Zeit, zu der sich die Kinder
auf dem Weg zur Schule befinden. In dieser Zeit wurden im
vergangenen Jahr 13 % der verunglückten 21 870 Kinder im
entsprechenden Alter verletzt oder getötet.
In den folgenden
Stunden bis 13 Uhr sind die Unfallzahlen niedriger. Montags bis
freitags in den Zeiten von 15 bis 16 Uhr sowie 16 bis 17 Uhr
erreichen sie mit einem Anteil von je 9 % den nächsthöchsten Wert.
Jüngere Kinder verunglücken am häufigsten im Auto, ältere Kinder auf
dem Fahrrad Die meisten Kinder, die 2024 im Straßenverkehr
verunglückten, waren mit dem Auto unterwegs (35 %). 33 % saßen auf
einem Fahrrad und 21 % gingen zu Fuß, als der Unfall passierte.
Betrachtet man jedoch verschiedene Altersgruppen, ergibt sich
ein differenzierteres Bild: Unter 6-Jährige sind besonders häufig im
Auto mit betreuenden Erwachsenen unterwegs, demzufolge verunglücken
sie hier am häufigsten (58 % im Jahr 2024). Schulkinder bewegen sich
mit zunehmendem Alter selbstständig im Straßenverkehr – entsprechend
steigt der Anteil der Radfahrenden und Fußgängerinnen und -gänger
unter den Verunglückten. 6- bis 14-Jährige verunglückten am
häufigsten auf ihrem Fahrrad (38 %), 29 % in einem Auto sowie 20 %
zu Fuß.
Schulweg: Sicherheit vor Schnelligkeit
· Website informiert über Gefahrenstellen auf Schulweg
· Haftungsprivileg für Kinder
· Autofahrer müssen aufpassen: Fuß
vom Gas
Die Sommerferien sind in einigen Bundesländern
schon vorbei. Zigtausende Kinder und Jugendliche machen sich wieder
auf den Schulweg. Klar ist, der Verkehr erfordert volle
Aufmerksamkeit. Das spiegelt sich seit Jahren in den Zahlen des
Statistischen Bundesamtes wider: Kinder verunglücken besonders
häufig am frühen Morgen, zwischen 7 und 8 Uhr, sowie ab Mittag, wenn
die Schule aus ist.

Nicht immer ist der kürzeste Weg der sicherste. Auf dem Schulweg auf
dem Schulweg zählt vor allem Sicherheit. Foto: HUK-COBURG
Der Weg zur Schule sollte also nicht der kürzeste, sondern der
sicherste sein. Ein kleiner Umweg kann sich lohnen, wenn dafür
Ampeln oder Schülerlotsen das Überqueren der Straße sicherer machen.
Doch welches ist der sicherste Weg? Eltern können eigene Erfahrung
auf der Seite
https://www.schulwege.de/ faktenbasiert noch einmal
gegenchecken: Hier lässt sich eine möglichst sichere Route auf Basis
bekannter gefährlicher Bereiche berechnen.
Einen Teil der
Daten zur Erkennung der Gefahrenstellen liefert die HUK-COBURG an
die „Initiative für sichere Straßen“, Betreiber des
Schulweg-Portals. Basis ist der Telematik-Tarif des Versicherers,
den fast 700.000 Kunden nutzen. In aggregierter und anonymisierter
Form geben diese Daten Hinweise auf Gefahrenstellen im Verkehr.
Weitere Daten, die in die Berechnung einfließen, sind u.a. die
polizeilichen Unfalldaten sowie Meldungen von Verkehrsteilnehmern.
Eltern von ABC-Schützen rät die HUK-COBURG, die Route
zusammen mit ihren Kindern zu planen und mehrfach abzulaufen.
Wichtig ist auch, dass ein Kind mit ausreichendem Abstand zum
fließenden Verkehr am Bordstein stehen bleibt. Und vor der
Straßenüberquerung sollten Kinder immer den Blickkontakt zum
Autofahrer suchen. Richtig üben lässt sich nur unter realen
Bedingungen: Also morgens, wenn die Schule beginnt und mittags, wenn
sie endet.
Doch der Gesetzgeber weiß, dass Kinder von der
Komplexität des motorisierten Straßenverkehrs oft überfordert sind.
Dies gilt besonders für die Einschätzung von Geschwindigkeiten und
Entfernungen. Darum haften Kinder für Schäden, die sie Dritten bei
einem Verkehrsunfall fahrlässig zufügen, erst ab ihrem zehnten
Geburtstag. Das hat für Autofahrer weitreichende Konsequenzen.
Werden sie in einen Unfall mit einem nicht-deliktsfähigen Kind
verwickelt, haften sie unabhängig von der Schuldfrage. Autofahrer
müssen also stets damit rechnen, dass Kinder sich im Straßenverkehr
nicht regelkonform verhalten. Ein Kind sehen, heißt vorsichtig
fahren, beide Straßenseiten im Auge behalten und jederzeit
bremsbereit sein. Dies gilt in besonderem Maße in verkehrsberuhigten
Zonen sowie vor Kindergärten und Schulen.
Ob ältere Kinder
über zehn Jahren tatsächlich für einen Unfall und seine Folgen
einstehen müssen, hängt von ihrer Einsichtsfähigkeit ab.
Entscheidend ist, ob sie die eigene Verantwortung und die
Konsequenzen ihrer Handlungen richtig einschätzen können.
Gleichzeitig kommt es auf das individuelle Verschulden in der
konkreten Situation an und auf die Frage, ob von einem Kind dieses
Alters korrektes Verhalten überhaupt erwartet werden konnte.
Lautet die Antwort ja, müssen aber auch Kinder für sämtliche
Haftpflichtansprüche ihres Opfers aufkommen. Sobald das Kind selbst
Geld verdient, muss es zahlen. Haben die Eltern ihre
Aufsichtspflicht verletzt, können auch sie zur Kasse gebeten werden.
Schutz bietet in beiden Fällen eine private Haftpflichtversicherung.
Wirtschaftsumfrage: schwarz-rote 100-Tage-Bilanz
durchwachsen
Der Bundesverband der Freien Berufe (BFB)
hat seine Mitgliedsverbände zur Bewertung der ersten 100 Tage der
neuen Bundesregierung befragt. Das Ergebnis: wirtschaftliches
Problembewusstsein ist da – aber wichtige Themen bleiben
unterpriorisiert. Für Freiberuflerinnen und Freiberufler, die
insgesamt 6,2 Millionen Erwerbstätige ausmachen, fehlt der klare
Kurs.
BFB-Präsident Dr. Stephan Hofmeister zieht nach 100
Tagen schwarz-rot Bilanz.

© axentis.de/Lopata
Wirtschaftsumfrage: schwarz-rote 100-Tage-Bilanz
durchwachsen Eine BFB-Kurzumfrage attestiert der schwarz-roten
Koalition wirtschaftliches Verständnis, aber zu wenig
Planungssicherheit und Priorität für Selbstständigkeit. Den
Freiberuflerinnen und Freiberuflern fehlt der klare Kurs.
Wie bewerten die Freien Berufe den Start der neuen
Bundesregierung? Der Bundesverband der Freien Berufe (BFB) hat seine
59 Mitgliedsorganisationen befragt und kommt zu einem
differenzierten Bild. Zwar erkennen die Verbände ein gewachsenes
Verständnis für wirtschaftliche Herausforderungen, doch Vertrauen
und Verlässlichkeit bleiben bislang hinter den Erwartungen zurück.
Das zeigt die erste BFB-Kurzumfrage zum 100-Tage-Zeitraum der neuen
schwarz-roten Koalition.
BFB-Präsident Dr. Stephan
Hofmeister findet deutliche Worte.
Wirtschaftsverständnis da,
Planungssicherheit fehlt
Die Freien Berufe sehen bei der
Bundesregierung durchaus wirtschaftliche Ernsthaftigkeit, aber auch
strukturelle Defizite. Der Start der schwarz-roten Koalition wird
mit durchschnittlich 3,6 von 6 Punkten (Skala von 1-6) bewertet. Auf
die Frage, ob die neue Bundesregierung die wirtschaftlichen Probleme
im Land verstanden hat, vergeben die Mitgliedsverbände einen Wert
von 3,9 – so hoch wie bei keinem anderen Indikator.
Zugleich
attestieren sie der Bundesregierung jedoch mangelnde
Planungssicherheit für die Unternehmen (2,7 Punkte) und eine zu
geringe Priorisierung freiberuflicher Themen (2,6 Punkte). Zu wenig
Fokus auf Selbstständigkeit und Fachkräfte Am häufigsten genannt als
zu niedrig priorisierte Themen: Selbstständigkeit (64,3 Prozent),
Bildung und Fachkräftesicherung (42,9 Prozent) sowie Digitalisierung
und Bürokratieabbau und Steuerpolitik (jeweils 28,6 Prozent).
Auffällig auch: Der wirtschaftspolitische Kurs der
Bundesregierung wird als nicht ausreichend klar wahrgenommen (3,5
Punkte). Die Zuversicht, dass zentrale Anliegen der Freien Berufe
politisch Gehör finden, liegt bei verhaltenen 3 Punkten.
BFB-Präsident fordert "Get it done"-Gipfel „Deutschland braucht noch
einen ,Get it done‘-Gipfel“, so BFB-Präsident Dr. Stephan Hofmeister
in einem Gastkommentar für das Handelsblatt.
„Die Regierung
muss verlorenes Vertrauen wieder aufbauen und Praxisnähe zeigen. Wer
etwas bewegen will, muss neben den Investitionen auch die Umsetzung
sichern. Das bedeutet: Diejenigen, die planen, beraten und
berechnen, müssen mit einbezogen werden.“ Beim „Made for
Germany“-Gipfel im Kanzleramt hatten Unternehmen Investitionen in
Milliardenhöhe angekündigt – doch viele praktische Fragen blieben
unbeantwortet.
Der BFB fordert daher einen Folgetermin mit
Beteiligung von Handwerk, Mittelstand und Freien Berufen. „Die
Freien Berufe stehen bereit, sich noch stärker einzubringen. Nicht
irgendwann, sondern jetzt", so Dr. Hofmeister. Über den BFB: Der
Bundesverband der Freien Berufe e. V. (BFB) vertritt als einziger
Spitzenverband der freiberuflichen Kammern und Verbände die
Interessen der Freien Berufe, darunter sowohl Selbstständige als
auch Angestellte, in Deutschland.
Allein die rund 1,48
Millionen selbstständigen Freiberuflerinnen und Freiberufler steuern
knapp zehn Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei. Sie beschäftigen
über 4,7 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – darunter ca.
129.000 Auszubildende. Die Bedeutung der Freien Berufe für
Wirtschaft und Gesellschaft geht jedoch weit über ökonomische
Aspekte hinaus: Die Gemeinwohlorientierung ist ein
Alleinstellungsmerkmal der Freien Berufe.
Über die Umfrage
Die BFB-Kurzumfrage wurde vom 31. Juli bis 4. August 2025 unter
den 59 Mitgliedsorganisationen des Bundesverbands der Freien Berufe
e. V. (BFB) online durchgeführt. Die eingegangenen Antworten wurden
gewichtet, um der jeweiligen Mitgliederstärke beziehungsweise
Einwohnerzahl der Bundesländer Rechnung zu tragen. Die Ergebnisse
verschaffen eine verlässliche Einordnung politischer Entwicklungen
aus Sicht der Freien Berufe, sind jedoch nicht-repräsentativ und
erheben keinen wissenschaftlichen Anspruch.
IHK: Kommunen sollen
„Möglichmacher“ sein Besserer Service für die Wirtschaft
Am 14. September finden in NRW die Kommunalwahlen statt. Die
Entscheider vor Ort beeinflussen, wie attraktiv ein Standort für
Unternehmen ist. Sie können die Gesetze aus Berlin und Brüssel nicht
ändern, Gestaltungsspielraum ist aber da, betont die
Niederrheinische IHK. Wie das aussehen kann, will sie der Politik
mit Beispielen aus der Praxis zeigen.
Die Kommunen stehen
im Wettbewerb. Schlanke, schnelle und wirtschaftsfreundliche
Verwaltungen können sich abheben. „Anträge dauern zu oft Monate oder
Jahre. Das kostet die Wirtschaft Geld. Im schlimmsten Fall suchen
sich die Unternehmen einen neuen Standort. Deshalb brauchen wir
Menschen in den Behörden, die sagen: Ich möchte, dass ein Projekt
gelingt und treibe das aktiv voran. Als Behördenlotsen sollen sie
Betriebe durch Genehmigungen leiten. Weg von unterschiedlichen
Zuständigkeiten, hin zu festen Ansprechpartnern“, sagt Dr. Stefan
Dietzfelbinger, Hauptgeschäftsführer der Niederrheinischen IHK.

Foto IHK
Prozesse beschleunigen
Damit Behörden
serviceorientiert handeln können, braucht es schlanke Prozesse.
„Viel Bürokratie gibt der Bund vor, aber jede Verwaltung kann an den
eigenen Prozessen arbeiten“, so Dietzfelbinger. „Da hilft auch mal
ein Blick in die Nachbarstädte. Wir müssen voneinander lernen.“
Gleichzeitig sind Kommunen die Schnittstelle zu den Bürgern. Sie
sind mit verantwortlich, dass Betriebe vor Ort akzeptiert werden.
Das fängt damit an, junge Menschen für Technik und Wirtschaft zu
begeistern. Helfen kann laut IHK, Bildungseinrichtungen wie
Science-Labs anzusiedeln. Ebenso gilt es Projekte wie die „Lange
Nacht der Industrie“ zu unterstützen, die Einblicke hinter die
Kulissen ermöglichen.
Für die neue Wahlperiode hat die IHK
acht Schwerpunkte festgelegt. Sie liefert Beispiele aus der Region
und wirbt für pragmatische Lösungen. So soll der Wirtschaftsstandort
zukunftssicher werden. Die Forderungen finden sich unter
www.ihk.de/niederrhein/kommunalwahl.
Der
Niederrhein ist zu teuer IHK wirbt vor Kommunalwahl für niedrige
Steuern
Hohe Steuern machen den Standort unattraktiv.
Unausweichlich, sagen die Kommunen, denen es finanziell nicht gut
geht. Zu kurz gedacht, findet die Niederrheinische IHK. Um die
Wirtschaft anzukurbeln, sollten Gewerbe- und Grundsteuern gesenkt
werden.
„Am 14. September ist Kommunalwahl. Nicht nur
Berlin und Brüssel können etwas verändern, auch die Kommunen.
Finanziell sieht es vielerorts nicht rosig aus. Aber wer seine
Wirtschaft belastet, verbaut sich die Zukunft. Unternehmen suchen
sich andere Standorte. Für Investoren wird der Standort
uninteressant. Das kostet Einnahmen und Arbeitsplätze“, so Dr.
Stefan Dietzfelbinger.
Am Niederrhein liegen die
Gewerbesteuern fast zehn Prozent höher als im deutschen
Durchschnitt. Duisburg stellt sich gegen den Trend. Die Stadt senkt
ihre Gewerbe- und Grundsteuer. „Daran sollten sich andere Kommunen
orientieren. Zusätzliche Belastungen wie die neue Verpackungssteuer
sind nicht tragbar. Jede Kommune kann für sich entscheiden, ob sie
die Steuer einführt. Das schafft ungleiche Bedingungen zwischen
Städten, aber auch Branchen. Von dem Mehr an Bürokratie ganz zu
schweigen“, betont Dietzfelbinger.
Das braucht die
Wirtschaft von der Politik
Für die neue Wahlperiode hat die IHK
acht Schwerpunkte festgelegt. Sie liefert Beispiele aus der Region
und wirbt für pragmatische Lösungen. So soll der Wirtschaftsstandort
zukunftssicher werden. Die Forderungen finden sich unter
www.ihk.de/niederrhein/kommunalwahl.
Wirtschaft
braucht Fläche IHK will mehr Platz für Unternehmen
Standorte,
die keine Flächen anbieten, fallen wirtschaftlich zurück.
Unternehmen investieren weniger oder anderswo. Anlässlich der
Kommunalwahl ruft die Niederrheinische IHK die Politik auf zu
handeln. Duisburg hat fast keine freien Flächen mehr. Auch am
Niederrhein gibt es immer weniger Spielraum.
„Unsere
Unternehmen stehen im internationalen Wettbewerb. Da können sie
nicht Jahre auf neue Gewerbeflächen warten. Ausgewiesene Flächen
müssen schnell mobilisiert werden. Brachflächen sollten schneller
nutzbar sein. Kommunen sollten auch gezielt Flächen auf Vorrat
kaufen, um flexibel auf Anfragen von Unternehmen reagieren zu
können“, sagt Dr. Stefan Dietzfelbinger.
IHK liefert
Beispiele aus der Praxis Duisburg verfügt über 15 Hektar freie
Fläche, die die Wirtschaft nutzen kann. Das reicht gerade noch für
ein Jahr. Auch an anderen Standorten sieht es schlecht aus. Moers
sollte die Gewerbegebiete „Kohlenhuck“ und „Kapellen“ schnell
entwickeln.
Dinslaken den Kooperationsstandort
„Dinslaken-Barmingholten“. Kommunale Kooperationen sind laut IHK
eine gute Option, um mehr Flächen anbieten zu können. Goch und Weeze
haben dadurch ein 47 Hektar großes Gewerbegebiet erschließen können.
Ein weiteres positives Beispiel liefert Wachtendonk. Hier kann ein
Non-Food-Discounter eine Gewerbebrachfläche so lange nutzen, bis sie
entwickelt wird. Ein Entgegenkommen, das dem Händler vor Ort hilft.
„Das ist pragmatisch, davon brauchen wir mehr“, so Dietzfelbinger.
Für die neue Wahlperiode hat die IHK acht Schwerpunkte
festgelegt. Sie liefert Beispiele aus der Region und wirbt für
pragmatische Lösungen. So soll der Wirtschaftsstandort
zukunftssicher werden. Die Forderungen finden sich unter
www.ihk.de/niederrhein/kommunalwahl.
Elektromobilität: Anzahl der Ladevorgänge steigt um mehr als 23
Prozent im 1. Halbjahr
Die Elektromobilität nimmt auch
in Duisburg weiter Fahrt auf. Die Stadtwerke Duisburg haben sich zum
Ziel gesetzt, die öffentliche Ladeinfrastruktur konsequent weiter
auszubauen und 500 öffentliche Ladepunkte im gesamten Stadtgebiet zu
errichten. Das Angebot wird von den Menschen in Duisburg immer
besser angenommen. Im ersten Halbjahr 2025 verzeichneten die
Stadtwerke Duisburg an ihren Ladepunkten 46.106 Ladevorgänge, das
waren 23,1 Prozent mehr als noch im ersten Halbjahr des Jahres 2024
(37.456 Ladevorgänge).
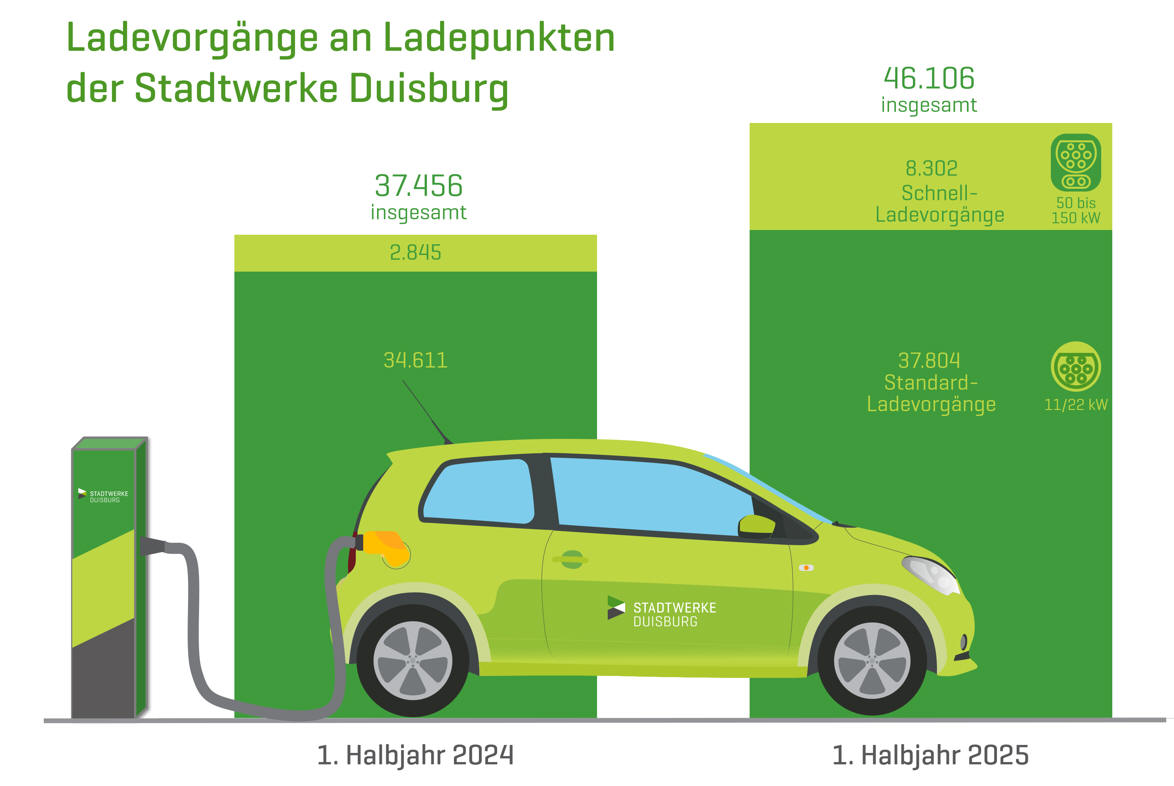
Gestiegen ist damit natürlich auch die gesamt abgegebene Menge
Ladestrom – und das massiv. Im ersten Halbjahr 2024 waren es noch
627.408 Kilowattstunden (kWh). Im ersten Halbjahr 2025 wurden an den
Ladepunkten der Stadtwerke Duisburg 1.048.173 kWh Ladestrom
abgegeben. Das entspricht einer Steigerung von 67,1 Prozent. Vor
allem die Nutzung der sogenannten Schnellladepunkte ist dabei in den
beiden Vergleichszeiträumen deutlich angestiegen.
Während
die Schnelladepunkte im ersten Halbjahr 2024 noch 2.845 Mal
angefahren wurden, waren es im ersten Halbjahr dieses Jahres schon
8.302 Ladevorgänge – eine Steigerung von 191,8 Prozent. Gestiegen
ist aber auch die Anzahl der Ladevorgänge an den
Standard-Ladepunkten: Um 9 Prozent auf 37.804 Ladevorgänge. Einen
deutlichen Zuwachs um 196,8 Prozent verzeichnete die abgegebene
Menge Ladestrom an den Schnellladepunkten des lokalen
Energiedienstleisters auf 226.818 kWh.
Rund 124.773 Stunden
standen damit im ersten Halbjahr 2025 Elektroautos an den
Ladepunkten der Stadtwerke Duisburg, um zu laden. 5.629 Stunden
entfielen davon auf die Schnelladepunkte, 119.144 Stunden waren die
Standard-Ladepunkte belegt. Die durchschnittliche Ladedauer an einem
Standard-Ladepunkt lag bei 3,2 Stunden, der durchschnittliche
Ladevorgang an einem Schnellladepunkt lag bei 0,7 Stunden. Am
beliebtesten, wie auch schon im ersten Halbjahr 2024, war auch in
den ersten sechs Monaten dieses Jahres die Ladestation am Stadthaus,
an der von Januar bis Ende Juni mehr als 1.300 Ladevorgänge
stattgefunden haben.
Durch den massiven Ausbau der
öffentlichen Ladeinfrastruktur durch die Stadtwerke Duisburg ist
zugleich die Suche nach einem freien Ladepunkt deutlich einfacher
geworden. Während die durchschnittliche Auslastung der Ladepunkte im
ersten Halbjahr 2024 noch bei 33 Prozent lag, ist sie im ersten
Halbjahr 2025 um 13 Prozent gesunken. Waren Ende Juni 2024 noch 124
Ladepunkte der Stadtwerke Duisburg in Betrieb, waren es Ende Juni
2025 schon 280 Ladepunkte.
Der lokale Energiedienstleister
unterstützt alle Menschen und Unternehmen in Duisburg dabei, den
Einstieg in die Elektromobilität zu realisieren. Privatkunden finden
alle Informationen im Internet unter
https://www.stadtwerke-duisburg.de/privatkunden/elektromobilitaet.
Geschäftskunden, die zum Beispiel ihren Dienstwagen-Fuhrpark auf
Elektromobilität umstellen wollen und Lademöglichkeiten am Betrieb
installieren wollen, finden alle Informationen unter
https://www.stadtwerke-duisburg.de/geschaeftskunden/elektromobilitaetskonzepte.
Workshop: Portraitzeichnen in der Neumühler Bibliothek
Die Bibliothek an der Lehrerstraße 4 bis 6 verwandelt
sich am Donnerstag, 28. August, in ein kleines Künstleratelier:
Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren können hier die Kunst des
schnellen und realistischen Porträtzeichnens entdecken und üben.
Riswane Rowinsky wird die Schritte vom genauen Beobachten des
Modells über die erste Skizze bis hin zum fertigen Porträt
vermitteln. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Alle
Materialien werden bereitgestellt, eigene Zeichenutensilien können
gerne mitgebracht werden. Der Workshop wird durch das Programm
„Kulturrucksack NRW“ gefördert. Die Teilnahme kostet zwei Euro
zugunsten der Duisburger Bibliotheksstiftung. Anmeldungen sind ab
sofort über www.stadtbibliothek-duisburg.de unter Veranstaltungen
möglich: https://stadtbibliothek-duisburg.easy2book.de/.
myBUS: Rabattaktion
für Fahrgäste bis 18. August
Die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG
(DVG) bietet ihren Fahrgästen aktuell eine besondere Rabattaktion
für myBUS an. Von montags bis freitags zahlt die erste Person nur 50
Prozent des Fahrpreises, die zweite Person fährt kostenlos mit. Alle
weiteren Mitfahrenden werden wie gewohnt nach Tarif abgerechnet. Die Rabattaktion läuft noch bis einschließlich Montag,
18. August. möchte, kann davon profitieren.
Mit über 5.600
virtuellen Haltestellen bietet myBUS eine individuelle Ergänzung zum
klassischen Linienverkehr. Das Angebot stellt insbesondere in den
Abend- und Nachtstunden eine verlässliche Lösung dar, um flexibel
ans Ziel zu kommen. Gleichzeitig leistet myBUS einen Beitrag zur
nachhaltigen Mobilität, denn die Elektro-Kleinbusse fahren nur, wenn
sie tatsächlich benötigt werden.
Die DVG und die Stadt
Duisburg sehen in nachfragebasierten Angeboten einen wichtigen
Baustein für die Mobilität der Zukunft. Besonders in Randzeiten oder
weniger stark frequentierten Gebieten ermöglicht myBUS eine
wirtschaftliche und kundenorientierte Lösung.
Wie
funktioniert myBUS? myBUS ist Teil des bestehenden
Nahverkehrsangebots. Fünf Elektro-Kleinbusse sind auf Abruf in
Duisburg unterwegs. Die myBUS-Fahrzeuge können über die myBUS
DVG-App gebucht werden. Per Smartphone können Fahrgäste ihre
Fahrtwünsche unter Angabe des Start- und Zielpunktes (virtuelle
Haltestellen) angeben.
Die Routen für die Busse werden von
einem Algorithmus in Echtzeit entsprechend der jeweiligen Nachfrage
berechnet. So teilen sich Fahrgäste gemeinsame Fahrten und werden
von ihren individuellen Standorten zum gewünschten Ziel gebracht.
Bereits die Anfahrt des Busses lässt sich in Echtzeit
verfolgen, die Fahrzeuge sind durch den myBUS-Schriftzug und durch
das auffällige Außendesign mit roten Diagonalflächen gut erkennbar.
Sowohl die Buchung als auch die Bezahlung des Tickets erfolgt
ausschließlich per App.
Fahrgäste schätzen nicht nur das
unkomplizierte Angebot, sondern auch den Komfort. Die Kleinbusse
sind zum Beispiel mit kostenlosem WLAN ausgestattet.

Bildquelle: Duisburger Verkehrsgesellschaft AG
Studie zeigt: Kommunikation verstärkt die Wirkung von
Ibuprofen
Positive Erwartungen an die Behandlung kann
die Wirkung von Ibuprofen verstärken - das wies jetzt eine
Arbeitsgruppe am Universitätsklinikum Essen nach. Diese Studie
belegt, dass Placeboeffekte auch bei Entzündungen den Nutzen aktiver
Wirkstoffe steigern können.
Daraus folgern die
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass der oder die
Behandelnde über positive Kommunikation den Therapieerfolg deutlich
steigern kann. Leitfrage der Untersuchung war: Wie wirken sich
Informationen durch den Arzt oder die Ärztin auf Entzündungssymptome
und die Behandlung aus?
Die Probandinnen und Probanden
erhielten eine niedrig dosierte immunaktivierende Substanz (LPS –
Lipopolysaccharid), die Immun-vermittelte Symptome während einer
akuten Entzündungsreaktion hervorruft. Kombiniert wurde die LPS-Gabe
entweder mit der Einnahme von Ibuprofen oder eines Placebos. Hinzu
kamen positive oder neutrale Informationen über die Behandlung. idr
Weitere Informationen zur aktuellen Forschung sind auf der
Webseite
http://www.treatment-expectation.de nachzulesen.
Flughafen Essen/Mülheim wird 100 Jahre alt
Der Flughafen Essen/Mülheim feiert in diesem
Jahr seinen 100. Geburtstag. Zwar gab es hier laut Chronik bereits
im Jahr 1919 erste Flüge, doch erst am 25. August 1925 erhielt der
Ort offiziell seine Flughafenrechte als genehmigter Notlandeplatz.
Angestoßen hatte dies die Industrie- und Handelskammer
Essen, die einen Flughafen für den Industrieraum Ruhrgebiet für
nötig befand. Damals verband der Flughafen das Rhein-Ruhr-Gebiet mit
dem restlichen Europa. So entstanden 1930 die ersten
Linienverbindungen von Essen/Mülheim in die Hauptstädte Europas.
Heute ist der Flughafen, der sowohl auf Essener als auch auf
Mülheimer Stadtgebiet liegt, kein Linienflughafen mehr.
Von
hier aus werden Businessflüge mit kleinen Turbo-Prop-Maschinen
abgewickelt und Rundflüge - u. a. mit dem Luftschiff - angeboten.
Zur Feier des runden Geburtstages steigt am 7. September ein großes
Familienfest auf dem Flughafengelände. Neben Spielangeboten und
Mitmachaktionen steht die Erkundung des Flughafengeländes auf dem
Programm.
Zu entdecken sind unter anderem eine Oldtimer
Cessna und der Doppeldecker Inge. Außerdem kann der große
Luftschiffhangar besichtigt werden. idr - Informationen:
https://www.flughafen-essen-muelheim.de/fem/aktuelles/100-jaehriges-jubilaeum
Neue
Studie: Bürgergeld: Einkommen bei Mindestlohnbeschäftigung deutlich
höher als mit Grundsicherung – Zahlen zu allen Landkreisen und
Städten
Auch wer zum Mindestlohn arbeitet, hat ein
deutlich höheres verfügbares Einkommen als vergleichbare Personen,
die Bürgergeld beziehen. Das gilt überall in Deutschland und
unabhängig von der Haushaltskonstellation. Im deutschen Durchschnitt
liegt der Einkommensvorteil bei 557 Euro monatlich im Falle einer
alleinstehenden Person, die Vollzeit zum Mindestlohn arbeitet.
Eine alleinerziehende Person mit einem Kind hat bei
Vollzeitbeschäftigung zum Mindestlohn 749 Euro mehr zur Verfügung
als bei Bürgergeldbezug. Bei einer Paarfamilie mit zwei Kindern und
einer oder einem in Vollzeit zum Mindestlohn Beschäftigten beträgt
der Vorteil 660 Euro. In Ostdeutschland inklusive Berlin ist der
Lohnabstand etwas größer als im Westen. Bei einer alleinstehenden
Person sind es beispielsweise durchschnittlich 570 Euro im Osten
gegenüber 549 Euro im Westen.
Regional unterscheidet sich der
Umfang des Einkommensvorteils bei Beschäftigung ebenfalls, in vielen
Städten und Landkreisen sind die Unterschiede zum Bundesdurchschnitt
nach oben oder unten dabei eher moderat. Im regionalen Vergleich am
kleinsten ist der Lohnabstand zum Bürgergeldbezug in Orten mit sehr
hohen Mieten wie z.B. in München und seinem Umland oder Hamburg. Das
zeigt eine neue Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen
Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung. Sie liefert auch
detaillierte regionale Daten für alle 400 deutschen Landkreise und
kreisfreien Städte (siehe Tabelle im Anhang der Studie; Link
unten).*
Dass überall in Deutschland ein deutlicher
Lohnabstand zwischen einer Vollzeitbeschäftigung zum Mindestlohn und
Bürgergeld besteht, ist auch eine Folge entsprechend gestalteter
Sozialleistungen, zeigt die Untersuchung des WSI: Erstens gibt es
mit Wohngeld, Kindergeld und Kinderzuschlag Leistungen, die
verhindern sollen, dass Menschen, die in Beschäftigung stehen,
überhaupt auf die Grundsicherung angewiesen sind. Zweitens stellen
die Hinzuverdienstregelungen im Sozialgesetzbuch II sicher, dass
auch Menschen, die Bürgergeld beziehen, bei Erwerbstätigkeit stets
mehr Einkommen zur Verfügung haben als ohne eine Beschäftigung.
„Aktuell steht das Bürgergeld wieder im Zentrum einer oft
polemisch geführten Debatte. Eine häufig gehörte Unterstellung ist,
dass es sich für Bezieher*innen von Bürgergeld nicht lohne,
erwerbstätig zu sein, weil das Bürgergeld zu hoch sei. Die Zahlen
dieser Studie zeigen erneut, dass Bürgergeldempfänger*innen
unabhängig vom Haushaltstyp und von der Region, in der sie wohnen,
weniger Geld haben als Erwerbstätige, die zum Mindestlohn arbeiten“,
sagt Prof. Dr. Bettina Kohlrausch, die wissenschaftliche Direktorin
des WSI.
„In Regionen, in denen der Abstand geringer ist,
liegt dies an den Mieten, die in einigen Gegenden extrem hoch sind.
Das verweist auf ein Feld, auf dem es im Gegensatz zum Niveau des
Bürgergelds tatsächlich dringend politischen Handlungsbedarf gibt:
Die Schaffung bezahlbaren Wohnraums, die sowohl die Staatskasse als
auch die unteren Einkommen entlasten würde.“
Der erhebliche
Abstand zwischen Bürgergeld und Mindestlohnbeschäftigung mache auch
klar, mit wie wenig Geld Bürgeldempfänger*innen auskommen müssen,
betont die Soziologin. „Die Behauptung, sie wollten nicht
erwerbstätig sein, weil sich mit dem Bürgergeld gut leben lasse, ist
sachlich falsch und stigmatisierend. Das ist das letzte, was
Bürgergeldempfänger*innen brauchen. Und es hilft auch nicht bei der
gesellschaftlichen Problemlösung, weil es von wirksamen
Lösungsansätzen ablenkt.“
Tatsächlich helfen würde
Qualifizierung von erwerbsfähigen Menschen im Bürgergeldbezug, gute
Betreuung „und in vielen Fällen Entlastung von sehr zeit- und
kraftintensiver Sorgearbeit, wie der Pflege von Kranken und alten
Angehörigen oder der Betreuung von Kindern“, analysiert Kohlrausch.
„Statt Menschen mit niedrigen Erwerbseinkommen und
Bürgergeldempfänger*innen gegeneinander auszuspielen, ist es Zeit,
diese arbeitsmarktpolitischen Herausforderungen endlich zu
adressieren.“
Im Rahmen der Analyse hat WSI-Forscher Dr. Eric
Seils für drei typische Haushaltskonstellationen Modellrechnungen
auf Basis des „WSI-Steuer-/Transfermodells“ durchgeführt, das alle
relevanten Abgaben, das Bürgergeld sowie weitere Sozialleistungen
umfasst. Regionale Daten zu den laufenden anerkannten Kosten der
Unterkunft wurden der SGB-II-Statistik der Bundesagentur für Arbeit
entnommen.
Den Berechnungen zufolge kommt eine alleinstehende
Person, die 38,19 Stunden pro Woche zum Mindestlohn arbeitet – was
der durchschnittlichen betriebsüblichen Vollarbeitszeit entspricht
–, auf einen Bruttomonatslohn von 2121,58 Euro. Davon bleiben nach
Abzug von Einkommenssteuer und Sozialversicherungsbeiträgen 1546
Euro.

Zusammen mit 26 Euro Wohngeld, auf die im Beispielfall im
Bundesdurchschnitt Anspruch besteht, ergibt sich ein verfügbares
Einkommen in Höhe von 1572 Euro. Wenn die Person Bürgergeld bezieht,
stehen ihr 563 Euro Regelbedarf und bei gleicher Miete 451,73 Euro
für die Unterkunft, also in Summe 1015 Euro zu. Der Lohnabstand
beträgt damit 557 Euro. Auch wenn man davon noch den Rundfunkbeitrag
von 18,36 Euro abzieht, bleibt eine Differenz von deutlich über 500
Euro.
Bei einer alleinstehenden Person mit fünfjährigem Kind
ergibt sich bei gleicher Arbeitszeit ein Nettolohn von 1636 Euro.
Mitsamt Kindergeld, Kinderzuschlag, Wohngeld und Unterhaltsvorschuss
beträgt das verfügbare Einkommen 2532 Euro. Im Falle von
Bürgergeldbezug summieren sich die beiden Regelsätze, der Mehrbedarf
für Alleinerziehende, die Kosten der Unterkunft und der
Sofortzuschlag auf 1783 Euro, was einem Lohnabstand von 749 Euro
entspricht.
Ein Ehepaar mit zwei Kindern im Alter von fünf
und 14 Jahren und einer Person als Alleinverdiener*in kommt netto
auf ein Arbeitseinkommen von 1682 Euro, das verfügbare Einkommen
inklusive Kindergeld, Kinderzuschlag und Wohngeld beträgt hier 3414
Euro. Bürgergeld-Regelsätze, Kosten der Unterkunft und
Sofortzuschläge machen zusammen 2754 Euro aus, also 660 Euro
weniger.
Regionale Abweichungen beruhen auf Unterschieden bei
den Mietkosten: Im Landkreis München, in Dachau und in der Stadt
München fällt der Lohnabstand beispielsweise bei einem
Single-Haushalt mit 379, 438 bzw. 444 Euro am geringsten aus, in
Nordhausen und dem Vogtlandkreis mit 662 bzw. 652 Euro am größten.
Pfarrerin Randow am Service-Telefon der evangelischen Kirche
in Duisburg
„Zu welcher Gemeinde gehöre ich?“ oder „Wie
kann ich in die Kirche eintreten?“ oder „Holt die Diakonie auch
Möbel ab?“: Antworten auf Fragen dieser Art erhalten Anrufende beim
kostenfreien Servicetelefon der evangelischen Kirche in Duisburg.

Es ist unter der Rufnummer 0800 / 12131213 auch immer
montags von 18 bis 20 Uhr besetzt, und dann geben Pfarrerinnen und
Pfarrer Antworten auf Fragen rund um die kirchliche Arbeit und haben
als Seelsorgende ein offenes Ohr für Sorgen und Nöte. Das
Service-Telefon ist am Montag, 18. August 2025 von Sara Randow,
Pfarrerin in der Evangelischen Kirchengemeinde Trinitatis (Buchholz
/ Wedau), besetzt
Kirchgarten wird zu „Church on the
beach“
Am letzten Sonntag in den Sommerferien, am 24.
August lädt die Evangelische Kirchengemeinde Trinitatis zu einer
besonderen Ausgabe ihres Formats „Spotlight“ ein. Dann verwandelt
sich der Garten des Jugendzentrums Arlberger, Arlberger Straße 6, in
eine Strandbar. Unter dem Motto „Church on the beach“ sollen es sich
die Besucherinnen und Besucher bei Gott und bei Kirche gut gehen
lassen.
Um 17.30 Uhr beginnt der Sommerabend mit einem
Kurzgottesdienst, in dem Pfarrerin Sara Randow auf die Geschichte
der Hochzeit zu Kana eingeht, bei der Jesus Wasser in Wein
verwandelt. Dazu singt Popkantor Daniel Drückes mit den Anwesenden
Lieder, die von Gott erzählen und gute Laune bringen. Anschließend
sind alle zu Cocktails, Getränken und Gesprächen eingeladen.
Spotlight ist für alle offen, die Lust auf Begegnung mit Gott
und Gemeinde haben, egal welchen Alters. Bei Regen findet der
Gottesdienst in der nebengelegenen Jesus-Christus-Kirche
statt. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter
www.trinitatis-duisburg.de.

Großhandelspreise im Juli 2025: +0,5 % gegenüber Juli
2024 Großhandelsverkaufspreise, Juli 2025 +0,5 % zum
Vorjahresmonat -0,1 % zum Vormonat
Die Verkaufspreise im
Großhandel waren im Juli 2025 um 0,5 % höher als im Juli 2024. Im
Juni 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat
bei +0,9 % gelegen, im Mai 2025 bei +0,4 %. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, fielen die Großhandelspreise
im Juli 2025 gegenüber dem Vormonat Juni 2025 geringfügig um 0,1 %.
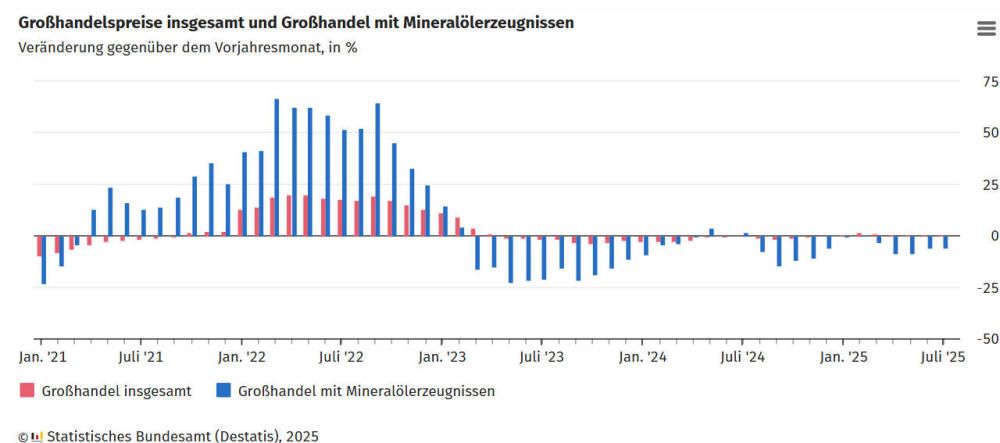
Gestiegene Preise für Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und
Tabakwaren sowie für Nicht-Eisen-Erze, Nicht-Eisen-Metalle und
Nicht-Eisen-Metallhalbzeug Hauptursächlich für den Anstieg der
Großhandelspreise insgesamt gegenüber dem Vorjahresmonat war im Juli
2025 der Preisanstieg bei Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und
Tabakwaren. Die Preise lagen hier im Durchschnitt 3,5 % über denen
von Juli 2024 (-0,6 % gegenüber Juni 2025).
Insbesondere
Kaffee, Tee, Kakao und Gewürze waren auf Großhandelsebene erheblich
teurer als ein Jahr zuvor (+16,0 %), gegenüber Juni 2025 sanken die
Preise aber um 6,2 %. Zucker, Süßwaren und Backwaren kosteten
ebenfalls mehr als im Vorjahresmonat (+15,0 %) und verteuerten sich
auch im Vormonatsvergleich (+0,8 ). Ebenfalls merklich mehr bezahlt
werden musste binnen Jahresfrist für Fleisch und Fleischwaren
(+9,4 %), lebende Tiere (+8,4 %) sowie für Milch, Milcherzeugnisse,
Eier, Speiseöle und Nahrungsfette (+7,3 %).
Gegenüber Juni
2025 wurden die Produkte hier billiger: lebende Tiere um 2,4 %,
Milch, Milcherzeugnisse, Eier, Speiseöle und Nahrungsfette um 0,4 %
und Fleisch und Fleischwaren um 0,1 %. Einen deutlichen Anstieg der
Preise gegenüber dem Vorjahresmonat gab es auch im Großhandel mit
Nicht-Eisen-Erzen, Nicht-Eisen-Metallen und Halbzeug daraus
(+17,6 %). Sie sanken aber gegenüber Juni 2025 um 1,5 %.
Niedriger als im Juli 2024 waren dagegen die Preise im Großhandel
mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen (-5,7 %).
Gegenüber Juni 2025 musste hier aber 2,0 % mehr bezahlt werden.
Ebenfalls günstiger im Vorjahresvergleich waren auf Großhandelsebene
Altmaterial- und Reststoffe (-9,0 %). Gegenüber Juni 2025 wurden sie
ebenfalls billiger (-2,4 %).
Niedrigere Preise gegenüber dem
Vorjahresmonat und Vormonat gab es auch im Großhandel mit Eisen,
Stahl und Halbzeug daraus (-5,6 % gegenüber Juli 2024; -0,2 %
gegenüber Juni 2025) sowie mit Datenverarbeitungs- und peripheren
Geräten (-4,8 % gegenüber Juli 2024; -0,3 % gegenüber Juni 2025).
4 % mehr Promovierende im Jahr 2024
• 212
400 Promovierende an deutschen Hochschulen
• 28 % strebten im
Jahr 2024 ihren Doktorgrad in Humanmedizin/
Gesundheitswissenschaften an
• Frauenanteil an den
Promovierenden bei 49 %
Im Jahr 2024 befanden sich an den
Hochschulen in Deutschland 212 400 Personen in einem laufenden
Promotionsverfahren. Das waren 7 500 oder 4 % Promovierende mehr als
im Jahr 2023. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter
mitteilt, blieb der Frauenanteil an den Promovierenden mit 49 % (103
500) fast unverändert gegenüber dem Vorjahr (48 %).
Über ein
Viertel promoviert in Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften
Mit
60 300 Personen strebte im Jahr 2024 gut ein Viertel (28 %) der
Promovierenden ihren Doktorgrad in der Fächergruppe
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften an. Die zweitgrößte Gruppe
bildeten die Promovierenden in der Fächergruppe Mathematik,
Naturwissenschaften mit 47 700 Personen (22 %) gefolgt von den
Ingenieurwissenschaften mit 39 200 Promovierenden (18 %) und den
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit
33 300 Promovierenden (16 %).
In den einzelnen Fächergruppen
zeigten sich deutliche Unterschiede in der Geschlechterverteilung.
So waren etwa drei von vier Promovierenden (77 %) in der
Fächergruppe Ingenieurwissenschaften Männer, während in der
Fächergruppen Kunst, Kunstwissenschaft zwei von drei Promovierenden
(67 %) Frauen waren.
In absoluten Zahlen promovierten Männer
am häufigsten in den Ingenieurwissenschaften (30 000), Frauen in der
Fächergruppe Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften (37 400).
16 % der Promovierenden haben 2024 mit der Promotion begonnen
Im Jahr 2024 waren 34 700 Personen (16 % aller Promovierenden)
erstmalig als Promovierende an einer deutschen Hochschule
registriert. Das waren 8 % mehr als im Vorjahr.
Mit
9 500 Personen hatte gut ein Viertel (27 %) der
Promotionsanfängerinnen und -anfänger des Jahres 2024 eine
ausländische Staatsangehörigkeit. Damit lag der Ausländeranteil bei
den Promotionsanfängerinnen und -anfängern etwas höher als bei den
Promovierenden insgesamt (25 %).
17 % der Promovierenden
verteilen sich auf vier Hochschulen Im Jahr 2024 entfielen 17 %
aller Promovierenden auf lediglich vier Hochschulen. Mit
9 700 Personen (5 % der Promovierenden) war die
Ludwig-Maximilians-Universität München die Hochschule mit den
meisten laufenden Promotionsvorhaben, gefolgt von der Technischen
Universität München (9 400 Personen), der Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg (9 300 Personen) und der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule Aachen (7 900 Personen) mit jeweils 4 % aller
Promovierenden.