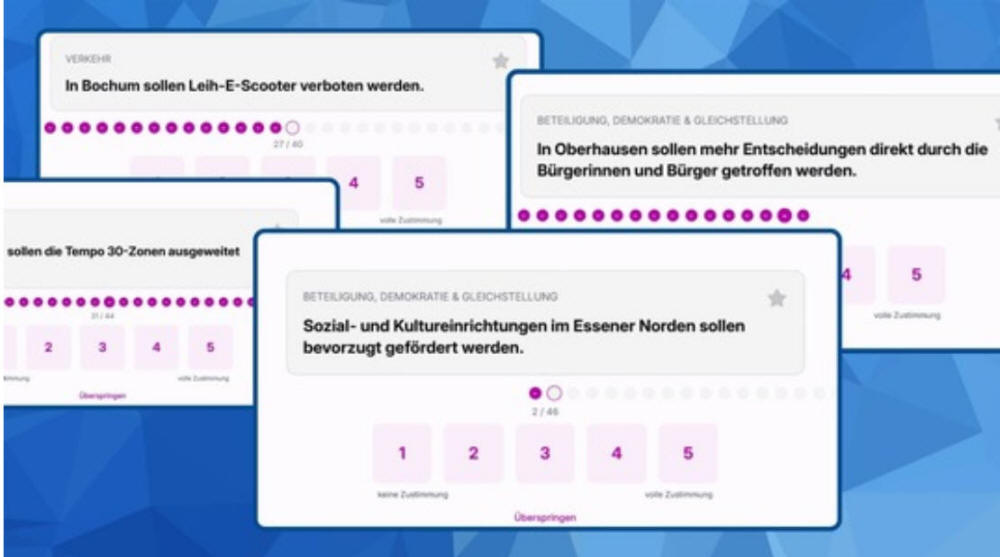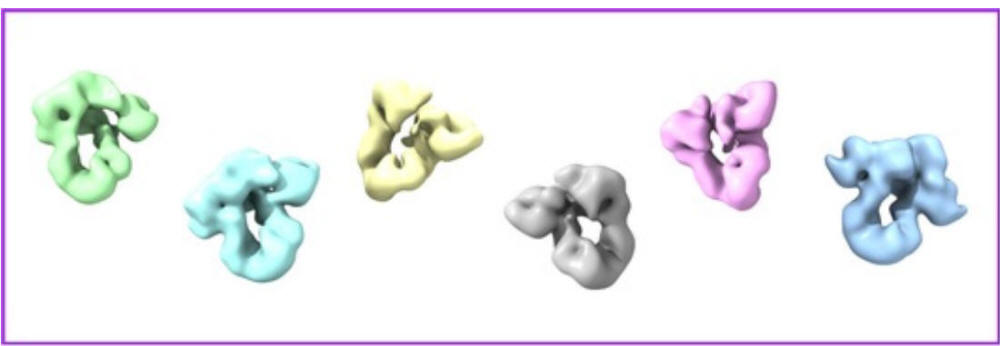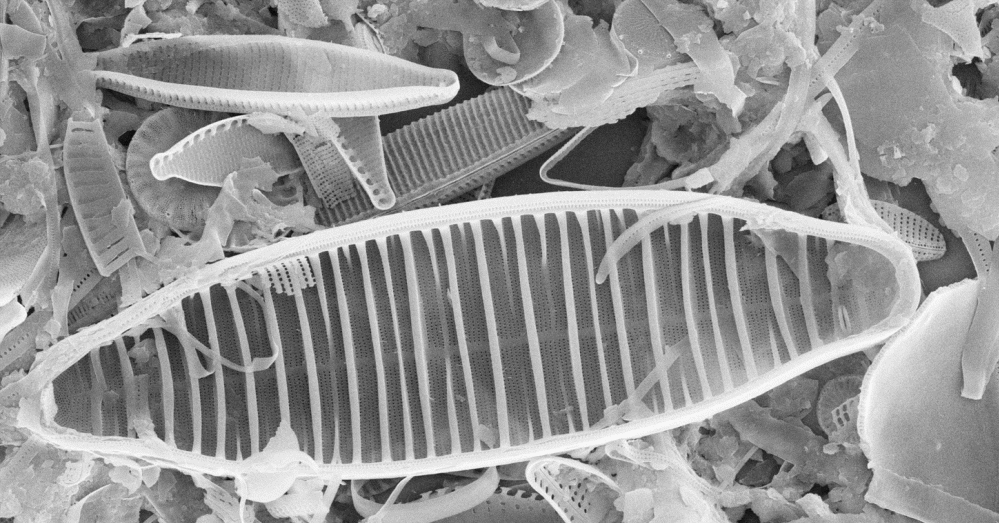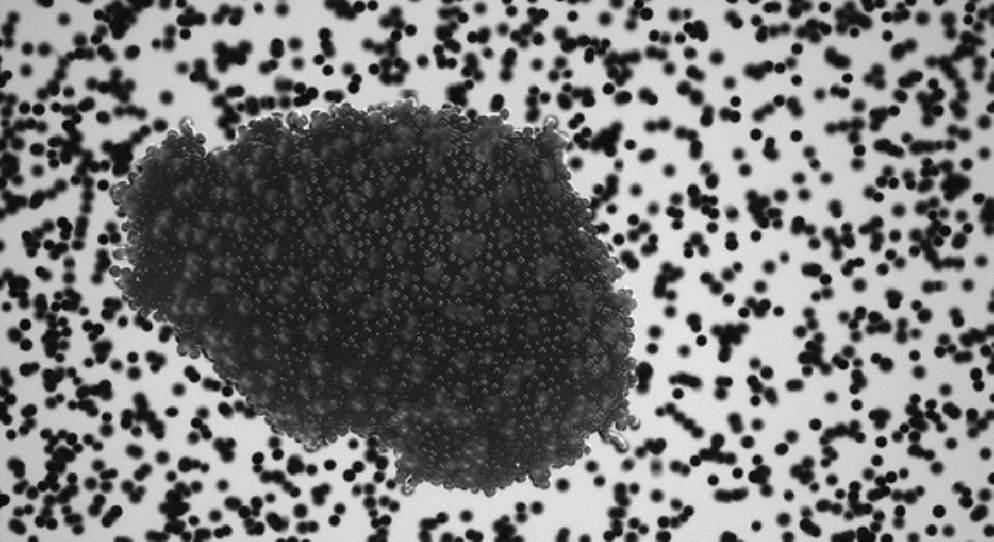|
|
UDE-Termine
• Hochschule
Rhein-Waal
•
Archiv
|
|
|
|
Neue Anlage für synthetisches Erdgas in Duisburg
Licht + Luft = Kraftstoff |
|
Duisburg, 20. Noveember 2025 - Am
Zentrum für Brennstoffzellen-Technik, einem An-Institut der
Universität Duisburg-Essen, nimmt Greenlyte Carbon Technologies am
20. November seine erste kommerzielle Liquid-Solar-Anlage in
Betrieb. Sie basiert auf Prozessschritten, die an der Universität
Duisburg-Essen erforscht und entwickelt wurden.
CO₂ wird aus
der Luft gebunden und grüner Wasserstoff erzeugt – eine Technologie,
die die Ausgangsstoffe für klimaneutrale Kraftstoffe liefert. Die
feierliche Eröffnung übernahm Hendrik Wüst, Ministerpräsident von
Nordrhein-Westfalen, im Beisein weiterer hochrangiger
Vertreter:innen aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft.

Gruppenfoto vor der neuen Anlage mit Ministerpräsident Hendrik Wüst
(1. Reihe, 4.v.l.) und Rektorin Prof. Dr. Barbara Albert (1. Reihe
3.v.r) Copyright: Britt Knautz
Die Direct Air
Capture-Technologie ist darauf ausgelegt, Kohlendioxid (CO₂)
effizient aus der Umgebungsluft zu entfernen und in synthetische
Kraftstoffe umzuwandeln. Bereiche wie Luftfahrt, Schifffahrt und
Industrie können somit ihren Ausstoß an klimaschädlichem CO₂
deutlich senken.
Die nun in Duisburg eröffnete Anlage im
industriellen Maßstab nutzt eine Kombination aus CO2-Bindung und
Wasserelektrolyse, um die Grundstoffe für synthetisches Erdgas zu
erzeugen (Details des Verfahrens: siehe unten). Die Anlage am
Zentrum für Brennstoffzellen-Technik (ZBT) wird jährlich etwa 40
Tonnen CO₂ aus der Luft binden und als Reingas bereitstellen, wovon
ein Teil in der ZBT-eigenen Anlage zu insgesamt fünf Tonnen
synthetischen Erdgases (SNG) umgesetzt wird.
Die modulare
Technik lässt sich leicht skalieren und läuft vollständig elektrisch
– ein Vorteil gegenüber bisherigen Verfahren, die auf hohe
Temperaturen angewiesen sind und deutlich schlechtere Wirkungsgrade
aufweisen.
Die nachhaltige Zukunftstechnologie basiert auf der
15-jährigen Forschungsarbeit von Dr. Peter Behr, der sich an
der Universität Duisburg-Essen intensiv mit dem Prozess des
Carbon Capture auseinandergesetzt und gemeinsam mit Florian
Hildebrand und Dr. Niklas Friederichsen 2022 die Greenlyte
Carbon Technologies GmbH gegründet hat.
An der nun in
Duisburg eröffneten Anlage ist neben dem Lehrstuhl für
Energieverfahrenstechnik und Energiesysteme der Universität
Duisburg-Essen auch der Lehrstuhl für Technische
Thermodynamik der RWTH Aachen beteiligt.* Die Universität
Duisburg-Essen unterstützte, indem ihr Gründungszentrum GUIDE
die Ausgründung begleitete.
„Diese Anlage zeigt
eindrucksvoll, wie Ergebnisse der universitären Forschung in
Startups und industrielle Dimensionen transferiert werden
können“, sagt Prof. Dr. Barbara Albert, Rektorin der
Universität Duisburg-Essen. „Mit Greenlyte wird Wissen aus
der Forschung umgesetzt in moderne Technologie für
Klimaneutralität.“
Mitgründer Dr. Niklas
Friederichsen sieht im Wasserstoff-Testfeld am Campus
Duisburg den idealen Standort für die Liquid-Solar-Anlage:
“Das Wasserstoff-Testfeld des ZBT befindet sich 20 km
entfernt vom Firmensitz der Greenlyte Carbon Technologies.
Wir glauben an schnelle, iterative Entwicklungsprozesse, für
die räumliche Nähe und ein enger Austausch mit den
Kolleg:innen von unschätzbarem Wert sind. Am Standort selbst,
aber insgesamt im Ruhrgebiet, wurde über die letzten Jahre
eine Fülle an Infrastruktur und Wasserstoff-Know-How
aufgebaut, von dem wir als innovatives Unternehmen sehr
profitieren.
Hier können wir unsere Technologie im
industriellen Maßstab weiterentwickeln, um sie robust und
über viele tausend Stunden validiert im nächsten Schritt zu
kommerzialisieren. Die Eröffnung heute ist für uns ein
wichtiger Meilenstein in der Demonstration unserer
Technologie auf industrieller Skala.”
Zur
Verfahrenstechnik: Die Direct-Air-Capture-Technologie basiert
auf einem kontinuierlich betriebenen, dreistufigen Prozess:
Absorption: Umgebungsluft wird durch eine Säule geleitet, in
der Kohlendioxid (CO₂) mit einem unternehmenseigenen
Absorptionsmittel reagiert. Das Gas wird dabei in Form von
Bicarbonat chemisch gebunden. Kristallisation und Trennung:
Die bicarbonatreiche Lösung wird kontrolliert
auskristallisiert. Es bilden sich feste Carbonatkristalle,
die unkompliziert zu handhaben und zu lagern sind.
Elektrochemische Desorption: Eine wässrige Bicarbonatlösung
wird elektrochemisch direkt zu Kohlendioxid (CO2) und
Wasserstoff (H2) umgewandelt. H2 und CO2 stehen direkt als
Ausgangsstoff für die Synthese von synthetischem Kraftstoff
wie z.B. SNG oder Methanol zur Verfügung. Das
Absorptionsmittel wird für den nächsten Zyklus regeneriert.
Die modular aufgebaute Technologie arbeitet mit
ungiftigen Materialien und lässt sich flexibel mit
intermittierenden erneuerbaren Energiequellen koppeln. * Zu
den Investoren von Greenlyte Carbon Technologies gehören
Earlybird, die Green Generation Management GmbH, die Carbon
Removal Partners AG, die AENU Advisor GmbH und Partech.
Partner sind neben der Universität Duisburg-Essen und dem
ZBT unter anderem die Evonik Industries AG, Düsseldorf
Airport, das Max-Planck-Institut für chemische
Energiekonversion, die Aachener Verfahrenstechnik der RWTH
Aachen, die Fumatech BWT GmbH, Uniper SE und MB Energy.
|
|
Nacht der Physik in Duisburg |
|
Experimentieren, staunen, verstehen
Duisburg, 17. November 2025 - Bei der Nacht der Physik an der
Universität Duisburg-Essen darf wieder nach Herzenslust geforscht,
gebaut und gestaunt werden. Am 21. November ab 17 Uhr öffnet die
Fakultät für Physik am Campus Duisburg (Lotharstraße 1) ihre Türen.
Kinder und Erwachsene können bis 23 Uhr Experimente
ausprobieren, Labore besichtigen und entdecken, wie spannend
Wissenschaft im Alltag sein kann. Der Eintritt ist frei, eine
Anmeldung nicht nötig.

Gebannt beobachten junge Besucher ein Experiment bei der Nacht der
Physik. Copyright: UDE/Nicolas Wöhrl
Mit Experimenten, Laborführungen und Vorträgen wecken die
Forschenden der UDE Neugier und Begeisterung für Physik: Im
„schnellsten Labor der Welt“, dem Schullabor des
Sonderforschungsbereichs 1242, wird Licht zum Werkzeug –
Laserstrahlen stoppen die Zeit, Lichtblitze messen
Sekundenbruchteile, und im Laserlabyrinth darf mitgespielt
werden.
Darüber hinaus können Kinder ab zehn Jahren
selbst handwerklich aktiv werden: Sie greifen zu Kabel, Draht
und Schraubenzieher und verwandeln eine einfache Bürste im
Handumdrehen in ein kleines Rennfahrzeug oder bauen ein
solarbetriebenes Spielzeugauto. Den ganzen Abend über öffnen
die Forschungslabore ihre Türen: Im Reinraum lässt sich
verfolgen, wie aus Halbleitern winzige Computerchips
entstehen – von der Lithografie bis zu ultradünnen
Materialien.
Andere Experimente führen ins All: Wie
aus mikroskopisch kleinen Staubkörnchen Planeten wachsen,
zeigen Versuche zu Gravitation und Schwerkraft. Und wer
wissen will, wie man Elektronen in Bewegung bringt, erlebt
bei der Führung „Mit Terahertz-Strahlung auf Elektronenjagd“,
wie Infrarotstrahlen unsichtbare Teilchen sichtbar machen.
Ab 19 Uhr beleuchten Physiker der UDE in Vorträgen
die Kernthemen der Physik – vom All bis zur Quantenwelt. Dr.
Jens Teiser erklärt, warum auf dem Mond die Sanduhr stehen
bleibt, Prof. Dr. Axel Lorke und Prof. Dr. Klaus Hornberger
entführen in die Welt des diesjährigen Physik-Nobelpreises.
Danach wird’s alltagsnah: Dr. Florian Mazur spricht über die
Optimierung von Flughäfen, Prof. Dr. Hendrik Härtig über
politische Bildung im Physikunterricht.
Wer nach dem
Staunen selbst ins Studium starten möchte, findet im Foyer
Ansprechpartner:innen zu Physik, Lehramt Physik und Energy
Science. Lehrende und Studierende berichten aus ihrem Alltag,
erklären das Buddy-System und beantworten Fragen zu
Bewerbung, Studienverlauf und Berufsperspektiven – ganz ohne
Formeln, aber mit viel Begeisterung. Die Veranstaltung ist
auch mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen zugänglich.
|
|
Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung
|
|
Ausgangsbedingungen für mehr
Chancengleichheit
Duisburg, 17. November 2025 -
Kurz vor Inkraftreten des Rechtsanspruchs auf
Ganztagsförderung im Grundschulalter zum Schuljahr 2026/27
ist Deutschland von der flächendeckenden Zugänglichkeit von
Ganztagsangeboten noch weit entfernt. Der soeben erschienene
IAQ-Report der Universität Duisburg-Essen bündelt die
Ausgangsbedingungen für eine erfolgreiche Umsetzung des
Rechtsanspruchs.
Das Team um Prof. Dr. Sybille
Stöbe-Blossey hat darin außerdem die aktuelle Lage
analysiert. Der Ausbau der Ganztagsförderung an Grundschulen
verfolgt ein politisch essentielles Ziel: die Verbesserung
der Chancengleichheit im Bildungssystem. Bereits 2021 wurde
ein ab dem Schuljahr 2026/27 geltender Rechtsanspruch auf
Ganztagsförderung beschlossen.
Damit verbunden ist
das Ziel, allen Kindern im Rahmen des Ganztagsangebots
zusätzliche Bildungs- und Förderangebote zu ermöglichen.
Nicht zuletzt für Kinder, die in schwierigen
Rahmenbedingungen aufwachsen, sollen sich so bessere Chancen
auf Bildung und gesellschaftliche Teilhabe ergeben. Dazu sind
Konzepte erforderlich, die Lernen, Freizeit und individuelle
Förderung verbinden.
Ein Fokus sollte dabei auf
sozialen Kompetenzen, Sprachförderung und kindgerechter
Beteiligung liegen, so die Wissenschaftlerinnen der
IAQ-Forschungsabteilung Bildung, Entwicklung, Soziale
Teilhabe (BEST) unter der Leitung von Prof. Dr. Sybille
Stöbe-Blossey im aktuellen IAQ-Report. „Am besten lassen sich
solche Angebote durch eine kommunal koordinierte
Zusammenarbeit zwischen Schule und Trägern der Kinder- und
Jugendhilfe realisieren“, erläutert Stöbe-Blossey.
Bislang nehmen Kinder aus bildungsbenachteiligten Familien,
die mit Blick auf bessere Bildungschancen in besonderem Maße
eine Förderung benötigen, unterdurchschnittlich oft an
Ganztagsangeboten teil. Hier verweisen die Forscherinnen auf
aktuelle Auswertungen der Kinderbetreuungsstudien (KiBS) des
Deutschen Jugendinstituts (DJI), die im Rahmen einer
Studie für das Deutsche Institut für Sozialpolitikforschung
(DIFIS)* durchgeführt wurden. Besonders benachteiligt
sind demnach Kinder aus Familien, in denen die Eltern einen
niedrigen Bildungsstand haben oder die Betreuungskosten nicht
tragen können.
Fazit: „Die bildungs- und
sozialpolitischen Potenziale der Ganztagsförderung können nur
ausgeschöpft werden, wenn es Angebote gibt, die allen Kindern
den Zugang zu einer kooperativen Förderung ermöglichen. Die
Voraussetzung dafür ist eine finanzielle Förderung, die einen
bedarfsdeckenden Ausbau ermöglicht und die sowohl soziale als
auch kommunale Ungleichheiten berücksichtigt“, erläutert
Prof. Dr. Sybille Stöbe-Blossey.
Am Montag,
24.11.2025 diskutieren Prof. Dr. Sybille Stöbe-Blossey und
Iris Nieding im Rahmen der Onlineveranstaltung „IAQ
debattiert“ u.a. mit Beteiligten aus dem Bundesministerium
für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ)
und aus der kommunalen Praxis die Frage, wie eine
kindorientierte und sozialräumlich verankerte Förderung an
Ganztagsschulen in Kooperation zwischen Schule, Trägern der
Kinder- und Jugendhilfe und kommunalen Akteuren gelingen kann
– und welche Rahmenbedingungen dafür notwendig sind.
* Neimanns, Erik und Antonella Faggin. 2025. Zugangshürden zu
Betreuung im Kita- und Grundschulalter trotz Rechtsanspruch.
DIFIS-Studie 2025-05. Duisburg, Bremen: Deutsches Institut
für Interdisziplinäre Sozialpolitikforschung. Weitere
Informationen: Sybille Stöbe-Blossey, Stella Glaser, Iris
Nieding, Corin Wimmers, 2025: Ganztagsförderung an
Grundschulen: Ein bildungs- und sozialpolitisches Konzept für
mehr Chancengleichheit? Duisburg: Inst. Arbeit und
Qualifikation.
IAQ-Report 2025-11.
|
|
Erste Zukunftskonferenz NRW holt
Landespolitik und -Wissenschaft zur Umsetzung der
Nachhaltigkeitsziele an einen TischDuisburg
|
|
Duisburg-Essen, 13. November 2025 –
Nordrhein-Westfalen steht vor großen gesellschaftlichen,
ökologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen bei den
Themen Klimawandel, Energie-, Wärme- und Mobilitätswende,
Transformation der Industrie, Digitalisierung sowie soziale
Teilhabe und Gerechtigkeit. Wissenschaft und Forschung
spielen eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, tragfähige
Lösungen aufzuzeigen und diese gemeinsam mit Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft umzusetzen. Vor diesem
Hintergrund findet am 12. und 13. November 2025 an der
Universität Duisburg-Essen die erste Zukunftskonferenz NRW
statt.
Themenbereiche
Im Zentrum der Konferenz
stehen die folgenden Themen:
Klimawandel und Gesundheit
Klimaanpassung und Resilienz
Integration, Bildung und
Teilhabe
Industrietransformation und Kreislaufwirtschaft
Transport und Mobilitätswende
Energie- und Wärmewende
Gesellschaftliches Miteinander
Bildung für
nachhaltige Entwicklung (BNE)
Entwicklung von Indikatoren
für Forschung, Lehre und Transfer

Ministerin Brandes bei der ersten Zukunftskonferenz NRW ©
Malte Reiter Fotografie
v.l.n.r Prof. Dr. Oliver Locker
Grütjen, Präsident der Hochschule Rhein-Waal und Sprecher der
Nachhaltigkeitsallianz NRW der Hochschulen für Angewandte
Wissenschaften, Wissenschaftsministerin Ina Brandes MdL,
Schirmherrin der Zukunftskonferenz NRW, Prof. Dr. Birgitta
Wolff, Rektorin der Bergischen Universität Wuppertal und
Sprecherin der Nachhaltigkeitsinitiative der Universitäten
Humboldtⁿ, Prof. Dr.-Ing. Manfred Fischedick, Präsident und
wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal Instituts
sowie Co-Sprecher von Humboldtⁿ
16 Universitäten, 20
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in
Nordrhein-Westfalen – so auch die drei Universitäten
Duisburg-Essen, Bochum und Dortmund in der
Universitätsallianz Ruhr sowie außeruniversitäre
Forschungseinrichtungen, wie insbesondere das Wuppertal
Institut, bündeln an diesen beiden Tagen erstmals ihre
Expertise im Rahmen einer gemeinsamen Konferenz und machen
damit deutlich: Die Wissenschaft stellt sich in den Dienst
der großen Transformationsaufgaben des Landes und engagiert
sich dafür, die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der Agenda
2030 voranzutreiben und den Transformationsprozess in
Nordrhein-Westfalen aktiv mitzugestalten.
Die
Zukunftskonferenz NRW wurde von der Nachhaltigkeitsinitiative
der Universitäten Humboldtⁿ sowie der Nachhaltigkeitsallianz
NAW.NRW der Hochschulen für angewandte Wissenschaften in
Nordrhein-Westfalen ins Leben gerufen.
Die erste
Zukunftskonferenz NRW wird vom Ministerium für Kultur und
Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert.
Ina Brandes, Wissenschaftsministerin und Schirmherrin der
Zukunftskonferenz NRW: „Die Dichte und Exzellenz unserer
Forschungslandschaft mit hervorragenden Universitäten,
Hochschulen für Angewandte Wissenschaft und
Forschungsinstituten ist einzigartig in Europa. Die
Zukunftskonferenz bündelt die herausragende Expertise und
bringt Politik, Wissenschaft und Wirtschaft an einen Tisch.
Besonders die enge Zusammenarbeit von Universitäten und
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften ist ein großer
Gewinn: Sie verbindet exzellente Forschung mit praxisnaher
Lehre und direktem Transfer in Wirtschaft und Gesellschaft.
Nur im engen Zusammenschluss wird es gelingen, unsere
Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.“
Kooperationsraum
für Synergien
Prof. Dr. Birgitta Wolff, Rektorin der
Bergischen Universität Wuppertal und Sprecherin der
Nachhaltigkeitsinitiative der Universitäten Humboldtⁿ,
verdeutlicht: „Nordrhein-Westfalen ist Wissenschaftsland. Mit
dieser Konferenz schaffen wir ein Scouting- und
Kooperationsformat, um Lösungsansätze aus der Tiefe der
NRW-Forschungscommunity sichtbarer zu machen und in die
Umsetzung zu bringen. Wir wollen die besten Ideen und Köpfe
zusammenbringen, um die Umsetzung der
Nachhaltigkeitsstrategie NRW gemeinsam voranzubringen.“
Prof. Dr. Oliver Locker-Grütjen, Präsident der Hochschule
Rhein-Waal und Sprecher der Nachhaltigkeitsallianz NRW der
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, betont: „Die
Herausforderungen von Klimawandel, Energiewende und sozialer
Teilhabe lassen sich nur gemeinsam lösen. Die
Zukunftskonferenz NRW ist ein starkes Signal dafür, dass
unsere Hochschulen gemeinsam Verantwortung übernehmen – über
Fächergrenzen und Hochschultypen hinweg. Wir danken der
Universität Duisburg-Essen, die den Raum dafür auf ihrem
Campus zur Verfügung stellt und dem Ministerium für die
Unterstützung.“
Prof. Dr.-Ing. Manfred Fischedick,
Präsident und wissenschaftlicher Geschäftsführer des
Wuppertal Instituts sowie Co-Sprecher von Humboldtn, stellt
heraus: „Gerade in der heutigen Zeit, die durch vielfältige
geopolitische Krisen eine zunehmende gesellschaftliche
Polarisierung und hohe Verunsicherung geprägt ist, kommt es
ganz entscheidend darauf an, dass die wissenschaftlichen
Akteurinnen und Akteure des Landes ihre Kräfte bündeln und in
die Erarbeitung konkreter Lösungsbeiträge einbringen. Gerade
in NRW mit seiner exzellenten Wissenschaftsbasis sind die
Voraussetzung dafür sehr gut.“
Zum Ablauf der
Konferenz
Diese Konferenz vereint Spitzenforschende aus
Nordrhein-Westfalen und bündelt die Expertise führender Köpfe
aus Forschung und Transfer des Landes, um die nachhaltige
Transformation voranzutreiben.
In sogenannten
Zukunftswerkstätten geschieht die eigentliche fachliche
Arbeit auf der Konferenz. Diese orientieren sich thematisch
weitgehend an der Empfehlung des NRW-Nachhaltigkeitsbeirats
für die Landesregierung zu Nordrhein-Westfalen-spezifischen
Transformationsbereichen. Drei Beispiele für die Werkstätten
sind „Klimawandel und Gesundheit“, „Transport und
Mobilitätswende“ und „Gesellschaftliches Miteinander“. Das
innovative Werkstattformat ermöglicht einen intensiven,
konzentrierten wissenschaftlichen Austausch zu den jeweiligen
Themen: Die Beteiligten können Forschungsfragen entwickeln,
Impulse für konkrete Umsetzungsideen setzen sowie Potenziale
für künftige Forschungskooperationen ausloten.
Exzellent ausgewiesene Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler leiten die Themenbereiche. Sie strukturieren
die Diskussion, bringen ihr Know-how ein und sorgen für die
Verknüpfung von Forschung, Transfer und gesellschaftlichen
Bedarfen. Im Nachgang der Veranstaltung werden unter
www.zukunftskonferenz.nrw weitere Informationen zu diesen
„Themenpatinnen und Themenpaten“ veröffentlicht. Sie stehen
auch nach der Zukunftskonferenz als Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartner, Vermittlerinnen und Vermittler für die
wissenschaftsbasierte Politikberatung in Nordrhein-Westfalen
zur Verfügung.
Die erste Zukunftskonferenz setzt den
Startpunkt für weitergehende Aktivitäten der beteiligten
Partner. Über verschiedene Folgeformate wird sichergestellt,
dass die Wissenschaftscommunity des Landes ihr Know-how auch
über den Auftakt hinaus in das Erreichen der
Nachhaltigkeitsziele investiert. Die Ideen hierfür sowie zur
Einbeziehung des wissenschaftlichen Nachwuchses ab 2026
werden im Rahmen der Konferenz weiter präzisiert.
|
|
Förderung für
Tumorforschung - Bessere Therapie gegen Krebs des oberen
Verdauungstrakts
|
|
Duisburg, 13.
November 2025 - Ein internationales Forschungsteam geht neue
Wege im Kampf gegen Krebs des oberen Verdauungstrakts.
Maßgeblich daran beteiligt sind Wissenschaftler:innen der
Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen. In
ihrem Fokus stehen sogenannte Radionuklid-Theranostika.
Das sind Medikamente, die Krebszellen gleichzeitig
aufspüren und mit gezielter Strahlung zerstören können. Sie
sollen in Zukunft auch bei Krebs des oberen Verdauungstrakts
eingesetzt werden. Gefördert wird das Vorhaben von „Stand Up
To Cancer“ für 18 Monate bis März 2027 mit rund 357.000 Euro.
Rund 200.000 Euro fließen an die Forschenden in Essen.

Die in Essen forschenden Teammitglieder (v.l.n.r.) Dr.
Valeska von Kiedrowski, Dr. Kim Fischer, Dr. Lisa Rennau,
Prof. Dr. Katharina Lückerath, Dr. Marija Trajkovic-Arsic und
Prof. Dr. Jens Siveke (Medizinische Fakultät / privat)
Krebserkrankungen des oberen Verdauungstrakts zählen
weltweit zu den aggressivsten Tumorarten mit oft ungünstiger
Prognose. Ziel des Forschungsprojektes ist, vor allem gegen
Krebs des oberen Verdauungstrakts gezieltere Behandlungen zu
entwickeln – mit besseren Heilungschancen und weniger
Belastung für die Betroffenen. „Wir konzentrieren uns auf
Radionuklid-Theranostika, weil diese zwei Funktionen ausüben
können“, sagt Prof. Dr. Ken Herrmann, Direktor der Klinik für
Nuklearmedizin des Universitätsklinikums Essen (UK Essen).
„Diese Medikamente machen Tumorzellen für bildgebende
Verfahren sichtbar und zerstören sie gleichzeitig mit
radioaktiver Strahlung. Dabei wirken sie gezielter als andere
Mittel, schonen gesundes Gewebe und verursachen weniger
Nebenwirkungen als klassische Chemotherapien.“ Bisher können
Radionuklid-Theranostika nur bei wenigen Krebsarten zum
Einsatz kommen. Das Konsortium möchte herausfinden, wie das
Prinzip auf Krebs des oberen Verdauungstrakts übertragen
werden kann.
Das Projekt bringt
Forschungspartner:innen aus den USA und Deutschland zusammen:
Verantwortlich sind Prof. Dr. Ken Herrmann und Eric Fischer,
PhD., Professor of Biological Chemistry and Molecular
Pharmacology am Dana-Farber Cancer Institute in Boston.
Unterstützt wird Professor Herrmann am UK Essen von Prof. Dr.
Jens Siveke, Dr. Marija Trajkovic-Arsic, Dr. Valeska von
Kiedrowski sowie von Prof. Dr. Katharina Lückerath.
Während das Team in Boston neue Wirkstoffe identifiziert,
entwickeln die Forschenden am UK Essen diese zu sogenannten
radioligandbasierten Medikamenten weiter, um sie künftig zu
erproben. Das Team arbeitet sowohl mit bereits gut
erforschten Angriffspunkten auf Tumorzellen als auch an der
Entdeckung neuer Strukturen, die sich für gezielte Therapien
eignen.
|
|
Wie Stressfaktoren das Leben in Flüssen formen
|
|
Erste weltweite Auswertung
Duisburg, 12. Noveember 2025 -
Süßgewässer verlieren unter dem Einfluss vieler
gleichzeitiger Belastungen schneller Arten als jedes andere
Ökosystem. Ein Forschungsteam um Biolog:innen der Universität
Duisburg-Essen hat nun erstmals vergleichend analysiert, wie
verschiedene Stressfaktoren weltweit auf fünf Gruppen von
Flussorganismen wirken. Die Ergebnisse, veröffentlicht in
Nature Ecology & Evolution, liefern eine Grundlage für
künftige Vorhersagen.

Versalzung ist ein weltweites Problem, vor allem in trockenen
Regionen, und betrifft Gewässer und Landlebensräume
gleichermaßen. © Dirk Jungmann
Landwirtschaft,
Abwässer, Staudämme, die Abschwemmung feiner Sedimente von
Äckern und nicht zuletzt der Klimawandel mit seinen
steigenden Temperaturen verändern Qualität und Struktur von
Süßwasserökosystemen, vor allem von Flüssen. Doch bislang
fehlte ein klares Bild, wie einzelne, menschgemachte
Stressfaktoren auf verschiedene Artengruppen wirken.
Ein Team um Erstautor Dr. Willem Kaijser von der
Arbeitsgruppe Aquatische Ökologie der Universität
Duisburg-Essen (UDE) hat diese Lücke nun geschlossen. Die
Forschenden sichteten mehr als 22.000 Fachartikel und
analysierten 1.332 Datensätze aus 276 Studien. Daraus
entstand die erste globale Zusammenfassung, die
Belastungsfaktoren mit den Reaktionen von fünf wichtigen
Organismengruppen in Beziehung setzt: Mikroorganismen, Algen,
Wasserpflanzen, wirbellose Tiere und Fische.
Über
alle Gruppen hinweg steht die Artenvielfalt besonders mit
folgenden Belastungsfaktoren in Zusammenhang: erhöhter
Salzgehalt, Sauerstoffmangel und übermäßige
Sedimentablagerungen. Diese Faktoren treten oft gemeinsam auf
und verschlechtern Lebensbedingungen – etwa durch
Stoffwechselstress oder verschlammte Lebensräume.
Andere Einflüsse wie Nährstoffanreicherung und Erwärmung
wirken je nach Artengruppe unterschiedlich. Manche Algen
profitieren von moderaten Nährstoffmengen, die ihr Wachstum
und ihre Artenzahl fördern können. Höhere Wasserpflanzen
hingegen verlieren an Vielfalt, wenn Salzgehalt oder
Nährstoffeinträge steigen. Wirbellose und Fische leiden
besonders unter Sauerstoffmangel und feinen
Sedimentablagerungen, die ihre Lebensräume überdecken.
Die Forschenden nutzten statistische Modelle und
Wahrscheinlichkeitstheorien, um diese Zusammenhänge sichtbar
zu machen und Wechselwirkungen zwischen den Stressoren zu
erkennen. Denn diese wirken oft zusammen und nicht selten
unterscheiden sich die Zusammenhänge zwischen Regionen und
Organismengruppen. Dennoch zeichnen sich Muster ab, die für
den Gewässerschutz entscheidend sind: „Salz, Sedimente und
Sauerstoffmangel schaden fast immer“ fasst Prof. Dr. Daniel
Hering zusammen.
„Unsere Analysen erlauben es nun,
diese Zusammenhänge zu quantifizieren und für Vorhersagen
nutzbar zu machen“. Die Studie entstand im
Sonderforschungsbereich RESIST der Deutschen
Forschungsgemeinschaft, der an der UDE koordiniert wird.
Originalpublikation:
https://doi.org/10.1038/s41559-025-02884-4
|
|
Kein
Wahlwunder, aber viel Erkenntnis - Politik am Kiosk
|
|
Duisburg, 3.
November 2025 - Kiosk, Büdchen, Bude oder Trinkhalle – sie
sind mehr als Verkaufsstellen für Zeitungen, Süßigkeiten und
Co. Oft sind sie Treffpunkte der Nachbarschaft, Orte des
Austauschs und soziale Knotenpunkte. Ihre Betreiber:innen
sind in ihren Vierteln teils bekannter als so mancher
politischer Akteur.
Können ihre Aufrufe die
Wahlbeteiligung erhöhen? Wohl nicht, so das Ergebnis eines
Feldexperiments während der Kommunalwahl im September 2025 in
Nordrhein-Westfalen. Wichtige Erkenntnisse für die politische
Bildung hat das Projekt der Arbeitsgruppe Empirische
Politikwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen dennoch
gebracht.
Rund sechs Wochen vor der Kommunalwahl am
14. September 2025 wurden an zufällig ausgewählten
Straßenkiosken in acht Großstädten (Bielefeld, Dortmund,
Duisburg, Düsseldorf, Essen, Köln, Münster und Wuppertal)
Wahlaufrufe der Betreiber:innen angebracht. Die Idee der
Arbeitsgruppe Empirische Politikwissenschaft an der
Universität Duisburg-Essen (UDE) in Kooperation mit der
Universität Bamberg dahinter: Kioskbesitzer:innen gelten in
ihren Vierteln als vertraute Gesichter und
Multiplikator:innen. Ihr persönlicher Appell sollte die
Menschen nicht nur an die Wahl erinnern, sondern auch als
glaubwürdiger und nahbarer wahrgenommen werden. So sollte das
Gefühl entstehen, dass Wählen ein gemeinschaftliches,
erwünschtes Verhalten ist – und die Plakate zugleich
Gespräche über die Wahl in der Nachbarschaft anregen.
115 Kioske nahmen am Projekt teil, 28 von ihnen erhielten ein
personalisiertes Plakat mit Foto der Betreiber:innen, 87
Kioske erhielten Plakate ohne Foto. Die Auswertung der
Wahldaten ernüchtert jedoch: Die Plakataktion hatte keinen
messbaren Einfluss auf die Wahlbeteiligung. Auch in den
Stimmbezirken mit personalisierten Plakaten lag der
Unterschied bei lediglich 0,3 Prozentpunkten – „zu gering, um
von einem echten Effekt zu sprechen“, erklärt Projektleiter
Prof. Dr. Achim Goerres. Der Politikwissenschaftler zeigt
sich selbst überrascht: „Es zeigt sich: Selbst lokal sehr
bekannte Personen wie Kioskbesitzer:innen können mit ihrer
Kampagnenunterstützung keine Mobilisierung im städtischen
Nahraum herbeiführen.“
Ganz ohne Wirkung blieb die
Aktion nicht: In Interviews mit 20 Kioskbesitzer:innen zeigte
sich, dass das Projekt vielerorts positiv wahrgenommen wurde
– als Zeichen von Engagement und Zusammenhalt. Zugleich
berichten jedoch viele von geringem politischen Interesse in
der Nachbarschaft. Eine ergänzende Bevölkerungsbefragung mit
rund 600 Teilnehmenden soll nun weitere Aufschlüsse über
Wahrnehmung und Wirkung der Aktion liefern.
„Kioskbesitzer:innen sind bereit, sich für die Community zu
engagieren“, so Goerres. Letztendlich zeige diese Studie
aber: „Nur Bildung, vor allem politische Bildung, in der
Schule sowie eine spannende politische Auseinandersetzung
treiben die Wahlbeteiligung sicher nach oben.“
|
|
- Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie fördert neues Projekt
- Neue Methode
verbessert Prognose und Therapie von Prostatakrebs
|
|
Mit
laseraktivierten Antikörpern gegen Magen- und Darmkrebs
Duisburg, 28. Oktober 2025 - Das Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie (BMWE) fördert ein gemeinsames
Forschungsprojekt des Instituts für Anatomie an der
Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen und der
Immunotools GmbH mit über einer halben Million Euro. Unter
der Leitung von Dr. Irina Kube-Golovin forscht ein Team des
Instituts für Anatomie dabei an der Entwicklung neuartiger
Therapien zur Behandlung gastrointestinaler Karzinome.
Ziel des Vorhabens ist die Verbindung von
MXen-Nanomaterialien mit tumorspezifischen Antikörpern, um
Darm- und Magentumoren gezielt bekämpfen zu können. Das Ziel
des Projektes ist es, einen wichtigen Beitrag zur
Weiterentwicklung moderner, personalisierter Krebstherapien
zu leisten.

Copyright: Irina Kube-Golovin (generiert mit KI)
Im
Zentrum der Forschung stehensogenannte
MXen-Antikörper-Konjugate, also zwei chemisch miteinander
verbundene Moleküle: winzige, hoch leitfähige
Nanomaterialien, verknüpft mit Antikörpern. Die Antikörper
richten sich gegen Oberflächenmoleküle, die auf Krebszellen
vorkommen: CEACAM5 (Carcinoembryonic Antigen-related Cell
Adhesion Molecule 5) und GPA33 (Glycoprotein A33). Beide
Moleküle kommen auf vielen Tumorzellen stark erhöht vor,
GPA33 insbesondere bei Darmkrebs, CEACAM5 vor allem bei
Magenkarzinomen.
Diese neuartigen
MXen-Antikörper-Konjugate haben die Funktion, Tumorzellen
gezielt zu erkennen und zu binden. Wird das Tumorgewebe
anschließend mit Infrarotlaser bestrahlt, wandeln die MXene
das Licht in Wärme um. In dieser sog. photothermalen
Tumortherapieansatz werden die Krebszellen lokal überhitzt
und zerstört, ohne umliegendes gesundes Gewebe zu schädigen.
„Unser Ansatz verbindet die Präzision von Antikörpern mit
den physikalischen Vorteilen neuartiger Nanomaterialien“,
erklärt Dr. Irina Kube-Golovin. „Dadurch können wir
Tumorzellen gezielt angreifen und gleichzeitig die Belastung
für Patient:innen verringern.“
Im Forschungsprojekt
arbeiten drei Akteure Hand in Hand: In der
Universitätsmedizin Essen werden Antikörper gegen CEACAM5
hergestellt und die biologische Wirksamkeit und Sicherheit
der MXen-Antikörper-Konjugate untersucht. Die Immunotools
GmbH im niedersächsischen Friesoythe fokussiert sich auf die
Produktion von Antikörpern gegen das Oberflächenmolekül GPA33
sowie die Etablierung neuer Antikörper-Kopplungsverfahren und
das im polnischen Posen ansässige Unternehmen NanoCarbonTech
produziert und optimiert die MXen-Nanomaterialien.
„Langfristig könnte der Ansatz dazu beitragen, neue,
minimalinvasive Behandlungs-strategien für Patient:innen mit
soliden Tumoren zu entwickeln, insbesondere für Fälle, in
denen herkömmliche Therapien an ihre Grenzen stoßen“, so Dr.
Kube-Golovin.
PROMISE erhält Preis der
Deutschen Hochschulmedizin 2025
Neue
Methode verbessert Prognose und Therapie von Prostatakrebs
Der Preis der Deutschen Hochschulmedizin 2025
geht an die internationale Initiative PROMISE*. Das
Forschungsteam unter Federführung der Universitätsmedizin
Essen entwickelte eine Methode, um mit hochgenauer Bildgebung
den Verlauf von Prostatakrebs noch präziser vorherzusagen und
Therapien individueller zu steuern.
Das Projekt ist
ein herausragendes Beispiel für eine internationale und
interdisziplinäre Zusammenarbeit, die Forschungsergebnisse in
Rekordzeit in die klinische Anwendung überführt.

Mit der PSMA-PET, einem hochmodernen Bildgebungsverfahren,
können Prostatakrebszellen und ihr Ausbreitungsstadium im
Körper besonders präzise sichtbar gemacht werden.
UDE/Wolfgang Fendler
Prostatakrebs ist mit jährlich
rund 65.000 Neuerkrankungen die häufigste Krebserkrankung bei
Männern in Deutschland, 2020 starben rund 15.000 Patienten,
etwa jeder elfte Mann erkrankt im Laufe seines Lebens daran.
Für Mediziner:innen ist es eine Herausforderung, den Verlauf
frühzeitig und abhängig von der Aggressivität richtig
einzuschätzen und eine passende Therapie zu wählen. Damit das
gelingen kann, ist eine verständliche Vermittlung der Befunde
und des individuellen Risikos notwendig.
Das
PROMISE-Team nutzte für die Risikobewertung die PSMA-PET**,
ein hochmodernes Bildgebungsverfahren, mit dem sich
Prostatakrebszellen besonders präzise und ihr
Ausbreitungsstadium im Körper sichtbar machen lassen. Da die
Methode empfindlicher ist als ältere Verfahren, mussten ihre
Befunde zunächst in neue Behandlungsempfehlungen übersetzt
werden – ein Prozess, den PROMISE maßgeblich geprägt hat.
In einer der größten Studien weltweit wertete das Team
Bilddaten von über 15.000 Patienten aus. Gemeinsam mit
international führenden Forschungseinrichtungen entwickelte
es daraus das PROMISE-Schema – eine Methode, mit der sich
individuelle Risikoprofile auf Basis der PSMA-PET deutlich
präziser bestimmen lassen. Darauf aufbauend entstanden
Nomogramme, also Vorhersagemodelle für das individuelle
Risiko, die für Ärzt:innen und Patient:innen verständlich
aufbereitet und zur gemeinsamen Therapieentscheidung nutzbar
sind.
Neuer Standard gesetzt Besonders beeindruckend:
die schnelle Übertragung der Forschungsergebnisse in die
klinische Praxis. Bereits wenige Monate nach der
Veröffentlichung wurden die neuen Modelle in die deutsche
S3-Leitlinie Prostatakarzinom aufgenommen und bilden für
Mediziner:innen die maßgebliche Empfehlung für die
Behandlung. Auch international gilt die Methode inzwischen
als Standard.
„Mit PROMISE können wir Patienten und
Ärzt:innen erstmals eine verlässliche Grundlage für
individuell abgestimmte Therapieentscheidungen bieten“,
erklärt dazu Prof. Dr. Wolfgang Fendler, Projektleiter und
leitender Oberarzt in der Klinik für Nuklearmedizin am
Universitätsklinikum Essen.
„Wir sind stolz, dass
unsere Arbeit inzwischen weltweit als Standard anerkannt ist
und die Prostatakrebsdiagnostik nachhaltig verändert.“ „Die
Jury war beeindruckt von der Teamleistung und der
wissenschaftlichen Exzellenz des PROMISE-Projekts, das eine
der größten Herausforderungen in der Urologie angegangen
ist“, heißt es in der Begründung. Das Projekt habe
Forschungsergebnisse in beeindruckender Geschwindigkeit in
klinische Leitlinien überführt und damit gezeigt, wie
universitärer Forschergeist direkt der Patientenversorgung
zugutekommt.
PROMISE bietet Ärzt:innen und Patienten
ein verlässliches Werkzeug für gemeinsame
Therapieentscheidungen und stärke durch nachvollziehbare,
individualisierte Diagnosen das Vertrauen in die Medizin.
Damit setze das Team neue internationale Maßstäbe für
vernetzte und innovative Hochschulmedizin.
Der Preis
der Deutschen Hochschulmedizin wird jährlich vom
Medizinischen Fakultätentag und dem Verband der
Universitätsklinika Deutschlands verliehen. Er zeichnet
innovative Forschungsprojekte mit hoher Relevanz für die
Patient:innenversorgung und Gesellschaft aus. Die mit 25.000
Euro dotierte Auszeichnung wird am 26. November 2025 in
Berlin im Rahmen des Tages der Hochschulmedizin vergeben.
Über die Preisträger entscheidet eine Jury aus
Vertretungen von Universitätsmedizin,
Patientenorganisationen, Industrie und Forschung.
*PROstate cancer Molecular Imaging Standardized Evaluation
**Prostata-spezifische Membran-Antigen
Positronen-Emissions-Tomographie
|
|
50 Jahre „Poet in Residence“ an der UDE |
|
Wo kommen
wir her, wo wollen wir hin?
Duisburg, 23.
Oktober 2025 - Seit 50 Jahren kommen Autorinnen und Autoren
als „Poets in Residence“ an die Universität Duisburg-Essen –
für Lesungen, Seminare und Poetikvorlesungen. Die
Einrichtung, 1975 nach US-amerikanischem Vorbild begründet,
bringt jedes Semester eine Stimme der Gegenwartsliteratur ins
Ruhrgebiet.
Von Literaturnobelpreisträger Günter
Grass über Kinder- und Jugendbuchautorin Kirsten Boie bis hin
zur frisch mit dem deutschen Buchpreis ausgezeichneten
Dorothee Elminger folgten 88 Autor:innen der Einladung. Ab
dem 4. November sind nun aus Anlass des Jubiläums gleich drei
Poets in Residence zu Gast in Essen: Karosh Taha, Dinςer
Güςyeter und Ralf Rothmann.
Den Auftakt der Reihe
machte 1975 einer der wichtigsten deutschen Autoren: Martin
Walser. Er hielt als erster Poet in Residence seine
Poetik-Vorlesungen noch an der damaligen
Universität-Gesamthochschule Essen. Seitdem kommen auf
Einladung des germanistischen Instituts regelmäßig namhafte
Schriftsteller:innen ins Ruhrgebiet.
„Für unser
50-jähriges Jubiläum haben wir drei wichtige Stimmen der
deutschen Gegenwartsliteratur mit Anbindung an die Region zu
uns eingeladen“, so Literaturwissenschaftlerin Prof. Dr.
Alexandra Pontzen, die die Reihe im Wintersemester 2025/2026
mit den Kolleginnen Dr. Anna Quednau und Prof. Dr. Corinna
Schlicht organisiert.
Unter dem Motto „Wo kommen wir
her, wo wollen wir hin? Schreiben und Identität in der
Gegenwart“ werden an drei Nachmittagen jeweils um 16:00 Uhr
in R11 T00 D03 (Hörsaal gegenüber der Bibliothek, Campus
Essen) Poetikvorlesungen, Lesungen und Gespräche mit
Studierenden und der interessierten Öffentlichkeit
stattfinden. Alle Veranstaltungen sind öffentlich und
kostenfrei.
Die Termine
4. November: Karosh Taha:
„Schreiben in Zeiten des Krieges und Völkermordes“.
Poetikvorlesung und Gespräch
Karosh Taha, 1987 im
irakischen Zaxo geboren, kam 1997 mit ihren kurdischen Eltern
nach Deutschland. An der Universität Duisburg-Essen und an
der University of Kansas/USA absolvierte sie ein
Lehramtsstudium in den Fächern Englisch und Geschichte und
arbeitete zeitweise als Lehrerin.
Ihren Debütroman
Beschreibung einer Krabbenwanderung veröffentlichte sie 2018.
Karosh Taha setzt sich in ihrem literarischen Werk mit
postmigrantischen Perspektiven auf das Leben in Deutschland
auseinander. Mit Im Bauch der Königin erschien 2020 das
zweite Buch der mehrfach ausgezeichneten Schriftstellerin.
11. November: Dinςer Güςyeter: „Zwei Asylsuchende in
einer Brust“. Poetikvorlesung und Gespräch
Dinςer Güςyeter
wurde 1979 in Nettetal geboren, wo er auch heute noch lebt.
Er absolvierte eine Ausbildung als Werkzeugmechaniker und
gründete 2012 den unabhängigen Elif Verlag mit dem
Programmschwerpunkt Lyrik, in dem auch Teile seines eigenen
Werkes verlegt sind. Es folgten Einzelbände und Anthologien
mit bundesweit zahlreichen Lesungen.
2017 erschien Aus
Glut geschnitzt, im Jahr 2021 Mein Prinz, ich bin das Ghetto
und 2022 der Roman Unser Deutschlandmärchen, der 2023 mit dem
Preis der Leipziger Buchmessen ausgezeichnet wurde. Der Text
wurde in verschiedenen Theateradaptionen inszeniert. Güςyeter
ist Mitgründer des PEN Berlin.
18. November: Ralf
Rothmann: „Museum der Einsamkeit". Lesung und Gespräch
Ralf Rothmann wurde 1953 in Schleswig geboren, wuchs im
Ruhrgebiet auf und lebt heute in Berlin. Er arbeitete nach
seiner Maurerlehre in verschiedenen Berufen, unter anderem im
Universitätsklinikum Essen. Seinen frühen Romane Stier
(1991), Wäldernacht (1994), Milch und Kohle (2000) und Junges
Licht (2004) spiegeln das Leben und Arbeiten im Revier. Ralf
Rothmann beschreibt sein eigens Schreiben als
„autobiografisch getönt“. Seine Romane, Erzählungen und
Gedichte wurden vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem
Kunstpreis des Landes Nordrhein-Westfalen 2025. An der UDE
liest er aus seinem neuen Erzählband.
|
|
Dr. Volker Wissing: Gastprofessur für
Politikmanagement der Stiftung Mercator |
|
Duisburg, 14. Oktober 2025 -
FDP-Generalsekretär, Brückenbauer der Ampelkoalition,
Doppelminister: All diese Positionen verbindet man mit Dr.
Volker Wissing. Der ehemalige Spitzenpolitiker lehrt in
diesem Wintersemester an der NRW School of Governance der
Universität Duisburg-Essen – als Gastprofessor für
Politikmanagement der Stiftung Mercator. In einem Seminar
vermittelt er Masterstudierenden seine Erfahrungen aus fast
20 Jahren Parlaments- und Regierungsarbeit. Eine öffentliche
Vorlesung ist ebenfalls geplant.

Dr. Volker Wissing. Foto: Dominik Konrad
Zuerst das
Land, dann die Partei: Diese Überzeugung begleitet den
promovierten Juristen Dr. Volker Wissing (Jg. 1970) bis
heute. Im Laufe seiner politischen Karriere war er
FDP-Bundestagsabgeordneter (ab 2004), finanzpolitischer
Sprecher seiner Fraktion, Minister für Wirtschaft, Verkehr,
Landwirtschaft und Weinbau in Rheinland-Pfalz (2016-2021),
Generalsekretär der FDP (2020-2024) und ab 2021
Bundesminister für Digitales und Verkehr.
Nach dem Bruch
der Ampelkoalition im November 2024 trat Dr. Wissing aus der
FDP aus, blieb aber als parteiloser Minister im Amt – aus
„politischer Verantwortung“, wie er sagte. Zusätzlich
übernahm er das Justizministerium.
„Dr. Volker Wissing
hat in politisch turbulenten Zeiten zentrale Zukunftsthemen
gestaltet – von der digitalen Verwaltung über moderne
Infrastruktur bis hin zu rechtspolitischen Reformen. Dass er
dieses Praxiswissen an unsere Studierenden weitergibt,
schätzen wir sehr“, sagt PD Dr. Julia Schwanholz, die mit Dr.
Kristina Weissenbach das Seminar leiten wird. Diese ergänzt:
„Ob es um Führungsstile, politische Kommunikation oder die
Frage geht, wie Vertrauen in Institutionen entsteht: Wer
könnte besser Einblicke in Entscheidungsprozesse geben als
jemand, der sie selbst mitgestaltet hat?“
Diese
Einblicke jungen Menschen zu ermöglichen, ist Dr. Wissing
wichtig. Denn: „Politische Praxis und wissenschaftliche
Perspektive gehören für mich unbedingt zusammen. Gerade in
schwierigen Regierungssituationen merkt man, wie wichtig
überlegtes Handeln, ein gutes Verständnis der Institutionen
und persönliche Verantwortung sind. Diese Erfahrungen möchte
ich an die Studierenden weitergeben – deshalb freue ich mich
sehr auf die Gastprofessur für Politikmanagement der Stiftung
Mercator.“
Gastprofessur mit Tradition:
Seit 2006
unterstützt die Stiftung Mercator die NRW School of
Governance der Universität Duisburg-Essen mit verschiedenen
Veranstaltungsformaten und eben jener Gastprofessur, die seit
18 Jahren an namhafte Persönlichkeiten aus der Politik
verliehen wird. Vor Dr. Volker Wissing gaben unter anderem
schon Armin Laschet, Dr. Gregor Gysi, Rita Süssmuth, Andrea
Nahles und Christian Wulff den Studierenden einen exklusiven
Einblick in ihre Arbeit.
|
|
Herausragende sicherheitspolitische
Expertin: Claudia Major wird Mercator-Professorin
|
|
Duisburg, 7. Oktober 2025 - Sie gilt als
eine der einflussreichsten Stimmen zu Fragen von Krieg und
Frieden, NATO und Sicherheit, sie berät die internationale
Politik und prägt die Debatten. Jetzt wird Dr. Claudia Major,
Senior Vice President für Transatlantische
Sicherheitsinitiativen des German Marshall Fund of the United
States, von der Universität Duisburg-Essen mit der
Mercator-Professur 2025 geehrt.

Grafik: UDE | Foto: Axel Martens
Am Mittwoch,19.
November, 18 Uhr, hält sie ihren öffentlichen Vortrag am
Campus Duisburg. Thema: Sicherheitspolitische Zeitenwende(n):
Herausforderungen und Handlungsoptionen für Deutschland und
Europa.
|
|
- Digitale Hochschultage für
Schüler:innen: Einblicke in die Welt des Studiums
-
Mathematik spielerisch erleben: Die mathebUDE wird eröffnet
|
|
Digitale Hochschultage für
Schüler:innen: Einblicke in die Welt des Studiums
Duisburg, 7. Oktober 2025 - Wie finde ich den
passenden Studiengang? Wie kann ich mein Studium finanzieren
und wie sieht der Campus eigentlich aus? Fragen, die bei den
Digitalen Hochschultagen der Universität Duisburg-Essen vom
20. Oktober bis 7. November beantwortet werden. Die
Anmeldungen zu den kostenlosen Veranstaltungen sind ab
sofort möglich.
Die Universität Duisburg-Essen (UDE)
lädt Schüler:innen ein, ihre Studienpläne schon jetzt in die
Spur zu bringen. Den Auftakt bilden die Campus-Touren in
Duisburg und Essen vom 20. bis 24. Oktober, bei denen
Teilnehmende den Campus erkunden und im direkten Austausch
mit Studierenden authentische Einblicke ins Uni-Leben
gewinnen können.
Vom 27. bis 31. Oktober folgen digitale
Informationsveranstaltungen rund um das Thema Studium – von
Studienfinanzierung und Stipendien über Campusleben bis hin
zu Berufsperspektiven.
Den Abschluss bildet vom 3.
bis 7. November die Studiengangwoche, in der sich zahlreiche
Fächer präsentieren: von Aquatischer Biologie über Energy
Science und Kommunikationswissenschaft bis hin zu Psychologie
und Wirtschaftswissenschaften. So erhalten Interessierte
einen tiefen Einblick in die Vielfalt der
Studienmöglichkeiten an der UDE. Weitere Informationen
https://www.uni-due.de/abz/studieninteressierte/digitalehochschultage.php
Mathematik spielerisch erleben: Die mathebUDE
wird eröffnet
Knobeltische, interaktive Exponate
und Stationen: Das ist die
mathebUDE,
die neue Mitmachwelt der Mathematik an der Universität
Duisburg-Essen. Hier entdecken Schüler:innen aller
Jahrgangsstufen mathematische Phänomene auf spielerische
Weise – sei es zu Zahlen, Geometrie, Funktionen,
Wahrscheinlichkeit, Logik und vielem mehr. Am Montag, 27.
Oktober, um 14 Uhr wird die mathebUDE offiziell eröffnet.
Interessierte Lehrkräfte sind eingeladen, das neue Angebot
kennenzulernen.
Anmeldungen sind bis zum 13. Oktober möglich.

Die Kugelpyramide ist
eines der 37 Exponate der mathebUDE. © UDE/Fabian Rösken
Inspiriert vom Gießener Mathematikum möchte die mathebUDE
Wissen auf erfrischende Weise näherbringen – nicht durch
abstrakte Formeln, sondern durch Ausprobieren und Erforschen.
37 verschiedene Exponate gibt es hier am Essener Campus.
„An ihnen lassen sich mathematische Strukturen und
überraschende Zusammenhänge buchstäblich be-greifen“, erklärt
Prof. Dr. Bärbel Barzel. „So muss man zum Beispiel beim
Zusammensetzen der Kugelpyramide den Aufbau geschickt planen.
Bei einem anderen Puzzle braucht es dringend den „anderen“
Blick und Zugang, um die Idee zur Lösung zu finden. Es ist
toll zu erleben, mit wie viel Spaß und Biss die Schüler:innen
an den interaktiven, visuellen und taktilen Exponaten
gemeinsam dranbleiben.“
Auch digitale Formate gehören
dazu „Die Jugendlichen können mit Tablets oder Smartphones
vorgefertigte Trails durch die mathebUDE erkunden“, ergänzt
Studiendekanin Dr. Monika Meise. „Eine App leitet sie durch
Aufgaben zu spezifischen Themen wie Kegelschnitte oder Satz
des Pythagoras.“
Das neue Angebot richtet sich an
Schulklassen aus NRW und ihre Lehrkräfte. Ebenso können
Uni-Dozierende und Studierende es nutzen. Der 10-jährige Ali,
der mit seiner Klasse bereits einen Vormittag in der
mathebUDE verbracht hat, weiß jedenfalls: „Mathe ist echt
cool!“ Anmeldung und weitere Informationen:
https://www.uni-due.de/mathebude/
|
|
Süßwassercheck für Bachflohkrebs bis Quappe |
|
Weltatlas
der Hitzetoleranz
Duisburg, 7. Oktober 2025 -
Mit dem Klimawandel steigen nicht nur die Temperaturen an
Land und im Meer, auch Flüsse, Seen und Bäche erwärmen sich –
mit gravierenden Folgen für die dort lebenden Tiere. Ein
Forschungsteam der Universität Duisburg-Essen hat nun die
bisher größte, frei zugängliche Datensammlung zur
Hitzetoleranz von Süßwasserorganismen veröffentlicht. Sie
hilft Wasserwirtschaft und Behörden dabei, am und im Wasser
lebende Tiere, präventiv zu schützen.

Süßwasserkrebsart Caridina Dennerli, UDE/Sebastian Prati
Die neue Datenbank
ThermoFresh
umfasst 6.825 Einträge zu 931 Arten aus 572 Studien, die
weltweit zwischen den Jahren 1900 und 2023 entstanden. Neben
Daten zu Fischen sind erstmals auch solche zu zahlreichen
wirbellosen Arten wie Insektenlarven, Krebsen oder Würmern
enthalten. Sie sind im Zusammenhang mit dem Klimawandel
besonders wichtig, denn sie halten Gewässer sauber und
lebendig, dienen als Nahrung und geben Aufschluss über die
Wasserqualität.
„Durch unseren Weltatlas der
Hitzetoleranz wissen wir jetzt deutlich genauer, welche Arten
besonders gefährdet sind, wenn die Wassertemperaturen
steigen“, betont Ökotoxikologin Helena Bayat, Doktorandin im
Sonderforschungsbereich
RESIST an der Universität Duisburg-Essen. „Unsere Flüsse
sind wie Frühwarnsysteme für den Klimawandel. Wenn Arten wie
die Quappe oder der Bachflohkrebs verschwinden, zeigt uns
das, dass auch die Wasserqualität für uns Menschen in Gefahr
ist.“
Gefährdete Arten in heimischen Gewässern
Die Quappe (Lota lota), die in Deutschland als gefährdet
gilt, ist besonders hitzeempfindlich. Auch der Bachflohkrebs
(Gammarus fossarum) und der Dreieckstrudelwurm (Dugesia
gonocephala) kommen nur in sauberen Gewässern mit einem guten
ökologischen Zustand vor. „Geht ihr Bestand zurück, werden
ganze Nahrungsketten und Nährstoffkreisläufe zerstört, das
Ökosystem kann kippen“, erklärt Bayat.
„Für den
Menschen büßen die Gewässer dann nicht nur ihren
Erholungswert ein, auch der Nutzen, zum Beispiel als
Kühlwasser für die Industrie oder als Trinkwasser, geht
verloren.“
Nutzen für Behörden und Planung
Die
frei zugängliche Datenbank ThermoFresh will verhindern, dass
es so weit kommt. Sie beinhaltet Daten in Englisch, Deutsch,
Französisch, Spanisch und Chinesisch und enthält neben
Temperaturtoleranzen auch Daten zu weiteren Stressfaktoren
wie Sauerstoffmangel oder Schadstoffen. Forschende, aber auch
Fachleute aus der Praxis können so empfindliche Arten
identifizieren, Gefahrenzonen erkennen und Maßnahmen gezielt
planen.
So können Behörden etwa Renaturierungen
priorisieren, die Verbreitung invasiver Arten im Klimawandel
besser einschätzen oder auch die Risiken von
Kühlwassereinleitungen (z. B von Thermischen Kraftwerken oder
Industrieanlagen) besser beurteilen. Über ThermoFresh
berichten Bayat und ihre Kolleg:innen im Magazin Scientific
Data:
https://www.nature.com/articles/s41597-025-05832-w
|
|
Kopfverletzungen bei Kindern: Forschende testen
digitale Betreuung daheim |
|
Duisburg, 30. September 2025 -
Ein Sturz beim Spielen, ein
Zusammenstoß beim Sport – schon ist es passiert: Jedes Jahr
erleiden in Deutschland tausende Kinder ein
Schädelhirntrauma. Meist handelt es sich um eine milde Form,
die zwar ärztlich kontrolliert werden muss, aber selten
lebensbedrohlich ist. Dennoch verbringen jährlich rund 92.000
Kinder sicherheitshalber Zeit im Krankenhaus – oft unnötig.
Für Familien ist das sehr belastend, für das
Gesundheitssystem teuer. Das Team des Projekts
SaVeBRAIN.Kids verfolgt
einen neuen Ansatz, um die Zahl von Krankenhausaufnahmen zu
reduzieren. Die Konsortialführung liegt bei Privatdozentin
Dr. Nora Bruns, sie ist Forscherin an der Medizinischen
Fakultät der Universität Duisburg-Essen.
Im Zuge
einer Studie wird erstmals eine digital gestützte Versorgung
getestet, die Kindern eine sichere Betreuung zuhause
ermöglichen soll. „Wir entwickeln eine Alternative zur
stationären Überwachung, von der alle profitieren – die
kleinen Patient:innen, ihre Familien und das gesamte
Gesundheitssystem“, sagt PD Dr. Nora Bruns.
Sie ist
Konsortialführerin und arbeitet als Oberärztin an der Klinik
für Kinderheilkunde I des Universitätsklinikums Essen. Im
Mittelpunkt stehen zwei digitale Werkzeuge: ein Arztcockpit
für die strukturierte Untersuchung in der Klinik und eine
Smartphone-App für die Eltern der betroffenen Kinder. Das
Arztcockpit hilft Ärzt:innen, die Befunde präzise zu
erfassen.
Die App hingegen erinnert die Familien nach
der Entlassung zu festen Zeitpunkten und mit einfachen Fragen
an die Überprüfung des Gesundheitszustand des Kindes. So
behalten Eltern die wichtigsten Symptome im Blick und haben
alle Informationen griffbereit. Die App ersetzt keinen Besuch
bei einer Ärztin oder einem Arzt, sondern ergänzt ihn um eine
verlässliche und leicht verständliche Anleitung.

„Unser Ziel ist, die Anzahl stationärer Aufnahmen um 20
Prozent zu verringern. Denn viele Kinder können zuhause
genauso sicher überwacht werden, wenn Eltern gut unterstützt
werden und behandelnde Ärzt:innen auf standardisierte Daten
zurückgreifen können“, sagt PD Dr. Bruns (Foto privat).
Die Studie läuft seit September 2025 und schließt knapp
1.400 Kinder ein. Dabei wird nicht nur untersucht, wie
wirksam die neue Versorgung medizinisch ist. Auch
wirtschaftliche Aspekte und die Erfahrungen von Eltern,
Kindern und medizinischem Personal spielen eine Rolle Am Ende
sollen klare Empfehlungen stehen, wie sich digitale Lösungen
dauerhaft in die Regelversorgung integrieren lässt.
Getragen wird SaVeBRAIN.Kids von einem Konsortium aus
Instituten, Kliniken, Krankenkassen, Hochschulen und
Technologiepartner:innen. Gefördert wird es vom
Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses über 3,5
Jahre mit rund 5,9 Millionen Euro. An die
Wissenschaftler:innen der Medizinischen Fakultät fließen
davon knapp 2,8 Millionen Euro.
|
|
Klimawandel bedroht Fischvielfalt |
|
Nature-Studie belegt Rückgänge in US-Gewässern
Duisburg, 24. September 2025 - Die Zusammensetzung von
Fischgemeinschaften in Flüssen und Bächen der USA hat sich in
den vergangenen drei Jahrzehnten massiv verändert. Eine neue
Studie in Nature belegt: Steigende Wassertemperaturen und die
Ansiedlung bestimmter Fische durch den Menschen beschleunigen
den Verlust der Biodiversität – vor allem in kühlen
Gewässern.
An der Studie ist Umweltexperte Prof. Dr.
Ralf Schäfer (Universität Duisburg-Essen) beteiligt. Mit
Hilfe des Elektrofischfangs untersucht ein Team der
US-Umweltbehörde EPA in Little Hunting Creek, Virginia, die
Fischbestände, um den ökologischen Zustand von Flüssen und
Bächen zu erfassen.

Foto: Kevin Biallas
„Arten aus der Familie der
Karpfen und echten Barsche, die kühles Wasser bevorzugen,
verlieren zunehmend ihren Lebensraum, da die Temperaturen in
Flüssen weltweit steigen", erklärt Prof. Dr. Ralf Schäfer,
Umweltforscher an der Universität Duisburg-Essen und am
Research Center One Health Ruhr. Für die Studie hat er
zusammen mit einem internationalen Forschungsteam
Langzeitdaten zu fast 400 Fischarten in Nordamerika
ausgewertet.
Die Daten stammen von der
US-Umweltbehörde EPA, die zwischen 1990 und 2019 Proben an
knapp 3.000 Standorten erhoben hat. Das Ergebnis in Flüssen
mit einer Durchschnittstemperatur unter 15 Grad Celsius ist
drastisch: Hier ist die Zahl der Fische um mehr als die
Hälfte geschrumpft, die Artenvielfalt um rund ein Drittel.
Gleichzeitig beobachten die Forschenden, dass größere Arten
wie Forellenbarsche und Kanalwelse, die zum Angeln und
Fischen eingesetzt werden, kleinere Arten in den kalten
Flüssen verdrängen.
In Flüssen mit Wassertemperaturen
über 24 °C zeichnet sich ein anderes Bild: In den warmen
Gewässern steigt sowohl die Zahl der Fische als auch deren
Vielfalt, vor allem robuste Arten legen zu. Doch dieser
Zuwachs darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die
Artenvielfalt insgesamt leidet. Eingesetzte Fischarten und
steigende Temperaturen wirken hier zusammen und verschärfen
den Verlust der Biodiversität.
„Unsere Ergebnisse
belegen, wie empfindlich Süßwasserökosysteme auf den
Klimawandel reagieren“, betont Schäfer. „Gerade in kühlen
Flüssen droht die charakteristische Artenvielfalt zu
verschwinden. Dabei sind die Daten aus den USA ein deutliches
Warnsignal für Europa, denn hier beobachten wir dieselbe
Entwicklung: Flüsse werden stetig wärmer.“
Gemeinsam
mit seinem Team hat der Umweltforscher kürzlich außerdem eine
umfassende Datenbank zur Hitzetoleranz von
Süßwasserorganismen veröffentlicht. Diese enthält weltweite
Daten zu vielen Fischen und zahlreiche wirbellose Arten wie
Insektenlarven und Krebse, die wiederum zentrale Indikatoren
für die Wasserqualität sind.
|
|
9. Oktober: Forschung trifft Praxis - Workshop zur
Wärmewende |
|
Duisburg, 24. September 2025 - Wie lassen
sich Städte künftig klimafreundlich heizen? Diese Frage steht
im Mittelpunkt eines Workshops an der Universität
Duisburg-Essen. Fachleute aus Wissenschaft und Praxis sind
eingeladen, am 9. Oktober über Strategien für die Wärmewende
in Ballungsräumen zu diskutieren – von der kommunalen Planung
bis zu neuen Technologien im Gebäudebestand. Die Teilnahme
ist kostenfrei, eine Anmeldung erforderlich.
Ohne die
Umstellung der Heizsysteme wird Deutschland seine Klimaziele
nicht erreichen. Besonders in dicht besiedelten Städten
stellt dies eine große Herausforderung dar: Viele Gebäude
sind alt, Heizungen laufen noch mit Gas oder Öl, und Platz
für neue Anlagen ist knapp. Wie Lösungen aussehen können,
erörtern Fachleute am Donnerstag, 9. Oktober 2025, an der
Universität Duisburg-Essen.
Der Workshop „Wie gelingt
die Wärmewende in Ballungsräumen?“ findet von 9 bis 16 Uhr im
Glaspavillon auf dem Essener Campus statt. Eingeladen sind
Fachleute, die beruflich mit Wärme zu tun haben – von
Energieversorgern über Wohnungsunternehmen bis zu
Planungsbüros.
Zum Auftakt spricht Prof. Dr. Christoph
Weber vom Lehrstuhl für Energiewirtschaft der UDE, gefolgt
von einem Einblick in die kommunale Wärmeplanung in Duisburg.
Danach werden Strategien zur Sanierung im Gebäudebestand und
ein Online-Tool zur Bewertung klimafreundlicher
Heizungssysteme vorgestellt. Rechtliche Rahmenbedingungen
sowie Erfahrungen mit neuen Wärmeerzeugern stehen ebenfalls
auf dem Programm.
Der Workshop ist Teil des
Forschungsprojekts KliWinBa, das an der UDE koordiniert wird.
Ziel ist es, Optionen für eine klimaneutrale Wärmeversorgung
im Gebäudebestand zu prüfen. Dabei geht es nicht nur um
technische Fragen, sondern auch um Kosten, Umbauzeiten und
rechtliche Rahmenbedingungen. Partner aus Energieversorgung
und Wohnungswirtschaft bringen ihre Erfahrung ein, damit
Lösungen nicht auf dem Papier bleiben, sondern in Quartieren
und Stadtteilen umgesetzt werden können.
|
|
Konzert zu 100 Jahren Quantenmechanik |
|
Duisburg, 19.
September 2025 - „Ein Quantum Musik“ Quantenphysik und Musik
– passt das zusammen? Sehr gut sogar, wenn es nach der
Bläsersymphonie der Abtei Hamborn und den Physikern der
Universität Duisburg-Essen, Dr. Nicolas Wöhrl und Prof. Dr.
Axel Lorke, geht. Am Sonntag, 5. Oktober, kann sich jede:r
selbst ein Bild davon machen.
Dann findet das Konzert
„Ein Quantum Musik – Musik trifft Wissenschaft im Quantenjahr
2025“ in Duisburg statt. Begleitet wird das Programm von
verblüffenden Experimenten, die die Quantenwelt lebendig
werden lassen.

Prof. Dr. Axel Lorke macht die Welt der Quanten in einem
Experiment sichtbar. Foto: UDE/Nicolas Wöhrl
Computer, Solarzellen, Laser – viele Errungenschaften unserer
Zeit beruhen auf der Quantenmechanik. Vor rund 100 Jahren
begann die Entdeckung dieser faszinierenden Welt der Atome
und Lichtteilchen, in der Wahrscheinlichkeiten und Unschärfen
die klassischen Vorstellungen von Naturgesetzen ablösen.
Passend zu dieser nur scheinbar „unscharfen“ Physik erwartet
die Besucher:innen am Konzertabend ein Programm voller
Energie und Farben: impulsive Rhythmen und schillernde Klänge
entführen in die sichtbare und unsichtbare Quantenwelt.
Wie sieht diese aus? Und was hat sie mit unserem Alltag
zu tun? Musikalisch nähert sich die Bläsersymphonie der Abtei
Hamborn diesen Fragen mit eigens arrangierten Stücken – aber
auch mit beliebten Melodien, etwa aus Disneys Aladdin oder
Star Wars. Wissenschaftlich führen Prof. Dr. Axel Lorke und
Dr. Nicolas Wöhrl durch das Programm.
Mit
anschaulichen Experimenten und einer Prise Humor geben die
beiden Physiker der Universität Duisburg-Essen (UDE) einen
Einblick in die Quantenphysik. Vorkenntnisse sind dabei nicht
nötig – Neugier genügt. Datum: Sonntag, 5. Oktober, ab 18 Uhr
Ort: Altes Audimax Campus Duisburg, Gebäude LA, Lotharstr. 65
Karten:
print@home oder auch an der Abendkasse
|
|
Neue Forschungsergebnisse: Grippe vergrößert
Schlaganfallrisiko |
|
Duisburg, 17. September 2025 - Von
einem Moment auf den anderen ist alles anders: Ein
Hirninfarkt, der ischämische Schlaganfall, trifft jedes Jahr
weltweit mehr als 12,2 Millionen Menschen. Dabei werden
bestimmte Bereiche des Gehirns nicht mehr durchblutet, was zu
Infektionen führen kann.
Neu ist die Erkenntnis, dass
diese selbst das Risiko für Schlaganfälle und
Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Forscher:innen der
Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen und des
Universitätsklinikums Essen haben dazu eine Studie
veröffentlicht.
„Während der COVID-19-Pandemie wurden
mehr Schlaganfälle bei SARS-CoV-2-Erkrankten registriert.
Ähnlich war es bei schweren Influenza-A-Virusinfektionen.
Deshalb sind wir diesen Hinweisen nachgegangen“, berichtet
die Biologin Dr. Friederike Langhauser, die das größere
Schlaganfallrisiko mit einem Team an der Klinik für
Neurologie des Universitätsklinikums Essen unter der Leitung
von Prof. Dr. Christoph Kleinschnitz erforscht hat.
Beteiligt waren auch Wissenschaftler:innen des Lehrstuhls für
Infektionsimmunologie der Universität Duisburg-Essen sowie
Fachleute aus den Niederlanden und Schweden. Zunächst wurden
im Tiermodell mit einem humanen Influenza-Virus infiziert und
anschließend wurde zu verschiedenen Zeitpunkten ein
Schlaganfall verursacht. Die Studienergebnisse zeigen, dass
insbesondere eine akute Grippe die Hirnschäden und
neurologischen Ausfälle verschlimmern kann. Denn die
Virusinfektion beeinflusst die Blutgerinnung, wie das
veränderte Blutbild verdeutlicht.
Es wird
wahrscheinlicher, dass sich Blutgerinnsel bilden, die
letztlich zu Gefäßverschlüssen und Schlaganfall führen
können. Was kann man tun, um solch einem Verlauf in der
Praxis entgegenzuwirken? „Gerade für vulnerable
Patient:innengruppen ist eine frühzeitige Impfung gegen
Influenzaviren eine wichtige Schutzmaßnahme“, sagt
Klinikdirektor Prof. Dr. Christoph Kleinschnitz.
„Bei
Infektionen empfehlen wir, auf neurologische Warnzeichen, wie
Taubheit und Lähmung, zu achten und bei möglichen
Schlaganfallsymptomen rasch zu handeln.“ In der Behandlung
können Medikamente wie Acetylsalicylsäure (ASS) oder
antivirale Therapien die fortschreitenden Hirnschäden
reduzieren.
|
|
Duisburg wird zum Zentrum der Medienpsychologie |
|
MediaPsych
Conference 2025
Duisburg, 8. September
2025 - Eine Beziehung zwischen Mensch und KI-Chatbot – wie
ist das möglich? Wie können wir Falschinformationen und Deep
Fakes besser erkennen? Und wie wirkt sich die dauerhafte
Nutzung von Smartphones auf die mentale Gesundheit aus? D
ie internationale Konferenz zur Medienpsychologie 2025
widmet sich vom 10. bis 12. September in Duisburg
hochaktuellen Fragen zwischen Psychologie und Technologie.
Und: Sie schreibt Rekordzahlen. Mit über 230 Teilnehmenden
aus 21 Ländern und 221 eingereichten Beiträgen ist sie größer
und internationaler denn je.
UDE/CAIS
Die 14.
Tagung der Fachgruppe Medienpsychologie der Deutschen
Gesellschaft für Psychologie bringt Forschende aus aller Welt
an der Universität Duisburg-Essen (UDE) zusammen, um über die
psychologischen und gesellschaftlichen Dimensionen digitaler
Technologien zu diskutieren. Die Themen der MediaPsych
Conference 2025 sollen Impulse für gesellschaftliche Debatten
und politische Entscheidungen liefern, etwa zur Förderung von
Medienkompetenz oder zur Regulierung von Technologien.
Prof. Dr. German Neubaum, Medienpsychologe an der UDE,
betont, wie wichtig das Zusammenkommen internationaler
Forschenden und Expert:innen ist: „Gerade in der
Medienpsychologie, wo der digitale Wandel alle Grenzen
überschreitet, zeigt sich der Wert internationaler
Konferenzen: Sie schaffen Räume für Austausch und gemeinsame
Lösungen – und fördern ein globales Verständnis dafür, wie
Menschen mit einer sich stetig wandelnden Technologie
umgehen.“
Für die im Oktober 2023 an der UDE
gegründete Fakultät für Informatik ist die Ausrichtung der
Konferenz eine wichtige Gelegenheit, ihr interdisziplinäres
Profil zu schärfen und mit der Abteilung „Human-Centered
Computing and Cognitive Science“ die
Mensch-Technologie-Interaktion als zentrales Forschungsthema
international sichtbar zu machen. Die gemeinsame Organisation
mit dem Center for Advanced Internet Studies (CAIS) stärkt
außerdem die Zusammenarbeit am Wissenschaftsstandort
Ruhrgebiet.
Programmhighlights
Das Programm aus
Workshops, Präsentationen und Poster Sessions zeigt die
thematische Breite und den interdisziplinären Anspruch der
MediaPsych Conference 2025. Zu den Höhepunkten zählen zwei
internationale Keynotes: Prof. Dr. Jessica Piotrowski
(Universität Amsterdam) spricht über die Bedeutung von
Kompetenzförderung in der digitalen Gesellschaft, Dr. Mitra
Shamsi (Iran) beleuchtet den Zusammenhang von digitaler
Sichtbarkeit, Verletzlichkeit und feministischem Aktivismus
in autoritären Kontexten.
Bereits am 10. September
starten die Pre-Conference Workshops, darunter ein spezielles
Angebot für Promovierende sowie ein praxisnaher Workshop zu
KI-Tools in der Forschung.
Anmeldungen zur Konferenz sind bis zum 9. September
möglich.
|
|
Verbundprojekt der UA Ruhr-Universitäten
Sprachbildung flexibel begegnen |
|
Duisburg, 4. September 2025 - Die
Metropole Ruhr ist vielsprachig – für die Schulen ist das
Herausforderung und Chance gleichermaßen. Mit dem neuen
Verbundprojekt Flexible DaZ-Professionalisierung im Lehramt
(DazFlexPro) reagieren die drei Universitäten der UA Ruhr
darauf: Das Projekt unter der Leitung des Zentrums für
Lehrkräftebildung der Universität Duisburg-Essen wird ab
Oktober 2025 für zunächst vier Jahre mit rund vier Millionen
Euro von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre
gefördert.
Das Vorhaben geht zwei Herausforderungen
an: „Zum einen sollte eine moderne Lehrkräftebildung ein
Studium ermöglichen, das individuelle Studienbiografien
berücksichtigt, da eine Vielzahl von Studierenden neben dem
Studium weiteren Verpflichtungen nachgeht oder bereits durch
Nebentätigkeiten an Schulen praktische Erfahrungen sammelt.
Kurz gesagt: Wir müssen unser Studium flexibilisieren und die
Schulpraxis inhaltlich mitdenken.
Bestenfalls können
in Zeiten des Lehrkräftemangels und sinkender
Studierendenzahlen auch neue Zielgruppen erschlossen werden“,
so Projektsprecher Prof. Dr. Tobias Schroedler, Leiter der
Arbeitsgruppe Mehrsprachigkeit und gesellschaftliche Teilhabe
an der Universität Duisburg-Essen (UDE).
„Zum anderen
sind angehende Lehrkräfte in unserer mehrsprachigen Region
mit besonderen Anforderungen an die sprachliche Bildung ihrer
Schüler:innen konfrontiert. Gemeinsam mit den Kolleg:innen
aus Bochum und Dortmund wollen wir unsere Studierenden für
einen ressourcenorientierten Umgang mit Mehrsprachigkeit fit
machen.“
Konkret wollen die beteiligten
Bildungsexpert:innen das Studium flexibler gestalten, dabei
stärker mit forschungsbasierten Ausbildungsinhalten zur
Sprachbildung und der Möglichkeit von Praxiserfahrungen
verknüpfen. Das bisher obligatorische Deutsch als
Zweitsprache (DaZ)-Modul wird künftig so aufgeteilt, dass es
die Studierenden flexibel über ihr Studium hinweg belegen
können – mit individuellen Schwerpunkten und engerer
Verzahnung von Theorie und Praxis.
Zudem wird es eine
Spezialisierung auf neu zugewanderte Schüler:innen geben.
Auch werden Strukturen geschaffen, die es Studierenden
ermöglichen, die im Lehramtsstudium obligatorischen
Praxisphasen eng begleitet mit einer Schwerpunktsetzung im
Bereich DaZ für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler
oder fachintegrierter Sprachbildung zu absolvieren.
So werden die Theorie-Praxis-Bezüge im Bereich DaZ
weiterentwickelt, inhaltlich ausgeweitet und in flexiblen
Formaten, z.B. in (teil)digitalisierten Lehr-Lernangeboten
zur Verfügung stehen. „Mit DaZFlexPro erreichen wir in der UA
Ruhr nicht nur eine enorme Anzahl angehender Lehrkräfte,
zusammen verfügen auch über eine große Expertise in der
sprachlichen Bildung.
Mit dieser gebündelten
Kompetenz entwickeln wir innovative Ausbildungsformate und
können so zukünftige Generationen von Lehrkräften bedeutend
besser als bisher auf die schulische Praxis vorbereiten“, ist
sich Prof. Dr. Tobias Schroedler sicher. Insgesamt hat die
Stiftung Innovation in der Hochschullehre im Programm
„Lehrarchitektur“ 119 Projekte zur Förderung ausgewählt.
Das Fördervolumen beträgt insgesamt rund 480 Millionen
Euro. Auf die UDE entfallen dabei rund 1,8 Millionen Euro,
die RUB und die TU Dortmund bekommen jeweils 1,2 Millionen
Euro Förderung. Für das Verbundprojekt besteht eine Option
auf eine zweijährige Verlängerung und eine weitere Förderung
von rund zwei Millionen Euro.
|
|
PETA zeichnet die vegan-freundlichsten Mensen
Deutschlands 2025 aus |
|
Vier Blätter für die Mensen in
Essen und Duisburg
Stuttgart/Duisburg, 3. September
2025 - Wachsende vegane Vielfalt: Das
Angebot pflanzlicher Speisen an deutschen Hochschulmensen wird immer
vielfältiger und etablierter. Bereits zum neunten Mal hat PETA
bundesweit Universitätskantinen zu verschiedenen Aspekten rund um
das Thema vegane Ernährung befragt.
Basierend auf den Antworten der
29 teilnehmenden Studierendenwerke wurden Punkte in Form von grünen
Blättern (1 bis 5 in halben Schritten) vergeben und die
vegan-freundlichsten Mensen 2025 gekrönt. Die Mensa Campus in Essen
und die Mensa Campus in Duisburg des Studierendenwerks
Essen-Duisburg haben dabei vier Blätter verliehen bekommen.
„Mit jeder Mahlzeit haben wir die Wahl, Tierleid zu verhindern und
gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt zu tun. Mit veganen
Gerichten gelingt das einfach, lecker und noch dazu gesund“, so
Julia Weibel, Fachreferentin bei PETA. „Ein pflanzenbasiertes
Speisenangebot deckt die Ernährungsbedürfnisse und -wünsche vieler
Menschen ab, die tierische Produkte ablehnen – sei dies aus
ethischen, religiösen, umwelttechnischen oder gesundheitlichen
Gründen. Wir freuen uns besonders, dass in diesem Jahr so viele neue
Einrichtungen dazugekommen sind und viele andere ihr Ergebnis vom
vergangenen Jahr verbessern konnten.“
Top-Mensen mit
vegan-freundlichem Angebot: Vier Blätter für Essen und Duisburg
Sowohl die Mensa Campus in Essen als auch die Mensa Campus in
Duisburg des Studierendenwerks Essen-Duisburg bietet jeweils täglich
ein veganes Gericht an. Hinzu kommen pflanzliche Vor- und
Nachspeisen sowie eine Salattheke mit diverser Auswahl, Snacks und
Gebäck. Einzelaktionen und Aktionstage wie die Teilnahme am
Weltvegantag finden statt. Es gibt einen regen Austausch mit den
Studierenden.
Die Bewertungskriterien
Die
Beurteilungskriterien bezogen sich unter anderem auf das tägliche
und vielfältige Angebot an veganen Gerichten sowie die spezielle
Schulung des Personals. Auch das vegane Angebot an Vor- und
Nachspeisen, Getränken sowie Snacks wurde in die Bewertung
einbezogen. Zudem wurde berücksichtigt, ob Aktionswochen oder -tage
zum Thema vegane Ernährung veranstaltet werden. In die Beurteilung
floss außerdem ein, ob ein Vegan-Tag angeboten oder regelmäßig für
rein pflanzliche Gerichte geworben wird. Wie sich die jeweilige
Mensa im Laufe der Jahre entwickelt hat, spielte ebenfalls eine
Rolle.
Veganes Angebot nimmt stetig zu
Alle teilnehmenden
Mensen haben täglich mindestens eine rein pflanzliche Speise im
Angebot – meist sogar mehrere. Bei einem Großteil gibt es auch
vegane Vor- und Nachspeisen, Snacks und Gebäck. Viele organisieren
Mitarbeiterschulungen und Aktionswochen, meist zum jährlichen
Welt-Vegan-Tag am 1. November oder zum Veganuary.
Einige der
ausgewählten Mensen der Studierendenwerke bieten mittlerweile eine
vielfältigere Auswahl an veganen Speisen an, weswegen sich alle
Vorjahresteilnehmer in diesem Jahr um einen oder einen halben Punkt
verbessern konnten. Die Entwicklung zeigt, dass die vegane Ernährung
in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist.
Eine 2023
veröffentlichte Studie kam zum Schluss: Werden pflanzliche Gerichte
in Hochschulmensen als Standardoption angeboten und Gerichte mit
tierischen Produkten nur auf Nachfrage, wird die vegane Mahlzeit zu
knapp 82 Prozent gewählt. [1] Insgesamt bieten die Studierendenwerke
einfallsreiche vegane Gerichte wie Burrito Bowl mit
Sonnenblumenhack, hausgemachte BratVurst, Blumenkohlburger, mit
Chili con Soja gefüllte Tortilla an pikanter Pueblo-Avocado-Salsa
oder Bohnen-Bulgur-Pfanne mit Walnüssen und Paprika-Radieschen Dip
an.
PETAs Motto lautet: Tiere sind nicht dazu da, dass wir an
ihnen experimentieren, sie essen, sie anziehen, sie uns unterhalten
oder wir sie in irgendeiner anderen Form ausbeuten. Die Organisation
setzt sich gegen Speziesismus ein – eine Form von Diskriminierung,
bei der Tiere aufgrund ihrer Artzugehörigkeit abgewertet werden. Der
Mensch wird hierbei allen anderen Spezies gegenüber als überlegen
angesehen.
Daneben wird auch zwischen verschiedenen
Tierarten unterschieden: So empfinden viele Menschen Hunde und
Katzen als Familienmitglieder und lehnen es ab, sie zu halten,
auszubeuten und zu töten wie Schweine, Rinder oder Hühner. Trotzdem
betrifft Speziesismus auch sogenannte Haustiere: Sie werden zur
menschlichen Unterhaltung benutzt, oftmals unter tierschutzwidrigen
Bedingungen (qual-) gezüchtet und wie Ware verkauft. Auch für
Tierversuche werden sie missbraucht.
|
|
Reifenabrieb im Rhein: Wie Mikroplastik die
Flussökologie verändert |
|
Duisburg, 1. September 2025 - Von der
Straße in Gewässer: Eine Studie von Forschenden der
Universität Duisburg-Essen und der Universität zu Köln zeigt
erstmals, wie stark Mikroplastik aus Reifenabrieb die
mikrobielle Welt im Rhein verändert. Über vier Wochen wurden
verschiedene Typen von Reifenpartikeln der Strömung im Fluss
ausgesetzt – mit klaren Ergebnissen. Das Fachmagazin
Environmental Pollution berichtet.

Per 3D-Druck hergestellte Kammern enthalten verschiedene
Arten und Partikelgrößen des Reifenabriebs sowie
Kontrollproben mit gleich großen, zuvor sterilisierten
Sedimentpartikeln als Kontrolle. Gestapelt und in einer Kiste
vor herumschwimmenden Gegenständen geschützt, werden sie vier
Wochen lang der Rheinströmung unterhalb des
Forschungsschiffes „Ökologische Rheinstation“ ausgesetzt. ©
Universität zu Köln / Julian Wagenhofer
Die winzigen
Partikel verschiedener Größen von neuen und alten PKW- wie
LKW-Reifen erwiesen sich nicht als neutrale Oberflächen, auf
denen sich Bakterien ansiedeln. Vielmehr veränderten sie die
Zusammensetzung der Biofilme – also jener bakteriellen
Schichten, die Flusssteine, Sedimente und auch künstliche
Materialien überziehen.
„Wir konnten zeigen, dass sich
bestimmte Bakterienarten besonders gern auf Reifenabrieb
ansiedeln, während die allgemeine Vielfalt der
Mikroorganismen darauf abnimmt“, erklärt Studienleiterin Dana
Bludau, die in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Jens Boenigk
in der Fakultät für Biologie der Universität Duisburg-Essen
(UDE) promoviert. „Besonders die Biofilme auf größeren
Partikeln älterer Reifen unterschieden sich deutlich von
denen auf natürlichen Partikeln des Flussgrundes.“
Die
Bedeutung dieser Veränderungen reicht weit über die
Bakteriengemeinschaft selbst hinaus. Mikroben sind zentrale
Akteure in aquatischen Ökosystemen: Sie zersetzen organisches
Material, steuern Nährstoffkreisläufe und bilden die Basis
für Nahrungsketten. „Wenn Reifenabrieb die Zusammensetzung
dieser Biofilme verändert, betrifft das daher das gesamte
Flusssystem“, betont Bludau.
Die Ergebnisse ergänzen
aktuelle Befunde des Landesamts für Natur, Umwelt und Klima
NRW (LANUK), das in einer Studie hohe Belastungen durch
primäres Mikroplastik im Rhein dokumentiert hat. Bei primärem
Mikroplastik handelt es sich um absichtlich hergestellte
Kunststoffpartikel wie Peelingkügelchen in Kosmetika oder
Kunststoffgranulat aus der Industrie, während sekundäres
Mikroplastik durch den Zerfall größerer Plastikteile
entsteht. Während in den Analysen des LANUK vor allem Mengen
und Eintragsquellen untersucht wurden, zeigt die Studie der
Universitäten Duisburg-Essen und Köln erstmals die konkreten
Auswirkungen von Reifenabrieb auf die mikrobiellen
Lebensgemeinschaften im Fluss.
Bisher wurden die
ökologischen Auswirkungen von Mikroplastik kaum systematisch
erforscht. Die neue Untersuchung liefert damit einen
wichtigen Mosaikstein für das Verständnis der ökologischen
Folgen.
|
|
Neue Masterplanung NRW-Hochschulbau -
Erster Schritt für Campus der Zukunft
|
|
Duisburg, 29. August 2025 - Für 2026
ist auf dem Campus Duisburg der Universität Duisburg-Essen
eine neue Etappe der Campusentwicklung geplant. Mit Neubauten
und Sanierungen entsteht Schritt für Schritt ein „Campus der
Zukunft“ – ein Ort, an dem innovative Lehre, international
wettbewerbsfähige Spitzenforschung und modernes Arbeiten auf
ideale Bedingungen treffen.

Foto UDE
Gleichzeitig setzt die Hochschule auf
Beteiligung: Im Herbst lädt sie mit dem Bau- und
Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB) Beschäftigte und Studierende
zu einem Town Hall Meeting ein, um das Projekt vorzustellen.
Das Ziel ist klar: ein interdisziplinär vernetzter Campus der
Zukunft, der Synergien schafft und der internationalen
Spitzenforschung der Universität Duisburg-Essen beste
Bedingungen bietet.
Dabei werden die Bauarbeiten
bewusst lokal gebündelt, damit Lehre, Forschung und
Campusleben auch während der Bauzeit bestmöglich
weiterlaufen. „Der Campus Duisburg entwickelt sich zu einem
zukunftsweisenden Standort, der den Austausch über
Fächergrenzen hinweg fördert und neue Formen von Lehre,
Lernen, Forschen und Arbeiten ermöglicht“, sagt Ulf Richter,
Kanzler der Universität Duisburg-Essen.
Zukunftsweisende Struktur
Was genau ist geplant? Kanzler
Ulf Richter erklärt: „In den kommenden Jahren entsteht auf
dem Campus Duisburg eine neue Struktur: Im Süden bündeln sich
Informatik und Ingenieurwissenschaften; im Zentrum der
Fachbereich Physik sowie die Gesellschaftswissenschaften und
die Betriebswirtschaftslehre.
Der Norden wird zum
kulturellen Herz des Campus mit Bibliothek, zentralen
Einrichtungen, Services und Verwaltung. Von den Neubauten und
Sanierungen wird die gesamte Universität spürbar profitieren
– und trotz unvermeidbarer Herausforderungen bleibt die
Universität ein attraktiver Ort zum Studieren, Forschen und
Arbeiten.“
Den Auftakt des mehrstufigen
Entwicklungsprojekts bildet voraussichtlich im ersten
Halbjahr 2026 der Interims-Umzug der zentralen
Universitätsverwaltung. Transparente Kommunikation und
Beteiligung Dabei stets im Fokus: Die UDE wird die Interessen
aller Beteiligten einbinden und plant eine umfangreiche
Information von Universitätsmitgliedern, Anwohnenden und der
Politik.
Richter ergänzt: „Im ersten Schritt laden
wir für den Herbst alle Angehörige der Universität zu einem
Town Hall Meeting ein und informieren über den weiteren
Projektverlauf.“
|
|
Gasthörerverzeichnis 2025/2026: Wissenshunger kann
gestillt werden |
|
Duisburg, 28. August 2025 - Was versteckt sich hinter Smart Farming?
Wie wird Versöhnung in den Religionen gelebt? Und warum ist in der
Mathematik die Quadratur des Kreises ein schönes Thema? Mehr über
diese und weitere Fragen erfahren Gasthörer:innen der Universität
Duisburg-Essen im kommenden Semester.
Das Verzeichnis mit
sämtlichen Veranstaltungen steht schon online:
https://www.uni-due.de...025-26.pdf (c) UDE/eventfotograf.in Das
Programm des Wintersemesters 2025/2026 gibt einen Einblick in das
vielfältige Lehrprogramm der Universität Duisburg-Essen (UDE).

Gedruckte Exemplare des Gasthörerverzeichnisses gibt es an beiden
Campi kostenlos im Akademischen Beratungszentrum (ABZ), den
Bibliotheken und bei der Einschreibung. In Essen ist es zudem bei
den Pförtner:innen im Gebäude R12 und am Klinikum (Hauptloge)
erhältlich. Genauere Auskunft an der UDE gibt Jennifer Peters,
Sachgebiet Studierendenservice, Akademische und hochschulpolitische
Angelegenheiten.
Die Einschreibung läuft bis zum 6. Februar 2026.
Gasthörer:innen zahlen für die Teilnahme einmalig 100 Euro
für das ganze Semester, bei Geflüchteten entfällt die Gebühr.
Weitere Informationen:
https://www.uni-due.de/imperia/md/content/dokumente/2025/gasthoererverzeichnis-wise-2025-26.pdf
|
|
Integrationsräte: Wenig bekannt,
aber demokratisch wichtig |
|
Duisburg, 26. August
2025 - Mit den Kommunalwahlen 2025 in Nordrhein-Westfalen
stehen auch die Wahlen zu den Integrationsräten an. Doch das
Interesse hält sich in Grenzen – sowohl bei den
Wahlberechtigten selbst als auch in der breiten
Öffentlichkeit. Prof. Dr. Conrad Ziller,
Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen, hat
untersucht, warum die Beteiligung so niedrig ist.
In
Deutschland haben rund 14 Prozent der Menschen keinen
deutschen Pass. Während EU-Staatsangehörige bei
Kommunalwahlen mitstimmen können, bleibt
Nicht-EU-Bürger:innen nur die Wahl zum Integrationsrat. Diese
Gremien sollen ihre Interessen vertreten, besitzen aber
lediglich beratende Funktion – etwa bei Fragen der
Mehrsprachigkeit in der Verwaltung oder bei Programmen gegen
Diskriminierung. „Integrationsräte sind eine Art
demokratisches Schaufenster, aber ohne echte
Entscheidungskompetenzen. Das ist ein Grund, warum die
Wahlbeteiligung oft bei nur 10 bis 15 Prozent liegt, obwohl
Wahlbenachrichtigungen verschickt werden“, erklärt
Politikwissenschaftler Prof. Dr. Conrad Ziller von der
Universität Duisburg-Essen (UDE).
Ziller hat Daten der
zweiten Befragungswelle der LiV-Studie ausgewertet, bei dem
Menschen mit und ohne Migrationshintergrund in zehn deutschen
Städten interviewt wurden. Demnach wussten nur 41 Prozent der
Befragten überhaupt, dass es Integrationsräte gibt. Unter
Nicht-EU-Bürger:innen, also der Zielgruppe, ist die
Bekanntheit sogar am geringsten. „Das ist ein Problem für die
Demokratie“, sagt Ziller. „Die Institution, die eigentlich
Partizipation ermöglichen soll, bleibt für viele Betroffene
unsichtbar.“
Streitpunkt Wahlrecht
Umstritten
bleibt das kommunale Wahlrecht für Nicht-EU-Bürger:innen: 69
Prozent dieser Gruppe befürworten, wenn es eingeführt würde,
bei Deutschen ohne Migrationserfahrung sind es 51 Prozent.
„Die Spaltung verläuft nicht entlang von Herkunft allein,
sondern vor allem entlang politischer Überzeugungen“, so
Ziller.
Seine Analyse zeigt: Höhere Bildung, Interesse
an Politik und eine eher linke Orientierung gehen mit mehr
Unterstützung für Integrationsräte und das kommunale
Wahlrecht einher. Wer hingegen die AfD wählt oder ein
skeptisches Klima gegenüber Migration vertritt, steht den
Gremien deutlich kritischer gegenüber. Auffällig ist auch,
dass in Städten, in denen Integrationsräte gewählt werden,
die Bekanntheit und Akzeptanz höher ist als dort, wo die Räte
nur berufen werden. „Wahlkämpfe machen sie präsenter und
verleihen ihnen mehr Legitimität“, sagt Ziller.
Er
empfiehlt, die Gremien bekannter zu machen – durch gezielte
Öffentlichkeitsarbeit in mehreren Sprachen, durch
Wahlkampagnen oder eine stärkere Einbindung der Parteien.
„Damit Integrationsräte mehr als symbolische Teilhabe sind,
braucht es mehr Aufklärung und Sichtbarkeit,“ betont Ziller.
„Letztlich geht es darum, wie offen unsere Demokratie sein
will.“
Zur Studie:
Ziller, Conrad and Hummler,
Teresa and Vierus, Paul (2025): Between Consultation and
Suffrage: Understanding Public Support for Integration
Councils and Non-Citizen Voting Rights in Germany.
Arbeitspapier verfügbar unter
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5401424
|
|
Landesverdienstorden für Prof.
Karl-Rudolf Korte
|
|
Herausragender Politikwissenschaftler
Düsseldorf/Duisburg, 21. August 2025 - NRW-Ministerpräsident
Hendrik Wüst hat heute (21. August) dem
Politikwissenschaftler Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte von der
Universität Duisburg-Essen den Landesverdienstorden
verliehen. Die seit 1986 vergebene Auszeichnung würdigt
Persönlichkeiten, die sich in herausragender Weise um das
Land und seine Menschen verdient gemacht haben.

Prof. Karl-Rudolf Korte (r.) mit Ministerpräsident Hendrik
Wüst. © Land NRW
In seiner Laudatio betonte Wüst
Kortes langjähriges Engagement für Demokratie und deren
Vermittlung. Korte sei Impuls- und Ideengeber, Netzwerker und
„eine wichtige Größe der Politikwissenschaft“, so der
Ministerpräsident.
Prof. Korte gilt als einer der
profiliertesten Politikwissenschaftler Deutschlands. Als
langjähriger Direktor der NRW School of Governance an der
Universität Duisburg-Essen (UDE), die er bis zu seiner
Emeritierung im Februar dieses Jahres leitete, baute er
Brücken zwischen Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit –
eine Aufgabe, die er auch weiterhin engagiert verfolgt.
Mit seinen pointierten Analysen und anschaulichen
Publikationen – von wissenschaftlichen Standardwerken bis hin
zu populären Büchern über Wählermärkte, politische Rituale
und Symbole oder zur Macht des Bundespräsidenten – prägt
Korte seit Jahren die politische Debatte in Deutschland.
Kortes Forschungsschwerpunkte liegen in der Regierungs-,
Parteien- und Wahlforschung. Regelmäßig trägt er mit
wissenschaftlich fundierten Analysen zur Einordnung aktueller
politischer Entwicklungen bei und ist einer der gefragtesten
Politik-Experten in den Medien. Damit hat er auch für viele
Bürger:innen zahlreiche Impulse gesetzt. Auch engagiert er
sich in zahlreichen Gremien und Institutionen, die sich der
Stärkung der Demokratie widmen.
„Der
Landesverdienstorden ist für mich eine große Ehre“, so Prof.
Korte. „Gleichzeitig gebührt dem ganzen Team der NRW School
of Governance die besondere Anerkennung. Hier haben wir mit
Forschung und Lehre viele Generationen auf das
Politikmanagement in einer freiheitlichen Demokratie
vorbereitet. Die Ehrung verstehe ich als besondere
Anerkennung, diese wissenschaftliche Einrichtung gründen zu
dürfen.“
|
|
- Studie der UDE zeigt: Social Media
kann Lernerfolg verbessern
- Kongress der Deutschen
Gesellschaft für Soziologie: Nichts bleibt, wie es ist
|
|
Studie der UDE zeigt: Social Media
kann Lernerfolg verbessern
Duisburg, 21. August 2025 -
Soziale Medien gelten oft als schlechte Informationsquelle.
Doch entscheidend ist nicht das Medium selbst, sondern wie
Inhalte verarbeitet werden: Zu diesem Ergebnis kommt eine
Studie der Universität Duisburg-Essen. Ein Feldexperiment mit
über 900 Teilnehmenden zeigt, dass informelles Lernen auf
Social Media möglich ist – sofern Inhalte dazu einladen, sich
intensiver mit ihnen auseinanderzusetzen.
Die
Teilnehmenden erhielten an vier aufeinanderfolgenden Tagen
identische Informationen über verschiedene Aspekte der
Tiefsee – entweder über einen E-Mail-Newsletter oder über
Instagram-Stories. In eine der beiden Instagram-Gruppen
wurden zusätzlich interaktive Fragen integriert, die gezielt
zum Nachdenken anregen sollten.
Diese knüpften an das
Vorwissen der Teilnehmenden an. In der Newsletter-Gruppe
wurden exakt dieselben Inhalte in kompakter Textform
vermittelt. Das Ergebnis: Die Newsletter-Gruppe schnitt beim
Wissenszuwachs zunächst am besten ab. Doch sobald die
Instagram-Inhalte mit Denkanstößen versehen wurden,
verschwand der Unterschied.
Teilnehmende mit
interaktivem Instagram-Content erinnerten sich an genauso
viele Informationen wie jene, die den Newsletter erhalten
hatten – und deutlich mehr als jene, die nur passiv
Instagram-Inhalte konsumierten. idr.
Zur Studie:
https://academic.oup.com/jcmc/article/30/5/zmaf014/8220424
Kongress der Deutschen Gesellschaft für
Soziologie: Nichts bleibt, wie es ist
Geht es um
das Thema Wandel, passt wohl kaum eine Stadt besser als
Duisburg: Hier diskutieren vom 22. bis 26. September rund
2.000 Expert:innen auf dem 42. Kongress der Deutschen
Gesellschaft für Soziologie das Leitthema „Transitionen“. Das
Institut für Soziologie der Universität Duisburg-Essen
richtet erstmals die traditionsreiche Fachveranstaltung aus.
Zur Eröffnung in der Philharmonie Mercatorhalle
werden Oberbürgermeister Sören Link und die Schriftstellerin
Lena Gorelik erwartet. Im Mittelpunkt des Kongresses steht
die Frage, wie Gesellschaft und Leben der Menschen sich
entwickeln und verändern oder wie sie neue Formen annehmen -
in Gemeinschaften, in Institutionen und im Alltag einzelner.
„Die Soziologie reflektiert und begleitet
gesellschaftliche Veränderungen kritisch, kann aber auch
aktiv Einfluss nehmen, indem sie Diskussionen anstößt“, so
Soziologieprofessorin Dr. Helen Baykara-Krumme, die mit vier
Mitarbeiterinnen des Instituts für Soziologie den Kongress am
Campus Duisburg der Universität Duisburg-Essen (UDE)
organisiert.
„Einige Transitionen sind unvorhersehbar
und kaum kontrollierbar, wie sich am Beispiel des
Klimawandels zeigt, andere im Bereich der Bildung oder der
Stadtentwicklung werden gezielt gestaltet, um
gesellschaftliche Ziele zu erreichen. Die soziologische
Forschung soll sowohl die Dynamiken als auch die Konflikte
hinter Transitionen untersuchen, darunter Machtverhältnisse,
Ressourcenverteilung und die sich daraus ergebenden sozialen
Ungleichheiten“, erklärt Prof. Baykara-Krumme.
Die
Plenen, Hauptvorträge und Panels befassen sich nicht nur mit
Wandel in Bereichen wie Demokratie, Nachhaltigkeit,
Digitalisierung, Arbeit oder Familie, sondern auch mit den
Methoden der Soziologie selbst: Bei der Frage, wie sich
Transitionen erfassen und analysieren lassen, spielen nicht
nur klassische sozialwissenschaftliche Instrumente wie
Zeitreihen- und Längsschnittanalysen oder Diskursanalysen
eine Rolle, sondern auch neue Ansätze, etwa aus der Big Data-
oder der interdisziplinären Forschung. Im Rahmenprogramm geht
es um den Zeitenwandel Duisburgs.
So gibt es
Exkursionen und Führungen durch die Stadtteile Marxloh,
Ruhrort und Hochfeld sowie eine Besichtigung des Innenhafens.
Außerdem bietet der erste DGS-Kongress in Duisburg mit dem
‚Campusabend‘ am Dienstag, 23. September, eine Besonderheit:
Dieses neue Format richtet sich nicht nur an
Kongressteilnehmende, sondern auch an weitere
Hochschulangehörige und die Stadtgesellschaft.
Der
Campus präsentiert sich in ausgelassener Abendstimmung – mit
einem Live-Auftritt der beiden Physiker Dr. Nicolas Wöhrl
(UDE) und Dr. Reinhard Remfort vom Podcast „Methodisch
inkorrekt!“ im Audimax, Foodtrucks im L‑Bereich und vielen
Gelegenheiten zum Austausch.
|
|
Internationale Tagung zu Kindheitsforschung
|
|
Duisburg, 6. August 2025 - Zwischen
Normalisierung und Behinderung Abhängigkeit und
Selbstständigkeit – in diesem Spannungsfeld bewegen sich
Kinder, insbesondere wenn sie eine Behinderung haben. Wie
kann ihre Verletzlichkeit ernst genommen werden, ohne ihnen
die Möglichkeit zur Selbstbestimmung abzusprechen?
Darüber diskutieren vom 10. bis 12. September Expert:innen
aus den Bereichen Kindheitsforschung, Disability Studies und
Philosophie der Kindheit. Aus sieben Ländern reisen sie auf
Einladung der Arbeitsgruppe Kindheitsforschung am Institut
für Erziehungswissenschaft an die Universität Duisburg-Essen.
„Die Kindheitsforschung ist gefordert, beides in den
Blick zu nehmen: die grundsätzliche Verletzlichkeit aller
Kinder und gleichzeitig ihr Recht auf Selbstbestimmung. Wir
müssen Kindheiten von als behindert verstandenen Kindern
analysieren, um Kindheit insgesamt besser zu verstehen. Die
englischsprachige Debatte ist der deutschsprachigen da weit
voraus“, so Prof. Dr. Anja Tervooren, Leiterin der
Arbeitsgruppe Kindheitsforschung an der Universität
Duisburg-Essen.
Gemeinsam mit ihrem Team richtet die
Erziehungswissenschaftlerin die von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft geförderte Tagung „Exploring
Vulnerability in Childhood. Between Normalization and
Disablement“ im Glaspavillon am Campus Essen aus. Neben
Keynotes aus Kanada, Großbritannien und Deutschland halten
Expert:innen zahlreiche Vorträge auf drei Panels zu ihren
aktuellen Forschungsprojekten und präsentieren ihre Poster.
„Auf unserer Podiumsdiskussion nehmen wir außerdem
Bezug auf aktuelle politische Entwicklungen, denn gerade in
Großbritannien existiert eine Verbindung des Forschungsfeldes
mit zum Beispiel Elterninitiativen. Für andere Länder könnte
das zum Vorbild werden“, so Prof. Tervooren.
|
|
Kommunalwahl-Navi: Klicken,
vergleichen, wählen
|
|
Duisburg, 4. August
2025 - Ein neuer Radweg, weniger Kita-Gebühren oder mehr
Videoüberwachung an Bahnhöfen? Wer in Nordrhein-Westfalen
lebt, kann am 14. September 2025 mitentscheiden – es ist
Kommunalwahl. Zur Abstimmung stehen Stadträte,
Bürgermeister:innen, Landrät:innen und mehr.
Doch
viele Menschen fragen sich:
Wo soll ich mein Kreuz
machen?
Was unterscheidet die Parteien?
Und um welche
Themen geht’s eigentlich?
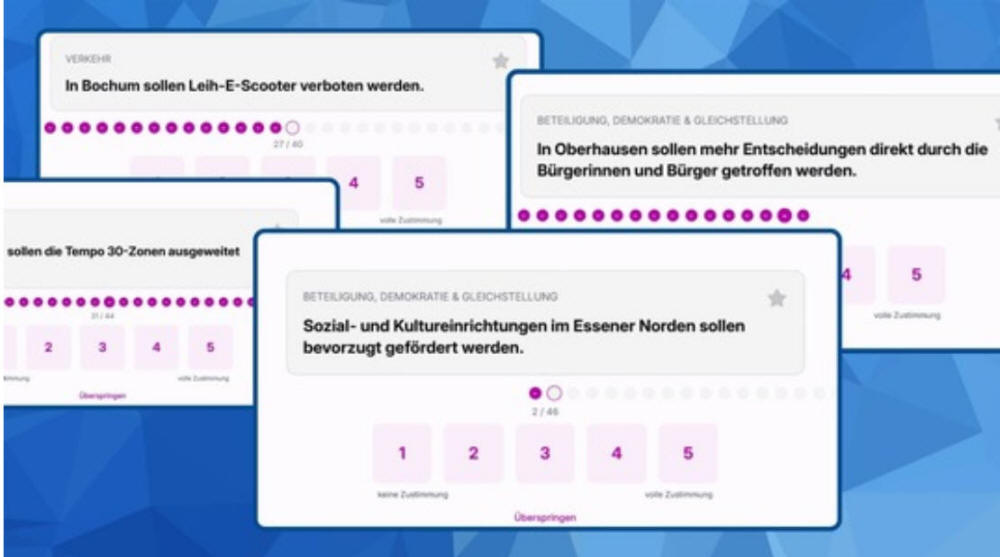
Screenshots von typischen Themen in
den Kommunalwahl-Navis. © UDE
Die NRW School of
Governance der Universität Duisburg-Essen und die Universität
Münster haben daher für einige Großstädte eine digitale
Wahlhilfe entwickelt: das Kommunalwahl-Navi. Es soll helfen,
die eigene Haltung mit den Positionen der Parteien
abzugleichen.
Das Kommunalwahl-Navi läuft für acht
Städte: Für
Duisburg,
Essen,
Oberhausen,
Bochum,
Köln
geht es Mitte August online, für
Münster,
Bielefeld,
Paderborn
ist es ab 4. August verfügbar. Wer das Navi nutzt, soll die
Positionen der Parteien in der jeweiligen Stadt verstehen und
sie vergleichen können, ohne sich mühsam durch Programme und
Politiksprech zu arbeiten.
Damit das funktioniert,
haben PD Dr. Julia Schwanholz, Raphael Moser, Dr. Ray
Hebestreit.(alle Universität Duisburg-Essen, UDE) und Prof.
Dr. Norbert Kersting (Universität Münster) im Juli mit rund
60 Studierenden Thesen entwickelt. Diese wurden an alle
kandidierenden Parteien, Wählerbündnisse und Bürgerlisten in
den genannten Städten geschickt. Niemand wurde
ausgeschlossen.
„Die meisten reagieren schnell und
konstruktiv, einige haben wir mehrfach erinnert“, so
Schwanholz. Prüfen, diskutieren, aussortieren „Uns war
wichtig, lokale Besonderheiten zu berücksichtigen“, sagt die
Politikwissenschaftlerin. „Neben übergreifenden Themen wie
Bildung, Verkehr oder Wohnen haben wir auch lokalspezifische
Fragen erarbeitet – etwa zu Radwegen, Videoüberwachung oder
kommunalen Finanzen.“
Was an Antworten eingeht, wird
nicht einfach übernommen, sondern geprüft, diskutiert und
manchmal auch aussortiert. Denn nur Thesen, die wirklich
Unterschiede zwischen den Parteien sichtbar machen, werden
ins Navi aufgenommen. Für die Umsetzung nutzen die
Wissenschaftler:innen die Plattform VOTO. Sie hat sich
bereits in anderen Bundesländern bewährt und wird bundesweit
in der politischen Bildung eingesetzt.
Nur: Was
bringt so ein Navi überhaupt? „Die Forschung zeigt: Wer eine
Wahlhilfe nutzt, wählt informierter – und überhaupt: geht
eher wählen“, sagt Schwanholz. Besonders für junge oder
unentschlossene Menschen könne das Navi ein Anstoß sein, sich
mit kommunalpolitischen Fragen auseinanderzusetzen. Und die
sind oft näher dran, als man denkt: „Ob Buslinie, Parkbank
oder Bolzplatz – viele politische Entscheidungen betreffen
direkt unser Wohnviertel.
Wer glaubt, dass Politik
nur in Berlin oder Brüssel gemacht wird, liegt falsch.
Kommunalpolitik gestaltet unser direktes Lebensumfeld. Wer
hier wählt“, appelliert Schwanholz, „kann mit seiner Stimme
tatsächlich etwas bewegen!“
URL der
Kommunalwahl-Navis, online ab Mitte August:
Duisburg:
https://app.voto.vote/de/app/12968927
Essen:
https://app.voto.vote/de/app/14583798
Oberhausen:
https://app.voto.vote/de/app/13786581
Bochum:
https://app.voto.vote/de/app/14542761
Köln:
https://app.voto.vote/de/app/3868580
Bereits online:
Münster:
https://app.voto.vote/de/app/3141396
Bielefeld:
https://app.voto.vote/de/app/2249723
Paderborn:
https://app.voto.vote/de/app/2544056
|
|
- UDE erhält Förderung durch Start-up Center.NRW
- Sportcamp Open Academy Trendsport testen Klettern,
Parkour oder Muay
|
|
Stärkung von
KI-Innovationen und Gründungskultur
Duisburg,
4. August 2025 - Wie lässt sich Unternehmertum an Hochschulen
digital neu denken und durch Künstliche Intelligenz
beschleunigen? Die Universität Duisburg-Essen tritt an, mit
dem Projekt SMART GUIDE eine zukunftsweisende Antwort zu
liefern – und gehört damit zu den 14 Hochschulen in
Nordrhein-Westfalen, die über das Programm Start-up
Center.NRW von Land und Europäischer Union in den kommenden
drei Jahren gefördert werden.
Insgesamt 18 Millionen
Euro stehen dafür landesweit zur Verfügung. Das Ziel ist
klar: „Wir entwickeln die Universität Duisburg-Essen zum
Innovationsmotor für KI-basierte Produkte und
Geschäftsmodelle weiter“, sagt Prof. Dr. Hannes Rothe. Er ist
Lehrstuhlinhaber am Rhine-Ruhr Institute of Information
Systems, Leiter des Place Beyond Bytes und Koordinator des
Projektes SMART GUIDE, das nun mit rund 1,5 Millionen Euro
gefördert wird. Damit sollen Teile des Gründungsprozesses mit
bestehenden KI-Technologien automatisiert werden.
„Diese neuen KI-Technologien werden uns helfen,
zukunftsweisende Lösungen zu erschaffen, die aktiv zur
nachhaltigen Transformation der gesamten Region beitragen“,
so Rothe weiter. Gemeinsam mit dem Zentrum für Gründungen und
Innopreneurship GUIDE der Universität Duisburg-Essen (UDE)
vereint SMART GUIDE die herausragende Expertise des Instituts
für Künstliche Intelligenz in der Medizin (IKIM), des
Fachgebiets Verteilte Systeme (VS), der Networked Embedded
Systems Group sowie des Co-Creation Labs Place Beyond Bytes
(PBB).
Durch das Zusammenspiel von technologischem
Know-how und fachspezifischem Wissen werden so
Gründungsprozesse an der UDE deutlich beschleunigt. Denn
gerade bei innovativen Start-ups zählt in der Gründungsphase
oft jede Woche, um mit einer Idee erfolgreich am Markt zu
sein.
Ein zentrales Element des Projekts: ein
KI-Fabrikationslabor. Hier werden Erfahrungen der
auslaufenden
Exzellenz Start-up Center.NRW-Initiative
genutzt und typische Herausforderungen des
Gründungsprozesses zukünftig via KI automatisiert.
Gründungsteams erhalten dafür Zugang zu speziellen Trainings
und auf sie zugeschnittene KI-Softwarelösungen.
Das
beschleunigt den gesamten Innovationsprozess – von der
datenbasierten Entscheidungsunterstützung, über die
automatisierte Entwicklung und Testing von Prototypen, bis
zur Ansprache von zukünftigen Nutzer:innen. In Eventformaten
wie “AI for Good”-Hackathons werden neue Use Cases, etwa zu
Gesundheit, Logistik und 5G/6G, erarbeitet. Zudem richtet
sich SMART GUIDE auch gezielt an Start-ups, deren Produkt im
Kern auf KI basiert.
Mit dem Format
„Entrepreneurs-in-Residence“ werden beispielsweise erfahrene
Unternehmer:innen ihr Wissen weitergeben und zeitlich
begrenzt Führungspositionen in Start-ups übernehmen. Darüber
hinaus ist die UDE eng mit nationalen und europäischen
Initiativen verknüpft – beispielsweise über begleitende
Projekte wie ZaKI.D, EHDS4ALL oder KI4KMU am Niederrhein.
Die Abstimmung mit führenden Accelerator-Programmen, wie der
BRYCK Startup Alliance und UNITE – KI Entrepreneurship
Zentrum (K.I.E.Z.) verstärkt die Strahlkraft der Maßnahmen
zusätzlich.
Sportcamp Open Academy Trendsport
testen Klettern, Parkour oder Muay
Thai: Diese
und andere coole Sportarten können junge Leute bei der Open
Academy vom 18. bis 22. August am Sportcampus der Universität
Duisburg-Essen ausprobieren. Anmelden kann sich, wer zwischen
13 und 20 Jahre alt ist. Vorkenntnisse sind nicht
erforderlich. In den Kosten von insgesamt 10 Euro ist ein
tägliches Mittagessen enthalten.

© Jonathan Steiof
Es wird eine Woche voller Action
und Abwechslung: Neben Klettern, Parkour und Muay Thai stehen
auch (Street-)Basketball, Trampolin, Calisthenics, Disc-Golf
(Frisbee), Skaten und Beachvolleyball auf dem Programm. Wer
schon Erfahrung mitbringt, kann neue Skills hinzulernen; alle
anderen probieren einfach aus, was Spaß macht.
Die
„Open Academy“ läuft täglich von 10 bis 15 Uhr an der
Gladbecker Straße in Essen. Sie wird organisiert vom Institut
für Sport- und Bewegungswissenschaften der Universität
Duisburg-Essen in Zusammenarbeit mit der Junior Uni Essen.
Gefördert wird das Sportcamp durch die
Anneliese-Brost-Stiftung sowie den Förderverein Universität
Duisburg-Essen e.V. Weitere Informationen und Anmeldung
unter:
http://www.junioruni-essen.de/kurse/sommerferien-open-academy-2025
|
|
Anmeldestart für die 30. SommerUni
Experimentieren, entdecken, durchstarten
|
|
Duisburg, 31. Juli 2025 - In der letzten
Ferienwoche in NRW, vom 18. bis 21. August 2025, lädt die
Universität Duisburg-Essen wieder Schüler:innen ab 15 Jahren
zur SommerUni Natur- und Ingenieurwissenschaften (SUNI) ein.
Die traditionsreiche Veranstaltung feiert in diesem Jahr ihr
30-jähriges Bestehen – und bietet 2025 so viel wie nie zuvor:
Erstmals findet die SUNI an drei Campusstandorten statt – in
Duisburg, Essen und an der Universitätsmedizin Essen.
Die SommerUni Natur- und Ingenieurwissenschaften (SUNI)
gibt Jugendlichen die Möglichkeit, sich intensiv mit den
spannenden Themen aus den Natur- und Ingenieurwissenschaften
auseinanderzusetzen. Das Programm reicht von interaktiven
Vorträgen und praktischen Workshops bis hin zu Experimenten
im Labor. So erfahren die Teilnehmenden zum Beispiel im
Workshop „Slimy & Smart“, wie Schnecken und ihre Parasiten
als Indikatoren für ökologische Zusammenhänge dienen können.
Zudem gehen sie den Fragen nach, warum wir in der
Medizin auch an das Geschlecht denken und was Laser alles
können. Neu in diesem Jahr ist die Einbindung des Campus der
Universitätsmedizin, die weitere spannende Perspektiven
eröffnet – etwa auf die Schnittstellen zwischen
Naturwissenschaften, Technik und Medizin. Damit lernen die
Teilnehmenden erstmals alle drei großen UDE-Standorte kennen.
Ein fester Bestandteil der SUNI ist das sogenannte
Kontaktikum: Einen Tag lang erkunden die Teilnehmenden reale
Berufsfelder in Industrie und Forschung. In diesem Jahr ist
ein Besuch beim Ruhrverband geplant – einem der wichtigsten
Akteure der Wasserwirtschaft im Ruhrgebiet, der für die
Abwasserreinigung in 60 Städten und Kommunen verantwortlich
ist.
Durch einen Besuch beim Fischlift am Baldeneysee
und der Kläranlage in Essen Kupferdreh werden durch dieses
Kontaktikum Fragen wie: Warum müssen Fische Aufzug fahren?
und Was passiert mit dem Wasser, das ihr täglich benutzt?
geklärt. Die UDE legt besonderen Wert auf
Chancengerechtigkeit: Wie in den vergangenen Jahren werden
die Programme geschlechtergetrennt durchgeführt, um eine
gezielte Förderung in geschütztem Rahmen zu ermöglichen.
Ursprünglich ausschließlich für Mädchen konzipiert, steht
die Veranstaltung seit 2012 allen Interessierten offen. Die
SommerUni kostet 35 Euro, inklusive Mensaessen. Die
Anmeldung zur SUNI 2025 ist ab sofort online möglich.
Weitere Informationen: Hier geht es zum Programm und zur
Anmeldung:
www.uni-due.de/schuelerinnenprogramme
|
|
Netzwerk stärkt ukrainische Universitäten |
|
Hoffnung dank akademischem
Austausch
Duisburg, 22. Juli 2025 - Sirenen
statt Seminar, Stromausfall statt Studium: Für Studierende
und Lehrende in der Ukraine gehört das zum Alltag. Trotz der
katastrophalen Lage halten viele Hochschulen seit Beginn des
russischen Angriffskriegs den Lehrbetrieb aufrecht – oft nur
digital, unter schwierigen Bedingungen. Die Universität
Duisburg-Essen unterstützt sie dabei.
Nach dem
erfolgreichen Projekt „Ukraine Digital“ (2022–2025) erhält
sie nun vom Deutschen Akademischen Austauschdienst DAAD
erneut über eine halbe Million Euro für die kommenden vier
Jahre. Rektorin Prof. Dr. Barbara Albert unterzeichnete
soeben den Vertrag, der im Rahmen des DAAD-Programms DUHN
(Deutsch-Ukrainisches Hochschulnetzwerk) mit vier
ukrainischen Universitäten geschlossen wurde.

v.l.: Prof. Matthias Epple, Rektorin Prof. Barbara Albert,
Prof. Heike Roll. © UDE
Bis 2029 wird so die bewährte
Zusammenarbeit der Universität Duisburg-Essen mit den
Partnerhochschulen in Kharkiv, Sumy und Vinnytsia vertieft,
neu hinzu kommt die Pädagogische Universität Kryvyi Rih.
„Inmitten des Krieges möchten wir damit eine akademische
Entwicklung unterstützen und ein Zeichen internationaler
Solidarität setzen“, erklärt Rektorin Prof. Dr. Barbara
Albert. Die Projektleitung liegt erneut bei Prof. Dr.
Matthias Epple (Fakultät für Chemie) und Prof. Dr. Heike Roll
(Institut für Deutsch als Zweit- und Fremdsprache).
„Wir wollen mit den vier Universitäten digitale und hybride
Lehrangebote weiterentwickeln, gemeinsame Curricula gestalten
und Studienmodule internationalisieren“, sagen sie.
„Neben der Online-Lehre planen wir außerdem Präsenzformate:
Jährlich stattfindende Sommerschulen in Deutschland werden
Raum für einen akademischen Austausch, für praktische
Laborerfahrungen und interdisziplinäre Workshops bieten –
auch zu Themen wie Resilienz, Internationalisierung oder
wissenschaftlicher Ethik. In der Ukraine hingegen sollen
Blockkurse stattfinden, die auch deutsche Lehrende und
Studierende einbeziehen.“
Über eine gemeinsame
Online-Plattform vernetzen sich nicht nur Dozierende,
Studierende und Alumni. Hierüber werden auch Lehrmaterialien
bereitgestellt und Forschungsideen gemeinsam entwickelt.
Epple und Roll betonen: „Gerade angesichts der schwierigen
Bedingungen in der Ukraine soll das neue Netzwerk nicht nur
akademische Strukturen sichern, sondern auch Hoffnung geben.“
UDE: Neues Tool macht komplexe Daten
verständlich
Tabellarische Daten sind das
Herzstück wissenschaftlicher Analysen – ob in der Medizin,
den Sozialwissenschaften oder auch in der Archäologie. Sie
nachvollziehbar und nutzbar zu machen, gestaltet sich oft
mühsam, vor allem wenn die Daten umfangreich oder komplex
sind. Das Institut für Künstliche Intelligenz in der Medizin
(IKIM) der
Universität Duisburg-Essen hat eine elegante Lösung
entwickelt: Datavzrd.
Dieses Open-Source-Tool verwandelt einfache Tabellen
in interaktive, visuell ansprechende HTML-Berichte – ganz
ohne Programmierkenntnisse oder zusätzliche Software. Die
Open-Access-Zeitschrift
PLOS One berichtet hierüber. Rohdaten in Tabellenform
sind häufig schwer lesbar und unübersichtlich. Meist lassen
sich Datenpunkte nicht filtern, sortieren oder verknüpfen.
Und werden Tabellen versendet oder geteilt, gehen oft Kontext
und Verknüpfungen verloren.
Werkzeuge wie etwa R
Shiny bieten zwar gute Möglichkeiten, Daten zu visualisieren
und interaktiv nutzbar zu machen. Sie erfordern aber
besondere technische Kenntnisse oder eine spezielle Software.
Nicht so die am IKIM entwickelte Lösung Datavzrd. Die
erstellten Berichte lassen sich lokal im Browser öffnen, per
E-Mail versenden oder als Manuskriptanhang nutzen. Dabei
bleiben sie vollständig interaktiv – sogar bei großen
Datensätzen mit Millionen von Zeilen.
„Der große
Vorteil von Datavzrd: Es ist besonders einsteigerfreundlich
und wartungsarm“, erklärt Informatiker Felix Wiegand. Der
Wissenschaftler, der zur Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Johannes
Köster am IKIM gehört, hat das Tool mitentwickelt. „Die
Berichte werden nicht programmiert, sondern einfach über eine
leicht verständliche Textdatei beschrieben – ähnlich wie ein
Steckbrief, in dem festgelegt wird, welche Daten gezeigt
werden sollen und in welcher Weise. So können auch Nutzende
ohne Programmiererfahrung ihre Daten schnell und
übersichtlich aufbereiten.“
Außerdem lassen sich
komplexe Beziehungen zwischen verschiedenen Tabellen
abbilden, um etwa durch Datenhierarchien zu navigieren oder
zusammenhängende Einträge miteinander zu verknüpfen. Ein
Tutorial erleichtert die Nutzung des Tools. Wie
vielseitig Datavzrd ist, zeigt das IKIM-Team in der
Publikation beispielhaft an verschiedenen Anwendungen,
darunter sind diese zwei: In einem molekularen
Tumorboard werden genetische Befunde und Therapieoptionen
patientenbezogen interaktiv dargestellt – so wie es in der
medizinischen Praxis benötigt wird.
Und in einer
archäologischen
Studie werden verzierte Kleidungselemente aus
verschiedenen Fundstätten vergleichbar aufbereitet und
verknüpft präsentiert. „Datavzrd macht datenbasierte
Ergebnisse intuitiv, flexibel und nachhaltig nutzbar“, fasst
Felix Wiegand die Vorteile zusammen. „Es eignet sich für
nahezu alle Disziplinen und wissenschaftliche Bereiche – von
der Forschung über die Lehre bis hin zur Begutachtung.“
|
|
- UDE-Forschung: Chaperon-Komplex
in Aktion sichtbar gemacht
- Studierende
konzipieren Kunstausstellung „MOTHER MADONNA ME“
|
|
UDE-Forschung: Chaperon-Komplex in Aktion sichtbar gemacht
Duisburg, 21. Juli 2025 - Proteinfaltung im Zellinneren
neu verstanden Wie Proteine in unseren Zellen ihre richtige Form
finden, ist entscheidend für die Gesundheit. Fehler dabei können
schwere Krankheiten verursachen. Forschende des Zentrums für
Medizinische Biotechnologie (ZMB) der Universität Duisburg-Essen
haben nun gemeinsam mit nationalen Partnern einen zentralen
Mechanismus dieses Prozesses entschlüsselt.
Im Mittelpunkt:
der sogenannte BiP-GRP94-Chaperon-Komplex. Er spielt im
endoplasmatischen Retikulum, dem Produktions- und Kontrollzentrum
der Zelle, eine Schlüsselrolle bei der Proteinfaltung. Die
Ergebnisse der Studie wurden nun in der Fachzeitschrift
Nature
Structural & Molecular Biology veröffentlicht.
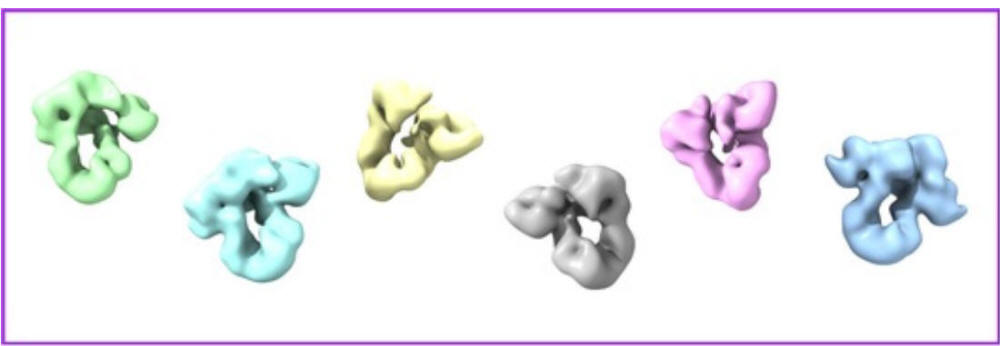
Mit der Einzelpartikel-Negativkontrast-Elektronenmikroskopie wurden
viele einzelne BiP–GRP94-Komplexe untersucht. Aus den Aufnahmen
entstanden 3D-Modelle, die verschiedene Formen des Komplexes zeigen
– ein Hinweis darauf, wie der BiP–GRP94-Komplex seine Konformation
ändern kann.
„Unsere Studie zeigt erstmals auf struktureller
Ebene, wie die beiden Chaperone BiP und GRP94 zusammenarbeiten. Wir
konnten nachweisen, dass sich der Komplex bei seiner Arbeit
schrittweise und koordiniert verändert.“ erklärt Prof. Dr. Doris
Hellerschmied von der Universität Duisburg-Essen (UDE), Letztautorin
der Arbeit und Leiterin der Studie.
„Die flexible Struktur
des BiP-GRP94-Komplexes ist vermutlich entscheidend dafür, dass er
eine Vielzahl von verschiedenen Proteinen bei ihrem Faltungsprozess
unterstützen kann.“
Die Forscher:innen nutzten modernste
Methoden wie hochauflösende Elektronenmikroskopie und biochemische
Analysen, um verschiedene, bislang unbekannte Konformationen des
Chaperon-Komplexes sichtbar zu machen und deren Bedeutung für die
Funktion zu entschlüsseln.
„Unsere Ergebnisse liefern
wertvolle Einblicke in die molekulare Maschinerie der Zelle“, betont
Dr. Simon Pöpsel (UDE), Ko-Leiter der Studie. „Langfristig könnten
sie dazu beitragen, neue Therapieansätze gegen Krankheiten zu
entwickeln, bei denen die Proteinfaltung gestört ist – etwa bei
bestimmten neurodegenerativen Erkrankungen.“
Die Arbeit
wurde im Rahmen des DFG-geförderten Sonderforschungsbereichs 1430
(„Molekulare Mechanismen der Zellfunktion und zellulären
Organisation“) durchgeführt und unterstreicht die Bedeutung der
interdisziplinären Zusammenarbeit an der UDE und mit nationalen
Partnern.
Studierende konzipieren Kunstausstellung
„MOTHER MADONNA ME“
Die vielen Facetten von Mutterbildern
Rabenmutter, Löwenmama, Helikoptermutter: Es gibt viele
unterschiedliche Vorstellungen vom Mutterdasein. Sie sind Thema
einer Ausstellung, die Studierende der Universität Duisburg-Essen in
Kooperation mit der Essener Galerie Obrist realisiert haben. Am 25.
Juli um 19 Uhr wird sie eröffnet.

Judith Samen, o.T., (Milch schütten), 2001 (c) UDE/Judith Samen
Die Galerie und die rund 40 Studierenden der Literatur- und
Kunstwissenschaft der Universität Duisburg-Essen (UDE) konnten sechs
renommierte internationale Künstlerinnen für ihre Ausstellung
gewinnen, ihre Werke, die sich mit ihren eigenen Vorstellungen von
Mutterdasein auseinandersetzen, zu präsentieren: Kayoon Anderson,
Wiebke Bartsch, Katharina Bosse, Marcela Böhm, Judith Samen und
Annie Wang. Ihre Skulpturen, Malereien, Fotografien und textile
Arbeiten werden bis zum 23. August in der Essener Galerie zu sehen
sein.
Entstanden ist die Ausstellung im interdisziplinären
Seminar „Mutterbilder in Literatur und Kunst“. Die Studierende, die
zum Teil angehende Lehrkräfte sind, befassten sich wissenschaftlich
mit dem Thema und lernten, was es heißt, ein solches Projekt auf die
Beine zu stellen. Sie entschieden, welche Werke wo im Raum zu sehen
sein werden, wie visuelle Spannung im Raum erzeugt werden kann. Sie
verfassten Texte für den Ausstellungskatalog, bereiteten ein
Gespräch mit den Künstlerinnen für die Vernissage vor und entwarfen
Plakate und Flyer. Außerdem informieren sie über einen eigenen
Instagram-Kanal über ihr Projekt.
„Mit diesem
Kooperationsprojekt wollten wir den Studierenden vermitteln, wie
anregend der Austausch mit regionalen Kulturorten sein kann und sie
zu eigenen Projekten in ihrem künftigen Berufsalltag ermutigen“,
erklären Dr. Sabine Kampmann vom Institut für Kunst und
Kunstwissenschaft mit Dr. Liana Schüller vom Institut für
Germanistik der UDE das Ziel des Seminars, das sie gemeinsam im
vergangenen Sommersemester angeboten haben.
Weitere
Informationen:
https://www.galerie-obrist.de/mother-madonna-me/
|
|
Universitätsallianz Ruhr schließt
neuen Kooperationsvertrag
Neues Forschungsprojekt
durchleuchtet Hantavirus
|
|
Universitätsallianz Ruhr schließt
neuen Kooperationsvertrag
Duisburg, 17. Juli 2025
- Die drei Partnerunis TU Dortmund, Ruhr-Universität Bochum
und Universität Duisburg-Essen vereinbaren in ihrer
gemeinsamen Universitätsallianz Ruhr (UA Ruhr) einen neuen
Kooperationsvertrag. Die bisherige Vereinbarung decke die
Tragweite der hochschulübergreifenden Zusammenarbeit nicht
mehr ab: "Viele neue Institutionen und Kooperationen wurden
geschaffen, allen voran die vier Research Center und das
College, die vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert werden",
heißt es aus der Allianz.
Um die Weiterentwicklung der
UA Ruhr zu gestalten, sieht der Kooperationsvertrag neue
Gremien vor: das Executive Board, das die bisherigen
Steuerungsgremien ersetzt, und ein Sprecher oder eine
Sprecherin zur Repräsentation der UA Ruhr nach außen wurden
bestimmt. Außerdem wird die UA Ruhr Assembly ins Leben
gerufen, in der sich entsandte Senatsmitglieder der drei
Universitäten austauschen. Die Rektorin der Universität
Duisburg-Essen, Prof. Dr. Barbara Albert, wurde nach
Inkrafttreten des Vertrags zur Sprecherin des Executive
Boards gewählt.
Seit 2007 arbeiten die
Ruhr-Universität Bochum, die Technische Universität Dortmund
und die Universität Duisburg-Essen unter dem Dach der UA Ruhr
strategisch eng zusammen. Unter dem Motto "gemeinsam besser"
gibt es inzwischen über 100 Kooperationen in Forschung, Lehre
und Verwaltung. Mit rund 100.000 Studierenden und nahezu
14.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gehört die
UA Ruhr zu den größten und leistungsstärksten
Wissenschaftsstandorten Deutschlands. idr
Neues Forschungsprojekt durchleuchtet Hantavirus
Mit einem neuen Forschungsprojekt möchten
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität
Duisburg-Essen herausfinden, wie sich sogenannte Hantaviren
vermehren. Hantaviren, die grippeähnliche Symptome sowie
Nieren- oder Lungenprobleme auslösen können, breiten sich in
Teilen Deutschlands aus – doch es fehlen Impfstoffe und
Therapien. Das Forschungsteam untersucht, wie die Viren
gesunde Zellen reprogrammieren, um sich darin zu vermehren.
Die Viren verändern gezielt das Zytoskelett – eine
Art Stützgerüst der Zelle. Diesen Prozess möchten die
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler besser verstehen, um
neue Schwachstellen des Virus‘ zu entdecken und
Angriffspunkte für künftige Therapien zu identifizieren.
Das Forschungsprojekt wird von der DFG mit mehr als
430.000 Euro gefördert. Hantaviren werden durch Nagetiere,
vor allem Mäuse, auf den Menschen übertragen. Eine Infektion
erfolgt meist über das Einatmen von Staub, der mit
Ausscheidungen infizierter Tiere verunreinigt ist. Eine
direkte Übertragung von Mensch zu Mensch wurde bisher nicht
nachgewiesen. idr
|
|
Gleichstellungserfolg für die Universität
Duisburg-Essen |
|
Top im CEWS-Ranking
Duiisburg, 3. Juli 2025 - Wie ist es um die
Gleichstellung der Geschlechter an Hochschulen und
Universitäten in Deutschland bestellt? Das bewertet und
vergleicht das Center of Excellence Women and Science (CEWS)
alle zwei Jahre für die verschiedenen Qualifikations- und
Karrierestufen. Soeben ist das
aktuelle Ranking erschienen – mit einem starken Ergebnis
für die Universität Duisburg-Essen: Sie ist unter den besten
sieben von 79 bewerteten Universitäten.
Ihre
Anstrengungen für Gleichstellung zahlen sich demnach aus. Das
CEWS-Ranking hat sich seit seinem ersten Erscheinen 2003 als
Instrument für die Qualitätssicherung von Gleichstellung an
Hochschulen und Universitäten etabliert. Wie erfolgreich
Hochschulen und Universitäten – sie werden getrennt
voneinander betrachtet – mit ihren Maßnahmen sind, wird mit
Hilfe quantitativer Indikatoren kontinuierlich und bundesweit
verglichen.
Das aktuelle Ranking beruht auf Daten der
amtlichen Hochschulstatistik aus 2023 und teilt die
Gleichstellungsleistungen der Universitäten in elf
Ranggruppen ein. Gruppe 1, die voraussetzt, in allen
Kategorien an der Spitze zu sein, hat keine der 79
untersuchten Universitäten erreicht. In die zweitbeste Gruppe
haben es nur sieben Universitäten geschafft. Eine davon ist
die Universität Duisburg-Essen.
„Das ist ein starkes
Signal für uns“, sagt Rektorin Prof. Dr. Barbara Albert. „Das
tolle Abschneiden bestätigt, dass unsere Maßnahmen zur
Förderung und Gewinnung von Frauen für die Wissenschaft
wirken. Es ist zugleich eine wichtige Anerkennung und spornt
uns an, den eingeschlagenen Weg entschlossen weiterzugehen.“
Das CEWS-Ranking sieht die Universität Duisburg-Essen
in diesen Kategorien in der Top-Gruppe: Promotionen,
Post-Docs, hauptberufliches wissenschaftliches Personal sowie
Steigerung dieses Personals gegenüber dem Jahr 2018. Gelobt
wird auch, dass im Vergleich zur letzten Erhebung 2018 mehr
Frauen berufen wurden.
Lediglich beim Frauenanteil an
Professuren insgesamt sieht das Ranking Luft nach oben.
Positiv ist, dass an der UDE die Hälfte der Studierenden
weiblich sind (50,16%), bei den Promovierenden sind es 46,40
Prozent.
Die Ergebnisse zur UDE in Zahlen:
Promotionen 2021-2023: 1519 Promotionen, Frauenanteil 45,75%
Wissenschaftliche Qualifikation nach der Promotion
2021-2023:
131 Habilitationen, Frauenanteil 42,27%
64
Juniorprofessuren, Frauenanteil 53,13%
Hauptberufliches
wissenschaftliches und künstlerisches Personal unterhalb der
Lebenszeitprofessur 2021-2023:
1577 Personen,
Frauenanteil 48,76% (in 2018: 44,52%)
Professuren 2023:
480 Professuren, Frauenanteil 31,04% (in 2018: 25,16%)
|
|
Expertin Prof. Monika Schnitzer zu
Gast: Wirtschaftspolitik in unsicheren Zeiten
|
|
Duisburg, 25. JUni 2025 - Braucht die
Bundesregierung eine fundierte Aussage zur aktuellen Lage der
Wirtschaft, kommt er zum Zug: der Sachverständigenrat zur
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.
Zweimal jährlich legen die berufenen Expert:innen, auch die
fünf Wirtschaftsweisen genannt, einen Bericht vor. Die
aktuelle Ausgabe, das Frühjahrsgutachten, stellt die
Vorsitzende, Prof. Dr. Monika Schnitzer, am 2. Juli allen
Interessierten an der Universität Duisburg-Essen vor.

(copyright: Sachverständigenrat Wirtschaft)
Eine
Anmeldung ist nicht nötig. Prof. Dr. Monika Schnitzer ist zu
Gast an der UDE Unter dem Titel „Wirtschaftspolitik in
unsicheren Zeiten – Das Frühjahrsgutachten 2025 des
Sachverständigenrates“ erklärt die
Wirtschaftswissenschaftlerin von 18 bis 19.30 Uhr am Campus
Duisburg (Raum LB 104) die Arbeit des Rats, dem auch Prof.
Dr. Achim Truger angehört.
Der Professor für
Sozioökonomie hat seine Ratskollegin an das Institut für
Sozioökonomie der Universität Duisburg-Essen (UDE)
eingeladen. Gemeinsam mit ihren drei Kolleg:innen hatten
Schnitzer und Truger in ihrer Konjunkturprognose für 2026 ein
Nullwachstum voraussagt. Außerdem werden im aktuellen Bericht
die Chancen zusätzlicher Investitionen und strukturelle
Herausforderungen für die deutsche Volkswirtschaft
diskutiert.
Wirtschaftsweise Schnitzer stellt das
aktuelle Gutachten vor, das am 21. Mai der Bundesregierung
übergeben wurde, und geht dabei auch auf die aktuelle Debatte
um die Zollpolitik ein. Anschließend besteht die Möglichkeit
Fragen zu stellen und gemeinsam zu diskutieren. Prof. Dr.
Monika Schnitzer ist seit Oktober 2022 die Vorsitzende des
Sachverständigenrates Wirtschaft, dem sie seit April 2020
angehört. Sie ist Professorin für Komparative
Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität
München (LMU).
|
|
Studie zu privaten
Krankenversicherungen
|
|
Lange Laufzeiten
entschärfen Probleme
Duisburg, 20. Juni 2025 -
Langfristige Verträge der privaten Krankenversicherung in
Deutschland kommen nah an das, was die Wirtschaftstheorie als
„optimal“ beschreibt. Eine internationale Studie mit
Beteiligung der Universität Duisburg-Essen zeigt: Viele
Probleme des Versicherungsmarkts lassen sich durch lange
Laufzeiten abfedern – ganz ohne komplizierte Konstruktion der
Verträge. Veröffentlicht wird die Studie im Journal of
Political Economy, einem der fünf führenden Fachjournale der
Volkswirtschaftslehre.
Einer der vier Studienleiter
ist Prof. Dr. Martin Karlsson von der Universität
Duisburg-Essen (UDE). Gemeinsam mit Kollegen der Cornell
University, der University of Pennsylvania (beide USA) sowie
des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung
analysierte er, wie gut die langfristigen Verträge in der
privaten Krankenversicherung (PKV) funktionieren – gemessen
an dem, was die ökonomische Theorie als „optimal“ beschreibt.
Optimal ist ein Vertrag dann, wenn er sich flexibel an
die aktuelle Lebenslage anpasst. In einkommensstarken
Lebensphasen zahlt man mehr, in schwächeren wird man
entlastet. In der Realität funktioniert das kaum. Trotzdem
zeigen die Gesundheitsökonomen: Die PKV-Verträge kommen
diesem Ideal erstaunlich nah – vor allem, wenn das Einkommen
im Lauf des Lebens relativ stabil bleibt.
|
|
- Erneute
Förderung für Graduiertenkolleg durch KI
-
Reformplan für die Finanzkontrolle Schwarzarbeit für faire
Löhne
-
Studie zur Datenweitergabe - Vertrauen verstärkt Offenheit
|
|
Erneute Förderung für
Graduiertenkolleg - Maßgeschneiderte Behandlung durch KI
Juni 2025 -
Durch die Digitalisierung in der Medizin entsteht eine große Menge
klinischer Daten. Das Graduiertenkolleg Wissens- und datenbasierte
Personalisierung von Medizin am Point of Care, kurz: WisPerMed,
macht sie für Ärzt:innen in einer neuen Form nutzbar. Die Deutsche
Forschungsgemeinschaft fördert das Programm unter der Leitung der
Universität Duisburg-Essen für weitere viereinhalb Jahre. Sprecher
ist Prof. Dr. Felix Nensa vom Institut für Künstliche Intelligenz in
der Medizin der Medizinischen Fakultät.

GRK-Sprecher Prof. Dr. Felix Nensa arbeitet mit dem „Patient
Dashboard“ an einem radiologischen Befundarbeitsplatz. © UDE /
Bettina Engel-Albustin
Ziel des seit 2021 laufenden
Graduiertenkollegs (GRK) der Universitätsmedizin Essen und der FH
Dortmund ist es, die personalisierte Medizin mithilfe von KI
unmittelbar dort voranzutreiben, wo ein:e Patient:in versorgt wird
(Point of Care). Am Beispiel des malignen Melanoms werden in den
Projekten am Universitätsklinikum Essen hierfür neue Werkzeuge
entwickelt.
Personalisierte Medizin meint in diesem Fall
beide Seiten: Statt des Prinzips „eine Behandlung für alle“ wird die
medizinische Entscheidung datenbasiert und jeweils abgestimmt auf
die biologische, gesundheitliche und persönliche Situation einer
bzw. eines Erkrankten getroffen. Zum anderen werden aber auch die
individuellen Präferenzen der behandelnden Mediziner:innen
miteinbezogen. Denn sie müssen bei der Nutzung der Werkzeuge die
Informationen schnell und intuitiv verstehen.
„Es gibt eine
Wissens-Explosion in der Medizin, vor allem in der Onkologie; es
entstehen immer mehr Daten. Ärzt:innen haben weder Zeit noch
Kapazitäten, alles selbst zu filtern und zu verarbeiten“, erklärt
GRK-Sprecher Prof. Dr. Felix Nensa, Experte für Radiologie mit
Schwerpunkt KI. „Wir möchten ihnen daher ergänzendes Wissen zur
Verfügung stellen und neues Wissen aus Daten generieren, ohne sie in
ihrer Entscheidungsfreiheit zu beschränken. Das ist eine riesige
Chance, gerade in der Krebsmedizin.“
Im GRK WisPerMed
forschen zurzeit 13 Professor:innen und 13 Doktorand:innen an einem
adaptiven System, KI in medizinische Entscheidungsprozesse zu
integrieren. Unter anderem durch Machine Learning-Methoden werden
Daten intelligent verknüpft und systematisch ausgewertet: solche aus
den Leitlinien zur Diagnostik, aus der Therapie und Nachsorge,
sämtliches verfügbares Wissen aus Studien, aus Patientendatenbanken
und alle relevanten Daten zur erkrankten Person.
Die KI
könnte dann eine Behandlungsempfehlung generieren und
prognostizieren, ob ein Tumor Resistenzen oder eine Therapie schwere
Nebenwirkungen entwickeln könnte. Ärzt:innen können dabei immer
nachvollziehen, auf welcher Basis die Empfehlung getroffen wurde, um
die Ergebnisse zu kontrollieren.
Visualisiert werden die
Ergebnisse der KI in einem Dashboard – abgestimmt auf die
persönlichen Arbeitsweisen und Fachbereiche der Behandelnden. Dafür
arbeiten die Mediziner:innen mit anderen Disziplinen der UDE
zusammen, wie der Informatik und der Sozialpsychologie.
In
der nun anstehenden Förderphase wird die Forschung auf den gesamten
Behandlungspfad der Patient:innen ausgeweitet. Anstatt wie bisher
einzelne Entscheidungsunterstützungen für spezifische Probleme zu
adressieren, zielt der neue Ansatz darauf ab, Prozesse von der
Erstdiagnose über die Behandlung bis zur Nachsorge ganzheitlich zu
erfassen, zu unterstützen und zu optimieren.
Indem
Patientendaten und klinisches Wissen an verschiedenen Schnittstellen
des Gesundheitssystems nahtlos integriert werden, sollen
Technologien entstehen, die sowohl den individuellen Anforderungen
von medizinischem Fachpersonal gerecht werden als auch die
Versorgungskontinuität und das Behandlungserlebnis der Patient:innen
verbessern.
Reformplan für die Finanzkontrolle
Schwarzarbeit - Mehr Kontrollen, faire Löhne
Rund zwei
Millionen Beschäftigte in Deutschland erhalten trotz gesetzlichem
Anspruch keinen Mindestlohn. Besonders betroffen sind
Minijobber:innen, Werkvertragsbeschäftigte, Leiharbeiter:innen,
Scheinselbstständige sowie illegal Beschäftigte, zum Beispiel im
Baugewerbe. Viele kennen ihre Rechte nicht oder trauen sich nicht,
sie einzufordern.
Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit deckt
bei Kontrollen in mehr als jedem vierten Betrieb Verstöße auf. Doch
gerade in unübersichtlichen Subunternehmerketten stößt sie an ihre
Grenzen. Das Institut Arbeit und Qualifikation erarbeitet daher
einen umfassenden Reformvorschlag.
Der Bundestag will den
Mindestlohn effektiver durchsetzen – mit mehr Personal bei der
Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) und dem verstärkten Einsatz
digitaler Datenanalyse. Ausgewertet werden sollen unter anderem
Lohn- und Beschäftigtendaten der Rentenversicherung,
Entgeltmeldungen der Bundesagentur für Arbeit sowie Umsatz- und
Steuerdaten der Finanzbehörden.
Doch neue Gesetze und
zusätzliches Personal allein genügen nicht, um Lohnverstöße
aufzudecken. Das sagt Prof. Dr. Gerhard Bosch vom Institut Arbeit
und Qualifikation (IAQ) der Universität Duisburg-Essen (UDE). Er
betont: „Die FKS braucht eine digitale und strategische
Neuausrichtung.“ Sie habe zwar bereits ein eigenes Arbeitsgebiet für
organisierte Kriminalität, erstellt aber meistens nur regionale
Täterprofile. Übergreifende kriminelle Netzwerke können so kaum
erkannt werden.
Bosch und Frederic Hüttenhoff,
wissenschaftlicher Mitarbeiter am IAQ, haben deshalb Empfehlungen
für eine Reform der FKS herausgearbeitet: Bausteine sind dabei eine
bundesweite, datengestützte Risikoanalyse sowie eine verpflichtende,
digitale und manipulationssichere Arbeitszeiterfassung. Außerdem
soll die Zusammenarbeit mit der Zollfahndung ausgebaut und
überregionale Ermittlungen in regionalen Zentren gebündelt werden.
Auch die Ausbildung soll reformiert werden – etwa durch
spezialisierte Ausbildungs- und Studiengänge für die beiden
Ermittlungsdienste, FKS und Zollfahndung. Um betroffene Beschäftigte
besser zu schützen, schlagen die Autoren zudem vor, Kronzeug:innen,
falls sie illegal beschäftigt waren, ein dauerhaftes
Aufenthaltsrecht in Deutschland zu gewähren und Betroffene direkt
über ihre Lohnansprüche zu informieren.
Allein im vergangenen
Jahr deckten die Ermittlungen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und
der illegalen Beschäftigungen einen Schaden von rund 766 Millionen
Euro auf. Die Dunkelziffer ist noch viel größer. „Mit den richtigen
Strukturen kann die FKS ein deutlich wirksameres Instrument zur
Durchsetzung fairer Arbeitsbedingungen werden“, so Hüttenhoff.
Demnach sollen die vorgeschlagenen Maßnahmen Verstöße wirksamer
aufdecken, die organisierte Kriminalität besser bekämpfen und die
betroffenen Beschäftigten stärker unterstützen.
Studie zur Datenweitergabe - Vertrauen verstärkt Offenheit
Mailadresse, Wohnort, aktueller Standort oder Bankverbindung – um
digitale Dienste wie Video-Streaming, Soziale Medien oder
Bezahlsysteme zu nutzen, müssen Menschen oft persönliche Daten
preisgeben. Allerdings sind nicht alle gleichermaßen bereit dazu.
Eine nun veröffentlichte Studie unter Federführung der Universität
Duisburg-Essen* zeigt: Wer persönliche Daten preisgibt, lässt sich
dabei stark durch Empfehlungen von Freunden und Bekannten sowie
durch „grüne“ Versprechen – wie die CO2-Emissionen zu kompensieren –
beeinflussen.
Allzu oft wird der digitale Alltag zur
Datenschutzfrage: Was bin ich bereit, wem preiszugeben? „Weltweit
sind Menschen zunehmend daran gewöhnt, ihre Privatsphäre zumindest
teilweise aufzugeben, um an der digitalen Welt teilzuhaben.
Gleichzeitig sind die Menschen oft besorgt darüber, dass sie von
Webdienstanbietern erkannt werden und ihre Privatsphäre vollständig
verlieren,“ erklärt Prof. Dr. Conrad Ziller die Ausgangslage seiner
nun veröffentlichten Studie.
„Die Bereitschaft, persönliche
Daten weiterzugeben, wird beeinflusst von einer Vielzahl
individueller Motive, Einstellungen und Erfahrungen sowie von der
Art, wie die Daten von diesen Diensten verwendet werden“, erklärt
der Politikwissenschaftler der Universität Duisburg-Essen. Die
aktuelle Studie nimmt dabei zwei bisher wenig beachtete Aspekte in
den Fokus: sozialen Einfluss und die wahrgenommene Nachhaltigkeit
eines Dienstes – etwa in Bezug auf CO₂-Emissionen. Die Daten dazu
stammen von einem groß angelegten deutschen Online-Experiment von
2023.
Die Ergebnisse zeigen, dass soziale Empfehlungen – vor
allem von Freunden und Bekannten – die Bereitschaft zur
Datenfreigabe deutlich erhöhen. Nachhaltigkeitsmerkmale spielen
hingegen nur für diejenigen eine Rolle, die sich ohnehin aktiv für
Umweltschutz interessieren. Sie sind eher bereit, persönliche Daten
weiterzugeben, wenn sich Unternehmen verpflichten, die
CO2-Emissionen zu kompensieren, die bei der Verarbeitung und
Speicherung von Daten entstehen.
Ziller sieht dabei vor allem
die Gefahr, dass Anbieter Umwelt- oder Sozialbotschaften nutzen
könnten, um von problematischen Datenschutzpraktiken abzulenken.
Deshalb müssten Politik und Verbraucherschutz früher ansetzen:
Nachhaltigkeitsversprechen sollten klar von datenschutzrelevanten
Informationen getrennt und Nutzer:innen gezielt über deren Einfluss
auf Entscheidungen aufgeklärt werden. So ließe sich verhindern, dass
sogenannte „Ausstrahlungseffekte“ die Wahrnehmung verzerren.
Ein Beispiel ist eine klimafreundliche Mobilitäts-App, die mit
CO₂-neutralen Fahrten, Ökostrom und Baumpflanzungen wirbt.
Umweltbewusste Nutzer:innen vertrauen solchen Diensten oft stärker –
und übersehen dabei, dass die App umfassend Bewegungsdaten erhebt,
obwohl das für den ökologischen Zweck gar nicht nötig ist. Gerade
deshalb müsse, so Ziller, klarer kommuniziert und reguliert werden,
wo Datenschutz endet und Marketing beginnt.
*Alle Autoren
wurden zu Mitgliedern der Global Young Faculty VII der
Universitätsallianz Ruhr ernannt. Dieses Netzwerk, dessen
Förderzeitraum mittlerweile ausgelaufen ist, hatte das Ziel,
herausragende Nachwuchswissenschaftler:innen der Metropole Ruhr
interdisziplinär zu vernetzen, um dadurch gemeinsam an
Zukunftsthemen zu arbeiten und neue Impulse für ihre Forschung zu
gewinnen.
|
|
26. Juni: Hochschultag an der UDE
|
|
Von A wie Anmeldung bis Z wie
Zukunftsplanung
Duisburg, 13. Juni 2025 -
Geschafft – endlich ist das Abitur in der Tasche! Und wie
geht's jetzt weiter? Kurz vor dem Bewerbungsschluss für
zulassungsbeschränkte Studiengänge lädt die Universität
Duisburg-Essen zum Hochschultag am 26. Juni ein. Auf dem
Programm für Studieninteressierte stehen Infos zu Stipendien,
Bewerbungsverfahren, Studiengängen und vieles mehr.
Wie sieht ein Hörsaal von innen aus? Was lerne ich dort
eigentlich? Und braucht man einen Einser-Schnitt fürs
Stipendium? Auf diese und viele weitere Fragen gibt es vor
Ort die passenden Antworten beim ersten uniweiten
Hochschultag an der Universität Duisburg-Essen am 26. Juni.
Neben diversen Info-Ständen und Vorträgen, werden auch
Campus- und Laborführungen sowie Schnuppervorlesungen
angeboten.
Das Besondere: Zeitgleich findet das
jährliche Sommerfest der Uni am Campus in Duisburg statt –
mit Musik, Foodtrucks und Festivalstimmung.
Das Programm:
•
8-13 Uhr Veranstaltungen der Studiengänge (Infoveranstaltungen,
Laborführungen, Campus-Touren, Schnuppervorlesungen)
•
13 Uhr: Beginn Sommerfest auf dem Campus in Duisburg
•
16-18 Uhr: UDE Stipendientag im Foyer LA und Hörsaal LX in
Duisburg
•
16-19.30 Uhr: Langer Abend der Studienberatung mit Beratung im
Foyer LA und Vorträgen (Bewerbung, Einschreibung, Lehramt)
und Studies erzählen aus ihrem Alltag in Hörsaal
LX
Das gesamte Programm gibt es unter:
www.uni-due.de/abz/studieninteressierte/hochschultag.
Anmeldungen sind teilweise erforderlich. Weitere
Informationen Silke Gramsch, Akademisches Beratungs-Zentrum,
0203/379-2404,
silke.gramsch@uni-due.de
|
|
Duisburger Ehrennadel für Prof. Dr. Dr. Korte und Prof. Dr.
Radtke
|
|
Duisburg, 11. Juni 2025 - Oberbürgermeister
Sören Link verlieh am 10. Juni 2025 im Namen des Rates der
Stadt Duisburg zum zweiten Mal die Ehrennadel der Stadt. Mit
dieser Auszeichnung werden langjährige Verdienste um das
gesellschaftliche Leben und das bürgerschaftliche Miteinander
in Duisburg gewürdigt. In diesem Jahr ging die Ehrung an
Prof. Dr. Dr. Karl-Rudolf Korte und Prof. Dr. Ulrich Radtke.

Verleihung Duisburger Ehrennadel an Prof. Dr. Karl-Rudolf
Korte (r) und Prof. Dr. Ulrich Radtke (l) durch
Oberbürgermeister Sören Link. Bild Ilja Höpping / Stadt
Politikwissenschaftler Korte, ehemaliger Professor an der
Universität Duisburg-Essen (UDE), wurde unter anderem durch
sein außergewöhnliches Engagement an der Hochschule sowie in
vielen weiteren Projekten bekannt. Er war 2006 maßgeblich an
der Gründung der „NRW-School of Governance“ beteiligt und
leistet seither einen bedeutenden Beitrag zur
Demokratiebildung auf lokaler, regionaler und überregionaler
Ebene.
Er hat zahlreiche Projekte initiiert und
Fördermittel mit namhaften Partnern der UDE für die Region
eingeworben. Diese Projekte verbesserten nicht nur die Lehre,
sondern förderten auch den Transfer wissenschaftlicher
Erkenntnisse in die Zivilgesellschaft.
Mit dem
Projekt „Politik geht an die Schulen“, das in Kooperation mit
der Bundeszentrale für politische Bildung entstand, eröffnete
Prof. Dr. Dr. Korte auch schon jungen Menschen einen Zugang
zur politischen Bildung. Zudem etablierte er in
Nordrhein-Westfalen und auf Bundesebene relevante Netzwerke,
durch die die Bedeutung Duisburgs und NRWs für die
Politikwissenschaft enorm gestärkt wurde.
Prof. Dr.
Radtke wechselte 2008 als Rektor an die 2003 gegründete
Universität Duisburg-Essen. Sein Erfolg zeigt sich nicht
zuletzt in seiner langjährigen Amtszeit bis 2022. Die
Wochenzeitung „DIE ZEIT“ würdigte ihn 2015 sogar als
„Hochschulmanager des Jahres“. Unter seiner Leitung erreichte
die UDE internationale Sichtbarkeit durch zahlreiche
Publikationen, Zitationen, Positionen und die Einwerbung
bedeutender Forschungsmittel.
Dank seines Engagements
wurde unter anderem das 2012 eröffnete Forschungsgebäude des
Westdeutschen Tumorzentrums in Essen Teil des Nationalen
Centrums für Tumorerkrankungen – heute eine der führenden
Institutionen der Krebsforschung in Deutschland.
In
Studium und Lehre ist die Universität Duisburg-Essen in
vielen Bereichen Vorreiterin. Sie bietet innovative
Studienprogramme an, die andernorts selten zu finden sind –
stets mit einem besonderen Fokus auf Bildungsgerechtigkeit.
Diese Erfolge sind zahlreichen engagierten
Mitgliedern der Universität zu verdanken, doch ohne Prof.
Radtke als treibende Kraft wären sie in dieser Form nicht
möglich gewesen. Oberbürgermeister Sören Link dankte den
beiden Preisträgern im Namen des Rates der Stadt Duisburg und
im Beisein ihrer Angehörigen und Freunde für ihren
herausragenden und unermüdlichen Einsatz.
|
|
- UDE und UK Essen:Dual studieren: Bachelor of Nursing
- Citizen Science-Projekt „DNA macht Schule“ Was lebt
in meinem Bach?
|
|
UDE und UK Essen:Dual studieren: Bachelor of Nursing
Duisburg, 5. Juni 2025 - Die Gesundheitsversorgung steht vor großen
Aufgaben: Die Bevölkerung wird immer älter, Krankheitsbilder
verändern sich, und neue Technologien prägen immer stärker das
Gesundheitswesen. An Fachkräfte im Gesundheitswesen stellt das hohe
Ansprüche. Die Universität Duisburg-Essen und das Uniklinikum Essen
bieten daher ab dem kommenden Wintersemester gemeinsam den dualen
Studiengang Bachelor of Nursing (B.Sc.) an.
30
zulassungsfreie Studienplätze stehen zur Verfügung, die mit einem
Ausbildungsvertrag am Klinikum gekoppelt und tariflich bezahlt sind.
Bewerbungen sind ab sofort bis zum 15. August 2025 möglich.

Neuer BA-Studiengang Pflegewissenschaften startet am UK
Essen. (Foto: Medizinische Fakultät / André Zelck)
Das
Studium kombiniert Theorie- und Übungsphasen an der
Medizinischen Fakultät der Uni mit einer praktischen
Ausbildung am Universitätsklinikum. Nach acht Semestern
erhalten die Absolvent:innen zwei Abschlüsse: den
akademischen Grad Bachelor of Science und die Anerkennung als
staatlich anerkannte Pflegefachkraft.
Dass
Universität und Uniklinikum gemeinsam ausbilden, macht den
„Bachelor of Nursing“ besonders attraktiv: Theoretisches
Wissen wird im SkillsLab praktisch erprobt und in den
Kliniken der Maximalversorgung vertieft – etwa in der
Onkologie, Herz-Kreislauf-Medizin oder Transplantation. Auch
Auslandsaufenthalte sind im 6. Semester möglich.
„Wir
bieten ein Studium, das zukünftigen Pflegefachpersonen auf
eine evidenz-basierte Pflege und Begleitung von Menschen
aller Altersgruppen vorbereitet. Es gibt von Anfang an
Einsätze in der Praxis, dadurch erleben die Studierenden eine
enge Verzahnung von Wissenschaft praktischer Umsetzung. Dies
ermöglicht es ihnen, in verschiedenen Settings wie der
Akutpflege, der Langzeitpflege oder ambulanten
Versorgungsarrangements zu arbeiten und in
interprofessionellen Teams zu tätig zu sein.“ sagt Prof. Dr.
Erika Sirsch.
„Mit unserem Bachelorstudium
qualifizieren wir unsere Studierenden für eine wichtige Rolle
bei der Gestaltung der Gesundheitsversorgung von morgen. Sie
werden mit ihren Fachkenntnissen und Kompetenzen aktiv
beteiligt sein und die Möglichkeit haben, sich in
Masterprogrammen weiter zu qualifizieren. Unsere
Absolvent:innen sind somit nicht nur qualifizierte
Pflegefachpersonen, sie können innovativ die
Gesundheitsversorgung der Zukunft mitgestalten.“
Wer
sich für den akkreditierten Studiengang bewerben möchte:
Voraussetzung ist die allgemeine oder fachgebundene
Hochschulreife. Aber auch Pflegefachpersonen mit
Berufserfahrung können über einen verkürzten Quereinstieg in
das Programm aufgenommen werden.
https://medizindidaktik.uk-essen.de/angebote-fuer-studierende/pflegewissenschaft
Citizen Science-Projekt „DNA macht
Schule“ Was lebt in meinem Bach?
In NRW
stehen bald Schüler:innen der Grundschule und der Oberstufe
an Bächen ihrer Umgebung. Im Projekt
DNA macht Schule
der Universität Duisburg-Essen nehmen sie Wasserproben und
untersuchen den Zustand der Gewässer. Dabei liefern sie auch
Daten, die behördliche Beobachtungen ergänzen können. Am 2.
Juni war der offizielle Projektstart des vom Umweltbundsamtes
finanzierten Projekts. Lehrkräfte können ihre Klassen oder
Kurse jetzt
anmelden.

Projektlogo. © UDE
Junge Menschen für Natur und
Wissenschaft begeistern und
nützliche Daten
gewinnen. Diesen Ansatz verfolgt das Citizen Science-Projekt
DNA macht Schule. Kinder aus der Grundschule und
Schüler:innen der gymnasialen Oberstufe in NRW untersuchen in
dem Projekt ein schulnahes Fließgewässer. Dort beurteilen sie
die Gewässerstruktur, also beispielsweise, wie der Bach
verläuft und wie seine Umgebung aussieht. Und sie verschaffen
sich einen Überblick über die dort lebenden Tiere, indem sie
u. a. Steine umdrehen und die Arten bestimmen. Aber nicht
alle Lebewesen lassen sich leicht entdecken.
Hier
kommt die innovative Forschungsmethode DNA-Metabarcoding in
Spiel: Sie funktioniert wie ein Barcode-Leser, der auch
kleinste Lebewesen anhand genetischer Spuren im Wasser
identifizieren kann. Forscher:innen der Aquatischen
Ökosystemforschung der Universität Duisburg-Essen (UDE)
analysieren die Gewässerproben der Schüler:innen und
erstellen Listen der nachgewiesenen Arten.
Diese
werden vom Biology Education Research and Learning Lab, kurz
BERLL, für die Auswertung in der Schule aufbereitet und in
ein Unterrichtskonzept eingebunden. Mit den Ergebnissen
können die Schüler:innen Rückschlüsse auf die
Lebensgemeinschaften und den ökologischen Zustand ihres
Gewässers in Schulnähe ziehen. Die so gewonnen Daten sind
auch für die Gewässerforschung sowie Behörden interessant,
denn über den ökologischen Zustand vieler kleiner
Fließgewässer in NRW gibt es nur wenige Informationen.
Entsprechend des Citizen Science-Ansatzes, auch
Bürgerwissenschaften genannt, arbeiten Bürger:innen, hier
Schüler:innen und Lehrkräfte, und Wissenschaftler:innen Hand
in Hand. Junge Menschen können ihr Bewusstsein und Interesse
für den Schutz dieser fließenden Ökosysteme weiterentwickeln
sowie moderne Forschungsmethoden kennenlernen. Gleichzeitig
entstehen relevante Daten für Wissenschaft und Behörden. Das
Projekt wird durch das Umweltbundesamt finanziert.
Das Kick-off-Treffen fand am 2. Juni im Bundesministerium für
Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit
(BMUKN) in Berlin statt. Hier präsentierten und diskutierten
die Projektbeteiligten aus Wissenschaft, Schule,
Umweltbundesamt und Bundesministerium die Projektpläne und
-ziele. Weitere Informationen und Anmeldung:
www.dna-macht-schule.de
|
|
Friedensgutachten 2025 vorgestellt. Frieden retten! |
|
Berlin/Duisburg, 2. Juni 2025 - Der Frieden ist auf dem Rückzug:
Russlands Krieg in der Ukraine destabilisiert Europa, der Krieg in
Gaza stürzt den Nahen Osten in Leid und Gewalt, und im Sudan hat der
Konflikt die größte humanitäre Katastrophe der Welt ausgelöst. Das
Friedensgutachten 2025 zeigt, warum Europa selbst für seine
Sicherheit und Verteidigung sorgen und zugleich am Ziel des Friedens
festhalten muss.
Die vier führenden deutschen Friedensforschungsinstitute,
darunter das Institut für Entwicklung und Frieden (INEF) der
Universität Duisburg-Essen (UDE), haben das Gutachten heute
(2.6.) in Berlin vorgestellt.

Am 2. Juni wurde das Friedensgutachten 2025 auf der
Bundespressekonferenz Berlin vorgestellt. © UDE/INEF
Die Weltpolitik wird von heftigen Turbulenzen erschüttert.
Nach der Wahl Donald Trumps fallen die USA als globaler
Stabilitätsanker aus. Der US-Präsident attackiert die
demokratischen Institutionen seines Landes und verfolgt eine
aggressive Außenpolitik, die auf Egoismus und kurzfristige
Vorteile setzt. Die führenden deutschen
Friedensforschungsinstitute sprechen sich angesichts dieses
politischen Umbruchs dafür aus, die europäische
Verteidigungsfähigkeit zu stärken.
Um unabhängiger
von den USA zu werden und sich gegenüber Russland zu
behaupten, gelte es für die europäischen Staaten,
Rüstungskooperationen zu intensivieren und
Verteidigungsstrategien zu aktualisieren. Zugleich dürfe die
Vorbereitung einer künftigen europäischen Friedensordnung
nicht vernachlässigt werden, so die Forscher:innen. Rüstung
müsse daher von Rüstungskontrolle und diplomatischen
Initiativen begleitet werden.
Die hohe Zahl an
Gewaltkonflikten weltweit geht mit der Missachtung zentraler
Normen des Völkerrechts einher. Das vom INEF koordinierte
Kapitel „Nachhaltiger Frieden“ thematisiert, wie humanitäre
und menschenrechtliche Mindeststandards in den Kriegen in der
Ukraine und in Gaza verletzt werden. Zivilist:innen werden
nicht ausreichend geschützt, Hilfslieferungen unterbunden,
und zivile Infrastruktur wird gezielt zerstört.
Die
Friedensforscher:innen stellen zudem fest, dass humanitäre
Hilfsleistungen von hochgradig repressiven Regimen in Staaten
wie Afghanistan zweckentfremdet werden. Dieser Umstand dürfe
aber nicht zur Folge haben, dass humanitäre Hilfe für die
betroffenen Gesellschaften eingestellt werde.
Das
Kapitel „Nachhaltiger Frieden“ betont auch, dass die
internationale Gerichtsbarkeit einen wichtigen Beitrag zum
Erhalt der regelbasierten Weltordnung leistet. Die
Friedensforscher:innen fordern die Bundesregierung dazu auf,
weiterhin die Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs
und des Internationalen Strafgerichtshofs zu respektieren.
„Die Bundesregierung würde Deutschlands
Glaubwürdigkeit untergraben, sollte sie Gerichtsbeschlüsse
wie den 2024 erlassenen Haftbefehl gegen den israelischen
Premierminister infrage stellen“, so Prof. Dr. Tobias Debiel,
stellvertretender Direktor des INEF.
|
|
UDE richtet Leichtathletik-Event im Sportpark
Duisburg aus |
|
Hochklassige Wettkämpfe erwartet
Duisburg, 26. Mai 2025 - Teilnahmerekord bei der
Deutschen Hochschulmeisterschaft (DHM) Leichtathletik: Knapp
600 Athlet:innen von 87 Hochschulen sind für das Event im
Sportpark Duisburg in Neudorf-Süd am Himmelfahrtstag, 29.
Mai, gemeldet, darunter viele Spitzensportler:innen. Sie
hoffen, mit einem guten Ergebnis wertvolle Punkte für das
internationale Ranking zu sammeln oder noch die Norm für die
World University Games im Sommer zu erfüllen.
Auch die
Universität Duisburg-Essen (UDE) schickt 11 Studierende an
den Start – und hat an diesem Tag alle Hände voll zu tun:
Denn sie richtet die DHM aus, in enger Zusammenarbeit mit
Eintracht Duisburg und dem Leichtathletik-Verband Nordrhein.
Um 10.45 Uhr eröffnet UDE-Kanzler Ulf Richter die
Wettbewerbe, um 11 Uhr fällt der erste Startschuss
(Leichtathletikstadion, Margaretenstraße 20 in 47055
Duisburg).
Erwartungsgemäß sind vor allem die
Sprintdisziplinen stark besetzt. Allein in den Läufen über
100 Meter werden nicht weniger als 56 Männer und 53 Frauen
antreten. Über 200 Meter sind es 52 bzw. 39 Aktive. Spannende
Wettkämpfe sind auch auf den Mittel- und Langstrecken zu
erwarten, außerdem im Weit-, Drei-, Hochsprung und
Stabhochsprung sowie im Diskus-, Speerwurf und Kugelstoßen.
Während für die einen das Dabeisein zählt, geht es für
die anderen um Medaillen, um internationale Rankingpunkte –
die DHM ist ein „World Athletics-Meeting“ -, oder darum, die
Norm für die bevorstehenden Rhine-Ruhr 2025 FISU World
University Games zu knacken. Etliche Leichtathlet:innen, die
an den Start gehen, sind in den nationalen Bestenlisten
vertreten und bringen internationale Erfahrung mit von Welt-
und Europameisterschaften der U 20 bzw. U23 oder gar den
Olympischen Spielen in Paris.
Apropos Spiele: Die
Vorfreude auf die World University Games wird auch am 29. Mai
im Sportpark Wedau befeuert: Mit einem Fackellauf (12 Uhr)
durch das Stadion werden Publikum, Athlet:innen und
zahlreiche Ehrengästen auf die bevorstehenden Weltspiele der
Studierenden eingestimmt. Zur Erinnerung: Diese finden vom
16. bis 27. Juli an Rhein und Ruhr statt – und die UDE ist
Teil des Spektakels.
Diesen UDE-Leichtathlet:innen
drücken wir bei der DHM die Daumen:
Julien Clair
(200m), der auch auf der Nominierungsliste für die World
University Games steht,
Martin Gerth (100m + 200m),
Anna-Lena Berninger (100m + 200m),
Lorena Lindermann
(100m),
Neele Janssen (800m),
Mara Antonia Groß (Diskus
+ Kugelstoßen),
Julika Peters (Dreisprung),
Alyssa
Tagbo (Dreisprung),
Mila Zarges (Hochsprung),
Jana
Katharina Krämer (Diskus),
Franziska Folz (Diskus).
Programm:
10:45 Uhr : Eröffnung durch den Kanzler der
Uni Duisburg-Essen, Ulf Richter
11 Uhr: Beginn der
Wettkämpfe
Zeitplan:
https://ergebnisse.leichtathletik.de/Competitions/Details/16106
11:45 Uhr: Empfang von Ehrengästen aus Hochschule, Sport und
Politik
12 Uhr: Fackellauf durch das Stadion mit dem
offiziellen Feuer der FISU Games
|
|
Schwimmendes
Labor - Forschungsschiff NOVA getauft
|
|
Duisburg, 23. Mai
2025 - Mit glänzenden Solarzellen auf dem Dach und einem
nahezu verwaistem Steuerstand ist die NOVA alles andere als
ein gewöhnliches Schiff. Der Katamaran ist eine schwimmende
Forschungsplattform. An Bord erarbeiten Wissenschaftler:innen
der Universität Duisburg-Essen und des JRF-Instituts
Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme
(DST) zukunftsfähige Konzepte: Wie können alternative
Antriebe die Umwelt entlasten? Und wie lässt sich die
Schifffahrt sicher autonom betreiben? NOVA wurde heute
feierlich durch NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer in
Ruhrort getauft.

Die NOVA bei einer Testfahrt in Duisburg / Copyright Ilja
Höpping, Stadt Duisburg
„Wir wollen das automatisierte
Fahren von Schiffen unter realen Bedingungen untersuchen –
dort, wo es eng, unübersichtlich und voll sein kann“, erklärt
Prof. Dr. Bettar el Moctar vom Institut für Nachhaltige und
Autonome Maritime Systeme (INAM) der Universität
Duisburg-Essen. Im Gegensatz zu Teststrecken ist die
Verkehrsdichte in Häfen und insbesondere auf dem Rhein hoch.
„Stoppmanöver einleiten, Kurs ändern oder Kurs
halten? Entscheidungen wie diese muss die NOVA künftig selbst
treffen – auch bei Nebel, Dunkelheit oder hoher
Verkehrsdichte.“ Dafür wird der 15 Meter lange Katamaran mit
sämtlicher Technik ausgerüstet, die für eine vollständig
automatisierte Fahrt nötig ist – einschließlich komplexer
Manöver wie Schleusenfahrten.
Angetrieben wird NOVA
dabei rein elektrisch. Die Energie liefern Akkus und eine
Solaranlage auf dem Dach. „Wir analysieren, wie sich
unterschiedliche Fahrweisen auf den Energieverbrauch
auswirken – und wie sich durch Automatisierung Kraftstoff und
Emissionen einsparen lassen“, so Dr. Jens Neugebauer,
Oberingenieur am INAM.
NRW-Umweltminister Oliver
Krischer betont: „Mit dem innovativen Forschungsschiff NOVA
können zukunftsweisende Technologien praxisnah entwickelt und
erprobt werden. Wir bauen damit Nordrhein-Westfalens Position
als führender Forschungsstandort für eine nachhaltige
Binnenschifffahrt aus. Das trägt zum Klimaschutz bei und
stärkt die wirtschaftliche Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit
der Binnenschifffahrt als moderner Verkehrsträger."
„Dass das Forschungsschiff NOVA hier in Duisburg zum Einsatz
kommt, ist kein Zufall. Mit dem größten Binnenhafen der Welt
bieten wir für die Zukunft der Binnenschifffahrt ein
einzigartiges Erprobungsfeld“, sagt Sören Link,
Oberbürgermeister der Stadt Duisburg. „Damit setzen wir nicht
nur Impulse für Wissenschaft und Wirtschaft, wir zeigen auch,
dass wir hier in Duisburg Wandel klug und nachhaltig
gestalten.“
Auch die Rektorin der Universität
Duisburg-Essen, Prof. Dr. Barbara Albert, lobt das Projekt:
„Die NOVA steht exemplarisch für die Innovationskraft unserer
Universität – hier verbinden sich Spitzenforschung,
Nachhaltigkeit und technologischer Fortschritt auf
beeindruckende Weise.“
Der wissenschaftliche Vorstand
der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft (JRF) und Präsident
des Wuppertal Instituts Prof. Dr. Manfred Fischedick macht
deutlich: „Die Entwicklung und der Betrieb des innovativen
Forschungsschiffs NOVA sind ein Paradebeispiel für die
Philosophie der JRF. Sie hat sich mit ihren 15
Mitgliedsinstitutionen Forschung ‚Made in NRW‘ für
Gesellschaft, Wirtschaft und Politik auf die Fahnen
geschrieben und steht für transferorientierte Forschung und
den Brückenschlag zwischen universitärer Forschung und der
Praxis.“
Das Projekt wird durch das Ministerium für
Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes
Nordrhein-Westfalen mit 1,17 Millionen Euro gefördert. Es
arbeiten hier das Institut für Nachhaltige und Autonome
Maritime Systeme, der Lehrstuhl für Mechatronik und das DST
zusammen. Das DST ist ein An-Institut der Universität
Duisburg-Essen und Mitglied der
Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft (JRF).
|
|
Forschungsschiff Nova wird in Ruhrort getauft
|
|
Duisburg, 21. Mai 2025 - Mit
glänzenden Solarzellen auf dem Dach und einem nahezu
verwaisten Steuerstand ist die „Nova“ alles andere als
ein gewöhnliches Schiff. Die „NOVA“ ist ein 15 Meter
langer Katamaran, optimiert für den Einsatz auf
Binnengewässern und im küstennahmen Bereich – auch bei
extremen Niedrigwasserständen.
An Bord erarbeiten
Wissenschaftler:innen der Universität Duisburg-Essen und
des Entwicklungszentrums für Schiffstechnik und
Transportsysteme (DST) zukunftsfähige Konzepte: Wie
können alternative Antriebe die Umwelt entlasten? Und wie
lässt sich die Schifffahrt sicher autonom betreiben?
Die Schiffstaufe wird im Duisburger Hafen durch Oliver
Krischer, Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen, vorgenommen. Die „NOVA“
ist ein 15 Meter langer Katamaran, optimiert für den
Einsatz auf Binnengewässern und im küstennahmen Bereich –
auch bei extremen Niedrigwasserständen.
Sie dient als Plattform für Forschung zum automatisierten
Fahren und zur Erprobung emissionsfreier Antriebe. Voll
ausgestattet mit Sensorik, ferngesteuert oder zukünftig
autonom unterwegs, eröffnet die „NOVA“ neue Wege
nachhaltiger Schifffahrt. Das Projekt wird durch das
Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des
Landes Nordrhein-Westfalen mit 1,17 Millionen Euro
gefördert.

Forschungsschiff Nova/ Copyright Rupert Henn, DST
Mitten im
geschäftigen Trubel des Duisburger Hafens und auf dem vielbefahrenen
Rhein soll die Zukunft der Binnenschifffahrt erprobt werden – dort,
wo die Realität eng, unübersichtlich und voller Herausforderungen
ist. Kein steriles Testgelände, sondern ein echtes Verkehrschaos mit
Frachtschiffen, Sport- und Ruderbooten bildet die Bühne für den 15
Meter langen Katamaran „Nova“.
Er soll künftig selbstständig
durch dieses Gewusel navigieren – und das auch bei schlechten
Sichtverhältnissen, dichtem Gegenverkehr oder komplexen Manövern wie
dem Durchqueren von Schleusen. Ausgestattet mit modernster Technik
für automatisierte Fahrten, muss das Schiff in Echtzeit
Entscheidungen treffen: bremsen, ausweichen oder Kurs halten?
Die „Nova“ wird dabei rein elektrisch betrieben – gespeist von
Akkus und einer Solaranlage auf dem Dach. Parallel zur Navigation
wird auch der Energieverbrauch genau unter die Lupe genommen. Ziel
ist es, herauszufinden, wie sich automatisiertes Fahren auf
Effizienz und Emissionen auswirkt – und wie sich der Verkehrssektor
auf dem Wasser nachhaltiger gestalten lässt.
|
|
Pint of
Science in Duisburg und Essen - Daten, Drinks und Dialoge
|
|
Duisburg, 15. Mai 25
- Physik, Biotechnologie, Bildung oder künstliche Intelligenz
– alles Themen für die Kneipe? Unbedingt, beim Festival Pint
of Science vom 19. bis 21. Mai. Zahlreiche Forschende der
Universität Duisburg-Essen sprechen bei Bier, Saftschorle und
Erdnüssen über ihre Arbeit. Verständlich, frei von
Fachchinesisch, offen für alle.

© UDE/Peter Kohl
Das Pint of Science ist eine
internationale Veranstaltungsreihe, die Wissenschaft dorthin
bringt, wo Menschen reden, lachen und trinken: in die Kneipe.
Vom 19. bis 21. Mai ist das Format wieder in Deutschland
zu Gast – darunter auch in Duisburg und Essen. Renommierte
Forschende aus unterschiedlichen Disziplinen sprechen dort
über ihre Projekte. Viele von ihnen arbeiten an der
Universität Duisburg-Essen (UDE). Sie erklären, was sie
bewegt, woran sie forschen – und das ganz ohne Fachvokabular.
Wer zuhören will, braucht keinerlei Vorkenntnisse, nur
Neugier.
Eine Chance gibt es noch in Essen für 2,50
Euro pro Ticket: Am 20. Mai öffnet das Don’t Panic am
Viehofer Platz 2 um 19 Uhr seine Türen, um 19.30 Uhr geht es
los. Zwei UDE-Forschende geben Einblicke in ihre Arbeit ganz
ohne akademische Hürden. Dr. Michael Kloster spricht über
winzige Wesen in gläserner Rüstung: Kieselalgen. Prof.
Anzhela Galstyan erklärt, wie Licht gegen Bakterien hilft und
Wasser ohne Chemie desinfiziert werden kann. Und schließlich
nimmt der ehemalige UDE-Mitarbeiter Dr. Sebastian Markert das
Publikum mit auf eine Reise ins Gehirn – genauer: zu dem
Moment, wenn wir die Augen schließen.
Auch in Duisburg
lädt der Finkenkrug zweimal zum Pint of Science - beide
Veranstaltungen sind bereits ausverkauft. Am 19. Mai geht es
um künstliches Sehen, Sternengeburten und künstliche
Intelligenz. Dabei stehen Prof. Rolf Kuiper, Domenic Pascual
und Katja Buntins von der UDE im Rampenlicht. Zwei Tage
später dreht sich alles um Nanotechnologie, Roboteranzüge und
physikalische Miniaturphänomene – auch hier mit starker
Beteiligung der UDE: Prof. Elsa Kirchner und Dr. Lars Breuer
sind mit ihren Themen „Exoskelette“ und „ultraschnelle
Prozesse“ vertreten.
Abende voller Ideen, Gespräche
und Aha-Momente – mit Getränk, ohne Vorlesungsatmosphäre. Wer
sich für Wissenschaft interessiert und unterhalten werden
möchte, ist hier genau richtig.
|
|
17. Wissenschaftsforum Mobilität: Mobilitätskonflikte
gemeinsam lösen |
|
Duisaburg, 15. Mai 2025 - Wie lassen sich
wirtschaftliche, ökologische und soziale Ziele auf dem Weg zu
nachhaltiger Mobilität in Einklang bringen? Diese zentrale
Frage stand im Fokus des 17. Wissenschaftsforums Mobilität,
das am 15. Mai 2025 rund 400 Expert:innen aus Wissenschaft,
Wirtschaft und Politik im Duisburger CityPalais
zusammenbrachte.

Die jährlich stattfindende Konferenz wurde erneut vom
Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre &
Internationales Automobilmanagement der Universität
Duisburg-Essen organisiert. Eröffnet wurde das Forum von
UDE-Rektorin Prof. Dr. Barbara Albert, Veranstalterin Prof.
Dr. Heike Proff sowie Prof. Dr. Kienle, die kurzfristig für
Ministerin Ina Brandes einsprang und die Grußworte aus dem
nordrhein-westfälischen Ministerium für Kultur und
Wissenschaft übermittelte.
Unter dem diesjährigen
Leitthema „Solving Conflicts on the Way to Sustainable
Mobility“ diskutierten die Teilnehmer:innen, wie
umweltfreundliche technologische Entwicklungen, soziale
Akzeptanz und wirtschaftliche Tragfähigkeit zusammengebracht
werden können. Im Fokus stand dabei neben der
Elektromobilität, wie Mobilität in Städten verbessert werden
kann und ÖPNV auf dem Land geschaffen werden kann.
Das vielfältige Programm umfasste über 60 Fachvorträge in
fünf parallelen Tracks – unter anderem zu Mobility-Management
und -Engineering, urbaner Mobilität, IT, Dienstleistungen und
Rahmenbedingungen. Zwei prominent besetzte
Podiumsdiskussionen, eine Poster-Session im „Knowledge Café“
sowie eine begleitende Ausstellung innovativer Projekte
rundeten das Forum ab. Zukunftsforscher Lars Thomsen
eröffnete die Konferenz mit einer inspirierenden Keynote und
setzte dabei den inhaltlichen Rahmen für den Tag.
„Wenn wir glauben, dass der Status quo der Mobilität das
Beste ist, was wir tun können, dann fehlt uns der Blick in
die Zukunft.“ Prof. Dr. Barbara Albert unterstrich die Rolle
der Universität: „Die Universität Duisburg-Essen steht für
exzellente Wissenschaft, die Innovationen für Wirtschaft und
Gesellschaft generiert.
Das Wissenschaftsforum
Mobilität zeigt eindrucksvoll, wie wir mit interdisziplinären
Perspektiven Antworten auf zentrale Zukunftsfragen geben.“
Auch Veranstalterin Prof. Dr. Heike Proff betonte die
Notwendigkeit neuer Denkansätze: „wir müssen mutig weiter,
größer und innovativer denken, weil sich nur dann neue
Handlungsräume eröffnen – wer zu eng denkt, kommt aus den
Zielkonflikten in der Transformation der Mobilität nicht
heraus“.

Nachwuchs im Fokus
Erstmals öffnete das
Wissenschaftsforum auch gezielt seine Türen für den
Nachwuchs: 60 Schüler:innen der 11. Jahrgangsstufe der
Theodor-König-Gesamtschule Duisburg nutzten die Gelegenheit,
sich über Studienmöglichkeiten und technologische
Innovationen zu informieren und mit Unternehmen vor Ort ins
Gespräch zu kommen. Mit seinem interdisziplinären Ansatz und
praxisnahen Impulsen leistete das Forum erneut einen
wichtigen Beitrag zur Mobilitäts- und Verkehrswende – und
zeigte, wie gemeinsame Lösungen für eine nachhaltige Zukunft
möglich werden.
|
|
Recht auf mehr (Lebens)Zeit? |
|
Was lebensphasenbezogene Zeitrechte
für Betriebe bedeuten
Duisburg, 15. Mai
2025 - Sich Auszeiten zu nehmen, um sich um Kinder zu kümmern
oder weniger zu arbeiten, ist unter deutschen
Arbeitnehmer:innen verbreitet. Wie sich das auf die Betriebe
auswirkt, ist bisher weitgehend unerforscht.
Ein
Projekt des Instituts Arbeit und Qualifikation der
Universität Duisburg-Essen legt daher einen Fokus auf die
Fragen, wie stark Betriebe aktuell von der Nutzung von
Zeitrechten betroffen sind und welche Maßnahmen ergriffen
werden, um den damit verbundenen Arbeits(zeit)ausfall zu
kompensieren.
Für das Projekt „Mehr Rechte für die
einen, mehr Druck für die anderen? Lebensphasenbezogene
Zeitoptionen und ihre Auswirkungen auf die betriebsinterne
Arbeitsorganisation (ZOBAO)“ haben Prof. Dr. Ute Klammer, Dr.
Angelika Kümmerling und Timothy Rinke zwischen September 2023
und Februar 2024 mittels Fragebögen und computergestützten
Telefon-Interviews eine repräsentative Studie mit 1.015
Betrieben ab 50 Beschäftigten durchgeführt.
Die
wichtigsten Ergebnisse im Überlick: Die Elternzeit ist mit 36
% das von den Beschäftigten am häufigsten genutzte Zeitrecht.
Auch tarifliche Wahloptionen in Form von mehr Geld, mehr
Urlaub oder Arbeitszeitverkürzung sind weit verbreitet (20
%); während Pflegezeiten (1,7 %) oder das
Pflegeunterstützungsgeld (0,8 %) kaum in Anspruch genommen
werden. Darüber hinaus berichten mehr als 40 % der Betriebe,
dass sie Anfragen nach temporärer Arbeitszeitreduzierung auch
mittels informeller Absprachen regeln.
Insgesamt
zeigt sich, dass die Vielfalt der zur Verfügung stehenden
Zeitrechte mit ihren unterschiedlichen Ankündigungsfristen
und Bestimmungen für die Betriebe eine Herausforderung
darstellen. Interne Vertretungen (57 %) und Mehrarbeit (50
%), aber auch flexible Arbeitszeitmodelle (38 %) sind für den
Großteil der Betriebe die meist gewählten und als besonders
effektiv bewerteten Kompensationsmaßnahmen.
Eine
entscheidende Rolle bei der Wahl der Maßnahmen spielen laut
den Arbeitsforscher:innen Faktoren wie Betriebsgröße,
Branche, Tarifbindung, Mitbestimmung, Altersstruktur der
Belegschaft sowie der Frauenanteil: „Unsere Analysen zeigen,
dass in tarifgebundenen Betrieben Arbeitszeitausfall aufgrund
der Inanspruchnahme von Zeitrechten signifikant weniger
häufig durch die Steigerung der Arbeitsintensität von
Beschäftigten kompensiert wird“, so Kümmerling.
Nach
Einschätzung der befragten Personalverantwortlichen sind
darüberhinaus insbesondere die Personalressourcen im
betroffenen Arbeitsbereich wichtig für die Wahl der
Maßnahmen. „Vieles spricht dafür, dass eine erfolgreiche
Kompensationsstrategie nur mit ausreichend Personalressourcen
gelingen kann. Nur so sind interne Vertretungen möglich, ohne
die Beschäftigten insgesamt zusätzlich zu belasten“,
erläutert Rinke.
Die Gewährung und der weitere Ausbau
von Zeitrechten kann nach Meinung der Wissenschaftler:innen
einen Weg darstellen, Zeitkonflikte für die in Sorgearbeit
involvierten Mitarbeiter:innengruppen zu reduzieren. Viel
spricht aber dafür, dass dies nicht ausreichen wird, um den
im Zuge des demografischen Wandels wachsenden
Zeitanforderungen langfristig zu begegnen.
Es brauche
daher, wie Kümmerling ausführt, innovative Konzepte, z.B.
eine intelligente Verzahnung von dynamisch-situativen und
lebensphasenbezogenen Instrumenten der
Arbeitszeitflexibilität, die sowohl von Männern als auch von
Frauen in Anspruch genommen werden können und werden.
Der aktuelle IAQ-Report
|
|
Große Ehre für Prof. Dr. Norbert Scherbaum n die NRW-Akademie
der Wissenschaften und Künste aufgenommen
|
|
Duisburg, 14. Mai 2025 - Der Mediziner wird
gemeinsam mit elf weiteren hochkarätigen
Wissenschaftler:innen und Künstler:innen in die
Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der
Künste aufgenommen. Der Professor für Psychiatrie und
Psychotherapie an der Medizinischen Fakultät der UDE wird
heute (14. Mai) im Beisein der Wissenschaftsministerin Ina
Brandes zum ordentlichen Mitglied ernannt.

Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der
Künste | Bettina Engel-Albustin
Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der
Künste | Bettina Engel-Albustin Scherbaums Spezialgebiet ist
die Suchtmedizin. So hat er den Ansatz der
Substitutionstherapie entscheidend vorangetrieben. Eingesetzt
wird sie bei heroinabhängigen Menschen, die mit einem
ärztlich verschriebenen langwirksamen Opioid wie Methadon
behandelt werden. Das Medikament mindert das Verlangen nach
Heroin und unterdrückt Entzugssymptome.
Die
Substitutionstherapie gilt weltweit als die erfolgreichste
Behandlungsform der Heroinabhängigkeit. In seiner Forschung
verbindet Scherbaum klinische Fragestellungen, zum Beispiel
zur Prüfung von neuen Therapieansätzen, mit Untersuchungen
zum besseren Verständnis von Suchterkrankungen. Er ist
Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie sowie
der Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin an der
LVR Universitätsklinik Essen.
Zudem engagiert er sich
in verschiedenen Gremien wie dem Ausschuss Sucht und Drogen
der Bundesärztekammer, dem Sachverständigenausschuss des
Bundesministeriums für Gesundheit zur Bewertung von
Suchtmitteln sowie der Beratungskommission der Ärztekammer
Nordrhein zur substitutionsgestützten Behandlung
Opiatabhängiger.
Die Nordrhein-Westfälische Akademie
der Wissenschaften und Künste wurde 1970 gegründet.
Aufgenommen werden ausschließlich exzellente Forschende und
Kunstschaffende. Derzeit hat die Akademie rund 280
ordentliche und knapp 130 korrespondierende Mitglieder.
|
|
Neu an der
Uni: Elena Beregow
Was macht Hitze mit uns – und mit der
Gesellschaft?
|
|
Duisburg, 28. April
2025 - Die Soziologin Elena Beregow geht dieser Frage auf den
Grund. Seit April 2025 forscht die Juniorprofessorin an der
Universität Duisburg-Essen und am College for Social Sciences
and Humanities der Universitätsallianz Ruhr. Dort baut sie
eine Forschungsgruppe zur „Soziologie des Schwitzens“ auf.

Neu an der Uni: Elena Beregow (Bild: UDE/Fabian Strauch)
Wer schwitzt wann, wo – und warum? Diese Fragen hängen
nicht nur mit der Temperatur zusammen, sondern auch mit
gesellschaftlichen Strukturen. „Aus soziologischer
Perspektive verstärkt Hitze Ungleichheiten: etwa durch
ungleichen Zugang zu Kühlung und unterschiedliche
Verwundbarkeiten. So trifft Hitze bestimmte Gruppen besonders
stark“, erklärt Elena Beregow, die ihr Forschungsthema
insbesondere im Kontext der Klimakrise verortet.
Ihr
Forschungsinteresse reicht weit über die klassische
Soziologie hinaus. Sie verbindet kulturhistorische und
sinnessoziologische Perspektiven, blickt auf Deutungsmuster,
die das Schwitzen begleiten: Im Fitnessstudio oder in der
Sauna gilt es als gesund, in der Popkultur steht es für
Rebellion, im Alltag oft für Kontrollverlust. Beregow fragt,
wie sich das moderne Ideal von Kühle, Kontrolle und Distanz
verändert – in einer Welt, in der Hitzewellen zunehmen.
Mit ihrer Forschung sucht sie bewusst den
interdisziplinären Austausch. Am College der
Universitätsallianz Ruhr findet sie dafür ideale Bedingungen.
„Hier bekommt man ganz andere Perspektiven auf das
Forschungsthema als aus dem eigenen Fach – was idealerweise
auch umgekehrt gilt. Am College reizt mich besonders das
Prinzip der Themenoffenheit und die Struktur aus ‚festen‘
Professuren und wechselnden internationalen Fellows.“
Auch international will Elena Beregow Kooperationen
ausbauen, beispielsweise zum Heat Lab an der University of
California in Los Angeles (UCLA). Dabei ist ihr wichtig,
Perspektiven aus dem Globalen Süden einzubeziehen.
Vor
ihrer Berufung ans College forschte und lehrte Elena Beregow
an der Universität der Bundeswehr in München (2020-2025) und
der Universität Hamburg (2015-2020). Mit thermischen Figuren
in der Sozialtheorie befasste sie sich bereits in ihrer
Dissertation, für die sie 2022 den Dissertationspreis der
Sektion soziologische Theorie der Deutschen Gesellschaft für
Soziologie (DGS) erhielt.
Sie ist Mitherausgeberin
der Zeitschrift Pop. Kultur und Kritik. Zwischen 2022 und
2025 wirkte sie als assoziierte Wissenschaftlerin im
ERC-Projekt „Cryosocieties“ an der Goethe-Universität
Frankfurt sowie in mehreren DFG-Netzwerken mit. Elena Beregow
studierte Soziologie in Hamburg, Göttingen und Kopenhagen.
|
|
Campus-Tour am
23. April: Osterferien mit Zukunftsvision
|
|
Duisburg, 17. April
2025 - Was mit Menschen machen oder doch lieber was mit
Technik? Warum nicht beides in einem studieren?
Schüler:innen, die sich dafür interessieren, sind am 23.
April an der Universität Duisburg-Essen genau richtig.
Denn bei einer Campus-Tour in Duisburg können sie sich
über den Bachelor-Studiengang „Menschzentrierte Informatik
und Psychologie“ informieren und einen Blick in die Labore
werfen. Der Studiengang ist deutschlandweit einzigartig und
kombiniert Informatik, Psychologie und
Betriebswirtschaftslehre.

© UDE/Interaktive Systeme
Die angehenden
Abiturient:innen können einen Vormittag ins Studierendenleben
eintauchen und die Forschung im Bereich
Mensch-Technik-Interaktion kennenlernen: Neben einer kurzen
Einführung gibt es eine Campus-Tour mit Studierenden des
Studiengangs, anschließend können in den Laboren ausgiebig
Augmented Reality (AR)-Brillen ausprobiert werden. Auch mit
Robotern lässt sich Kontakt aufnehmen.
Abgerundet wird
der Besuch durch eine Vorlesung zum Thema Digitale Medien. So
bekommen Schüler:innen einen praxisnahen Einblick in den
Studiengang und können alle ihre Fragen direkt mit
Studierenden und Lehrenden klären.
Weitere
Informationen und Anmeldung unter:
https://www.uni-due.de/abz/studieninteressierte/campus_tour.php
|
|
Universität Duisburg-Essen entwickelt sich weiter
|
|
Weichenstellung innerhalb der „Neuen Masterplanung
Hochschulbau“
Duisburg, 16. April 2025 - Im
Zuge der Neuen Masterplanung Hochschulbau verfolgt die
Universität Duisburg-Essen das Ziel, die bestehenden
Standorte der Universität in Duisburg und in Essen deutlich
auszubauen und zu stärken.

Der Campus Duisburg aus der Luft/ Copyright: UDE
Das
Land Nordrhein-Westfalen hatte im April 2024 die Neue
Masterplanung Hochschulbau als zukünftigen Weg vorgestellt,
um Bauprojekte mit mehr Tempo günstiger und passgenauer
umzusetzen. Die Universität Duisburg-Essen wurde als eine von
drei Hochschulen für den Auftakt dieses neuen Verfahrens
ausgewählt.
In Abstimmung mit dem Ministerium für
Kultur und Wissenschaft, dem Ministerium der Finanzen und dem
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) hat die
Universität nun entschieden, welche Bauprojekte an der
Universität Duisburg-Essen in den nächsten Jahren im Rahmen
der Neuen Masterplanung umgesetzt werden sollen, um die
bestehenden Hauptstandorte in Duisburg und in Essen zu
stärken und die Flächen bestmöglich effizient zu nutzen.
Stärkung des Campus Duisburg
Der Campus an der
Lotharstraße ist seit jeher ein zentraler Ort für Studium,
Forschung und akademischen Austausch in Duisburg. Die
Fakultät der Ingenieurwissenschaften der Universität
Duisburg-Essen ist eine der größten und modernsten ihrer Art
in Deutschland mit über 7.500 Studierenden. Über 30
Professuren und mehr als 4.000 Studierende gibt es darüber
hinaus in der 2024 neu gegründeten Fakultät für Informatik.
Der Campus an der Lotharstraße in Duisburg soll jetzt
ausgebaut werden, so dass insbesondere diese wichtigen
Zukunftsdisziplinen kurzfristig und in großer räumlicher Nähe
zueinander optimale, zeitgemäße und entwicklungsfähige
Bedingungen erhalten. Die geplanten Neubauten bieten Raum für
innovative Forschung und moderne Lehre und stärken zugleich
die interdisziplinäre Vernetzung innerhalb der Universität.
Gerade die räumliche Nähe fachlich verwandter Disziplinen
ist ein zentrales Element der Entscheidung für den Campus an
der Lotharstraße: Sie ermöglicht eine engere Verzahnung,
kürzere Wege und intensivere Forschungskooperation,
insbesondere im Bereich der Digitalisierung und in der
nachhaltigen Technikentwicklung.
Stärkung des Campus
Essen
Für die künftige Entwicklung und Stärkung des
Standorts Essen hat der Neubau der Universitätsbibliothek am
Campus Essen wesentliche Bedeutung. Zeitgemäße
Universitätsbibliotheken sind mehr denn je Lern- und
Begegnungsorte einer Präsenzuniversität, die für ihre
Studierenden wichtige wissenschaftliche, pädagogische und
soziale Funktionen haben und zugleich eine Offenheit und
Brücke zur Stadt und Gesellschaft garantieren.
Neue
Infrastruktur mit Signalwirkung
Mit der Identifikation und
Priorisierung der hochschulseitig vordringlichen Bedarfe ist
ein zentraler Schritt der Neuen Masterplanung Hochschulbau
getan. Die hieran anschließend gemeinsam mit dem BLB NRW zu
konkretisierenden Bauvorhaben werden sich an neuesten
Anforderungen an Barrierefreiheit, Energieeffizienz und
Nutzerfreundlichkeit orientieren.
Diese
Transformation soll den Campus sowohl baulich als auch
atmosphärisch und funktional grundlegend verbessern und seine
Attraktivität für Studierende, Forschende und die
Öffentlichkeit deutlich steigern.
Modellprojekt für
das ganze Land
Das Land Nordrhein-Westfalen und die
Universität Duisburg-Essen wollen zeigen, wie strategische
Campusentwicklung innerhalb der Neuen Masterplanung
funktionieren kann: schnell, wirtschaftlich, vernetzt und
zukunftsorientiert. Die Universität Duisburg-Essen wird
dadurch gestärkt, denn eine moderne bauliche Situation
sichert ihre Stellung als wissenschaftlichen Spitzenstandort
für exzellente Forschung und Bildungsaufstieg.
Rektorin Prof. Dr. Barbara Albert betont: „Wir sind der
Landesregierung dankbar, dass unsere Universität
Duisburg-Essen für den Auftakt der Neuen Masterplanung
Hochschulbau ausgewählt wurde. Diese Entscheidung für einen
starken zentralen Campus Duisburg markiert einen wichtigen
strategischen Schritt und eröffnet der Universität
Duisburg-Essen neue Perspektiven für eine moderne, vernetzte
und nachhaltige Hochschulinfrastruktur.“
|
|
Humboldt-Professorin Dana Branzei kommt an die
Universitätsallianz Ruhr |
|
Duisburg, 16. April 2025 - Wie
schaffen es Zellen, ihr genetisches Material präzise zu
vervielfältigen, insbesondere bei DNA-Schäden? Die
international renommierte Molekularbiologin Prof. Dr. Dana
Branzei hat auf diese Frage wegweisende Antworten gefunden.
Sie erforscht, wie DNA-Reparatur und Chromosomenstruktur
perfekt ineinandergreifen.
Für ihre herausragenden
Forschungsarbeiten wurde sie von der Alexander von
Humboldt-Stiftung mit einer Humboldt-Professur 2025
ausgezeichnet. Am 1. April hat sie ihre Professur im Research
Center One Health Ruhr der Universitätsallianz Ruhr und an
der Fakultät für Biologie der Universität Duisburg-Essen
angetreten.

Dana Branzei / Copyright: UDE/Bettina Engel-Albustin
Die Molekularbiologin Dana Branzei zeigt in ihrer Forschung,
dass Reparaturmechanismen und die Struktur von Chromosomen im
Rahmen des laufenden Prozesses der Verdopplung des Erbguts
funktionell miteinander verwoben sind.
„Meine
Forschung konzentriert sich auf das Replisom - die
biochemische Maschinerie der Zelle, die das genetische
Material dupliziert und zum Aufbau der Chromosomenstruktur
beiträgt“, sagt Branzei. Ich konnte zeigen, dass diese
molekulare 'Kopiermaschine' nicht nur bei der DNA-Verdopplung
funktioniert, sondern auch DNA-Schäden erkennt und mit Hilfe
der Informationen des unbeschädigten DNA-Strangs überwindet -
ein für die Stabilität des Genoms entscheidender Prozess.
Ihre Arbeit hat die molekulare Choreografie hinter
diesem Mechanismus zur Umgehung von DNA-Schäden aufgedeckt
und damit ein langjähriges Rätsel der Zellbiologie gelöst –
ein Meilenstein für die Krebsforschung. Er erklärt, warum
bestimmte genetische Veränderungen das Risiko für
Tumorerkrankungen erhöhen – und wie Therapien wie die
Chemotherapie unbeabsichtigt Veränderungen im Erbgut auslösen
können.
„Mit Dana Branzei begrüßen wir eine
herausragende Wissenschaftlerin, die mit ihrer Expertise das
Research Center One Health Ruhr entscheidend stärken wird“,
sagt Rektorin Prof. Dr. Barbara Albert. „Wir sind
außerordentlich stolz und glücklich, eine
Humboldt-Professorin für die Universität Duisburg-Essen
gewonnen zu haben.“
Wissenschaftsministerin Ina
Brandes betonte bereits im Juni 2024 bei der Bekanntgabe von
Branzeis Nominierung: „„Über diese Auszeichnung freue ich
mich dreifach: Für Dana Branzei ist es die verdiente
Bestätigung für ihre Forschungsarbeit auf internationalem
Spitzenniveau. Für die Universität Duisburg-Essen bedeutet
die Humboldt-Professur eine weitere Verstärkung im Kampf
gegen die Volkskrankheit Krebs. Und für das Forschungsland
Nordrhein-Westfalen ist es Ausweis einer starken
Anziehungskraft für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
mit weltweitem Renommee.
Hier finden sie die
Bedingungen, die sie für erfolgreiche Forschung brauchen. In
kein anderes Land wurden so viele Humboldt-Professuren
vergeben wie nach Nordrhein-Westfalen.“ Die in Rumänien
geborene Wissenschaftlerin Dana Branzei war seit 2008 am AIRC
Institute of Molecular Oncology (IFOM) in Mailand, Italien,
tätig und ist seit 2020 Forschungsdirektorin am Institut für
Molekulare Genetik des Italienischen Forschungsrates (CNR) in
Pavia.
Sie studierte und forschte zuvor als
Postdoktorandin in Japan und unterhält seither enge
Forschungskooperationen in Asien. Seit 2016 ist sie gewähltes
Mitglied der Europäischen Organisation für Molekularbiologie
(EMBO). Branzei hat bereits einen ERC Starting Grant und
einen ERC Consolidator Grant erhalten und wurde kürzlich mit
einem ERC Advanced Grant ausgezeichnet.
|
|
„Biofabrik“ soll Mikroplastik
reduzieren
|
|
Millionen-Förderung
durch VolkswagenStiftung
Duisburg, 16. April 2025 -
Mikroplastik ist nicht biologisch abbaubar und deshalb ein
großes Problem für Mensch und Umwelt. Bei ihrer Suche nach
Möglichkeiten, Mikroplastik zu vermeiden, werden Prof. Dr.
Bettina Siebers, Leiterin des Bereiches Molekulare
Enzymtechnologie und Biochemie (MEB) an der Universität
Duisburg-Essen, und Dr. Christopher Bräsen,
Forschungsgruppenleiter am MEB, gemeinsam mit Prof. Dr.
Oliver Spadiut von der Technischen Universität Wien nun von
der VolkswagenStiftung unterstützt. 1,4 Millionen Euro stehen
dem Forschungsteam für ihr Projekt zur Verfügung, in dem
Mikroplastik ersetzt werden soll durch natürliche Lipide,
produziert von Mikroorganismen.

Grafische Darstellung des Projekts HotCircularity ̶ Nutzung
thermophiler Archaea für die Herstellung biologisch
abbaubarer Alternativen zu Mikroplastik aus
Biodieselabfallprodukten´ (Copyright: UDE/ Prof. Bettina
Siebers)
„Der Anteil unserer Universität am Fördergeld
für unser Projekt ‚HotCircularity ̶ Nutzung thermophiler
Archaea für die Herstellung biologisch abbaubarer
Alternativen zu Mikroplastik aus Biodieselabfallprodukten´
beträgt rund eine Million Euro. Damit können wir unsere
Forschung weiter vorantreiben und eine Lösung zur Reduzierung
der Mikroplastikfreisetzung in der Landwirtschaft
entwickeln“, freut sich Prof. Siebers.
Schädliches
Mikroplastik gelangt in die Umwelt
Materialien aus Plastik
werden in vielen Bereichen eingesetzt, so auch in der
Landwirtschaft. Sie zersetzen sich durch UV-Strahlung und
Witterung im Boden zu Mikro- und Nanoplastik – biologisch
abbaubar sind sie jedoch nicht. „Die Ansammlung von
Mikroplastik in der Umwelt wirkt sich negativ auf das
Bodenökosystem aus und kann auch schädlich für die
menschliche Gesundheit sein, wenn die Partikel über Tiere und
Pflanzen in die Nahrungskette gelangen“, erklärt Prof.
Siebers.
Besonders problematisch wird es, wenn
(Mikro)plastik gezielt in die Umwelt freigesetzt wird, z.B.
in der Landwirtschaft in Form von Beschichtungen für
Bodenverbesserer, Pestizide und Samen. Ziel des neuen
Projekts ist die Synthese und (Weiter)Entwicklung biologisch
abbaubarer Lipide als Ersatz für diese Beschichtungen.
In den Mittelpunkt ihres Forschungsprojekts stellen die
Wissenschaftler:innen Archaeen, einzellige Lebewesen ohne
Zellkern, denn sie synthetisieren Tetraetherlipide für den
Aufbau ihrer Zellmembranen, die daher leicht aus
Archaeen-Biomasse isoliert werden können.
„Im
Gegensatz zu den Esterlipiden aus Bakterien und Eukaryonten,
sind die archaealen Tetraetherlipide bzw. die aus ihnen
aufgebauten Membranen außerordentlich stabil gegenüber
physikalischen und chemischen Einwirkungen“, so Dr.
Christopher Bräsen. Sie haben daher großes Potential,
Mikroplastik in verschiedenen Anwendungen zu ersetzen und so
zu vermeiden, da sie biologisch abbaubar und damit
umweltfreundlich sind.
Die tetraetherlipide
produzierenden Mikroorganismen können auf günstigen
Abfallprodukten wie Rohglycerin – einem Nebenprodukt der
Biodiesel-Produktion – wachsen. Das Forschungsteam will die
Organismen und deren Wachstumsbedingungen optimieren, um so
eine wirtschaftliche "Biofabrik" zu schaffen, die die
biologisch abbaubaren Lipide herstellt, Abfälle verwertet und
Mikroplastik reduziert.
Mit ersten Ergebnissen rechnen
die Wissenschaftler:innen in rund 18 Monaten. Ihre Forschung
wird für insgesamt vier Jahre in der Förderinitiative
"Zirkularität mit recycelten und biogenen Rohstoffen"
unterstützt. Die VolkswagenStiftung fördert damit praxisnahe
Forschungsprojekte, die auf geschlossene Rohstoffkreisläufe
abzielen.
|
|
André Kubiczek ist Poet in
Residence
|
|
Realität statt
Ostalgie
Duisburg, 16. April 2025 - Seit 35 Jahren ist
die DDR Geschichte – und lebt doch in den Büchern von André
Kubiczek weiter. Jugendliche Alltagserfahrungen in
Ostdeutschland schildert der Schriftsteller mit Humor und
Ironie ebenso spannend, wie er anhaltende Ost- und
Westkonflikte mit satirischem Unterton kommentiert. Sein Werk
präsentiert der Autor nun als Poet in Residence an der
Universität Duisburg-Essen unter dem Titel: Wer schreibt, der
bleibt – Schriftsteller werden und Schriftsteller sein.
1968: Teo, eine junge Laotin, kommt am Berliner
Ostbahnhof an. Es ist die Liebe, die sie in die DDR führt,
weit weg von ihrer Familie. Doch ihr neues Leben in Potsdam,
scheinbar ein sozialistisches Idyll, ist schwer, und auch
perfektes Deutsch kommt gegen die Fremdheit nicht an, die man
sie als Asiatin jeden Tag spüren lässt.
„Nostalgia“
ist die Geschichte von André Kubiczeks Mutter – und auch
seine eigene, denn in seinem jüngsten Werk, nimmt er beide
Perspektiven ein. 1969 als Sohn eines laotisch-deutschen
Ehepaares in Potsdam geboren, schildert der Autor seine
Kindheit und Jugend in einer binationalen Familie in der DDR.
Gleichzeitig zeichnet er den Lebensweg seiner Mutter nach,
die versucht, in der Fremde eine neue Heimat zu finden.
Wie er beide Kulturen in seinem Roman zusammenführt,
wurde von Kritiker:innen hochgelobt. Nostalgia war auch für
den Deutschen Buchpreis nominiert. Ob die etwas andere
Familiengeschichte sie gleichermaßen berührt, können
Literaturinteressierte in einer öffentlichen Lesung des
Autors am 24. April am Campus Essen erfahren.
Blick
zurück, Blick nach vorn
Neben seinem letzten Buch führen
auch seine Romane „Oben leuchten die Sterne“ (2006) und „Der
Genosse, die Prinzessin und ihr lieber Herr Sohn“ (2012) die
Lesenden in eine kindlich-jugendliche Weltwahrnehmung und die
DDR in den 1980er Jahren.
„Vor allem seine Trilogie
(„Skizze eines Sommers“ / „Straße der Jugend“ / „Der perfekte
Kuss“) reiht sich in das Genre der coming-of-age-Erzählung
ein“, so Literaturwissenschaftlern Prof. Dr. Corinna
Schlicht, die die Reihe im Sommersemester 2025 organisiert.
„André Kubiczek schildert aus der Sicht eines jungen
Heranwachsenden Familienleben, Schulalltag und Freundeskreis,
wobei die spezifischen Lebensbedingungen der DDR Teil der
jugendlichen Alltagserfahrung sind.“
Der Autor blickt
aber nicht nur zurück, sondern auch nach vorn: Seine Romane
„Die Guten und die Bösen“ (2003), „Kopf unter Wasser“ (2009),
„Das fabelhafte Jahr der Anarchie“ (2014) und „Komm in den
totgesagten Park und schau“ (2018) kreisen rund um
gesellschaftspolitische Fragen, die die bundesrepublikanische
Wirklichkeit seit der Widervereinigung betreffen:
Rechtspopulismus, Neoliberalismus, Prekariat,
Ost-West-Konflikt und die Rolle der Medien in der Gegenwart.
Auch hier schlägt André Kubiczek einen durchaus beißend
satirischen Ton an.
Das Programm:
Poetikvorlesung
I: Guten Tag, ich schweife ab
Dienstag 22. April, 16-18
Uhr in R11 T00 D05
Poetikvorlesung II: Wo war ich stehen
geblieben? Die Entstehung einer Bibliographie
Mittwoch 23.
April, 16-18 Uhr in R11 T00 D05
Lesung aus dem Roman
Nostalgia
Donnerstag 24. April, 18-20 Uhr in R11 T00 D05
Alle Vorlesungen sind öffentlich und kostenfrei.
Zusätzlich wird André Kubiczek am 23., 24. und 25. April das
Seminar von Prof. Corinna Schlicht besuchen, um mit
Studierenden ins Gespräch zu kommen. Dafür können sich
interessierte Studierende ab sofort per Mail
(corinna.schlicht@uni-due.de) anmelden.
Weitere
Informationen:
https://www.uni-due.de/germanistik/poet/
|
|
Alexander von Humboldt-Professur
bringt Molekularbiologin an die Uni Duisburg-Essen
|
|
Duisburg, 11. April 2025 - Eine der fünf
Humboldt-Professuren geht in diesem Jahr an die Universität
Duisburg-Essen: Die Molekularbiologin Dana Branzei wechselt
vom Institute of Molecular Oncology in Mailand (IFOM) an die
Ruhrgebiets-Universität. Die Preisverleihung findet am 5. Mai
in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften
statt.
Eine Humboldt-Professur ist mit einer
Förderung von bis zu fünf Millionen Euro verbunden und damit
der höchstdotierte internationale Forschungspreis in
Deutschland. Die Spitzenforscher sollen langfristig für die
Arbeit an deutschen Forschungseinrichtungen gewonnen werden.
idr Infos:
https://www.humboldt-foundation.de
|
|
Blutzucker messen ohne Nadel |
|
Präzise und schmerzfrei dank
THz-Technologie
Duisburg, 8. April 2025 -
Forschende der Universität Duisburg-Essen haben ein neue
Methode entwickelt, die den Blutzuckerspiegel am Fingernagel
misst – ganz ohne Nadelstich. Statt Haut zu durchstechen,
nutzt sie Terahertz-Wellen, die durch den Fingernagel ins
Nagelbett dringen und dort reflektiert werden. Die
Terahertz-Technologie basiert auf elektromagnetischen Wellen
mit einer Wellenlänge zwischen Mikrowellen und
Infrarotstrahlung.
Sie ermöglicht eine detaillierte
Analyse biologischer Gewebe, ohne diese zu beeinträchtigen.
Für Menschen mit Diabetes könnte die Entwicklung der
Universität Duisburg-Essen (UDE) eine Alternative zur
herkömmlichen Blutzuckermessung darstellen, die bislang meist
einen Stich in die Haut erfordert. Das Verfahren beruht auf
einem miniaturisierten Terahertz-Sensor, der hochfrequente
Wellen einer bestimmten Frequenzbandbreite (z.B. 300 GHz)
durch den Fingernagel ins gut durchblutete Nagelbett sendet.
Je nach Blutzuckerkonzentration verändern sich die
reflektierten Signale, die der Sensor erfasst und
entsprechend des Frequenzverhaltens mit Hilfe einer KI
auswertet und dem zugehörigen Blutzuckerspiegel zuordnet.
Erste Auswertungen des Konzepts am Modell und realistischen
Blutwerten zeigen bei 300 GHz eine Sensitivität des
reflektierten Signals gegenüber der Glukosekonzentration von
0.2 dB/(mmol/L).
Betrachtet man das
Reflexionsverhalten über den gesamten Frequenzbereich nun
durch die Augen einer KI, dann lässt sich der
Blutzuckerspiegel noch sensitiver und damit genauer
bestimmen. Aufgrund seiner geringen Größe von wenigen
Quadratmilimetern könnte der Sensor in Alltagsgegenstände wie
Schlüsselanhänger oder künstliche Fingernägel integriert
werden.
Die Ingenieur:innen der UDE zählen zu den
führenden Forschenden im Bereich miniaturisierter
Terahertz-Systeme. Mit Unterstützung von PROvendis wurde für
die entwickelte Blutzuckersensorik ein Patent angemeldet –
ein wichtiger Schritt in Richtung einer möglichen Anwendung.
Aktuell arbeitet das Team an einem KI-gestützten System, um
die Messgenauigkeit weiter zu verbessern.
Das
Sensorkonzept entstand aus einer Forschungszusammenarbeit mit
insgesamt acht Wissenschaftler:innen aus drei Fachgebieten
der Universität Duisburg-Essen (UDE) sowie einem
Wissenschaftler der TU Darmstadt. „Unser Team hat hier
Neuland betreten, und diese Entwicklung könnte die Art, wie
Menschen ihren Blutzucker kontrollieren, grundlegend
verändern“, sagt Prof. Dr. Daniel Erni aus der Fakultät für
Ingenieurwissenschaften der UDE, der das Projekt leitet.
|
|
Ausstellung „Mit anderen Augen sehen“ -
UDE-Studierende fotografieren |
|
Duisburg, 8. April
2025 - Ihre Erkrankungen sind vielfältig. Einige der Kinder
sind zu früh geboren, andere haben angeborene Herzfehler,
können schlecht hören und oder sind geistig eingeschränkt.
Vor Energie sprühen sie trotzdem – das zeigen
Fotografie-Studierende der Universität Duisburg-Essen mit
knapp 20 Bildern in der Ausstellung „Mit anderen Augen
sehen“. Zu sehen sind sie bis zum 5. Mai in den Räumen der
Novitas BKK.
„Die 25 Kinder, die wir fotografiert
haben, sind zwischen vier Monaten und 10 Jahre alt“, sagt
Ditmar Schädel. Er unterrichtet die Fotografie-Studierenden
der Universität Duisburg-Essen (UDE) im Studiengang Komedia
(Angewandte Kognitions- und Medienwissenschaft). Insgesamt
haben sie den Nachwuchs in 19 großen Fotos abgelichtet.
„Es gibt wieder Texte zu den Fotos. Das kam beim letzten
Mal gut an.“ Schädel bietet diese Projektarbeit an der UDE
schon zum zehnten Mal an. Sie bereichere die Studierenden
ungemein. „Die Studierenden müssen hoch sensibel sein, wenn
sie mit den Eltern und den gehandicapten Kindern
kommunizieren. Ich höre aber immer wieder, dass es ihren
Blick auf schwierige Situationen schärft“, so Schädel.
Im Alltag werden die Kinder und ihre Eltern durch den
Verein Bunter Kreis Duisburg unterstützt. Er betreut Familien
am Niederrhein und im westlichen Ruhrgebiet, in denen Kinder
behindert oder als Frühgeburt zur Welt gekommen sind, hilft
bei der Vermittlung von Ärzten und wenn Umbauten oder
Therapien notwendig sind.
Die Ausstellung „Mit anderen
Augen“ ist zu sehen in der Novitas BKK, Zum Portsmouthplatz
24, 47051 Duisburg. Interessierte können sie bis zum 5. Mai
während der Öffnungszeiten der Krankenkasse besuchen.
Weitere Informationen:
https://bunter-kreis-duisburg.de/
|
|
Universität Duisburg-Essen bekommt
Forschungsbau Active Sites
|
|
Duisburg, 7. April 2025 - An der
Universität Duisburg-Essen wurde heute der erste Spatenstich
für den neuen Forschungsbau Active Sites gesetzt. Dort soll
interdisziplinär in Natur-, Lebens- und
Ingenieurwissenschaften mit dem Schwerpunkt Wasserforschung
gearbeitet werden. Der Neubau mit zahlreichen Laboren und
insgesamt 4.850 Quadratmetern Nutzfläche entsteht im Essener
Norden.
Die Kosten werden mit 70 Millionen Euro
veranschlagt. Das Land fördert den Bau gemeinsam mit dem Bund
jeweils zur Hälfte. Im Sommer 2028 soll das Gebäude bezogen
werden können. Active sites (aktive Zentren) sind essenziell
für chemische und biologische Prozesse und spielen eine
Schlüsselrolle in vielen technologischen Bereichen von der
chemischen Energieumwandlung bis zur Wasserreinigung. idr
|
|
Gefragtes
Frühstudium - 109 Zertifikate ausgestellt
|
|
Duisburg, 2. April
2025 - Ihr Wissensdurst geht über den Schulunterricht hinaus:
74 Schüler:innen haben im vergangenen Semester an der UDE am
Frühstudium teilgenommen. Sie besuchten Veranstaltungen
unterschiedlicher Fächer – zusammen mit eingeschriebenen
Studierenden und feierten erste akademische Erfolge. In einer
Feierstunde erhielten sie nun ihre Zertifikate.

Frühstudium 2025 an der UDE: 74 Schüler:innen waren dabei. ©
Digitale Fotografien/Paul Klimek
Humanmedizin,
Informatik und Mathematik kamen bei den Studis von morgen am
besten an. 24 von ihnen nahmen schon zum wiederholten Mal am
Frühstudium teil, 32 testeten ihr Wissen in Klausuren. Und
das teils sehr erfolgreich: Fünf Schüler:innen bestanden ihre
Prüfungen in Mathematik, Informatik und Unternehmensführung
mit der Bestnote 1,0. Die UDE stellte insgesamt 109
Zertifikate aus, Leistungsnachweise nach bestandener Prüfung
können später im Studium angerechnet werden.
Der
Wissensdurst kennt weder Alter noch Geschlecht: Die Jüngsten
waren 13 und 14 Jahre alt, die Ältesten waren knapp über 30,
wobei die meisten zwischen 15 und 17 Jahre alt waren. Und
beim Geschlecht lagen sie mit 53 Prozent (weiblich) und 47
Prozent (männlich) fast gleich auf.
Insgesamt waren 37
Schulen vertreten. Ein Gymnasium aus Emmerich am Rhein (etwa
75 km entfernt) schickte mit 11 Schüler:innen die meisten
Teilnehmenden. Gefördert wurde das Frühstudium von der
National-Bank AG, der Jörg-Keller-Stiftung, dem Förderverein
der UDE und TalentTage Ruhr.
Wer Lust hat, beim
nächsten Frühstudium einzusteigen, kann sich im August für
das Wintersemester 2025/26 anmelden:
https://www.uni-due.de/abz/studieninteressierte/fruehstudium_anmeldung_fruehstudium.php.
Die Frist fürs Sommersemester 2025 ist bereits abgelaufen.
|
|
Neuer Therapieansatz für
Diabetes-Patient:innen
|
|
Molekulare
Klebstoffe schützen insulinproduzierende Zellen
Duisburg, 1. April 2025 - Ein internationales Forschungsteam
hat einen neuen Ansatz entwickelt, um insulinproduzierende
Betazellen vor diabetesbedingten Schäden zu bewahren.
Spezielle Moleküle – sogenannte molekulare Klebstoffe –
stabilisieren eine entscheidende Protein-Interaktion, die den
Zelltod verhindert. Die Erkenntnisse, veröffentlicht in
Nature Communications, könnten den Weg für neuartige
Therapien ebnen.
Mehr als 500 Millionen Menschen
weltweit leiden an Diabetes, einer Erkrankung, die oft mit
dem fortschreitenden Versagen der Betazellen in der
Bauchspeicheldrüse einhergeht. Besonders bei Typ-2-Diabetes
führt eine anhaltend hohe Belastung durch Zucker und Fette im
Blut – die sogenannte Glukolipotoxizität – dazu, dass
Betazellen geschädigt und schließlich zerstört werden. Ohne
die insulinproduzierenden Betazellen kann in der
Bauchspeicheldrüse kein Insulin mehr gebildet werden, das den
Blutzuckerspiegel im Körper reguliert.
Ein
Forschungsteam der Universität Duisburg-Essen, der Icahn
School of Medicine am Mount Sinai (USA) und der Technischen
Universität Eindhoven (Niederlande) hat nun herausgefunden,
dass sich dieser Prozess gezielt aufhalten lässt:
Normalerweise schützen viele verschiedene Faktoren die
Betazellen vor Überlastung, unter anderem indem sie eine
Bindung zwischen dem Stoffwechselregulator ChREBPα und dem
Protein 14-3-3 vermitteln.
Doch genau dieser
Schutzmechanismus versagt, sobald der Blutzuckerspiegel zu
stark und oft ansteigt: Die Bindung löst sich, die Zellen
sind der schädlichen Wirkung von Zucker und Fetten – der
sogenannten Glukolipotoxizität – schutzlos ausgeliefert. Hier
setzt die Entdeckung des internationalen Forschungsteams an.
Mit neu entwickelten molekularen Klebstoffen gelingt es
ihnen, die Bindung zwischen ChREBPα und 14-3-3 gezielt zu
verstärken. Dadurch werden die Betazellen vor den toxischen
Folgen des hohen Blutzuckers bewahrt, was ihren
Funktionsverlust aufhält und womöglich das Fortschreiten von
Diabetes verlangsamt.
Bisher galten
Transkriptionsfaktoren wie ChREBP als kaum beeinflussbare
Zielstrukturen für Medikamente. Die nun entdeckte Strategie
durch molekulare Klebstoffe eröffnet völlig neue
Perspektiven: "Zum ersten Mal ist es gelungen, mit kleinen
Molekülen die Aktivität von ChREBP gezielt zu steuern – ein
Meilenstein mit enormem therapeutischem Potenzial," erklärt
Prof. Dr. Markus Kaiser von der Universität Duisburg-Essen.
Die Entdeckung dieser Schutzmechanismen könnte die
Diabetesbehandlung revolutionieren. „Unsere Forschung zeigt
eine völlig neue Strategie zur Bewahrung der
Betazell-Funktion“, betont Kaiser. „Dieser Ansatz könnte
bestehende Therapien ergänzen und das Fortschreiten der
Krankheit verlangsamen.“
Der nächste Schritt besteht
darin, die molekularen Klebstoffe weiter zu optimieren und in
präklinischen Modellen zu testen. Gelingt die
Weiterentwicklung, könnten diese neuen Wirkstoffe einen
entscheidenden Beitrag zur Behandlung von Diabetes leisten –
und Millionen von Menschen eine bessere Zukunft ermöglichen.
Zur Publikation:
https://www.nature.com/articles/s41467-025-57241-7
|
|
UDE-Erfindung
an Airbus Helicopters verkauft
|
|
Notschwimmsystem für Hubschrauber
Duisburg,
31. März 2025 - Hubschrauber für einen Brand im Triebwerk und
für eine Notwasserung nach aktualisierten Vorschriften zu
rüsten, war das Ziel des 2022 gestarteten Vorhabens
EvoS-BraWa*. Die Forschung übernahm ein Team der Universität
Duisburg-Essen in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Airbus
Helicopters.
Mit Erfolg: Den Ingenieur:innen ist es
gelungen, neuartige Schwimmkörper für die Bestückung der
Helikopter mit Notschwimmsystemen zu entwickeln. Die Rechte
an der Erfindung und das darauf basierende Patent verkauft
die Universität nun an Airbus Helicopters.
Gemeinsames
Forschungsprojekt von UDE und Airbus Helicopters endete
erfolgreich in einem Patent. Foto: Airbus.
Die
Erfindung war notwendig geworden, nachdem die Agentur der
Europäischen Union für Flugsicherheit (EASA) ihre Regularien
zu Notschwimmsystemen verschärft hatte. Mit diesen müssen
Hubschrauber für den Fall einer Notwasserung ausgestattet
sein, um Stabilität in schwerer See sicherzustellen und
Strukturversagen zu vermeiden. Während bis 2021 nur
nachgewiesen werden musste, dass ein notgewasserter
Helikopter mit dem angebrachten Notschwimmsystem stabil in
regelmäßigen Wellen schwimmt, verlangen die Vorschriften nun,
dass die Schwimmstabilität durch Modellversuche in
unregelmäßigen Wellen bei Seegangstärke 6 nachgewiesen werden
muss.
Die Ingenieur:innen am Institut für Nachhaltige
und Autonome Maritime Systeme (INAM) der Universität
Duisburg-Essen (UDE) haben im Rahmen eines vom Bayerischen
Wirtschaftsministerium geförderten Forschungsvorhabens die
Schwimmstabilität eines Helikopters dementsprechend
untersucht. Das INAM ist auf Fluid-Strukur-Wechselwirkung im
maritimen Kontext spezialisiert. Dabei ist es dem Team um
Prof. Bettar O. el Moctar gelungen, neuartige Schwimmkörper
für das Notschwimmsystem zu entwickeln.
„Im Gegensatz
zu den gebräuchlichen Systemen gewährleistet unsere Erfindung
auch bei rauem Seegang genügend Kentersicherheit. Die
Kenterwahrscheinlichkeit konnte auf unter ein Prozent
verringert werden“, so el Moctar. Gemäß EASA gilt
Schwimmstabilität als nachgewiesen, wenn eine
Kenterwahrscheinlichkeit von drei Prozent mit intakten
Schwimmkörpern bzw. 30 Prozent mit einem beschädigten
Schwimmkörper nicht überschritten wird. Darüber hinaus wurden
Simulationsverfahren zur Berechnung von Stoßlasten und
Bewegungsverhalten von Hubschraubern in Wellen entwickelt und
validiert.
Mit Unterstützung von PROvendis, der
Patentvermarktungsgesellschaft für die Hochschulen in NRW,
hat die UDE nun die Rechte an der Erfindung sowie an der
darauf basierenden Patentanmeldung an Airbus Helicopters
verkauft. Das Unternehmen will die Technologie nun
weiterentwickeln und auf den Markt bringen.
*Die
Projektleitung hat Airbus Helicopters, zweiter Projektpartner
ist das Deutsche Zentrum für Luft-und Raumfahrt e. V. (DLR)
|
|
Suchtpotenzial im Internet:
Universität Duisburg-Essen sucht Probandinnen und Probanden
für neue Studie
|
|
Duisburg, 27. März
2025 - Für eine neue Studie sucht die Universität
Duisburg-Essen Personen, die das Internet intensiv nutzen.
Die viel online shoppen oder spielen, um soziale Netzwerke zu
besuchen oder pornografische Inhalte zu konsumieren. Dabei
wollen die Forschenden herausfinden, wie hoch das
Suchtpotenzial bei all diesen Tätigkeiten sein kann.
In dem wissenschaftlichen Experiment müssen Probandinnen und
Probanden experimentelle und neuropsychologische Aufgaben
absolvieren, Fragebögen beantworten und an einer
Nachbefragung teilnehmen. Gesucht werden Personen aller
Geschlechter im Alter zwischen 18 bis 65 Jahren. Die
Teilnahme wird mit 12 Euro pro Stunde vergütet. idr
Eine Registrierung erfolgt über die Website
https://www.uni-due.de/for2974/rekrutierung oder per Mail
an for.studie@uni-due.de.
|
|
Partneruniversität der FISU World
University Games. Die UDE spielt mit!
|
|
Duisburg, 27. März
2025 - „Partnerhochschule des Spitzensports" ist die
Universität Duisburg-Essen schon seit Jahren, nun kommt noch
ein Titel dazu: offizielle Partneruniversität der Rhine-Ruhr
2025 FISU World University Games. Die UDE ist mittendrin,
wenn eines der größten Multisport-Events der Welt vom 16. bis
27. Juli an Rhein und Ruhr an den Start geht. Am 26. März
wurde die Zusammenarbeit zwischen der Universität und der
Rhine-Ruhr 2025 FISU Games gGbmH mit der Unterzeichnung der
Kooperationsvereinbarung offiziell besiegelt.

v.l.n.: Niklas Börger (Rhine-Ruhr 2025 FISU World University
Games), UDE-Prorektorin Prof. Karen Shire und
UDE-Hochschulsportleiter Daniel Krüger haben die neue
Partnerschaft im Beisein von Maskottchen Wanda offiziell
besiegelt. Foto: UDE/Fabian Strauch
Unter den
Wanderfalkenaugen von Maskottchen Wanda unterschrieben Prof.
Karen Shire, Prorektorin für Universitätskultur, Diversität
und Internationales und Hochschulsportleiter Daniel Krüger
für die UDE, sowie Niklas Börger als CEO der Rhine-Ruhr 2025
FISU World University Games.
18 Sportarten, 12
Wettkampftage, sechs Städte
Rund 8.500 Athlet:innen und
Offizielle aus über 150 Ländern treten in 18 Sportarten
gegeneinander an. Auch fünf Studierende der UDE haben derzeit
Hoffnungen auf eine Nominierung. Die Unistädte Duisburg und
Essen werden bei den Rhine-Ruhr 2025 FISU World University
Games zu einem sportlichen und kulturellen Zentrum.
Neben der Eröffnungs- und Abschlusszeremonie werden hier die
Wettkämpfe in den Sportarten Bogenschießen, Geräteturnen,
Basketball, Fechten und Judo, rhythmische Gymnastik, Rudern,
Tischtennis, Tennis, Taekwondo, Beachvolleyball und
Wasserball in ausgetragen. Weitere Wettbewerbe finden in
Bochum, Mülheim, Hagen und Berlin statt. Außerdem gibt es ein
umfangreiches Rahmenprogramm mit Konzerten, Festivals, einer
wissenschaftlichen Konferenz, Kulturveranstaltungen und
Mitmachangeboten
Die FISU World University Games, die
früher „Universiade“ hießen, gelten als die Olympischen
Spiele für Studierende und sind bei den angehenden
Akademiker:innen weltweit sehr beliebt. Zum ersten Mal fanden
sie 1923 in Paris statt. Seit 1959 wird der wichtigste
Wettbewerb im internationalen Hochschulsport alle zwei Jahre
sowohl im Sommer als auch im Winter ausgetragen – 1989
übrigens schon einmal in der Rhein-Ruhr-Region. Damals kamen
3.000 Studierende aus aller Welt in Duisburg zusammen.
|
|
Niedriglohnforschung des IAQ: Niedriglohnrisko 2022 gesunken |
|
Duisburg, 17. März 2025 - Das Risiko,
hierzulande für einen Niedriglohn zu arbeiten, ist zwischen
2021 und 2022 um fast zwei Prozentpunkte auf 19 Prozent
gesunken. Der vermutliche Grund: die Anhebung des
Mindestlohns auf 12 Euro im Jahr 2022. Vor allem in
Westdeutschland zeigt sich ein deutlicher Rückgang. Zu diesem
Ergebnis kommt eine aktuelle Auswertung des Instituts Arbeit
und Qualifikation IAQ der Universität Duisburg-Essen.
Für den neuen IAQ-Report zum aktuellen Stand der
Niedriglohnforschung betrachtete Dr. Thorsten Kalina
insbesondere die jährlichen Zahlen des sozio-oekonomischen
Panels (SOEP) für 2022. Im Mittelpunkt seiner Auswertung
stand dabei die Frage, wie sich der Umfang der
Niedriglohnbeschäftigung verändert hat und wie sich dies auf
einzelne Beschäftigtengruppen auswirkt.
Der Anteil der
Niedriglohnbeschäftigung erreichte in Deutschland in den
Jahren 2009 bis 2011 einen Höchststand von rund einem Viertel
(24 %) aller Beschäftigten. Erst seit 2018 – also drei Jahre
nach der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns – war die
Anzahl der Niedriglohnbeschäftigten und deren Anteil an der
Gesamtbeschäftigung erstmals erkennbar gesunken (21,2 %).
Zwischen 2021 und 2022 ist das Niedriglohnrisiko in
Gesamtdeutschland von 20,9 % auf 19 % weiter zurückgegangen.
Bemerkenswert ist vor allem, dass sich dieser Rückgang sehr
deutlich in Westdeutschland bemerkbar macht (von 19,9 % auf
17,9 %), während frühere Rückgänge vor allem mit der
Angleichung der Ostlöhne an das Westniveau erklärt werden
konnten.
Kalinas Auswertungen zeigen außerdem, dass
sich im Zeitraum der Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro das
Niedriglohnrisiko für einen Teil der besonders stark von
Niedriglöhnen betroffenen Gruppen reduziert hat, z.B. für
Migrant:innen oder befristet Beschäftigte. Bei
Geringqualifizierten, Frauen, Jüngeren, Älteren oder
Minijobber:innen konnte hingegen nur ein
unterdurchschnittlicher Rückgang des Niedriglohnrisikos
festgestellt werden.
Dagegen zeigte sich ein
überdurchschnittlicher Rückgang eher bei Hochqualifizierten,
mittleren Altersgruppen, Männern oder
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten – also nicht bei
den Beschäftigtengruppen, die besonders schlecht bezahlt
werden.
„Es ist fraglich, ob eine abermalige Erhöhung
des Mindestlohns dazu geeignet ist, den Niedriglohnsektor
weiter zu verkleinern, und ob sie andererseits besonders
betroffenen Beschäftigtengruppen helfen würde, ein Lohnniveau
oberhalb der Niedriglohnschwelle zu erreichen“, so der
Arbeitsmarktforscher. „
Die internationale
Mindestlohnforschung wie auch eigene Studien zeigen vielmehr,
dass der Umfang der Tarifbindung einen deutlich stärkeren
Einfluss auf den Umfang der Niedriglohnbeschäftigung in einem
Land hat als die Existenz oder Höhe eines gesetzlichen
Mindestlohns“. Der Wissenschaftler plädiert daher für eine
Ausweitung der Tarifbindung, um den Niedriglohnsektor
hierzulande auch zukünftig weiter zu verkleinern.
|
|
Universität Duisburg-Essen: Neues
Gasthörerverzeichnis erschienen |
|
Bildung ohne Druck für alle
Duisburg, 14. März 2025 - Gemeinsames Lernen ist wieder
angesagt! Wissbegierige treffen sich dazu an der Universität
Duisburg-Essen – auch ohne Abitur. Wie wär’s etwa mit
Einblicken in den Zusammenhang von Theologie und Politik oder
magnetische Materialien bei der Energiewende? Gasthörer:innen
können das Verzeichnis des kommenden Semesters online
herunterladen:
https://www.uni-due.de/imperia/md/content/dokumente/2025/gasthoerer-sose-2025.pdf.
Das aktuelle Programm gibt Einblicke in das vielfältige
Lehrprogramm der Universität Duisburg-Essen (UDE). Gedruckte
Exemplare des Gasthörerverzeichnisses gibt es an beiden Campi
kostenlos im Akademischen Beratungszentrum (ABZ), den
Bibliotheken und bei der Einschreibung. In Essen ist es zudem
bei den Pförtner:innen im Gebäude R12 und am Klinikum
(Hauptloge) erhältlich.
Genauere Auskunft gibt an der
Universität Duisburg-Essen Jennifer Peters, Sachgebiet
Studierendenservice, Akademische und hochschulpolitische
Angelegenheiten. Die Einschreibung läuft bis zum 18. Juli
2025. Gasthörer:innen zahlen für die Teilnahme einmalig 100
Euro für das ganze Semester, bei Geflüchteten entfällt die
Gebühr.
https://www.uni-due.de/imperia/md/content/dokumente/2025/gasthoerer-sose-2025.pdf
|
|
„Die Zukunft gehört Dir“ |
|
Duisburg, 11. März 2025 - Wer sich vom
diesjährigen Aufruf zum Girls'Day und Boys'Day 2025
angesprochen fühlt, ist auch an der Universität
Duisburg-Essen richtig. Am 3. April bietet die UDE
Schüler:innen der Jahrgangsstufen 9 und 10 wieder ein
umfangreiches und spannendes Programm an beiden Campi an.
Anmelden kann man sich noch bis Ende März. Beim Girls’Day
gibt es über 20 Workshops.
Dabei erfahren die
Mädchen, wie eine Gasturbine funktioniert und wie sie in
Zukunft mit Wasser betrieben werden kann. Ob man mit KI ein
Schiff steuern oder sogar Kunstwerke generieren kann und wie
man mit genetischen Fingerabdrücken der Artenvielfalt auf die
Spur kommt. Zudem warten noch weitere spannende Themen u.a.
aus den Bereichen Mathematik, Wirtschaftsinformatik, Chemie,
Physik, Ingenieurwissenschaften, Medizin- und Wassertechnik,
Partikeltechnologie und der Werkstofftechnik auf die
Teilnehmerinnen.
Auch Ausbildungsberufe wie
Baustoffprüferin in der Geotechnik werden vorgestellt. Beim
Boys’Day erfahren die Schüler, was einen guten
Grundschullehrer ausmacht, in welchen Bereichen man als
Psychologe arbeiten kann und warum ein Sonderpädagoge über
Superkräfte verfügt. Die Jungen wissen anschließend auch, mit
welchen Themen man sich im Rahmen eines Studiums im
Studienfach Lehramt Englisch befasst und wie vielfältig der
Beruf des Sachunterrichtslehrers sein kann.
Außerdem lernen sie Ausbildungsberufe wie Kaufmann für
Büromanagement kennen und können ihre Fragen direkt den
Auszubildenden stellen, die sie bei ihrem Workshop begleiten.
Ziel des bundesweiten Aktionstages ist es, traditionelle
Geschlechterrollen in der Berufswahl zu durchbrechen und
Schüler:innen so die Möglichkeit zu geben, Berufe zu
erkunden, die traditionell mit dem anderen Geschlecht
assoziiert werden.
Die Anmeldung erfolgt über das
Girls'Day- (https://www.girls-day.de/Radar)
bzw. Boys'Day Radar (https://www.boys-day.d...-day-radar)
und ist bis zum 24. März 2025 freigeschaltet. Weitere
Informationen:
https://www.uni-due.de.../girlsday/ und
https://www.uni-due.de...e/boysday/ Büro der
Gleichstellungsbeauftragten, Tel. 0201/18 3-4527,
schuelerinnenprogramme@uni-due.de
|
|
NRW-weite Themenwochen:
Studienzweifel – was nun? |
|
Duisburg, 5. März
2025 - Wer kennt das nicht: Es gibt Phasen, da fällt das
Lernen schwer, die Motivation ist im Keller, und manchmal
kommt sogar der Gedanke auf, das Studium abzubrechen. Die
NRW-weiten Themenwochen Studienzweifel bieten Betroffenen
gezielt Unterstützung.
Drei Wochen lang, vom 10. bis
zum 28. März, können Studierende an dem umfangreichen
Programm teilnehmen. Es wird von etwa 30 Hochschulen
gestaltet – darunter der Universität Duisburg-Essen – und vom
Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes gefördert.
Zweifeln als Chance: Unter diesem Aspekt organisieren
die Studienberatungen und Career Services der beteiligten
NRW-Hochschulen die kommenden Themenwochen. Sie finden
mittlerweile zum sechsten Mal statt. Zu den 40 überwiegend
digitalen Veranstaltungen gehören Vorträge, Workshops und
Beratungssprechstunden.
Dabei können Studierende ihre
aktuelle Situation reflektieren und persönliche Kompetenzen
weiterentwickeln, z.B. Lerntechniken. Sie erhalten außerdem
Einblicke zum Fach- und Hochschulwechsel, in Bildungswege
außerhalb der Uni, und sie haben die Möglichkeit, mit den
passenden Kontaktpersonen von Hochschule und Arbeitsmarkt zu
sprechen.
Zum Online-Auftakt der Themenwochen am 10.
März gibt es einen Überblick über das Programm. Außerdem
berichten (ehemalige) Betroffene von ihren Erfahrungen.
Das Akademische Beratungs-Zentrum der Universität
Duisburg-Essen (UDE) bietet die folgenden Veranstaltungen an:
13.3.2025, 16.00-17.30 Uhr
Erfolgreich berufsorientiert
studieren (online in Kooperation mit der Arbeitsagentur
Essen)
19.3.2025, 16.00-17.30 Uhr
Studienzweifel
überwinden – Effektive Techniken für den Studienerfolg
(online)
Weitermachen, wechseln, neuanfangen oder
pausieren? Studierende, die Probleme in ihrem Studium haben,
erhalten nicht nur während der Themenwochen Unterstützung. An
vielen NRW-Hochschulen sind die Sprechstunden bei
Studienzweifeln längst fest verankert. So auch an der UDE, wo
das Akademische Beratungs-Zentrum weiterhilft.
Weitere
Informationen und Anmeldung:
Das Programm der Themenwochen
„Studienzweifel“ ist kostenfrei. Für einige Veranstaltungen
muss man sich vorher anmelden:
https://nextcareer.de/themenwochen_studienzweifel/
https://www.uni-due.de/abz/studierende/fachwechsel-studienabbruch.php
Heike Alberts, Akademisches Beratungs-Zentrum,
heike.alberts@uni-due.de
|
|
Immer länger arbeiten – geht das? |
|
Aktuelle
Entwicklungen beim Zugang in Erwerbsminderungsrente
Duisburg, 24. Februar 2025 - Gesundheitliche Einschränkungen
sind ein häufiger Grund für das vorzeitige Ausscheiden aus
dem Erwerbsleben. Mit der schrittweisen Anhebung der
Regelaltersgrenze auf 67 Jahre steigt auch das Alter von
Arbeitnehmer:innen, die vorzeitig ihr Erwerbsleben beenden
müssen. Sie wechseln in eine Erwerbsminderungsrente.
Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle
Altersübergangs-Report, den das Institut Arbeit und
Qualifikation der Universität Duisburg-Essen in Kooperation
mit der Hans-Böckler-Stiftung herausgibt. Die
Forschungsergebnisse und mögliche Konsequenzen diskutieren
die Autor:innen am 24. Februar um 14:30 Uhr online live.
Die Zugänge in Alters- und Erwerbsminderungsrenten
wurden in der Forschung bislang aufgrund der
unterschiedlichen Voraussetzungen überwiegend getrennt
betrachtet. Der neue Altersübergangs-Report des Instituts
Arbeit und Qualifikation (IAQ) analysiert nun die Verbindung
der beiden Risiken Alter und Gesundheit.
Hierzu
wurden die Neuzugänge in Erwerbsminderungsrente (kurz
EM-Rente) mehrerer aufeinander folgender Geburtskohorten
(1945 bis 1955) auf Datenbasis der Gesetzlichen
Rentenversicherung betrachtet und folgende Frage gestellt:
Wie entwickelt sich die Inanspruchnahme von EM-Renten im
Umfeld steigender Altersgrenzen und welche Folgen hat dies
für die Gestaltung des Altersübergangs und die Anforderungen
an die soziale Sicherung?
Seit etwa 20 Jahren bekommen
jedes Jahr zwischen ca. 160.000 und 180.000 Personen eine
EM-Rente bewilligt. Der Anteil der EM-Renten an allen
Rentenzugängen ist seit Jahren sogar rückläufig, wie
Auswertungen des Portals Sozialpolitik-aktuell.de zeigen.
Zugleich wechselt eine wachsende Zahl von Personen mit
fortlaufender Zeit erst in einem Alter jenseits von 60 Jahren
in EM-Rente. So machten im Jahr 2004 die EM-Rentenzugänge ab
60 Jahren nur etwa 15% aller EM-Rentenzugänge aus, im Jahr
2021 jedoch über 40%.
Die wachsende Bedeutung der
EM-Rente im Altersübergang entwickelt sich parallel zur
Schließung von Frühverrentungsmöglichkeiten und zur Anhebung
der Altersgrenzen. In der jüngsten Geburtskohorte (Jahrgang
1955) wechseln Personen in einem Alter in EM-Rente, zu dem
ebenso alte Personen früherer Kohorten in eine Altersrente
hätten wechseln können.
„Offensichtlich kann ein
Teil der Beschäftigten die Erwerbsphase nicht entlang der
steigenden Altersgrenzen verlängern und scheidet
gesundheitsbedingt aus dem Erwerbsleben aus“, ordnet Prof.
Dr. Martin Brussig die Entwicklungen ein. „Da die
persönlichen Voraussetzungen für eine Erwerbsminderungsrente
sehr streng sind, ist zu vermuten, dass es deutlich mehr
Personen gibt, die mit der Anhebung der Altersgrenze nicht
Schritt halten können, als nur diejenigen, die tatsächlich
eine Erwerbsminderungsrente zugesprochen bekommen.“
Der Arbeitsmarktforscher regt daher eine Verbesserung der
Alterssicherung an: Bisher wird die Erwerbsfähigkeit auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt herangezogen, um zu prüfen, ob eine
weitere Erwerbstätigkeit zumutbar ist. Brussig schlägt vor,
im hören Erwerbsalter stattdessen die gesundheitliche
Leistungsfähigkeit im langjährig ausgeübten Beruf als Maßstab
heranzuziehen.
Die Forschungsergebnisse und mögliche
Konsequenzen diskutieren Martin Brussig und seine Kollegin
Dr. Susanne Drescher am Montag, 24. Februar um 14:30 Uhr
online im Rahmen der öffentlichen Diskussionsreihe „IAQ
debattiert“ mit Michael Popp, Referent für Alterssicherung
und gesetzliche Unfallversicherung beim Sozialverband VdK
Deutschland e.V. und Prof. Dr. Martin Werding, seit September
2022 Mitglied des Sachverständigenrates für Wirtschaft und
damit einer von fünf „Wirtschaftsweisen“.
Weitere
Informationen: Brussig, Martin, 2025: Erwerbsminderungsrenten
im Altersübergang: Entwicklungstrends in einem
Umfeld
steigender Altersgrenzen. Altersübergangs-Report 2025-01.
Düsseldorf/Duisburg: Hans-Böckler-Stiftung/Institut Arbeit
und Qualifikation (IAQ), Universität Duisburg-Essen.
|
|
Das erwarten
Forschende und Praxisakteure von der Wissenschaft
|
|
Politikforschung in Deutschland
Duisburg, 17. Februar
2025 - Die Sozialpolitik in Deutschland steht vor einer
Vielzahl neuer und alter Herausforderungen. Das Deutsche
Institut für Interdisziplinäre Sozialpolitikforschung, das
durch das Institut Arbeit und Qualifikation (Universität
Duisburg-Essen) und das SOCIUM Forschungszentrum Ungleichheit
und Sozialpolitik (Universität Bremen) betrieben wird, will
zu einer Weiterentwicklung der Sozialpolitik(-forschung) in
Deutschland beitragen.
Ein Team aus
DIFIS-Wissenschaftler:innen hat sich deshalb mit den
Erwartungen von Forschenden und Praxisakteuren an die
Sozialpolitikforschung auseinandergesetzt. Die Ergebnisse
finden sich im aktuellen IAQ-Report.
Das vom
Bundesministerium für Arbeit und Soziales geförderte Deutsche
Institut für Interdisziplinäre Sozialpolitikforschung (DIFIS)
der Universitäten Duisburg-Essen und Bremen führt seit seiner
Gründung im Jahr 2021 vielfältige Aktivitäten mit Bezug zur
sozialpolitischen Forschung, Lehre und Politikberatung in
Deutschland durch. Es greift gesellschaftliche
Herausforderungen auf und forscht zur Weiterentwicklung des
Sozialstaates und der sozialen Sicherung.
Für den
neuesten IAQ-Report hat das DIFIS-Team unter der Leitung von
Tom Heilmann innerhalb von 1,5 Jahren rund 50
Expert:inneninterviews mit Akteuren aus Wissenschaft,
Politik, öffentlicher Verwaltung und Zivilgesellschaft zu
deren Erwartungen an die Sozialpolitikforschung geführt.
Die Erwartungen sind hoch, weil auch die
Herausforderungen, vor denen die deutsche Sozialpolitik
steht, komplex und vielfältig sind. Zahlreiche übergreifende
und miteinander verwobene Entwicklungen wie der Klimawandel,
die Alterung der Gesellschaft, der technologische Wandel
sowie zunehmende inner- und zwischenstaatliche Konflikte
treffen auf ein ausdifferenziertes, aber auch fragmentiertes
System sozialer Sicherung.
Die befragten Expert:innen
setzten ihre Hoffnungen deshalb insbesondere auf den
Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis. Tom Heilmann,
identifiziert im IAQ-Report vier idealtypische
Transferverständnisse, die mit je unterschiedlichen
Erwartungen an das Verhältnis von Wissenschaft und Praxis
verknüpft sind.
„Das institutionalisierte
Bewertungssystem der Wissenschaft honoriert vor allem
theoretisch und methodisch ausgefeilte Untersuchungen. Diese
lassen sich in der Regel zwar besser in begutachteten
Zeitschriften unterbringen, sind aber für Praxisakteure oft
weniger relevant. Viele der interviewten
Sozialpolitikforschenden versuchen deshalb aktiv, auch
praxisorientiertere Forschung zu betreiben“, so Heilmann.
Von den Interviewten aus Politik, Verwaltung und
Zivilgesellschaft wird genau das auch eingefordert: Sie
erwarten von der Sozialpolitikforschung in erster Linie
Ergebnisse, die sich stärker auf Fragen der unmittelbaren
Politikgestaltung und weniger auf die Weiterentwicklung
theoretischer und methodischer Modelle beziehen. Heilmann
weiter: „Davon abgesehen zeigt sich, dass die verschiedenen
Akteure Wissenstransfer, entgegen aktuellen
wissenschaftspolitischen Debatten, häufig als ‚Einbahnstraße‘
von der Forschung in die Praxis verstehen. Transferformate,
die auf einen gegenseitigen und multidirektionalen Austausch
zwischen sozialpolitischer Forschung und Praxis abzielen,
werden dagegen weniger häufig genannt und umgesetzt.“
Der Soziologe zieht daraus den Schluss, dass die Vielfalt der
Transferverständnisse zwischen Wissenschaft und Praxis auch
in der wissenschaftspolitischen Debatte anerkannt werden
sollte: „Unterschiedliche Arten des
Wissenschaft-Praxis-Transfers sind immer auch mit
unterschiedlichen Funktionen und Zielsetzungen verknüpft.
Wie ein ‚guter‘ Wissenstransfer aussieht, ist immer auch
kontextabhängig. Bevor undifferenzierte Forderungen nach
‚mehr Wissenstransfer‘ gestellt werden, sollte daher geklärt
werden, welche Ziele und Erwartungen im konkreten Fall durch
den Transfer erfüllt werden sollen“, erläutert Heilmann.
Ein erfolgreicher Wissenstransfer setze außerdem voraus,
dass sowohl Forschende als auch Praxisakteure die jeweiligen
Arbeitsweisen und Systemlogiken der anderen Seite verstehen
und anerkennen. Darüber hinaus stellt sich die Frage, wer die
notwendigen Ressourcen für einen intensiveren und
strukturierteren Wissenstransfer bereitstellen soll und kann.
Das DIFIS will durch konzeptionelle Arbeit, aber auch durch
praktische Vernetzungsaktivitäten zu einer Verbesserung des
Wissenschaft-Praxis-Transfers in der deutschen Sozialpolitik
beitragen.
|
|
Biodiversität in europäischen Flüssen |
|
Ausbreitungsfähigkeit beeinflusst Erholung der Artenvielfalt
Duisburg, 4. Februzar 2025 - Schadstoffe aus Industrie,
Haushalten und Landwirtschaft setzen unseren Flüssen zu.
Obwohl zahlreiche Renaturierungsmaßnahmen in der
Vergangenheit die Wasserqualität verbessert und eine
teilweise Erholung der Artenvielfalt ermöglicht haben, ist
dieser positive Trend ins Stocken geraten. Ein
internationales Forschungsteam unter der Leitung von Prof.
Dr. Peter Haase (Senckenberg/Universität Duisburg-Essen)
identifiziert in einer aktuellen Studie die
Ausbreitungsfähigkeit der Arten als wichtigen Faktor für die
Wiederbesiedlung renaturierter Flüsse. Die Ergebnisse wurden
kürzlich im Fachjournal Global Change Biology veröffentlicht.
Bereits 2023 wies das Team um Prof. Dr. Peter Haase in
einer vielbeachteten Nature-Publikation darauf hin, dass die
Rückkehr der Artenvielfalt trotz verbesserter
Gewässerqualität seit 2010 stagniert. Nun liefern die
Forschenden eine Erklärung: „Die Ausbreitungsfähigkeit ist
ein wichtiger Schlüssel“, so Haase. „Sie bestimmt, ob eine
Art neue oder renaturierte Lebensräume besiedeln kann – sei
es durch aktive Bewegung wie Schwimmen oder Fliegen oder
durch passive Verbreitung, etwa über die Strömung. Diese
Fähigkeit beeinflusst maßgeblich die genetische Durchmischung
und die Widerstandsfähigkeit gegenüber Umweltveränderungen.“
Für die Studie wertete das Forschungsteam Daten aus 1327
Zeitreihen von 1968 bis 2021 aus, die 23 europäische Länder
umfassen. Die Analyse zeigt: In sich erholenden Flüssen nahm
die Artenvielfalt zu, insbesondere bei Arten mit hoher
Ausbreitungsfähigkeit – darunter schwimmende und driftende
Tiere sowie Insekten mit großen Flügeln wie Schwimmkäfer und
Köcherfliegen. In sich verschlechterten Gewässern hingegen
schrumpfte die Artenzahl, und der Anteil gut
ausbreitungsfähiger Arten sank.
Allerdings variierte
dieser Trend lokal und nicht überall führte eine bessere
Wasserqualität zu einer Rückkehr stark mobiler Arten. „Damit
Renaturierungen erfolgreicher werden, sollten Schutzmaßnahmen
die Landschaftsvernetzung stärken, um Lebensräume besser zu
verbinden. Dies gilt insbesondere für die Anbindung
artenreicher „Quell-“ Populationen, die eine wichtige Rolle
für eine erfolgreiche Wiederbesiedlung spielen. Angesichts
des Klimawandels sind zudem flexible Strategien nötig, um
sich an die veränderten Umweltbedingungen anzupassen, die
Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme zu verbessern und die
langfristige Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen zu
gewährleisten“, sagt Dr. Carlos Cano-Barbacil, Erstautor der
Studie und Postdoc in Haases Arbeitsgruppe. '''
|
|
KI gegen Krebs: Forschende der Universität
Duisburg-Essen erreichen Meilenstein in der Personalisierten Medizin
|
|
Duisburg, 1. Februuar
2025 -
Wie können Krebsbehandlungen individuell auf einzelne Patientinnen
und Patienten abgestimmt werden? In der sogenannten Personalisierten
Medizin konnten Forschende unter Beteiligung der Universität
Duisburg-Essen (UDE) nun einen neuen Lösungsansatz entwickeln:
Gegenüber starren Bewertungen, wie beispielsweise der Einteilung in
Tumorstadien, konnten die Forschenden mithilfe Künstlicher
Intelligenz (KI) verschiedene Quellen – medizinische Vorgeschichte,
Laborwerte, Bildgebung und genetische Analysen – zusammenführen und
daraus eine Gesamtprognose für jeden einzelnen Erkrankten ermitteln.
Die KI wurde mit Daten von über 15.000 Patientinnen und
Patienten mit insgesamt 38 verschiedenen Tumorerkrankungen
"gefüttert". Dabei wurde das Zusammenspiel von 350 Parametern
untersucht, darunter klinische Daten, Laborwerte, Daten aus
bildgebenden Verfahren und genetische Tumorprofile. Das KI-Modell
wurde dann erfolgreich anhand der Daten von über 3.000
Lungenkrebspatienten überprüft, um die gefundenen Wechselwirkungen
zu validieren. idr
|
|
Wochen der Studienorientierung
Einblick in Studiengänge
|
|
Duisburg, 30. Januar
2025 - Noch bis zum 7. Februar finden an der Universität
Duisburg-Essen die NRW-weiten Wochen der Studienorientierung
statt. In den kommenden Tagen geht es vor allem um
Studiengänge – von A wie Angewandter Informatik bis hin zu W
wie Wirtschaftspädagogik.
Welche Fächer und
welche Ausbildungsberufen gibt es? Schüler:innen können
täglich zwischen 15 und 18 Uhr digitale Vorträge und
Veranstaltungen vor Ort besuchen. Programm, Infos sowie die
Anmeldemöglichkeiten:
https://www.uni-due.de/abz/studieninteressierte/wochen_der_studienorientierung.php
|
|
Hausärztliche
Versorgung: Projekt zur Gesundheitsförderung vor Ort
gestartet
|
|
Duisburg, 27. Januar
2025 - Vertreter:innen von 6 Universitäten aus
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg
haben das Forschungsprojekt „Positive Health Innovation“
gestartet. Beteiligt sind auch Wissenschaftler:innen der
Universität Duisburg-Essen. Die Forschenden möchten die
Qualität der Vorsorge und Gesundheitsförderung vor Ort in
Praxen von Hausärzt:innen verbessern.

UK Essen / Hausarztpraxis Mortsiefer und Breer Köln
Die Grundlage bildet das Konzept zur „Positiven
Gesundheit“, das die niederländische Ärztin und Forscherin
Dr. Machteld Huber entwickelt hat. Das Vorhaben koordinieren
Forschende der Universität Witten/Herdecke. Es wird durch den
Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses mit 2,5
Millionen Euro über 3 Jahre gefördert. Das Team am
Forschungsstandort Essen erhält davon rund 500.000 Euro.
Durch das „Positive Health“-Konzept werden Patient:innen
motiviert, mehr Verantwortung für ihre Gesundheit zu
übernehmen. Mithilfe eines Spinnennetz-Diagramms lernen sie,
ihre Gesundheit in sechs Bereichen einzuschätzen und zu
bewerten. Das Diagramm unterstützt Patient:innen dabei, mit
ihrer Ärztin oder ihrem Arzt individuelle Gesundheitsziele zu
entwickeln und die nächsten Schritte festzulegen.
„Ziel unserer Forschung in Essen ist, die hausärztlich
initiierte Gesundheitsförderung vor Ort in den Praxen zu
stärken sowie Schnittstellenprobleme zwischen Hausärzt:innen
und lokalen Unterstützungsangeboten zu überwinden“, sagt Dr.
Philip Schillen, Leiter des Essener Teilprojekts
„PositiveHealth – Entwicklung und Pilotierung eines neuen
Dialogs zur Gesundheitsförderung in der Primärversorgung“.
Im Zuge der Auswertung soll festgestellt werden,
wie Hausärzt:innen gemeinsam mit Vertreter:innen von
bestehenden Gesundheitsnetzen dazu beitragen können, dass es
Patient:innen besser geht und ein gesundheitsförderndes
Umfeld geschaffen werden kann. Für das Forschungsteam in
Essen liegt ein Arbeitsschwerpunkt auf der Einführung des
Beratungskonzepts in den Gesundheitsnetzen der drei
Studienzentren des Projekts. Innerhalb Essens untersucht das
Team die Gesundheitsversorgung nördlich der Autobahn A40.
Mit einer Positive-Health-Beratung können sehr
unterschiedliche gesundheitlich relevante Bedürfnisse
identifiziert werden. Eine wichtige Rolle spielt die
Vermittlung psychosozialer Hilfen, beispielsweise durch die
Unterstützung von sozialer Interaktion im Viertel oder durch
Vermittlung einer Beratung bei Überschuldung oder
Drogenabhängigkeit.
„Mit unseren Erkenntnissen
möchten wir dazu beitragen, dass Patient:innen auf sie
passende Angebote im Stadtteil stärker als bislang nutzen“,
ergänzt Projektleiter Dr. Schillen, der am Institut für
Allgemeinmedizin des Universitätsklinikums Essen arbeitet.
Das Konzept sieht Lotsen in den Gesundheitsnetzen vor, die
beteiligte Hausärzt:innen und Patient:innen bei der Umsetzung
unterstützen.
|
|
Fünf Jahre Europäische
Hochschulallianzen: Mobilität der Studierenden deutlich
gestiegen
|
|
Brüssel, 24.
Januar 2025 - Zum internationalen Tag der Bildung hat die
EU-Kommission Schlüsseldaten zur frühkindlichen Bildung
und Betreuung vorlegt und eine Bilanz der Initiative
„Europäische Universitäten“ gezogen.
Roxana
Mînzatu, Exekutiv-Vizepräsidentin der EU-Kommission und
zuständig für soziale Rechte und Kompetenzen, hochwertige
Arbeitsplätze und Vorsorge, sagte: „Der Europäische
Bildungsraum ist ein Ort, an dem jeder sein Recht auf
Zugang zu einer qualitativ hochwertigen allgemeinen und
beruflichen Bildung wahrnehmen kann, von klein auf bis
zur Hochschulbildung und darüber hinaus, unabhängig von
der sozialen Herkunft.
An diesem Internationalen
Tag der Bildung möchte ich mein Engagement bekräftigen,
in den nächsten fünf Jahren mit allen EU-Mitgliedstaaten
Hand in Hand zu arbeiten und den Aufbau einer besseren,
gleichberechtigten und zugänglichen Bildung
fortzusetzen.“
Europäische
Hochschulallianzen: Anstieg der Studierendenmobilität um
400 Prozent Der Bericht skizziert die Fortschritte und
Errungenschaften der Europäischen
Hochschulallianzen fünf
Jahre nach ihrem Start. Die Hochschulallianzen sind
bereits ein Eckpfeiler des europäischen Hochschulsystems.
Allein in den ersten drei Jahren verzeichneten sie einen
Anstieg der Studierendenmobilität innerhalb der Allianzen
um 400 Prozent.
Derzeit gibt es 65 Allianzen,
an denen über 570 Hochschuleinrichtungen aus 35 Ländern,
darunter alle Mitgliedstaaten, beteiligt sind.
Aus Deutschland sind insgesamt 67Hochschulen an den 65
geförderten Allianzen beteiligt. Damit ist Deutschland
einer der Spitzenreiter bei der Beteiligung an der
Initiative.
Flaggschiff-Initiative der
Europäischen Hochschulstrategie der EU-Kommission
Die Hochschulallianzen bilden ein neues Modell der
transnationalen Zusammenarbeit in der Hochschulbildung
mit einer langfristigen strategischen Perspektive. Die
europäischen Hochschulallianzen haben erfolgreich
europäische interuniversitäre Campus geschaffen, in denen
Studierende grenzüberschreitend studieren und
zusammenarbeiten und von innovativen Lern- und
Lehrmethoden profitieren.
Schlüsseldaten zur
frühkindlichen Bildung und Betreuung Darüber hinaus hat
die Kommission neue Schlüsseldaten zur frühkindlichen
Bildung und Betreuung (FBBE) veröffentlicht, die eine
umfassende eingehende Analyse des Stands der FBBE, der
Politik, der Praxis und der Trends in 37 europäischen
Ländern bietet. Der Bericht zeigt, dass bei der
Ausweitung des Zugangs zu FBBE Fortschritte erzielt
wurden.
Allerdings sind die Unterschiede
zwischen den Ländern nach wie vor groß sind, auch was die
Qualität der Dienstleistungen betrifft. Zwei Drittel der
europäischen Länder berichten über einen Mangel an
Fachkräften in der FBBE. Die zeigt den dringenden Bedarf
an verbesserten Arbeitsbedingungen und verstärkter
beruflicher Weiterbildung deutlich macht, um
qualifizierte Erzieherinnen und Erzieher zu gewinnen und
zu halten. Der Bericht untersucht auch die
ECEC-Lehrpläne: Die meisten europäischen Länder beziehen
die Erziehung zur Nachhaltigkeit und die Entwicklung
digitaler Kompetenzen mit ein.
|
|
Gewässerreinigung mit Algen:
Chemischer Verschmutzung bekämpfen
|
|
Duisburg, 24. Januar
2025 - Europas Gewässer sind in schlechtem Zustand: Über die
Hälfte von ihnen ist chemisch stark belastet. Kein Wunder –
täglich werden in Europa in Industrie und Landwirtschaft bis
zu 70.000 verschiedene Chemikalien eingesetzt. Forschende der
Universität Duisburg-Essen haben jetzt eine neue Methode
entwickelt, um verschmutzte Gewässer zu reinigen.
Ihre aktuelle Studie zeigt*, dass fossilen Überresten von
Kieselalgen (Diatomeen) Schadstoffe effizient aus dem Wasser
entfernen können, nachdem sie chemisch modifiziert wurden.
Nahaufnahme der Kieselalgen aus der Algensammlung der
Universität Duisburg-Essen, Gut zu erkennen sind
unterschiedliche Porengrößen. Copyright: UDE/Arbeitsgruppe
Phykologie/CCAC
Über 500 Chemikalien finden Forschende
in Europas Flüssen, sie gelangen durch Industrie und
Landwirtschaft ins Gewässer und bedrohen die aquatischen
Lebensräume. Das Team um Juniorprofessorin Dr. Anzhela
Galstyan will die Chemikalien jetzt mit Algen beseitigen.
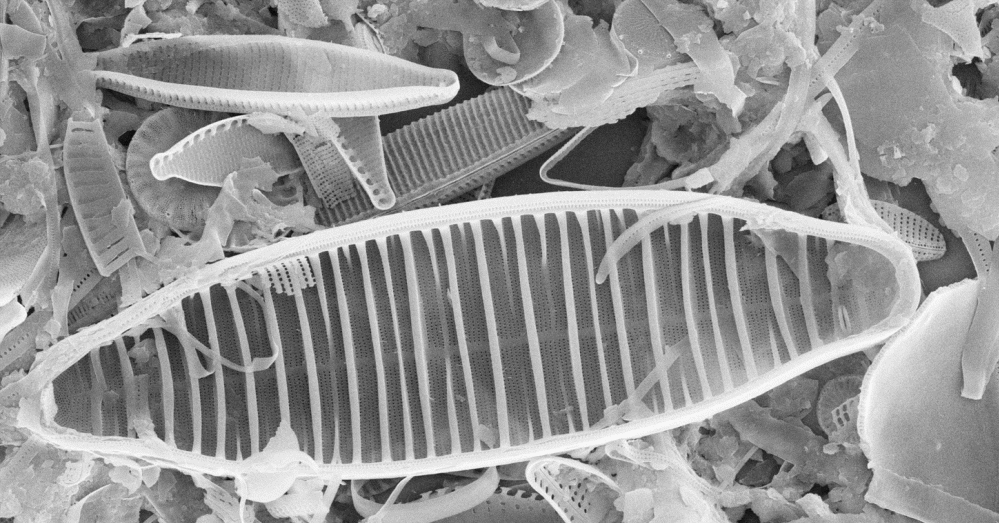
Nahaufnahme der Kieselalgen aus der Algensammlung der
Universität Duisburg-Essen, Gut zu erkennen sind
unterschiedliche Porengrößen. Copyright: UDE/Arbeitsgruppe
Phykologie/CCAC
Kieselalgen sind mikroskopisch
kleine einzellige Organismen, die in Gewässern leben und eine
Zellwand aus Kieselsäure (Siliziumdioxid) besitzen. Dank
seiner porösen Struktur kann es eine Vielzahl von
Schadstoffen aufnehmen“, erklärt Galstyan.
In der
Studie testeten die Forschenden Kieselalgenschalen an zwei
exemplarischen Schadstoffen, die häufig aus der
Textilindustrie in Flüsse und Grundwasser gelangen:
Methylenblau und Methylorange. Um die Adsorptionsfähigkeit zu
verbessern, wurde das Kieselgur chemisch modifiziert, indem
seine Oberfläche mit speziellen funktionellen Gruppen
versehen wurde. „Das könnte problemlos auch in industriellem
Maßstab umgesetzt werden“, betont die Juniorprofessorin für
Nanomaterialien in aquatischen Systemen.
Im Labor
wurde das Kieselgur unter verschiedenen Bedingungen getestet,
etwa bei unterschiedlichen Salzkonzentrationen und pH-Werten.
Die Ergebnisse sind gut: Unabhängig von den Bedingungen
entfernte das Material die Schadstoffe gleichbleibend
effektiv.
Zum Vergleich zogen die Forschenden
Silica heran, ein Material, das bereits in der
Wasserreinigung etabliert ist. Kieselgur schnitt deutlich
besser ab: Nach einer Stunde wurden bis zu 100 Prozent des
Methylenblaus entfernt, das Silicia hingegen entfernte in der
selben Zeit nur 88% des Farbstoffs. Beim Methylorange nahmen
sowohl Silica als auch Kieselgur etwa 70 Prozent des
Schadstoffs auf.
„Wir sehen in Kieselgur eine
umweltfreundliche und kostengünstige Lösung zur
Wasseraufbereitung“, resümiert Galstyan. Der große Vorteil:
Algen sind ein nachwachsender Rohstoff und lassen sich mit
minimalem Energieaufwand züchten – ganz im Gegensatz zum
etablierten Filtermaterial Aktivkohle.
Nun prüfen die
Forschenden, wie Kieselgur in Membranen zur Wasserreinigung
eingesetzt werden kann. Dank der weltweit größten
Algensammlung, die an der Universität Duisburg-Essen
beheimatet ist, sind die Voraussetzungen für die Entwicklung
dieser umweltfreundlichen Technologie optimal.
* C. A.
Ojike, V. Hagen, B. Beszteri, A. Galstyan,
Surface-Functionalized Diatoms as Green Nano-Adsorbents for
the Removal of Methylene Blue and Methyl Orange as Model Dyes
from Aqueous Solution. Adv. Sustainable Syst. 2025, 2400776.
https://doi.org/10.1002/adsu.202400776
|
|
Algenforschung im
Teilchenbeschleuniger: Kooperation mit dem Lawrence Berkeley
National Laboratory
|
|
Duisburg, 24. Januar
2025 -
Die Universität Duisburg-Essen beherbergt mit über
7.000 Stämmen die größte Algensammlung der Welt. Nun wird die
Sammlung am Teilchenbeschleuniger Advanced Light Source des
Lawrence Berkeley National Laboratory mittels
Infrarotspektroskopie untersucht.
So wollen die
Forschenden die chemische Zusammensetzung der Algenzellen
entschlüsseln und herausfinden, welche Biomoleküle sie
produzieren. Algen stellen beispielsweise Biomoleküle in Form
von Lipiden her, die als nachhaltiger Energieträger genutzt
werden können.

Der Teilchenbeschleuniger Advanced Light Source von
innen. Copyright: UDE/Alexander Probst
Algen gelten
als wahre Multitalente der Natur. Sie können Kohlendioxid in
organische Materie umwandeln und tragen somit zur Bekämpfung
des Klimawandels bei. Einige Algen wie zum Beispiel Chlorella
produzieren besonders viele Lipide, aus denen Biokraftstoff
hergestellt werden kann.
Prof. Dr. Alexander Probst
und Dr. Andre Soares von der Universität Duisburg-Essen
(UDE), wollen mithilfe der Infrarot-Spektroskopie genau
herausfinden, welche Biomoleküle von den Algen produziert
werden. „Wir möchten Algen identifizieren, die sich für
biotechnologische Anwendungen eignen, beispielsweise zur
Herstellung von Biokraftstoffen“, erklärt Probst. Der
Teilchenbeschleuniger in Berkeley eignet sich hierfür
besonders gut, da er extrem reines Infrarotlicht produziert,
das Hintergrundrauschen in Messungen minimiert.
Darüber hinaus widmet sich das Team auch der
Grundlagenforschung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der
Analyse, wie Algen mit anderen Organismen, etwa Bakterien,
interagieren. Diese Erkenntnisse könnten wertvolle Einblicke
in die Ökologie und Funktionalität von Algen liefern.
Bereits im Jahr 2024 hatte das Team der UDE in Zusammenarbeit
mit dem renommierten Joint Genome Institute des Lawrence
Berkeley National Laboratory (LBL) den ersten Schritt zur
Entschlüsselung des Erbguts von mehr als 100 Stämmen in der
Algensammlung gemacht. Durch die Kombination der
Genomanalysen mit der hochauflösenden Infrarot-Spektroskopie
am Teilchenbeschleuniger eröffnen sich nun völlig neue
Möglichkeiten: „Die Kombination aus Genomanalyse und der
IR-Spektroskopie am Teilchenbeschleuniger ist unschlagbar“
betont Probst. „Wir entschlüsseln nicht nur die genetischen
Baupläne der Algen, sondern können gleichzeitig feststellen,
welche Biomoleküle sie produzieren.“
Die
Untersuchungen an der Advanced Light Source in Berkeley
begannen am 1. Januar 2025 und werden bis Ende Juni 2025 vor
Ort durchgeführt, wobei viele Anschlussanalysen und lange
Perioden der Datenauswertung geplant sind. Diese
Zusammenarbeit stellt einen bedeutenden Meilenstein für die
international anerkannten Wasserforschung der UDE dar und
spiegelt die Interdisziplinarität des Forschungsschwerpunktes
wider.
|
|
Planetenentstehung: Wachstum durch Kollision |
|
Duisburg, 22. Januar 2025 - Planeten
entstehen, indem Staub und Gestein in einer Scheibe um einen
jungen Stern kollidieren und sich zu immer größeren Körpern
verbinden. Diese so genannte Akkretion ist bislang nicht
vollständig verstanden. Astrophysiker der UDE konnten durch
Experimente in einer Forschungsrakete wesentliche
Beobachtungen zu Kollisionsgeschwindigkeit und elektrischer
Ladung der Partikel machen. Ihre Ergebnisse wurden soeben in
Nature Astronomy* veröffentlicht.
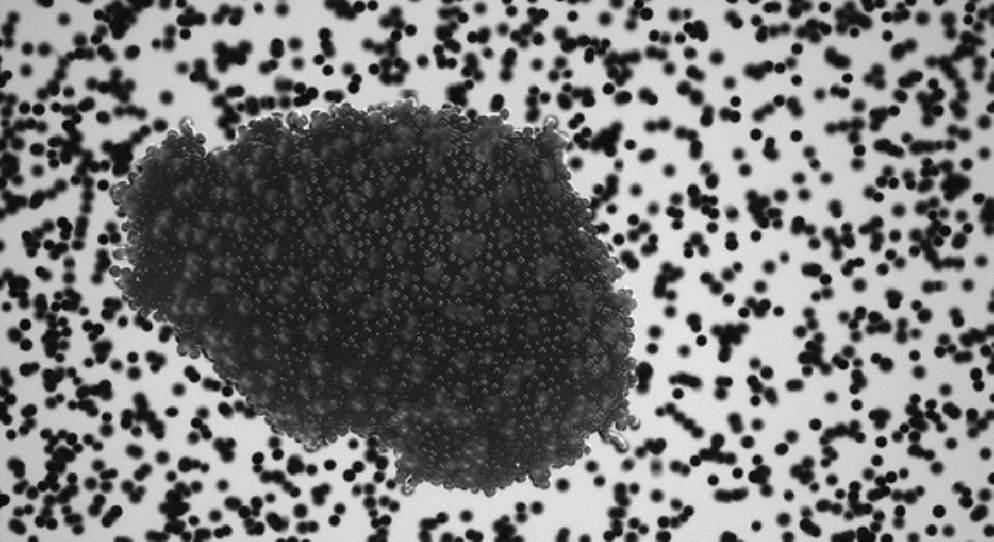
Geladene Partikel haben sich zu einem Agglomerat verbunden.
AG Wurm / UDE
Bis aus einem mikrometerfeinen Staubkorn
ein Planet mit einem Ausmaß von 10.000 Kilometern wird,
vergehen Millionen von Jahren. Alles beginnt in einer
scheibenförmigen Wolke aus Gas (99%) und Staub (1%), der
protoplanetaren Scheibe: Hier stoßen die Staubpartikel
zusammen und bilden Agglomerate. Wolken dieser Agglomerate
kollabieren schließlich zu größeren Körpern, die
Planetesimale genannt werden und bereits einen Durchmesser
von ein bis hundert Kilometer haben können. Durch Gravitation
ziehen die Planetesimale weitere Materie an, wachsen zu
Protoplaneten und später zu vollwertigen Planeten heran.
Bei den Vorgängen in der Scheibe setzen die Partikel
eine Kollisionsbarriere außer Kraft. „Eigentlich ist es
nämlich so, dass Staubkörner ab etwa einem Millimeter Größe
gar nicht wachsen können, weil sie voneinander abprallen oder
sie beim Zusammenstoß zerbrechen“; erklären die Astrophysiker
Prof. Dr. Gerhard Wurm und PD Dr. Jens Teiser. „Dadurch aber,
dass sie immer wieder kollidieren, laden sie sich
unterschiedlich auf und ziehen sich dann gegenseitig an.“
Die Haftung durch elektrostatische Aufladung hatte
ihr Team schon in vorherigen Fallturmexperimenten beobachtet.
Weil dabei nur knappe neun Sekunden Messzeit in
Schwerelosigkeit möglich sind, konnten sie die finale Größe
und die Stabilität der wachsenden Körper nicht untersuchen.
Ganz anders in den Experimenten der aktuellen Studie: Sie
fanden auf einer Forschungsrakete der Europäischen
Weltraumorganisation ESA statt. „Während die Rakete auf 270
Kilometer Höhe aufstieg, bot sie uns sechs Minuten
Schwerelosigkeit, unsere Experimente vom Boden aus zu steuern
und zu verfolgen“, so Teiser.
Das UDE-Team
konnte dadurch das Wachstum von kompakten Agglomeraten von
etwa drei Zentimetern Größe direkt beobachten und genau
messen, mit welcher Geschwindigkeit einzelne Partikel
höchstens aufprallen dürfen, um nichts zu zerstören.
„Die Agglomerate sind so stabil, dass sie den Beschuss von
einzelnen Partikeln mit bis zu 0,5 Meter pro Sekunde
aushalten. Alles darüber hinaus erodiert“, betont
Astrophysiker Wurm. „Zusätzlich haben wir numerische
Simulationen durchgeführt, die zeigen, dass es durch die
Kollisionen tatsächlich zu einer starken elektrostatischen
Aufladung und Anziehung kommt.“
„Derart konkrete
Geschwindigkeiten für Erosion zu finden, hat uns überrascht“,
ergänzt Teiser. „vor allem da sie nahe an jenen Werten
liegen, die in früheren Simulationen für die Fragmentation
verwendet wurden, also für das Zerbrechen von Partikeln oder
Objekten.“ Das heißt, dass die physikalischen Bedingungen
ähnlich sind, unter denen Material in der scheibenförmigen
Wolke um einen jungen Stern abgetragen oder zerbrochen wird.
Die Ergebnisse des UDE-Teams fließen in physikalische
Modelle zu protoplanetaren Scheiben und zum Partikelwachstum
ein und helfen somit, die Details der Planetenbildung zu
verstehen.
Die Forschungen wurden vom Deutschen
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) sowie vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Klima gefördert.
|
|
Luftlinie versus Straßennetz
Universeller Zusammenhang gefunden
|
|
Essen/Duisburg, 21. Januar 2025 - Die
direkte Verbindung zwischen zwei Orten per Luftlinie ist in
der Regel kürzer als der Weg, den man per Auto zurücklegen
muss. Zwei Physik-Arbeitsgruppen der Universität
Duisburg-Essen haben nun herausgefunden: Die Entfernung
zwischen zwei Orten in einem Autobahn-Netzwerk ist
typischerweise 1,3-mal länger als deren Verbindung per
Luftlinie.
Ihre tatsächlich neue Erkenntnis
basiert auf einer umfangreichen Analyse von Daten aus Europa,
Asien und Nordamerika und wurde veröffentlicht im Fachmagazin
npj
Complexity. Durchgeführt wurde die Studie von den
Arbeitsgruppen Statistische Physik komplexer Systeme um Prof.
Thomas Guhr sowie Physik von Transport und Verkehr unter der
Leitung von Prof. Michael Schreckenberg.
Sie
ermittelten die Entfernung zwischen etwa 2.000 Orten
innerhalb von Frankreich, Deutschland, Spanien, China und den
USA. Dazu verwendeten sie frei nutzbare Geodaten und
verglichen die Streckenlänge über das Autobahnnetz mit der
jeweiligen geodätischen Entfernung – der direkten Verbindung
zwischen zwei Orten, wie ein Vogel sie fliegen könnte.
Sie fanden heraus, dass das Verhältnis der beiden
Strecken recht universell ist: Die Strecke per Auto ist in
der Regel 1,3 (± 0,1) mal länger als die Luftlinie. „Dieses
stabile Verhältnis über Länder und Kontinente hinweg ist das
Ergebnis zweier gesellschaftlicher Bedürfnisse, die
miteinander konkurrieren“, erklären die Leiter der Studie.
„Zum einen möchten wir schnell und effizient an unser Ziel
gelangen, zum anderen möchten wir Kosten und
Umweltauswirkungen so gering wie möglich halten.“
Aus ihren Erkenntnissen wurde ein neues Modell für die
Planung von Autobahn-Netzwerken abgeleitet, das sie als
"teilweise zufälliges Autobahn-Netzwerk" bezeichnen. Es
basiert auf der Idee, bestehende Verbindungen effizient zu
nutzen, indem benachbarte Regionen schrittweise verbunden
werden. Der zufällige Teil des Modells besteht darin, gewisse
Verbindungen zwischen Städten und Orten im Autobahn-Netzwerk
nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit herzustellen.
Definierte Regeln stellen dabei logische Verbindungen
und eine gute Vernetzung sicher. Das Modell könnte künftig
die Effizienz von Verkehrswegen verbessern und gleichzeitig
deren Umweltauswirkungen verringern.
|
|
Duisburger Forscher wird
neuer Präsident der Nordrhein-Westfälischen Akademie der
Wissenschaften und der Künste
|
|
Essen/Duisburg, 21. Januar 2025 - Die
Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der
Künste hat einen neuen Präsidenten: Der emeritierte
Universitätsprofessor der Universität Duisburg-Essen (UDE)
Prof. Dr. Gerd Heusch hat die dreijährige Amtszeit
übernommen. Prof. Heusch zählt zu den führenden Köpfen der
Herz-Kreislauf-Forschung.
1989 übernahm er die
Leitung des Instituts für Pathophysiologie an der UDE, die er
mehr als drei Jahrzehnte innehatte. Von 2014 bis 2022 war er
zudem Wissenschaftlicher Vorstand des Westdeutschen Herz- und
Gefäßzentrums in Essen. Darüber hinaus ist er Mitglied
zahlreicher weiterer Fachgesellschaften, darunter die
Deutsche Gesellschaft für Kardiologie (DGK), deren Präsident
er von 2007 bis 2009 war, und die European Society of
Cardiology (ESC).
Die Nordrhein-Westfälische
Akademie der Wissenschaften und der Künste ist eine
Vereinigung führender Forscherinnen und Forscher. Diese
pflegen den wissenschaftlichen und künstlerischen
Gedankenaustausch untereinander sowie mit Vertreterinnen und
Vertretern des politischen, wirtschaftlichen und
künstlerischen Lebens. idr
|
|
Mitarbeiter:innen entlasten,
Unfälle verhindern: Projekt zur Digitalisierung von
Tanklagern gestartet
|
|
Duisburg, 17. Januar
2025 - Tanklager spielen eine wichtige Rolle für zahlreiche
Industriezweige. Da sie aus logistischen Gründen häufig in
der Nähe von Gewässern liegen, hat die Unfallprävention
oberste Priorität. Denn allein 2023 gab es mehr als 900
Gewässerverunreinigungen durch austretende Stoffe, darunter
war 46-mal das Grundwasser betroffen. Mit dem Projekt
DigiTank will die Evos GmbH Hamburg mit der
wissenschaftlichen Expertise der Universität Duisburg-Essen
die Digitalisierung der Tanklager stärken und damit deren
Sicherheit erhöhen.*

Ein Mitarbeiter überprüft Rohrleitungen im Tanklager optisch
und manuell – noch. © Evos GmbH Hamburg
Das Projekt
DigiTank: Digitaler Tanklagerbetrieb – sicher,
umweltfreundlich und menschenzentriert ist am Donnerstag, 16.
Januar, mit einer Auftaktveranstaltung in Hamburg gestartet.
Gefördert wird es mit fast 4 Mio. Euro für vier Jahre
innerhalb des Förderprogramms für Innovative
Hafentechnologien (IHATEC II) vom Bundesministerium für
Digitales und Verkehr.
Herzstück des Vorhabens ist die
Entwicklung eines digitalen Zwillings des Tanklagers, der in
einen innovativen Leitstand integriert ist, sowie mobile
Überwachungssysteme inklusive Drohnen. Gemeinsam sollen die
Technologien Mitarbeitende in Tanklagern entlasten, die
Sicherheit erhöhen und somit auch den Umweltschutz
verbessern.
Die Universität Duisburg-Essen (UDE)
beteiligt sich mit zwei Arbeitsgruppen am Projekt: Die
Projektleitung liegt bei Dr. Magnus Liebherr aus dem
Lehrstuhl für Mechatronik, ebenfalls beteiligt ist der
Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und
Mobilität um Prof. Dr. Ellen Enkel – das Zentrum für Logistik
und Verkehr (ZLV), ein An-Institut der UDE, ist als
assoziierter Partner beratend dabei.
Die Forschenden
der UDE verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz, der
gleichermaßen Mensch und Technik in den Fokus rückt: Der
Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung eines
menschenzentrierten Leitstands, dessen Systeme individuell an
die Bedürfnisse der Mitarbeitenden angepasst werden können.
Mithilfe Künstlicher Intelligenz werden Muster in
Tanklagerdaten analysiert, Anomalien frühzeitig erkannt und
dadurch die Sicherheit und Effizienz der Systeme verbessert.
Parallel dazu werden Strategien erarbeitet, die sowohl die
Akzeptanz der neuen Technologien fördern als auch die
Motivation der Mitarbeitenden im Umgang mit den innovativen
Systemen stärken.
„Bisher sind menschliche
Überwachungsprozesse im Tanklager essenziell, aber
zeitintensiv und fehleranfällig. Mit DigiTank setzen wir auf
modernste Technologien: Drohnen und roboterbasierte Systeme
erkennen Leckagen oder Schwachstellen frühzeitig und senden
präzise Warnmeldungen. Im künftigen menschenzentrierten
Leitstand arbeiten Mensch und Technologie Hand in Hand – ein
Ansatz, der nicht nur die Sicherheit und Effizienz erhöht,
sondern den Arbeitsplatz im Tanklager auch zukunftsfähig und
attraktiver gestaltet,“ sagt Dr. Magnus Liebherr.
Wie
dringlich derartige Maßnahmen sind, zeigt der Blick auf die
Statistik: Trotz stetig weiterentwickelter
Präventionsmaßnahmen kommt es nach wie vor zu einer hohen
Anzahl von Vorfällen mit wassergefährdenden Stoffen: Im Jahr
2023 wurden durch Unfälle rund 21 Millionen Liter
wassergefährdende Stoffe freigesetzt – 3,3 Millionen Liter
konnten nicht zurückgewonnen werden und verblieben dauerhaft
in der Umwelt.
* Weitere Projektbeteiligte sind die
Schotte Automotive GmbH & Co.KG, der Hafen Hamburg Marketing
e.V., die ma-co maritimes competenzcentrum GmbH sowie der
Unabhängige Tanklagerverband e.V.
|
|
Seilroboter an Universität Duisburg-Essen vorgeführt:
Automatisierte Baustelle entlastet Fachkräfte
|
|
Duisburg, 16. Januar
2025 - Ein Seilroboter, der eigenständig Mauern errichtet und
Zwischendecken einzieht, könnte Baustellen revolutionieren:
Nicht mehr Menschen, sondern Maschinen führen dann die
künftig digitalisierte Planung aus. Am 16. Januar
demonstrierten Forschende der Universität Duisburg-Essen die
von ihnen entwickelte Technologie vor Staatssekretär Daniel
Sieveke, Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und
Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen, Rektorin
Prof. Dr. Barbara Albert sowie Medienvertreter:innen.

V.l.n.r: Prof. Dr.-Ing. Tobias Bruckmann, Rektorin Prof. Dr.
Barbara Albert, Staatssekretär Daniel Sieveke, Prof. Dr.-Ing.
Alexander Malkwitz, Prof. Dr.-Ing. Dieter Schramm und Dr.
Aileen Pfeil bei der Vorführung des Seilroboters. Copyright:
UDE/Birte Vierjahn
Prof. Dr. Barbara Albert,
Rektorin der Universität Duisburg-Essen (UDE): „Das Projekt
veranschaulicht den Anspruch der Universität Duisburg-Essen,
gemeinsam mit ihren Partnerinstitutionen als Impulsgeberin
und Innovationstreiberin in der Region zu wirken und mit
wissenschaftlicher Innovation und Invention einen Beitrag zur
Lösung gesellschaftlicher Fragestellungen zu leisten.“
Der Seilroboter übernimmt die schwere körperliche Arbeit
und führt sie automatisiert und präzise aus: Innerhalb
weniger Stunden soll er künftig eine Etage mauern.
Anschließend wechselt er das Werkzeug und platziert
Deckenelemente als Grundlage des nächsten Geschosses:
Schrittweise entwickeln die Forschenden der Universität
Duisburg-Essen (UDE) ein Robotersystem, das die wesentlichen
Arbeiten im Rohbau umsetzt.
Entwickelt wurde die
zugrunde liegende Technik am Lehrstuhl für Mechatronik unter
Leitung von Prof. Dr.-Ing. Dieter Schramm; das Institut für
Baubetrieb und Baumanagement (IBB) um Prof. Dr.-Ing.
Alexander Malkwitz brachte seine Expertise rund um den
Baubetrieb ein. Unterstützt wurde das Projekt durch die
Forschungsvereinigung Kalk-Sand e.V. sowie das Institut für
Angewandte Bauforschung Weimar gGmbH. An der UDE koordinieren
Mechatroniker Prof. Dr.-Ing. Tobias Bruckmann und
Bauingenieurin Dr. Aileen Pfeil (IBB) die Arbeit des
interdisziplinären Entwicklungsteams.
Die Technik
könnte den akuten Fachkräftemangel abpuffern, indem sie
schwere, monotone Arbeiten übernimmt. Die Forscher:innen sind
dazu im Dialog mit Ausbilder:innen und Bauunternehmen, um zu
diskutieren, wie künftig angehendes Baustellenpersonal den
Umgang mit automatisierten Bauverfahren in der beruflichen
Aus- und Weiterbildung erlernen kann.
„Die Planung der
Baustelle als Fertigungsort wird anderen Regeln folgen",
betont Dr.-Ing. Aileen Pfeil vom IBB. „In der
Mensch-Maschine-Interaktion sowie in der
Baustelleneinrichtung und -logistik werden wir neue Wege
gehen müssen – ohne Menschen zu ersetzen. Vielmehr werden sie
im Umgang mit der Technologie geschult und von körperlich
schwerer Arbeit entlastet."
Robotikforscher Prof.
Dr.-Ing. Tobias Bruckmann ergänzt: „Diesen Weg werden wir
nicht alleine gehen. Von der Planung bis zur Ausführung
müssen alle am Bau Beteiligten – aus Architektur, Planung,
Baustoffherstellung und -lieferung bis hin zur
automatisierten Errichtung von Bauwerken – die Transformation
zur Digitalisierung der Branche mitgestalten.“
Diese
Kette von Schritten eines Bauvorhabens greift die von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Forschungsgruppe
FOR 5672 Das Informationsrückgrat des robotisierten Bauens
unter der Leitung der Technischen Universität München auf:
Hier entwickeln die Robotiker:innen der UDE Softwaremodelle
von Baurobotern. Zusammen mit Softwarebausteinen anderer
Universitäten zur Koordination aller Akteure erlauben diese
den simulierten Blick in die automatisierte Baustelle der
Zukunft, um dafür Prozesse, Bauverfahren und Systeme zu
entwickeln und zu optimieren.
|
|
Spannende Exponate auf weltgrößter
Bootsmesse
|
|
UDE und DST
auf der boot
Duisburg, 15. Januar 2025 - Weit
über 200.000 Menschen werden ab Samstag (18.1.) auf der
weltgrößten Bootsmesse boot Düsseldorf erwartet. Ein echter
Besuchermagnet. Unter den 1.500 Ausstellern sind die
Universität Duisburg-Essen und ihr An-Institut, das
Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme
DST. Auf einem 400 qm großen Stand präsentieren sie
spektakuläre Entwicklungen und Forschungsprojekte, darunter
das Binnenschiff der Zukunft ELLA, einen Simulator, mit dem
reale Testfahrten gemacht werden können, und das
Hafenforschungslabor HaFoLa. Sie bieten zahlreiche
Mitmach-Aktionen und beraten zu praxisnahen Studiengängen.
Studierende zeigen Projekte wie ein Betonkanu oder ein
Renntretboot. Wer Innovationen rund um Wasser, Boot und
Technik erleben möchte, sollte also unbedingt Halle 14, Platz
14D41, ansteuern.
© DST
Als eine der wenigen
Hochschulen in Deutschland forscht und lehrt die Universität
Duisburg-Essen (UDE) zu nachhaltigen maritimen Systemen, zur
modernen KI gestützten Binnen- und Küstenschifffahrt sowie
zur Hafenlogistik. In entsprechenden Studiengängen und
Kreativlaboren bildet sie praxisnah Ingenieur:innen aus. Das
DST ist international bekannt für seine Forschungsarbeit und
kooperiert eng mit der Industrie und verschiedenen
Lehrstühlen an der Uni.
Auf der boot zeigen UDE
und das DST gemeinsam folgende Exponate:
Forschungsschiff
ELLA: Es ist das Binnenschiff der Zukunft und zeigt
eindrücklich, wie das autonome Fahren auch auf dem Wasser
voranschreitet. ELLA ist ein Modell im Maßstab 1:6 und misst
stattliche 15 Meter. Vom Simulator aus lässt sich ELLA
fernsteuern, von der Testrecke lassen sich hier
Live-Sensordaten abrufen.
(https://www.smartshipping.info/ella/)
Schiffssimulator VeLABi mit virtuellem Testfeld VERA: Er ist
deutschlandweit einzigartig und zeigt den Standard der
Zukunft, wenn Schiffe von Land aus ferngesteuert werden bzw.
sogar vollends automatisch fahren. Wie das funktioniert bei
ELLA und Co., lässt sich im Simulator erleben.
(https://www.velabi.de/; https://www.dst-org.de/vera/)
Hafen-Forschungslabor HaFoLa: Hier wird die
Logistikinfrastruktur von morgen erforscht, denn auch die
Arbeit im Hafen läuft immer automatisierter. Am Stand ist
eine Fracht- und Umschlag-Umgebung im Maßstab 1:16 aufgebaut.
Wer möchte, kann z.B. einen Reachstacker per Playstation
Controller über einen Parkour fernsteuern und Container
transportieren. (https://www.smartshipping.info/hafola/
Betonkanu und Rennkatamaran: Dass Beton schwimmt, und
Tretboote nicht plump sein müssen, zeigen Studierende mit
ihren selbstentwickelten und -gebauten Booten Ruhr-Pott I
sowie Close to Perfection. Außerdem zu sehen sind SL
Modellschiffe, an denen Studierende Automatisierung
erforschen.
Windturbine: Gezeigt wird eine Windanlage,
mit der sich auch auf Schiffen elektrische Energie gewinnen
lässt.
Flexible Wellen (Flex-Line N-FLEX): Diese
innovative Kunststoff-Welle für den Antrieb von Schiffen hat
die UDE mit einem Industriepartner entwickelt. Sie ist aus
Faserverbundwerkstoff und Elastomermaterial konstruiert.
(https://www.vulkan.com/produkte/detail/n-flex)
Aqua
Speeder: Es ist der erste voll-elektrische, lautlose Jetski
für den europäischen Markt. Die Ingenieur:innen der UDE haben
es mitentwickelt. (https://www.aquaspeeder.de/)
CoCreation Lab: Das Team für Produktinnovationen kommt aus
den Bereichen Design, Chemie, Ingenieurwissenschaften und
3D-Druck. Auf der boot führt es verschiedene 3D-Drucker und
einen 3D-Scanner vor und druckt Mini-ELLAs und andere
Giveaways aus.
(https://www.uni-due.de/chemie/akgiese/ccl_home.php)
Wasser, Technik, Studium: Studierende, Dozierende und
Studienberater:innen informieren über Studiengänge wie
Nachhaltige und autonome maritime Systeme, Maschinenbau,
Energy Science, aber auch über viele andere spannende Fächer.
Weitere Informationen:
Dr. Frederic Kracht,
Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme
DST, Tel. 0151/42467347,
kracht@dst-org.de
|
|
Unsichere Zukunft für
Gewerkschaften
|
|
Neuer
IAQ-Report
Duisburg, 15. Januar 2025 - Inzwischen
machen Angestellte mit über 70% die Mehrheit der
Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe aus. Diese sind höher
qualifiziert, weiblicher und vor allem: deutlich seltener
gewerkschaftlich organisiert als Arbeiter:innen. Was können
Gewerkschaften tun – und was tun sie bereits –, um
Industrieangestellte breiter zu organisieren und zu
vertreten? Diese Fragen untersucht der neue Report des
Instituts Arbeit und Qualifikation (IAQ) der UDE insbesondere
mit Blick auf die beiden großen deutschen
Industriegewerkschaften IGBCE und IG Metall.
Durch
Rationalisierungsmaßnahmen und Produktionsverlagerung ins
Ausland nimmt die Zahl der (Fach-)Arbeitenden im
produzierenden Gewerbe seit Jahren ab. Parallel steigt die
Bedeutung von Angestelltentätigkeiten im Bereich der
wissensintensiven Dienstleistungen, wie Forschung und
Entwicklung. Angestellte machen daher nach Auswertungen des
Sozio-ökonomischen Panel (SOEP) inzwischen über 70% der
Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe aus – was
Industriegewerkschaften vor Herausforderungen stellt.
Bisher beziehen sie ihre Organisationsmacht vor allem aus
den gewerblichen Bereichen der Produktion. Je mehr der Anteil
der Arbeiter:innen zurückgeht, desto größer ist die Gefahr,
dass sie ihre Durchsetzungsfähigkeit in Tarifverhandlungen,
ihre Ressourcenstärke und ihre gesellschaftliche Stellung
verlieren.
Vor diesem Hintergrund analysiert der
aktuelle Report des IAQ am Beispiel von IGBCE und IG Metall,
was Gewerkschaften tun können – und bereits tun –, um
Industrieangestellte breiter zu organisieren und zu
vertreten. Er stützt sich auf Ergebnisse einer eigenen,
erstmalig durchgeführten, standardisierten Befragung von
Angestellten (n = 1.045) im Verarbeitenden Gewerbe. Ergänzend
wurden Workshops mit Expert:innen der IGBCE und der IG Metall
ausgewertet.
Die Ergebnisse der Befragung verweisen
auf ambivalente Arbeitsbedingungen der Angestellten: Auf der
einen Seite erscheint ein größerer Teil relativ zufrieden mit
ihrer Bezahlung, den Möglichkeiten, ihre Arbeitszeiten nach
ihren Bedürfnissen zu gestalten oder auch der Sinnhaftigkeit
ihrer Arbeit. Zugleich berichtet ein erheblicher Teil der
Befragten über Zeitdruck bei der Arbeit und eine
Intensivierung der an sie gestellten Anforderungen.
Und auch bei Themen wie Weiterbildungsmöglichkeiten und
Karrierechancen wird noch Verbesserungsbedarf gesehen. „Hier
zeigen sich durchaus Ansatzpunkte, die von den Gewerkschaften
erfolgreich genutzt werden könnten, um Angestellte breiter zu
organisieren“, ist sich Prof. Dr. Thomas Haipeter, Leiter der
Forschungsabteilung Arbeitszeit und Arbeitsorganisation
(AZAO) am IAQ, sicher.
Knapp ein Drittel der befragten
Angestellten sind bereits Mitglied in einer Gewerkschaft.
Davon halten rund 92% deren Arbeit für (sehr) wichtig. Eine
Position, die auch von rund zwei Dritteln der Nichtmitglieder
geteilt wird. Weniger wichtig wird die Gewerkschaftsarbeit
allerdings von den Befragten für die eigene Person
eingeschätzt: 80% der Mitglieder, aber nur 40% der
Nichtmitglieder erkennen die Wichtigkeit für die eigene
Person an.
„Für die Gewerkschaften bedeutet dies,
dass sie den Transfer vom ‚allgemein wichtigen
gesellschaftlichen Gut‘ hin zur persönlichen Bedeutsamkeit
bewältigen müssen“, ordnet Arbeitsforscherin Dr. Angelika
Kümmerling die Ergebnisse ein. Eine weitere Schwierigkeit:
Nur 41% der Befragten hatte bereits Kontakt zu
Gewerkschaften, unter den Nichtmitgliedern sind es sogar nur
27%.
Um Industrieangestellten besser zu erreichen,
haben IGBCE und IG Metall thematische Aktionen, die auf die
Gruppe der Angestellten abzielen, gestartet. Mit der Kampagne
„Home-Office muss fair sein“ nahm die IG Metall ein zentrales
Thema der Arbeitsrealität der Industrieangestellten auf.
„Diese Kampagne und andere Maßnahmen der Gewerkschaften
zeigen, dass die Beteiligung der Beschäftigten gerade bei den
Hochqualifizierten ein Schlüsselfaktor für die erfolgreiche
Organisierung und Vertretung ist“, so die Arbeitsforscherin
Dr. Sophie Rosenbohm.
Auch wird von den
Expert:innen beider Gewerkschaften betont, dass die
Aktivitäten in den Betrieben mit und über die Betriebsräte
koordiniert werden müssen. Deren Aktivierung für die
Organisierung und Vertretung der Angestellten ist aus Sicht
aller Befragten eine Kernaufgabe für die Gewerkschaft. Einig
ist man sich, dass die Interessenvertretungen dafür ihre
Zusammensetzung ändern und mehr Angestellte für ihre Arbeit
gewinnen müssen. Auch eine neue Art der Ansprache sei nötig,
um höherqualifizierte Angestellte zu erreichen.
|
|
Wenn Gefühle den Schulalltag bestimmen |
|
Duisburg, 14. Januar 2025 - Aggression,
Depression, Angst, fehlender Selbstwert: Viele Kinder und
Jugendliche kennen das. Wie sich ihre Gefühle auf Unterricht
und Schulalltag auswirken, erforschen Wissenschaftler:innen
wie Prof. Dr. Désirée Laubenstein von der Fakultät für
Geisteswissenschaften der Universität Duisburg-Essen. Die
neue Professorin für Pädagogik und Didaktik im
Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung
erforscht am Institut für Sonderpädagogik das Schulklima und
Herausforderungen an Regelschulen des Gemeinsamen Lernens und
Förderschulen.
Klima an Regel- und Förderschulen: Prof.
Dr. Désirée Laubenstein forscht dazu. © UDE/Bettina
Engel-Albustin
„Kinder und Jugendliche stoßen mit
ihrem Verhalten bei Bildungsangeboten oft an Grenzen. Je
nachdem, was sie tun, laufen sie Gefahr, diskreditiert,
pathologisiert, exkludiert oder marginalisiert zu werden“,
sagt Professorin Désirée Laubenstein „Ich möchte verstehen,
wie sie Situationen emotional erleben, wieso sie sie
problematisch finden und sich so verhalten. Ich möchte zudem
wissen, wie wir Schulen unterstützen können, mit diesen
Herausforderungen umzugehen.“

Prof. Dr. Désirée Laubenstein (© UDE / Bettina
Engel-Albustin)
Aktuell erforscht Professorin
Laubenstein an der Universität Duisburg-Essen (UDE) im
Projekt „InSchul2“ das Klima in der inklusiven
Schulentwicklung und wie Kompetenzen der emotionalen und
sozialen Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen gezielt
unterstützt werden können, um Bildungsteilhabe zu
realisieren. „Ich untersuche seit mehr als zehn Jahren mit
meinem Team, wie die Zusammenarbeit an Schulen so gestaltet
werden kann, dass Lehrkräfte Unterrichts- und individuelle
Förderkonzepte gerne umsetzen und als bereichernd fürs
Schulklima werten.“
Besonders wichtig hält sie
die emotional-soziale Unterstützung von Schüler:innen: „Es
geht uns darum, ein sicheres und positives Schulklima zu
schaffen. Dafür vermitteln wir den Lehrkräften
lösungsorientierte Gesprächstechniken und ermutigen sie zu
einem ressourcenorientierten Blick auf ihre Schülerinnen und
Schüler.“
Laubenstein studierte Heilpädagogik
(1991-1995) an der Universität Köln. Von 1996 bis 2007 war
sie wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich ‚Pädagogik für
geistig behinderte Menschen‘ an der Universität
Koblenz-Landau. 2008 wechselte sie als Projektmitarbeiterin
für zwei Jahre an die Universität Würzburg und erforschte den
Bereich ‚Übergang Schule-Beruf‘.
Von 2010 bis 2014
kehrte sie als Junior-Professorin für Pädagogik bei
herkunftsbedingten Benachteiligungen, Lernschwierigkeiten und
Verhaltensstörungen an die Universität Koblenz-Landau zurück.
Bevor sie an die UDE kam, war sie seit 2014 Professorin für
Inklusion unter besonderer Berücksichtigung des
Förderschwerpunkts Emotionale und Soziale Entwicklung an der
Universität Paderborn.
|
|
Membrantechnologie im Wasser- und Energiemanagement
Wichtiger Beitrag zur Versorgung in Afrika
|
|
Duisburg, 14. Januar
2025 - Auf dem afrikanischen Kontinent wächst die Bevölkerung
stetig. Sie mit sauberem Wasser und ausreichend Energie zu
versorgen, stellt für die Staaten eine Herausforderung dar.
Die Membrantechnologie könnte innovative und nachhaltige
Lösungen liefern. Im internationalen Projekt „WE-Africa,
Membrane Knowledge Hub“ wollen Forschende und Partner aus der
Wirtschaft deshalb eine Hochschul-Industrie-Plattform für
nachhaltiges Wasser- und Energiemanagement in Afrika
etablieren. Es wird von der Universität Duisburg-Essen (UDE)
geleitet und koordiniert.
Der Deutschen
Akademischen Austauschdienst (DAAD) fördert es für vier Jahre
mit knapp 800.000 Euro.
Die Membrantechnologie spielt eine
zentrale Rolle beim nachhaltigen Wasser- und
Energiemanagement. Beispielsweise ist der Einsatz von
Membranen beim Entsalzen von Meerwasser energiesparender
verglichen mit anderen Methoden. Außerdem werden Membrane
verwendet, um Schadstoffe aus Abwässern zu filtern, und in
Brennstoffzellen eingesetzt, wandeln sie Wasserstoff
effizient in Elektrizität um.
Im Projekt, das vom
Zentrum für Wasser- und Umweltforschung (ZWU) der UDE
koordiniert wird, soll nun an Partneruniversitäten in
Ägypten, Ghana und Marokko ein Membrane Technology Knowledge
Hub entstehen. Dort werden für Studierende und Fachkräfte
Online-Kurse zur Membrantechnik im Wasser- und
Energiemanagement angeboten. Gleichzeitig sammeln die
Studierenden in Unternehmen praktische Erfahrungen. In
Intensivkursen zum Unternehmertum erfahren sie, wie sie aus
ihren Ideen ein Geschäftsmodell entwickeln und in den lokalen
Markt einbringen können.
„Wir unterstützen mit
dem Projekt den Wissensaustausch, den Aufbau von Kapazitäten
und den Technologietransfer“, erklärt Leiter Dr. Stefan
Panglisch, UDE-Professor für Mechanische
Verfahrenstechnik/Wassertechnik. „Damit leisten wir einen
wichtigen Beitrag zur sozioökonomischen Entwicklung und zum
Umweltschutz in Afrika.“

Prof. Dr. Michael Eisinger, Geschäftsführer des Zentrums für
Umwelt- und Wasserforschung (ZWU) der UDE (l.), und Hasan
Idrees, Mitarbeiter am Lehrstuhl für Professor für
Mechanische Verfahrenstechnik/Wassertechnik der UDE (M.),
beim Besuch einer Trinkwasseraufbereitungsanlage in Ghana
(Foto: KNUST/Ghana)
Die UDE ist Teil der Ghana-NRW
Universitätsallianz. „WE-Africa, Membrane Knowledge Hub“
leiste einen wichtigen Beitrag, diese Kooperation zu
intensivieren, betonte Prof. Dr. Karen Shire, Prorektorin für
Universitätskultur, Diversität und Internationales, kürzlich
bei der Auftaktveranstaltung des Projekts. Dazu waren
Verteter:innen von Partneruniversitäten aus Ägypten, Ghana
und Budapest an den Essener Campus gekommen.
Weitere
Informationen:
https://www.uni-due.de/zwu/we_africa.php
|
|
KI gestützte Vorhersagen: Frühwarnsystem für
Trinkwasserversorger |
|
Duisburg, 13. Januar 2025 - Rund 12 Prozent
des Trinkwassers in Deutschland stammen aus Seen und
Talsperren. Deren Zustand wird maßgeblich von den darin
lebenden Organismen bestimmt. Der Klimawandel,
Umweltverschmutzungen und invasive Arten wie Blaualgen
gefährden jedoch die Biodiversität – und damit die Qualität
des Trinkwassers.
Im Forschungsprojekt IQ Wasser*
untersucht ein interdisziplinäres Team der Universität
Duisburg-Essen die mikrobiologische Biodiversität mithilfe
von Umwelt-DNA-Analysen. Ziel ist die Entwicklung eines
KI-gestützten Frühwarnsystems, das Veränderungen in der
Wasserqualität erkennt.

Das Team untersucht die Wasserqualität und Biodiversität der
Talsperre Kleine Kinzig in den nächsten drei Jahren.
Copyright: TZW, Michael Hügler
„Etliche Lebewesen
tragen zur Wasserqualität in Trinkwasserreservoiren bei“,
erläutert Dr. Julia Nuy aus der Umweltmetagenomik am Research
Centre One Health. „Muscheln filtern Partikel aus dem Wasser,
Bachflohkrebse zerkleinern organisches Material, und
bestimmte Bakterien verstoffwechseln Stickstoff oder
Kohlenstoff.“ Dabei gilt: Je höher die Artenvielfalt, desto
stabiler bleiben ökologische Dienstleistungen wie etwa das
Filtern des Wassers.
Die Rolle der Biodiversität und
insbesondere die mikrobiologische Vielfalt wird bei der
Bewertung der Wasserqualität bislang jedoch kaum
berücksichtigt. Mikroorganismen wie Bakterien übernehmen
dabei wesentliche Funktionen im Ökosystem, bergen aber auch
Risiken, wie etwa Cyanobakterien (Blaualgen), die sich bei
steigenden Temperaturen ausbreiten.
In den nächsten
drei Jahren nimmt das interdisziplinäre Team vier Mal pro
Jahr Proben in der Wahnbachtalsperre und in der Talsperre
Kleine Kinzig. „Nach der Filterung extrahieren wir die DNA
und sequenzieren sie vollständig“, erläutert Dr. Julia Nuy,
die das Teilvorhaben Mikrobielle Ökologie und Biodiversität
leitet.
„Damit arbeiten wir genom-aufgelöst und
können aus kleinen Fragmenten nahezu vollständige Genome
rekonstruieren, das gibt präzise Einblicke in die mikrobielle
Vielfalt und die Dienstleistungen eines Ökosystems“, erklärt
Dr. Julia Nuy. „Anhand der Genome können wir beispielsweise
erkennen, ob Bakterien Stickstoff oder Kohlenstoff
verstoffwechseln – eine zentrale Funktion für das Ökosystem“.
Ein weiterer Fokus liegt auf dem Pathogenitätspotenzial:
„Wir untersuchen, wie sich Antibiotikaresistenzen zeitlich
entwickeln, ob bestimmte Resistenzgene nur in spezifischen
Bakterien vorkommen oder in einer breiten Vielfalt von
Mikroorganismen. Zudem analysieren wir, ob aktuelle Trends
beim Antibiotikaeinsatz in den untersuchten Bakterien
nachweisbar sind“, so Nuy.
Die gewonnenen Daten
fließen in KI-Modelle ein, die Umweltveränderungen und ihre
Auswirkungen auf die Biodiversität vorhersagen. „Unser Ziel
ist es, ein Frühwarnsystem für Trinkwasserversorger zu
schaffen“, betont Nuy. „So können potenzielle Gefahren wie
Algenblüten oder antibiotikaresistente Keime frühzeitig
erkannt und gezielte Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.“
* IQ Wasser wird vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung mit etwa zwei Millionen Euro gefördert und vom TZW:
DVGW-Technologiezentrum Wasser koordiniert. Weitere Partner
sind das Fraunhofer-Institut IOSB, das Museum für Naturkunde
Berlin sowie bbe Moldaenke GmbH und Ident Me GmbH.
|
|
Physician Assistants im Praxis-Test: Neue
Berufsgruppe soll Hausärzt:innen entlasten |
|
Duisburg, 13. Januar
2025 - Wo es einen Mangel an Ärzt:innen gibt, könnten
sie eine Lösung sein: Physician Assistants (PAs). PAs sind
studierte Assistent:innen, die Mediziner:innen entlasten,
indem sie einen Teil ihrer Aufgaben übernehmen. Wie das bei
der hausärztlichen Versorgung in einer Teampraxis
funktioniert, wird seit Januar 2025 in einem bundesweiten
Kooperationsprojekt getestet.
An dem
multizentrischen Projekt „Physician Assistants in der
Allgemeinmedizin“ (PAAM) sind auch Forschende der
Medizinischen Fakultät und der Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften der Universität Duisburg-Essen
beteiligt. Die Konsortialführung liegt beim Institut für
Allgemeinmedizin (ifam) am Universitätsklinikum Essen. Das
PAAM-Projekt wird durch den Innovationsfonds des Gemeinsamen
Bundesausschusses (G-BA) mit rund 6,75 Millionen Euro
gefördert.
Physician Assistants durchlaufen einen 6-
bis 8-semestrigen medizinnahen Bachelor-Studiengang und
übernehmen delegierbare ärztliche Aufgaben. „Das Berufsbild
des Physician Assistant ist in Deutschland zwar noch wenig
bekannt, wird jedoch von Fachleuten zunehmend als wichtige
Ergänzung in der medizinischen Versorgung angesehen“, sagt
Prof. Dr. Jürgen in der Schmitten, Leiter des Instituts für
Allgemeinmedizin am Universitätsklinikum Essen. „Bisher sind
die meisten PAs im klinischen Sektor tätig, es wurden aber in
einigen Best-Practice-Praxen bereits vielversprechende
Erfahrungen gesammelt.“
In dem neuen Projekt PAAM,
das eine Laufzeit von 45 Monaten hat, wird eine
cluster-randomisierte Studie in 24 Interventions- und 28
Kontrollpraxen in Westfalen-Lippe und Schleswig-Holstein
durchgeführt. Es wird untersucht, welchen Beitrag PAs in der
hausärztlichen Versorgung leisten und wie Kooperationen von
PAs und Hausärzt:innen bestmöglich unterstützt werden können.
Dabei werden Patient:innensicherheit und
Versorgungsqualität sowie Auswirkungen auf
Versorgungskapazitäten, Ärzt:innen- und
Patient:innenzufriedenheit und Effizienz evaluiert. Die
Mediziner:innen möchten herausfinden, wo die Potenziale von
PAs in der hausärztlichen Versorgung liegen und wie ihre
Rolle in Zukunft weiter ausgestaltet werden kann.
Mehr
Informationen zum Projekt „Physician Assistants in der
Allgemeinmedizin“:
http://www.ifam-essen.de/forschen/paam/
|
|
63 Hochschulen und
Forschungsinstitutionen verlassen Plattform X – Gemeinsam für
Vielfalt, Freiheit und Wissenschaft
|
|
Essen/Duisburg, 10. Januar 2025 - Mehr als
60 deutschsprachige Hochschulen und Forschungsinstitutionen,
darunter die Universität Duisburg-Essen, möchten ein Zeichen
setzen und verkünden gemeinschaftlich, ihre Aktivitäten auf
der Plattform X (ehemals Twitter) einzustellen. Der Rückzug
ist Folge der fehlenden Vereinbarkeit der aktuellen
Ausrichtung der Plattform mit den Grundwerten der beteiligten
Institutionen: Weltoffenheit, wissenschaftliche Integrität,
Transparenz und demokratischer Diskurs.
Die
Veränderungen der Plattform X – von der algorithmischen
Verstärkung rechtspopulistischer Inhalte bis zur
Einschränkung organischer Reichweite – machen eine weitere
Nutzung für die beteiligten Organisationen unvertretbar. Der
Austritt der Institutionen unterstreicht ihren Einsatz für
eine faktenbasierte Kommunikation und gegen antidemokratische
Kräfte. Die Werte, die Vielfalt, Freiheit und Wissenschaft
fördern, sind auf der Plattform nicht mehr gegeben.
Auch einige Institutionen, die ihre Aktivitäten auf der
Plattform bereits eingestellt haben, unterstützen den
gemeinsamen Appell und bekräftigen damit die Bedeutung einer
offenen und konstruktiven Diskussionskultur. Diese
Entscheidung betrifft ausschließlich die X-Accounts der
beteiligten Institutionen und nicht ihre Kommunikation über
andere Social-Media-Kanäle. Im Lichte der jüngsten Ereignisse
werden sie die Entwicklung der Plattformen und ihrer
Algorithmen weiterhin aufmerksam beobachten.
Die beteiligten Institutionen:
• Alanus
Hochschule für Kunst und Gesellschaft
•
Bauhaus-Universität Weimar
• Berliner Hochschule für
Technik
• Brandenburgische Technische Universität Cottbus
– Senftenberg
• Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
• Deutsche Ornithologische Gesellschaft
• Deutsche
Sporthochschule Köln
• Europa-Universität Viadrina
Frankfurt (Oder)
• Fachhochschule Dortmund
•
FernUniversität in Hagen
• Freie Universität Berlin
•
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
•
Goethe-Universität Frankfurt
• HAWK Hochschule für
angewandte Wissenschaft und Kunst
Hildesheim/Holzminden/Göttingen
•
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
• Hochschule Anhalt
• Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
• Hochschule Darmstadt
•
Hochschule der Bildenden Künste Saar
• Hochschule für
Musik und Theater Hamburg
• Hochschule für Philosophie
München
• Hochschule Furtwangen
• Hochschule München
• Hochschule Neubrandenburg
• Hochschule Osnabrück
•
Hochschule RheinMain
• Hochschule Ruhr West
•
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
•
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen
• Humboldt-Universität zu Berlin
• Institut für
Vogelforschung
• Johannes Gutenberg-Universität Mainz
•
Justus-Liebig-Gesellschaft
• Justus-Liebig-Universität
Gießen
• Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen
•
Kirchliche Hochschule Wuppertal
• Leibniz-Zentrum für
Marine Tropenforschung
• Leibniz-Institut für
Ostseeforschung Warnemünde
• Medizinische Universität
Innsbruck
• Philipps-Universität Marburg
• RWTH Aachen
• Technische Hochschule Georg Agricola
• Technische
Hochschule Köln
• Technische Universität Braunschweig
•
Technische Universität Darmstadt
• Technische Universität
Dresden
• Universität Bamberg
• Universität Bayreuth
• Universität des Saarlandes
• Universität der Künste
Berlin
• Universität Duisburg-Essen
• Universität
Erfurt
• Universität Greifswald
• Universität
Heidelberg
• Universität Innsbruck
• Universität
Münster
• Universität Potsdam
• Universität Siegen
•
Universität Trier
• Universität Ulm
• Universität
Würzburg
• Universität zu Lübeck
• Westsächsische
Hochschule Zwickau
|
|
Öffentliche Lesung am 15. Januar: Schriftstellerin
Shida Bazyar zu Gast |
|
Duisburg, 7. Januar 2025 - „Ein Buch wie
ein Faustschlag!“ heißt es in einer der vielen Rezensionen
des Romans „Drei Kameradinnen“. Ob die Geschichte von drei
jungen Frauen, die zusammenstehen, egal was kommt, sie
gleichermaßen berührt, können Literaturinteressierte am 15.
Januar 2025 erfahren. Dann kommt die Autorin Shida Bazyar für
eine öffentliche Lesung an die Universität Duisburg-Essen.
Sie folgt der Einladung von Germanistin Prof. Dr. Corinna
Schlicht und liest um 18:15 Uhr am Campus Essen (Gebäude R11
T00 D03). „In unserer Veranstaltungsreihe `Literatur zu Gast´
können unsere Studierenden, aber natürlich auch alle anderen
Interessierten zeitgenössische Autorinnen und Autoren treffen
und mit ihnen gemeinsam über literarische und aktuell
gesellschaftspolitische Themen sprechen,“ so Schlicht. Der
Eintritt zur Lesung ist frei, eine Anmeldung nicht nötig.
Mit bindungsloser Freundschaft gegen rechten Terror
Mit Shida Bazyar, Jahrgang 1988, kommt eine erfolgreiche
Autorin an die UDE, die auch viele Jahre in der
Jugendbildungsarbeit aktiv war. In ihrem Roman berichtet sie
über den Alltag aus der Perspektive dreier Frauen: Sie sehen
sich regelmäßig mit Sprüchen, Hass und Gewalt einer
Gesellschaft konfrontiert, in der rechter Terror an der
Tagesordnung ist. Im Zentrum der Geschichte steht die
bedingungslose Freundschaft der drei Protagonistinnen, die
ein annähernd selbstbestimmtes Leben für sie überhaupt erst
möglich macht.
Shida Bazyars Debütroman »Nachts ist es
leise in Teheran« erschien 2016; er wurde u.a. dem
Ulla-Hahn-Autorenpreis und dem Uwe-Johnson-Förderpreis
ausgezeichnet und in mehrere Sprachen übersetzt. »Drei
Kameradinnen« folgte 2021 und stand auf der Longlist für den
Deutschen Buchpreis.
|
|
Wie wir künftig heizen: Projekt analysiert Umrüstung
von bestehenden Gebäuden |
|
Duisburg, 6. Januar 2025 - Rund 80 Prozent
der Heizenergie in Deutschland stammt noch aus fossilen
Quellen, meist importierten Energieträgern wie Gas und Öl.*
Doch laut dem aktuellen
Wärmeplanungsgesetz sind Kommunen verpflichtet, abhängig
von der Einwohnerzahl bis 2026 bzw. 2028 einen Wärmeplan zu
erstellen: Womit kann künftig nachhaltig geheizt werden, und
wie kann das in der Praxis funktionieren? Im Projekt KliWinBa
schauen Forschende der Universität Duisburg-Essen hier
genauer hin.
Das Projekt Klimaneutrale Wärme in
industriell geprägten Ballungsräumen (KliWinBa) wird geleitet
von Prof. Dr. Christoph Weber vom Lehrstuhl für
Energiewirtschaft der Universität Duisburg-Essen (UDE). Sein
Team analysiert bisherige Erfahrungen mit klimafreundlichen
Heizsystemen und untersucht exemplarisch die Optionen in zwei
Kommunen mit unterschiedlichen Siedlungsstrukturen: das
großstädtisch geprägte Duisburg sowie Gevelsberg als urbanes
Umfeld mittlerer Größe.
Wie ist dort eine
verlässliche, bezahlbare und nachhaltige Wärmeversorgung in
bestehenden Mehrfamilienhäusern sicherzustellen?
Dazu
untersuchen die Forschenden die Rahmenbedingungen in
unterschiedlichen Stadtteilen und bei verschiedenen Arten von
Immobilien: Sie bewerten Technologieoptionen, vergleichen
Umbauzeiten, berechnen Emissionen und die Leistung der
verschiedenen Heizvarianten unter normalen Bedingungen und
bei hohen Belastungen durch sehr kalte Wintertage.
Geförderte Projektpartner sind das Wohnungsunternehmen
Vonovia sowie die AVU Serviceplus GmbH. Gemeinsam mit den
assoziierten Partnern Netze Duisburg, Stadtwerke Duisburg und
Bosch Home Comfort bringen sie nicht nur relevante Daten,
sondern auch ihre praktischen Erfahrungen ein, bewerten
Ergebnisse und unterstützen die Entwicklung praxisnaher
Lösungen für die Analysen an der UDE.
Das Team um
Christoph Weber erarbeitet daraus ein Analyseraster, das bei
der Entscheidung hilft: Sind Hochtemperatur-Wärmepumpen,
Wärmenetze mit Kraftwärmekopplung, Power-to-Heat-Anlagen und
Speicher oder tiefengeothermische Ressourcen im konkreten
Fall umsetzbar und ökonomisch vorteilhaft? „Siedlungen mit
Mehrfamilienhäusern, speziell in urbanen Räumen, benötigen
tendenziell größere Heiztechnologien, bieten aber nicht
unbedingt den Platz dafür, und teure Technologien sind in
Gegenden mit niedrigen Immobilienpreisen nicht ohne weiteres
zu finanzieren“, erklärt Weber einige der Aspekte, die in die
Studie einfließen.
Mit ihren Analysen wollen die
Projektpartner Immobilieneigentümer:innen, Planer:innen sowie
Netz- und Anlagenbetreiber bei ihren
Investitionsentscheidungen unterstützen. Zudem erhalten
Kommunen und andere staatliche Behörden konkrete
Empfehlungen, wie sie ihre Regularien anpassen und
Förderbedingungen definieren sollten, damit der grundlegende
Umbau auf nachhaltige Wärme flächendeckend und zügig gelingt.
Das Projekt ist angelegt auf drei Jahre und wird vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) mit
rund 596.000 Euro gefördert; davon gehen rund 455.000 Euro an
die UDE. *
Quelle:
Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen
|
|
Insektenvielfalt: Viele artenreiche Gebiete
unzureichend geschützt |
|
Duisburg, 23.
Dezember 2024 - Die Insektenvielfalt in Deutschland wird vor
allem durch die Landnutzung beeinflusst, Wetter und Klima
spielen eine geringere Rolle. Das belegen Forschende der
Universität Duisburg-Essen und der Senckenberg-Gesellschaft
in einer aktuellen Studie im Fachjournal Conservation
Biology*.
Besonders Gebiete mit niedrig wachsender
Vegetation sind Hotspots der Biodiversität: Sie weisen bis zu
58 Prozent mehr Arten auf als Wälder. Doch gerade diese
artenreichen Regionen sind oft unzureichend geschützt. Den
Rückgang der Insektenvielfalt könnte das weiter
beschleunigen.

Eine wichtige Art: der Bläuling. © Beatrice
Kulawig/Senckenberg
Über 30.000 Insektenarten gibt es
in Deutschland, Tendenz rückläufig. In unseren Ökosystemen
spielen sie jedoch eine Schlüsselrolle: sie beackern unsere
Böden, bestäuben Pflanzen, darunter viele Nutzpflanzen, und
zersetzen organisches Material.
„In unserer Studie
haben wir die Insektenvielfalt nicht nur mit Blick auf
Veränderungen in der Gesamtbiomasse und im Artenreichtum
untersucht, sondern auch zeitliche Fluktuationen,
Verschiebungen in der Artenzusammensetzung und die
Entwicklung zentraler Funktionsgruppen“, erklärt Prof. Dr.
Florian Leese, Leiter der Arbeitsgruppe Aquatische
Ökosystemforschung an der Universität Duisburg Essen (UDE).
Zu den Funktionsgruppen zählen Bestäuber wie Bienen, bedrohte
Arten wie die Arbeiterlose Parasitenameise oder sowie
invasive Spezies wie der Asiatische Marienkäfer, die das
Ökosystem nachhaltig beeinflussen können.
„Unsere
Ergebnisse zeigen, dass Verteilung der Insektenvielfalt vor
allem durch die Nutzung der Landschaft beeinflusst wird und
weniger von Wetter- und Klimaveränderungen,“ erklärt Leese.
„Wie viele Insekten in einem Gebiet leben und welche Arten
vorkommen, hängt in erster Linie von der Art der
Bodenbedeckung ab. Besonders dort, wo die Vegetation
vielfältig und abwechslungsreich ist, steigt die
Insektenbiomasse deutlich an – um bis zu 56 Prozent.
Gleichzeitig nimmt der Artenreichtum in solchen Gebieten um
bis zu 58 Prozent zu“, so der Biologe weiter.
„Besorgniserregend ist, dass viele artenreiche Gebiete nur
unzureichend geschützt sind, was den Rückgang der
Insektenvielfalt weiter verstärken könnte. Für die Ziele des
EU Nature Restoration Law und des Kunming-Montreal Global
Biodiversity Framework neue Schutzgebiete zu schaffen,
sollten auch unbewaldete Lebensräume in tieferen Lagen
berücksichtigt werden.“ betont Prof. Dr. Peter Haase,
Letztautor der Studie. Haase forscht am Senckenberg
Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt und leitet die
Arbeitsgruppe Fluss- und Auenökologie an der UDE.
Die
Basis der Analyse bildet ein umfangreicher Insektendatensatz,
der mithilfe von 75 Malaise-Fallen erstellt wurde. Diese
zeltartigen Fallen, die fliegende Insekten in einen
Auffangbehälter leiten, wurden von den bayerischen Alpen bis
zur Nord- und Ostseeküste verteilt. So konnten die
Forschenden eine breite Spanne an Lebensräumen und
klimatischen Bedingungen abdecken. Um die enorme Vielfalt der
gesammelten Insekten zu identifizieren, setzten sie auf
DNA-Metabarcoding: Mit diesem Verfahren lassen sich die
genetischen Informationen aller Proben gleichzeitig
sequenzieren und durch den Abgleich mit
DNA-Referenzbibliotheken bestimmen.
|
|