






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 2. Kalenderwoche:
8. Januar
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Donnerstag, 9. Januar 2025
Hausgiebel eines Mehrfamilienhauses in Duisburg-Bissingheim
eingestürzt
Der Feuerwehr Duisburg wurde heute gegen
13.10 Uhr der Einsturz des Hausgiebels eines Mehrfamilienhauses auf
der Bissingheimer Straße in Bissingheim gemeldet. Beim Eintreffen
der Einsatzkräfte war die Giebelwand teilweise eingestürzt und lag
neben dem Haus.
Die Rettungskräfte stellten im Keller des
Gebäudes ein Feuer fest. Vermutlich ist der Brand genauso wie der
eingestürzte Dachgiebel auf eine Verpuffung im Keller
zurückzuführen. Eine Person wurde vermisst. Sie konnte leider nur
noch tot geborgen werden.
Die Feuerwehr bekämpfte den Brand, setzte dazu mehrere Trupps unter
Atemschutz ein. Parallel wurde das Gebäude auf möglich weitere
Schäden und Stabilität geprüft. Der Rettungsdienst betreute zudem
eine weitere Person.
Aktuell sind etwa 80 Einsatzkräfte der
Freiwilligen Feuerwehr, der Wache 1 (Mitte), Wache 7 (Süd) und Wache
3 (Hamborn), des Bautrupps und des Rettungsdienstes sowie zwei
Seelsorger vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache der
Verpuffung aufgenommen.
Unterwegs bei Schnee und Eis Ob zu Fuß, im Auto oder auf dem
Fahrrad
Starke Schneefälle und Glätte können für alle
Verkehrsteilnehmenden gefährlich werden. Verletzungsgefahr bergen
beispielsweise sich ablösende Schneelawinen von Hausdächern oder
abbrechende Eiszapfen an den Regenrinnen. Generell gilt: Wenn Sie
Zeuge von Unfällen oder Stürzen mit Verletzten werden, leisten Sie
Erste Hilfe und verständigen Sie den Notruf.
Halten Sie
sich in sicherer Entfernung von geneigten Dachflächen auf. Und
warnen Sie spielende Kinder, dass besonders eisiger und harter
Schnee ebenfalls zu Verletzungen führen kann. Betreten von
Eisflächen Zugefrorene Seen locken besonders Kinder zum Eislaufen
an. Doch der solide Eindruck einer Eisfläche kann täuschen.
Daher gilt: Nur Eisflächen, die durch die zuständigen Behörden
freigegeben wurden, sollten betreten werden! Außerdem sollten die
Eisregeln der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) beachtet
werden: Erst ab einer Eisschicht mit einer Dicke von 15 Zentimetern
trägt die Fläche. Austretendes Wasser, Risse im Eis und dunkle
Stellen sind erste deutliche Hinweise für nicht tragendes Eis. Und
was tun, wenn das Eis auf einmal anfängt zu knistern und zu knacken?
Der Tipp der DLRG: Möglichst schnell zurück ans Ufer,
auf dem Bauch robbend und genau den Weg zurück, auf dem man auch
gekommen ist. Lassen Sie ihre Kinder nie allein auf zugefrorenen
Gewässern spielen. Alarmieren Sie die Feuerwehr, wenn sie einen
Einbruch bemerken. Langanhaltende Schneefälle und Schneelast auf dem
Dach Zusätzlich können extreme, langanhaltende Schneefälle die
Tragfähigkeit eines Daches gefährden. Durch das hohe Gewicht der
Schneemasse können Dächer einstürzen oder Dachschneelawinen
verursacht werden.
Um diesen Gefahren entgegenzuwirken,
empfiehlt das BBK verschiedene vorbeugende Maßnahmen. Lassen Sie
insbesondere bei älteren Bestandsbauten die Tragfähigkeit Ihres
Daches gegenüber möglichen hohen Schneebelastungen überprüfen.
Bedenken Sie, dass für die Schneelast das Schneegewicht und nicht
die Schneehöhe maßgebend ist. Führen Sie Sicherungsmaßnahmen gegen
Schneerutschungen vom Dach durch.
Schneiden Sie lange
und schwere Äste über Hausdächern zurück und verwenden Sie
Schneerutschgitter und Schneestoppvorrichtungen, um Dachlawinen
vorzubeugen. Allgemein ist es ratsam, die Schneehäufungen sowie den
Wetterbericht stetig zu beobachten, die tragenden Bauteile der
Dachkonstruktion zu beobachten und frühzeitig dafür zu sorgen, dass
das Dach idealerweise durch Fachpersonal von Schneelasten wieder
geräumt wird.
Bäcker-Innung Rhein-Ruhr übergab Neujahrsbrezel an
Oberbürgermeister Sören Link
Die Schornsteinfeger
hatten bereits am Dienstag ihre Glückswünsche ins Duisburger Rathaus
getragen, heute hielt ein weiteres Glückssymbol Einzug am Burgplatz:
die Neujahrsbrezel. Oberbürgermeister Sören Link nahm insgesamt drei
Brezel am Mittwoch im Mercatorzimmer von Vertreterinnen und
Vertretern der Bäcker-Innung Rhein-Ruhr entgegen.

Die Bäckerei-Innung Rhein-Ruhr übergibt die Traditionelle
Neujahrsbrezel an Oberbürgermeister Sören Link. Foto: Tanja Pickartz
/ Stadt Duisburg
Unter ihnen war auch ein Schülerpraktikant,
der die erste Brezel überreichte. Die Tradition der Neujahrsbrezel
hat eine lange Geschichte in Deutschland. Das Gebäck steht für
Hoffnung, Glück, Zusammenhalt und den Wunsch nach einem guten Start
ins neue Jahr. Familien und Freunde kommen zusammen, um das
Hefegebäck zu genießen. Wie es üblich ist, wurden die Brezel mit den
anwesenden Gästen geteilt und das neue Jahr in Gemeinschaft und
Freude begonnen.
Die Neujahrsbrezel erinnert in ihrer
charakteristischen Form an eine verschlungene Schleife und
symbolisiert damit die ununterbrochene Verbindung des alten und
neuen Jahres sowie die Hoffnung auf Kontinuität und gute
Veränderungen neuen Jahr. In einigen Regionen Deutschlands ist es
auch Brauch, dass die Neujahrsbrezel mit speziellen Zutaten verziert
wird. So können zum Beispiel Mandeln, Rosinen oder Zucker darauf
gestreut werden – als Zeichen für Wohlstand, Süße und Glück.
Empfang der Sternsinger im Stadtbezirk
Rheinhausen
Sternsinger der Katholischen
Kirchengemeinde St. Peter Rheinhausen besuchten am Dreikönigstag das
Bezirksamt Rheinhausen und hinterließen ihren traditionellen
Segensspruch. Bezirksbürgermeisterin Elisabeth Liß empfing „Kasper,
Melchior und Balthasar“, die die anwesenden Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mit bekannten Liedern wie unter anderem „Wir kommen
daher aus dem Morgenland“ erfreuten.

Stadt Duisburg
Unter dem Motto „Erhebt eure Stimme!
Sternsingen für Kinderrechte“ werden in diesem Jahr von den
Sternsingerinnen und Sternsingern weltweit besonders die Rechte von
Kindern in den Blick genommen. Unterstützt und vorgestellt werden
Beispielprojekte aus Turkana im Norden Kenias und in Kolumbien.
Bezirksbürgermeisterin Elisabeth Liß überreichte im Namen der
Bezirksvertretung einen Spendenscheck, der diesen Projekten
zugutekommt.
Bundesregierung beschließt Wohnungslosenbericht
2024
Bericht gibt Auskunft über die Anzahl der in Deutschland
wohnungslosen Menschen
Das Bundeskabinett hat am 8.
Januar 2025 den vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen vorgelegten Wohnungslosenbericht 2024 beschlossen. Mit
diesem wird nach 2022 zum zweiten Mal ein gesamtdeutscher Überblick
über die Situation wohnungsloser Menschen vorgelegt. Der Bericht
enthält Informationen und Analysen über Umfang und Struktur von
Wohnungslosigkeit im Bundesgebiet.

Klara Geywitz, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und
Bauwesen: „Der Bericht zeigt, dass die Obdach- und Wohnungslosigkeit
in Deutschland unterschiedliche Formen und Ursachen hat und bei
weitem kein rein städtisches Problem darstellt. Mit dem Nationalen
Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit hat der Bund daher den Weg
geebnet, abgestimmt mit den Ländern, Kommunen und der
Zivilgesellschaft, die Herausforderung der Bekämpfung der
Obdachlosigkeit langfristig anzugehen.
Hierfür haben wir im
letzten Jahr eine Kompetenzstelle des Bundes beim BBSR eingerichtet.
Derzeit werden dort Maßnahmen erarbeitet, um zum Beispiel Frauen und
Kinder in Obdachlosenunterkünften durch bessere Standards zu
schützen. Um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und damit auch
Menschen, die gegenwärtig wohnungs- und obdachlos sind, eine Wohnung
zu ermöglichen, investiert der Bund bis 2028 mehr als 20 Milliarden
Euro in den sozialen Wohnungsbau.
Auch die neue
Wohngemeinnützigkeit, die am 1. Januar 2025 gestartet ist, kann
hierbei helfen. Und mit der Erhöhung des Wohngeldes zu Jahresbeginn
um durchschnittlich 15% unterstützt der Bund präventiv Menschen, die
durch hohe Miet- und Energiekosten stark belastet werden.“
Zum Wohnungslosenbericht
Im Mittelpunkt des Berichtes stehen
drei Gruppen von wohnungslosen Personen: Die untergebrachten
wohnungslosen Personen, über die das Statistische Bundesamt Daten
erhebt und jährlich eine Statistik erstellt, des Weiteren die
Gruppen der verdeckt wohnungslosen Personen und die der
wohnungslosen Menschen ohne Unterkunft, zu denen das
Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen einen
empirischen Forschungsauftrag vergeben hat, um mittels einer
hochgerechneten Stichprobe entsprechende Informationen zu gewinnen.
Laut der Statistik und der empirischen Erhebung waren Ende
Januar/Anfang Februar 2024 rund 439.500 Personen im System der
Wohnungsnotfallhilfe untergebracht, weitere rund 60.400 Personen bei
Angehörigen, Freunden oder Bekannten untergekommen (verdeckt
wohnungslose Personen).
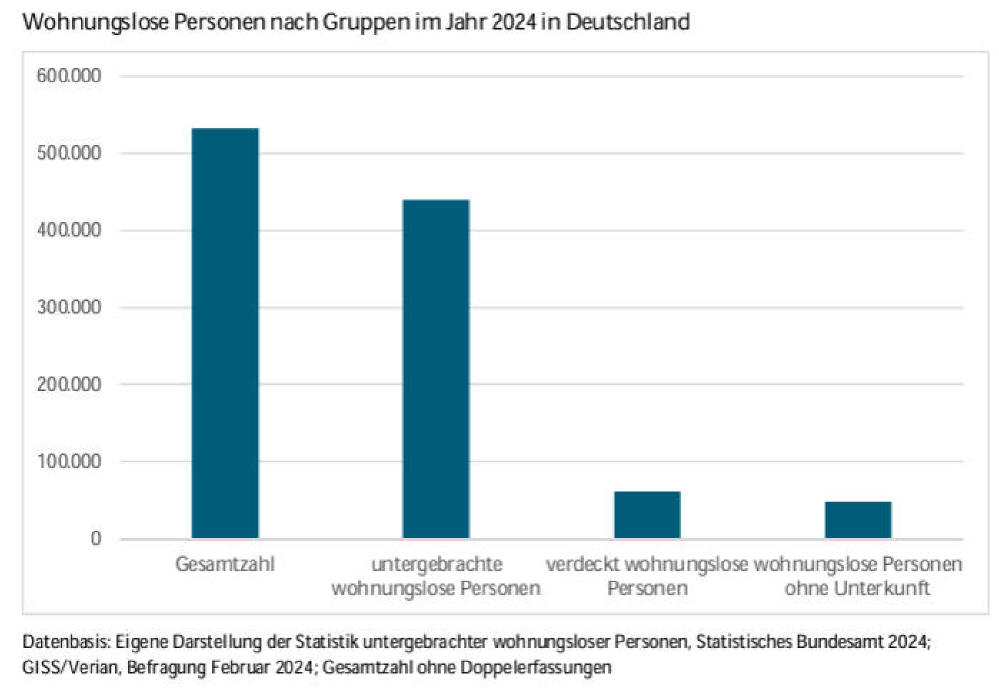
Rund 47.300 Personen lebten auf der Straße oder in
Behelfsunterkünften. Berücksichtigt man rund 15.600
Doppelerfassungen, leben in Deutschland damit insgesamt rund 531.600
wohnungslose Menschen. Dabei umfasst die Statistik untergebrachter
wohnungsloser Menschen gemäß gesetzlicher Definition von
Wohnungslosigkeit auch in Unterkünften für Geflüchtete
untergebrachte Personen, wenn ihr Asylverfahren positiv
abgeschlossen wurde (z. B. Asylberechtigung, Flüchtlingseigenschaft,
subsidiärer Schutz) und sie zur Vermeidung von ansonsten
eintretender Wohnungslosigkeit in der Unterkunft verbleiben.
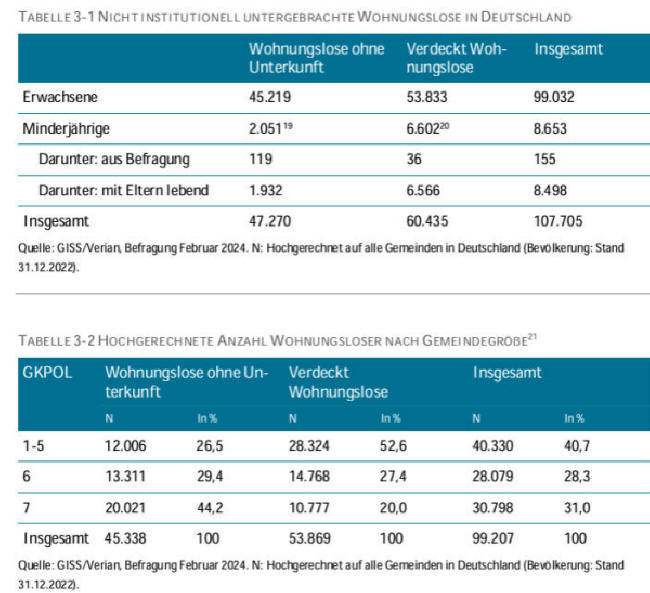
Personen, die eine Aufenthaltserlaubnis über das
Chancen-Aufenthaltsrecht erhalten haben, und Geflüchtete aus der
Ukraine, die im Rahmen einer Aufenthaltsgewährung zum
vorübergehenden Schutz nach § 24 Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
aufgenommen wurden, sind ebenfalls in der Statistik berücksichtigt,
wenn sie untergebracht sind und nicht über einen Mietvertrag oder
Ähnliches verfügen.
All dies sowie die Ausweitung der
Gemeindestichprobe in der aktuellen empirischen Erhebung in
Verbindung mit der Verringerung von Untererfassungen in der
Statistik führt dazu, dass im Vergleich zu 2022 ein Anstieg der
Wohnungslosenzahlen zu verzeichnen ist.
Die
Bundesregierung sieht sich in der Verantwortung, zum Ziel der
Überwindung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit beizutragen und hat
deshalb in Übereinstimmung mit den Initiativen der Europäischen
Union, das Ziel bekräftigt, die Wohnungs- und Obdachlosigkeit bis
zum Jahr 2030 in Deutschland zu überwinden. Hierfür wurde am 24.
April 2024 der Nationale Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit
beschlossen, der als bundesweiter Handlungsleitfaden erstmals die
gemeinschaftlichen Anstrengungen aller Ebenen zur Überwindung der
Wohnungs- und Obdachlosigkeit in Deutschland abbildet.
Er identifiziert Rahmenbedingungen und Herausforderungen. Mit seinen
inhaltlichen Leitlinien und den Leitlinien zum Verfahren gibt es
einen von allen beteiligten Akteuren akzeptierten und abgestimmten
Handlungsrahmen. Mehr Informationen zum Nationalen Aktionsplan gegen
Wohnungslosigkeit finden Sie
hier. Den Wohnungslosenbericht 2024 können Sie
hier
einsehen.
Bundestagswahl 2025: Bundeswahlausschuss
entscheidet über Anerkennung von Parteien In einer
öffentlichen Sitzung entscheidet der Bundeswahlausschuss über die
Anerkennung von politischen Vereinigungen als Parteien zur
Bundestagswahl am 23. Februar 2025. Die Sitzung findet am 13. und
14. Januar 2025, jeweils ab 9:00 Uhr im Deutschen Bundestag in
Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus (Eingang
Adele-Schreiber-Krieger-Straße 1), Raum 3.101 (Anhörungssaal) statt.
Der Bundeswahlausschuss stellt für alle Wahlorgane zur
bevorstehenden Bundestagswahl verbindlich fest, welche Parteien im
Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit deren letzter Wahl
aufgrund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf
Abgeordneten vertreten waren. Diese Parteien können Wahlvorschläge
bei den Landes- und Kreiswahlleitungen einreichen, ohne
Unterstützungsunterschriften vorlegen zu müssen.
Welche
sonstigen Vereinigungen, die der Bundeswahlleiterin ihre Beteiligung
an der Wahl des 21. Deutschen Bundestages angezeigt haben, für diese
Wahl als Parteien im Sinne des § 2 Parteiengesetz anzuerkennen sind
und damit Wahlvorschläge bei den Landes- und Kreiswahlleitungen
einreichen können, für die sie unter anderem entsprechende
Unterstützungsunterschriften nachweisen müssen. Gegen eine
Feststellung des Bundeswahlausschusses kann eine Partei oder
Vereinigung innerhalb von vier Tagen nach Bekanntgabe eine
Beschwerde an das Bundesverfassungsgericht erheben.
Das
Bundesverfassungsgericht muss dann bis zum 23. Januar 2025 über die
Beschwerden entscheiden. Bis zur Entscheidung müssen die Wahlorgane
die Partei oder Vereinigung wie eine wahlvorschlagsberechtigte
Partei behandeln. Bis zum Ablauf der Einreichungsfrist am
7. Januar 2025, 18:00 Uhr haben 56 Vereinigungen der
Bundeswahlleiterin ihre Beteiligung
an der Bundestagswahl 2025 angezeigt (2021: 87
Beteiligungsanzeigen).
Die Sitzung wird live im Internet (www.bundestag.de)
übertragen. Im Nachgang ist sie in der Mediathek des Bundestages (www.bundestag.de/mediathek)
abrufbar.
Bundestagswahl: 56 Parteien und politische
Vereinigungen haben Beteiligung angezeigt
Bis zum
Ablauf der Einreichungsfrist am 7. Januar 2025, 18:00 Uhr haben 56
Parteien und politische Vereinigungen der Bundeswahlleiterin
angezeigt, dass sie sich an der Bundestagswahl 2025 beteiligen
wollen. Wie die Bundeswahlleiterin weiter mitteilt, ist dies für die
meisten Parteien und politischen Vereinigungen Voraussetzung für die
Teilnahme an der Bundestagswahl.
Nur Parteien, die im
Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit deren letzter Wahl
aufgrund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf
Abgeordneten vertreten sind, können ihre Wahlvorschläge direkt bei
den zuständigen Landes- beziehungsweise Kreiswahlleitungen
einreichen. Alle übrigen Parteien und politischen Vereinigungen
müssen zuvor der Bundeswahlleiterin ihre Beteiligung schriftlich
anzeigen.
Im Einzelnen haben folgende Parteien und
politischen Vereinigungen ihre Beteiligungsanzeige bei der
Bundeswahlleiterin eingereicht (Reihenfolge nach Eingang):
Kurzbezeichnung Parteiname Zusatzbezeichnung (nur, wenn im
Wahlverfahren verwendet)
1 PfM Partei für Motorsport
2 BP
Bayernpartei
3 Bündnis GRAL BündnisGRAL - Ganzheitliches Recht
Auf Leben
4 MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands
5 IBD Identitäre Bewegung e.V.
6 PDR Partei der Rentner
Landesverband Berlin
7 BüSo Bürgerrechtsbewegung Solidarität
8 APPD Anarchische Pogo-Partei Deutschlands
9 Anarchie-Partei
10 Anarcho-Partei
11 iNSDAP interNationalSozialistische
Deutsche ArbeiterPartei
12 Ultranation
13 Gartenpartei
Gartenpartei
14 PdH Partei der Humanisten Fakten, Freiheit,
Fortschritt
15 Vereinigte Direktkandidaten
16 dieBasis
Basisdemokratische Partei Deutschland
17 Die
Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer
18 MENSCHLICHE WELT
Menschliche Welt für das Wohl und Glücklichsein aller
19 PDR
Partei der Rentner
20 ZRSD Bundeszentralrat der Schwarzen in
Deutschland
21 Bündnis C Bündnis C - Christen für Deutschland
22 DG Die Guten
23 BÜNDNIS DEUTSCHLAND BÜNDNIS DEUTSCHLAND
24 UNABHÄNGIGE UNABHÄNGIGE für bürgernahe Demokratie
25
Partei Orange
26 DE2040 Deutschland 2040
27 Die PARTEI
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und
basisdemokratische Initiative
28 FREIE SACHSEN FREIE SACHSEN
29 Tierschutzpartei PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ
30
Volksabstimmung Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung Politik
für die Menschen
31 CSC Cannabis Social Club
32 MERA25 MERA25
- Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit
33 ÖDP
Ökologisch-Demokratische Partei Die Naturschutzpartei
34 VPD
Volksstimmen-Partei-Deutschland
35 SSW Südschleswigscher
Wählerverband
36 IDA Initiative für Demokratie und Aufklärung
37 LD Liberale Demokraten – Die Sozialliberalen
38 Die LIEBE
Die LIEBE Europäische Partei
39 Volt Volt Deutschland
40
WerteUnion WerteUnion
41 DAVA Demokratische Allianz für Vielfalt
und Aufbruch
42 SGP Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte
Internationale
43 Verjüngungsforschung Partei für
Verjüngungsforschung
44 THP Thüringer Heimatpartei
45 A L AL
( Partei )
46 PdF Partei des Fortschritts
47 sonstige DIE
SONSTIGEN X
48 DrA Dr. Ansay Partei
49 DIE NEUE MITTE DIE
NEUE MITTE Zurück zur Vernunft.
50 V-Partei³ V-Partei³ - Partei
für Veränderung, Vegetarier und Veganer
51 Bund Köln
52
PIRATEN Piratenpartei Deutschland
53 Unity Party of Germany
54 SAI4Paris Brücke Partei
55 Döner Partei Deutsche Partei für
die ökonomische Neuordnung essentieller Ressourcen
56 –
Wachstumswandel
Über die Anerkennung dieser
Vereinigungen als Parteien für die Bundestagswahl als Voraussetzung
für die Einreichung von Wahlvorschlägen entscheidet der
Bundeswahlausschuss spätestens am 40. Tag vor der Bundestagswahl
(§ 18 Absatz 4 Bundeswahlgesetz in Verbindung mit § 1 Ziffer 1 b)
Verordnung über die Abkürzung von Fristen im Bundeswahlgesetz für
die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag).
Die öffentliche
Sitzung des Bundeswahlausschusses findet daher spätestens am
14. Januar 2025 im Deutschen Bundestag in Berlin,
Marie-Elisabeth-Lüders-Haus (Eingang Adele-Schreiber-Krieger-Straße
1), Raum 3.101 (Anhörungssaal) statt. Hierüber informiert die
Bundeswahlleiterin in einer gesonderten
Pressemitteilung am 8. Januar 2025. Wahlvorschläge von Parteien
müssen bis zum 20. Januar 2025, 18:00 Uhr eingereicht werden, und
zwar als Landeslisten bei den zuständigen Landeswahlleitungen oder
als Kreiswahlvorschläge bei den zuständigen Kreiswahlleitungen.
Aber nicht nur Parteien können Wahlkreisbewerbende
nominieren; auch Gruppen von Wahlberechtigten eines Wahlkreises
können andere Kreiswahlvorschläge für sogenannte „Einzelbewerbende“
bis zum 20. Januar 2025, 18:00 Uhr bei den Kreiswahlleitungen
einreichen. Über die Zulassung der Wahlvorschläge entscheiden je
nach Zuständigkeit die Landes- oder Kreiswahlausschüsse am 24.
Januar 2025. Gemäß § 20 Absatz 2 Satz 2 und § 26 Absatz 1 Satz 3
Bundeswahlgesetz können Kreiswahlvorschläge einer Partei nur dann
zugelassen werden, wenn für die Partei in dem betreffenden Land eine
Landesliste zugelassen wird.
2024 war das wärmste Jahr an Emscher und Lippe
seit 1931
Die Niederschlagsbilanz von
Emschergenossenschaft und Lippeverband für den Dezember 2024 fällt
unterdurchschnittlich aus – anders als noch ein Jahr zuvor, als es
infolge von anhaltendem Dauerregen zu wochenlangen Hochwässern in
der Region kam. Die Bilanz für das gesamte Kalenderjahr 2024 fällt
dagegen wiederum überdurchschnittlich nass aus.
Eine
neue Rekordmarke erreichte die durchschnittliche Jahrestemperatur:
Mit im Mittel 12,3 Grad war 2024 das wärmste bisher aufgezeichnete
Jahr an Emscher und Lippe seit 1931. Der Dezember 2024 ist mit 62,7
mm im Emscher-Gebiet und 57,2 mm im Lippe-Gebiet nur
unterdurchschnittlich nass gewesen. Ein Millimeter entspricht einem
Liter Regen pro Quadratmeter.
Der größte
Tagesniederschlag fiel in beiden Flusseinzugsgebieten jeweils am 5.
Dezember 2024. An diesem Tag fielen im Emscher-Gebiet maximal 22,3
mm an der Station Mülheim an der Ruhr-Frohnhauser Weg. Im Gebiet des
Lippeverbandes fiel der maximale Tagesniederschlag an der Station
Hünxe-Schacht Lohberg. Dort fielen 21,7 mm innerhalb eines Tages. Im
Dezember gab es zwei längere Phasen ohne oder mit kaum Niederschlag.
Einmal vier Tage vom 10. bis zum 13. Dezember und einmal sieben Tage
vom 25.12. bis zum 31. Dezember.
Das Monatsmittel der
Lufttemperatur im Dezember betrug 5,1 Grad. Damit liegt der Dezember
1,2 Grad über dem langjährigen Mittel von 3,9 Grad. Kalenderjahr
2024 Der Niederschlag im Kalenderjahr 2024 war im Gegensatz zum
Dezember-Monat überdurchschnittlich nass. Im Emscher-Gebiet liegt
der Jahresniederschlag mit 931 mm deutlich über dem 130-jährigen
Mittel von 799 mm.
Damit landet das Kalenderjahr 2024
auf Platz 13 der vergangenen 94 Kalenderjahre. Im Gebiet des
Lippeverbandes liegt der Jahresniederschlag bei 874 mm und somit
auch deutlich über dem 130-jährigen Mittel von 766 mm. Das bedeutet
im Lippe-Gebiet Platz 20 der vergangenen 94 Kalenderjahre. Es folgt
also auf das Rekordjahr 2023 ein weiteres überdurchschnittlich
nasses Jahr.
Wie bereits bei der Auswertung des
Wasserwirtschaftsjahres 2024 (November 2023 bis Oktober 2024) war
der Mai im Kalenderjahr 2024 der Monat mit dem meisten Niederschlag.
Deutlich nasser als das Mittel waren auch der Februar und der April.
Einzig die Monate Juli und Dezember waren unterdurchschnittlich. Das
Jahresmittel der Lufttemperatur lag bei 12,3 Grad (langjähriges
Mittel: 10,7 Grad) und knackt somit den bisherigen Höchstwert aus
dem vorherigen Jahr von 12,2 Grad.
Damit ist das
Kalenderjahr 2024 im EGLV-Gebiet das wärmste bisher aufgezeichnete
Kalenderjahr ab 1931. Emschergenossenschaft und Lippeverband
Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV) sind
öffentlich-rechtliche Wasserwirtschaftsunternehmen, die als Leitidee
des eigenen Handelns das Genossenschaftsprinzip leben. Die Aufgaben
der 1899 gegründeten Emschergenossenschaft sind unter anderem die
Unterhaltung der Emscher, die Abwasserentsorgung und -reinigung
sowie der Hochwasserschutz.
Der 1926 gegründete
Lippeverband bewirtschaftet das Flusseinzugsgebiet der Lippe im
nördlichen Ruhrgebiet und baute unter anderem den Lippe-Zufluss
Seseke naturnah um. Gemeinsam haben Emschergenossenschaft und
Lippeverband rund 1.700 Beschäftigte und sind Deutschlands größter
Abwasserentsorger und Betreiber von Kläranlagen und Pumpwerken (rund
782 Kilometer Wasserläufe, rund 1533 Kilometer Abwasserkanäle, 546
Pumpwerke und 59 Kläranlagen). www.eglv.de
Anschlussqualifizierung 160 + nach QHB für
Kindertagespflegepersonen
Noch freie Plätze für März 2025
Die Betreuung von Kindern ist eine verantwortungsvolle
und erfüllende, aber auch herausfordernde Aufgabe. Zur Sicherung
einer qualitativ guten pädagogischen Arbeit bedarf es einer
kontinuierlichen Vertiefung des Fachwissens sowie einer
Kompetenzerweiterung. Die angebotene Anschlussqualifizierung richtet
sich an aktive Kindertagespflegepersonen (tätigkeitsbegleitend) und
wird nach dem Curriculum des Qualifizierungshandbuches (QHB)
durchgeführt.
Zu den Themenschwerpunkten gehören u. a.
Frühpädagogik, Kompetenzentwicklung, Profilbildung und Reflexion der
eigenen Praxis. Nach einer erfolgreichen Lernergebnisfeststellung,
die sich aus schriftlicher und mündlicher Leistung zusammensetzt,
erlangen Sie das bundesweit gültige Zertifikat des Bundesverbandes
Kindertagespflege (Stufe 2): „Qualifizierte Kindertagespflegeperson
nach dem Kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch (QHB) nach
140 Unterrichtseinheiten tätigkeitsbegleitend“.
Die
Anschlussqualifizierung startet am 20.03.2025 und findet in
Kooperation mit dem Jugendamt Duisburg und dem Bundesverband für
Kindertagespflege e. V. statt. Die Inhalte werden in einem
praxisorientierten und lebendigen Unterricht 1–2 mal wöchentlich,
werktags im Abendbereich und samstags, vermittelt.
Der
Kurs findet in den Räumlichkeiten der
AWO-Familienbildung/Mehrgenerationenhaus auf der Düsseldorfer Str.
505 in 47055 Duisburg statt. Auskunft und Anmeldungen unter
AWO-Campus gGmbH, Jessica Buschmann, Tel. 0203 3095-647,
buschmann@awo-campus.de. Alle Infos zum Kursprogramm der
AWO-Familienbildung unter:
www.familienbildung-duisburg.de
Sorge um
Tiere bei Zoo Zajac: PETA fordert Insolvenzverwalter auf,
Geschäftsbetrieb ohne Tierhandel fortzuführen und Versorgung der
Tiere höchste Priorität einzuräumen
Tierverkaufsstopp
längst überfällig:
Medienberichten zufolge hat das Zoogeschäft Zoo Zajac GmbH in
Duisburg kurz vor Weihnachten ein vorläufiges Insolvenzverfahren
beantragt. Das Unternehmen beschäftigt 150 Mitarbeitende und
beherbergt etwa 200.000 Tiere. PETA hat sich gestern mit einem
Schreiben an die vorläufige Insolvenzverwalterin, die Rechtsanwältin
Sarah Wolf von Anchor Rechtsanwälte, gewandt.
Die
Tierrechtsorganisation warnte darin vor einer raschen Einstellung
des Geschäftsbetriebs. Dieser könnte dazu führen, dass eine hohe
Anzahl Tiere ohne Unterbringung und Versorgung dastünden. PETA
forderte zudem – auch an potenzielle Investoren gerichtet – ein Ende
des Verkaufs von fühlenden Lebewesen bei Zoo Zajac und dass die
verbleibenden Tiere unter Aufsicht der zuständigen Behörden
sukzessive vermittelt werden.
„Als
Tierschutzorganisation machen wir uns große Sorgen um die Versorgung
der verbleibenden Tiere bei Zoo Zajac. Behörden und
Tierschutzvereine wären völlig überfordert, sollte das Geschäft von
heute auf morgen schließen. Wichtig ist auch, dass ab sofort keine
neuen Tiere mehr von den Zuchtbetrieben eingekauft werden“, so Jana
Hoger, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei PETA.
„Unsere Tierheime in Deutschland sind überfüllt und stehen an ihrer
Kapazitätsgrenze – der Tierverkauf ist mit dem Tierschutz nicht
vereinbar. Aus diesem Grund fordern wir das Ende des Tierhandels bei
Zoo Zajac als wichtiges Zeichen für all die Lebewesen, die in den
vergangenen Jahren in der Zoohandlung gelitten haben.“
Wiederholte Tierschutzverstöße bei Zoo Zajac Zoo Zajac ist nach
eigenen Angaben der größte Tierfachhandel der Welt. Auf etwa 12.000
Quadratmetern werden unter anderem hochsensible „exotische“ Tiere
wie Faultiere, Reptilien und Vögel ausgestellt und angeboten.
Bereits in der Vergangenheit ist die Zoohandlung aufgrund massiver
Tierschutzverstöße immer wieder in die Kritik geraten. Im August
2024 veröffentlichte PETA
Aufnahmen von verhaltensauffälligen Frettchen und Faultieren,
sowie Rochen, die unter artwidrigen Bedingungen gehalten und zu
Besuchermagneten degradiert wurden.
2023 ist das
Unternehmen endlich aus dem
Verkauf von Hundewelpen ausgestiegen. Anfang 2023 wurde dem
Unternehmen eine tierschutzwidrige Erdmännchenhaltung nach Anzeige
von PETA untersagt. Tiere leiden für den Verkauf in Zoohandlungen
Aber auch der Verkauf von Kleintieren ist mit dem Tierschutz nicht
vereinbar. PETA veröffentlichte immer wieder
Aufnahmen, die erschreckende Zustände hinter den Kulissen der
Heimtierbranche belegen. Kleintiere werden in großen Zuchtanlagen
massenhaft „produziert“ und gewinnbringend vermarktet.
Aus Tierschutzsicht gibt es keine verantwortungsvolle Zucht, denn
jedes gezüchtete Tier nimmt einem Tier im Tierheim die Chance auf
ein neues Zuhause. PETAs Motto lautet: Tiere sind nicht dazu da,
dass wir an ihnen experimentieren, sie essen, sie anziehen, sie uns
unterhalten oder wir sie in irgendeiner anderen Form ausbeuten.
Die Organisation setzt sich gegen Speziesismus ein – eine
Form von Diskriminierung, bei der Tiere aufgrund ihrer
Artzugehörigkeit abgewertet werden. Der Mensch wird hierbei allen
anderen Spezies gegenüber als überlegen angesehen. Daneben wird auch
zwischen verschiedenen Tierarten unterschieden: So werden
beispielsweise Schweine, Rinder und Hühner gequält und getötet,
Hunde und Katzen hingegen liebevoll umsorgt.

Im Duisburger Unternehmen Zoo Zajac werden fühlende Lebewesen zur
Massenware degradiert. Dort werden neben Hunden, Katzen und anderen
beliebten sogenannten „Haustieren“
auch Exoten und
andere Wildtiere zum Verkauf angeboten. Erfahren Sie hier alles über
das fragwürdige Geschäft
mit Tieren bei Zoo Zajac. Fotos PETA
Vor 10
Jahren in der BZ:
Wiedereröffnung des Kleinen Saals der Mercatorhalle
im Januar
Nach fast zweieinhalb
Jahren stehen die Sanierungsarbeiten im Kleinen Saal der
Mercatorhalle im CityPalais nun kurz vor ihrem Abschluss. Im Rahmen
einer musikalischen Veranstaltung eröffnet der Kleine Saal am
Freitag, 9. Januar, mit einer Mozart-Serenade. Oberbürgermeister
Sören Link: „Ich freue mich sehr, dass hiermit ein weiterer und
sichtbarer Schritt vollzogen ist auf dem Wege, unsere Konzert- und
Veranstaltungshalle den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Gästen der
Stadt Duisburg wieder komplett zugänglich zu machen.
Gleichzeitig haben wir endlich einen genehmigten Bauantrag für die
Gesamtmaßnahme Mercatorhalle vorliegen, so dass wirklich Licht am
Ende des Tunnels zu sehen ist. Die Mercatorhalle galt in der
Vergangenheit immer als gute Stube der Stadt – ich bin mir sicher,
dass sie es auch zukünftig wieder sein wird. Mein Dank geht an das
Immobilien-Management Duisburg und an alle Beteiligten, die dieses
schwierige Projekt in den letzten zwei Jahren aus der Krise geführt
haben – im Besonderen an Kulturdezernent Thomas Krützberg, der als
Projektleiter viel Energie investiert hat.“
Kulturdezernent
Thomas Krützberg: „Die Wiedereröffnung des Kleinen Saals ist ein
Etappensieg. Den wollen und werden wir feiern. Aber dann wird weiter
gearbeitet, denn das große Ziel, die Eröffnung des Großen Saals,
steht noch aus.“

Im kleinen Saal stellte sich heraus, dass die verbauten
Deckenaufhängungen nicht den Schwingungen der Musik
standhalten, sondern von den Deckenhalterungen, im Laufe der
Zeit, abrutschen können. Die Firma, eine renommiertes
Unternehmen mit gutem Ruf, hat diesen Mangel
zwischenzeitlich behoben.
Schutz vor „K.o.-Mieten“ im Alter durch Wohneigentum – Aktuelle
Fakten zum Wohneigentum für den Bund, alle Bundesländer, Städte und
Kreise
Die eigenen vier Wände – für einen Haushalt mit
Durchschnittseinkommen: Fehlanzeige. Die meisten Menschen haben
keine Chance auf eine Eigentumswohnung, ein Reihenhaus oder ein
Einfamilienhaus. Besonders kritisch wird das im Alter. Denn
Wohneigentum schützt vor Altersarmut. Viele drohen deshalb in die
„Wohn-Armut“ zu rutschen: Altersarmut durch „K.o.-Mieten“. Hier hat
die Bundespolitik versagt. Sie hat jetzt schon einer ganzen
Generation die Chance auf Wohneigentum verbaut. Es wird deshalb
höchste Zeit, dass die neue Bundesregierung das Ruder herumreißt.
Das ist das Fazit der aktuellen Wohnungsbau-Studie, die das
Pestel-Institut (Hannover) auf einer Hybrid-Pressekonferenz zum
Auftakt der Fachmesse BAU in München am kommenden Montag (13.
Januar) vorstellen wird.
Titel der Studie:
Schutzschirm vor
Altersarmut: Wohneigentum in Deutschland
Mit Zahlen für den Bund,
für alle Bundesländer, für Städte und Kreise
Konkrete Zahlen,
Fakten und Daten zum „Wohneigentum in Deutschland“ wird das
Pestel-Institut bei der Vorstellung der Studie auf der
Hybrid-Pressekonferenz präsentieren – für Deutschland, alle
Bundesländer sowie für Städte und Kreise. Dabei wird es u.a. auch um
diese Inhalte gehen:
Deutschland-Ranking – Wohneigentums-Quote
§ TOP 10 der Mieter-Städte – TOP 10 der Eigentümer-Städte
§
Eigentümer-/Mieterquote – Zahlen für alle kreisfreien Städte in
Deutschland (über 100 Städte)
§ Trends und Entwicklungen in
Deutschland – mit Europa-Vergleich
Deutschland-Check (für
alle Städte und Kreise): Miete oder Wohneigentum?
§ Analyse für
alle kreisfreien Städte und Kreise: Mieten oder Wohnungskauf/
Hausbau – wo ist wie viel Wohneigentum machbar?
„Preis-Explosion“
§ Welche Kostensprünge hat es in nur 10 Jahren beim Wohneigentum
gegeben? – Mit einem Vergleich zur allgemeinen Preisentwicklung.
§ Hemmnisse: Woran scheitert die Anschaffung (Bau und Kauf) eines
Eigenheims bzw. einer eigenen Wohnung?
„Machbarkeits-Check
Wohneigentum“
§ Eigentümer-Profil: Wer kann sich Wohneigentum
noch leisten – in welchem Alter, mit welchem Einkommen?
§ Kosten
von Einfamilienhäusern (100 m²) für alle Städte und Kreise
(Angebotspreise)
Eigentümer-Quote erhöhen
§ Förderung fürs
Eigenheim und für die Eigentumswohnung:
Wie müsste eine effektive
Unterstützung vom Staat aussehen?
§ Kalkulation für einen
Muster-Haushalt mit durchschnittlichem Einkommen
Altersvorsorge
Wohneigentum
§ Haus und Eigentumswohnung versus Gefahr von
Grundsicherung im Alter durch hohe Mieten
§ Dazu der
Renten-Check: Wie ist die aktuelle und die künftige
Einkommenssituation der Senioren?
Prognose
§ Wie würde
mehr Wohneigentum die Mieten ins Rutschen bringen?
Polit-Positionen im Bundestagswahlkampf
§ Wie stehen die Parteien
zum Wohneigentum?
§ „Merz-Mini-Haus“ im Check: Wissenschaftler
beurteilen das Wahlversprechen von CDU/CSU-Kanzlerkandidat Friedrich
Merz zum „Bau-Turbo-Programm“ für erschwingliche Mini-Häuser.
Hochheide: Musikvereinigung Duisburg-West spielt in
der Glückauf-Halle
Die „Musikvereinigung Duisburg-West“
spielt am Sonntag, 12. Januar 2025, ab 11 Uhr Werke aus ihrem
umfangreichen Repertoire in der Glückauf-Halle, Dr. Kolb-Straße 2,
in Hochheide. Damit startet der Bezirk Homberg/Ruhrort/ Baerl auch
2025 mit einem Neujahrskonzert in das neue Veranstaltungsjahr Mit
dabei sind Lieder von Coldplay, Prince, Roxette, Elton John und
Frank Sinatra, aber auch von deutschen Interpreten.
So
kann man in festlicher Atmosphäre und guter Laune das neue Jahr
beginnen. Der Eintritt beträgt 10 Euro, ermäßigt 5 Euro. Karten sind
im Bürgerservice des Bezirksrathauses Homberg, Bismarckplatz 1,
erhältlich, oder können per E-Mail unter
kulturbuero@stadt-duisburg.de reserviert werden. An der Tageskasse
kann man ebenfalls Karten erwerben.

Foto Musikvereinigung Duisburg-West
Taizé-Gottesdienst in Großenbaum Instrumentalistinnen
und Instrumentalisten für Projektorchester gesucht
Auch
für den diesjährigen Taizé-Gottesdienst in der Großenbaumer
Versöhnungskirche stellt Annette Erdmann, Kirchenmusikerin der
Evangelischen Versöhnungsgemeinde Duisburg-Süd, ein Projektorchester
zusammen. Interessierte, die ein Streichinstrument oder ein Holz-
oder Blechblasinstrument spielen, sind herzlich eingeladen, in
diesem Gottesdienst musikalisch mitzuwirken und vorher auch
gemeinsam zu proben.
Anmeldungen sind bis zum 15. Januar
bei Kantorin Erdmann (Tel. 0203/767709) möglich (die
Instrumentalnoten werden vor der ersten Probe zugeschickt). Die
Musikfans kommen zu den gemeinsamen Proben am 11. Februar im
Gemeindehaus, Lauenburger Allee 21, und am 18. Februar in der
Versöhnungskirche, Lauenburger Allee 23 zusammen – jeweils von 17.30
Uhr bis 19.15 Uhr.
Die Generalprobe mit Projektorchester
ist am Samstag, 22. Februar 2025 von 10 bis 11.30 Uhr in der
Versöhnungskirche, einen Tag vor dem Gottesdienst. Infos zur
Gemeinde gibt es im Netz unter https://www.evgds.de. Der
Taizé-Gottesdienst hat die Gesänge und Texte der „Communauté de
Taizé“ zum Inhalt. Die Atmosphäre ist geprägt von stimmungsvoller
Beleuchtung und Musik und kurzen Textimpulsen.
Gemeinsam mit
Momenten der Stille, aber auch eingängigen meditativen
Gebetsgesängen soll so der Weg für die verbindende Erfahrung der
Gegenwart Gottes geöffnet werden.

Taizé-Gottesdienst in der Versöhnungskirche Großenbaum (Foto:
https://www.evgds.de)
Hoffnung für die Welt:
Allianz-Gebetswoche im Duisburger Norden mit Gebetskonzert
Die 1846 gegründete weltweite Bewegung der Evangelischen Allianz
lädt wieder zur internationalen Gebetswoche ein. Diesmal steht sie
unter dem Motto „Miteinander Hoffnung leben“. Auch die der
Evangelischen Allianz Duisburg Nord zugehörigen christlichen
Gemeinden und Vereine laden in dieser Zeit zu Andachten, Gesprächen
und Gottesdienste ein.
Wie immer gibt es zum Auftakt ein
Gebetskonzert, diesmal am Montag, 13. Januar 2025 um 19.30 Uhr in
der evangelischen Kirche in Obermeiderich, Emilstr. 27-29; es steht
unter dem Motto „Hoffnung für die Welt“. Sängerin Elena Becker, die
von Jannik Becker an der Akustikgitarre und am Klavier von Joshua
Plewka begleitet wird, will mit jedem Lied zum Innehalten einladen,
zur Einkehr mit sich selbst. „Und was ist da zu entdecken in der
Atempause unserer Geschäftigkeit?“ fragt sie im Vorfeld des
Konzertes.
„Trauer? Wut? Bedingungslose Liebe? Gott?
Vielleicht.“ Der Eintritt ist frei. Im Duisburger Norden sind
außerdem folgende Gottesdienste im Rahmen der Gebetswoche geplant:
Mittwoch, 15. Januar 2025, 19.30 Uhr: Landeskirchliche
Gemeinschaft, Wiesbadener Str. 102
Freitag, 17. Januar 2025,
19.30 Uhr: Gemeinde Gottes, Schulte-Marxloh-Straße 2
Sonntag,
19. Januar 2025, 11 Uhr: Gemeinsamer Abschlussgottesdienst im
Gemeindezentrum der Evangelischen Gemeinde Obermeiderich, Emilstr.
27-29

Die evangelische Kirche Obermeiderich an der Emilstraße (Foto:
Tanja Pickartz).

Einzelhandelsumsatz im Jahr 2024 real voraussichtlich um
1,3 % höher als 2023
Einzelhandelsumsatz,
Jahresergebnis 2024 (Schätzung, vorläufig)
+1,3 % im Jahr 2024
gegenüber 2023 (real, Originalwerte)
+2,7 % im Jahr 2024
gegenüber 2023 (nominal, Originalwerte)
+1,1 % im Jahr 2024
gegenüber 2023 (real, kalender- und saisonbereinigt)
+2,5 % im
Jahr 2024 gegenüber 2023 (nominal, kalender- und saisonbereinigt)
Einzelhandelsumsatz, November 2024 (vorläufig, kalender- und
saisonbereinigt)
-0,6 % zum Vormonat (real)
-0,6 % zum
Vormonat (nominal)
+2,5 % zum Vorjahresmonat (real)
+3,5 % zum
Vorjahresmonat (nominal)
Der Einzelhandel in
Deutschland hat nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes
(Destatis) im Jahr 2024 real (preisbereinigt) 1,3 % und nominal
(nicht preisbereinigt) 2,7 % mehr Umsatz erwirtschaftet als im Jahr
2023. Nachdem die reale Umsatzentwicklung im Einzelhandel im 1.
Halbjahr 2024 gegenüber dem Vorjahreszeitraum rückläufig war (-0,4
%), verzeichneten die realen Umsätze im 2. Halbjahr einen Zuwachs
von schätzungsweise 3,0 %.
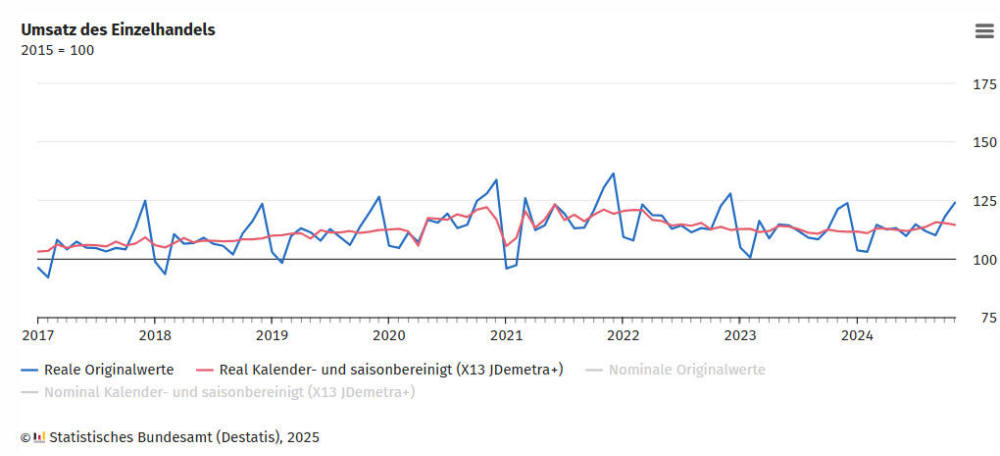
Im Vergleich zu 2021, als der deutsche Einzelhandel den bisher
höchsten Umsatz seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1994 erzielte, lag
der reale Jahresumsatz 2024 voraussichtlich um 2,7 % niedriger.
Während der Corona-Pandemie im Jahr 2020 hatte der Einzelhandel,
unter anderem getragen durch den Internet- und Versandhandel, einen
hohen realen Umsatzzuwachs von 4,8 % gegenüber dem Vorjahr erzielt,
2021 war der Umsatz nochmals um real 0,6 % gestiegen.
Im
Gegensatz hierzu war die reale Umsatzentwicklung in den Jahren 2022
und 2023 aufgrund der hohen Preissteigerungen rückläufig
(-0,7 % bzw. -3,3 %). Dennoch lagen die realen Umsätze im Jahr 2024
voraussichtlich 2,6 % über dem Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019.
• Weihnachtsgeschäft
im November 2024: Umsatz real 2,5 % höher als im Vorjahresmonat
In den vergangenen Jahren hat sich ein Teil des Weihnachtsgeschäfts
durch Sonderaktionen in den Tagen rund um den „Black Friday“ oder
den „Cyber Monday“, vor allem im Internet- und Versandhandel,
zunehmend in den November vorverlagert. Im November 2024 setzten die
Einzelhandelsunternehmen nach vorläufigen Ergebnissen kalender- und
saisonbereinigt real 2,5 % und nominal 3,5 % mehr um als im November
2023.
Im Vormonatsvergleich sank der kalender- und
saisonbereinigte Umsatz im November 2024 gegenüber Oktober 2024
sowohl nominal als auch real um 0,6 %. Umsätze im Einzelhandel mit
Lebensmitteln sowie mit Nicht-Lebensmitteln mit Zuwächsen am
Jahresende Im Einzelhandel mit Lebensmitteln stieg der kalender- und
saisonbereinigte Umsatz im November 2024 im Vergleich zum November
2023 real um 1,7 % und nominal um 4,1 %.
Bereits im
Oktober 2024 hatte der Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel gegenüber
dem Vorjahresmonat einen Anstieg von real 1,2 % und nominal 3,8 %
verzeichnet. Nachdem die Umsätze von Januar bis September 2024 nur
leicht über denen des Vorjahreszeitraums gelegen hatten (real
+0,3 %), legte die Umsatzentwicklung im Einzelhandel mit
Lebensmitteln zum Jahresende somit deutlich zu. Im
Vormonatsvergleich stieg der Umsatz im November 2024 mit real +0,1 %
und nominal +0,2 % gegenüber Oktober 2024 nur leicht.
Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich auch im Einzelhandel mit
Nicht-Lebensmitteln. Hier stieg der kalender- und saisonbereinigte
Umsatz im November 2024 real um 2,3 % und nominal um 2,5 % gegenüber
dem Vorjahresmonat. Bereits im September 2024 und Oktober 2024 hatte
der reale Umsatz gegenüber dem jeweiligen Vorjahresmonat einen
deutlichen Anstieg erfahren (+7,8 % und +2,3 %), nachdem die Umsätze
von Januar bis August 2024 real 0,7 % unter denen des
Vorjahreszeitraums gelegen hatten.
Im Vormonatsvergleich
sank der reale Umsatz im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmittel im
November 2024 gegenüber Oktober 2024 real um 1,8 % und nominal um
1,7 %. Diese Entwicklung wurde getragen vom Internet- und
Versandhandel, der im November 2024 einen realen Umsatzanstieg von
9,7 % zum November 2023 erzielte, jedoch gegenüber Oktober 2024
einen realen kalender- und saisonbereinigten Umsatzrückgang von
1,2 % verzeichnete.