






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 8. Kalenderwoche:
21. Februar
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Samstag, 22., Sonntag, 23. Februar 2025
A40, Erweiterung der A 40 inkl. Ersatzneubau
Rheinbrücke Neuenkamp: Vollsperrung Anschlussstelle Duisburg-Häfen
Ost
Von Samstag, 22. Februar, 15 Uhr, bis Montag, 24.
Februar, 4 Uhr wird die Anschlussstelle Duisburg-Häfen Ost voll
gesperrt, sowohl die Auffahrt als auch die Abfahrt sind nicht
nutzbar. Die Umleitungsstrecken (Rote-Punkt-Umleitungen) werden
frühzeitig eingerichtet.
Sie führen die
Verkehrsteilnehmenden Fahrtrichtung Venlo ab Autobahnkreuz Duisburg,
weiter über die A 59, zur Anschlussstelle Duisburg-Ruhrort und
weiter Richtung Ruhrort. Ansonsten kann die Umleitung bis zur
Anschlussstelle Rheinhausen genutzt werden, folgen dann weiter der A
40 Fahrtrichtung Essen und verlassen an der Anschlussstelle
Duisburg-Häfen West die Autobahn.
Um von Ruhrort auf die
A 40 zu gelangen, folgen die Verkehrsteilnehmenden ab der
Bürgermeister-Karl-Lehr-Brücke, weiter über den Ruhrdeich zum
Autobahnkreuz Duisburg-Kaiserberg auf die A 40. Im städtischen Netz
folgen die Verkehrsteilnehmenden bitte der Umleitungsstrecke U 55.
IHK beunruhigt: Schließung von HKM hätte
schwerwiegende Folgen für Duisburg und NRW
Gescheiterter Verkauf nährt Sorgen um Fortbestand des
Traditionsunternehmens. Thyssenkrupp bemüht sich als Miteigentümer
um den Verkauf des Stahlwerkes HKM. Nun wurde bekannt, dass der
Hamburger Investor CE Capital aus den Verhandlungen ausgestiegen
ist. Wenn sich kein neuer Eigentümer findet, droht die Schließung
von Kokerei und Hochöfen. Das bedeutet auch das Aus für 3000 Jobs in
Duisburg.
Dazu Matthias Wulfert (Foto: Niederrheinische
IHK/Jacqueline Wardeski), stellvertretender Hauptgeschäftsführer der
Niederrheinischen IHK: „Wir bedauern, dass die Gespräche zum
Verkauf von HKM gescheitert sind. Stahl ist die Basis für viele
Produkte ,Made in Germany‘. Er ist auch für unsere Unabhängigkeit
und die Verteidigung wichtig. Wir hoffen sehr, dass für HKM noch
eine Lösung gefunden wird. Neben 3000 Beschäftigten sind rund 1500
Arbeitsplätze bei Stahl-Verarbeitern unmittelbar bedroht. Doch die
indirekten Effekte dürften weitaus gravierender sein: Von sinkenden
Steuereinnahmen, über fehlende Investitionen in unseren Standort bis
zu den mittelbar betroffenen Dienstleistern rund um das Werk.

Bund und Land müssen mit den betroffenen Akteuren und uns ein
Zukunftskonzept für unseren Stahlstandort entwickeln. Deshalb
brauchen wir nach der Bundestagswahl sehr schnell Klarheit. Und eine
Wirtschaftspolitik, die verlässliche Rahmenbedingungen für die
Transformation der Stahlindustrie schafft. Wir dürfen die
Stahlunternehmen und die Menschen nicht im Stich lassen.“
Kampagnen für Demokratie: Kultur- und Wirtschaftsinitiativen
aus dem Ruhrgebiet rufen zur Bundestagswahl auf
Für
demokratische Werte, Vielfalt und eine freie Gesellschaft:
Ruhrgebietsinitiativen aus der Kultur und der Wirtschaft machen sich
anlässlich der Bundestagswahl mit eigenen Kampagnen stark für die
Demokratie. Das Netzwerk der RuhrBühnen, dem elf städtische Theater
im Ruhrgebiet sowie die Festivals Ruhrtriennale und Ruhrfestspiele
angehören, geht mit der Kampagne "RuhrBühnen für die Demokratie" an
den Start.
Ziel ist es, die aktuellen antidemokratischen
Entwicklungen in den Fokus zu rücken und das enge Verhältnis von
Kunst und Demokratie zu unterstreichen. Im Zentrum steht ein
gemeinsamer Veranstaltungskalender: Tagesaktuell ausgewählte
Produktionen und Formate der 13 Netzwerkmitglieder, die eine
besondere Relevanz für die Demokratie haben und zu den derzeitigen
populistischen Strömungen Stellung beziehen, sind hier zu finden.
"RuhrBühnen für die Demokratie" ist Teil der
bundesweiten Kampagne "Theater und Orchester für die Demokratie" des
Deutschen Bühnenvereins. Der Veranstaltungskalender ist zu finden
auf
https://www.ruhrbuehnen.de/ Auch der Initiativkreis Ruhr ruft
zur Teilnahme an der Bundestagswahl auf und wirbt für Demokratie und
Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland.
Mehr als 70
Partnerunternehmen und Institutionen haben sich zusammengeschlossen,
um die Bedeutung dieser Wahl zu unterstreichen. Unter dem Slogan
"Starke Demokratie, starke Wirtschaft, starkes Ruhrgebiet" posten
CEOs und Geschäftsführende persönliche Wahlaufrufe in den sozialen
Medien, um insbesondere Nicht-Wählerinnen und -Wähler sowie
Unentschlossene zur Teilnahme aufzurufen.
"Ich
wähle, weil mir das Gemeinwohl und der gesellschaftliche
Zusammenhalt am Herzen liegen. Die Werte der Demokratie und der
Freiheit werden nur durch aktive Mitwirkung gestärkt und
verteidigt", äußert sich Garrelt Duin, Regionaldirektor des
Regionalverbandes Ruhr, im Rahmen der Kampagne. idr
Weitere
Mitwirkende sind u. a. die RAG-Stiftung, Evonik oder das Uniklinikum
Essen. Informationen auf
https://initiativkreis-ruhr.de/
Die Stimme
einsetzen für ein respektvolles Miteinander und gegen Ausgrenzung
Superintendent Dr. Urban ruft in seiner Video-Botschaft zum
Wählen auf Kurz vor der Bundestagswahl ruft Pfarrer Dr. Christoph
Urban zur Stimmabgabe auf. Er bittet in seinem Videostatement:
„Gehen Sie wählen – wählen Sie demokratisch und setzen Sie sich mit
ihrer Stimme gegen Ausgrenzung und für ein respektvolles Miteinander
ein.“
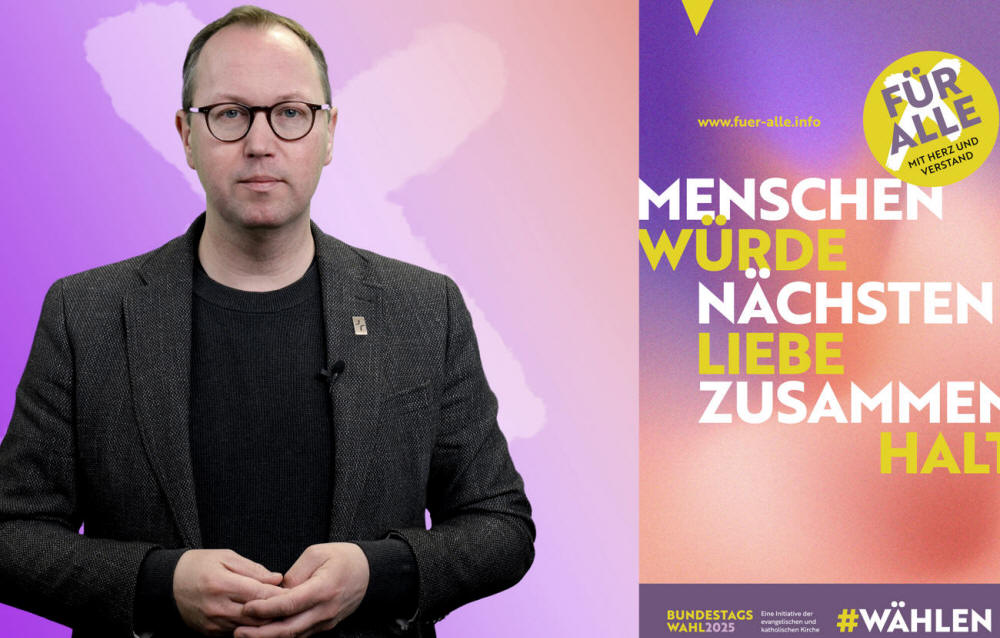
Der Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Duisburg
benennt in seinem Beitrag, was Gläubige bei der Wahl, aber auch
generell im Leben leitet und hält: „Menschenwürde, Nächstenliebe und
Zusammenhalt sind uns als Kirche wichtig. (…) Wir vertrauen auf
Gottes verbindende Kraft, die Grenzen, Fremdheit und sogar
Feindschaft überwindet.“ Das Video ist auf dem Youtubekanal
„Evangelisch in Duisburg“ zu sehen.
Infos zum Kirchenkreis,
den Gemeinden und Einrichtungen gibt es im Netz unter
www.kirche-duisburg.de.
Bald ist Bundestagswahl. Zunächst kam der Wahlkampf nicht so
recht in Gang, doch nun wird er hitzig. In solchen Momenten ist es
wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren und das große Ganze im Blick
zu behalten. Menschenwürde, Nächstenliebe und Zusammenhalt sind uns
als Kirche wichtig. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes und besitzen
eine unveräußerliche Würde.
Jesus hat Nächstenliebe
gepredigt und vorgelebt. Wir vertrauen auf Gottes verbindende Kraft,
die Grenzen, Fremdheit und sogar Feindschaft überwindet. Ich bitte
Sie: Gehen Sie wählen – wählen Sie demokratisch und setzen Sie sich
mit ihrer Stimme gegen Ausgrenzung und für ein respektvolles
Miteinander ein.
150 Jahre
Trinkwasserversorgung: Stadtwerke Duisburg feiern Jubiläumsjahr
Seit 150 Jahren versorgen die Stadtwerke Duisburg die Bürgerinnen
und Bürger der Stadt an Rhein und Ruhr zuverlässig mit sauberem
Trinkwasser. Im Frühjahr 1875 begann die Erfolgsgeschichte mit den
Arbeiten zur Errichtung des ersten städtischen Wasserwerks an der
Aakerfähre und der zugehörigen Infrastruktur in den Ruhrauen. Schon
Ende 1875 floss das erste Wasser in die Stadt zur Versorgung der
damals 36.706 Einwohner.
Auftakt am internationalen Tag
des Wassers
Die Stadtwerke Duisburg feiern das Jubiläumsjahr mit
einer Reihe von spannenden Veranstaltungen und Aktionen für alle
Duisburgerinnen und Duisburger. Den Startpunkt setzt der
internationale Tag des Wassers am Samstag, 22. März. Ab 9 laden die
Stadtwerke in den Zoo Duisburg ein. An diesem Tag erwartet große und
kleine Duisburgerinnen und Duisburger ein abwechslungsreiches
Familienprogramm und eine Reise durch die 150-jährige Geschichte der
Trinkwasserversorgung in Duisburg.
Bei Vorlage der
Stadtwerke-Kundenkarte sparen an diesem Tag kleine und große
Zoobesucher 50 Prozent des regulären Eintrittspreises. Und zur Feier
des Tages verlosen die Stadtwerke150 Freikarten für den Zoo
Duisburg. Wer bei freiem Eintritt mitfeiern möchte, kann bis zum 9.
März unter www.swdu.de/wasser-gewinnspiel am Gewinnspiel teilnehmen.
Neuer Wasserspielplatz im Frühjahr
Noch in diesem
Frühjahr eröffnet auch der neue Stadtwerke-Wasserspielplatz im Zoo
Duisburg. Der Spatenstich erfolgte am 24. Januar, seitdem laufen die
Bauarbeiten für die Spiellandschaft mit Pumpen, Wasserläufen, einem
Kletterturm und integrativen Elementen. Auf rund 600 Quadratmeter
können kleine Abenteurer künftig das Element Wasser mit allen Sinnen
und auf vielfältige Weise erleben.
Zahlreiche Aktionen im
Jubiläumsjahr
Bereits einen Tag zuvor, am 21. März, nehmen die
Stadtwerke ihre Trinkwasserbrunnen in der Duisburg Innenstadt wieder
in Betrieb. Selbstverständlich sind die Stadtwerke auch 2025 im
gesamten Stadtgebiet mit ihrer Energie-Lounge und dem
Trinkwassermobil unterwegs, um alle Durstigen mit frischem
Trinkwasser zu versorgen.
Am 14. September steht der Tag
des offenen Denkmals im Wasserwerk Bockum ganz im Zeichen der
Trinkwassergeschichte. Und auch zum WDR-Maus-Türöffner-Tag am 3.
Oktober im Wasserwerk Wittlaer dreht sich alles um die Geschichte
der Wasserversorgung.

Führungen durch die Wasserwerke
Auch wer hinter die Kulissen der
historischen und heutigen Wasserversorgung blicken möchte, erhält
dazu mehrfach Gelegenheit: So öffnen die Stadtwerke in diesem Jahr
gleich mehrmals ihre Wasserwerke Bockum und Wittlaer für
Besucherinnen und Besucher jeden Alters. Jeweils von 15 bis 18 Uhr
finden am 23. April, 19. Mai, 13. Juni, 23. Juli und 6. August
Führungen statt. Anmeldungen sind ab sofort unter
www.swdu.de/fuehrung möglich.
Geschichte des Trinkwassers:
Dramatischer Beginn
Im 19. Jahrhundert versorgten sich die
Bürgerinnen und Bürger Duisburgs übrigens noch über private und
gemeinschaftliche Brunnen mit Wasser. Mit zunehmender
Industrialisierung und Bevölkerungsdichte verschlechterte sich die
Wasserqualität dramatisch. Da es keine Kanalisation gab,
verschmutzten Abwässer aus Haushalten und Betrieben das Grundwasser.
Die Folgen waren gravierend: 1866 brach die Cholera aus,
1870/71 folgte eine Pockenepidemie. Besonders betroffen waren
ärmere, dicht besiedelte Stadtteile. Diese Krisen führten 1873 zum
Entschluss der Duisburger Stadtverwaltung, eine zentrale
Wasserversorgung im städtischen Eigenbetrieb aufzubauen. Einen
Überblick über die historische Entwicklung mit zahlreichen Bildern
haben die Stadtwerke unter www.swdu.de/wasser-150 zusammengestellt.

Die Stadtwerke öffnen im Jubiläumsjahr gleich mehrmals ihre
Wasserwerke Bockum und Wittlaer für Besucherinnen und Besucher.
Bildquelle: Stadtwerke Duisburg
Jetzt bewerben! Jugendamt Duisburg sucht
Betreuerinnen und Betreuer für die Stadtranderholung 2025
Das Jugendamt Duisburg startet die Bewerbungsphase für die
Stadtranderholung 2025 und sucht engagierte junge Menschen zwischen
16 und 25 Jahren, die in der zweiten Hälfte der Sommerferien
Duisburger Schulkinder betreuen möchten. Vom 4. bis 22. August läuft
das beliebte Ferienprogramm an 18 Standorten im Stadtgebiet.
Teilnehmen können Kinder ab der zweiten Grundschulklasse bis
zum 13. Lebensjahr. Geboten wird ihnen ein vielseitiges
Ferienprogramm. Und die Eltern haben eine verlässliche Betreuung von
8 bis 16 Uhr. Interessierte, die gerne mit Kindern arbeiten und sich
im Team engagieren wollen, können sich ab sofort beim Jugendamt als
Betreuungsperson bewerben.
Spezielle Vorkenntnisse sind
nicht erforderlich. Vorausgesetzt wird lediglich ein Mindestalter
von 16 Jahren und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Zur
Vorbereitung auf die Betreuer-Aufgaben organisiert das Jugendamt vor
der Stadtranderholung Wochenendschulungen und Erste-Hilfe-Kurse. Die
Teilnahme daran ist verpflichtend.
Für diese
Jugendleitertätigkeit wird eine steuerfreie Vergütung von 500 Euro
gezahlt. Weitere Informationen zur Stadtranderholung und der Link
für die Online-Bewerbung sind unter
www.duisburg.de/stadtranderholung zu finden. Bewerbungsschluss ist
Sonntag, 23. März.
„Innenstädte als Treffpunkt
sehen“ Stephanie Eses neu in der IHK-Vollversammlung
Die Niederrheinische Wirtschaft hat eine neue IHK-Vollversammlung.
Dieses „Parlament der Unternehmer“ gestaltet die Arbeit der IHK für
die nächsten fünf Jahre. Fast die Hälfte der Mitglieder ist neu
dabei. Unter ihnen ist Stephanie Eses, Inhaberin von Korrekt Mode in
der Duisburger Innenstadt. Sie vertritt den Einzelhandel.

Foto: Niederrheinische IHK/Jacqueline Wardeski
Warum
engagieren Sie sich in der IHK-Vollversammlung? Stephanie Eses: Für
mich ist es die Chance, Dinge zu verändern. Als Inhaberin eines
Modegeschäfts will ich die Sichtweise von kleinen Unternehmen und
dem Einzelhandel einbringen. Vor allem als Teil der
Streetwear-Branche möchte ich neue Impulse setzen. Die Themen und
Probleme des Einzelhandels dürfen nicht übersehen werden.
Was ist Ihnen besonders wichtig für unsere Wirtschaft? Stephanie
Eses: Die Innenstädte müssen wieder lebendig werden. Junge Menschen
sind unsere Zukunft, und wir müssen ihnen etwas bieten. Kreativität
und Individualität sind mir wichtig. Jugendliche sollen schon in der
Ausbildung merken, dass sie etwas bewirken können. Ich setze mich
dafür ein, dass der Beruf der Einzelhandelskaufleute wieder
attraktiver wird.
Die Politik sollte außerdem mehr für
inhabergeführte Geschäfte tun. Diese Läden machen unsere Städte
besonders. Sie sind nicht nur Orte zum Einkaufen, sondern ein
Treffpunkt. Ich kenne meine Kunden. Sie kommen zu uns, weil wir sie
gut beraten und Persönlichkeit zeigen. Ich wünsche mir, dass unsere
Innenstädte wieder zu Orten werden, an denen Menschen gerne
zusammenkommen. Dafür möchte ich mich einsetzen.
Aktuelle Umfrage der Deutschen Stiftung für Engagement und
Ehrenamt zeigt: Bürokratie belastet Ehrenamtliche in deutschen
Vereinen
Deutschland ist das Land der Vereine – in rund
600.000 eingetragenen Vereine engagieren sich mehr als 29 Millionen
Menschen in verschiedenen Bereichen wie Sport, Umweltschutz und
Nachbarschaftshilfe. Doch die Freude am Ehrenamt wird zunehmend von
bürokratischen Hürden überschattet. Insbesondere diejenigen, die
Leitungsfunktionen übernehmen, sind von komplexen Vorschriften und
Antragsverfahren betroffen.
In einer aktuellen Umfrage der
Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt
(DSEE) unter 901
Ehrenamtlichen in Leitungspositionen schätzten über 77 Prozent der
Befragten die Bürokratiebelastung für ihren Verein als hoch bis sehr
hoch ein. Zudem äußerten 24,4 Prozent der befragten Ehrenamtlichen
große Befürchtungen, dass bürokratische Anforderungen ihre Vereine
in diesem Jahr stark belasten werden.
Die Umfrage, die im
Dezember 2024 und Januar 2025 durchgeführt wurde, fokussierte sich
auf Engagierte in Leitungspositionen in rein ehrenamtlich geführten
Vereinen.
Besonders hoch bewerten sie die bürokratischen
Hürden in den Bereichen Fördermittel und Finanzen, Datenschutz,
Vereinsrecht und Veranstaltungen. Der Aufwand für komplexe
Antragsverfahren, Datenschutzvorgaben und rechtliche Anforderungen
nimmt nicht nur wertvolle Ressourcen der Ehrenamtlichen in Anspruch
und führt zu Frustration. Eine andere Studie von ZiviZ zeigt zudem:
Über die Hälfte der zivilgesellschaftlichen Organisationen beklagt
zudem, dass die Rekrutierung von Ehrenamtlichen für
Leitungspositionen immer schwieriger wird.
Die
Ehrenamtlichen selbst sehen verschiedene Lösungsansätze. 30,4
Prozent der Befragten wünschen sich eine Vereinfachung von
Vorschriften und eine Entlastung durch klare und weniger komplexe
Anforderungen. Weitere 12,2 Prozent setzen auf die Förderung von
Digitalisierung und Automatisierung als mögliche Entlastung. Doch
ein erheblicher Teil der Ehrenamtlichen bleibt ratlos und unsicher,
wie sie den bürokratischen Herausforderungen begegnen können.
Jan Holze, Vorstand der Deutschen Stiftung für Engagement
und Ehrenamt, kennt die Sorgen der Engagierten: “42 Tage im Jahr
oder sechseinhalb Stunden pro Woche schlägt sich ein
durchschnittlich großer Verein mit bürokratischen Hürden herum.
E-Rechnung, Steuererklärung, Datenschutzgrundverordnung,
Zuwendungsempfängerregister, Lebensmittelverordnung – die Liste ist
lang. Hier braucht es eine deutliche Entlastung. Ein kleiner Verein
darf nicht so behandelt werden wie eine Aktiengesellschaft.”
Dr. Vivian Schachler ist Referentin für Forschung und
Wissenstransfer in der Deutschen
Stiftung für Engagement und
Ehrenamt: “Es steht außer Frage, dass Vereine für den
gesellschaftlichen Zusammenhalt, die Integration und die
demokratische Teilhabe
unverzichtbar sind. Wenn die Freude am
Engagement durch bürokratische Hürden erstickt wird, leidet nicht
nur das Vereinsleben, sondern auch das soziale Miteinander in der
Gesellschaft. Es bleibt zu hoffen, dass durch politische Maßnahmen
und gezielte
Entbürokratisierung die ehrenamtliche Arbeit
gestärkt wird und das Engagement für Vereine auch in Zukunft
lebendig bleibt.”
Die Deutsche Stiftung für Engagement
und Ehrenamt (DSEE) unterstützt Engagierte
deutschlandweit mit
Weiterbildungen und Beratungsangeboten dabei, sich im
Bürokratie-Dschungel zurechtzufinden. Das große Interesse an diesen
Angeboten zeigt, dass sich Ehrenamtliche trotz der hohen Belastung
aktiv informieren und Lösungen suchen.
Alle Informationen zu
kommenden Veranstaltungen der DSEE gibt es hier:
https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/veranstaltungen/
Internationaler Mindestlohnbericht des WSI
Mindestlohn: Deutliche Zuwächse für Beschäftigte in den meisten
EU-Ländern – Deutschland fällt mit Mini-Anhebung zurück
Fast überall in der Europäischen Union sind die Mindestlöhne zum
Jahresanfang gestiegen. Für Mindestlohnbeziehende kamen dabei zwei
günstige Entwicklungen zusammen: Zum einen fielen die Erhöhungen
meist kräftig aus. Im Mittel (Median) betrug die nominale Steigerung
gegenüber dem Vorjahr 6,2 Prozent. Zum anderen ist die Inflation
gemessen am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) im Verlauf
des Jahres 2024 europaweit zurückgegangen.
Anders als in den
vergangenen Jahren bleibt damit auch nach Berücksichtigung der
gestiegenen Lebenshaltungskosten mit 3,8 Prozent im Median ein
deutliches reales Plus. Wermutstropfen bei der Entwicklung ist, dass
die Zuwächse geographisch sehr ungleich verteilt sind. So stammen
die neun Länder mit den größten realen Zuwächsen – jeweils oberhalb
von 5 Prozent – allesamt aus Osteuropa.
Im Rest der EU
verzeichnen Irland (+4,9 %), Portugal (+3,3 %), Griechenland (+3,3
%) und die Niederlande (+2,7 %) vergleichsweise hohe reale
Steigerungen. In Deutschland übertraf die Anpassung des Mindestlohns
auf 12,82 Euro zum Jahresanfang die HVPI-Inflationsrate des
Vorjahres nur geringfügig, sodass für Menschen, die hierzulande zum
Mindestlohn arbeiten, lediglich ein reales Wachstum von 0,8 Prozent
übrigbleibt. Das ergibt der neue internationale Mindestlohnbericht
des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der
Hans-Böckler-Stiftung.*
Als einen Grund für die Erhöhungen
macht der Bericht den Einfluss der Europäischen
Mindestlohnrichtlinie aus. „Durch Referenzwerte für angemessene
Mindestlöhne, die im Zuge der Umsetzung der Europäischen
Mindestlohnrichtlinie in den nationalen Mindestlohngesetzen
verankert wurden, entsteht in viele Ländern ein Sog hin zu
strukturellen Mindestlohnerhöhungen, die über die normalen
regelmäßigen Anpassungen hinausreichen“, bilanzieren die
Studienautoren Dr. Malte Lübker und Prof. Dr. Thorsten Schulten.
Um die Angemessenheit von Mindestlöhnen zu beurteilen, ist
in der Richtlinie unter anderem der Referenzwert von 60 Prozent des
Medianlohns verankert – also des Lohnes, der die Lohnverteilung in
zwei gleichgroße Hälften teilt. Nach den aktuellsten verfügbaren
Daten der OECD, die sich auf das Jahr 2023 beziehen, erreichten
zuletzt nur Portugal (68,2 %), Slowenien (63,0 %) und Frankreich
(62,2 %) diese Zielvorgabe. Deutschland verfehlte das Ziel mit 51,7
Prozent des Medianlohns der Vollzeitbeschäftigten deutlich. Bereits
im laufenden Jahr wäre ein Mindestlohn von rund 15 Euro notwendig,
um das 60-Prozent-Ziel zu erreichen, so die WSI-Forscher.
Viele Länder haben eine langfristige Zielgröße für den Mindestlohn
gesetzlich verankert oder auf andere Weise festgelegt (siehe
Übersicht 1 im Bericht). Die Bilanz der vergangenen zehn Jahre
zeigt, dass dies dem Mindestlohn einen deutlichen Schub gibt: In
Westeuropa verzeichnen Spanien (+48,9 %), Portugal (+40,3 %) und
Irland (+30,7 %) gegenüber dem Jahr 2015 ein deutliches
Realwachstum, in Großbritannien stieg der Mindestlohn preisbereinigt
in den letzten zehn Jahren sogar um 76,0 Prozent.
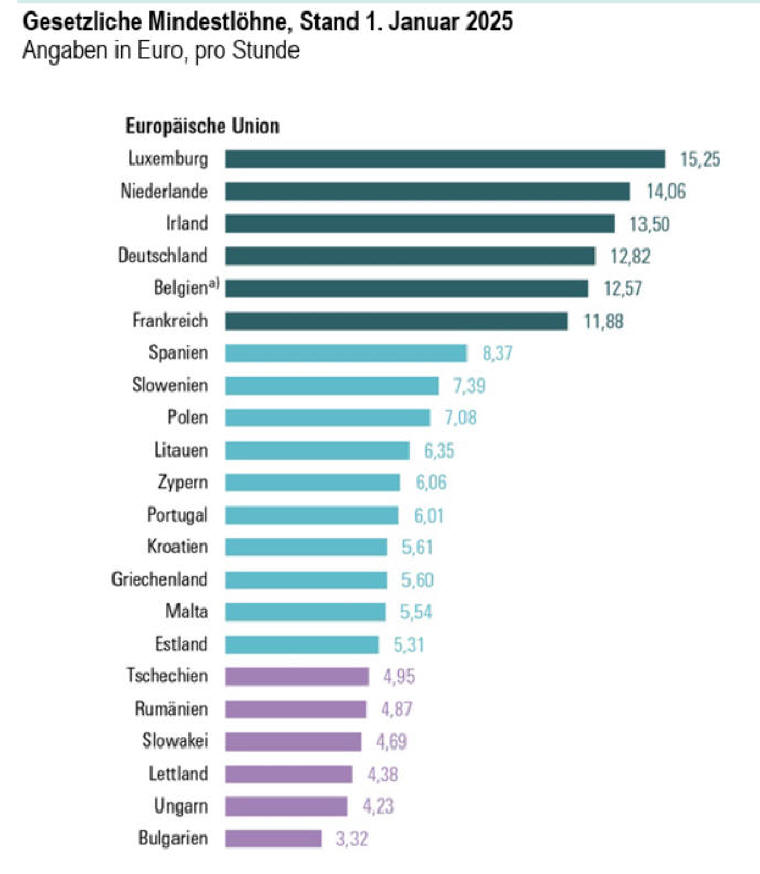
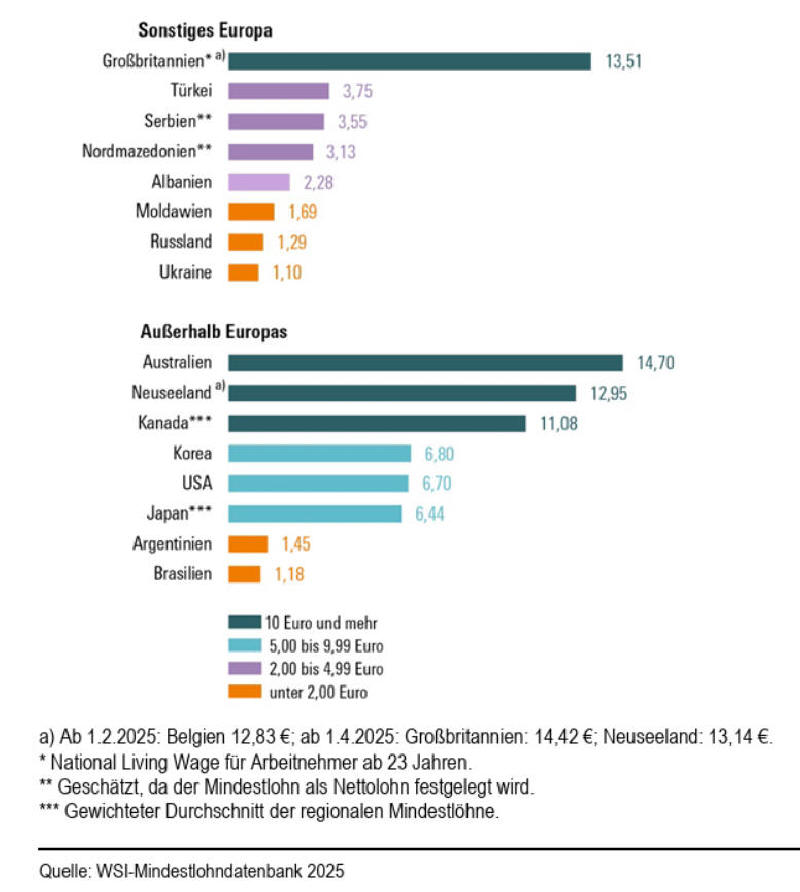

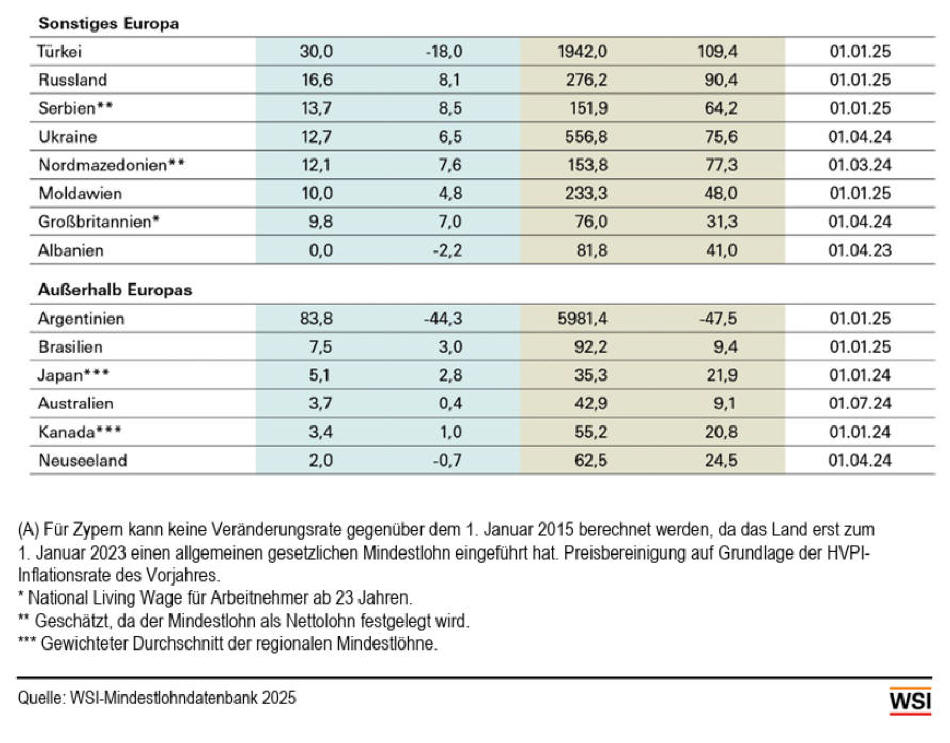
Das Ex-EU-Mitglied Großbritannien verfolgt inzwischen das
ambitionierte Ziel, ein Living Wage in Höhe 66 Prozent des
Medianlohns zu erreichen. Auch Irland will sein derzeitiges Ziel von
60 Prozent des Medians überprüfen, um perspektivisch ein Living Wage
von 66 Prozent des Medians einzuführen.
Verhaltene
Zehn-Jahres-Bilanz für Deutschland
Demgegenüber fällt die
Zehn-Jahres-Blanz in Deutschland deutlich bescheidener aus:
Hierzulande stieg der Mindestlohn real um 16 Prozent gegenüber dem
Einführungsniveau aus dem Jahr 2015. Dies entspricht in etwa der
Erhöhung des Mindestlohns durch den Deutschen Bundestag von 10,45
Euro auf 12 Euro zum 1. Oktober 2022.
„Per Saldo haben die
Anpassungen unter der Ägide der Mindestlohnkommission über die
vergangenen zehn Jahre zu keiner nennenswerten realen Erhöhung
geführt, sondern lediglich inflationsbedingte Kaufkraftverluste
ausgeglichen – ähnlich wie dies in Frankreich und Belgien durch eine
Indizierung des Mindestlohns erreicht wird“, so das Fazit der
Studienautoren Lübker und Schulten.
„Wenn der
Mindestlohn auch in diesem Jahr wieder Thema im Wahlkampf ist, hat
sich die Mindestlohnkommission das ein Stück weit selbst
zuzuschreiben“, ergänzt Lübker. „Insbesondere die letzte
Anpassungsentscheidung, die gegen die Stimmen der
Gewerkschaftsvertreter*innen gefällt wurde, hat den Ruf der
Kommission in den Augen Vieler beschädigt.“
Inzwischen
deute sich jedoch Grund zur Hoffnung auf eine Kurskorrektur der
Kommission an: In ihrer neuen Geschäftsordnung hat sich diese darauf
festgelegt, sich künftig unter anderem am Wert von 60 Prozent des
Bruttomedianlohns der Vollzeitbeschäftigten zu orientieren und
wieder im Konsens zu entscheiden. Die nächste Entscheidung steht zum
30. Juni dieses Jahres an. „Um den Referenzwert von 60 Prozent des
Medianlohns dauerhaft als Zielgröße zu etablieren, wäre auch in
Deutschland eine Aufnahme in das Mindestlohngesetz sinnvoll“, sagt
Prof. Dr. Bettina Kohlrausch, die wissenschaftliche Direktorin des
WSI.
Deutschland fällt in der Europäischen Union auf den
5. Platz zurück
Mit dem aktuellen Mindestlohnniveau lag
Deutschland unter den 22 EU-Ländern mit gesetzlichem Mindestlohn zum
Stichtag 1. Januar 2025 hinter Luxemburg (15,25 €), den Niederlanden
(14,06 €) und Irland (13,50 €) auf dem 4. Platz. Da Belgien seinen
Mindestlohn am 1. Februar von 12,57 Euro auf 12,83 Euro erhöht hat,
ist diese Rangfolge allerdings inzwischen obsolet und Deutschland
(12,82 €) ist mittlerweile auf den 5. Platz vor Frankreich (11,88 €)
abgerutscht. Auch in Großbritannien liegt der Mindestlohn mit
umgerechnet 13,51 € oberhalb des deutschen Niveaus und steigt dort
zum 1. April 2025 auf umgerechnet 14,42 €.
In Süd- und
Osteuropa gelten niedrigere Mindestlöhne, wie beispielsweise in
Spanien (8,37 €), Slowenien (7,39 €) und Polen (7,08 €). Am Ende der
Tabelle finden sich Lettland (4,38 €), Ungarn (4,23 €) sowie
Bulgarien (3,32 €; siehe Abbildung 1 in der pdf-Version). Durch das
kräftige Mindestlohnwachstum in den osteuropäischen Ländern hat sich
das Gefälle innerhalb der EU in den letzten Jahren allerdings
deutlich verringert. In Österreich, Italien und den nordischen
Ländern existiert kein gesetzlicher Mindestlohn. In diesen Staaten
besteht aber eine sehr hohe Tarifbindung, die auch vom Staat stark
gestützt wird. Faktisch ziehen dort also Tarifverträge eine
allgemeine Lohnuntergrenze.
Deutscher Mindestlohn
kaufkraftbereinigt auf Position 6 in der EU
Die Unterschiede im
Mindestlohnniveau werden durch unterschiedliche Lebenshaltungskosten
innerhalb der EU teilweise relativiert. Der WSI-Mindestlohnbericht
weist deswegen auf Basis von Daten des Internationalen Währungsfonds
(IMF) auch kaufkraftbereinigte Mindestlöhne aus.
Durch
das vergleichsweise hohe Preisniveau in Westeuropa fallen hier die
Mindestlöhne in Kaufkraftstandards auf Euro-Basis (KKS €) niedriger
aus: Luxemburg (12,29 KKS €), die Niederlande (12,26 KKS €) und
Irland (12,16 KKS €) liegen nach dieser Betrachtungsweise fast
gleichauf, gefolgt von Frankreich und Belgien (beide 11,92 KKS €).
Deutschland (11,81 KKS €) liegt mit geringem Abstand auf dem 6. Rang
(Abbildung 2 im Bericht). In Ost- und Südeuropa kommt aufgrund von
tendenziell niedrigeren Lebenshaltungskosten ein gegenläufiger
Effekt zum Tragen: So schließen Polen (10,36 KKS €), Spanien (9,32
KKS €) und Slowenien (8,64 KKS €) zu Westeuropa auf und auch beim
Schlusslicht Bulgarien (5,48 KKS €) fällt der Mindestlohn nach
Berücksichtigung der geringeren Lebenshaltungskosten deutlich höher
aus.
Mindestlöhne außerhalb der EU
Auch außerhalb der EU
sind Mindestlöhne weit verbreitet. Exemplarisch betrachtet das WSI
die Mindestlöhne in 16 Nicht-EU-Ländern mit ganz unterschiedlichen
Mindestlohnhöhen. Sie reichen von, jeweils umgerechnet, 14,70 Euro
in Australien, 12,95 Euro in Neuseeland oder 11,08 Euro in Kanada
über 6,80 Euro in Korea oder 6,44 im japanischen Landesdurchschnitt
bis zu 3,75 Euro in der Türkei, 1,45 Euro in Argentinien, 1,18 Euro
in Brasilien und 1,10 Euro in der Ukraine. Auch außerhalb Europas
fallen die Unterschiede in KKS häufig etwas weniger groß aus.
„Weitgehend obsolet“ ist der landesweite Mindestlohn nach
Einschätzung der WSI-Experten in den USA, weil er seit 2009 nicht
mehr erhöht wurde und mit umgerechnet 6,70 Euro oder gerade einmal
4,85 Euro in KKS nicht zum Überleben reicht. Daher gibt es daneben
in rund 30 US Bundesstaaten und Washington DC höhere regionale
Untergrenzen. Dazu gehören die Bundesstaaten Washington (15,39 €),
Kalifornien (15,24 €), New York (14,32 €), New Jersey (14,31 €)
sowie Illinois (13,86 €).
Trauercafé am 23. Februar im Malteser
Hospizzentrum St. Raphael
Der Verlust eines
geliebten Menschen schmerzt und reißt eine große Lücke in das Leben
von Verwandten und Freunden. Die geschulten und erfahrenen
Mitarbeitenden des Malteser Hospizzentrum St. Raphael bieten
unterschiedliche Beratungsangebote für Hinterbliebene. Die
Trauerberatung ist eine Hilfestellung, den schwierigen Übergang in
ein anderes „Weiter-Leben“ während der Trauerphase zu begleiten und
neue Wege zu finden.
Das Trauercafé findet einmal im
Monat im Malteser Hospizzentrum St. Raphael, Remberger Straße 36,
47259 Duisburg, statt. Der nächste Termin ist am 23. Februar von
15.00 bis 16.30 Uhr. Menschen, die nahe stehende Angehörige oder
Freunde verloren haben, können sich hier für die bevorstehenden
Wochen stärken und ihre Erfahrungen mit anderen Betroffenen
austauschen. Begleitet wird das Trauercafé von den geschulten und
erfahrenen Mitarbeitenden des Malteser Hospizzentrum St. Raphael.
Eine Anmeldung für das Trauercafé ist nicht notwendig.
KHYAL – Searching For Peace. Ein Geflecht aus
Jazz und Poesie, verwoben mit den Sprachen des Nahen Ostens
Ein einzigartiges Timbre und wunderbar komplexe Kompositionen und
Arrangements – dafür steht die Sängerin und Komponistin Sophie
Tassignon.
Sophie Tassignon ermöglicht uns mit KHYAL eine
musikalische Begegnung der Kulturen. Das Projekt steht für die
Toleranz und Akzeptanz von Völkern aus aller Welt, unabhängig von
Herkunft oder Glaubenssystemen. Die Musik macht erfahrbar, welche
Schönheit und Kunstfertigkeit durch kulturübergreifende
Zusammenarbeit entstehen kann.
Tassignons Arbeit mit
syrischen Flüchtlingen 2016 in Berlin führte sie dazu, mit dem
Erlernen der arabischen Sprache zu beginnen und ein tieferes
Verständnis der arabischen Kultur zu suchen. Diese Arbeit mündet nun
in die Geburt ihres neuesten Projekts „KHYAL“.
Khyals
nächstes Album ist durch die Konflikte im Nahen Osten inspiriert.
"Ich möchte damit ein Zeichen für Frieden setzen, indem ich
arabische und hebräische Gedichte vertone. Auf dem Album singe ich
diese Gedichte in beiden Sprachen. In dem beide Sprachen
nebeneinander "singen", finden wir einen Weg zur menschlicher
Harmonie."
„KHYAL“, das vom arabischen Wort für
„Vorstellungskraft“ abstammt, kann als „Erinnerung an und Sehnsucht
nach etwas längst Vergangenem“ übersetzt werden. In „KHYAL“
vermischen sich poetische arabische und hebräische Texte mit
Jazztraditionen aus Europa und Nordamerika. Die Gruppe, die aus vier
internationalen Musikern mit Wohnsitz in Berlin besteht, trägt unter
anderem Vertonungen der Worte von Mahmoud Darwish und Rachel Tzvia
Bach vor. Andere Songtexte stammen von Sophie Tassignon und wurden
vom Englischen ins Arabische von Hicham Nasr übersetzt.
KHYAL
sind Sophie Tassignon: Gesang, Peter Meyer: Gitarre, Roland
Fidezius: Bass und Klaus Kugel: Schlagzeug
Sophie Tassignon
| Khyal - Searching for Peace
Samstag, 22. Februar 2024, 19 Uhr
Lokal Harmonie, Harmoniestr. 41, 47119 Duisburg-Ruhrort
Eintritt
frei (Hutveranstaltung) eine Veranstaltung der Kreativquartier
Ruhrort UG
www.kreativquartier-ruhrort.de
AUSGERUFEN | Aquapax und Jomah - Indie PopRock
Aquapax und Jomah könnten unterschiedlicher nicht sein
– ruhig und feurig, männlich und weiblich, Generation Y und Z, ernst
und augenzwinkernd – doch finden sie in der englischsprachigen Musik
zusammen und bilden ein einzigartiges Duo. Gemeinsam präsentieren
sie ihre besten Eigenkompositionen und ausgewählte Coverstücke, die
alle ihre besondere Harmonik der zwei Stimmen mit sich bringen.

Aquapax&Jomah by Angela von Brill
Mit der Gitarre hauchen
sie ihren musikalischen Ideen Leben ein und geben dem Gesang das
Fundament. Ihre Lieder lassen sich nicht in eine Kategorie wie
„ruhige“ oder „schnelle“ Musik einordnen. Es ist alles dabei. Mit
Balladen zielen Aquapax und Jomah direkt aufs Herz oder sie hauen
ihre Zuhörer*innen mit wilden Rhythmen aus den Socken.
Es wird ein bunter Mix an Beziehungsthematiken und
lebenssinnstiftenden Themen in den Songs verarbeitet. Eins ist dabei
sicher: Langweilig wird es nicht!
AUSGERUFEN | Aquapax und
Jomah Sonntag, 23. Februar 2025, 18 Uhr Das PLUS am Neumarkt,
Neumarkt 19, 47119 Duisburg-Ruhrort Eintritt frei(willig) -
Hutveranstaltung
Hanno Nell wird offiziell in die Hamborner
Pfarrstelle eingeführt
Gemeinde lädt zum
Festgottesdienst Das Presbyterium der Evangelischen Kirchenggemeinde
Duisburg Hamborn lädt zum Festgottesdienst in die Friedenskirche am
23. Februar 2025 um 11 Uhr ein. Festlich wird es, weil Hanno Nell
von Superintendent Dr. Christoph Urban offiziell als Pfarrer in sein
Amt eingeführt wird.
Beim anschließenden Empfang gibt es
Gelegenheit zur Begegnung und mit Pfarrer Nell ins Gespräch zu
kommen und ihm zu gratulieren. Hanno Nell wirkt bereits seit einem
Jahr der Gemeinde. Er kam als Vakanzvertreter für die frei gewordene
Pfarrstelle in Hamborn. Seine Arbeit habe deutliche Spuren
hinterlassen fand die Gemeinde, so dass sie ihn im Gottesdienst am
10. November 2024 als Pfarrer gewählt hatte.
Vor seiner Zeit in
Hamborn war Hanno Nell 17 Jahre lang Seelsorger in der
Kirchengemeinde Gruiten-Schöller.

Pfarrer Hanno Nell bei seiner Predigt während der Synodentagung des
Evangelischen Kirchenkreises Duisburg am 15.6.2024 in Meiderich.
(Foto: Rolf Schotsch).
Snacks und Getränke bei der Stimmangabe im Wahllokal
Gemeindezentrum Obermeiderich
Sonderausgabe vom
Mittagstisch am Wahlsonntag Beim monatlichen kostenfreien
Mittagstisch der Evangelischen Kirchengemeinde Obermeiderich gibt es
im Februar eine Sonderausgabe. Am 23. Februar kommen die Menschen
nach dem 11-Uhr-Gottesdienst in der Kirche an der Emilstr. 27 um 12
Uhr wie gewohnt zur gemeinsamen Mahlzeit zusammen. Diesmal gibt es
Hackfleisch mit Wirsing und Kartoffeln und natürlich wieder einen
leckeren Nachtisch.
Da das Gemeindezentrum jedoch auch
offizielles Wahllokal ist, bieten Leute aus der Gemeinde allen die
zwischen 8 Uhr und 18 Uhr zur Stimmabgabe dorthin kommen einen Snack
und ein Getränk an. Dies ist Teil des Engagements der Gemeinde, die
derzeit gemeinsam mit der Nachbargemeinde über mehrere Banner fürs
Wählen motiviert – „damit uns die demokratischen Kräfte im Land
erhalten bleiben“ sagt Presbyteriumsmitglied Peter Fackert aus
Obermeiderich. Das habe etwas mit „Menschenwürde, Nächstenliebe und
Zusammenhalt FÜR ALLE zu tun“. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz
unter www.obermeiderich.de.
Großer Taizé-Gottesdienst in Großenbaum
Die Taizé-Gottesdienste in der Versöhnungskirche in Großenbaum,
Lauenburger Allee 23, sorgen immer für volle Bänke. So bestimmt auch
bei dem am Samstag, 22. Februar 2025 um 18 Uhr. Er steht unter dem
Leitwort „Gemeinsam Hoffnung wagen“. Die Mitwirkenden in dem
Gottesdienst Pfarrer Ernst Schmidt, Kantorin Annette Erdmann, die
Mitglieder des Kinderchores und der „Young Voices“, die Kantorei und
ein Projektorchester füllen das Thema mit viel Leben und Freude und
dem Geist von Taizé.
Die Evangelische
Versöhnungsgemeinde Duisburg-Süd lädt herzlich zum Mitfeiern
ein. Der Taizé-Gottesdienst hat die Gesänge und Texte der
„Communauté de Taizé“ zum Inhalt. Sie stehen für die Suche nach Gott
in Gemeinschaft. Die Melodien der Taizé-Gesänge sind so angelegt,
dass sie Besucherinnen und Besucher zum Mitsingen geradezu einladen.
In der „Communité de Taizé“, gegründet 1940 von Frère Roger in Taizé
/ Burgund, haben Nächstenliebe und Versöhnung eine wichtige
Bedeutung. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter
https://www.evgds.de.
Melancholy of Love
Konzert mit englischer Musik des 17. Jahrhunderts - gespielt auf
historischen Instrumenten
Das Ensemble „il gesto
musicale“ präsentiert am Sonntag, 23. Februar um 16 Uhr im
Gemeindezentrum Duisburg Neudorf in der Wildstraße 31 sein neues
Programm „A Melancholy of Love“ - Musik des 17. Jahrhunderts aus
England, gespielt auf historischen Instrumenten. Unter den
Komponisten sind Thomas Morley und Robert Johnson, Zeitgenossen und
Kollegen William Shakespeares, sowie John Dowland, ein Lautenist und
Komponist im „Rockstar“ Status des Elisabethanischen Zeitalters und
William Byrd, ein Meister für Tasten- und Chormusik jener Zeit.
Im vierköpfigen Ensemble spielt Ada Tanir, Kirchenmusikerin
der Evangelischen Gemeinde Hochfeld-Neudorf Cembalo. Die anderen
drei Mitglieder des Ensembles waren schon mehrmals Gast in der
Gemeinde: Florie Leloup, Barockgesang und Gestik, Yuichi Sasaki,
Laute und Theorbe, und Torben Klaes, Diskant- und Bassgambe. Der
barocke Gesang wird von Florie Leloup durch Gesten (eben „il gesto
musicale“!) untermalt, wie es zur Zeit von Königin Elisabeth und
Shakespeare üblich war.
Dies ist, so hofft das
Ensemble, ein besonderer Genuss nicht nur für die Ohren, sondern
auch für die Augen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.
Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter
www.hochfeld-neudorf.de.

Das Ensemble (Foto: Ensemble „il gesto musicale“).

NRW: Stärkste Reallohnentwicklung seit 15 Jahren
Die effektiven Bruttomonatsverdienste der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Nordrhein-Westfalen waren im
Jahr 2024 real – also preisbereinigt – um 2,7 Prozent höher als im
Jahr 2023. Dies war der höchste Anstieg der Reallöhne der letzten 15
Jahre. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, war der im Vergleich
zu den beiden Vorjahren gemäßigte Anstieg der Verbraucherpreise im
Jahr 2024 (+2,2 Prozent) hauptverantwortlich für den außergewöhnlich
starken Reallohnzuwachs.
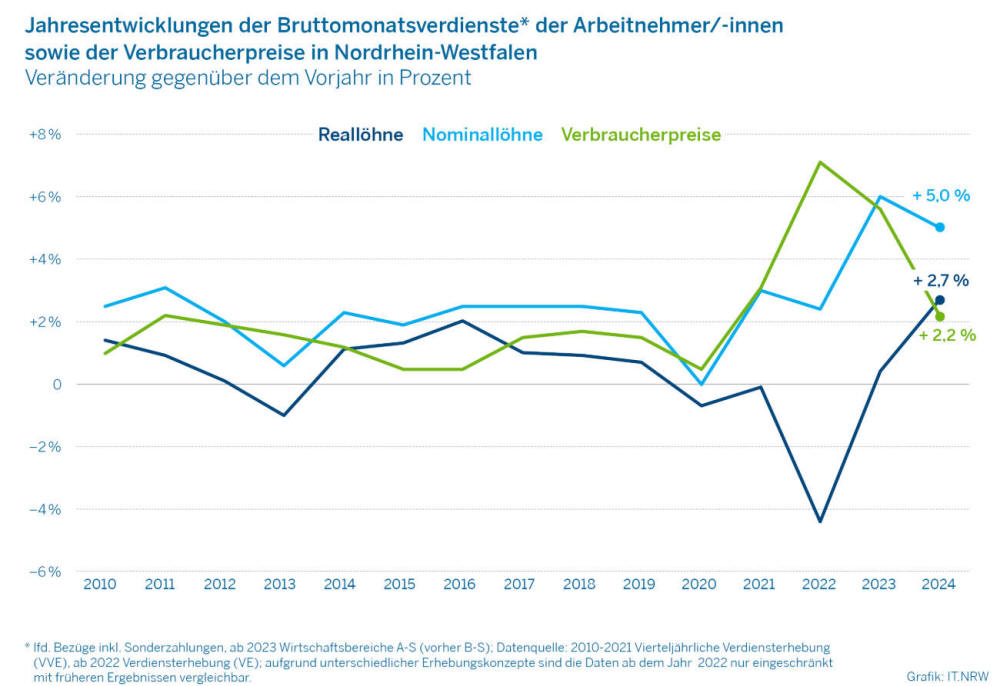
Allerdings war mit einem Plus von 5,0 Prozent auch ein
ungewöhnlich hoher Anstieg der Nominallöhne zu verzeichnen, der
jedoch etwas niedriger als im Jahr zuvor (2023: 6,0 Prozent)
ausfiel. Das überdurchschnittliche Nominallohnwachstum der
vergangenen beiden Jahre ist maßgeblich auf die Zahlung von
Inflationsausgleichsprämien sowie relativ hohen Tariflohnerhöhungen
und tariflichen Einmalzahlungen zurückzuführen.
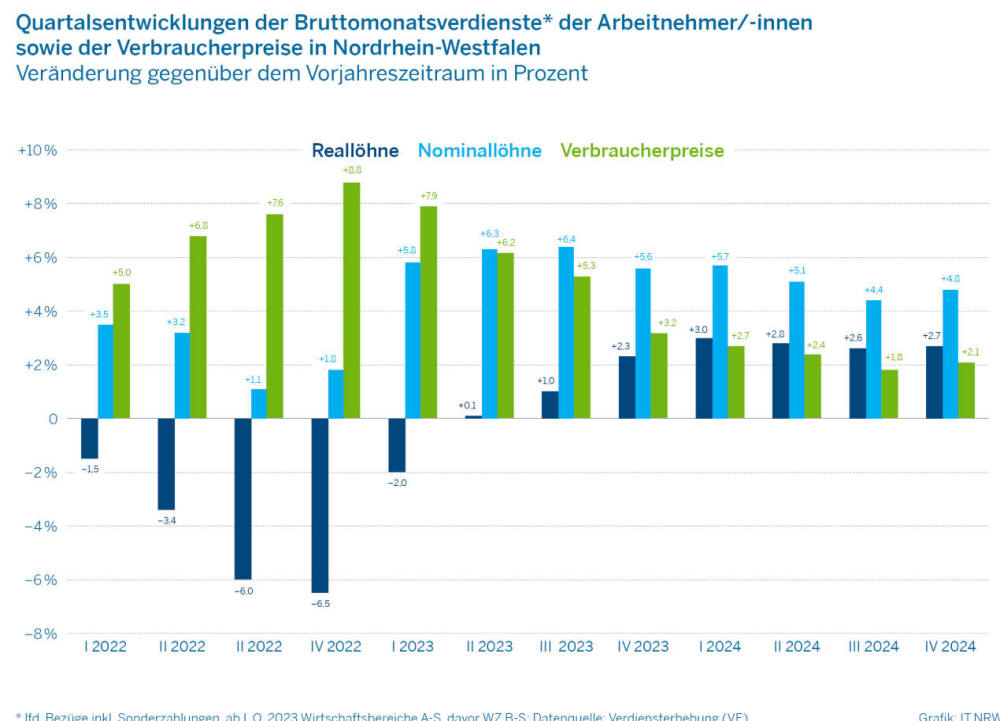
Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe im Dezember
2024: +0,2 % zum Vormonat
Auftragsbestand im
Verarbeitenden Gewerbe, Dezember 2024 +0,2 % real zum Vormonat
(saison- und kalenderbereinigt) -0,6 % real zum Vorjahresmonat
(kalenderbereinigt) Reichweite des Auftragsbestands 7,5 Monate
Der reale (preisbereinigte) Auftragsbestand im Verarbeitenden
Gewerbe ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes
(Destatis) im Dezember 2024 gegenüber November 2024 saison- und
kalenderbereinigt um 0,2 % gestiegen. Im Vergleich zum
Vorjahresmonat Dezember 2023 lag der Auftragsbestand im Dezember
2024 kalenderbereinigt 0,6 % niedriger.
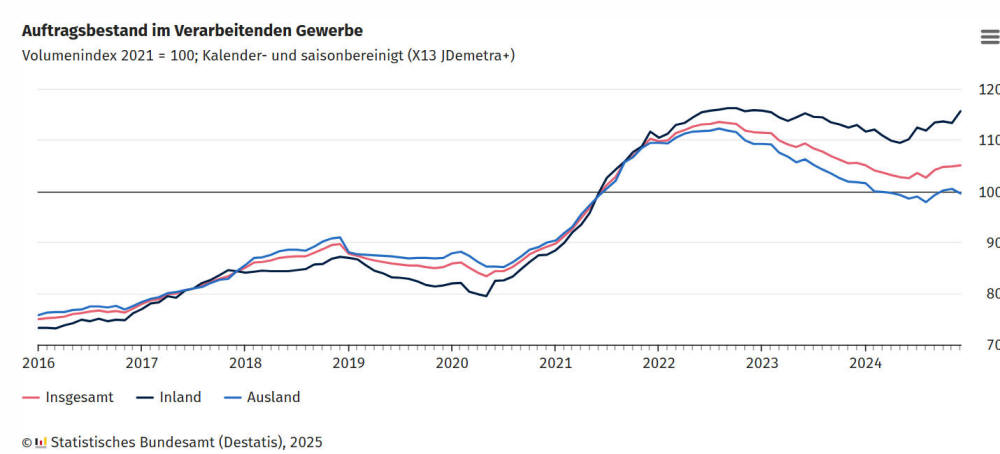
Der Anstieg des Auftragsbestands im
Dezember 2024 ist wesentlich auf die Entwicklung im Sonstigen
Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, Züge, Militärfahrzeuge; saison- und
kalenderbereinigt +3,0 % zum Vormonat) zurückzuführen. Ein hohes
Volumen an Großaufträgen trug zu dem Wachstum in diesem Bereich bei.
Auch der Anstieg des Auftragsbestands im Maschinenbau (+0,4 %)
wirkte sich positiv aus.
Negativ beeinflussten das
Gesamtergebnis hingegen die Rückgänge im Bereich Herstellung von
elektrischen Ausrüstungen (-0,5 %) und in der Automobilindustrie
(-0,4 %). Die offenen Aufträge aus dem Inland stiegen im Dezember
2024 gegenüber November 2024 um 2,0 %. Der Bestand an Aufträgen aus
dem Ausland fiel hingegen um 0,9 %. Bei den Herstellern von
Investitionsgütern sowie Konsumgütern nahm der Auftragsbestand
jeweils um 0,3 % zu.
Im Bereich der Vorleistungsgüter
sank der Auftragsbestand um 0,5 %. Reichweite des Auftragsbestands
auf 7,5 Monaten gestiegen Im Dezember 2024 stieg die Reichweite des
Auftragsbestands im Vergleich zum November 2024 von 7,3 Monaten auf
7,5 Monate. Bei den Herstellern von Investitionsgütern stieg die
Reichweite von 9,9 Monaten auf 10,1 Monate und bei den Herstellern
von Vorleistungsgütern von 4,1 Monaten auf 4,2 Monate.
Bei den Herstellern von Konsumgütern blieb die Reichweite konstant
bei 3,6 Monaten. Die Reichweite gibt an, wie viele Monate die
Betriebe bei gleichbleibendem Umsatz ohne neue Auftragseingänge
theoretisch produzieren müssten, um die vorhandenen Aufträge
abzuarbeiten. Sie wird als Quotient aus aktuellem Auftragsbestand
und mittlerem Umsatz der vergangenen zwölf Monate berechnet.