






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 10. Kalenderwoche:
4. März
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Mittwoch, 5. März 2025
NATO-Generalsekretär trifft Vorsitzenden der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion Am Mittwoch, den 5. März
2025, empfängt NATO-Generalsekretär Mark Rutte den Vorsitzenden der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Friedrich Merz, im NATO-Hauptquartier in
Brüssel.
Warnstreiks: Erhebliche Einschränkungen in städtischen
Ämtern und Kitas möglich
Die Gewerkschaften ver.di und
komba haben, aufgrund der laufenden Tarifverhandlungen im
öffentlichen Dienst, alle Tarifbeschäftigten der Stadt Duisburg am
Donnerstag, 6. März sowie Freitag, 7. März, ganztägig zum Warnstreik
aufgerufen. Vom Streik könnten potenziell alle Bereiche der
Stadtverwaltung betroffen sein.
Beeinträchtigungen, vor
allem bei Ämtern mit Publikumsverkehr, sind nicht auszuschließen.
Bürgerinnen und Bürger sollten sich auf Notbesetzungen einstellen
und werden gebeten, städtische Dienststellen möglichst an einem
anderen Tag aufzusuchen. In den sieben Bürger-Service-Stationen wird
es voraussichtlich keine Einschränkungen geben.
Gebuchte
Online-Termine können nach derzeitigem Stand wahrgenommen werden.
Städtische Kindertagesstätten und Jugendzentren können auch vom
Streik betroffen sein. Sofern städtische Kindertagesstätten
bestreikt werden, werden nach Möglichkeit Notgruppen eingerichtet
Lockerung der Schuldenbremse nur für
Verteidigung wäre ökonomisch falsch
Aktuell wird
diskutiert, durch eine Änderung des Grundgesetzes schnell mehr
Verschuldungsspielraum für höhere Verteidigungsausgaben zu schaffen,
ohne zugleich mehr öffentliche Investitionen zu ermöglichen. Dieser
Ansatz ist ökonomisch falsch und gefährdet den Wohlstand
Deutschlands.
Ein kreditfinanziertes öffentliches
Investitionsprogramm ist in Zeiten von höheren
Verteidigungserfordernissen durch eine veränderte geopolitische Lage
sogar noch wichtiger als ohnehin schon, weil es für die Zukunft mehr
Wirtschaftsleistung und daraus folgend höhere Staatseinnahmen
schafft. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Kurzstudie des Instituts
für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der
Hans-Böckler-Stiftung.
Dabei unterstreichen aktuelle
Berechnungen des IMK für ein kreditfinanziertes
Investitionsprogramm, das über die kommenden zehn Jahre insgesamt
600 Milliarden Euro für Investitionen in die öffentliche
Infrastruktur, Energienetze, Digitalisierung und Bildung
mobilisiert: Bis 2045 ergibt sich durch dieses Programm ein
kumulierter Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um bis zu 4750
Milliarden Euro.
Für die öffentliche Hand ergeben sich
daraus zusätzliche Einnahmen von bis zu gut 2300 Milliarden Euro.
Die Staatsverschuldung im Vergleich zum BIP würde wegen des großen
Wachstumsimpulses trotz der zusätzlichen Kredite weiter sinken.
„Wenn man es ernst meint mit der Verteidigungsfähigkeit
Deutschlands, dann sollte zwingend der Aufwuchs der
Verteidigungsausgaben auch mit einer – ohnehin lange notwendigen –
kreditfinanzierten öffentlichen Investitionsoffensive einhergehen.
Läuft beides Hand in Hand, lassen sich die finanziellen
Möglichkeiten Deutschlands nachhaltig erweitern“, sagt Prof. Dr.
Sebastian Dullien, Studienautor und wissenschaftlicher Direktor des
IMK.
„Angesichts der im internationalen Vergleich
niedrigen deutschen Staatsverschuldung ist auch kurzfristig
Spielraum für beides. Das einzige, was uns hindert, ist die
dysfunktionale Schuldenbremse.“ Für den Fall, dass eine Form der
Wehrpflicht wieder eingeführt würde, könnte zudem eine höhere
Produktivität durch bessere Infrastruktur einem verschärften
Arbeitskräftemangel entgegenwirken.
Mit dem Antritt der
neuen US-Regierung ist klar: Deutschland und Europa werden sich
nicht wie bisher darauf verlassen können, dass die USA bei einem
Angriff auf die EU-Staaten Unterstützung bei der Verteidigung
leisten würde – und das in einer zugespitzten Situation nach dem
russischen Überfall auf die Ukraine.
Deutschlands
Verteidigungsausgaben werden für diese neuen Herausforderungen
bislang als unzulänglich angesehen. Grundsätzlich lasse sich eine
gewisse Kreditfinanzierung der notwendigen Erhöhung rechtfertigen,
betont Ökonom Dullien. „Die nun notwendig gewordenen Ausgaben sind
Ergebnis jahrzehntelanger Unterinvestitionen in die Verteidigung und
dürften auch künftigen Generationen zugutekommen.“
Allerdings
zeichne sich aktuell die Gefahr ab, dass über die Kreditfinanzierung
höherer Verteidigungsausgaben andere, volkswirtschaftlich und
gesellschaftlich mindestens ebenso zentrale Zukunftsausgaben, etwa
zur Modernisierung der Infrastruktur, ins Hintertreffen geraten,
warnt der IMK-Direktor.
So kursiert im politischen Berlin
die Idee, mit Mehrheiten des alten Bundestages noch schnell das
Grundgesetz dahingehend zu ändern, dass mit einem neuen
Sondervermögen Bundeswehr – beziehungsweise einer Aufstockung des
existierenden Sondervermögens – eine zusätzliche Verschuldung für
Verteidigungsausgaben von 200 Milliarden Euro ermöglicht wird.
Zugleich wurde allerdings vom designierten Kanzler Friedrich Merz
eine zügige, grundlegende Reform der Schuldenbremse abgelehnt.
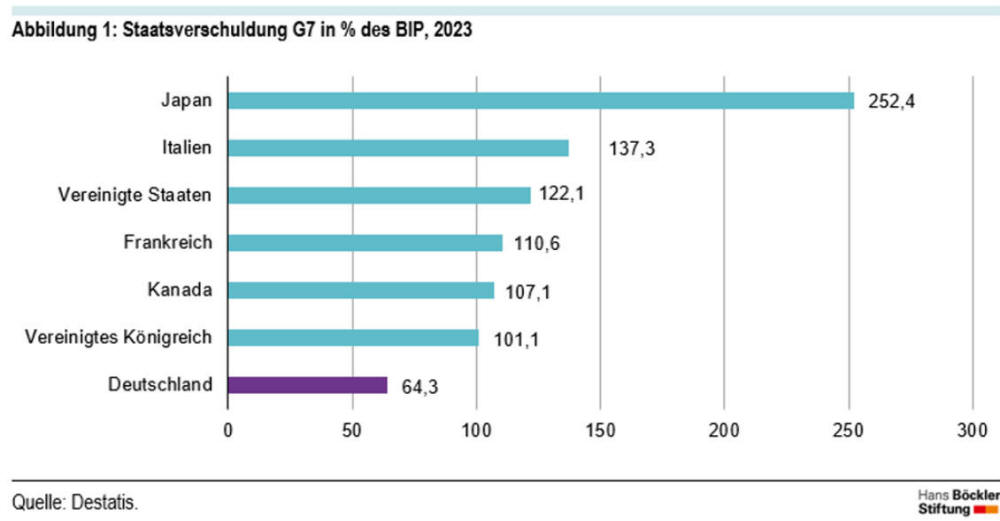
Zusammen mit dem Institut der deutschen Wirtschaft hat das IMK
die zusätzlichen Bedarfe für eine Modernisierung des öffentlichen
Kapitalstocks über die kommenden zehn Jahre auf 600 Milliarden Euro
geschätzt. Da diese Summen zum einen nicht realistisch durch
Einsparungen in den laufenden öffentlichen Haushalten zu finanzieren
sind, zugleich aber diese Investitionen künftig Wachstum und
Steuereinnahmen generieren und künftigen Generationen zugutekämen,
haben sich IMK und IW für eine Kreditfinanzierung ausgesprochen und
dazu – ebenso wie zahlreiche andere Wirtschaftswissenschaftler*innen
– eine Reform der Schuldenbremse angemahnt.
Deutsche
Schuldenquote wäre trotz Krediten für Infrastruktur und Verteidigung
weiter sehr niedrig unter G7-Ländern
Am Bedarf für ein rasch
umzusetzendes massives Investitionsprogramm hat die Notwendigkeit
höherer Verteidigungsausgaben nicht geändert, und auch nicht an der
Finanzierbarkeit, betont IMK-Direktor Dullien. Auch bei einer
zusätzlichen Verschuldung für die Bundeswehr von 200 Milliarden Euro
wäre es ohne Probleme für die Schuldentragfähigkeit Deutschlands
möglich, über die kommenden zehn Jahre die notwendigen 600
Milliarden Euro für öffentlichen Investitionen über neue
Kreditaufnahme zu finanzieren.
Die Spielräume illustriert
Dullien aufbauend auf einer kürzlich veröffentlichten Studie der
IMK-Forscher PD Dr. Sebastian Watzka und Dr. Christoph Paetz. Diese
hat in Simulationsrechnungen mit dem weit verbreiteten
makroökonomischen Modell NiGEM gezeigt, dass auch bei einer
zusätzlichen Kreditaufnahme für ein Investitionsprogramm von 600
Milliarden Euro über die kommenden zehn Jahre die Schuldenquote
Deutschlands kontinuierlich weiter fallen würde und auch kurzfristig
die aktuellen Werte von knapp über 60 Prozent des BIPs nicht
überschreiten würde.
Eine zusätzliche Kreditaufnahme von 200
Milliarden Euro für Verteidigung würde nach Dulliens neuen,
ergänzenden Berechnungen zwar für das Jahr 2035 (nach Verausgabung
der Gesamtsummen) die Schuldenquote um etwa 3,5 Prozentpunkte
erhöhen, diese bliebe aber deutlich unter 70 Prozent – und weit
unter dem Niveau, das andere Länder der G7-Gruppe aktuell haben
(siehe auch die Abbildung in der pdf-Version dieser PM; Link unten).
„Angesichts dessen, dass wir mit dem Geld in einer Ausnahmesituation
zwei zentrale Probleme des Landes entschlossen angehen können, ist
das ein absolut vertretbarer Preis“, sagt der Wissenschaftler.
Mittel- und längerfristig würde ein solches kreditfinanziertes
Investitionsprogramm sogar die nachhaltige Finanzierung von
Verteidigungsausgaben erleichtern. Denn wie die Studie von Watzka
und Paetz zeigt, erhöht es nach einigen Jahren massiv die
Wirtschaftsleistung in Deutschland – und damit die Einnahmen der
öffentlichen Hand und auch den Spielraum, mehr Verteidigungsausgaben
zu tätigen, ohne an anderer Stelle kürzen zu müssen.
In einem
konservativen Szenario, bei dem positive Zusammenhänge zwischen mehr
öffentlichen und zusätzlichen privaten Investitionen nur rudimentär
betrachtet werden, ergibt sich bis 2045 durch das
Investitionsprogramm ein kumulierter Zuwachs des
Bruttoinlandsprodukts (in konstanten Preisen) um rund 2130
Milliarden Euro. In einem realistischen Szenario, das diese
mittlerweile in der Forschung gut belegten Zusammenhänge einbezieht,
sogar um gut 4750 Milliarden Euro.
Bei einer Steuer- und
Abgabenquote von knapp 50 Prozent ergeben sich so für die
öffentliche Hand zusätzliche Einnahmen von gut 1000 Milliarden Euro
nach konservativer Schätzung oder mehr als 2300 Milliarden im
realistischen Szenario, rechnet Dullien vor. „Oder anders
ausgedrückt: Selbst nach konservativer Schätzung ergäben sich etwa
fünfmal so viel zusätzliche Staatseinnahmen, wie heute für ein neues
Sondervermögen Bundeswehr diskutiert werden, im realistischen
Szenario mehr als elfmal so viele Einnahmen.“
Schließlich
wäre eine öffentliche Investitionsoffensive auch für eine andere
Frage wichtig, die angesichts der veränderten geopolitischen Lage
gestellt wird: Wie könnte die deutsche Wirtschaft eine – ebenfalls
diskutierte – Wiedereinführung der Wehrpflicht verkraften?
Schließlich könnte das zu verschärftem Fach- und Arbeitskräftemangel
führen. Dullien geht auch bei diesem Thema von entlastenden Effekten
aus: „Da eine Modernisierung der Infrastruktur die Produktivität der
Beschäftigten in der Wirtschaft insgesamt erhöht, könnte der höhere
Personalbedarf der Bundeswehr durch eine Wehrpflicht besser
verkraftet werden.“
Deutsche Post und ver.di
einigen sich auf neuen Tarifvertrag
Rund 170.000
Tarifbeschäftigte erhalten mehr Geld und zusätzlichen Urlaub 5 %
mehr Lohn und zusätzlicher Urlaub für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, Auszubildende und BA-Studierende Thomas Ogilvie: „In
wirtschaftlich herausfordernden Zeiten für Post & Paket Deutschland
realisieren wir Lohnsteigerungen, die die Kaufkraft unserer
Beschäftigten erhalten.”
Nach schwierigen Verhandlungen haben sich die Deutsche Post und
die Gewerkschaft ver.di in der vierten Verhandlungsrunde auf einen
neuen Tarifvertrag für rund 170.000 Beschäftigte der Deutsche Post
AG geeinigt. Dieser sieht in Summe 5 % mehr Lohn für alle
tarifbeschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie alle
Auszubildenden und BA-Studierenden vor: 2 % zum 01.04.2025 und
weitere 3 % zum 01.04.2026.
Darüber hinaus gibt es
Änderungen beim Urlaub – was eine zentrale Forderung der
Gewerkschaft war. Alle Beschäftigten erhalten einen zusätzlichen
Urlaubstag; ab dem 16. Beschäftigungsjahr erhalten Beschäftigte
einen weiteren zusätzlichen freien Tag. Der neue Tarifvertrag hat
eine Laufzeit von 24 Monaten und ist frühestmöglich zum 31.12.2026
kündbar.
Thomas Ogilvie, Konzernvorstand Personal und
Arbeitsdirektor der Deutsche Post AG: „Die Verhandlungen mit ver.di
waren äußerst schwierig. Angesichts der Geschäftsentwicklung bei
Post & Paket Deutschland gab es kaum Spielraum für Lohnerhöhungen.
Dennoch war es uns wichtig, eine Einigung zu erzielen. Nach einem
sehr hohen Tarifabschluss im Jahr 2023 realisieren wir jetzt erneut
Lohnsteigerungen, die die Kaufkraft unserer Beschäftigten über die
vereinbarte Laufzeit des Tarifvertrags erhalten.
Auch für
unsere Kunden ist die Einigung gut: Die Warnstreiks sind vorbei und
der Fokus liegt wieder uneingeschränkt auf hoher Servicequalität und
Zuverlässigkeit. Die strukturellen Probleme, die Post & Paket
Deutschland belasten, sind mit der Einigung allerdings nicht vom
Tisch.“
Post & Paket Deutschland befindet sich inmitten
des Umbaus vom Brief- zum Paketgeschäft, der in einem
herausfordernden Umfeld stattfindet: Der strukturelle
Briefmengenrückgang hat sich deutlich beschleunigt, das
regulatorische Umfeld ist nachteilig, und die Kostenbelastung durch
die letzten Tarifabschlüsse ist signifikant.
Die
vereinbarte Tariferhöhung wird das Unternehmen allein in 2026 und
damit noch in der laufenden Entgeltregulierungsperiode strukturell
mit EUR 360 Mio. zusätzlichen Kosten belasten. Gleichzeitig besteht
weiterhin ein hoher Investitionsbedarf zum Umbau der Infrastruktur
des Brief- und Paketnetzes sowie in die ökologische Nachhaltigkeit
des Unternehmensbereichs.
Nikola Hagleitner, Vorständin
Post & Paket Deutschland: „In diesem schwierigen Umfeld ist es nun
unsere Aufgabe, den Umbau des Unternehmensbereichs voranzutreiben
und die Profitabilität von Post & Paket Deutschland zu sichern, um
weiter in den Umbau unserer Netze und die Qualität unserer
Dienstleistung investieren zu können. Mit Blick auf das Umfeld und
diesen Tarifabschluss werden wir daher unsere
Kostensenkungsmaßnahmen konsequent erweitern und beschleunigen
müssen.“
„Circular Economy -
CircularCities.NRW“: Maßnahmen für eine umfassende
Kreislaufwirtschaft in Kommunen gesucht
Um Kommunen auf
ihrem Weg zu einer klimaschonenderen Kreislaufwirtschaft zu
unterstützen, hat das Umweltministerium am Dienstag, 4. März 2025,
die dritte Einreichungsrunde des Förderaufrufs „Circular Economy -
CircularCities.NRW“ gestartet. Land und EU stellen hierfür 16
Millionen Euro über das EFRE/JTF-Programm Nordrhein-Westfalen
2021-2027 zur Verfügung.
„Kommunen haben zahlreiche
Möglichkeiten, um eine ressourcen- und klimaschonende
Kreislaufwirtschaft zu entwickeln. Ziel ist, dass Produkte und
Materialien immer wieder neu verwendet, repariert oder
weiterverkauft werden. Mit unserem Förderaufruf stärken wir die
Städte und Gemeinden bei der Abfallvermeidung und der sparsamen
Nutzung wertvoller Rohstoffe", erklärte Umweltminister Oliver
Krischer.
Der Schwerpunkt des Förderaufrufs „Circular Economy
– CircularCities.NRW“ liegt auf den Bereichen Wieder- und
Weiterverwendung von Produkten und Materialien, Reparatur sowie
ressourcenschonende Geschäftsmodelle. Gefördert werden Innovationen,
Investitionen, Aktivierungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen sowie
die Einstellung von Circular- Economy-Beauftragten in Kommunen.
In der jetzt startenden dritten Runde können sich die nächsten
Projekte für eine Förderung bewerben – zum Beispiel mit Innovationen
für ein verbessertes Recycling von kritischen Rohstoffen. Auch
interkommunale Zusammenschlüsse können gefördert werden, wenn sie
zum Beispiel die Sammlung und Wiederverwendung von Elektronik,
Möbeln, Einrichtungsgegenständen, Matratzen oder Reifen verbessern.
Antragsberechtigt sind Kommunen, kommunale Unternehmen und
Einrichtungen, Forschungseinrichtungen, kleine und mittlere
Unternehmen sowie Kammern, Vereine und Stiftungen. Projektskizzen
können bis zum 28. Mai 2025 eingereicht werden.
Hintergrund
Das Land Nordrhein-Westfalen gehört zu den innovativsten Regionen
der Europäischen Union und hat sich zum Ziel gesetzt, Vorreiter
einer ökologischen Transformation im Sinne des Europäischen Green
Deals zu werden. Der Förderwettbewerb „Circular Economy –
CircularCities.NRW“ ist ein wesentlicher Baustein dahin.
Für
zukunftsweisende, nachhaltige und innovative Vorhaben in
Nordrhein-Westfalen stehen aus dem EFRE/JTF-Programm NRW 2021-2027
EU-Mittel in Höhe von 1,9 Milliarden Euro des Europäischen Fonds für
Regionale Entwicklung (EFRE) und des Just Transition Funds (JTF) zur
Verfügung. Hinzu kommen eine Ko-Finanzierung des Landes
Nordrhein-Westfalen und Eigenanteile der Projekte.
Unterstützt werden Vorhaben aus den Themenfeldern Innovation,
Nachhaltigkeit, Mittelstandsförderung, Lebensqualität, Mobilität,
Strukturwandel in Kohlerückzugsregionen sowie strategische
Technologien und Wettbewerbsfähigkeit.
Weitere Informationen:
https://www.efre.nrw/einfach-machen/foerderung-finden/circular-economy-circularcitiesnrw
https://www.in.nrw/massnahmen/circular-cities-nrw
Neue Wege bei der Behandlung von Darmkrebs –
Patientenveranstaltung am 5. März
Ob das Fast-Track-Verfahren oder die onkologische Fachpflege –
bei der Bekämpfung von bösartigen Tumoren im Dickdarm oder Rektum
bieten neue Therapiewege, spezialisierte Pflegekräfte oder
personalisierte Medizin vielversprechende Fortschritte.
Was sich bei der Erkrankung von Darmtumoren in den letzten Jahren
getan hat und welche Möglichkeiten für welche Patient:innen geeignet
sind, darüber informieren die beiden Expert:innen des Helios
Darmkrebszentrums Dr. Daniel Busch (Oberarzt, links) und Tobias
Matfeld (Pflegerische Zentrumsleitung) am kommenden Mittwoch, 5.
März 2025, um 16 Uhr in kurzweiligen und laienverständlichen
Vorträgen zum Thema.


Die Veranstaltung findet am Standort Helios St. Johannes Klinik
(Dieselstraße 185, 47166 Duisburg) statt und ist kostenfrei. Weitere
Informationen sowie eine formlose Anmeldung unter 0203 546 30301.
Einladung
zum 4. Vaskulitis-Tag an der Helios St. Johannes Klinik
Seltene Erkrankungen wie die Vaskulitis eint ein Defizit: Viele
Betroffene und auch Ärztinnen und Ärzte wissen oftmals deutlich zu
wenig darüber, deshalb ist Aufklärung und Information ein
entscheidendes Puzzleteil in der Versorgung.
Um Patient:innen, Angehörigen und Fachleuten
wertvolle Informationen zu vermitteln, lädt die Helios St.
Johannes Klinik am Samstag, 8. März 2025, von 10 bis 14 Uhr
gemeinsam mit der Selbsthilfegruppe Vaskulitis der
Rheuma-Liga NRW zum 4. Vaskulitis-Tag nach Duisburg-Hamborn
ein.
Im Rahmen der Veranstaltung können sich
Betroffene und Interessierte, aber auch Ärzt:innen über
aktuelle Forschungsergebnisse, Hilfestellungen bei der
Diagnose und über den Alltag mit Vaskulitis informieren.
Zudem gibt es ausreichend Möglichkeit zu Austausch und
Kontaktaufnahme, ob mit anderen Betroffenen oder den
Organisator:innen der Selbsthilfegruppe. Weitere
Informationen zu Programm und Veranstaltungsort gibt es
unter:
Vaskulitistag 2025 - Aktionstag für Betroffene und
Interessierte | Helios St. Johannes Klinik Duisburg
Marita Schröders Umweg zur Diagnose Rheuma ist ein
bekannter Krankheitsbegriff, doch darunter fasst die Medizin
zahlreiche rheumatische Störungen zusammen. Viele davon sind
höchst selten und spezifisch, so wie die Vaskulitis. Für
Betroffene mit dieser besonderen Gefäßerkrankung bedeutet das
meist einen langen Diagnoseweg. Marita Schröder hatte Glück
im Unglück, denn ihre behandelnden Ärzte holten schnell eine
Zweitmeinung ein.

Dr. Monika Klass mit Patientin Marita Schröder
Als
Marita Schröder (69) im Januar 2020 eine Mittelohrentzündung
mit Hörminderung bekam, ahnte sie nicht, dass dies der Beginn
einer langen und ungewissen Reise sein würde. Wenige Monate
später folgte eine Lungenentzündung, die nicht unter
Antibiotika, jedoch unter Kortisonbehandlung zunächst besser
wurde. Doch immer, wenn das Medikament reduziert wurde,
verschlechterte sich ihr Zustand wieder. Schließlich wurde
sie in ihrer Heimatstadt Oberhausen stationär aufgenommen,
zahlreiche Untersuchungen folgten.
Nach drei
Wochen ohne endgültiges Ergebnis ahnten die dortigen
Mediziner:innen, dass die Ursache weitreichender sein könnte.
Sie kontaktierten Dr. Monika Klass, Chefärztin der
Rheumatologie und Physikalischen Medizin an der Duisburger
Helios St. Johannes Klinik und Spezialistin für seltene
Diagnosen, die die Patientin mitbeurteilte und schließlich
entscheidende Hinweise fand: Ein spezifischer Antikörper im
Blut wies auf eine seltene Autoimmunerkrankung hin, die
sogenannte Granulomatose mit Polyangiitis, eine Form der
Vaskulitis.
Die damit einhergehenden
Gefäßentzündungen können zu einer Verengung oder sogar zum
Verschluss der Gefäße führen, wodurch die Durchblutung
beeinträchtigt wird und Organe wie Lunge und Niere oder das
HNO-System Schaden nehmen können. Diese spezielle
Vaskulitis-Form betrifft nur etwa fünf von 100.000 Menschen
und zählt damit zu den besonders seltenen
Autoimmunerkrankungen. Eine zusätzliche Nierenbiopsie
bestätigte die Diagnose, so dass das Team von Monika Klass
bei Marita Schröder schließlich eine spezifische Therapie in
der Helios St. Johannes Klinik Duisburg einleiten konnte.
Für die Rentnerin eine enorme Erleichterung: „Es ist
so wichtig, eine Ärztin oder einen Arzt zu haben, dem man
vertraut.“ Auch Monika Klass weiß, wie wichtig das
Vertrauensverhältnis ist, zu den Patient:innen genauso wie zu
unterstützenden Abteilungen: „Gerade die interdisziplinäre
Zusammenarbeit der verschiedenen Fachrichtungen ist
entscheidend für eine erfolgreiche Therapie.“
An
ihrem Duisburger Standort kann sie auf all diese Strukturen
zurückgreifen, zahlreiche andere Abteilungen wie die
Nephrologie, Pneumologie oder Radiologie sind vor Ort und
können jederzeit hinzugezogen werden. Auch die umfassende
Behandlung von Marita Schröder – unter anderem mit Kortison
und immunsuppressiven Medikamenten, die auch in der
Chemotherapie eingesetzt werden – fand im
fächerübergreifenden Setting statt.
Heute
befindet sich die fast 70-Jährige in Remission, doch
regelmäßige Medikamentengaben und Kontrolluntersuchungen sind
weiterhin notwendig. Sie achtet besonders auf Warnsignale wie
Fieber, Husten oder Luftnot. Kraft und Unterstützung findet
sie in einer Selbsthilfegruppe in Dinslaken, wo sich
Betroffene und ihre Angehörigen austauschen. Trotz der
Herausforderungen nimmt Marita Schröder das Leben mit Humor:
„Den ganzen Tag im Garten wühlen geht nicht mehr – aber den
halben!“
Vor 10 Jahren in der BZ: Temporärer Fernbusbahnhof an der
Otto-Keller-Straße - Endgültiger Standort nicht an der Neudorfer Straße
an der Ostseite sondern südlich des neuen Hotels an der
Hbf-Westseite?
Der Baubeginn für das IC –
Hotel am jetzigen Standort des Fernbusbahnhofs ist durch
den Investor für Mai geplant. Der Fernbusbahnhof wird
deshalb, wie bereits im März 2013 angekündigt, verlegt
werden. Dazu ist mit Ratsbeschluss vom 13.05.2013 die
Otto-Keller-Straße auf der Ostseite des Hauptbahnhofes als
Zwischenlösung vorgesehen. Hier werden die Fernreisebusse
nach derzeitigem Informationsstand ab dem 4. Mai halten.
Die Arbeiten zur Einrichtung dieser Zwischenlösung
werden ab dem 20. April beginnen. Fahrbahnmarkierungen
werden dann aufgetragen, Wartehäuschen installiert und der
ruhende Verkehr mit neuer Beschilderung neu geregelt. Den
Anwohnern wurden diese Planungen bereits 2013 vorgestellt.
Haltestellen für vier Reisebusse werden hier ausgewiesen,
Halteverbote sichern den Ein- und Ausfahrtsbereich für die
Busse.
Um den Bahnhofsvorplatz, den Umbau der Mercatorstraße und um Baumfällungen geht es auch.

Hbf und Mercatorstraße mit dem damaligen Ausflugsziel "Gläserner Hut"
Diese temporäre Lösung soll zur Entlastung der
Otto-Keller-Straße möglichst kurzfristig durch den neuen,
endgültigen Standort des Fernbusbahnhofes abgelöst werden.
Dafür war bislang die Fläche an der Neudorfer Straße
nördlich des Parkhauses vorgesehen. Im Rahmen des
Bauleitplanverfahrens wurden immissionsschutzrechtliche
Untersuchungen durchgeführt, bei denen umweltrelevante
Belange ermittelt wurden, die das Bauleitplanverfahren und
somit die Realisierung eines Fernbusbahnhofs mit sechs
Bussteigen an dieser Stelle erheblich erschweren.
Vor
diesem Hintergrund wurde der Bereich rund um den
Hauptbahnhof im Zuge einer intensivierten
Alternativenprüfung erneut untersucht. Als
Alternative zum Standort Neudorfer Straße wurde dabei die
städtische Fläche süd-westlich des Hauptbahnhofsgebäudes
zwischen Mercatorstraße und A 59, südlich des neuen
IC-Hotels, als bester und vergleichsweise kurzfristig
realisierbarer Standort identifiziert.
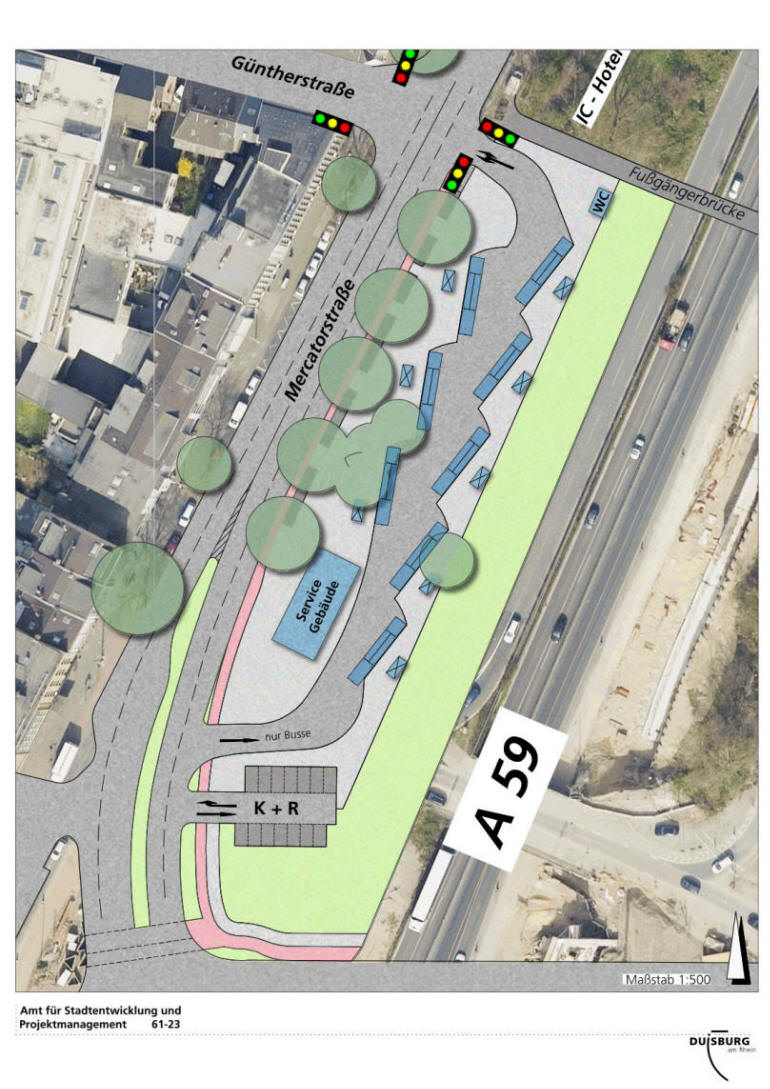
Nach dem derzeitigen Planungsstand eines für diese Fläche
neu ausgearbeiteten Konzepts könnte hier ein
Fernbusbahnhof errichtet werden, der den Anforderungen
besser gerecht wird als die Fläche an der Neudorfer
Straße. Der Anschluss an die Autobahn 59 über die
Anschlussstelle Duisburg-Zentrum ist ideal, die
anfahrenden Verkehre belasten nur minimal städtische
Straßen.
Die Fläche ist über die Fußgängerbrücke über die
A 40 direkt mit dem Hauptbahnhof verbunden. Dieser
Standort erfüllt damit alle Kriterien, die an einen
modernen Fernbusbahnhof gestellt werden. Auch bei dieser
alternativen Planung ist weiterhin als Zwischenlösung die
Otto-Keller-Straße südlich des Ostausgangs des
Hauptbahnhofs als temporärer Haltepunkt für die Fernbusse
zwingend erforderlich.
Die Beschlussvorlage zur
Fortführung der Planung eines Fernbusbahnhofs an der
Mercatorstraße ist unter der Drucksache (DS) 15-0274 im
Ratsinformationsportal unter www.duisburg.de zu finden und
wird dem Rat der Stadt am 27. April zur Entscheidung
vorgelegt.
Quiz, Comedy und Roboter:
„Nacht der Bibliotheken“ im Stadtfenster
Die
Zentralbibliothek an der Steinschen Gasse 26 öffnet demnächst für
Nachtschwärmer. Am Freitag, 4. April, ist wieder die bundesweite
„Nacht der Bibliothek“, an der sich auch Duisburg beteiligt. Von 19
bis 22 Uhr veranstaltet die Zentralbibliothek unter dem Motto
„Wissen. Teilen. Entdecken.“ zum Beispiel ein Quiz mit dem
TV-bekannten „Quizgott“ Sebastian Jacoby. Um 19.15 und um 20.30 Uhr
können Teams (je vier bis sechs Personen) gegeneinander antreten.
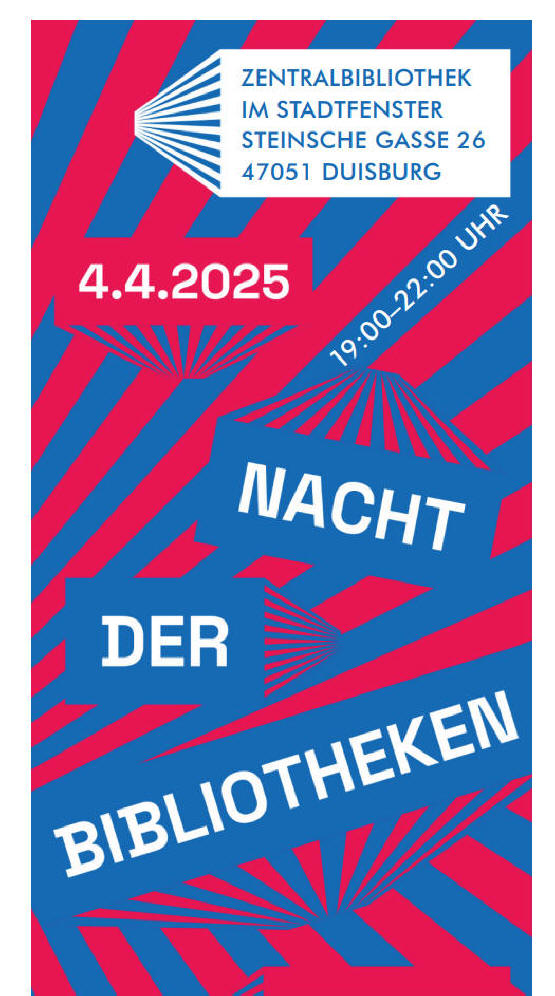
Auf der Bühne geht es dann komödiantisch kritisch, scharf und
herzerwärmend zu - mit viel Lokalkolorit aus dem Ruhrpott. Die
Comedians Lale Öztürk, Morea Remy und Jay Nightwind treten auf.
Außerdem versorgt Manfred Bellingrodt bei einem „Insta-Walk“ durch
die Bibliothek Interessierte mit Tipps, wie man aus seinen Fotos mit
einfachen Mitteln mehr herausholen kann.
Und wer immer
schon mal DJ sein wollte, kann bei einem Workshop für Einsteiger
erste Grundlagen erlernen. Wer mag, kann sich zudem im Line Dance
ausprobieren, etwas über Ahnenforschung erfahren, mit kleinen
Robotern, sogenannten Ozobots, Rennen fahren, beim Manga-Workshop
mitmachen und vieles mehr. Das „Café im Stadtfenster“ sorgt für die
abendliche Verköstigung. Natürlich können die
Bibliotheksbesucherinnen und -besucher in der Zeit auch in den
Lektüren stöbern, Medien ausleihen, zurückgeben oder sich Als Nutzer
anmelden.
Der Eintritt zur „Nacht der Bibliotheken“ ist
frei. Für einige Angebote ist allerdings eine Anmeldung
erforderlich. Informationen zum detaillierten Programm gibt es unter
www.stadtbibliothek-duisburg.de. Für Fragen steht das
Bibliotheksteam während der Öffnungszeiten vor Ort oder telefonisch
unter 0203 283-4218 zur Verfügung. Die Servicezeiten sind montags
von 13 bis 19 Uhr, dienstags bis freitags von 11 bis 19 Uhr sowie
samstags von 11 bis 16 Uhr.
Vorlesespaß in der Bezirksbibliothek Vierlinden
Kinder ab vier Jahren
sind am Mittwoch, 5. März, um 16 Uhr in die Bezirksbibliothek
Vierlinden am Franz-Lenze-Platz zum Vorlesespaß eingeladen. Sena
Sahin liest spannende und lustige Geschichten vor. Im Anschluss wird
noch gemeinsam gespielt. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Die Anmeldung ist online auf www.stadtbibliothek-duisburg.de unter
Veranstaltungen möglich. Fragen beantwortet das Team der Bibliothek
gerne persönlich oder telefonisch unter 0203 473380. Die
Servicezeiten mit Personal vor Ort sind dienstags von 14 bis 18 Uhr,
mittwochs von 10.30 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr, freitags von 14
bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr.
Geschichten, Einsätze und Themen aus der Pflege (hauptsächlich
Altenpflege, vom Autor der zivilen Fahnder/innen)
Normalerweise spielt das Ermittlerduo Judith
Reiter & Nick Fengler (bekannt als „Die zivilen Fahnder/innen“, die
BZ berichtete) bei seinen Veröffentlichungen die Hauptrolle. Beim
neuesten Werk, das sich ausschließlich dem Thema Pflege widmet,
steuern sie wie das zweite Dialekt-Duo Miriam „Miri“ Homberg und
Michael „Mike“ Steiner aus Bayern vereinzelt Fälle bei.
Der Autor ist examinierter Altenpfleger und in diesem Beruf über
zwanzig Jahre tätig. Zudem hatte er fünfzehneinhalb Jahre einen
pflegebedürftigen Menschen in der eigenen Familie. Mit „Geschichten,
Einsätze und Themen aus der Pflege“ präsentiert der Essener
Christian Günther sein inzwischen neuntes Buch.
In diesem
beleuchtet er nicht nur die Situation von Pflegekräften, sondern
ebenso von Pflegebedürftigen und Angehörigen. Oft gaben ihm reale
Erlebnisse Ideen für fiktive Storys, von denen hier eine Auswahl
präsentiert wird. Inklusive seiner drei „Pflege-Geschichten“, den
drei Geschichten zum Thema „Gewalt gegen Rettungskräfte“ und einer
Auseinandersetzung mit der Impfpflicht.
Seine eigene
Geschichte „Fünfzehneinhalb Jahre“ schrieb der Autor erst 2024
rückblickend für eine externe Anthologie auf. Sie ist nun erstmals
in eigener VÖ enthalten. Im Anschluss an diese persönliche
Kurzgeschichte präsentiert er Auszüge aus seinem inzwischen
vergriffenen Roman „Lange Nacht“ aus dem Jahr 2009: Der bairische
Ermittler Mike bekam damals fiktiv einen Schwiegervater mit dem
gleichen Krankheitsbild.
Im Ruhrpott ist es die demente Oma
von Nicks Partnerin Judith, die als Nebenhandlung einbezogen wird.
Bei „Zu Besuch bei Omma Irmi“ ist sie erst ein paar Tage im Heim und
hadert noch mit dem Ortswechsel. Eine exklusive Vorschau auf die für
Sommer geplante Halbstaffel mit „Ein (un)möglicher Todesfall“!
Bei „Notfallzimmer“ wird eigentlich ein in der Nacht abgängiger
Bewohner gesucht, doch was Judith und Nick darüber hinaus entdecken,
ist schockierend. Die „Klavier-Trilogie“ konfrontiert Miri und Mike
mit einem vereinsamten und verwirrten, dehydrierten und
kachektischen Senior. Das Gegenteil dazu ist der Pensionär, der bei
„Falscher Enkel, richtiger Polizist“ einen Betrüger aufs Kreuz legt.
Ist die Versorgung eines Pflegebedürftigen zu Hause möglich -
oder doch besser ein Heimeinzug? Diese Frage stellt sich öfters bei
den Geschichten. 24/7-Betreuung hat den Nachteil, dass Angehörige
kaum mehr nach draußen kommen oder auf Urlaub und nötige Erholung
verzichten, ein sich wie lebendig begraben Fühlen.
Es ist
kein Sachbuch oder Ratgeber, dennoch soll das Buch pflegerische
Inhalte näher bringen und für Thematiken sensibilisieren, diverse
gesundheitliche Spektren abdecken. Fehlende Zeit bei der Arbeit, wie
sich ein Notfall auswirkt oder wie das Arbeiten an Weihnachten ist,
während die Familie feiert zu Hause. Was passiert, wenn ein Arzt
eine unklare Todesursache feststellt, warum dürfen ältere Menschen
nicht einfach gehen?
„Geschichten, Einsätze und Themen aus
der Pflege“
(ISBN 9783769375428) ist am 20.02.25 erschienen. Das
Buch mit 192 Seiten hat das Format 13,5x21,5cm. Es kostet 10,00€,
das eBook (2,99€) folgt nach.
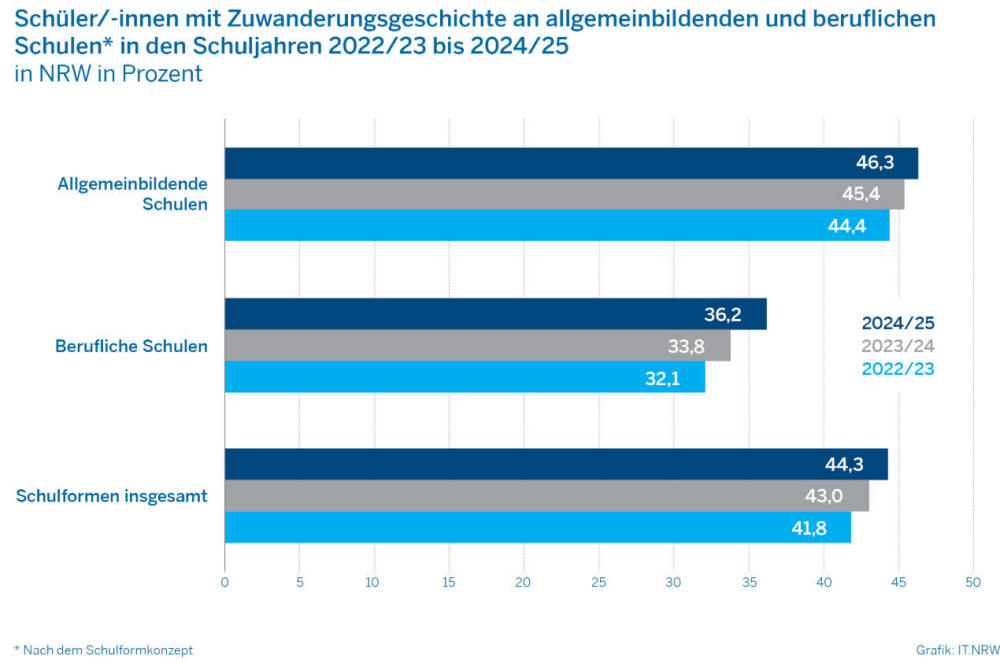
Fotoausstellung zur Folk- und
Weltmusikreihe „Spelunken-Spektakel“ in Ruhrort - 15 Jahre
Kulturarbeit im Stadtteil
Das Kreativquartier Ruhrort blickt in diesem Jahr unter dem
Motto „anderthalb.dekaden“ auf 15 Jahre Kulturarbeit im Stadtteil
zurück. Startpunkt war das Kulturhauptstadtjahr 2010, in dem Ruhrort
als „Hafen der Kulturhauptstadt“ Akzente setze. Daraus entwickelte
sich eine engagierte Szene, die nach dem Motto, „das
Kulturhauptstadtjahr kann ja nicht alles gewesen sein“, weitere
vielfältige kulturelle Aktivitäten organisierte.
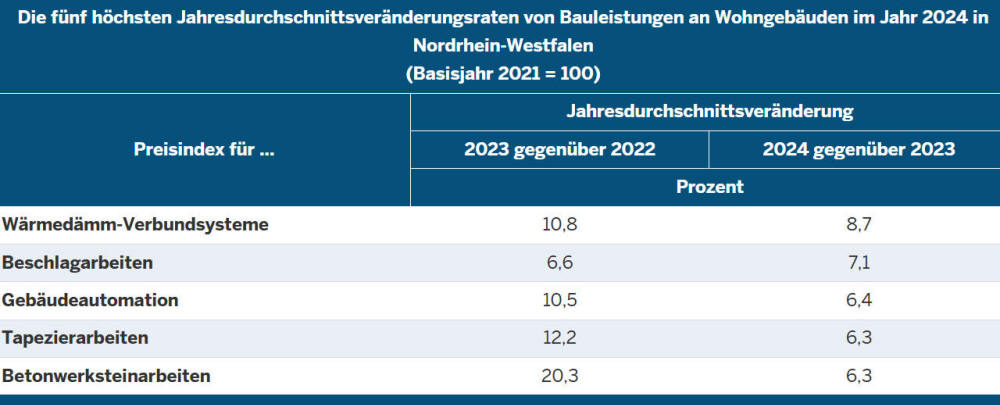
Auftritt des Provinztheaters auf dem Museumsschiff Oscar Huber -
Foto Peter Jacques
Eine davon ist die Folk- und
Weltmusikreihe „Spelunken-Spektakel“, die seit 2017 Konzerte aus
dieser Musiksparte in den Kneipen und Kultureinrichtungen in Ruhrort
veranstaltet. Diesem „Spelunken-Spektakel“ ist nun eine
Fotoausstellung vom 9. bis 21. März 2025 im „Das Plus am Neumarkt“,
Neumarkt 19, 47119 Duisburg gewidmet.
Vielfältiges
Rahmenprogramm
Die Ausstellungseröffnung/Vernissage am
Sonntag, 9. März 2025, Beginn 11:00 Uhr, wird von Holger Technau und
weiteren Musikern der Gruppe „Singadjo“ gestaltet. Die Singadjos
verquicken virtuos viele unterschiedliche Stilrichtungen, ob Gipsy,
Rumba, Rembetiko, Mariachi, Balkan, Latin, Chanson usw.
Daher ist für ihre Musik „Folk“ im Sinne von „Weltmusik“ der einzig
richtige Sammelbegriff. Die Singadjos waren 2017 am ersten Konzert
des Spelunken-Spektakels beteiligt und sind der Reihe seit dem
freundschaftlich verbunden.
Am Freitag, 14. März 2025,
Beginn 19:30 Uhr im Ausstellungslokal wird die Gruppe „Schlagsaite“
ein Spelunken-Spektakel Konzert gestalten.
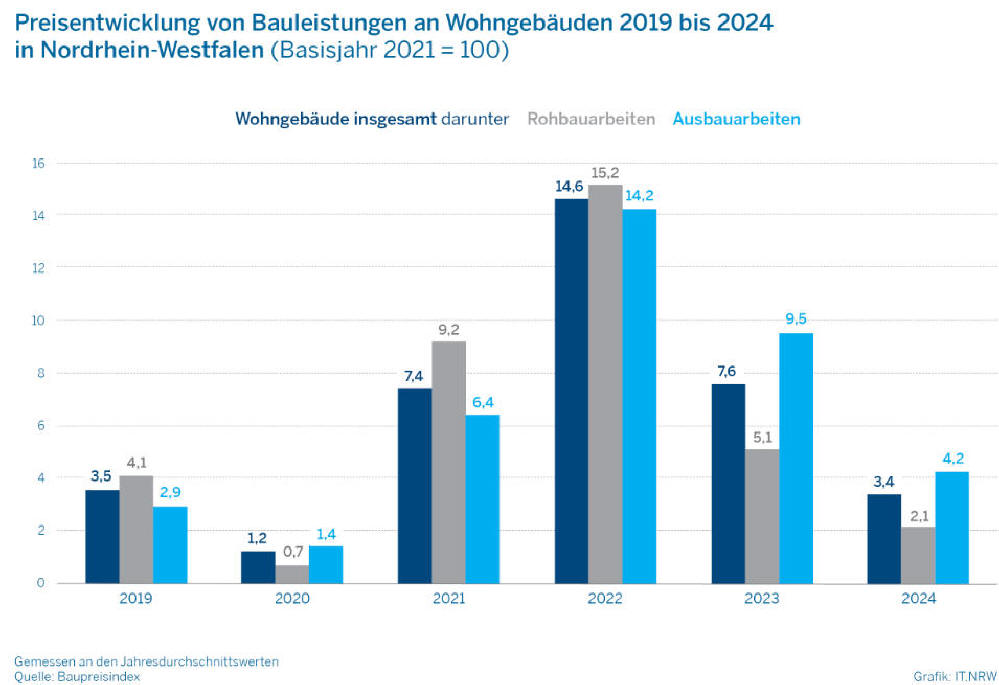
Virtuoser Folk trifft hier auf leidenschaftliche Polkarhythmik,
moderne Chansons werden mit Balkan und Gypsy-Swing Elementen
versetzt und verträumte Akustik-Balladen stehen neben
gesellschaftskritischen Stücken in der Tradition deutscher
Liedermacher. Kurz: Das ist Weltmusik in deutscher Sprache.
Ihr
neuestes Album „Fantasie von Übermorgen“ mit Gedichtvertonungen von
Erich Kästner, wurde gerade für den Preis der deutschen
Schallplattenkritik nominiert.
Und zum guten
Ausstellungschluss/Finissage am Freitag, 21.März 2025, Beginn 19:00
Uhr, wird das Duo „Im Taxi rauchen“ den musikalischen Schlusspunkt
setzen.„Im Taxi rauchen“ steht dafür, etwas tun zu dürfen, was man
einfach mal braucht und das zu teilen, mit denen die es wollen. Die
Songwriterpunks Thore und Maurice machen Indie-Alternative-Rock mit
deutschen Texten, die aus ihren Herzen plaudern, nuanciert bis
plakativ, gut gefühlt bis schlecht gelaunt.
Öffnungszeiten: Zu den Veranstaltungen im „Das Plus am Neumarkt“
sowie Dienstag + Donnerstag 10:00 - 13:00 Uhr und Freitag 10:00 -
13.00 und 14:00 - 18:00 Uhr. Eintritt frei. Zu den Veranstaltungen
wird um Spenden gebeten.
Ein Projekt im Rahmen von
Kreativ.Quartiere, gefördert vom Ministerium für Kultur und
Wissenschaft des Landes NRW und umgesetzt von ecce - european centre
for creative economy
Ökumenischer Kanzeltausch
im Duisburger Süden beginnt
Ab März feiert
die katholische Gemeinde aus Duisburg Ungelsheim an jedem
2. Sonntag im Monat in der evangelischen
Auferstehungskirche am Sandmüllersweg ihre Gottesdienste,
die evangelischen Geschwister feiern dafür an den gleichen
Tagen Gottesdienst in der Mündelheimer St.
Dionysius-Kirche.
Grund für den „ökumenischen
Kanzeltausch“ ist die Entwidmung der katholischen Kirche
St. Stephanus in Ungelsheim Ende des letzten Jahres. Dort
werden seitdem keine Messen mehr gefeiert. Die
Evangelische Versöhnungsgemeinde Duisburg Süd hatte damals
der katholischen Gemeinde angeboten, an jedem 2. Sonntag
im Monat in der Auferstehungskirche eine Messe zu halten,
damit katholische Christinnen und Christen zumindest alle
vier Wochen die Möglichkeit haben, an einer Messe in
Ungelsheim teilzunehmen.

Marienstatue
- aufgenommen wurde es noch in St. Stephanus (Foto:
www.evgds.de).
Los geht es mit dem Kanzeltausch am 9. März 2025: Um
9.30 Uhr wird in St. Dionysius in Mündelheim ein
evangelischer Gottesdienst gefeiert, in der Ungelsheimer
Auferstehungskirche wird an diesem Tag um 10 Uhr eine
katholische Messe gefeiert.
Dort können dann die
katholischen Gläubigen aus Ungelsheim „ihre“ Maria
wiedersehen – die Statue zog mit der Entwidmung der
katholischen Kirche St. Stephanus in das benachbarte
evangelische Gotteshaus um. Infos zur Evangelischen
Versöhnungsgemeinde Duisburg-Süd gibt es im Netz unter
www.evgds.de.

NRW Sterbefallschätzung: 2024 das zweite Jahr
in Folge weniger Sterbefälle Nach ersten
Schätzungen sind im Jahr 2024 etwa 220 000 Personen in
Nordrhein-Westfalen gestorben. Wie das Statistische
Landesamt mitteilt, wären das im Vergleich zum Vorjahr
knapp 6 000 bzw. 2,7 Prozent weniger Gestorbene
(2023: 226 034 Sterbefälle).
Nachdem im
Jahr 2022 mit 234 176 Sterbefällen der bisherige
Höchststand verzeichnet wurde, bedeutet dies nun den
zweiten Rückgang in Folge. 2024 rund 68 300 Sterbefälle
für das gesamte Ruhrgebiet prognostiziert Für die Mehrheit
der Kreise und kreisfreien Städte kann für das Jahr 2024
mit weniger Sterbefällen als im Vorjahr gerechnet werden.
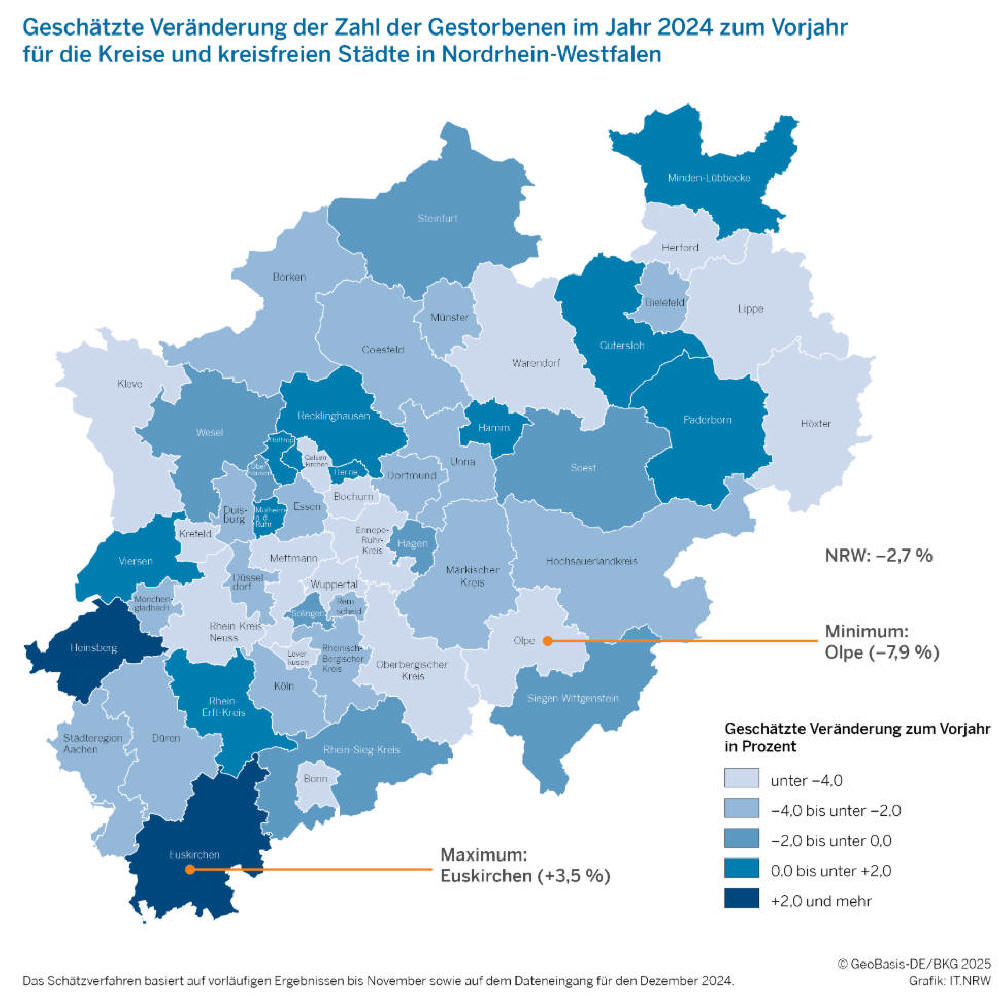
Die höchsten Rückgänge werden für den Kreis Olpe
(−7,9 Prozent), die kreisfreie Stadt Bochum (−7,8 Prozent)
sowie den Kreis Warendorf (−7,7 Prozent) prognostiziert.
Der stärkste Anstieg der Sterbefallzahlen wird in den
Kreisen Euskirchen (+3,5 Prozent) und Heinsberg
(+2,3 Prozent) erwartet.
Im gesamten
Ruhrgebiet gab es im Jahr 2024 schätzungsweise rund
68 300 Sterbefälle, das wären 2,5 Prozent weniger als ein
Jahr zuvor (2023: 70 068). Wie die Statistikerinnen und
Statistiker mitteilen, stammen die genannten Daten aus
einer Schätzung, die vom Statistischen Landesamt
Nordrhein-Westfalen entwickelt und durchgeführt wurde.
Das Schätzverfahren basiert auf vorläufigen
Ergebnissen für die Monate Januar bis November 2024, die
Sterbefallzahlen für Dezember 2024 fließen als geschätzte
Werte in die Berechnung ein. Diese Auswertung ermöglicht
lediglich Aussagen zur Zahl der Sterbefälle insgesamt.
Eine Differenzierung nach Geschlecht oder Alter ist
aufgrund dieser Datenbasis nicht möglich. Endgültige
Ergebnisse der Sterbefallstatistik 2024 stehen
voraussichtlich im Juni 2025 zur Verfügung. (IT.NRW)
NRW-Bauhauptgewerbe:
Produktion im Dezember 2024 um 0,4 Prozent gesunken –
Nachfrage im vierten Quartal 2024 um 11,6 Prozent
niedriger als ein Jahr zuvor
Die Produktion im
nordrhein-westfälischen Bauhauptgewerbe ist im Dezember
2024 um 0,4 Prozent niedriger gewesen als ein Jahr zuvor.
Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als
Statistisches Landesamt weiter mitteilt, war die
Baunachfrage im vierten Quartal des Jahres 2024 um
11,6 Prozent niedriger als im entsprechenden
Vorjahreszeitraum.
Bauproduktion im Tiefbau
gestiegen und im Hochbau gesunken
Die Produktion im
nordrhein-westfälischen Bauhauptgewerbe war im
Dezember 2024 um 0,4 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor.
Die Produktion im Hochbau verringerte sich gegenüber dem
Vorjahresergebnis um 4,7 Prozent.

Im Tiefbau war im selben Zeitraum ein Anstieg der
Bauproduktion von 4,7 Prozent zu beobachten. Im Vergleich
zum entsprechenden Monatsergebnis des Jahres 2019 ist ein
Anstieg der Bauproduktion von 15,5 Prozent zu vermelden:
Sowohl die Bauproduktion im Hochbau (+20,2 Prozent) wie
auch die Produktion im Tiefbau (+10,3 Prozent) lag über
dem Niveau von Dezember 2019.

Das kumulierte Ergebnis der Bauproduktion für das
gesamte Jah 2024 war um 1,6 Prozent höher als in der
entsprechenden Vergleichsperiode 2023. Baunachfrage:
Auftragslage im vierten Quartal 2024 um 11,6 Prozent
gesunken Die Auftragseingänge des nordrhein-westfälischen
Bauhauptgewerbes waren im vierten Quartal 2024 um
11,6 Prozent niedriger als im entsprechenden
Vorjahreszeitraum.
Für die Auftragslage ist
sowohl im Tiefbau (−13,1 Prozent) als auch im Hochbau ein
Rückgang (−10,2 Prozent) zu konstatieren. Für das vierte
Quartal 2024 ermittelte das Statistische Landesamt im
Vergleich zum vierten Quartalsergebnis des Jahres 2019
einen Rückgang der Baunachfrage (−11,0 Prozent). Die
Auftragslage verschlechterte sich im Hochbau um
22,2 Prozent während sie sich im Tiefbau um 4,7 Prozent
verbesserte.