






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 12. Kalenderwoche:
17. März
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Dienstag, 18. März 2025 - Global Recycling Day
Stadt Duisburg informiert über kommunale Wärmeplanung
Weitere Bürgerdialoge in den Bezirken
Die Stadt
Duisburg stellt Interessierten derzeit den aktuellen Planungsstand
zur kommunalen Wärmeplanung vor.
Nach einer stadtweiten
Auftaktveranstaltung im Lehmbruck Museum und den ersten
Bürgerdialogen in den Bezirken Homberg/Ruhrort/Baerl und
Meiderich/Beeck folgen Bürgerdialoge in den weiteren fünf Bezirken.
In diesen erfahren die Teilnehmenden mehr über die spezifische
Planung zum Ausbau der Wärmenetze und zur Nutzung erneuerbarer
Energien für die Wärmeversorgung in den Bezirken.
Eine
Anmeldung zu den fünf noch anstehenden Bürgerdialogen ist per E-Mail
an waermeplanung@duisburgstadt.de, über die Website www.du-heizt.de
oder telefonisch unter 0203/94000 gewünscht.
Termine
(jeweils von 18.30 – 21 Uhr)
Bürgerdialog Hamborn Donnerstag,
20. März 2025, Hamborner Ratskeller (Duisburger Str. 213, 47166
Duisburg)
Bürgerdialog Walsum Montag, 24. März 2025 Stadthalle
Walsum (Waldstraße 50, 47179 Duisburg)
Bürgerdialog Rheinhausen
Mittwoch, 26. März 2025 Rheinhausenhalle (Beethovenstraße 20, 47226
Duisburg)
Bürgerdialog Mitte Donnerstag, 27. März 2025 Lehmbruck
Museum (Friedrich-Wilhelm-Straße 40, 47051 Duisburg)
Bürgerdialog Süd Mittwoch, 9. April 2025 Steinhof (Düsseldorfer
Landstraße 347, 47259 Duisburg)
Bei den Bürgerdialogen
werden individuelle Rückfragen zu Gebäudesanierungen, zur
Modernisierung von Heizanlagen und zur Dekarbonisierung und zum
Ausbau Wärmenetzes beantwortet. Hierfür sind die Klimaschutzexperten
der Stadt Duisburg, die Stadtwerke Duisburg, die Fernwärme Duisburg,
die Verbraucherzentrale NRW sowie die Innung für Sanitär, Heizung
und Klima vor Ort.
„Die Bürgerinnen und Bürger
interessiert besonders die Zukunft der Erdgasversorgung und welche
Alternativen – etwa Fernwärme oder Wärmepumpen - für das Haus, in
dem sie leben, vorgeschlagen werden,“ berichtet Kai Lipsius, Leiter
der Stabsstelle Klimaschutz der Stadt Duisburg von den Erfahrungen
der bisherigen Bürgerdialoge. „Außerdem spielen natürlich die
Fördermöglichkeiten und Kosten für die persönliche Wärmewende eine
wesentliche Rolle.“
Die kommunale Wärmeplanung bewertet
für jedes Gebäude in Duisburg den Weg zu einer klimaneutralen
Wärmeversorgung. Da heute in den meisten Fällen mit Erdgas oder Öl
geheizt wird, bringt die Wärmewende für viele Bürgerinnen und Bürger
Veränderungen mit sich. Die gesetzlich vorgeschriebene kommunale
Wärmeplanung ist ein zentraler Baustein, um die Klimaschutzziele der
Stadt Duisburg zu erreichen und die Wärmeversorgung nachhaltig,
kosteneffizient und klimafreundlich zu gestalten.
Baubeginn Fernwärmeleitung Quartier Wedau
Am Montag, 17. März 2025 begann die Fernwärme Duisburg GmbH mit dem
Bau einer 7,7 Kilometer langen Fernwärmeleitung zur Anbindung des
Quartiers Wedau sowie weiterer Stadtteile an das Fernwärmenetz
Mitte-Süd-West.
Durch die entstehende Verbindungsleitung
wird zukünftig sowohl eine Wärmeeinspeisung aus der Energiezentrale
im Quartier Wedau in das Wärmenetz möglich als auch eine zusätzliche
Wärmelieferung aus dem bestehenden Fernwärmenetz an die
Wärmeabnehmer im Quartier Wedau. Über die neue Fernwärmeleitung
lassen sich perspektivisch rund 6.000 Wohneinheiten mit Fernwärme
versorgen.
Die Gesamtinvestitionen belaufen sich auf 23,7
Millionen Euro. Davon werden 3,24 Millionen Euro im Rahmen des
Landesprogramms „progres.nrw“ gefördert. Weitere Fördermittel über
das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) in Höhe von 40 Prozent der
Investitionskosten sind möglich.
„Die neue Fernwärmeleitung
ist ein wichtiger Bestandteil der Wärmewende hier bei uns in
Duisburg, denn unser Ziel ist es, die Fernwärmeversorgung weiter
auszubauen und bis 2035 die Wärme für unsere Kundinnen und Kunden in
Duisburg vollständig CO2-neutral zu erzeugen“, erklärt Matthias
Lötting, Geschäftsführer der Fernwärme Duisburg.
Ab dem 17.
März 2025 beginnen die Netze Duisburg GmbH im Auftrag der Fernwärme
Duisburg GmbH mit der Verlegung der neuen
Fernwärmeerschließungsleitung. Innerhalb circa 8 Wochen soll der
erste Bauabschnitt auf der Wedauer Straße zwischen dem Kreisverkehr
Kalkweg bis hinter den Allensteiner Ring erfolgen.
Die
weiteren Abschnitte erfolgen fortlaufend Richtung Masurenallee und
Werkstättenstraße. Leider lassen sich hierfür entsprechende
Tiefbauarbeiten und damit einhergehende Verkehrsbehinderungen nicht
vermeiden.
Fernwärme wichtiger Faktor für Wärmewende
In rund der Hälfte der Haushalte in Duisburg befinden sich aktuell
noch Gasheizungen, weitere rund 15 Prozent der Haushalte heizen mit
Öl. Bei der künftigen Umstellung liegt ein zentraler Fokus auf der
Nutzung von Fernwärme, insbesondere in Ballungsgebieten. Bereits
heute heizen mehr als 70.000 Haushalte mit Fernwärme, die Heizkessel
und Brennstofflager überflüssig macht.
„In den kommenden
Jahren wollen wir unser Fernwärmenetz und unsere Fernwärmeerzeugung
deutlich ausbauen, so dass wir genug Wärme produzieren, um bis zu
15.000 weitere Haushalte anschließen zu können. Fernwärme ist heute
schon umweltfreundlich, bis 2035 beabsichtigen wir unsere Wärme
komplett CO2-neutral erzeugen“, sagt Matthias Lötting.

Vier Bauabschnitte
Die rund 7.700 Meter lange Verbindungsleitung
wird in den kommenden zweieinhalb Jahren in vier Bauabschnitten
verlegt. Durch die neue Fernwärmeleitung können dann in Zukunft die
Quartiere Wedau-Süd und Wedau-Nord, die Stadtteile Wanheim, Buchholz
mit Fernwärme versorgt werden. In Wanheimerort, Wedau und Großenbaum
werden über entsprechende Leitungen im ersten Schritt Großkunden
versorgt. Danach können entlang der Trasse auch weitere Anrainer
durch Verdichtungs- und Erschließungsmaßnahmen an die Fernwärme
angeschlossen werden.
Zur Orientierung hier der derzeitige
Planungsstand:
Bauabschnitt 1
Bauzeit: März 2025 bis Anfang
2027
Wedauer Straße (ab Kreuzung Großenbaumer Allee), über
Masurenallee, Wedauer Brücke, Werkstättenstraße bis zur
Energiezentrale
Bauabschnitt 2
Bauzeit: Sommer 2025 bis
Herbst 2027
Neuenhofstraße, Kreuzung Düsseldorfer Straße bis
Wedauer Straße (bis Kreuzung Großenbaumer Allee)
Bauabschnitt
3
Bauzeit: Sommer 2025 bis Frühjahr 2027
Großenbaumer Allee
(ab Kreuzung Wedauer Straße) bis ca. Gesamtschule Süd
Bauabschnitt 4
Bauzeit: Frühjahr 2026 bis Herbst 2027
Kalkweg
(ab Kreisverkehr Wedauer Straße) bis ca. Landesportbund NRW e.V.
(Kreuzung Friedrich-Alfred-Allee)
Für die Gesamtbauzeit plant
die Fernwärme Duisburg unter Berücksichtigung von Parallelarbeiten
mit ca. 2,5 Jahren. Für die entstehenden Behinderungen im Bereich
der Baustellen und für den Wegfall von Parkplätzen bittet die
Fernwärme Duisburg um Verständnis. Die Anwohner werden zusätzlich
mit persönlichen Anschreiben über die sie betreffenden Baumaßnahmen
informiert.

Verlegung einer Fernwärmeleitung im Quartier Wedau - Fotos Fernwärme
Duisburg
„Eure Stadt, eure Themen“:
Jugendsprechstunde mit dem Oberbürgermeister
Was bewegt
die Jugendlichen in Duisburg? Was läuft gut, und was könnte besser
sein? Um genau das herauszufinden, lädt Oberbürgermeister Sören Link
Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren zu einer Sprechstunde in
das Rathaus ein.
Nachdem die erste Kindersprechstunde im
vergangenen Jahr überaus positiv angenommen wurde, möchte
Oberbürgermeister Sören Link nun in einer Jugendsprechstunde am 8.
April mit jungen Duisburgerinnen und Duisburgern ins Gespräch
kommen. „An Jugendliche werden oft viele Erwartungen geknüpft – in
der Schule, in der Ausbildung, und auch privat. Häufig wird von
ihnen verlangt, sich in die festen Strukturen der Erwachsenenwelt
einzufügen.
Mit der Jugendsprechstunde möchte ich ihnen
einen Raum bieten, in dem sie frei und ohne Druck ihre Meinung
äußern können“, sagt Oberbürgermeister Sören Link. „Es geht darum,
ihre Ideen und Wünsche kennenzulernen und zu verstehen, was sie
bewegt. Denn wenn junge Menschen sich in Duisburg aktiv einbringen,
gewinnt am Ende die ganze Stadt.“
Was: Jugendsprechstunde
mit Oberbürgermeister Sören Link
Wer: Jugendliche (14 bis 17
Jahre)
Wann: Dienstag, 8. April 2025, von 15 bis 17 Uhr
Wo:
Rathaus Duisburg, Burgplatz 19, 47051 Duisburg
Wie: Anmeldung
bis zum 25. März per E-Mail unter
jugendsprechstunde@stadtduisburg.de oder auch telefonisch unter
(0203) 283-6111
Niedriglohnforschung des IAQ: Niedriglohnrisko
2022 gesunken
Das Risiko, hierzulande für einen
Niedriglohn zu arbeiten, ist zwischen 2021 und 2022 um fast zwei
Prozentpunkte auf 19 Prozent gesunken. Der vermutliche Grund: die
Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro im Jahr 2022. Vor allem in
Westdeutschland zeigt sich ein deutlicher Rückgang. Zu diesem
Ergebnis kommt eine aktuelle Auswertung des Instituts Arbeit und
Qualifikation IAQ der Universität Duisburg-Essen.
Für den
neuen IAQ-Report zum aktuellen Stand der Niedriglohnforschung
betrachtete Dr. Thorsten Kalina insbesondere die jährlichen Zahlen
des sozio-oekonomischen Panels (SOEP) für 2022. Im Mittelpunkt
seiner Auswertung stand dabei die Frage, wie sich der Umfang der
Niedriglohnbeschäftigung verändert hat und wie sich dies auf
einzelne Beschäftigtengruppen auswirkt.
Der Anteil der
Niedriglohnbeschäftigung erreichte in Deutschland in den Jahren 2009
bis 2011 einen Höchststand von rund einem Viertel (24 %) aller
Beschäftigten. Erst seit 2018 – also drei Jahre nach der Einführung
des gesetzlichen Mindestlohns – war die Anzahl der
Niedriglohnbeschäftigten und deren Anteil an der Gesamtbeschäftigung
erstmals erkennbar gesunken (21,2 %).
Zwischen 2021 und 2022
ist das Niedriglohnrisiko in Gesamtdeutschland von 20,9 % auf 19 %
weiter zurückgegangen. Bemerkenswert ist vor allem, dass sich dieser
Rückgang sehr deutlich in Westdeutschland bemerkbar macht (von 19,9
% auf 17,9 %), während frühere Rückgänge vor allem mit der
Angleichung der Ostlöhne an das Westniveau erklärt werden konnten.
Kalinas Auswertungen zeigen außerdem, dass sich im Zeitraum der
Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro das Niedriglohnrisiko für einen Teil
der besonders stark von Niedriglöhnen betroffenen Gruppen reduziert
hat, z.B. für Migrant:innen oder befristet Beschäftigte. Bei
Geringqualifizierten, Frauen, Jüngeren, Älteren oder
Minijobber:innen konnte hingegen nur ein unterdurchschnittlicher
Rückgang des Niedriglohnrisikos festgestellt werden.
Dagegen
zeigte sich ein überdurchschnittlicher Rückgang eher bei
Hochqualifizierten, mittleren Altersgruppen, Männern oder
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten – also nicht bei den
Beschäftigtengruppen, die besonders schlecht bezahlt werden.
„Es ist fraglich, ob eine abermalige Erhöhung des Mindestlohns dazu
geeignet ist, den Niedriglohnsektor weiter zu verkleinern, und ob
sie andererseits besonders betroffenen Beschäftigtengruppen helfen
würde, ein Lohnniveau oberhalb der Niedriglohnschwelle zu
erreichen“, so der Arbeitsmarktforscher. „
Die internationale
Mindestlohnforschung wie auch eigene Studien zeigen vielmehr, dass
der Umfang der Tarifbindung einen deutlich stärkeren Einfluss auf
den Umfang der Niedriglohnbeschäftigung in einem Land hat als die
Existenz oder Höhe eines gesetzlichen Mindestlohns“. Der
Wissenschaftler plädiert daher für eine Ausweitung der Tarifbindung,
um den Niedriglohnsektor hierzulande auch zukünftig weiter zu
verkleinern.
Rund 800 Kufenflitzer beim Eislaufspaß
der Stadtwerke Duisburg
Flotte Runden drehen, den Puck
schlagen, beim Bobbycar-Rennen richtig Gas geben oder auf der
Hüpfburg die höchsten Sprünge machen: Beim Stadtwerke-Eislaufspaß in
der PreZero Rheinlandhalle am Sonntag, 16. März, kamen rund 800
kleine und große Kufenflitzer voll auf ihre Kosten. Bereits zum
dritten Mal hatten die Stadtwerke Duisburg zu dem Familienevent in
die Eishalle an der Margarethenstraße eingeladen.

Eislaufspaß: Beim Stadtwerke Eislaufspaß konnte nach Herzenslust auf
dem Eis gelaufen werden. Rund 800 große und kleine Besucherinnen und
Besucher kamen in die PreZero Rheinlandhalle. Quelle: Stadtwerke
Duisburg
Volle sechs Stunden gab es auf dem Eis, drumherum
und vor der Halle allerhand zu erleben und zu entdecken. Wer wollte,
konnte nach Herzenslust auf der in drei Bereiche unterteilten
Eisfläche seine Runden auf den Kufen drehen, sich mit dem
Eishockey-Schläger versuchen oder mit dem Schlitten übers Eis
sausen. Neben dem Eis konnten sich die kleinen Besucherinnen und
Besucher beim Kinderschminken in fantastische Tierwesen verwandeln,
sich auf der Hüpfburg austoben oder in der Fotobox tolle
Erinnerungsfotos schießen.
Natürlich waren auch die
„Hausherren“ mit dabei und die Füchse-Spieler Adam Zoweil und
Brooklyn Beckers schrieben fleißig Autogramme. Ebenfalls mit dabei
war das Füchse-Maskottchen „Manni“, das jeden Fotowunsch erfüllte.
Wem nach so viel Action der Magen knurrte, fand an den
Verpflegungsständen die richtige Stärkung für die nächsten eisigen
Highlights beim Stadtwerke-Eislaufspaß.

„Manni“, das Maskottchen der Füchse Duisburg, stand für Fotowünsche
der Fans parat. Quelle: Stadtwerke Duisburg
Weil die
Teilnehmerzahl begrenzt werden musste, konnten sich die
Kundenkarten-Inhaber der Stadtwerke Duisburg vorab für die Teilnahme
anmelden. Eine Kundenkarte kann jeder Inhaber eines Strom- oder
Gasbelieferungsvertrages bei den Stadtwerken Duisburg kostenlos
beantragen und dann deutschland- und sogar europaweit bei mehr als
3.000 Rabattpartnern kräftig sparen. Alle Informationen gibt es im
Internet unter www.stadtwerke-kundenkarte.de.
BVS – Wasserstoff: Hoffnungsträger oder Hype?
Herausforderungen und Chancen der Wasserstoffwirtschaft
Grüner Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien hergestellt wird,
gilt als Schlüsseltechnologie für eine klimaneutrale Zukunft. Doch
wie realistisch ist ein rascher Marktdurchbruch – und wie gut sind
Deutschland und Europa aufgestellt? Diese Fragestellungen standen im
Mittelpunkt eines Fachseminars des BVS e.V. in der Referenzfabrik.H2
des Fraunhofer IWU in Chemnitz.
Wissenschaftliche und industrielle
Experten analysierten die wirtschaftlichen, technischen und
politischen Herausforderungen, die auf dem Weg zu einer
leistungsfähigen Wasserstoffwirtschaft zu bewältigen sind.
Hohe Nachfrage – Begrenztes Angebot
„Die Nachfrage nach grünem
Wasserstoff steigt, doch Produktion und Verfügbarkeit hinken
hinterher", erläutert Dirk Hennig, Bundesfachbereichsleiter
Maschinen, Anlagen, Betriebseinrichtungen beim BVS e.V. „Deutschland
benötigt bis 2030 rund 4,5 Mio. Tonnen Wasserstoff – weltweit werden
derzeit lediglich etwa eine Million Tonnen produziert. Unsere
Aufgabe als Sachverständige besteht darin, Innovationen objektiv zu
bewerten und belastbare Fakten für fundierte Entscheidungen
bereitzustellen. Es reicht nicht, lediglich grüne
Wasserstoffprojekte zu fördern – wir müssen die gesamte Lieferkette
wirtschaftlich tragfähig gestalten, um eine flächendeckende,
marktreife Versorgung sicherzustellen.“
Einsatzbereiche und
Praxisbeispiele
Obgleich Wasserstoff für viele noch ein
abstraktes Thema darstellt, zeigt sich bereits heute eine
vielfältige Anwendungspraxis:
Mobilität:
Wasserstoffbetriebene Fahrzeuge bieten eine emissionsfreie
Alternative zu herkömmlichen Antriebssystemen und könnten
insbesondere im Schwerlastverkehr von Bedeutung sein.
Industrie:
In der Stahlproduktion ersetzt Wasserstoff zunehmend
kohlenstoffbasierte Reduktionsverfahren und senkt so die
CO₂-Emissionen. Auch in der chemischen Grundstoffherstellung findet
Wasserstoff Anwendung.
Gebäudetechnik: Erste Projekte belegen den
Einsatz von Wasserstoff zur Wärmeversorgung in Wohn- und
Industriegebäuden.
Energieversorgung: Pilotprojekte untersuchen
den Einsatz von Wasserstoffspeichern als integralen Bestandteil der
Sektorenkopplung, also der Verbindung von Strom, Wärme und
Mobilität.
So ambitioniert sind die deutschen
Wasserstoff-Ziele
Deutschland verfolgt beim Wasserstoff
ambitionierte Ziele. So soll den aktuellen Plänen der
Bundesregierung zufolge bis 2030 eine Erzeugungskapazität von
10 Gigawatt für grünen Wasserstoff entstehen. In der
Referenzfabrik.H2 in Chemnitz arbeiten Experten an industriellen
Lösungen zur Massenfertigung von Elektrolyseuren und
Brennstoffzellen.
„Gleichzeitig stehen wir jedoch vor einigen
wesentlichen Herausforderungen“, so Dr.-Ing. Ulrike Beyer, Expertin
für Wasserstofftechnologien beim Fraunhofer IWU in Chemnitz: „Die
hohen Investitionskosten und begrenzten Produktionskapazitäten
erschweren eine flächendeckende Versorgung. Zudem erfordert die
spezifische Physik von Wasserstoff neue Sicherheitskonzepte für den
Transport und die Speicherung des Gases. Und nicht zuletzt müssen
wir eine sichere und leistungsfähige Infrastruktur aufbauen, um die
Lieferketten langfristig zu sichern.“
Unabhängige Expertise
Sachverständiger als wirtschaftlicher Impulsgeber
Der BVS
e.V., als Verband qualifizierter Sachverständiger, liefert fundierte
und praxisorientierte Bewertungen für technologische Innovationen.
„Wir werden von Unternehmen und Behörden zu Wasserstofffragen
konsultiert – unsere Aufgabe ist es, faktenbasierte Antworten zu
liefern“, erklärt Dirk Hennig.
Das Fachseminar in Chemnitz
verdeutlicht, dass grüner Wasserstoff großes Potenzial bietet,
jedoch nur durch realistische Planung und wirtschaftliche
Skalierbarkeit zu einem integralen Bestandteil der Energiewende
werden kann. Der BVS e.V. wird diese Diskussion weiterhin aktiv
vorantreiben und sich für eine sachliche, differenzierte Bewertung
der Wasserstofftechnologie einsetzen. In diesem Rahmen sind bereits
weitere Fachveranstaltungen geplant, die die neuesten Entwicklungen
in der Wasserstoffwirtschaft kritisch begleiten werden.
Über
den BVS – Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter sowie
qualifizierter Sachverständiger e.V.
Als bundesweit
mitgliedsstärkste Vereinigung öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger gehören dem BVS rund 3.000 Sachverständige an,
organisiert in 12 Landes- und 13 Fachverbänden. Sie sind auf über
250 Sachgebieten tätig und erfüllen die höchsten Standards im
Sachverständigenwesen: Grundsätzlich sind alle Mitglieder öffentlich
bestellt und vereidigt, anderweitig durch staatliche Stellen oder
durch Gesetz befugte Institutionen hoheitlich beliehen oder
zertifiziert.
https://www.bvs-ev.de/
Feierabendführung zu kolonialen Spuren in
Duisburg
Koloniale Spuren in Duisburg sind das Thema
einer Feierabendführung, die Carmen Simon Fernandez und Miriam
Monsemvula am Dienstag, 18. März, um 17 Uhr in der Ausstellung
„ÜBERSEeHEN. Auf (post)kolonialer Spurensuche in Duisburg“ im
Kultur- und Stadthistorischen Museum, Johannes-Corputius-Platz 1,
anbieten.
Die Führung findet auf Initiative des Zentrums
für Erinnerungskultur im Rahmen der Internationalen Wochen gegen
Rassismus statt. Welche Spuren der deutschen Kolonialzeit finden
sich in Duisburg? Und welche Auswirkungen sind bis heute spürbar?
Diese und weitere Fragen quer durch zwei Jahrhunderte Duisburger
Geschichte werden behandelt. Dabei kommen auch verschiedene Themen
wie Handel, Mode und Kindererziehung nicht zu kurz.
Mit
dabei ist immer der Blick in die Gegenwart und die Frage, wo uns
diese Spuren heute noch begegnen. Der Eintritt ist frei. Um eine
Anmeldung per E-Mail unter zfe@stadtduisburg.de wird gebeten. Das
gesamte Programm des Stadtmuseums ist im Internet unter
www.stadtmuseum-duisburg.de abrufbar.

„Kolonialwaren wie Kaffee oder Tabak kamen über die Duisburger Häfen
in die Stadt.“ Foto: Tanja Pickartz/Stadt Duisburg
„Weihnachtsbäckerei“ ist Deutschlands schönste Briefmarke
2024
Fast 30.000 Personen haben an der Umfrage der
Deutschen Post teilgenommen
Auf den Plätzen 2 und 3: „Hund“ und
„Kryptomarke Kölner Dom“
Liedermacher Rolf Zuckowski: „Mit der
Briefmarke wollten wir Kinder für das Schreiben und Empfangen von
Briefen begeistern“
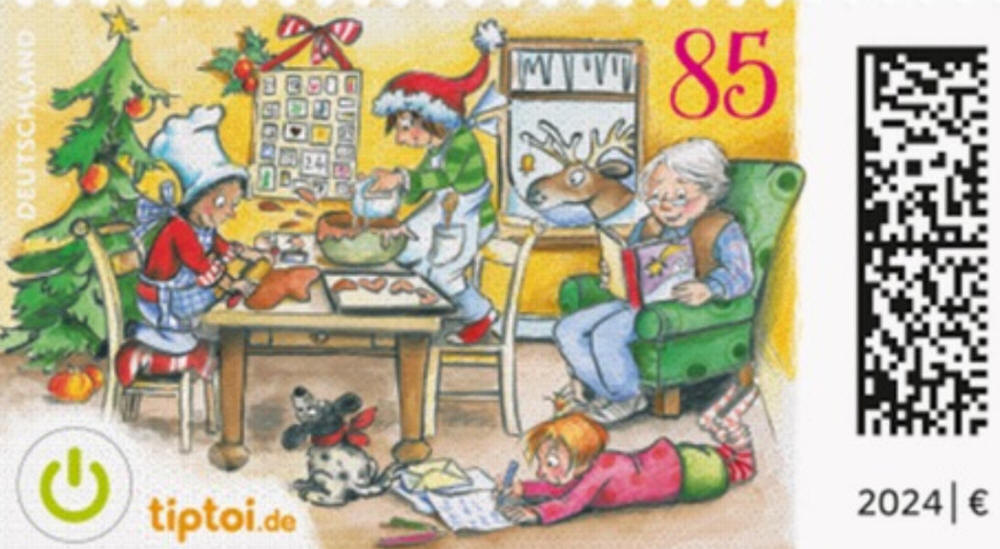
Deutschlands Briefmarkenfreunde haben abgestimmt: Mit knappem
Vorsprung ist die Briefmarke „Weihnachten für Kinder -
Weihnachtsbäckerei“ zur schönsten Briefmarke des Jahres 2024 gewählt
worden. Die 85 Cent-Marke hat die Künstlerin Julia Ginsbach
illustriert. Sie zeigt eine adventlich geschmückte Wohnstube, in der
Kinder eifrig Plätzchen backen, während Opa die Weihnachtsgeschichte
vorliest. Auf Platz 2 folgt das Motiv „Hund“ aus der
Briefmarken-Serie „Beliebte Haustiere“, das einen freundlich in die
Kamera blickenden Border Collie zeigt. Platz 3 geht an die
Krypto-Marke „Kölner Dom“, deren Motiv von einer Künstlichen
Intelligenz gestaltet wurde. Fast 30.000 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer haben bei der Umfrage der Deutschen Post mitgemacht.
Die Sonderbriefmarke mit dem Siegermotiv „Weihnachtsbäckerei“
hatten Deutsche Post, Liedermacher Rolf Zuckowski und Ravensburger
Verlag gemeinsam Anfang November vergangenen Jahres präsentiert. Der
Clou ist, dass man die Briefmarke auch hören kann, z. B. Liedzeilen
des Ohrwurms „In der Weihnachtsbäckerei“ von Rolf Zuckowski, kurze
Dialoge der abgebildeten Personen, die Weihnachtsgeschichte oder
Wissenswertes rund um den Advent. Mit einem tiptoi® Stift von
Ravensburger können Kinder und Erwachsene die Audioinhalte auf dem
mit viel Liebe zum Detail gestalteten Motiv zum Klingen bringen. So
wurde aus der Weihnachtspost 2024 auch ein echtes, weltweit
einmaliges Hörerlebnis und eine Entdeckungsreise für Jung und Alt.
Dazu Rolf Zuckowski, Liedermacher und Komponist: „Ich freue mich
sehr, dass die Sondermarke ‚Weihnachtsbäckerei‘ zur schönsten
Briefmarke des Jahres 2024 gewählt worden ist. Sie würdigt nicht nur
die Tradition des Plätzchenbackens in der Adventszeit, die ich seit
1987 mit meinem Lied begleite. Mit der Briefmarke wollten wir zudem
Kinder und ihr Umfeld für das Schreiben und Empfangen von Briefen
begeistern. Das scheint uns gelungen zu sein und wir haben ein
wichtiges kulturelles Zeichen in dieser zunehmend digitalen Welt
gesetzt. Die Illustratorin Julia Ginsbach hat mit ihrem bezaubernden
Kunstwerk viel dazu beigetragen. Dafür danke ich ihr von Herzen."
Nikola Hagleitner, Vorständin Post & Paket Deutschland der DHL
Group, sagt: „Wir bedanken uns bei den vielen Menschen, die an
unserer Umfrage zur schönsten Briefmarke teilgenommen haben. Für die
Deutsche Post ist dieses Feedback sehr wichtig, um auch künftig bei
der Gestaltung neuer Briefmarken-Motive den Nerv unserer Kundinnen
und Kunden zu treffen. Dass diesmal die ‚Weihnachtsbäckerei-Marke‘
gewonnen hat, freut mich sehr, denn sie erinnert uns in diesen
unübersichtlichen Zeiten an liebgewonnene Traditionen – bildlich und
akustisch.“
Details zur Umfrage
Insgesamt gefiel den
Umfrageteilnehmern an den drei Siegermotiven die vermittelte
Stimmung und Farbgebung, die Briefmarke „Weihnachtsbäckerei“ fanden
zwei Drittel originell. 55 Prozent der Teilnehmer an der Umfrage
waren weiblich. Für das Siegermotiv stimmten sogar 74 Prozent Frauen
ab. 64 Prozent aller Teilnehmer gehörten der Altersgruppe 50+ an,
wobei fast die Hälfte derjenigen, die für das Motiv
“Weihnachtsbäckerei” votierten, zwischen 30 und 49 Jahre alt waren.
13 Prozent bezeichneten sich selbst als Sammler. Neun der
Briefmarken, die es bei der Umfrage in die „Top Ten“ geschafft
haben, sind von Briefmarkendesignerinnen und -designern der
Deutschen Post gestaltet worden.
Im Zeitraum vom 6. Februar
bis 6. März 2025 konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einer
öffentlichen Online-Befragung für ihre drei Favoriten des
vergangenen Jahres abstimmen. Bereits in den Jahren zuvor hatte die
Deutsche Post eine Wahl zur schönsten Briefmarke durchgeführt. 2023
gewann das Motiv „100 Jahre Disney“, davor landete mit dem
„Polarlicht“ erstmals ein Naturbild auf Platz 1. 2021 war „Sendung
mit der Maus“ die schönste Briefmarke, 2020 „Die Biene Maja“.
Gedanken eines Klimatoten: Bilder vom Küchentisch -
Ausstellung und Lesung
Frank Bialinski aka Linse hat
23 Jahre lang Punk-Rock-Musik gemacht als Texter und Sänger in den
Bands „Fluchtversuch“ und „Bad News“. Einige Jahrzehnte lang war
sein Leben von Abhängigkeiten und Depressionen bestimmt. In seinem
ersten Buch, das 2023 erschienen ist, finden sich Bilder, Objekte
und Texte aus den letzten 13 Jahren. Diese entstehen immer intuitiv
und sind von äußeren Einflüssen oder inneren Bedürfnissen und
Gefühlslagen bestimmt.
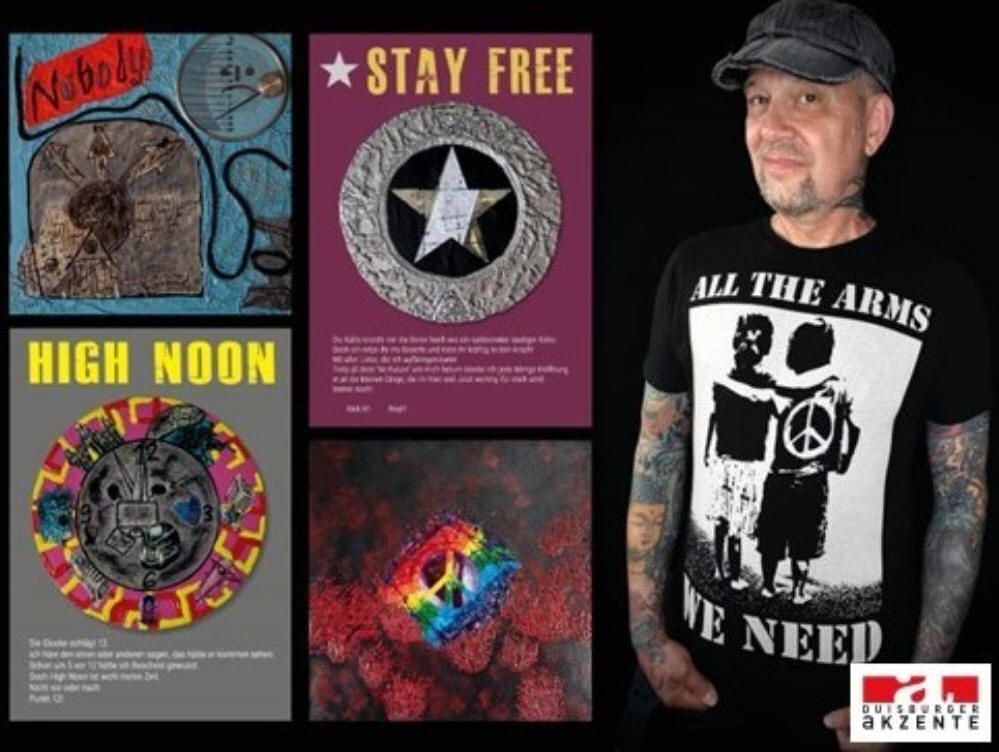
Einige seiner Werke werden während der Akzente 2025 im
Mercator-Buchladen ausgestellt und können während der
Geschäftszeiten besichtigt werden. Freitag, 21.3. 18:30 Uhr
Mercator-Buchladen Bergiusstr. 18-20 47119 Duisburg
www.mercator-buchladen.buchhandlung.de Eintritt: frei -
Hutveranstaltung
Vernissage der 3-fach
Ausstellung im Amt zu den 46. Duisburger Akzenten - Sein und Schein
Auf Einladung von Bezirksbürgermeisterin Beate Lieske
stellen eine Fotokünstlerin und zwei Fotokünstler für das
Kreativquartier Ruhrort im Duisburger Süden aus. Eröffnet wird die
Ausstellung mit der Vernissage am Donnerstag, 20. März 2025 um 18
Uhr.
ICH SEHE WAS – SIEHST DU ES AUCH? Realität –
Wahrnehmung – Täuschung Marion Köllner zeigt, dass sich im urbanen
Raum auch heute Täuschungen (der „schöne Schein“) an Häuserwänden,
Garagentoren etc. finden lassen. Während im ersten Teil der
Ausstellung die „Illusionen“ in der realen Welt zu finden sind, wird
im zweiten Teil die „Täuschung“ durch die Fotografin geschaffen und
der Betrachtende irritiert.
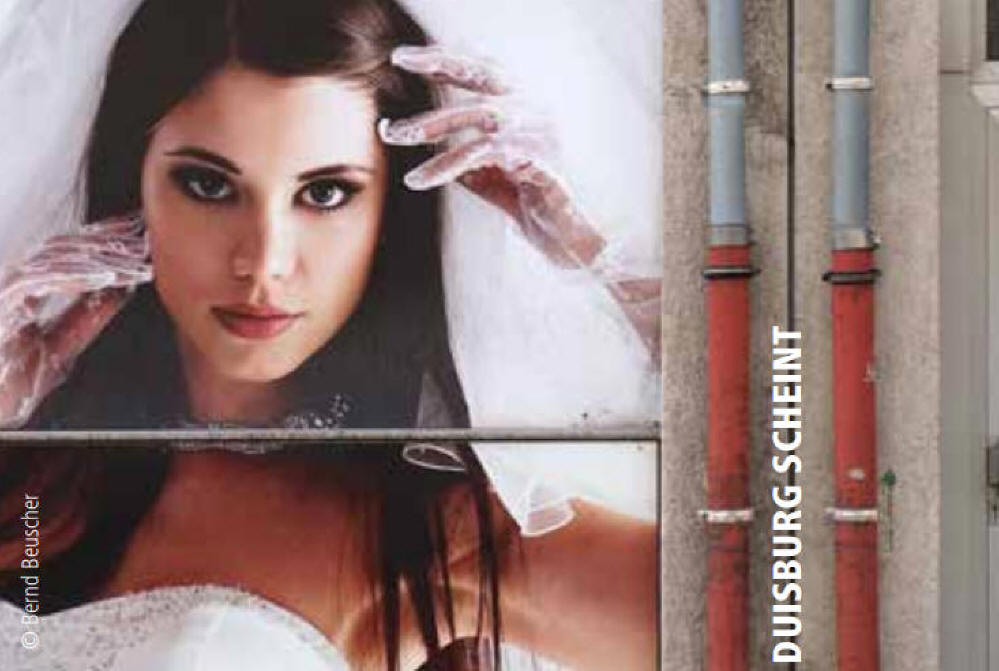
C BBernd euscher
Schein UND SEIN IN DER DIGITALEN
BILDERWELT Surreale Fotoarbeiten Dieter Schwabe aka Mononom
bearbeitet das Thema „Schein und Sein“ in seinen ausgestellten
Bildern unter dem Aspekt der Wahrnehmung surrealer Fotoarbeiten.
Ungewöhnliche Bildkompositionen lassen den Betrachter Wahrnehmung
und Verständnis von Realität hinterfragen.
DUISBURG
SCHEINT Woanders is’ auch sch...e Als waschechter Duisburger ist
Bernd Beuscher voreingenommen. Darum hat er nicht nur seine
Heimatstadt portraitiert, sondern auch anderen Städten eine Chance
gegeben. Schillernd zwischen Schein und Sein haben seine Fotos etwas
Idyllisches und Abgründiges. Sie fangen Wünsche und Versprechen ein.
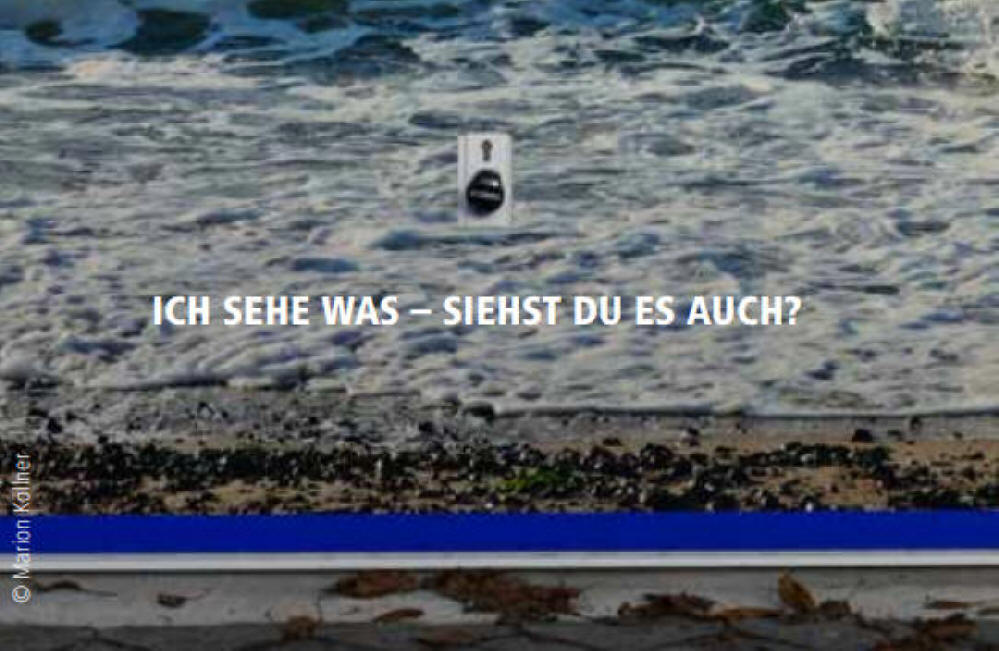
C Marion Köllner
Begleitet wird die Vernissage vom Duisburger
Liedermacher Bernd Eisenblätter. Eine Veranstaltung des
Kreativquartier Ruhrort zum Kulturfestival 46. Duisburger Akzente
"Sein und Schein"
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do 08:00 -
16:00 Uhr Di 8:00 - 18:00 Uhr Fr 8:00 - 14:00 Uhr Bezirksamt
Duisburg-Süd Sittardsberger Allee 14, 47249 Duisburg. Jeweils drei
Fotos je Aussteller werden zum „Appetitmachen“ für die ganzen
Ausstellungen auch in der Zweigstelle der Stadtbiliothek Duisburg in
Buchholz zu deren Öffnungszeiten gezeigt.
Das
Leben im Mittelpunkt: AKZENTE-Ausstellung in der Salvatorkirche
eröffnet
Marayle Küpper, Arno Bortz und Pfarrer Martin
Winterberg (rechts im Bild, stehend) haben am letzten Donnerstag in
der Duisburger Salvatorkirche einen guten Platz für die drei Bilder
von Wilfried Weiß gefunden. Sie sind Teil der Ausstellung „Sein und
Schein wird zu Leben und Licht“, deren Eröffnung am Sonntag Wilfried
Weiß aber nicht mehr erleben konnte. Der Künstler ist in der
vorletzten Woche plötzlich verstorben.
Die Mitglieder
der Künstlergruppe entschieden, die Werke des Kollegen dürfen in der
Ausstellung nicht fehlen. „Plötzlich, erschreckend, aber friedevoll
eingeschlafen. Wenn man so will, mitten in der Vorbereitung dieser
Ausstellung, auf die er sich freute“ erinnerte Pfarrer Winterberg in
seiner Predigt zum Eröffnungsgottesdienst an Weiß.
Dem
dritten seiner Ausstellungsbilder habe der 1955 geborene Künstler
erst die Grundierung geben können, doch für Pfarrer Winterberg sieht
es vollendet aus und passend zum Leitmotiv der Ausstellung, die das
Licht und das Leben in den Mittelpunkt stellt: Symbol dafür ist die
zentralen Rauminstallation mit einer zarten, lebendige Pflanze, die
während der Ausstellung wächst.
Von dort führen die
Blicke zu Raumnischen der Citykirche, in denen die Werke der
Künstlerinnen und Künstler aufgebaut sind: die Plastiken von Arno
Bortz, Bilder und Upcycling von Silvia Kemmer, Malerei und Druck von
Marayle Küpper, Collagen von Silvia Thimm und eben die drei Bilder
des verstorbenen Künstlers Wilfried Weiß.
Die Ausstellung ist
Teil des Duisburger AKZENTE-Programms und bis zum 6. April zu sehen.
Die Salvatorkirche, Am Burgplatz im Zentrum der Stadt ist geöffnet
dienstags bis samstags, von 10 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 13
Uhr. Der Eintritt ist frei.

Marayle Küpper, Arno Bortz und Pfarrer Martin Winterberg (rechts im
Bild, stehend) beim Aufbau der Ausstellung in der Salvatorkirche…
vor den Werken von Wilfried Weiß (Foto: salvatorkirche.de).
Knabbern
und Brunchen für die neue Gemeindeküche
In der
Evangelischen Rheingemeinde Duisburg braucht es dringend eine neue
Küche im Gemeindehaus am Vogelsangplatz. Ein Spendenbrunch soll
mithelfen, dass der Ersatz so schnell wie möglich angeschafft werden
kann. Das alte Schätzchen hat Schubladen, die nicht vernünftig zu
reparieren sind, ihm fehlen Türen und der alte Backofen ist auch
nicht mehr zu gebrauchen.
Die Kücheneinrichtung muss
schnell werden, weil Gemeindegruppen und Treffpunkte wie Kirchencafé
oder Kinderbibelmorgen auf die Stärkung und Verköstigung aus diesem
Raum angewiesen sind. Ein Spendenbrunch im Wanheimerorter
Gemeindehaus am Vogelsangplatz am 22. März soll mithelfen, dass
Ehrenamtliche schon bald wieder Plätzchen vor Ort in der dann neuen
Küche backen können.
Zur Schlemmeraktion fahren
Engagierte der Gemeinde viel Leckeres auf, das ab 11 Uhr verputzt
und verknabbert werden kann: üppige Frühstücksleckereien, Suppen,
Salate, Fingerfood bis hin zu Kuchen, Kaffee und Getränken aller
Art. Damit die Planung gut läuft, ist eine Anmeldung notwendig (bei
Ehrenamtsbeauftragte Maria Hönes: 0203-770134 bzw.
maria.hoenes@ekir.de oder Pfarrer Jürgen Muthmann: 0203-722383 bzw.
juergen.muthmann@ekir.de.

Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte im Januar
2025: +2,8 % gegenüber Januar 2024
Erzeugerpreise
landwirtschaftlicher Produkte insgesamt, Januar 2025 +2,8 % zum
Vorjahresmonat -0,5 % zum Vormonat Preise für pflanzliche
Erzeugnisse -3,8 % zum Vorjahresmonat Preise für Tiere und tierische
Erzeugnisse +7,4 % zum Vorjahresmonat
Die Erzeugerpreise
landwirtschaftlicher Produkte waren im Januar 2025 um 2,8 % höher
als im Januar 2024. Im Dezember und November 2024 hatten die
Veränderungsraten zum Vorjahresmonat jeweils bei +4,1 % gelegen. Wie
das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, fielen die
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte im Januar 2025
gegenüber dem Vormonat Dezember 2024 um 0,5 %.
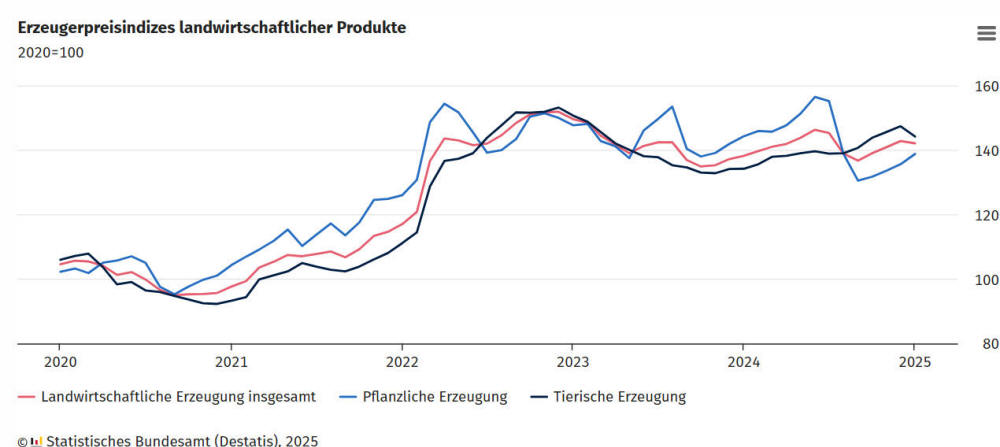
•
Im Vergleich zum Vorjahresmonat entwickelten sich die Preise für
Produkte aus pflanzlicher und tierischer Erzeugung wie bereits in
den Vormonaten auch im Januar 2025 gegenläufig. So sanken die Preise
für pflanzliche Erzeugnisse um 3,8 % gegenüber Januar 2024, während
die Preise für Tiere und tierische Erzeugnisse um 7,4 % stiegen. Im
Vergleich zum Vormonat Dezember 2024 waren Produkte aus pflanzlicher
Erzeugung im Januar 2025 teurer (+2,4 %) und Produkte aus tierischer
Erzeugung günstiger (-2,2 %).
•
Preisrückgang bei Speisekartoffeln gegenüber Vorjahresmonat
Der
Preisrückgang bei pflanzlichen Produkten um 3,8 % im Vergleich zum
Vorjahresmonat ist unter anderem auf die gesunkenen Preise für
Speisekartoffeln zurückzuführen. Diese waren im Januar 2025 um 37,0
% niedriger als im Januar 2024. Im Dezember 2024 hatte die
Vorjahresveränderung bei -32,5 %, im November 2024 bei -31,7 %
gelegen. Gegenüber dem Vormonat Dezember 2024 stiegen die
Speisekartoffelpreise um 5,5 %.
- Preise für Obst, Getreide,
Handelsgewächse und Wein gestiegen, für Gemüse und Futterpflanzen
gesunken
- Die Erzeugerpreise für Obst waren im Januar 2025 um
16,5 % höher als ein Jahr zuvor. Preisanstiege gab es unter anderem
bei Tafeläpfeln mit +16,9 %.
- Die Erzeugerpreise für Gemüse
gingen gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,5 % zurück. Insbesondere
sanken die Preise für Kohlgemüse (-12,1 %) und Salat (-7,4 %).
•
Getreide war im Januar 2025 im Vergleich zum Januar 2024 um 5,5 %
teurer (Dezember 2024: +1,9 % zum Vorjahresmonat). Das
Handelsgewächs Raps verteuerte sich im Januar 2025 im Vergleich zum
Vorjahresmonat um 23,3 %. Preise für Handelsgewächse insgesamt lagen
im Januar 2025 um 8,9 % höher als ein Jahr zuvor. Wein war im Januar
2025 um 1,1 % teurer als im Vorjahresmonat. Die Preise für
Futterpflanzen waren im Januar 2025 mit einer Veränderungsrate von
-10,1 % im Vergleich zum Vorjahresmonat weiterhin rückläufig
(Dezember 2024: -10,7 %).
•
Tierische Erzeugung: Preisanstieg bei Milch, Preisrückgang bei Eiern
und Tieren
Der Preisanstieg für Tiere und tierische Erzeugnisse
um 7,4 % im Vergleich zum Vorjahresmonat ist unter anderem auf die
gestiegenen Preise für Milch zurückzuführen. Der Milchpreis lag im
Januar 2025 um 19,1 % höher als im Vorjahresmonat (Dezember 2024:
+23,0 % zum Vorjahresmonat). Im Vergleich zum Vormonat Dezember 2024
sanken die Preise für Milch um 1,5 %. Bei Eiern kam es zu einem
Preisrückgang von 3,5 % gegenüber dem Vorjahresmonat (Dezember 2024:
-3,7 %).
•
Die Preise für Tiere lagen im Januar 2025 mit -0,1 % auf einem
ähnlichen Niveau wie im Januar 2024 (Dezember 2024: +1,9 % zum
Vorjahresmonat). Dabei stiegen die Preise für Rinder um 22,7 %, für
Schlachtschweine fielen die Preise hingegen um 12,6 %. Die Preise
für Geflügel waren im Januar 2025 um 4,3 % höher als im Januar 2024.
Ausschlaggebend hierfür waren insbesondere die Preissteigerungen bei
Hähnchen um 6,6 %. Die Preise für Sonstiges Geflügel (Enten und
Puten) stiegen binnen Jahresfrist um 0,7 %.
NRW:
2024 erstmalig mehr Eier aus ökologischer Erzeugung als aus
Käfighaltung
Im Jahr 2024 sind in Nordrhein-Westfalen
rund 1,43 Milliarden Eier von Legehennen produziert worden. Wie das
Statistische Landesamt mitteilt, entspricht dies einem Rückgang von
1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Anzahl der gehaltenen
Legehennen verzeichnete einen Rückgang (−1,4 Prozent) auf
5,02 Millionen Tiere.
•
Mit rund 285 Eiern pro Legehenne blieb die Legeleistung im Vergleich
zum Jahr 2023 damit konstant. Höchster Zuwachs bei ökologischen
Erzeugungsbetrieben Mit einem Anteil von 69,0 Prozent machte
Bodenhaltung, trotz weiter sinkender Eiererzeugung (−3,8 Prozent im
Vergleich zum Vorjahr), nach wie vor den größten Anteil an der
nordrhein-westfälischen Eierproduktion aus.
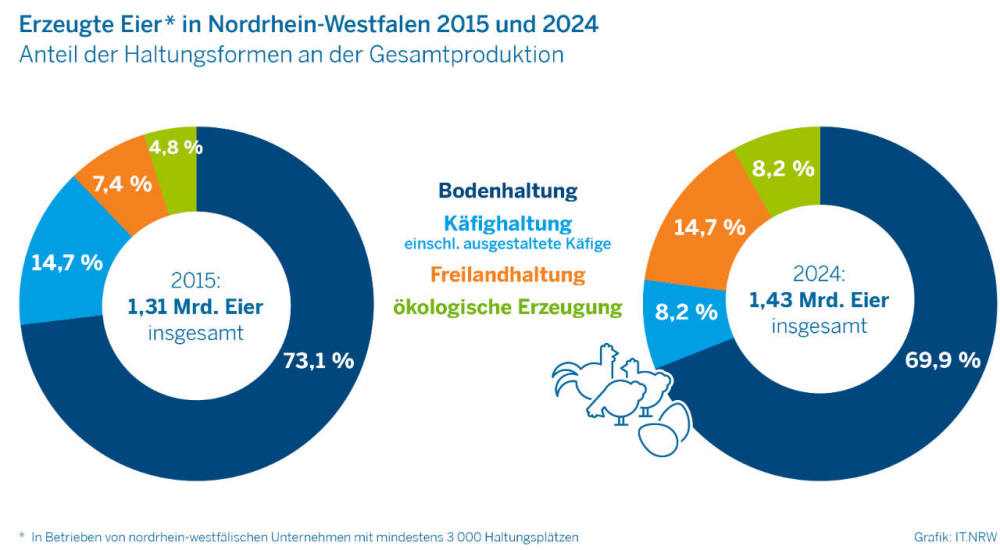
Seit 2016 fällt die Zahl der erzeugten Eier aus Bodenhaltung
erstmalig wieder unter die Milliarden-Marke (2024: 985 Millionen).
209 Millionen bzw. 14,7 Prozent der produzierten Eier kamen von
Legehennen aus Freilandhaltung. Die Eiererzeugung in ökologisch
anerkannten Erzeugungsbetrieben verzeichnete den größten Zuwachs
innerhalb eines Jahres (+13,4 Prozent).
So überstieg die
Anzahl der Eier aus ökologisch anerkannten Erzeugungsbetrieben mit
117 Millionen erstmalig die Anzahl derer aus Käfighaltung
einschließlich ausgestalteter Käfige (116 Millionen). Beide
Haltungsformen machten jeweils im Jahr 2024 einen Anteil von
8,2 Prozent an der Gesamtproduktion der Eier aus.
•
Eiererzeugung in Freilandhaltung hat sich mehr als verdoppelt
Die Zahl der erzeugten Eier aus Käfighaltungen einschließlich
ausgestalteter Käfige hat sich zwischen 2015 und 2024 um
39,5 Prozent verringert – seit dem Jahr 2021 war ein Rückgang von
rund 20 Prozent zu beobachten. In ökologisch anerkannten
Erzeugungsbetrieben wurden im vergangenen Jahr dagegen 84,0 Prozent
mehr Eier erzeugt als noch 2015. Die Eiererzeugung aus
Freilandhaltung hat sich im selben Zeitraum mehr als verdoppelt
(+116,8 Prozent).
Insgesamt wurden im vergangenen Jahr
9,1 Prozent mehr Eier erzeugt als 2015. Knapp die Hälfte der Eier
wurde 2024 im Regierungsbezirk Münster erzeugt Der Großteil der
erzeugten Eier kam im vergangenen Jahr aus dem Regierungsbezirk
Münster. Hier wurden mit 669 Millionen 46,9 Prozent aller Eier in
NRW produziert.
Darauf folgten die Regierungsbezirke Detmold
(16,2 Prozent), Köln (13,6 Prozent) und Arnsberg (13,4 Prozent). Den
geringsten Anteil an der nordrhein-westfälischen Eierproduktion
machte der Regierungsbezirk Düsseldorf (9,9 Prozent) aus. Rund 40
Prozent der Eier aus ökologischer Haltung stammte 2024 aus Arnsberg
.
Der Regierungsbezirk Münster verzeichnete mit einem
Anteil von 87,5 Prozent sowohl die meisten Eier aus der
Käfighaltung, als auch aus Bodenhaltung (47,6 Prozent) und
Freilandhaltung (37,3 Prozent). Der Großteil der Eier aus
ökologischer Haltung wurde in den Regierungsbezirken Arnsberg
(38,5 Prozent) und Detmold (24,0 Prozent) erzeugt.