






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 14. Kalenderwoche:
5. April
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Montag, 7. April 2025 - Weltgesundheitstag
Aktion Mensch-Umfrage zum Weltgesundheitstag am 7.
April
Barrierefreies und inklusives Gesundheitssystem:
94 Prozent der Menschen mit Behinderung sehen Staat in der
Verantwortung
Aktuelle Umfrage zeigt grundsätzliche
Zufriedenheit von Menschen mit Behinderung mit Gesundheitssystem und
Versorgungsqualität
Mehrheit beklagt jedoch fehlende
Unterstützung durch Behörden, Kranken- oder Pflegeversicherungen bei
der Gesundheitsförderung
Aktion Mensch appelliert:
Barrierefreiheit und diskriminierungsfreier Umgang müssen
vollumfänglich etabliert werden
Bonn (3. April 2025) Laut 94
Prozent der Menschen mit Behinderung sollte der Staat für ein
barrierefreies und inklusives Gesundheitssystem sorgen, von dem alle
profitieren können. Doch mehr als die Hälfte (54 Prozent) nimmt
Barrieren oder Hürden wahr, die den Zugang zu Gesundheitsleistungen
erschweren. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle bundesweite
Online-Umfrage, die die Sozialorganisation Aktion Mensch anlässlich
des Weltgesundheitstages am kommenden Montag veröffentlicht hat.
Finanzielle Hürden und hohe Kosten bei Zuzahlungen (41 Prozent),
ein Nichteingehen auf besondere Bedarfe aufgrund ihrer Behinderung
(36 Prozent) sowie räumliche Barrieren wie etwa fehlende Rampen (25
Prozent) – mit diesen zentralen Herausforderungen sehen sich
Menschen mit Behinderung im Gesundheitswesen konfrontiert. Durch
hohe Gesundheitskosten belastet fühlen sich damit mehr als doppelt
so viele wie in der Gesamtbevölkerung (20 Prozent).
Da
Menschen mit Behinderung ohnehin einem höheren Armutsrisiko
unterliegen, ist dies besonders besorgniserregend. 54 Prozent von
ihnen sind zudem davon überzeugt, einen häufig schlechteren Zugang
zu Gesundheitsleistungen zu haben als Menschen ohne Behinderung.
„Bei der Gesundheit darf es keine strukturelle Benachteiligung
von Menschen mit Behinderung geben – gelebte Realität ist das aber
längst nicht“, mahnt Christina Marx, Sprecherin der Aktion Mensch.
„Neben der vielfach noch mangelnden Barrierefreiheit in Praxen und
anderen medizinischen Einrichtungen zeigt unsere Erhebung auch: Mehr
als jede*r Fünfte hat Angst vor Ablehnung und Ausgrenzung durch
Gesundheitspersonal. Gezielte Anstrengungen hinsichtlich einer
diskriminierungssensiblen Ausbildung und Schulung müssen
entsprechend die Folge sein.“
Behörden und Versicherungen:
Langsam, frustrierend und kompliziert
Kritisch äußert sich die
Mehrheit der befragten Menschen mit Behinderung außerdem in Bezug
auf Behörden, Kranken- oder Pflegeversicherungen: 61 Prozent sind
der Meinung, dass diese Institutionen sie nicht genügend bei der
Gesundheitsförderung unterstützen. Am Kontakt mit Behörden und
Versicherungen beklagen sie dabei vor allem die lange
Bearbeitungsdauer (36 Prozent) und bewerten ihn als frustrierend (30
Prozent) sowie kompliziert (28 Prozent).
Zufriedenheit mit
Versorgungsqualität und Gesundheitssystem insgesamt
Ein positives
Bild zeichnet die Umfrage dagegen bei der Bewertung des
Gesundheitssystems insgesamt: Immerhin fast zwei Drittel (64
Prozent) der Menschen mit Behinderung fühlen sich grundsätzlich gut
durch dieses unterstützt. Während weitere 74 Prozent angeben,
medizinische Hilfe auch zu bekommen, wenn sie diese benötigen,
erachten ebenso viele die Behandlung und Qualität als gut, sobald
sie Ärzt*innen, Therapeut*innen, das Krankenhaus oder die Apotheke
aufsuchen.
Digitale Affinität bei Menschen mit Behinderung
höher
In Online-Angeboten oder digitalen Diensten im
Gesundheitssystem sieht die große Mehrheit der Menschen mit
Behinderung zudem eine Bereicherung (79 Prozent) und will davon auch
in Zukunft Gebrauch machen (72 Prozent). Im Vergleich zum Rest der
Bevölkerung haben sie so bereits deutlich häufiger das E-Rezept
genutzt (69 zu 47 Prozent) oder Termine online vereinbart (67 zu 50
Prozent).
Über die Aktion Mensch e.V.
Die Aktion
Mensch ist die größte private Förderorganisation im sozialen Bereich
in Deutschland. Seit ihrer Gründung im Jahr 1964 hat sie mehr als
fünf Milliarden Euro an soziale Projekte weitergegeben. Ziel der
Aktion Mensch ist, die Lebensbedingungen von Menschen mit
Behinderung, Kindern und Jugendlichen zu verbessern und das
selbstverständliche Miteinander in der Gesellschaft zu fördern. Mit
den Einnahmen aus ihrer Lotterie unterstützt die Aktion Mensch jeden
Monat bis zu 1.000 Projekte.
Möglich machen dies rund vier
Millionen Lotterieteilnehmer*innen. Zu den Mitgliedern der Aktion
Mensch gehören: ZDF, Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Deutsches Rotes
Kreuz, Diakonie, Paritätischer Gesamtverband und die
Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Seit Anfang 2014
ist Rudi Cerne ehrenamtlicher Botschafter der Aktion Mensch.
www.aktion-mensch.de
Abitur 2025: 78.000 Abiturientinnen und Abiturienten
bereiten sich vor
Für rund 70.000 Schülerinnen und
Schüler an etwa 1.000 öffentlichen und privaten Gymnasien,
Gesamtschulen, Weiterbildungskollegs und Waldorfschulen in
Nordrhein-Westfalen beginnen nach den Osterferien am 29. April die
schriftlichen Abiturprüfungen.
Eine Woche später – am 6. Mai
– folgen dann rund 7.800 Abiturientinnen und Abiturienten an 231
Berufskollegs. An den allgemeinbildenden Schulen werden zentrale
schriftliche Prüfungen in 40 Fächern abgelegt. An den Berufskollegs
sind es 47 Prüfungsfächer. Damit wird den verschiedenen beruflichen
Fachrichtungen Rechnung getragen.
Schulministerin
Dorothee Feller: „Das Abitur ist ein besonderes Ereignis am Ende der
Schullaufbahn, das mit viel Fleiß und Ausdauer vorbereitet wird. Die
Prüfungen sind nun die Gelegenheit, erworbene Kompetenzen unter
Beweis zu stellen. Ich drücke die Daumen für erfolgreiche Prüfungen
und wünsche allen Abiturientinnen und Abiturienten viel
Konzentration, Zuversicht und das nötige Quäntchen Glück.“
Nordrhein-Westfalen beteiligt sich wie in den vergangenen Jahren
am gemeinsamen Aufgabenpool der Länder. Dies betrifft die Fächer
Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch sowie erstmals die
Fächer Biologie, Chemie und Physik. Der gemeinsame Aufgabenpool
trägt dazu bei, die Vergleichbarkeit und Qualität der
Abiturprüfungen bundesweit zu sichern. Erstmals wird auch das
Hörverstehen in allen modernen Fremdsprachen Bestandteil der
zentralen Abiturprüfungen sein.
In der letzten Woche vor
den Osterferien bereiten sich die Schülerinnen und Schüler intensiv
auf ihre Prüfungen vor. Sie erhalten dabei gezielte Unterstützung
durch ihre Lehrkräfte. So werden beispielsweise typische
Prüfungsaufgaben geübt und relevante Themen wiederholt und vertieft.
Die Prüfungstermine für die allgemeinbildenden Schulen finden
Sie
hier.
Die Prüfungstermine für das Berufliche Gymnasium
finden Sie
hier.
Steffi Neu mit ihrem Kneipenquiz im „Paddy’s
Pub“ in Duisburg
Welches Tier symbolisiert die Menschen
in Meiderich? Und wo endet der Mammutmarsch Ruhrgebiet in diesem
Jahr? Einigen Rate-Teams in der Duisburger Gastwirtschaft „Paddy’s
Pub“ qualmten schon bei der ersten Runde von Steffis Kneipenquiz die
Köpfe. Bei der ersten von fünf Fragerunden waren die Einheimischen
noch klar im Vorteil, alle anderen hatten aber noch genügend
Chancen, mit Allgemeinbildung, Musikwissen und Kreativität zu
punkten.

Zum Team von Steffi Neu gehört beim Kneipenquiz auch WDR-Comedian
René Steinberg. (Foto: Veranstalter)
Seit sieben Jahren tourt
die bekannte Radiomoderatorin Steffi Neu mit ihrem Team durch
Kneipen und Gaststätten in Nordrhein-Westfalen und hat dabei den
„größten Kindergeburtstag für Erwachsene“, wie sie ihr Kneipenquiz
selbst bezeichnet, im Gepäck. 23 Termine stehen 2025 im Kalender,
die Tickets waren schon lange vor Tourstart ausverkauft.
Das
Konzept: In lockerer Atmosphäre, musikalisch unterstützt von der
Band Pocket Party, stellen Steffi Neu und ihr Co-Moderator, Comedian
René Steinberg, den Quizteams Fragen – die Antworten werden auf
Bierdeckel geschrieben und nach jeder Runde eingesammelt. Dabei hält
es die Moderatoren selten lange auf der Bühne, immer wieder laufen
sie durch den Saal und beziehen die Teams direkt mit ein.
Die
Vertreter der besten Teams müssen sich in der Finalrunde in
kreativen Spielen beweisen, bis am Ende die Quizkönigin oder der
Quizkönig gekürt wird. Zwischendurch verteilt Steffi Neu außerdem
immer wieder kleine Geschenke an Quizzer, die sich durch besonders
kreative Antworten hervorgetan haben. In Duisburg strahlte am Ende
der Meidericher Stefan Mandlburger über das ganze Gesicht, als ihm
Steffi Neu nicht nur eine rote Schärpe umhängte, sondern auch die
goldene Krone des Quiz-Königs aufsetzte.

Quizkoenig – Stefan Mandlburger wurde von Steffi Neu zum Quizkönig
in Paddy’s Pub gekrönt. (Foto: Veranstalter)
Nicht fehlen
darf bei einem Kneipenabend natürlich das Gespräch mit guten
Freunden. Daher lädt Steffi Neu an jedem Quiz-Abend eine prominente
Person aus der Region ein. In Paddy’s Pub sprach sie mit Kabarettist
Wolfgang Trepper über die Menschen im Ruhrgebiet,

Als Talkgast sprach
Steffi Neu mit Kabarettist Wolfgang Trepper – einem Stammgast in
Paddy’s Pub. (Foto: Veranstalter)
Auftritte mit Mary Roos und
seine Pläne für das Jahr. Viel Applaus gab es zudem für René
Steinberg, der Ausschnitte aus seinem aktuellen Solo-Programm
zeigte.
Weitere Informationen zu Steffis Kneipenquiz und zu den
weiteren Terminen gibt es auf der Seite www.steffiskneipenquiz.de –
dort gibt es auch einen Link zum Ticket-Shop.
VHS: Polizei erläutert Kriminalitätsentwicklung in
Duisburg
Duisburgs Kripo-Chef, Leitender
Kriminaldirektor Christian Voßkühler, präsentiert am Montag, 7.
April, um 20 Uhr die Kriminalitätsstatistik für das abgelaufene Jahr
2024 in der VHS im Stadtfenster, Steinsche Gasse 26. Die Polizei
stellt die Statistik in jedem Frühjahr vor.
Gemeinsam mit
der Volkshochschule Duisburg wird sie interessierten Bürgerinnen und
Bürgern ausführlich im Rahmen einer Vortragsveranstaltung erläutert.
Herr Voßkühler steht anschließend für Fragen zur Verfügung. Der
Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.
Storchentreff – Infoabend zur Geburt für werdende Eltern
Heute um 18 Uhr bietet die Helios
St. Johannes Klinik Duisburg wieder den Storchentreff an, einen
Informationsabend für werdende Eltern. Das bewährte Konzept
bleibt: An diesem Abend vermitteln Ärzt:innen aus Geburtshilfe und
Neonatologie (Neugeborenenmedizin) sowie eine Hebamme wissenswerte
Informationen rund um Schwangerschaft, Geburt und die erste Zeit von
Mutter und Kind nach der Geburt.


Das Team geht aber auch auf die Abläufe der Schwangerschaft und
der Entbindung im Klinikum ein. Außerdem stehen die Expert:innen für
individuelle Fragen zur Verfügung. Die Veranstaltung findet an der
Helios St. Johannes Klinik im Veranstaltungsraum neben der Cafeteria
statt (Dieselstraße 185 in 47166 Duisburg). Da die Teilnahmeplätze
begrenzt sind, ist eine kurze Anmeldung per Telefon unter (0203)
546-30701 oder per E-Mail:
frauenklinik.hamborn@helios-gesundheit.de erforderlich.
OMAS GEGEN RECHTS stellen sich vor
Bei einem
offenen Treff der OMAS GEGEN RECHTS stellt sich unsere
parteiunabhängige Initiative vor. Am Montag, 7. April, ab 19;00 Uhr
findet im Café Museum, Duisburg, Friedrich-Wilhelm-Str. 64a das
nächste Treffen statt. Jeder ist willkommen, der unsere Arbeit
kennenlernen möchte, auch Opas, Kinder oder Enkel.

Bei der Winterlaufserie ASV vom 29. März 2025
Investitionen in Hochwasserschutz sind gefragt
Auch in Zeiten von Trockenheit muss an den Hochwasseschutz gedacht
udn geplant werden.
Der Klimawandel sorgt dafür, dass Naturgefahren immer häufiger und
heftiger Menschen und Häuser bedrohen. Was tun? Die DEVK hat in
einer aktuellen, repräsentativen Umfrage mit Civey die Bevölkerung
zu Elementarschäden befragt. Ergebnis: Starkregen, Überschwemmung
und Hochwasser gelten wegen ihrer Häufigkeit als besonders
gefährlich.
Deshalb sagt die große Mehrheit, dass Investitionen in
Hochwasserschutz am besten helfen würden, Schäden zu verhindern. Und
44 Prozent der Befragten mit Eigenheim empfehlen eine
Elementarschadenversicherung für alle.
Viele Deutsche
befürchten, dass Hochwasser bei ihnen zu Hause ähnliche Zerstörungen
anrichten könnte wie hier in Bad Münstereifel 2021.

Foto: DEVK/Peter Joester
Bei den aktuellen
Koalitionsverhandlungen in Berlin sollten die Themen
Klimafolgenanpassung und Elementarschadenversicherung auf den Tisch
kommen. Das fordern inzwischen viele Verbände – etwa das Zentrum für
Europäischen Verbraucherschutz (ZEV), der Gesamtverband der
Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) und sogar der
Naturschutzbund Deutschland (NABU). GDV und NABU haben dazu eine
gemeinsame Erklärung veröffentlicht.
Dass die Forderungen
gehört werden, zeigt ein Arbeitspapier, das bereits der Presse
vorliegt. So planen CDU/CSU und SPD offenbar eine verpflichtende
Elementarschadenversicherung im Neugeschäft und eine
Stichtagsregelung für den Bestand. Außerdem soll es eine staatliche
Rückversicherung für besonders hohe Schäden geben.
56 Prozent
befürchten Schäden durch Überschwemmung
Laut GDV haben Unwetter
und Hochwasser 2024 in Deutschland Schäden von über 5,5 Milliarden
Euro verursacht. Auch in der Bevölkerung wächst die Erkenntnis, dass
Naturgefahren den persönlichen Wohlstand bedrohen. Das zeigt eine
repräsentative Umfrage mit mehr als 5.000 Befragten, die die DEVK in
Auftrag gegeben hat. Darin untersucht das
Meinungsforschungsunternehmen Civey, wie die Menschen in Deutschland
Elementarschäden einschätzen und welche Konsequenzen sie daraus
ziehen.
Gefragt nach den Naturgefahren, die zu Hause Schäden
verursachen können, antworten rund 56 Prozent: Starkregen,
Überschwemmung und Hochwasser. Bei den Eigenheimbesitzerinnen und
-besitzern sind es sogar 59 Prozent. Etwa 28 Prozent erwarten
dagegen keine Elementarschäden. Und knapp ein Viertel befürchtet
Erdbeben, Erdsenkung und Erdrutsch. Weit abgeschlagen landen
Gefahren wie Schneedruck, Vulkanausbruch und Lawinen.
21
Prozent der Eigenheime von Elementarschäden betroffen
Dabei
gehören 60 Prozent der Befragten zu den Glücklichen, die bisher
keine Erfahrungen mit Elementarschäden gemacht haben. Dagegen waren
rund 7 Prozent der Gesamtbevölkerung in den letzten 5 Jahren selbst
betroffen, weitere 10 Prozent vor vielen Jahren. Bei den Menschen
mit Wohneigentum sagen sogar 21 Prozent, dass sie in ihrem Leben
bereits Erfahrungen mit Hochwasser & Co. machen mussten. Etliche
kennen persönlich Betroffene oder haben bei Aufräumarbeiten
mitgeholfen.
44 Prozent der Menschen mit Wohneigentum wollen
eine Pflichtversicherung
Doch was könnte am ehesten helfen, die
schlimmen Folgen solcher Ereignisse einzudämmen? Hier sagen 57
Prozent und damit die große Mehrheit, dass Investitionen in
Hochwasserschutz am wichtigsten wären.
Bei den
Eigenheimbesitzerinnen und -besitzern sind sogar 61 Prozent davon
überzeugt. Diese Gruppe hält auch eine weitere Maßnahme für wirksam:
Auf Platz 2 der Wunschliste landet der Elementarschadenschutz für
alle, also eine Pflichtversicherung. 44 Prozent der Menschen mit
Wohneigentum halten diese Idee für vielversprechend.
„Wir
begrüßen, dass die kommende Regierung den Schutz der Bevölkerung vor
den Folgen von Elementarrisiken auf die Agenda genommen hat“, sagt
Dr. Michael Zons, der neue Schaden-Vorstand der DEVK: „Im Falle
einer Pflichtversicherung halten wir eine risikoadäquate Bepreisung
für wichtig.“
41 Prozent fordern Investitionen in den
Katastrophenschutz
Versicherungen reichen jedoch nicht, um die
Gesellschaft vor zunehmenden Naturkatastrophen zu schützen. Der
Umfrage zufolge sind der Bevölkerung auch Investitionen in
Katastrophenschutz (41 Prozent) und Änderungen beim Baurecht (37
Prozent) wichtig.
In diesem Zusammenhang weist der NABU kritisch auf
die Genehmigungspraxis hin, die es überhaupt erst ermöglicht, in
Überschwemmungsgebieten zu bauen. Erste Schritte für Veränderungen
gibt es schon. So ist am 1. Juli 2024 das Klimaanpassungsgesetz in
Kraft getreten. Es schreibt vor, dass Bund, Länder und Kommunen
Strategien erarbeiten, wie sie mit den Folgen des Klimawandels
umgehen.
In Sachen Hochwasserschutz könnten Länder und
Kommunen zum Beispiel mehr Flächen ausweisen, die Raum für
Überflutungen bieten, oder große Rückhaltebecken bauen. Der GDV
schlägt vor, Prävention und Klimafolgenanpassung in die
Landesbauordnungen aufzunehmen. Ziel sind klare Bauverbote in
hochwassergefährdeten Gebieten und verpflichtende
Klima-Gefährdungsbeurteilungen bei Baugenehmigungen. Laut dem
Arbeitspapier aus den Koalitionsverhandlungen sollen Länder und
Gemeinden künftig stärker haften, wenn sie neue Baugebiete dort
erschließen, wo die Gefahr von Naturkatastrophen hoch ist.
23
Prozent erwarten, in den nächsten zehn Jahren betroffen zu sein
Zwar vermuten der Umfrage zufolge 62 Prozent, dass sie in den
nächsten zehn Jahren nicht von Elementarschäden betroffen sein
werden. Aber 23 Prozent der Gesamtbevölkerung befürchten das konkret
und weitere 15 Prozent sind unsicher. Das sind deutlich mehr als
diejenigen, die tatsächlich schon einmal persönlich betroffen waren.
Wer Wohngebäude und Hausrat gegen die Folgen von Naturgefahren
absichern möchte, braucht Versicherungsschutz gegen
Elementarschäden. „Bei der DEVK müssen Kundinnen und Kunden schon
seit 2011 die Elementardeckung bewusst abwählen, wenn sie darauf
verzichten möchten“, erklärt Dr. Michael Zons. „Damit schützen wir
unsere Versicherten vor bösem Erwachen, falls doch was passiert.“
Das Meinungsforschungsunternehmen Civey hat vom 05. bis
07.02.2025 im Auftrag der DEVK 5.015 Menschen online befragt. Die
Ergebnisse sind repräsentativ für die Gesamtbevölkerung sowie
Menschen mit Wohneigentum. Der statistische Fehler der
Gesamtergebnisse liegt bei 2,5 %.
Branchenanalyse: Europäischer
Benchmark-Vergleich zeigt fünf Erfolgsfaktoren für die nachhaltige
Leistungsfähigkeit der Bahn
Was muss getan werden, um
die Leistungen der Deutschen Bahn zu verbessern? Die
Hans-Böckler-Stiftung hat die auf die Bahn- und Logistikbranche
spezialisierte Beratungsgesellschaft SCI Verkehr beauftragt, diese
Frage im Vergleich mit erfolgreichen Bahnen in Europa zu prüfen.
Auf der Grundlage umfassender Datenanalysen zeigt die Studie mit
einer „Benchmark Schiene in Europa“ fünf Handlungsfelder für eine
Wende in der Bahnpolitik: Erstens eine gesicherte überjährige
Finanzierung, zweitens eine an Zielen orientierte Finanzierung,
drittens die staatliche Verantwortung für die gemeinwohlorientierten
Unternehmensteile, viertens eine konsequente Digitalisierung und
fünftens eine integrierte Verkehrspolitik.*
Negative
Schlagzeilen haben die Bahnpolitik in den öffentlichen Fokus gerückt
und damit Fragen nach der Neuausrichtung der Deutschen Bahn. „Für
die anstehenden strategischen Entscheidungen liefert die neue Studie
nun wichtige Zahlen und Fakten“, sagt Christina Schildmann, Leiterin
der Abteilung Forschungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung.
Verglichen werden die Leistungen der Schiene in Deutschland mit
denen der Bahnsysteme in der Schweiz, Österreich, Frankreich,
Spanien und Polen. Die umfangreichen Leistungsvergleiche verweisen
auf fünf Erfolgsfaktoren für eine nachhaltige Leistungsfähigkeit der
Deutschen Bahn:
- Eine gesicherte überjährige Finanzierung
wie in der Schweiz und in Österreich ermöglicht wirtschaftliches
Handeln und effiziente Mittelverwendung durch planbare
Kapazitätsallokation.
- Eine ausreichende Mittelausstattung zur
Erreichung politischer Ziele sichert ein qualitativ hochwertiges,
resilientes Netz und stabilen Bahnbetrieb, basierend auf
verbindlichen Zielvereinbarungen zwischen Politik und Bahn.
-
Eine klare Differenzierung zwischen gemeinwohlorientierten und
wettbewerbsorientierten Unternehmensbereichen ist für die
Daseinsvorsorge essenziell – ein Ansatz, den Deutschland mit der DB
InfraGO begonnen hat, aber noch ausbauen muss.
- Eine
systematische Digitalisierungsstrategie für das Schienennetz: ETCS,
digitale Stellwerke und Automatische Kupplung im Güterverkehr
erfordern entschiedene, planbare Schritte.
- Eine
verkehrsträgerübergreifende Politik der CO2-Vermeidung fördert den
Schienenanteil neben ausreichender Finanzierung insbesondere durch
Maßnahmen wie CO2-Bepreisung und Deutschlandticket. In der Schweiz
und Österreich gibt es zudem etwa Nachtfahrverbote für Lkw.


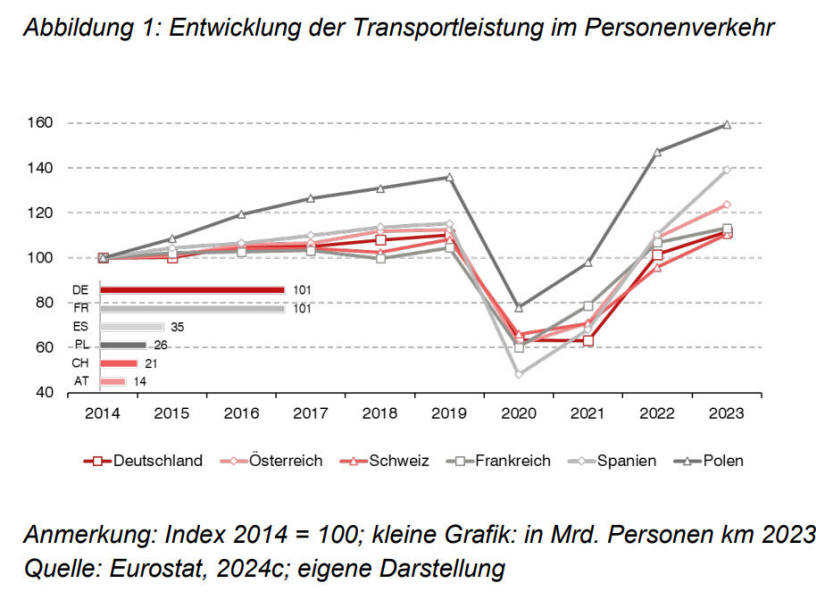

Die Nutzungsintensität im Personenverkehr, gemessen in
Personenkilometern pro Einwohner, zeigt deutliche Unterschiede
zwischen den Ländern. Mit 2.350 Personenkilometern pro Einwohner
nutzt die Bevölkerung in der Schweiz die Bahn doppelt so intensiv
wie in Deutschland (1.200 Personenkilometer). Dies ist vor allem auf
ein sehr gut ausgebautes Schienennetz, pünktliche Züge und ein
anderes Mobilitätsverhalten in der Gesellschaft zurückzuführen.
Letzteres zeigt sich bereits im höchsten Modal Share des
Personenverkehrs im Vergleich zu den Fokusländern. Spanien und Polen
weisen trotz positiver Entwicklungen im Personenverkehr derzeit noch
vergleichsweise niedrige Werte auf.
Im Fokus der
deskriptiven Analyse mit Benchmark-Ansatz stehen zentrale Kennzahlen
wie Marktgröße, Regulierung, Investitionen und betriebliche
Leistung. Detailliert erfasst für jeweils alle untersuchten Länder
werden Branchenstruktur, Markttrends, Beschäftigungsentwicklung und
Innovationen.
Download (pdf) ›
E-Scooter in Europa: Flitzen oder Fluchen?
Paris verbietet sie, Berlin liebt sie, Amsterdam ignoriert sie:
E-Scooter sind ein europaweites Thema. Während Deutschland über eine
neue Verordnung diskutiert, um das E-Roller-Chaos stärker als bisher
zu bändigen, verfolgen andere EU-Staaten ganz unterschiedliche
Lösungsansätze. Doch was sollten Reisende wissen, um Strafen und
Risiken zu vermeiden? Das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ)
Deutschland wirft einen Blick über den Lenker: Wie streng sind die
Regeln in beliebten Reiseländern?

Im europäischen Ausland ganz spontan auf einen E-Scooter steigen?
Lieber einen Gang zurückschalten, denn sonst könnte es Ärger geben.
(Bild: KI-generiert)
Die E-Scooter-Regeln für ganz Europa
Ob für den
schnellen Café-Besuch oder die letzte Etappe zum Hotel – E-Scooter
sind auch im Urlaub ein beliebtes Fortbewegungsmittel. Doch wer
glaubt, überall gelten dieselben Regeln, muss schnell auf die Bremse
treten. In der EU reicht die Palette von strikten Verboten bis zu
Basisregeln, die auf Eigenverantwortung setzen.
Darüber
hinaus wichtig: Es gelten unterschiedliche technische Vorgaben und
Versicherungspflichten bezüglich des Fahrzeuges. Leih-Modelle
erfüllen in der Regel die nationalen Vorschriften. Wer jedoch seinen
privat zugelassenen Scooter einfach mit ins Ausland nimmt, riskiert
böse Überraschungen und sollte sich vorher gut informieren. Sonst
endet die Fahrt schneller als geplant – und zwar nicht, weil der
Akku leer ist, sondern weil die Zulassung fehlt. Und selbst wenn
solche unerlaubten Spritztouren unbemerkt bleiben: Ein Unfall kann
schwere finanzielle Folgen nach sich ziehen.
Frankreich:
Adieu, Leih-Scooter?
Frankreich geht härter vor. Aus Paris wurden
Leih-Scooter bereits 2023 komplett verbannt – zu viele Unfälle und
Beschwerden über achtlos abgestellte Roller. Private E-Scooter sind
jedoch weiterhin erlaubt. Abseits der Hauptstadt rollen die
Leih-Flitzer aber noch, doch Städte wie Lyon und Marseille setzen
auf strenge Vorschriften und Geschwindigkeitsbegrenzungen. Wer sich
nicht daran hält, riskiert hohe Bußgelder.
Niederlande:
Fahrradland, aber nicht für jeden mit zwei Rädern
Die Niederlande
sind ein Paradies für Radfahrer – doch bei E-Scootern hört die Liebe
auf zwei Rädern auf. Die meisten Modelle sind dort für den
Straßenverkehr nicht zugelassen. Wer also glaubt, in Amsterdam
ebenso unbeschwert mit dem E-Scooter durch die Gassen zu cruisen wie
die Einheimischen auf ihren Hollandrädern, könnte eine teure
Überraschung erleben.
Italien: Dolce Vita mit Helm
Italien
setzt auf Regeln statt Verbote. Seit Ende 2024 gilt eine landesweite
Helmpflicht für alle E-Scooter-Fahrer – und eine
Versicherungspflicht. Wer also in Rom oder Mailand stilvoll durch
die Straßen gleiten möchte, sollte nicht nur an die Sonnenbrille,
sondern auch an Helm und Versicherung denken.
Skandinavien:
Einheitlich uneinheitlich
Skandinavien? Einheitliche Regeln?
Fehlanzeige! Die E-Scooter-Regeln im Norden Europas variieren stark,
sind aber insgesamt nicht besonders streng. In Norwegen sind
E-Scooter weitgehend erlaubt, jedoch werden alkoholbedingte Verstöße
streng bestraft. Schweden verbietet das Fahren auf den meisten
Gehwegen, und Dänemark hat eine besonders kreative Regelung: Private
E-Scooter dürfen ohne Helm gefahren werden, bei Leih-Scootern ist
jedoch Kopfschutz Pflicht.
Irland: Entspanntes Rollen auf der
grünen Insel
Einen liberaleren Ansatz gibt es in Irland: Seit Mai
2024 sind E-Scooter hier erlaubt und die Regeln überraschend
entspannt. Mit Leih-Rollern darf man ab 16 Jahren losflitzen, die
Höchstgeschwindigkeit liegt bei 20 km/h und eine Helmpflicht gibt es
nicht. Auch eine Versicherung ist nicht notwendig. E-Scooter dürfen
auf Straßen und Radwegen fahren, jedoch nicht auf Gehwegen oder in
Fußgängerzonen.
Vorher schlau machen, sonst heißt es laufen
statt rollen
Europa bleibt beim Thema E-Scooter von großen
Unterschieden geprägt: Die genannten Länder sind nur Beispiele, denn
in den 27 EU-Mitgliedstaaten gibt es genauso viele unterschiedliche
Regelungen. Besonders knifflig: Oft bestehen Unterschiede zwischen
Leih-Scootern und privaten Modellen. Zwar fordert der Europäische
Verkehrssicherheitsrat (ETSC) europaweit gültige
Sicherheitsstandards für E-Scooter, doch ob und wann diese
tatsächlich kommen, bleibt abzuwarten.
Für Nutzer in Europa
bedeutet das: Wer auf Reisen also unerwartete Strafen vermeiden
möchte, sollte sich vorher informieren. Denn „Unwissenheit schützt
vor Knöllchen nicht“ – das gilt auch auf dem E-Scooter. Ansonsten
bleibt am Ende doch nur der gute alte Fußmarsch.
Die E-Scooter-Regeln für ganz Europa
Europäisches
Verbraucherzentrum Deutschland
c / o Zentrums für Europäischen
Verbraucherschutz e. V.
Bahnhofsplatz 3, 77694 Kehl
Mitmachen beim Nähtag in Obermeiderich - Aktion
Herzkissen für Brustkrebs-Patientinnen
In der
Evangelischen Kirchengemeinde Duisburg Obermeiderich sollen am 13.
April 2025 von 12 bis 16 Uhr die Nähmaschinen rattern und die
Scheren beim Stoffe schneiden klappern, denn alles, was dann im
Gemeindezentrum Emilstr. 27 getan wird, geschieht im Rahmen der
„Herzkissen Aktion“ für den guten Zweck. Herzkissen sind weiche
Polsterungen in Form eines Herzens, die an Brustkrebs erkrankte
Frauen nach der Operation im Heilungsprozess unterstützen.
Die Herzkissen werden unter dem Arm positioniert und ermöglichen
eine angenehme Haltung. Die Idee zur Aktion hat Gemeindemitglied
Tabea Henseler, die selbst an Brustkrebs erkrankt ist und weiß, wie
hilfreich Herzkissen sind. Sie lädt mit der Gemeinde Interessierte
ein, an diesem Tag gemeinsam Herzkissen für Brustkrebs-Patientinnen
der Evangelischen Kliniken Essen-Mitte zu nähen.
Wer
Näherfahrung hat, beim Zuschnitt oder auch nur beim Kaffeekochen für
die anderen unterstützend will, ist herzlich willkommen. Vorhandene
Nähmaschinen, Stoffscheren, Schneidematten und auf jeden Fall gute
Laune können gerne mitgebracht werden. „Gemeinsam können wir etwas
Wundervolles schaffen und betroffene Frauen unterstützen“ sagt Tabea
Henseler im Vorfeld der Aktion.
„Diese Kissen sind nicht nur
ein Zeichen der Unterstützung, sondern bieten auch Trost und Halt in
einer schwierigen Zeit.“ Wer am 13.4 dabei sein möchte, meldet sich
bis zum 10.4.2025 unter Mobil: 0163 313 30 93 oder E-Mail:
shop@hensilineswelt.de. Im Anhang senden wir ein Bild zur
honorarfreien Verfügung. Es zeigt ein Herzkissen, von denen beim
Aktionstag noch viel mehr erstellt werden sollen.
 (Foto: obermeiderich.de).
(Foto: obermeiderich.de).
Gemeinde lädt zum Frühlingslieder-Singen in das BBZ
Marxloh ein
Die Evangelische Bonhoeffer Gemeinde
Marxloh Obermarxloh lädt zum beliebten Frühlingslieder-Singen ein:
Die bekannten Songs, in denen sich alles um die blühende Jahreszeit
dreht, werden am 10. April um ab 14.30 Uhr im BBZ – Begegnungs- und
Beratungszentrum Marxloh Karl-Marx-Straße 20, angestimmt.
Kirchenmusiker Karl Hülskämper wird Singfans aller Generationen
durch den Nachmittag führen. Am Schluss steht das Klönen bei Kaffee
und Kuchen. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter
www.bonhoeffer-gemeinde.org.
Achtsames Pilgern
auf dem niederrheinischen Jakobsweg
Entschleunigung, den
Gedanken Raum geben, die frische Luft genießen und neue Wege
entdecken. Das ist es, was eine Gruppe um Ines Auffermann aus der
Evangelischen Gemeinde Duisburg Hochfeld-Neudorf beim Pilgern
regelmäßig entdeckt. Nun laden sie Interessierte ein, am Samstag,
den 12. April 2025, einen weiteren Abschnitt des niederrheinischen
Jakobsweges mitzugehen und ähnliche Erfahrungen zu machen.
Der Weg beginnt diesmal in Moers und führt durch eine Landschaft,
die vom Abbau der Bodenschätze, ihrer Folgeindustrie und dem
Entstehen von Wohngebieten geprägt ist. „Die Rekultivierung von
Kiesgruben und stillgelegten Industrieflächen, die von der Natur
zurückerobert werden, lassen uns ganz eigene menschengestaltete
Landschaft erleben“ verspricht Ines Auffermann.
Für die 22
km ist eine Gehzeit von knapp sechs Stunden eingeplant. Details zu
Anfahrt und Startpunkt gibt es bei Ines Auffermann, über die auch
Anmeldungen möglich sind (ines.auffermann@ekir.de). Infos zur
Gemeinde gibt es im Netz unter www.hochfeld-neudorf.de.
Pfarrer Muthmann am Service-Telefon der
evangelischen Kirche in Duisburg
„Zu welcher Gemeinde
gehöre ich?“ oder „Wie kann ich in die Kirche eintreten?“ oder „Holt
die Diakonie auch Möbel ab?“: Antworten auf Fragen dieser Art
erhalten Anrufende beim kostenfreien Servicetelefon der
evangelischen Kirche in Duisburg.
Es ist unter der Rufnummer
0800 / 12131213 auch immer montags von 18 bis 20 Uhr besetzt, und
dann geben Pfarrerinnen und Pfarrer Antworten auf Fragen rund um die
kirchliche Arbeit und haben als Seelsorgende ein offenes Ohr für
Sorgen und Nöte. Das Service-Telefon ist am Montag, 7. April 2025
von Jürgen Muthmann, Pfarrer in der Evangelischen Rheingemeinde
Duisburg, besetzt.

NRW: Zahl der Azubis im dualen System
weiter rückläufig
Im Jahr 2024 machten 272 163 Personen
in Nordrhein-Westfalen eine Ausbildung im dualen System. Die Zahl
der Azubis ging damit im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Prozent
zurück. Im Zehnjahresvergleich sank die Zahl der Auszubildenden im
dualen System um 10,4 Prozent: Im Jahr 2015 hatte es noch 303 681
Azubis in NRW gegeben.
Rückgang auch bei den neu
abgeschlossenen Ausbildungsverträgen
Auch die Zahl der neu
abgeschlossenen Ausbildungsverträge in NRW ging im Jahr 2024 zurück.
Von den 272 163 Auszubildenden im dualen System haben 104 925 einen
Ausbildungsvertrag neu abgeschlossen. Seit Beginn der Erhebung der
Berufsbildungsstatistik in den 1970er Jahren war dies der
zweitniedrigste Wert der Neuabschlüsse in NRW nach 2020, dem Jahr
des Beginns der Corona-Pandemie.
Im Jahr 2020 hatten 103 188
Azubis eine duale Ausbildung begonnen. Zahl der Neuabschlüsse von
weiblichen Azubis nimmt leicht zu Von den 104 925 neuen
Ausbildungsverträgen im Jahr 2024 wurden 67 779 von Männern
abgeschlossen und 37 146 von Frauen. Damit lag der Anteil der Männer
an den neuen Azubis bei 64,6 Prozent.
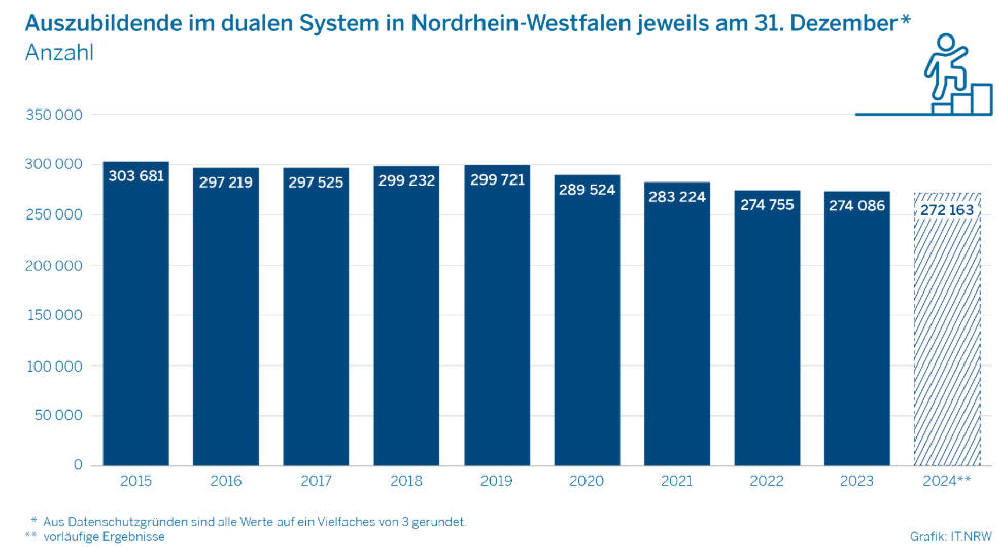
Die Zahl der männlichen Auszubildenden mit neu abgeschlossenem
Ausbildungsvertrag ist im Vergleich zu 2023 um 2,0 Prozent gesunken;
damals wurden 69 138 neue Ausbildungsverträge von Männern
abgeschlossen. Dagegen stieg die Zahl der weiblichen
Ausbildungsanfängerinnen von 36 957 im Jahr 2023 auf 37 146
Neuabschlüsse in 2024, was einem Plus von 0,5 Prozent entspricht.
Mehr Neuabschlüsse in den Bereichen Freie Berufe,
Öffentlicher Dienst und Handwerk Bei den freien Berufen, zu denen
z. B. medizinische Fachangestellte sowie Rechtsanwalts- und
Notarfachangestellte zählen, stieg die Zahl der neuen Azubis 2024 im
Vergleich zum Vorjahr um 5,1 Prozent auf 11 073. Auch in den
Ausbildungsbereichen Öffentlicher Dienst und Handwerk war ein
Anstieg der Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge um 1,9
beziehungsweise 0,9 Prozent zu verzeichnen.

Dagegen wurden in den Ausbildungsbereichen
Industrie, Handel u. a. und Landwirtschaft jeweils 3,1 Prozent
weniger neue Ausbildungsverträge abgeschlossen als 2023. Im Bereich
Sonstige, zu dem Hauswirtschaftsberufe gehören, gab es ebenfalls
einen Rückgang der Neuabschlüsse von 4,8 Prozent im Vergleich zum
Vorjahr.
Die Zahlen der Berufsbildungsstatistik zum
31.12.2024 sind vorläufig und können von den – voraussichtlich Mitte
Juni vorliegenden – endgültigen (regional verfügbaren) Ergebnissen
abweichen, da sie teilweise aus Vorjahresdaten geschätzt und noch
nicht vollständig plausibilisiert wurden. Alle Daten wurden aus
Gründen der Geheimhaltung auf ein Vielfaches von drei gerundet.
(IT.NRW)
Öffentliches Finanzierungsdefizit im
Jahr 2024 bei 104,4 Milliarden Euro
• Defizit des
Bundes verringert sich weiter, Länder und Kommunen dagegen mit
erheblich größeren Finanzierungslücken als im Vorjahr
•
Öffentliche Ausgaben steigen erstmals auf über zwei Billionen Euro
Der Öffentliche Gesamthaushalt hat im Jahr 2024 rund 7,1 %
mehr ausgegeben und 6,8 % mehr eingenommen als im Jahr 2023:
Einnahmen von 1 977,6 Milliarden Euro standen Ausgaben von 2 082,1
Milliarden Euro gegenüber. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
mitteilt, schlossen damit die Kern- und Extrahaushalte von Bund,
Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung das Jahr 2024 mit einem –
in Abgrenzung der Finanzstatistiken errechneten –
Finanzierungsdefizit von 104,4 Milliarden Euro ab.
Damit
fiel das Defizit um 12,7 Milliarden Euro höher aus als im Vorjahr.
Seit 2021 hatte der Bund mit Abstand den größten Anteil am
Gesamtdefizit. 2024 bestanden aber auch bei den Ländern, den
Gemeinden und der Sozialversicherung erhebliche Defizite, die
zusammengenommen das Defizit des Bundes noch übertrafen.
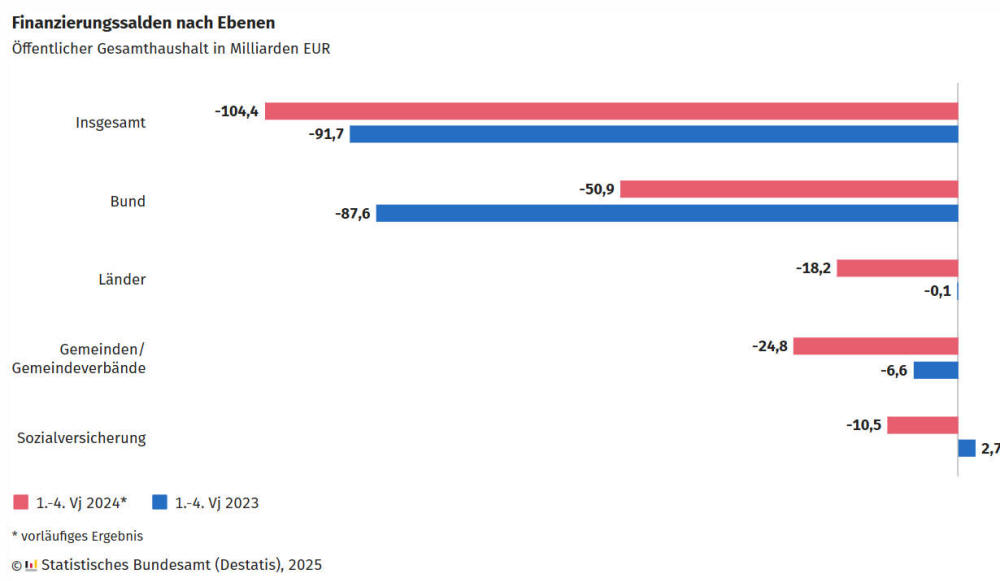
Während im Jahr 2024 die Einnahmen beim
Bund (+8,1 % auf 569,0 Milliarden Euro) im Vorjahresvergleich
stärker wuchsen als die Ausgaben (+1,0 % auf 620,0 Milliarden Euro),
war die Entwicklung bei den Ländern und Kommunen umgekehrt. So
stiegen die Einnahmen der Länder um 2,8 % auf 544,1 Milliarden Euro,
die Ausgaben jedoch um 6,2 % auf 562,4 Milliarden Euro. Noch
deutlicher ging die Entwicklung bei den Gemeinden und
Gemeindeverbänden auseinander.
Hier erhöhten sich die
Einnahmen um 7,6 % auf 376,1 Milliarden Euro, während die Ausgaben
um 12,6 % auf 400,9 Milliarden Euro zunahmen. Vergleichsweise
ausgeglichen waren dagegen die Wachstumsraten bei der
Sozialversicherung (Einnahmen: +5,3 % auf 864,1 Milliarden Euro;
Ausgaben: +6,9 % auf 874,6 Milliarden Euro).
Zwar wuchsen
alle maßgeblichen Einnahmearten stabil, so etwa die Einnahmen aus
Steuern, steuerähnlichen Abgaben und Beitragseinnahmen der
Sozialversicherung, die um 4,6 % auf 1 656,7 Milliarden Euro stiegen
und die Haupteinnahmequelle des Öffentlichen Gesamthaushalts bilden.
Die gestiegenen Gesamteinnahmen konnten die erstmals auf zwei
Billionen Euro gewachsenen Ausgaben aber bei Weitem nicht decken.
Höhere Sozialausgaben, entfallene Energiehilfen, mehr
militärische Beschaffungen
Die vor allem bei den Gemeinden
und Gemeindeverbänden festzustellenden höheren Sozialausgaben sind
auch beim Bund zu beobachten, der viele dieser Leistungen in Form
von Zuweisungen an die Länder mitfinanziert. Diese Zuweisungen
stiegen 2024 gegenüber 2023 um 3,3 Milliarden Euro (darunter rund
1,0 Milliarden Euro für Kosten für Unterkunft und Heizung sowie
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) und die Ausgaben
an natürliche Personen um 3,9 Milliarden Euro, wovon allein das
Bürgergeld 3,3 Milliarden Euro ausmachte.
Insgesamt jedoch
gingen die Zuweisungen des Bundes an Unternehmen und Privathaushalte
im Jahr 2024 um 7,9 % zurück, nachdem die während der Energiekrise
gewährten Hilfen ("Energiepreisbremsen“) Ende März 2024 ausgelaufen
sind.
Beim Bund ist außerdem ein starker Anstieg der
laufenden Sachausgaben aus militärischen Beschaffungen zu
verzeichnen: Diese gingen für den Kernhaushalt zwar zurück auf 14,7
Milliarden Euro (2023: 17,0 Milliarden Euro), stiegen jedoch beim
Sondervermögen Bundeswehr (2024: 16,9 Milliarden Euro, 2023: 5,6
Milliarden Euro).
Alle Ebenen defizitär, Gemeinden tief im
Minus
Das Finanzierungsdefizit der Gemeinden und
Gemeindeverbände wuchs im Jahr 2024 erheblich auf 24,8 Milliarden
Euro, nach einem Defizit von 6,6 Milliarden Euro im Jahr 2023 (siehe
Pressemitteilung Nr. 126 vom 1. April 2025). Beim Bund ist dagegen
mit einem Defizit von 50,9 Milliarden Euro im Jahr 2024 ein
rückläufiger Trend erkennbar. Nach den Corona-Jahren mit einem
Rekorddefizit von 145,1 Milliarden Euro im Jahr 2022 war das Defizit
des Bundes bereits 2023 auf 87,6 Milliarden Euro gesunken.
Hinter dem Finanzierungsdefizit der Länder von insgesamt 18,2
Milliarden Euro im Jahr 2024 verbergen sich unterschiedliche
finanzielle Lagen der einzelnen Länder. Mit einem Überschuss
schlossen jedoch nur Niedersachsen, Sachsen und Rheinland-Pfalz ab.
Ebenso wurde das Defizit der Sozialversicherung von 10,5
Milliarden Euro nicht von allen Versicherungszweigen verursacht:
Während Unfallversicherung und Arbeitslosenversicherung das Jahr
2024 positiv abschlossen, waren die Pflegeversicherung (1,5
Milliarden Euro), die Rentenversicherung (1,4 Milliarden Euro) und
insbesondere die Krankenversicherung (9,2 Milliarden Euro)
defizitär.