






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 37. Kalenderwoche:
10. September
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Donnerstag, 11. September 2025
Bundesweiter Warntag – Erste Ergebnisse
Die
Stadt Duisburg hat heute erneut das Konzept zur Warnung und
Information der Bevölkerung im Gefahrenfall überprüft. Dies erfolgte
mit einem stadtweiten Probealarm des Sirenensystems innerhalb des
bundesweiten Warntags.
Die geplante Auslösung der
Sirenensignale „Entwarnung“ (eine Minute Dauerton), nach einer Pause
die „Warnung“ (eine Minute auf- und abschwellender Heulton) und nach
einer weiteren Pause erneut die „Entwarnung“ (eine Minute Dauerton)
funktionierte grundsätzlich wie erwartet.
Die Auslösung der
Sirenen wurde durch das Monitoring-System der Feuerwehr Duisburg
überwacht. Demnach haben 72 von 80 aktiven Sirenen reibungslos
funktioniert und jeweils entsprechende Warntöne abgegeben. Bei sechs
Sirenen (Standorte Bonnmannshof in Hamborn, Wintgensstraße in
Duissern, Ottostraße in Hochheide, Dahlingstraße und
Otto-SchulenbergStraße in Rheinhausen sowie Werthauser Straße in
Hochfeld) haben nach ersten Erkenntnissen nur zwei von drei Signalen
ausgelöst.
An zwei Standorten (Am See in Wedau sowie
Mendelstraße in Rheinhausen) erfolgte keine Rückmeldung. Eine
Aussage zur Funktionalität kann daher derzeit nicht getroffen
werden. Seitens der Stadt wurde umgehend damit begonnen, die
Ursachen zu ermitteln und zu beheben.
Die Warn-App Nina
wurde für die bundesweite Alarmierung durch das Bundesamt für
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) pünktlich zum Start
des Sirenenalarms ausgelöst. Auch die Funktion des Cell Broadcasts
wurde getestet, welches als weiteres Warnmittel durch das BBK
eingeführt wurde.
Bundesweiter Warntag 2025: Erste
Bilanz positiv
Am heutigen fünften Bundesweiten Warntag
wurden in ganz Deutschland wieder die Warnsysteme für Krisen- und
Katastrophenfälle erprobt. Um 11 Uhr wurde eine Probewarnung
ausgelöst, um 11:45 Uhr folgte die Entwarnung über die meisten
Warnkanäle.

Fotos Quelle: BBK
Bürgerinnen und Bürger konnten die
Warnmeldung aus dem Bundeswarnsystem über zahlreiche Kanäle
empfangen – darunter Fernsehen, Radio, Smartphones, Cell Broadcast,
Warn-Apps sowie digitale Stadtinformationstafeln.
Zusätzlich
kamen vielerorts Sirenen und weitere lokale Warnkanäle wie
Lautsprecherwagen zum Einsatz.
BBK-Präsident Ralph Tiesler:
„Nach ersten Erkenntnissen war der heutige fünfte Bundesweite
Warntag erfolgreich. Wir haben gezeigt, dass unser Bundeswarnsystem
und die angeschlossenen Kanäle funktionieren und haben Millionen von
Menschen erreicht. Die Arbeit und Investitionen der vergangenen
Jahre haben sich gelohnt.

Wir werten nun die Rückmeldungen aller Beteiligten und auch aus der
Bevölkerung aus, um gezielt Optimierungen vorzunehmen. Denn wir
werden die Warnsysteme weiterentwickeln – etwa mit der zentralen
Auslösung der Sirenen, einer Entwarnungsfunktion für Cell Broadcast
und der Integration weiterer neuer Technologien, um den bestehenden
Warnmix zu ergänzen.“
BBK-Vizepräsident Dr. René Funk:
„Die Warnkette hat heute wie vorgesehen gearbeitet. Entscheidend ist
nun für uns, die technischen Messwerte mit den Erfahrungen aus
Ländern und Kommunen sowie den Rückmeldungen der Bürgerinnen und
Bürger abzugleichen. Ich danke den Ländern, Kommunen und
Warnmultiplikatoren sowie allen unseren weiteren Partnern – von den
Mobilfunknetzbetreibern bis hin zu Partnerbehörden, Unternehmen und
technischen Dienstleistern. Sie machen nicht nur diese Erprobung zum
Bundesweiten Warntag gemeinsam mit uns möglich, sondern auch die
Warnungen, die täglich problemlos über das Bundeswarnsystem laufen.“

Die Probewarnung wurde in diesem Jahr an sechs Warn-Apps (inkl.
Warn-App NINA) und rund 8.700 Stadtinformationstafeln ausgesteuert.
Außerdem arbeitet das BBK mit 59 sogenannten Warnmultiplikatoren
zusammen. Dahinter verbergen sich beispielsweise Rundfunk- und
Fernsehanstalten, die ebenfalls die Probewarnung erhalten und an
ihre Nutzerinnen und Nutzer weitergegeben haben.
Online-Umfrage für Bevölkerung läuft
Auch in diesem Jahr bittet
das BBK die Bevölkerung, ihre Erfahrungen bis zum 18. September 2025
unter www.warntag-umfrage.de mitzuteilen. Die Ergebnisse werden
wissenschaftlich ausgewertet und fließen in die weitere Optimierung
der Warnsysteme ein.
Bundesweiter Warntag 2025: Bund, Länder und Kommunen testen
Warnsysteme am 11. September
Gegen 11 Uhr löst das
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) über
das Modulare Warnsystem des Bundes (MoWaS) eine Probewarnung aus.
Diese wird an alle angeschlossenen Warnmultiplikatoren wie Rundfunk-
und Fernsehsender, digitale Anzeigetafeln, Warn-Apps sowie Cell
Broadcast weitergeleitet und erreicht so Millionen Menschen in
Deutschland.
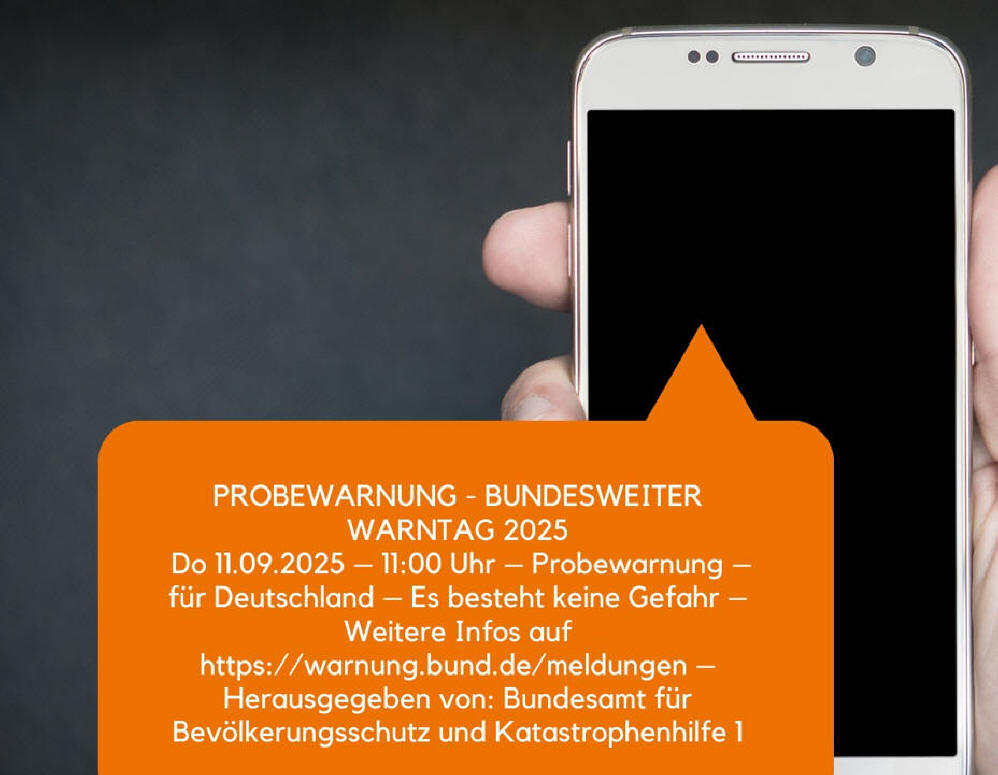
Viele Kommunen testen ergänzend ihre eigenen Warnmittel wie Sirenen
oder Lautsprecherwagen. Gegen 11:45 Uhr erfolgt eine bundesweite
Entwarnung – mit Ausnahme von Cell Broadcast. Dieses System
versendet bisher ausschließlich Warnungen. Bundesweiter Warntag als
gemeinsamer Test von Staat und Gesellschaft
BBK-Präsident Ralph Tiesler: „Eine effektive
Warnung geht über technische Funktionalitäten hinaus. Damit Warnung
ankommt und verstanden wird, brauchen wir die Bevölkerung an unserer
Seite: Ihre Rückmeldungen nach dem Warntag sind für uns ein
zentraler Bestandteil der Auswertung. Nur wenn Bürgerinnen und
Bürger ihre eigenen Erfahrungen mit den verschiedenen Warnmitteln
einbringen, können wir das System gezielt weiterentwickeln und für
den Ernstfall noch verständlicher und verlässlicher machen.
Der Warntag ist deshalb ein gemeinsamer Aktionstag – von Staat und
Gesellschaft.“ BBK-Vizepräsident Dr. René Funk: „Der Bundesweite
Warntag ist unser Stresstest unter Volllast: Wir prüfen die gesamte
Übermittlungskette von der Auslösung bis zum Endgerät. Entscheidend
ist dabei die enge Zusammenarbeit von Bund, Ländern, Kommunen und
Warnmultiplikatoren – und das Zusammenspiel der unterschiedlichen
Warnkanäle, die Millionen Menschen gleichzeitig erreichen.“
Bürgerbeteiligung über Online-Umfrage Begleitend startet am
Bundesweiten Warntag direkt um 11 Uhr eine Online-Umfrage, bei der
Bürgerinnen und Bürger ihre Erfahrungen mit den verschiedenen
Warnkanälen melden können. Die Ergebnisse fließen zusammen mit der
technischen Auswertung in die Weiterentwicklung des Warnsystems ein.
Die Teilnahme ist bis zum 18. September 2025 möglich unter:
www.warntag-umfrage.de
Bundesweiter Warntag – Probealarm des Sirenensystems
Die Stadt Duisburg überprüft erneut das Konzept zur
Warnung und Information der Bevölkerung im Gefahrenfall. Dies
erfolgt mit einem stadtweiten Probealarm des Sirenensystems am
Donnerstag, 11. September, um 11 Uhr.
Der Probealarm findet
wieder innerhalb eines bundesweiten Warntags statt, der vom
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)
koordiniert wird. Dabei werden im gesamten Bundesgebiet sämtliche
Warnmittel erprobt und damit zeitgleich die in den Kommunen
vorhandenen Warnkonzepte getestet.
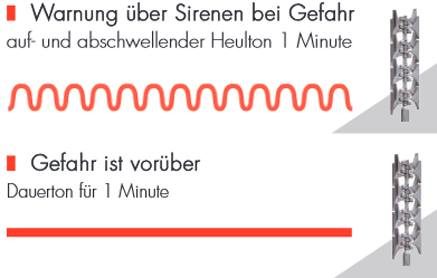
Sechster Bundesweiter Warntag am 11. September 2025.
Ziel ist es, die Bevölkerung für das Themenfeld
„Warnung“ zu sensibilisieren sowie Informationen und Tipps zu geben,
damit sie im Ernstfall richtig reagieren und sich selbst helfen
können. Der Beginn des Alarms wird mit einem einminütige Dauerton
für die Entwarnung ausgelöst. Es folgt der einminütige auf- und
abschwellende Heulton für die Warnung. Zum Abschluss erfolgt wieder
das Entwarnungssignal.
Über den Sirenentest informiert am
Tag des Probealarms auch die städtische Internetseite
(www.duisburg.de), das kostenlose Gefahrentelefon der Stadt Duisburg
(0800/1121313) sowie die Warn-App „NINA“. An diesem Tag wird auch
erneut Cell Broadcast über das Modulare Warnsystem (MoWaS) ausgelöst
und eine entsprechende Mitteilung auf Mobilfunkgeräte gesendet.
Weitere Informationen zu Cell Broadcast finden sich auf den
Internetseiten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe unter
www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Warnung-in-Deutschland/Sowerden-Sie-gewarnt/Cell-Broadcast/cell-broadcast_node.html
Zur Auswertung des aktuellen Probealarms stützt sich die Feuerwehr
Duisburg auf die eigene technische Analyse des Sirenensystems.
Rückmeldung zu den Sirenen können auch per E-Mail
(kub@feuerwehr.duisburg.de, Betreff „Probealarm“) an die Stabsstelle
Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz erfolgen. Weitere
Informationen zum bundesweiten Warntag sind online unter
https://www.bbk.bund.de/ bereitgestellt.
Bürger- und
Ordnungsamt: Bilanz der Schwerpunktkontrollen zum Falschparken auf
Radwegen
Die städtische Verkehrsüberwachung hat mit
Unterstützung des Städtischen Außendienstes (SAD) vom 18. bis 22.
August sowie vom 1. bis 5. September, sowohl in den Morgen- als auch
in den Abendstunden, umfangreiche Schwerpunktkontrollen zum
Falschparken auf Radwegen durchgeführt. Drei Teams mit
Einsatzkräften der Verkehrsüberwachung und des SAD überprüften in
den zwei Wochen gezielt 18 Stellen im Stadtgebiet, die vom ADFC
(Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) übermittelt wurden.
Zwei weitere Fahrradteams der Verkehrsüberwachung waren im gesamten
Duisburger Stadtgebiet unterwegs, um Verkehrsordnungswidrigkeiten zu
ahnden. Insgesamt wurden während der beiden intensiven
Kontrollwochen 286 Verkehrsordnungswidrigkeiten im direkten
Zusammenhang mit Radwegparken erfasst und geahndet. Es mussten vier
Abschleppmaßnahmen eingeleitet werden. Darüber hinaus wurden weitere
rund 50 Verkehrsteilnehmer durch mündliche Verwarnungen auf ihr
Fehlverhalten hingewiesen.

Zusätzlich wurden durch die Überwachungskräfte 432 allgemeine
Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt und neun
Abschleppmaßnahmen durchgeführt. „Radwege zu blockieren, ist nicht
nur eine Unsitte, sondern vor allem gefährlich. Deshalb werden wir
die Schwerpunktkontrollen auf jeden Fall fortsetzen und Verstöße
konsequent ahnden“, so Oberbürgermeister Sören Link.

Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung sind mit dem Fahrrad im gesamten
Stadtgebiet unterwegs. Fotos Tanja Pickartz / Stadt Duisburg
Die städtische Verkehrsüberwachung wird auch zukünftig die
Kontrollen, insbesondere mit den Fahrradteams, durchführen und dabei
verstärkt die bekannten Schwerpunkte anfahren, bei denen eine
erhöhte Anzahl von Verstößen festgestellt wurde. Das Falschparken
auf Radwegen ist eine Ordnungswidrigkeit und stellt eine erhebliche
Gefährdung des Straßenverkehrs, insbesondere für Radfahrer, dar. Das
Verwarngeld beträgt 55 Euro. Bei Behinderung anderer
Verkehrsteilnehmer gibt es ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro und
zusätzlich einen Punkt in Flensburg.
„Prima.Klima.Neuenkamp“ beteiligt sich am Rhine Cleanup 2025
Das Projekt „Prima.Klima.Neuenkamp“ nimmt in diesem
Jahr aktiv am Rhine Cleanup in Duisburg teil. Gemeinsam mit vielen
anderen Engagierten wird am Samstag, 13. September, ab 10 Uhr
entlang des Rheinufers in Neuenkamp Müll gesammelt und die Uferzonen
von Abfällen befreit. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich
eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen.
„Der Rhine
Cleanup Day ist ein wichtiges Symbol für das Engagement in unserer
Stadt, die Umwelt zu schützen und gemeinsam mit zahlreichen Kommunen
entlang des Rheins ein sichtbares Zeichen für Klimaschutz und
Nachhaltigkeit zu setzen“, sagt Linda Wagner, Dezernentin für Umwelt
und Klimaschutz, Gesundheit, Verbraucherschutz und Kultur. Die
Aktion Rhine Cleanup findet gleichzeitig in vielen Städten entlang
des Rheins statt.
„Mit unserer Teilnahme möchten wir zeigen,
dass Klimaschutz und Ressourcenschonung im Alltag beginnen – vor
unserer eigenen Haustür“, sagt Christopher Seifried vom
Sanierungsmanagement Prima.Klima.Neuenkamp. „Der Rhine Cleanup ist
eine tolle Gelegenheit, die Menschen im Quartier einzubeziehen und
gemeinsam Verantwortung für unsere Umwelt und unser Klima zu
übernehmen.“ Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Rheindeich in Höhe der
Lilienthalstraße 70 in Neuenkamp und auf dem Ruhrdeich in Höhe der
Kaßlerfelder Straße 188 um 10.30 Uhr. Der Müll wird an der
Rheinorange gesammelt.
Um Anmeldung über das Online-Portal
https://www.rhinecleanup.org/de/cleanup/duisportcleanup-an-der-rheinorange
wird gebeten. Über das Projekt „Prima.Klima.Neuenkamp“
„Prima.Klima.Neuenkamp“ ist Teil des Projekts
„Prima.Klima.Ruhrmetropole.“ Das Projekt verfolgt das Ziel,
Klimaschutz und Klimaanpassung direkt in den Stadtteilen erlebbar zu
machen und gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern, lokalen Akteuren
und Institutionen umzusetzen.
Im Klimaquartier
Duisburg-Neuenkamp werden dafür konkrete Maßnahmen entwickelt und
begleitet, die von energetischer Sanierung über Begrünungsprojekte
bis hin zu Informations- und Beteiligungsangeboten reichen. Ziel ist
es, das Quartier langfristig klimafreundlicher, lebenswerter und
zukunftssicher zu gestalten – im engen Schulterschluss mit den
Menschen vor Ort.
Weitere Informationen gibt es online unter
www.duisburg.de unter dem Suchbegriff „Prima.Klima.Neuenkamp“. „Mit
dem Projekt ‚Prima. Klima. Ruhrmetropole.‘ können passgenaue
Maßnahmen und Förderstrukturen ausprobiert, erfolgreich angewendet
und für die Zukunft evaluiert werden. So werden Vorbilder für die
ganze Region geschaffen.
Dank des Wissenstransfers zwischen
allen teilnehmenden Städten der Metropole Ruhr profitieren die
ausgewählten Wohnviertel sowie wie die gesamte Region von dem
interkommunal ausgerichteten Projekt im Sinne einer zukunftsfähigen
integrierten Quartiersentwicklung“, sagt Umweltund
Klimaschutzdezernentin Linda Wagner.
MSV Duisburg –
SV Wehen Wiesbaden: DVG setzt zusätzliche Busse ein
Für Gäste des Fußballspiels MSV Duisburg gegen den SV Wehen
Wiesbaden am Samstag, 13. September, um 14 Uhr in der
Schauinsland-Reisen Arena, setzt die Duisburger Verkehrsgesellschaft
AG (DVG) die Sportlinie 945 ein.
Für Gäste des Fußballspiels MSV
Duisburg gegen den SV Wehen Wiesbaden am Samstag, 13. September, um
14 Uhr in der Schauinsland-Reisen Arena, setzt die Duisburger
Verkehrsgesellschaft AG (DVG) die Sportlinie 945 ein.
Abfahrtszeiten Buslinie 945 Richtung MSV Arena
ab „Salmstraße“
(Meiderich) Abfahrt um 12.06, 12.16, 12.26 Uhr
ab „Bergstraße“ um
12.11, 12.21 und 12.31 Uhr
ab „Meiderich Bahnhof“ ab 12.15 bis
12.40 Uhr alle fünf Minuten
ab „Großenbaum Bahnhof Ost“ um 12.50
und 13.05 Uhr
ab „Betriebshof am Unkelstein“ ab 11.58 bis 12.23
Uhr alle fünf Minuten
ab Hauptbahnho“ (Verknüpfungshalle) ab
12.15 bis 13.35 Uhr alle fünf Minuten
ab „Businesspark Nord“
(Asterlagen) um 12.33 Uhr

DVG-Foto
Nach Spielende stehen am Stadion Busse für die Rückfahrt bereit.
Gäste des Fußballspieles, die eine Tageseintrittskarte im Vorverkauf
erworben haben oder eine Dauerkarte besitzen, können kostenlos die
öffentlichen Verkehrsmittel für die Hin- und Rückfahrt benutzen. Für
die Gäste, die sich an der Stadionkasse ihre Eintrittskarte kaufen,
ist die Rückfahrt mit Bus und Bahn kostenlos.
Wohnungsbau in Duisburg: Innenverdichtung allein reicht nicht
Die Wohnraumsituation in Duisburg war Teil einer vom
vom Bochumer Institut für Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft,
Stadt- und Regionalentwicklung (InWis) erstellte Studie mit dem
Titel „Wohnungsbau braucht (mehr) Fläche“. Nach städtischen Angaben
liegt die Leerstandsquote bei unter zwei Prozent, was deutlich
macht, dass kaum Puffer am Markt vorhanden ist.
Besonders
der preisgünstige Mietwohnungsbau steht unter Druck, während die
Nachfrage im mittleren Segment ebenfalls steigt. „Duisburg wächst
moderat, steht aber dennoch vor erheblichen Herausforderungen auf
dem Wohnungsmarkt. Die Bevölkerungszahlen werden nach Prognosen
langfristig stabil bleiben. Dennoch steigt der Bedarf an
zusätzlichem Wohnraum, weil Haushalte kleiner werden und die
Nachfrage nach modernen, bezahlbaren Wohnungen zunimmt“, so
InWisGeschäftsführer Prof. Torsten Bölting.
Seine Prognose:
„Duisburg kann mit Innenentwicklung allein den Wohnraumbedarf nicht
decken.“ Selbst wenn hohe Dichten von über 40 Wohnungen pro Hektar
umgesetzt werden und zwei Drittel aller neuen Flächen für den
Wohnungsbau reserviert werden, müssten täglich bis zu 42 Hektar
landesweit mobilisiert werden. Dieses Szenario überfordert die
Realität in Duisburg, wo Baulandreserven begrenzt und
Genehmigungsprozesse langwierig sind.
In den vergangenen
Jahren hat Duisburg vergleichsweise wenig neue Bauflächen für den
Wohnungsbau aktiviert. 2023 wurde ein Flächenverbrauch von knapp 40
Hektar bilanziert, der nicht ausreicht, um den Bedarf zu decken. Ein
Großteil des Potenzials liegt in Nachverdichtung und Umnutzung von
Industrieflächen. Doch diese Projekte erweisen sich oft als
langwierig und komplex. Beispiele sind die Konversionsflächen in
Hochfeld oder die Entwicklung des ehemaligen Güterbahnhofs. Zugleich
bleibt der Druck hoch, auch in den äußeren Stadtteilen Bauland
bereitzustellen, um kurzfristig Entlastung zu schaffen.
„Unsere Analyse verdeutlicht, dass Innenverdichtung nur ein Teil der
Lösung sein kann. Für Duisburg wie für viele andere Städte gilt: Es
braucht die richtige Balance aus Nachverdichtung und einer
verantwortungsvollen Entwicklung neuer Flächen im Außenbereich“,
sagt Dr. Torsten Bölting, Geschäftsführer von InWIS. Karsten Koch,
Regionalsprecher des BFW NRW und Geschäftsführer der Bochumer
Markus-Bau, betont: „Duisburg ist ein Beispiel dafür, dass selbst
die beste Innenentwicklung an Grenzen stößt. Ohne zusätzliche
Flächen im Außenbereich bleibt der Wohnraumbedarf ungestillt.
Politik und Verwaltung müssen den Mut haben, diese Potenziale zu
erschließen – nachhaltig und planvoll.“
Der BFW NRW vertritt
die Interessen von mehr als 300 Mitgliedsunternehmen aus NRW und ist
als Unternehmerverband der Ansprechpartner für
wohnungswirtschaftliche und wohnungspolitische Fragestellungen. Dem
BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen als
Interessenvertreter der mittelständischen Immobilienwirtschaft
gehören derzeit rund 1.600 Mitgliedsunternehmen an.
Als
Spitzenverband wird der BFW von Landesparlamenten und Bundestag bei
branchenrelevanten Gesetzgebungsverfahren angehört. Die
Mitgliedsunternehmen stehen für 50% des Wohnungs- und 30% des
Gewerbeneubaus. Sie prägen damit entscheidend die derzeitigen und
die zukünftigen Lebens- und Arbeitsbedingungen in Deutschland. Mit
einem Wohnungsbestand von 3,1 Millionen Wohnungen verwalten sie
einen Anteil von mehr als 14% des gesamten vermieteten
Wohnungsbestandes in der Bundesrepublik. Zudem verwalten die
Mitgliedsunternehmen Gewerberäume von ca. 38 Millionen Quadratmetern
Nutzfläche.
Wohnen in Duisburg: 3,8 Prozent mehr Energieverbrauch als im
Bundesdurchschnitt
• Energiespar-Sanierung von Wohnungen
in Duisburg würde 786 Mio. Euro pro Jahr kosten
• 205.000
Wohnungen älter als 45 Jahre | Baustoff-Fachhandel fordert
„Sanierungs-Turbo“ vom Bund
Viele Häuser in Duisburg brauchen
bald viele Handwerker: Die Wohngebäude sind enorm in die Jahre
gekommen. Von den insgesamt rund 254.000 Wohnungen in Duisburg sind
81 Prozent schon 45 Jahre oder älter: Rund 205.000 Wohnungen in
Altbauten sind damit mehr oder weniger „reif für eine Sanierung“.
Das geht aus der aktuellen Analyse zum regionalen Wohnungsbestand
hervor, die das Pestel-Institut gemacht hat.
Ein wichtiger
Punkt bei dem „Gebäude-Check“: der Energieverbrauch. „Je mehr Geld
Bewohner fürs Heizen und für warmes Wasser ausgeben müssen, desto
höher ist der Druck, das Haus energetisch zu sanieren“, sagt
Matthias Günther vom Pestel-Institut. Im Fokus der Untersuchung
steht deshalb auch die durchschnittlich verbrauchte Energie pro
Quadratmeter Wohnfläche in Duisburg.
„Dabei herausgekommen
ist, dass die Wohngebäude in Duisburg beim Energieverbrauch 3,8
Prozent pro Quadratmeter über dem bundesweiten Durchschnitt liegen“,
so Matthias Günther. Dazu habe das Pestel-Institut in seiner
Datenanalyse die Struktur der Wohngebäude in Duisburg mit dem
Bundesdurchschnitt verglichen. Wichtig sei dabei insbesondere die
Altersstruktur der Wohngebäude. Ebenso der Gebäudetyp – also die
Anzahl der Ein- und Zweifamilienhäuser sowie der Mehrfamilienhäuser.
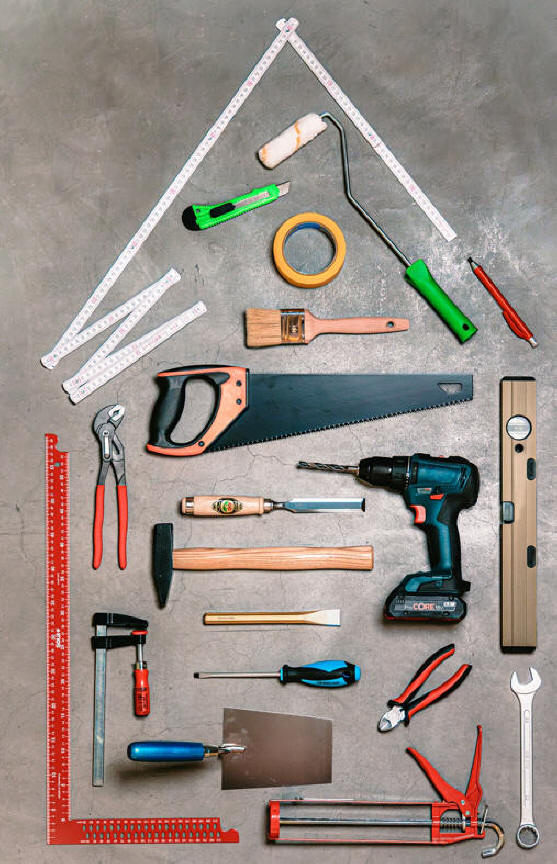
Warten dringend aufs Werkzeug – und auf Handwerker natürlich: Rund
205.000 Wohnungen in Duisburg sind älter als 45 Jahre. Die meisten
haben Sanierungsbedarf. „Oft muss eine Menge gemacht werden:
Energetisch, altersgerecht und auch, um die Bausubstanz überhaupt zu
erhalten“, sagt Matthias Günther vom Pestel-Institut. Foto: Nils
Hillebrand
Der Energieverbrauch fürs Wohnen ist nach
Angaben des Pestel-Instituts der entscheidende Richtwert für die
Energiespar-Sanierungen, die in den kommenden Jahren noch auf
Duisburg zukommen: „Immerhin sei es das Ziel, den gesamten
Gebäudebestand in Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen. Wenn
Duisburg bis dahin klimaneutral wohnen soll, dann ist es notwendig,
bei den Sanierungen in den ‚Turbo-Gang‘ zu schalten“, so Matthias
Günther vom Pestel-Institut, das die Regional-Untersuchung zur
Sanierung von Wohngebäuden im Auftrag des Bundesverbandes Deutscher
Baustoff-Fachhandel (BDB) gemacht hat.
Für die Hauseigentümer
bedeute dies, in die Tasche greifen zu müssen: „Pro Jahr sollte sich
Duisburg auf rund 786 Millionen Euro Sanierungskosten einstellen –
allein fürs Energiesparen. Und das zwanzig Jahre lang“, erklärt
Matthias Günther. Basis der Berechnungen ist eine bundesweite Studie
des landeseigenen Bauforschungsinstituts „ARGE für zeitgemäßes
Wohnen“ in Schleswig-Holstein.
Der Bundesverband Deutscher
Baustoff-Fachhandel spricht von einem „Mammut-Projekt für Duisburg“.
Dessen Präsidentin Katharina Metzger fordert deshalb jetzt
„finanziellen Rückenwind“ für die Eigentümer: „Entscheidend ist,
dass mehr und mehr – gerade private – Hauseigentümer mitziehen. Vor
allem, dass sie sich Sanierungen überhaupt erlauben können.
Das
klappt nur, wenn die Politik mehr Anreize schafft: Es ist höchste
Zeit, Energiespar-Sanierungen deutlich besser zu fördern als
bislang.“ Auf keinen Fall dürfe Bundeswirtschaftsministerin
Katherina Reiche (CDU) mit ihren Plänen durchkommen, Förderprogramme
für die Sanierung zusammenzustreichen – und das um mehr als 3
Milliarden Euro.
An die Adresse der Bundestagsabgeordneten
aus Duisburg und der Region appelliert der Baustoff-Fachhandel, sich
in Berlin für einen „Push bei der Gebäudesanierung“ stark zu machen:
„Altbau-Sanierungen würden helfen, Jobs auf dem Bau in Duisburg zu
sichern. Denn die Wohnungsbaukrise wird von Tag zu Tag schlimmer“,
so BDB-Präsidentin Katharina Metzger (Foto: Tobias Seifert).

Der Wohnungsbau sei wie gelähmt: Zwar habe Bundesbauministerin
Verena Hubertz (SPD) versprochen, dass „die Bagger auch wieder
rollen“. „Doch auf den versprochenen Neubau-Turbo warten Duisburg
und Nordrhein-Westfalen immer noch. Die Wohnungsbaukrise geht
weiter. Dem Bau rutschen die Kapazitäten weg: Bauarbeiter verlieren
ihre Arbeit. Betriebe machen dicht.
Diese Bau-Spirale nach unten
muss vor allem der Bund jetzt dringend stoppen: Er muss die
Konjunktur-Notbremse für den Bau ziehen“, fordert Katharina Metzger.
Gerade das Ankurbeln von Sanierungen und Modernisierungen gebe dem
Bau einen wichtigen Schub, den dieser dringend brauche.
Im
Fokus muss dabei das Energiesparen stehen, so das Pestel-Institut.
„Um Heizkosten zu senken, sind die Dachdämmung, neue Isolierfenster
und Wärmepumpen das A und O. Dabei ist es bei einem alten Dach nicht
so entscheidend, ob drei Zentimeter mehr oder weniger an Dämmung
zwischen die Sparren passen. Hauptsache, ab der obersten
Geschossdecke passiert überhaupt etwas“, sagt Institutsleiter
Günther.
Wenn sich Eigentümer entschließen, Handwerker ins
Haus zu holen, dann biete es sich an, möglichst umfassend zu
sanieren: „Wenn Dach und Fassade gemacht werden müssen, dann ist es
natürlich günstiger, das Gerüst nur einmal aufbauen zu müssen“, rät
Katharina Metzger vom Bundesverband des Baustoff-Fachhandels.
Es sei oft effektiver und unterm Strich in der Regel auch
günstiger, möglichst viel in einem Rutsch zu machen: „Also lieber im
Rundumschlag sanieren als Stück für Stück über Jahre verteilt. Das
ist natürlich immer auch eine Frage des Portemonnaies“, so Katharina
Metzger. Es lohne sich aber, mit Handwerksbetrieben darüber zu
sprechen und ein Sanierungskonzept zu machen. Und wenn doch in
Schritten saniert werde, dann in der richtigen Reihenfolge: „Erst
die Häuser energetisch fit machen – also dämmen. Dann die
Wärmepumpe“, so Metzger.
Neben der energetischen Sanierung
biete sich vor allem auch der altersgerechte Umbau an, um
Seniorenwohnungen zu schaffen. „Wer ein eigenes Haus oder eine
Eigentumswohnung hat, sollte rechtzeitig dafür sorgen, dass er in
den eigenen vier Wänden auch alt werden kann“, rät Katharina
Metzger.
„Hustet einer, husten alle!“ - Kai Wergener
ist neues Mitglied der IHK-Vollversammlung
Die
Niederrheinische IHK hat eine neue Vollversammlung. Dieses
„Parlament der Unternehmen“ gestaltet die Arbeit der IHK für die
nächsten fünf Jahre. Fast die Hälfte der Mitglieder ist neu dabei.
Unter ihnen Kai Wergener. Zusammen mit seinen Partnern gibt er als
Geschäftsführer des Restaurants Küppersmühle in Duisburg alles, um
ein perfekter Gastgeber zu sein. Bei ihm treffen sich Wirtschaft,
Politik und Menschen, die einfach ein hervorragendes Essen genießen
möchten.

Foto: SEEQ Agency Samuel Lemanczyk
Warum engagieren Sie sich
in der Vollversammlung?
Kai Wergener: Mein Herz schlägt für das
Ruhrgebiet und die Menschen hier. Nach beruflichen Stationen in
internationalen Hotels und auf verschiedenen Inseln bin ich jetzt
sehr glücklich im Restaurant Küppersmühle. Besonders freut es mich
als Lokalpatrioten, wenn internationale Gäste erstaunt sind, wie
schön Duisburg ist und dass es hier solche besonderen Orte wie die
Küppersmühle gibt. Die Lebensqualität des Ruhrgebiets ist häufig gar
nicht bekannt.
Neben der Museumsgastro und vielen privaten
Feiern hat sich unser Restaurant auch als beliebter Spot für
Geschäftstermine etabliert. Dadurch erlebe ich Geschäftsleute mit
ihren Themen und ihrem Engagement ganz direkt. Das alles hat mich
motiviert, mich auch selbst zu engagieren. Denn hier im Ruhrgebiet
hängen wir alle zusammen. Es heißt ja so schön: „Hustet einer,
husten alle!“. Das kommt auch durch die Bindung zum Stahl und zur
Industrie. Deshalb: Dem Ruhrgebiet muss es gut gehen! Dafür
engagiere ich mich gerne in der Vollversammlung der
Niederrheinischen IHK.
Was ist Ihnen wichtig, um die
Wirtschaft am Niederrhein voranzubringen?
Meine Aufgabe ist es
ja, den Menschen eine gute Zeit zu ermöglichen und sie
zusammenzubringen. Wir stecken viel Liebe und Herzblut in die
Details, in unsere Produkte und die Zubereitung. Diese Begeisterung
spüre ich bei vielen Wirtschaftsleuten, egal, welche Branche. Wir
haben diese lange Industrietradition. Die dürfen wir nicht einfach
aufgeben. Die Menschen brauchen gute Löhne, um sich ab und zu etwas
gönnen zu können. Dazu benötigen wir von Politik und Verwaltung die
passenden Rahmenbedingungen.
Hinzu kommt: In unserem Betrieb
legen wir viel Wert darauf, verlässlich, ehrlich und herzlich im
Umgang zu sein. Wenn wir es schaffen, damit neue Leute für unsere
Region zu begeistern und Unternehmergeist hierher zu holen, dann
profitieren alle davon. Es gibt also viel zu tun, und nur gemeinsam
können wir es schaffen.
Kreatives Upcycling: Shirts
in der Zentralbibliothek gestalten
Jugendliche im Alter
von zehn bis 14 Jahren können am Samstag, 13. September, von 11 bis
15 Uhr in der Zentralbibliothek, Steinsche Gasse 26, ihren eigenen
T-Shirts/Sweatshirts ein individuelles Aussehen verleihen. Unter der
Anleitung der Modedesignerin Caroline Sell machen die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus altem Stoff neue Kleidung.
Das mitgebrachte Kleidungsstück kann unter anderem mit
Textilfarbe, Nadel und Faden, Flicken oder Bügelfolie kreativ
bearbeitet und umgestaltet werden. Die Teilnahme kostet 2 Euro. Das
Geld geht zugunsten der Duisburger Bibliotheksstiftung. Ein T-Shirt
oder Sweatshirt muss selbst mitgebracht werden. Alle weiteren
Materialien werden gestellt. Die Kurse gehören zum Programm des
Kulturrucksacks NRW. Die Anmeldung ist online auf der Internetseite
www.stadtbibliothekduisburg.de unter Veranstaltungen möglich.
Comic-Zeichenworkshop in der Stadtteilbibliothek Neumühl
Die Stadtteilbibliothek Neumühl an der Lehrerstraße 4-6
lädt am Samstag, 20. September, von 10 bis 13 Uhr zu einem
Comic-Zeichenworkshop ein. Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren
können mit dem Künstler Robin Schicha in die Welt von Tim und
Struppi, Batman oder anderen ComicHeldinnen und Helden eintauchen,
aber auch eigene Figuren erfinden.
Bei dem Workshop werden
erste Grundkenntnisse im Zeichnen von Comics vermittelt.
Vorkenntnisse oder eine besondere künstlerische Begabung sind nicht
notwendig. Wer selbst schon gezeichnet hat, kann seine Sachen
mitbringen und sich weitere Tipps und Anregungen holen.
Die
Teilnahme beträgt 2 Euro und kommt der Duisburger
Bibliotheksstiftung zugute. Alle Materialien werden gestellt. Das
Angebot wird durch den Kulturrucksack NRW gefördert. Weitere
Informationen und die Möglichkeit sich anzumelden gibt es online
unter www.stadtbibliothek-duisburg.de bei der Rubrik
„Veranstaltungen“.
Graffiti-Event an der Emscherhalle im
Landschaftspark Duisburg-Nord
Das Jugendamt
der Stadt Duisburg veranstaltet gemeinsam mit den Duisburger
Streetworkern am Samstag, 27. September, von 10 bis 16 Uhr an der
Emscherhalle im Landschaftspark Duisburg-Nord ein spannendes
Graffiti-Event. Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren die
Möglichkeit, sich kreativ auszuleben und Graffiti-Kunst unter
professioneller Anleitung in Workshops zu gestalten.
Darüber hinaus besteht für alle Interessierten die
Möglichkeit, sich auch ohne Anleitung frei an den Wänden
mit den Spraydosen auszuprobieren. Die Dosen werden
hierfür kostenlos zur Verfügung gestellt. Abgerundet wird
das Event durch einen DJ, der für die passende
musikalische Atmosphäre sorgt.
Die Teilnahme ist
kostenlos und richtet sich sowohl an einzelne Jugendliche
als auch an Gruppen, wie zum Beispiel Schulklassen.
Interessierte können sich per E-Mail an
hall-of-fame-duisburg@web.de anmelden. Für die
Teilnehmenden werden sämtliche Materialien sowie
Verpflegung bereitgestellt. Das Graffiti-Event findet im
Rahmen der „Nacht der Jugendkultur“ statt und bietet
jungen Künstlerinnen und Künstlern eine tolle
Gelegenheit, ihre Kreativität öffentlich zu präsentieren
und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen.
VHS: Intensivkurs für Neulinge in Word und Excel
Die Volkhochschule Duisburg bietet von Dienstag, 23. September,
bis Freitag, 26. September, jeweils von 9 bis 16 Uhr im Stadtfenster
an der Steinschen Gasse 26 in der Innenstadt einen Intensivkurs für
Neulinge in Word und Excel an. Die Teilnehmenden erlernen die
Grundlagen der OfficeAnwendungen.
Der Kurs ist auch als
Bildungsurlaub anerkannt. Die Teilnahme kostet 184 Euro. Eine
vorherige Anmeldung online über www.vhs-duisburg.de ist notwendig.
Weitere Informationen gibt es auch bei Eva Fastabend telefonisch
unter (0203) 283-984580 oder per E-Mail an
e.fastabend@stadt-duisburg.de.
Abschaffung
der täglichen Höchstarbeitszeit: Knapp drei Viertel der
Beschäftigten fürchten negative Folgensehr langer Arbeitstage
Knapp drei Viertel der Beschäftigten befürchten negative Folgen für
Erholung und Gesundheit, für die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und
Familienleben sowie die Organisation ihres Alltags, wenn generell
Arbeitstage von mehr als zehn Stunden möglich werden. Das wäre eine
Folge der von der Bundesregierung favorisierten Abschaffung der
täglichen Höchstarbeitszeit.
Frauen rechnen noch deutlich
häufiger mit negativen Wirkungen als Männer, was daran liegen
dürfte, dass sie deutlich mehr unbezahlte Sorgearbeit zusätzlich zum
Erwerbsjob leisten. Das ergibt eine neue Studie des Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung.
Sie basiert auf einer Online-Befragung vom Juli 2025 unter mehr als
2000 Beschäftigten.*
Um Aussagen über die Gesamtheit der
Arbeitnehmer*innen in Deutschland treffen zu können, wurden die
Daten gewichtet. Die Befragungsergebnisse unterstreichen auch, dass
sehr lange und flexible Arbeitszeiten in Deutschland längst
verbreitet sind. Immerhin 12 Prozent der vom WSI Befragten arbeiten
wenigstens an einzelnen Tagen in der Woche länger als zehn Stunden.
Und knapp 38 Prozent der Beschäftigten nehmen zumindest ab und zu
abends nach 19 Uhr ihre Erwerbsarbeit nochmal auf, nachdem sie sie
tagsüber aus privaten Gründen unterbrochen haben, etwa, wenn die
Kinder aus der Schule kommen. „Die vorliegenden Ergebnisse zeigen:
Eine Abschaffung der gesetzlichen täglichen Arbeitszeitgrenze ist
weder erforderlich noch sinnvoll“, lautet daher das Fazit der
Studienautorinnen Dr. Yvonne Lott und Dr. Eileen Peters vom WSI.
Die Bundesregierung und Arbeitgeberverbände wollen mehr
Möglichkeiten für sehr lange Arbeitstage schaffen, indem die
Höchstarbeitszeit für den Erwerbsjob nicht mehr pro Tag, sondern pro
Woche geregelt wird. Damit würden kurzfristig generell
Erwerbsarbeitstage von mehr als zehn Stunden, im Extremfall sogar
von mehr als 12 Stunden möglich, die dann über einen längeren
Zeitraum auf durchschnittlich acht Stunden ausgeglichen werden
müssen. Aktuell ist der Acht-Stunden-Tag der gesetzliche
Referenzrahmen, allerdings kann die Arbeitszeit ohne Rechtfertigung
auf bis zu zehn Stunden täglich ausgeweitet werden, wenn innerhalb
von sechs Monaten ein Ausgleich erfolgt.
Darüber hinaus
lässt das Arbeitszeitgesetz zahlreiche branchen- bzw.
tätigkeitsbezogene Abweichungen und Ausnahmen zu, die auch in
erheblichem Umfang genutzt werden. Diese müssen aber transparent
geregelt sein durch einen Tarifvertrag, in einer
Betriebsvereinbarung oder durch behördliche Erlaubnis, wobei im
Regelfall ein entsprechender Zeitausgleich gewährleistet sein muss.
Trotz dieser erheblichen Gestaltungsmöglichkeiten argumentieren
Befürworter*innen einer generellen Deregulierung unter anderem mit
mehr Flexibilität, die nicht nur im Interesse von Arbeitgebern
sondern auch von Beschäftigten sei.
Weniger als 10 Prozent
der Befragten sehen mögliche Vorteile
Das sieht eine große
Mehrheit der potenziell Betroffenen jedoch ganz anders: 72,5 Prozent
jener befragten Arbeitnehmer*innen, die bislang noch nicht länger
als zehn Stunden an einzelnen Tagen in der Woche arbeiten, sagen,
dass auch schon einzelne derart lange Arbeitstage ihre Fähigkeit,
nach Feierabend abzuschalten und sich zu erholen, etwas bis deutlich
verschlechtern würden. Nur sechs Prozent erwarten eine Verbesserung.
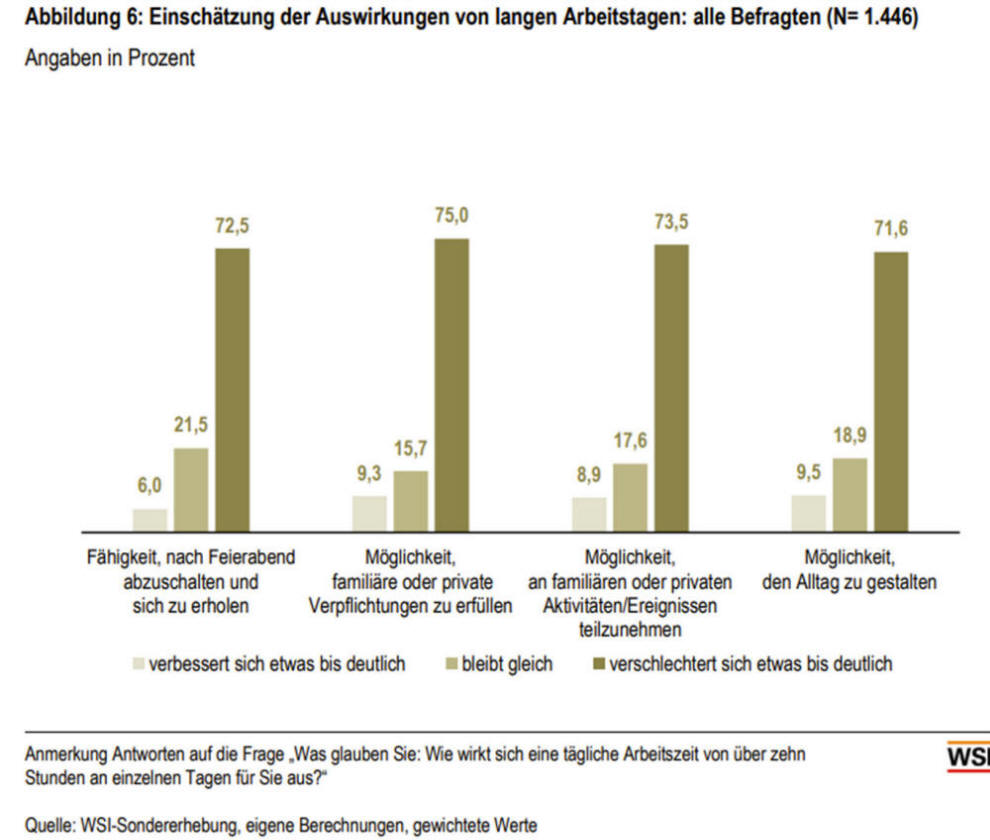
Die kritische Einschätzung deckt sich mit Erkenntnissen aus der
Arbeitsmedizin. Danach kommt es bei sehr langen täglichen
Arbeitszeiten langfristig häufiger zu stressbedingten Erkrankungen.
Es steigt sowohl das Risiko für psychische Leiden wie Burnout und
Erschöpfungszustände, als auch für körperliche Probleme, etwa
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zusätzlich wächst auch das Unfallrisiko
ab der 8. Arbeitsstunde exponentiell an, so dass Arbeitszeiten über
zehn Stunden täglich als hoch riskant eingestuft werden.
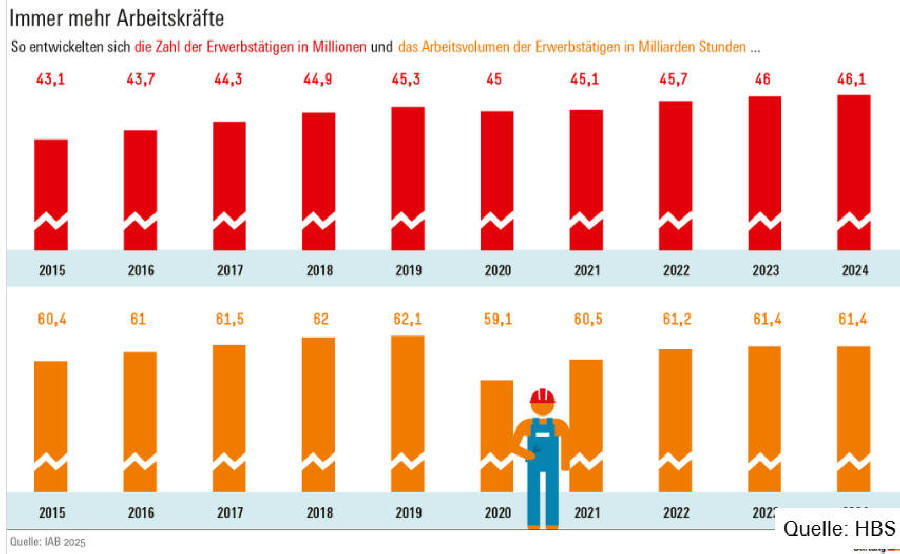
Sogar 75 Prozent der Befragten rechnen damit, dass Arbeitstage
über zehn Stunden für sie die Möglichkeit verschlechtern, familiäre
oder private Verpflichtungen zu erfüllen. 73,5 Prozent erwarten
negative Auswirkungen auf gemeinsame familiäre oder private
Aktivitäten, 71,6 Prozent sehen die Gestaltung ihres Alltags
erschwert. Der Anteil der Befragten, die hier Positives erwarten,
liegt jeweils unter zehn Prozent. „Eine Aufhebung der täglichen
Arbeitszeitgrenze droht, die Work-Life-Balance der Beschäftigten zu
verschlechtern“, fassen die WSI-Forscherinnen Lott und Peters die
Sicht der meisten Arbeitnehmer*innen zusammen.
Deregulierung
könnte Unwucht bei der Sorgearbeit noch weiter verschärfen – und so
Erwerbstätigkeit von Frauen behindern
Die Deregulierung könne
zudem Geschlechterungleichheiten verschärfen – weibliche
Beschäftigte befürchten noch häufiger Verschlechterungen als Männer.
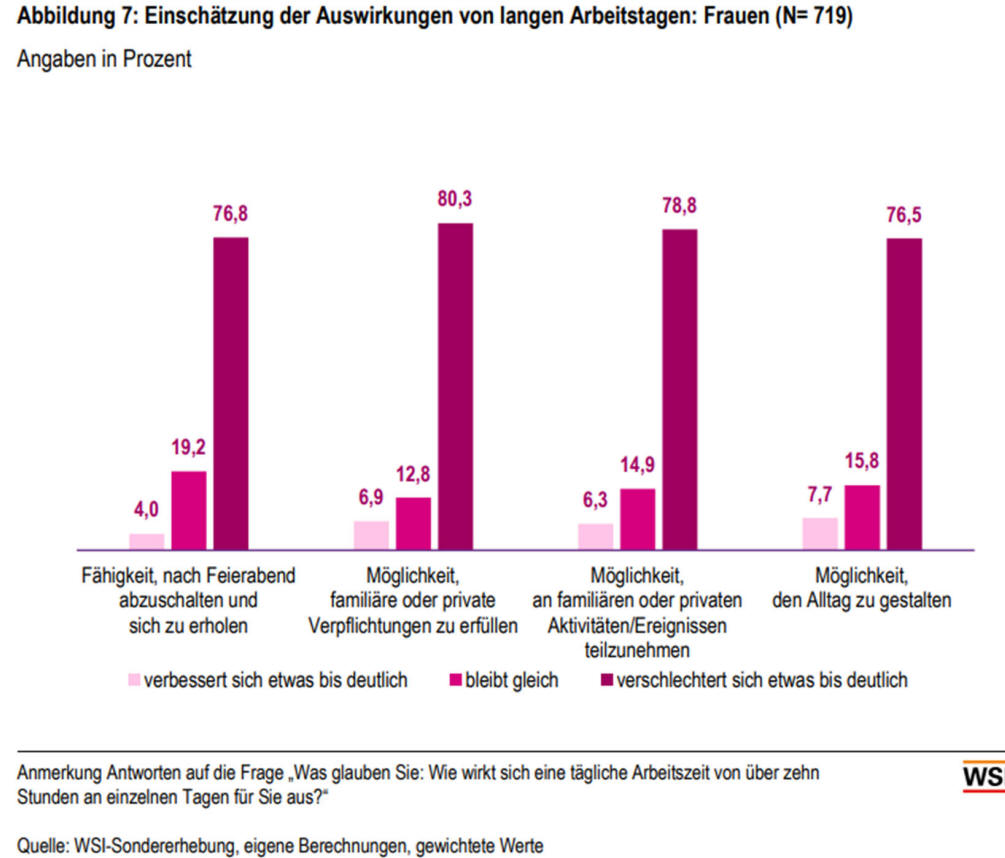
Ein wesentlicher Grund dürfte nach Analyse der WSI-Expertinnen
darin liegen, dass Frauen in Beziehungen neben ihrem Erwerbsjob
deutlich mehr als Männer unbezahlte Arbeit in Haushalt, Pflege von
Angehörigen oder mit Kindern leisten. Realistisch ist, dass diese
Unwucht weiter wächst, wenn der Partner künftig noch länger
arbeitet.
Das legen auch die Aussagen jener 12 Prozent der
Beschäftigten nahe, die bereits jetzt zumindest an einzelnen Tagen
in der Woche länger als zehn Stunden im Erwerbsjob arbeiten. 48
Prozent von ihnen berichten, dass am Abend die Partnerin oder der
Partner schon gelegentlich oder häufig bei Hausarbeiten oder der
Kinderbetreuung für sie einspringen mussten. Bei den Befragten ohne
Zehn-Stunden-Tage sagen das gut 17 Prozentpunkte weniger. Da die
befragten Männer fast doppelt so häufig wie die Frauen zumindest
gelegentlich mehr als 10 Stunden im Erwerbsjob arbeiten (15,4%
gegenüber 8 %), bleibt die häusliche Mehrarbeit vor allem an Frauen
hängen.
„Das ist nicht nur ein individuelles Problem der
direkt Betroffenen, sondern es macht es insbesondere Müttern noch
schwerer, ihre Arbeitszeit auszuweiten“, sagt Prof. Dr. Bettina
Kohlrausch, wissenschaftliche Direktorin des WSI. „Damit könnte die
Deregulierung der Höchstarbeitszeit ausgerechnet den Zuwachs bei der
Erwerbstätigkeit von Frauen bremsen, der in den vergangenen Jahren
wesentlich zu Rekordwerten bei Erwerbstätigkeit und Arbeitsvolumen
in Deutschland beigetragen hat.
Gleichzeitig könnte sie
Probleme bei Gesundheit und Demografie verschärfen, höhere
Krankenstände begünstigen und die Entscheidung für Kinder schwerer
machen. Die Deregulierung erscheint damit auch wirtschaftlich
kontraproduktiv.“
Ohnehin ist die Flexibilität, mit der
berufliche und private Anforderungen unter einen Hut gebracht werden
sollen, bereits jetzt hoch und offenbar mit dem geltenden
Arbeitszeitrecht vereinbar. So geben 37,6 Prozent der Befragten an,
dass es zumindest gelegentlich bei ihnen vorkommt, dass sie die
Arbeit tagsüber aus privaten Gründen für mehrere Stunden
unterbrechen und dafür nach 19 Uhr weiterarbeiten.
Wichtige
Gründe für Unterbrechungen sind Haushalt/Besorgungen,
Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen. Dass sie nach 19 Uhr die
Erwerbsarbeit fortsetzen, begründen 60 Prozent der Befragten mit
derart „fragmentierten“ Arbeitstagen damit, dass sie sonst nicht
ihre Arbeit schaffen würden. Jeweils ein gutes Drittel sagt zudem,
dass es die Arbeit erfordere, beispielsweise, weil sie mit
beruflichen Kontakten in anderen Zeitzonen kommunizieren müssen,
oder dass sie sonst nicht auf ihre Arbeitszeit kommen. Bei einem
knappen Viertel der Befragten, die nach 19 Uhr noch einmal loslegen,
erwarten das die Vorgesetzten.
Gut 60 Prozent der Befragten,
die zumindest gelegentlich nach 19 Uhr noch einmal die Erwerbsarbeit
aufgreifen, geben an, dass sie im Gegenzug „immer“ oder „meistens“
am Folgetag später mit der Arbeit beginnen können, weitere knapp 23
Prozent sagen, das sei „in Ausnahmefällen“ möglich. Wenn der
Arbeitsbeginn entsprechend später erfolgt, kann die im
Arbeitszeitgesetz vorgeschriebene und für die Gesundheit wichtige
Ruhezeit von 11 Stunden zwischen zwei Arbeitstagen eingehalten
werden.
Allerdings geben Beschäftigte mit „fragmentierten“
Arbeitstagen deutlich häufiger als andere an, dass abends die
Partnerin oder der Partner schon bei Haushalt oder Kinderbetreuung
für sie einspringen mussten. „Wir wissen auch aus anderen Studien,
dass fragmentierte Arbeitstage und Arbeit am Abend für viele
Beschäftigte bestenfalls eine Not- und keine Wunschlösung sind.
Häufig sind sie verbunden mit hohem Stress und Zeitdruck“, sagt
WSI-Arbeitszeitexpertin Yvonne Lott.
„Sie werden aber
genutzt, um Vereinbarkeitskonflikte zu entschärfen, und offenbar
funktioniert das mit dem aktuellen Arbeitszeitgesetz. Die von der
Bundesregierung angekündigte Deregulierung dürfte hingegen das
fragile Verhältnis von Flexibilität und notwendigen Begrenzungen aus
dem Gleichgewicht bringen, weil es gleichzeitig sehr lange und
fragmentierte Arbeitstage begünstigt.“
Anstelle der
Abschaffung der täglichen Arbeitszeitgrenze seien vielmehr Reformen
nötig, die Work-Life Balance und Partnerschaftlichkeit unterstützen,
analysieren die Wissenschaftler*innen. Zu den zentralen
arbeitszeitpolitischen Maßnahmen zählen sie:
- Die Verlängerung
der Partnermonate beim Elterngeld, wie im aktuellen
Koalitionsvertrag vorgesehen
- Bessere Rahmenbedingungen für
pflegende Angehörige, wie sie der Unabhängige Beirat für die
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf empfiehlt
- Eine Reform der
Brückenteilzeit, indem Schwellenwerte abgeschafft, individuelle
Arbeitszeitwünsche stärker berücksichtigt und flexible Anpassungen
während der Laufzeit ermöglicht werden
Da sich Zeitwünsche
und -bedarfe im Lebensverlauf der meisten Beschäftigten verändern,
brauche es darüber hinaus Arbeitszeitmodelle, die Beschäftigten mehr
Kontrolle über Dauer, Lage und Verteilung ihrer Arbeitszeit sowie
über den Arbeitsort ermöglichen.
Vortrag und
Diskussion zur Nachhaltigkeitsstrategie des Duisburger Hafens
Christina Rubach ist bei „duisport“ verantwortlich für
den klimafreundlichen Umbau des Duisburger Hafens. Am Montag, 22.
September 2025 stellt sie sich ab 18.30 Uhr im Maximilian-Haus,
Weinhagenstraße 25, 47119 Duisburg-Ruhrort der Diskussion und den
Fragen des Publikums. Es geht um die Nachhaltigkeitsstrategie des
Duisburger Hafens.

Christina Rubach (Foto: duisport.de) wird vorab berichten, warum der
Duisburger Hafen in herausgehobener Weise für die Organisation des
globalen Handels steht und warum Nachhaltigkeit für „duisport“ mehr
als Umweltschutz sei. „Unsere Verantwortung endet nicht beim
CO₂-Fußabdruck: Nachhaltigkeit ist mehr als Klimaschutz – unsere
Verantwortung geht weiter und schließt die Bereiche Soziales und
Unternehmensführung mit ein“ sagt Christina Rubach im Vorfeld der
Veranstaltung.
Der Eintritt ist frei, Anmeldungen sind
erbeten bei Dieter Zisenis (Mail: laboratorium@ekir.de) vom dem
„laboratorium“, dem evangelischen Zentrum für Arbeit, Bildung und
betriebliche Seelsorge der Evangelischen Kirchenkreise Dinslaken,
Duisburg, Moers und Wesel (www.ev-laboratorium.de).

NRW: Ausgaben der Eingliederungshilfe für Menschen mit
Behinderung um rund 13 % gestiegen
* 2024 wurden
7,2 Milliarden Euro für die Leistungen der Eingliederungshilfe
aufgebracht.
* Größte Ausgabeposten waren Assistenzleistungen.
* Zweitgrößte Ausgabeposten waren Leistungen in Werkstätten für
behinderte Menschen.
Im Jahr 2024 beliefen sich die Ausgaben
für Leistungen der Eingliederungshilfe nach Abzug der Einnahmen auf
7,2 Milliarden Euro. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen
als Statistisches Landesamt mitteilt, waren das 13,2 % mehr als ein
Jahr zuvor. Die Leistungen der Eingliederungshilfe sollen Menschen
mit Behinderung eine individuelle Lebensführung ermöglichen und die
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördern.
Assistenzleistungen waren der größte Ausgabeposten Für die
Leistungen zur sozialen Teilhabe wurden 2024 insgesamt
4,8 Milliarden Euro brutto aufgewendet. Den größten Teil dieser
Ausgaben machten die Assistenzleistungen zur selbstbestimmten und
eigenständigen Bewältigung des Alltags aus. Die Bruttoausgaben für
diese Leistungen betrugen 3,9 Milliarden Euro.
Im Jahr 2024
erhielten 140.570 Menschen Assistenzleistungen, das waren 0,8 % mehr
als im Vorjahr. Der Anstieg bei den Bruttoausgaben fiel mit 14,2 %
deutlich stärker aus. Zweitgrößte Ausgabenposition waren die
Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen Die
Ausgaben für die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben entfielen
zu 99,0 % auf die Leistungen in anerkannten Werkstätten für
behinderte Menschen.
2024 wurden für diese Leistungen
1,59 Milliarden Euro aufgewendet, das waren 2,2 % mehr als ein Jahr
zuvor. Die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen in
Werkstätten für behinderte Menschen lag 2024 bei 74.355 Menschen und
war damit um 0,5 % niedriger als im Vorjahr.
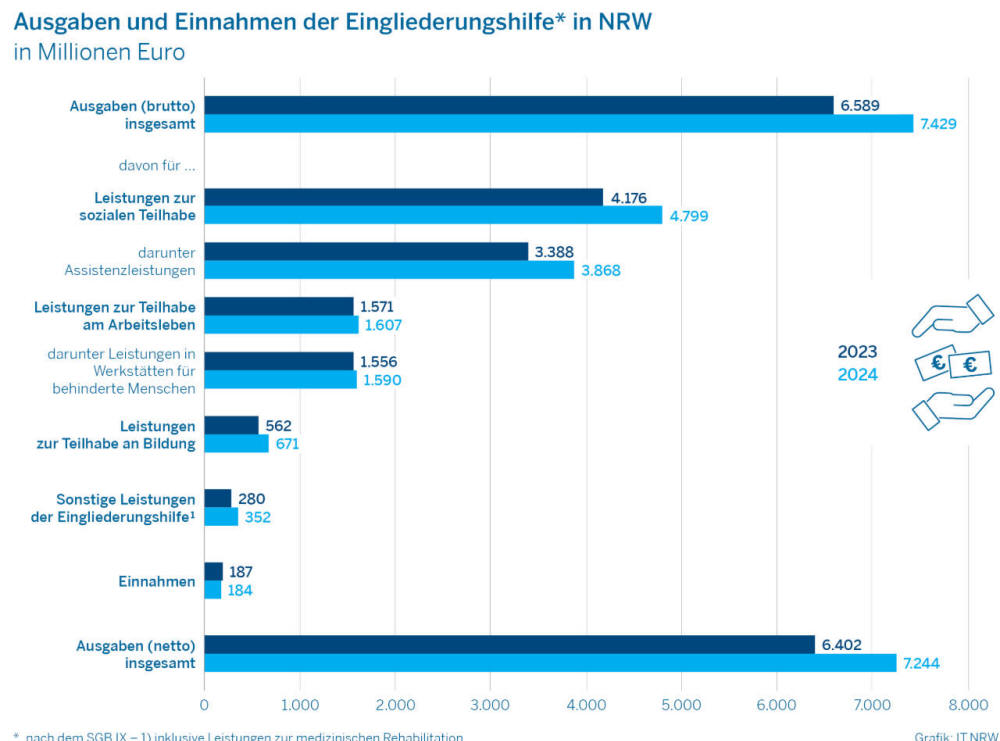
Leistungen zur Teilhabe an Bildung gestiegen
Die Ausgaben
für die Leistungen zur Teilhabe an Bildung lagen 2024 bei
671 Millionen Euro und damit um 19,4 % höher als 2023. Diese
Ausgaben wurden zu 74,8 % direkt von den nordrhein-westfälischen
Kommunen erbracht, die wesentlich für die
Eingliederungshilfeleistungen für Schülerinnen und Schüler zuständig
sind. Die Ausgaben für Leistungen der Eingliederungshilfe insgesamt
wurden nur zu 7,2 % direkt von den Kommunen und zu 92,8 % über die
Landschaftsverbände erbracht.
NRW: 17 % mehr
Unternehmensinsolvenzen im 1. Halbjahr 2025
* Zugleich
Rückgang bei den betroffenen Beschäftigten und den voraussichtlichen
Forderungen
* Wirtschaftsbereich „Handel; Instandhaltung und
Reparatur von KFZ“ am stärksten betroffen
Im 1. Halbjahr
2025 haben die Amtsgerichte in Nordrhein-Westfalen 3.190 beantragte
Unternehmensinsolvenzen gemeldet. Wie Information und Technik
Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, waren das
17,2 % mehr als im 1. Halbjahr 2024. Damals hatte es 2.722 gemeldete
Unternehmensinsolvenzen gegeben. Mit 3.427 Unternehmensinsolvenzen
hatten diese zuletzt im 1. Halbjahr 2016 ein höheres Niveau als
aktuell erreicht.
Nach Rückgängen bis zum 1. Halbjahr 2022
war die Zahl der Unternehmensinsolvenzen kontinuierlich gestiegen.
Es ist zu beachten, dass das Insolvenzgeschehen in den Jahren 2020
und 2021 von Sonderregelungen geprägt war. Unter anderem war infolge
der Corona-Pandemie die Insolvenzantragspflicht für Unternehmen
teilweise ausgesetzt.
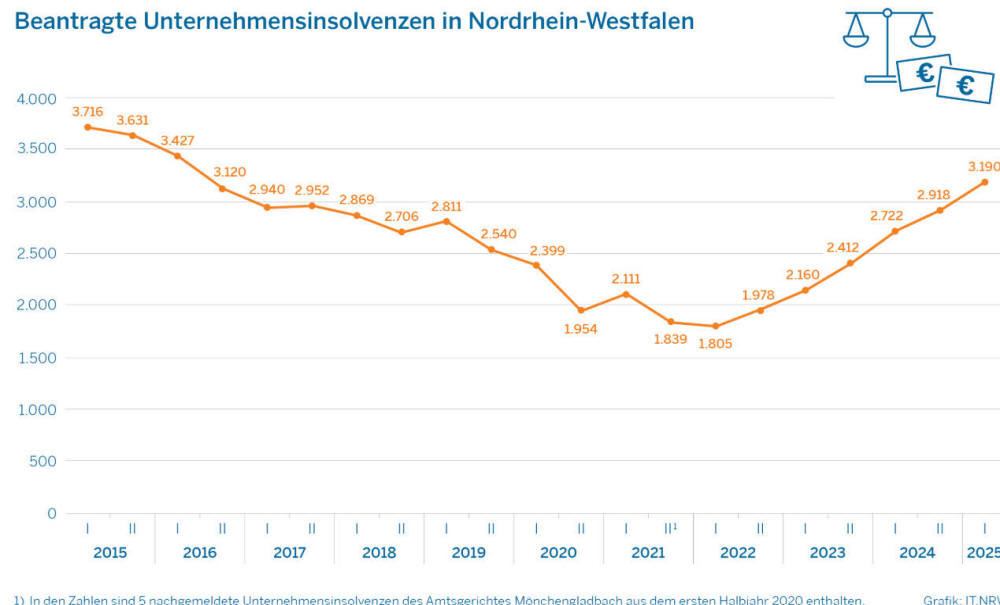
Über 21.000 betroffene Beschäftigte und 4,4 Milliarden
Euro an voraussichtlichen Forderungen
Die Zahl der im
1.Halbjahr 2025 von einer Unternehmensinsolvenz betroffenen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer lag insgesamt bei 21.274
Beschäftigten und damit um 46,4 % niedriger als im entsprechenden
Vorjahreszeitraum. Damals waren 39.683 Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer betroffen. Die Höhe der voraussichtlichen Forderungen
der Unternehmensinsolvenzen summierte sich im 1. Halbjahr 2025 auf
4,4 Milliarden Euro.
Damit waren die Forderungen um 54,0 %
niedriger als im Vorjahreshalbjahr. Damals hatte die Summe der
Forderungen bei 9,6 Milliarden Euro gelegen. Die Rückgänge bei den
betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie bei den
voraussichtlichen Forderungen bei zugleich steigenden
Unternehmensinsolvenzenzahlen deuten auf eine geringere Zahl von
Insolvenzanträgen wirtschaftlich bedeutender Unternehmen und
Unternehmensketten hin.
Höchste Zahl an
Unternehmensinsolvenzen im Wirtschaftsbereich „Handel;
Instandhaltung und Reparatur von KFZ“
Im 1. Halbjahr 2025 gab es
die meisten gemeldeten beantragten Insolvenzverfahren im
Wirtschaftsbereich „Handel; Instandhaltung und Reparatur von KFZ“.
Mit insgesamt 574 Verfahren lag die Zahl um 25,9 % über dem Wert des
entsprechenden Vorjahreszeitraums. An zweiter und dritter Stelle
folgten das „Baugewerbe“ mit 548 Verfahren und die „sonstigen
wirtschaftlichen Dienstleistungen“ mit 350 Verfahren.
Zum
letzteren Bereich gehören unter anderem der Garten- und
Landschaftsbau, Reisebüros und Wach- und Sicherheitsdienste. Nach
ersten Auswertungen lag im 1. Halbjahr 2025 der Großteil der
betroffenen Beschäftigten und der voraussichtlichen Forderungen im
Wirtschaftsbereich „Verarbeitendes Gewerbe“, in dem es 271 Verfahren
gab.
Gesamtzahl der Insolvenzen 9,4 % höher als im 1.
Halbjahr 2024
Die Gesamtzahl der gemeldeten Insolvenzverfahren
in NRW war im 1. Halbjahr 2025 mit 15.491 Verfahren um 9,4 % höher
als im entsprechenden Vorjahreszeitraum (1. Halbjahr 2024: 14.157
Verfahren). Neben den Unternehmensinsolvenzen gab es unter anderem
9.374 Verbraucherinsolvenzen, deren Zahl um 7,2 % gestiegen ist (1.
Halbjahr 2024: 8.748 Verfahren).