






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 43. Kalenderwoche:
20. Oktober
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Dienstag, 21. Oktober 2025
Thorsten Mieden ist neuer Bezirksdienstmitarbeiter für
Rheinhausen
Der Bezirksdienst beim Städtischen
Außendienst des Bürger- und Ordnungsamtes hat seinen Dienst
aufgenommen. Thorsten Mieden ist als einer der Ersten ab sofort für
den Stadtbezirk zuständig, der Rheinhausen umfasst: „Als
Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger, aber auch für
Gewerbetreibende, Vereine, Schulen und Kitas möchte ich ein Netzwerk
aufbauen, welches dem gesamten Bezirk Rheinhausen zugutekommt.“
Rheinhausen liegt auf der linken Rheinseite. Dort leben über 79.000
Einwohnerinnen und Einwohner auf rund 36 Quadratkilometern.
„Meinen Stadtbezirk würde ich als vielfältigen Ort beschreiben: ab
und an ruppig, idyllisch, aber auch grün. Die Rheinhausener sind
offen, ehrlich und direkt – das finde ich gut.“ Thorsten Mieden mag
die unterschiedlichen Seiten der Stadt: „Die Industriekultur, der
Rhein und seine Häfen, aber auch die Natur mit ihrer Seenvielfalt
und den Rheinauen – Duisburg hat viel zu bieten.“

Thorsten Mieden, Bezirksdienstmitarbeiter für den Stadtbezirk
Rheinhausen stellt sich auf dem Hochemmericher Markt den Bürgern und
Markthändlern vor. Fotos Tanja Pickartz / Stadt Duisburg
Der
44-Jährige war von 2018 bis 2025 beim Städtischen Außendienst des
Bürger- und Ordnungsamtes beschäftigt, bevor er zum Bezirksdienst
wechselte. Privat verbringt er gerne Zeit mit seinem vierjährigen
Neffen, kümmert sich um seine Eltern, liest viel und beschreibt sich
selbst als sehr technikaffin.
Der städtische Bezirksdienst
Die neuen
Bezirksdienstmitarbeitenden sind ab sofort täglich, weitestgehend zu
Fuß und uniformiert, in den verschiedenen Stadtteilen unterwegs, um
aktiv auf Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine und Gewerbetreibende
zuzugehen.
Zukünftig sollen in allen Duisburger
Stadtbezirken insgesamt zwei Bezirksdienstmitarbeitende unterwegs
sein. Neben der fußläufigen Sichtbarkeit der
Bezirksdienstmitarbeitenden im jeweiligen Stadtbezirk ist auch
geplant, regelmäßig Mobile Wachen, beispielsweise auf verschiedenen
Wochenmärkten sowie Infostände auf Stadtfesten anzubieten.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben dort die Möglichkeit ihre
Fragen und Anregungen loszuwerden. Außerdem soll die bestehende
Ordnungspartnerschaft durch gemeinsame Streifgänge mit den
Bezirksbeamten der Polizei weiter ausgebaut werden. Thorsten Mieden
kann – genau wie seine Kolleginnen und Kollegen vom Bezirksdienst –
jederzeit persönlich in den Stadtbezirken angesprochen werden.
Kontakt mit dem Bezirksdienst kann auch per E-Mail an
sad@stadtduisburg.de oder telefonisch unter 0203 283-3900 über die
Führungs- und Koordinierungsstelle des Bürger- und Ordnungsamtes
aufgenommen werden. Weitere Informationen online unter
www.duisburg.de/bezirksdienst.
„Tatort Duisburg“
1933–1945 – Die Stadt an Rhein und Ruhr während des
Nationalsozialismus: Führung zu Erinnerungsorten der NS-Verbrechen
Robin Richterich vom „Zentrum für Erinnerungskultur“
(ZfE) bietet am kommenden Samstag, 25. Oktober, um 15 Uhr eine
Außenführung zum Nationalsozialismus in Duisburg an.
Wie viele
Duisburgerinnen und Duisburger wählten die NSDAP? Was geschah mit
den Duisburger Jüdinnen und Juden? Gab es Widerstand gegen die
Nazis? Wie veränderte der Krieg die Stadt und gab es ein
Konzentrationslager in Duisburg?
Fragen, die bei einem
Rundgang durch die Innenstadt beantwortet und anhand von
Ortsbesuchen und biographischen Geschichten zu Menschen aus Duisburg
erläutert werden. Treffpunkt zur Führung ist am Stadtarchiv
Duisburg, Karmelplatz 5. Die Teilnahme ist kostenfrei. Das
vollständige Programm ist im Internet unter
www.stadtmuseum-duisburg.de abrufbar.
Sammelkarten-Tauschbörse im Bezirksrathaus Homberg
Zur
einer Sammelkarten-Tauschbörse lädt das Bezirksrathaus Homberg am
Mittwoch, 29. Oktober, von 16 bis 19 Uhr, am Bismarckplatz 1 ein.
Die Veranstaltung „KartenKiez“ bietet Sammlerinnen und Sammlern
aller Altersgruppen die Möglichkeit, ihre Karten in entspannter
Atmosphäre zu tauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Ob Pokémon,
Star Wars, Yu-GiOh!, Panini oder andere Sammelkarten – alle Formate
sind willkommen.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der
Eintritt ist kostenlos. Der kommerzielle Handel mit Sammelkarten ist
im Rahmen der Veranstaltung nicht gestattet. Für Rückfragen steht
das Team der Bezirksverwaltung Homberg/Ruhrort/Baerl telefonisch
(0203/283-8832) oder per E-Mail (kultur.homberg@stadt-duisburg.de)
zur Verfügung.
Führung im Stadtmuseum
Das Kultur- und Stadthistorische Museum lädt am Sonntag, 26.
Oktober, um 15 Uhr im Museum am Johannes-Corputius-Platz
(Innenhafen) zu einer Führung mit Harald Küst in der neuen
Dauerausstellung „Cash! Eine Geschichte des Geldes“. Die Ausstellung
eröffnet Einblicke in die Entwicklung eines der zentralen Elemente
unserer Gesellschaft: das Geld.
Von Messern und Muscheln
über Münzen und Papiergeld bis hin zur digitalen Revolution – die
Ausstellung führt die Gäste durch die faszinierende Geschichte des
Geldes und beleuchtet gleichzeitig hochaktuelle Themen, die uns alle
betreffen. Die Führung bleibt nicht in der Vergangenheit stehen:
Themen wie Inflation, Geldschöpfung, und die Frage nach der
Verteilung von Reichtum und Besitz werden ebenfalls besprochen – ein
Diskurs, der aktueller nicht sein könnte.
Die Veranstaltung
ist im Museumseintritt enthalten und kostet für Erwachsene 4,50
Euro, ermäßigt zwei Euro. Das vollständige Programm ist im Internet
unter www.stadtmuseum-duisburg.de abrufbar.
100. Kunde: Walsumer Betreuungsdienst Schlüter
knackt magische Grenze!
Jubel, Blumen, Sekt! Am 18.
Oktober 2025 war es so weit: Der Betreuungsdienst Schlüter feierte
seinen 100. Kunden. Der neue Kunde Günther Mette wurde von Inhaberin
Sara Schlüter und Mitarbeiterin Patrizia Eickhoff persönlich mit
einem Blumenstrauß empfangen – natürlich wurde auch angestoßen.
„Prost auf die 100!“
Noch im Frühjahr 2023 hätte Sara
Schlüter nie gedacht, dass sie einmal mit einem eigenen
Betreuungsdienst so erfolgreich sein würde. Die gelernte
Altenpflegerin arbeitete jahrelang in verschiedenen
Pflegeeinrichtungen – doch der Traum von der Selbstständigkeit ließ
sie nie los. „Als alleinerziehende Mutter war mir ein festes
Einkommen immer wichtiger als ein Risiko“, erzählt Schlüter ehrlich.
„Aber irgendwann dachte ich: Jetzt oder nie!“
Der Zufall half
mit: 2021 lernte sie Nachbar Simon Gerhardt kennen – auch er träumte
vom eigenen Unternehmen. Zusammen starteten sie erst den
Smartphone-Stammtisch „50plusdigital“ im Café B8LICH in Walsum. Doch
schnell merkten beide: Die Senioren brauchen mehr als nur Handyhilfe
– sie brauchen echte Unterstützung im Alltag. So war die Idee für
den Betreuungsdienst Schlüter geboren!
Am 24. März 2023
gründeten Schlüter und Gerhardt offiziell den Betreuungsdienst.
Heute – nur zweieinhalb Jahre später – beschäftigt der Dienst 12
Mitarbeiterinnen! Das Team betreut Kunden im gesamten Stadtbezirk
Walsum – von Alt-Walsum über Aldenrade bis Wehofen – und
mittlerweile auch in Hamborn und Dinslaken.
Nach Kunde Nummer
100 denkt die Powerfrau schon weiter: „Ich will bis Ende 2026 auf
150 Kunden wachsen!“, sagt Schlüter entschlossen. Um dieses Ziel zu
erreichen, richtet sie sich mit einer klaren Botschaft an die
Menschen in Duisburg und Umgebung: „Wer pflegebedürftig ist und
Unterstützung im Alltag benötigt, kann sich gerne jederzeit bei uns
melden! Wir freuen uns über jeden, den wir neu in der
‚Schlüter-Familie‘ begrüßen dürfen!“
Weitere Informationen
zum Betreuungsdienst Schlüter erhalten Sie auf der Website
www.betreuungsdienst-schlueter.de
Wenn die Blätter fallen – wer muss fegen?
Haftung bei Unfällen; Reinigungspflicht kann übertragen
werden
Viele genießen den goldenen Herbst, wenn das Laub
sich langsam verfärbt. Mit sinkenden Temperaturen verlieren Bäume
aber auch ihre Blätter, Niederschläge nehmen zu. Beides zusammen
verwandelt Bürgersteige in Rutschbahnen. Ohne Räumen ist ein Unfall
schnell passiert.
Wer zum Besen greifen muss, regeln die
meisten Kommunen in ihren Satzungen. Hier schreiben sie fest, ob und
in welchem Umfang sich Hauseigentümer um die Reinigung der
Bürgersteige kümmern müssen. Wer sich der Reinigungspflicht
dauerhaft entzieht, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Den Eigentümern
eines Mietshauses steht es offen, die Reinigungspflicht über den
Mietvertrag an die Mieter weiterzugeben.
Ereignet sich ein
Unfall, hat der nicht nur eine strafrechtliche Seite. Hier geht es,
wie die HUK-COBURG mitteilt, auch um persönliche Haftung. Bricht
sich ein Passant beispielsweise das Bein, weil vergessen wurde, die
Blätter wegzufegen, muss der Verantwortliche für den Schaden
aufkommen.

Gefährlich: Nasses Herbstlaub kann Bürgersteige schnell in rutschige
Flächen verwandeln.. Foto HUK
Ohne Haftpflichtversicherung
kann das teuer werden: Im geschilderten Fall können dem Geschädigten
Schmerzensgeld und falls er arbeitet auch eine Entschädigung für
seinen Verdienstausfall zustehen. Bleiben nach einem Unfall
dauerhafte Schäden zurück, können sogar lebenslange Rentenzahlungen
fällig werden.
Ob und in welchem Umfang ein säumiger
Laubräumer haftet, hängt allen Regeln zum Trotz oft von den
speziellen Umständen des Einzelfalls ab. Sollte der Geschädigte den
Rechtsweg beschreiten, steht die Haftpflichtversicherung ihrem
Kunden zur Seite.
Koalitionspläne zur Ausweitung der Mehrarbeit:
Steuerbefreiung von Überstundenzuschlägen bringt kaum Entlastung –
Beschäftigte mit niedrigeren Einkommen gehen weitgehend leer aus
Nach den Plänen der schwarz-roten Koalition sollen
Überstundenzuschläge künftig unter bestimmten Bedingungen steuerfrei
bleiben. Doch wie viele Menschen von der neuen Regelung profitieren
würden und wie hoch die Steuerersparnis ausfällt, war bisher unklar.
Eine neue Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen
Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung zeigt jetzt: Nur eine
verschwindend kleine Minderheit von 1,4 Prozent aller Beschäftigten
könnte sich künftig auf einen Steuerbonus freuen, der Rest geht leer
aus.*
Im Durchschnitt aller Beschäftigten in Deutschland
blieben deshalb nur 0,87 Euro pro Monat steuerfrei, die mittlere
Steuerersparnis fällt mit monatlich 0,31 Euro noch einmal dürftiger
aus. Gleichzeitig entfällt die Entlastung ganz überwiegend auf
Beschäftigte aus der oberen Hälfte der Entgeltverteilung. Die
Berechnungen des WSI beruhen auf der Verdiensterhebung des
Statistischen Bundesamtes vom April 2024, die detaillierte
Gehaltsdaten von rund 9,6 Millionen Beschäftigten enthält.
„In den Betrieben haben sich Arbeitszeitkonten durchgesetzt und
Mehrarbeit kann später durch Freizeit ausgeglichen werden“, so
Studienautor Dr. Malte Lübker. Nach den Ergebnissen der
IAB-Arbeitszeitrechnung verfällt zudem die Mehrheit der Überstunden
im engeren Sinne.
„Bezahlte Überstunden sind inzwischen eher
ein Randphänomen“, so Lübker. Laut Verdiensterhebung bekamen im
April 2024 nur 5,1 Prozent der Beschäftigten Überstunden ausbezahlt,
darunter waren 1,8 Prozent mit einem Überstundenzuschlag.
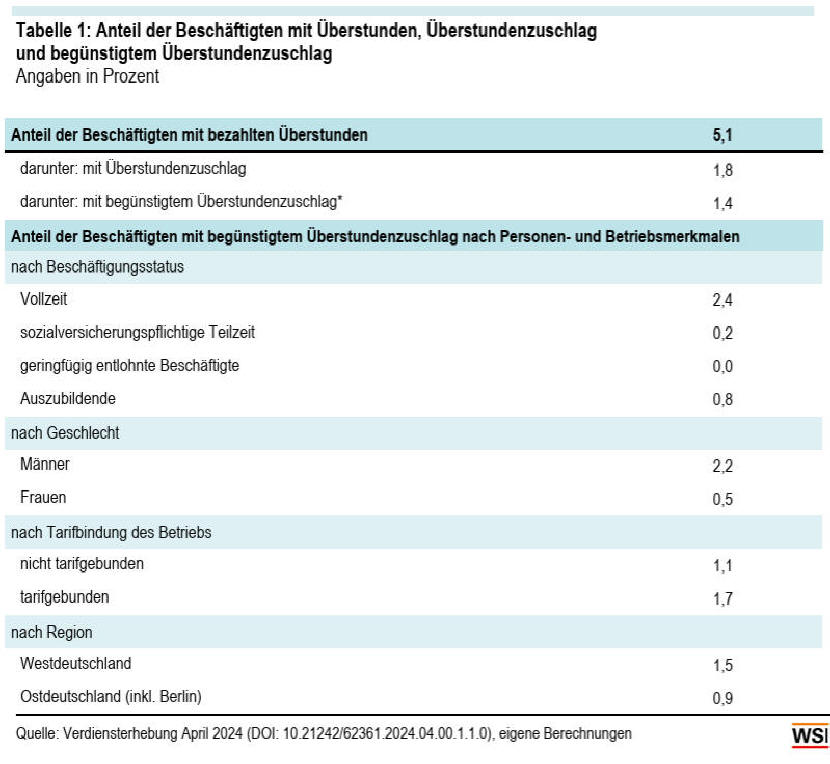
Nach den Koalitionsplänen sollen Überstunden jedoch nur
berücksichtigt werden, wenn diese über die normale Vollzeit
hinausgehen, sodass sich mit 1,4 Prozent ein noch kleinerer Kreis
von Begünstigten abzeichnet. Beschäftigte in Teilzeit erreichen die
Vollzeitschwelle auch inklusive Überstunden nur in Ausnahmefällen,
sodass von ihnen nur 0,2 Prozent einen Steuervorteil erwarten
können. Geringfügig Beschäftigte gehen leer aus. Deutlich häufiger
profitieren hingegen Vollzeitbeschäftigte (2,4 %).
Für
Beschäftigte mit Tarifvertrag (1,7 %) sind die Aussichten auf einen
Steuerbonus etwas besser, als wenn der Tarifvertrag fehlt (1,1 %).
Da Frauen in Deutschland häufiger in Teilzeit arbeiten als Männer,
würden unter ihnen nur 0,5 Prozent von der Steuerbefreiung
profitieren.
Bei Männern ergibt sich ein höherer Anteil von
2,2 Prozent. Deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern
zeigen sich auch bei der Höhe der freigestellten Beträge: Während
Männer künftig pro Monat durchschnittlich 1,46 Euro steuerfrei mit
nach Hause nehmen würden, sind es bei Frauen nur 0,23 Euro pro
Monat. Dies liegt nur zum Teil daran, dass Frauen aufgrund der
ungleichen Verteilung der Sorgearbeit weniger Überstunden machen als
Männer.
Entscheidend ist vielmehr, dass bei Frauen aufgrund
des Vollzeit-Erfordernisses nur rund die Hälfte (54 %) der
Überstunden mit Zuschlag unter das neue Steuerprivileg fallen würde.
Bei Männern sind es neun von zehn Überstunden mit Zuschlag (88 %).
Entgeltexperte Lübker sieht darin einen Beleg für die mittelbare
Diskriminierung von Frauen. Auch wenn die individuelle Entlastung
insgesamt sehr klein ist: Das Koalitionsvorhaben hat zudem
problematische Auswirkungen auf die Einkommensverteilung.
Rund 95 Prozent des Entlastungsvolumens käme Beschäftigten aus der
oberen Hälfte der Entgeltverteilung zugute, während auf die untere
Hälfte nur 5 Prozent der Gesamtsumme entfallen. Für
Arbeitnehmer*innen mit einem Bruttomonatsverdienst von bis zu 3.041
Euro beträgt die durchschnittliche Steuerersparnis gerade einmal 3
Cent pro Monat, für das Zehntel mit den höchsten Gehältern hingegen
1,18 Euro.
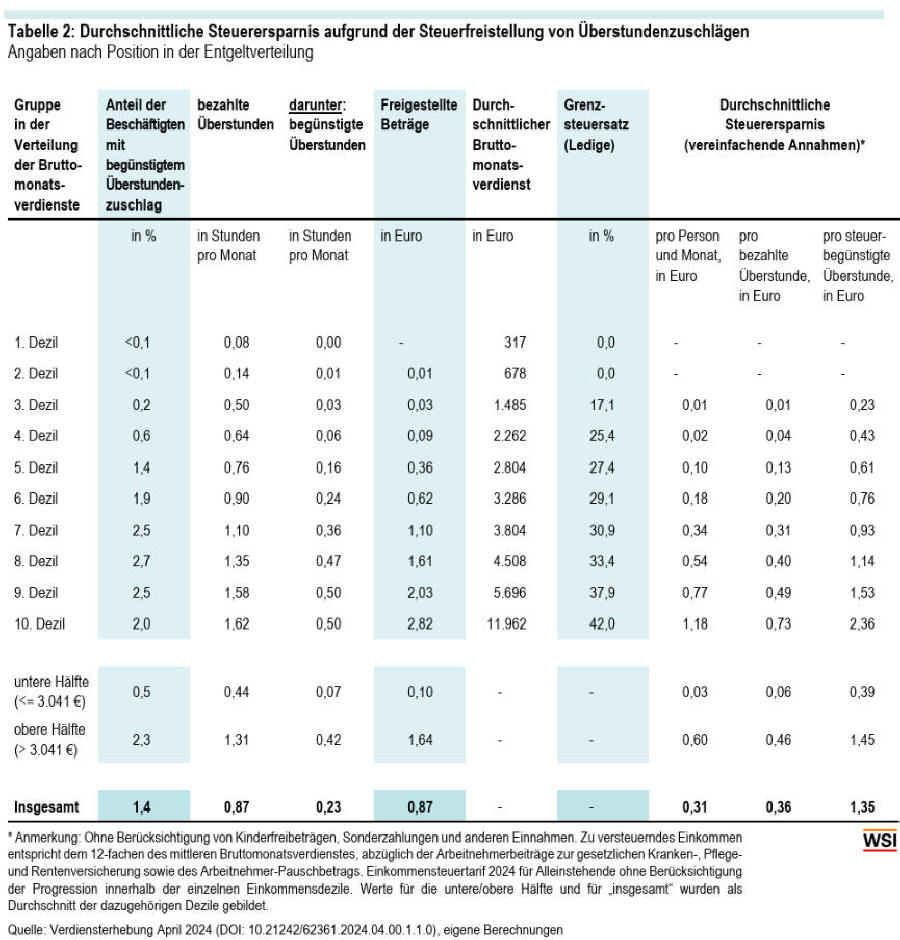
„Die neue Studie zeigt, wie sozial unausgewogen das Vorhaben
ist“, sagt Prof. Dr. Bettina Kohlrausch, Wissenschaftliche
Direktorin des WSI. „Statt eine breite Entlastung zu bewirken, würde
von dem Steuerprivileg in erster Linie eine kleine Gruppe von
Beschäftigten profitieren, die auch so ein auskömmliches Gehalt
haben. Das trägt weiter zur Ungleichheit in der Gesellschaft bei und
setzt ein falsches Signal.“
Das Vorhaben, das auf das
Wahlprogramm der CDU/CSU zurückgeht, war zuletzt auch vom
Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium der Finanzen scharf
kritisiert worden. Die Ökonom*innen hatten argumentiert, dass die
neue Regelung das Steuerrecht noch komplexer macht und erhebliche
Bürokratiekosten bei Arbeitgebern und in der Finanzverwaltung
verursachen würde. Außerdem bezweifelten sie, dass die
Steuerersparnis aufgrund ihrer geringen Höhe einen wirksamen Anreiz
für Mehrarbeit setzt.
Der Beirat war dabei unter großzügigen
Annahmen von einer Steuerersparnis von 3,50 Euro pro Überstunde
ausgegangen. Die neue WSI-Analyse zeigt, dass der Steuerbonus in der
Realität mit 1,35 Euro pro Überstunde deutlich geringer ausfallen
dürfte. Für Beschäftigte mit einem Bruttoverdienst von bis zu 3.041
Euro beläuft sich das durchschnittliche Plus beim Netto-Gehalt sogar
nur auf 0,39 Euro pro steuerbegünstigter Überstunde mit Zuschlag.
Grund dafür ist unter anderem, dass für Beschäftigte mit
geringerem Einkommen auch der Steuersatz geringer ist und
Überstundenzuschläge geringer ausfallen als bei Beschäftigten mit
höherem Einkommen. Handlungsbedarf besteht laut der neuen WSI-Studie
in anderen Bereichen. So verfällt derzeit nach der
IAB-Arbeitszeitrechnung mehr als die Hälfte aller geleisteten
Überstunden ohne Bezahlung und ohne Freizeitausgleich.
Um
dies zu verhindern, sollten laut Studie verbleibende Lücken in der
Arbeitszeiterfassung geschlossen werden. Zudem gibt es bei einigen
Arbeitgebern – beispielsweise im Polizeidienst des Landes
Nordrhein-Westfalen – die fragwürdige Praxis, auch bereits erfasste
Überstunden unter bestimmten Bedingungen wieder aus den
Arbeitszeitkonten zu löschen.
Trotzdem hat sich auf den
Arbeitszeitkonten in Deutschland inzwischen ein Berg von fast 500
Millionen bereits geleisteter Stunden im Wert von rund 9,5
Milliarden Euro angesammelt. „Wenn Beschäftigte in Bereichen mit
besonders hoher Arbeitsbelastung keine realistische Perspektive auf
Freizeitausgleich haben, kann es sinnvoll sein, die Zeitguthaben
auszuzahlen“, so Lübker. „Ob ein etwaiger Überstundenzuschlag dabei
steuerfrei bleibt oder nicht, ist für die Beschäftigten eher
zweitrangig.“
Bundesausschuss passt Häusliche Krankenpflege-Richtlinie nach
Hinweisen aus der Versorgung an
Nach verschiedenen Hinweisen von Vertragsärztinnen und -ärzten sowie
von Stellungnahmeberechtigten hat der Gemeinsame Bundesausschuss
(G-BA) seine Häusliche Krankenpflege-Richtlinie angepasst.
Der G-BA stellte klar, dass die Verantwortung für die
Durchführung der verordneten Maßnahmen der Behandlungspflege
bei den Pflegekräften resp. Pflegefachkräften liegt.
Folgerichtig wurde der bisher verwendete Begriff „delegieren“
durch „übertragen“ ersetzt.
Damit zeichnet der G-BA die
bestehende Rechtslage nach und schafft Klarheit. Außerdem
streicht der G-BA die in dieser Richtlinie nicht mehr nötigen
Übergangsregelungen zur außerklinischen Intensivpflege sowie
die Sonderregelungen im Zusammenhang mit der
COVID-19-Epidemie.
Angepasst wurde auch das
Leistungsverzeichnis der verordnungsfähigen Maßnahmen der
häuslichen Krankenpflege. Beispielhaft zu nennen sind diese
Änderungen:
Neu fügte der G-BA als Nummer 32 die
„(POCT-)INR-Messung zur Anpassung der
Antikoagulationstherapie“ (Gerinnungskontrolle) ein.
Bei Patientinnen und Patienten, die blutverdünnende
Vitamin-A-Antagonisten erhalten, sollen Pflegekräfte resp.
Pflegefachkräfte den Gerinnungswert des Blutes mit einem
zuvor ärztlich verordneten Messgerät (Koagulometer) ermitteln
und bewerten. Dafür soll auf den International Normalized
Ratio (INR) zurückgegriffen werden, einem Wert für die
Gerinnungsdauer des Blutes. Geregelt werden zudem die
Durchführung, die Verordnungsvoraussetzungen sowie die Dauer
und die Häufigkeit der Maßnahme.
In der
Leistungsnummer 16 „Infusionen i. v.“ wurde bei den Vorgaben
zur parenteralen Ernährung klargestellt, dass die alleinige
Flüssigkeitssubstitution und die alleinige parenterale
Ernährung, gegebenenfalls inklusive der bedarfsabhängigen
Zugabe von Vitaminen und Spurenelementen, Leistungen der
häuslichen Krankenpflege sein können.
Aus der
Leistungsnummer 6 wurde die „Bronchialtoilette
(Bronchiallavage)“ gestrichen; da die Leistungsgruppe
allgemein Maßnahmen zum Absaugen umfasst, muss die
Bronchialtoilette nicht gesondert dargestellt werden. Die
mittels Bronchoskop durchgeführte Bronchiallavage hingegen
stellt eine ärztliche Leistung dar, die als risikobehafteter
Eingriff nicht an Pflegefachpersonen übertragbar ist.
In der Leistungsnummer 26.2 wurde im Hinblick auf
Einreibungen der Haut mit ärztlich verordneten Medikamenten
klarer formuliert, dass es auf den akut
behandlungsbedürftigen Zustand der dermatologischen
Erkrankung ankommt, nicht darauf, dass es sich um eine
ausschließlich akut auftretende Erkrankung handeln muss.
HANDVERLESEN | Edgar Hilsenrath – Ich bin nicht Ranek
Helmut Braun liest aus seiner Hilsenrath-Biografie und berichtet
über die Begegnungen mit dem Literaten.
Spannend und einfühlsam
zeichnet Helmut Braun die Lebenslinien des deutschsprachigen Juden
Edgar Hilsenrath und verknüpft Leben und Werk dieses sprachmächtigen
Erzählers zu einem Bild, in dem auch die gewaltigen Verwerfungen des
20. Jahrhunderts aufscheinen. Ein 1926 in Deutschland geborener Jude
hatte wenig Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten.
Die
Alternativen in Nazideutschland waren: Emigrieren oder deportiert
werden. Dass einer den Krieg in Deutschland überlebte, war möglich,
aber unwahrscheinlich. So ist es im Prolog des Romans 'Fuck America
– Bronskys Geständnis' von Edgar Hilsenrath nachzulesen. Er wurde
deportiert und dank einer Reihe glücklicher Fügungen überlebte er,
emigrierte nachträglich in die USA und schrieb sich mit dem
Ghettoroman 'Nacht' die erlittenen Traumata von der Seele. So begann
eine im höchsten Maße ungewöhnliche Schriftstellerkarriere.
Edgar Hilsenrath und Helmut Braun sind seit 1977, seit im
Literarischen Verlag Braun in Köln der bitterböse, satirische Roman
‚Der Nazi & der Friseur‘ erschien, befreundet. Im Laufe von 26
Jahren hat der Autor seinem Biografen seine Sicht der Geschehnisse,
seine Wahrnehmungen berichtet, gewichtet, gewertet.
Zusätzlich
hat Helmut Braun eine Vielzahl von Interviews und autobiografische
Texte Hilsenraths ausgewertet und den umfangreichen Vorlass des
Schriftstellers gesichtet, der mittlerweile an die Akademie der
Künste in Berlin übergeben wurde.
Dokumente, Briefe, Fotos,
Medien- und Zeitzeugenberichte, auch wissenschaftliche Arbeiten
bilden das Fundament dieser Biografie. Die Erinnerungen des
Biografen an gemeinsame Erlebnisse mit Edgar Hilsenrath und Texte,
die autobiografische Einschübe in seinen Romanen sind oder sein
könnten, ergänzen den biografischen Bericht und stellen immer wieder
die Fakten in Frage; denn: was sind schon Fakten, wenn ein Leben zu
erzählen ist.
HANDVERLESEN | Edgar Hilsenrath – Ich bin
nicht Ranek
Donnerstag, 23. Oktober 2025, 19:00 Uhr
Das PLUS
am Neumarkt, Neumarkt 19, 47119 Duisburg-Ruhrort
Eintritt
frei(willig) – Hutveranstaltung
Kirchen und Stadt
gedenken der Menschen, die in Duisburg anonym bestattet wurden -
Gottesdienst für „Unbedachte“ in Salvator am 21. Oktober
Auch in diesem Jahr feiern die christlichen Kirchen in Duisburg
gemeinsam mit der Stadt Duisburg einen ökumenischen
Gedenkgottesdienst für die „Unbedachten dieser Stadt“: Am Dienstag,
21. Oktober 2025, wird um 15 Uhr in der Salvatorkirche, am Burgplatz
neben dem Rathaus, jener Verstorbenen gedacht, die auf Veranlassung
des städtischen Ordnungsamtes bestattet wurden.
Stadt und
Kirchen möchten mit diesen Gottesdiensten - im März 2011 fand der
erste dieser Art statt - ein Zeichen mit-menschlicher Verbundenheit
setzen und laden alle Mitbürgerinnen und Mitbürger zu der
Gedächtnisfeier ein. Den Gedenkgottesdienst gestalten Lutz Peller,
der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen
Duisburg, Pfarrer Dr. Christoph Urban, Superintendent des
Evangelischen Kirchenkreises Duisburg, Pfarrer Andreas Brocke,
Stadtdechant der Katholischen Kirche Duisburg, sowie Bürgermeisterin
Edeltraud Klabuhn als Vertreterin der Stadt Duisburg. Es predigt
Superintendent Urban.
Die Duisburger Tageszeitungen
unterstützen diese Form des Gedenkens mit der Schaltung einer
kostenlosen Traueranzeige, in der die Namen der Verstorbenen
aufgeführt sind. In Duisburg werden in jedem Jahr etwa 400
Verstorbene im Rahmen einer ordnungsbehördlichen Bestattung
beerdigt. Seit Oktober 2024 fand für 23 dieser Verstorbenen keine
Trauerfeier statt, da sie keiner Religionsgemeinschaft angehörten
und auch keine Angehörigen bzw. Nachbarn vorhanden waren, die eine
entsprechende Feier wünschten.
An das Leben der Menschen,
derer niemand gedacht hat, gibt es keine Erinnerung. Im
Gedenkgottesdienst werden die Namen der Verstorbenen vorgelesen und
auf dem Altar für jeden ein Teelicht entzündet. Das Blatt mit den
Namen wird in eine Vitrine gelegt, in weiteren Gottesdiensten kommen
Blätter hinzu, die dann zu einem „Buch des Lebens“ gebunden werden.
Damit soll ein Zeichen gesetzt werden: Bei Gott wird keiner
vergessen, jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes und deshalb
einmalig, unverwechselbar und unverlierbar. Bei Gott ist kein Mensch
„unbedacht“.

Salvatorkirche und Rathauss Duisburg (Foto: Rolf Schotsch).
Fesselnder Literaturabend im Begegnungscafé
Gemeinde lädt zur Duisburg-Krimi-Lesung
Engagierte der
Evangelischen Kirchengemeinde Duisburg Meiderich servieren im
Begegnungscafé „Die Ecke“, Horststr. 44a, regelmäßig auch kulturelle
Leckerbissen. Den nächsten literarischen Happen gibt es am Dienstag,
21. Oktober 2025 um 19 Uhr, wenn Helga Dittrich und Elke Klüpfel
Autor Dieter Kaspers begrüßen. Er liest aus seinem historischen
Duisburg-Krimi „Kommissar Greulichs Witterung“.
Der Roman
erzählt von einer Mordserie und schwierigen Ermittlungen in den
frühen 1950er-Jahren, in denen Kripo-Beamte mit einen Festgenommenen
auch schon mal zu Fuß oder in der Straßenbahn unterwegs sind. Das
Team des Begegnungscafés lädt zu einer spannende Zeitreise - nicht
für Krimibegeisterte und Fans der Stadtgeschichte. Der Eintritt ist
frei.
Mehr Infos hat Yvonne de Temple-Hannappel, die
Leiterin des Begegnungscafés (Tel. 0203 45 57 92 70, E-Mail:
detemple-hannappel@gmx.de). Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter
www.kirche-meiderich.de.

Helga Dittrich, die im Literaturcafé Meiderich vorliest (Foto:
www.kirche-meiderich.de).

Exporte von Eisen und Stahl sinken in den ersten acht
Monaten des Jahres 2025 um 4,8 %
• Eisen- und
Stahlexporte in die USA weniger stark gesunken als die deutschen
Eisen- und Stahlexporte insgesamt
• 6,2 % aller Exporte von
Eisen und Stahl gehen in die USA
• Wichtigstes Zielland für
deutsche Eisen- und Stahlexporte ist Polen
Seit dem 12. März 2025 erheben die USA für den Import von
Eisen, Stahl und Aluminium sowie Waren daraus Zusatzzölle in Höhe
von 25 %. Seit dem 4. Juni 2025 betragen die Zusatzzölle 50 %. Wie
das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden von Januar
bis August 2025 Eisen und Stahl sowie Waren daraus im Wert von 2,5
Milliarden Euro aus Deutschland in die Vereinigten Staaten
exportiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sanken die
Exporte dieser Handelsgüter in die USA um 2,3 %. Damit sanken die
Eisen- und Stahlexporte in die USA in den ersten acht Monaten 2025
weniger stark als die deutschen Eisen- und Stahlexporte insgesamt,
die gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,8 % auf 39,9 Milliarden
Euro zurückgingen. Dies ist der niedrigste Wert für die ersten acht
Monate eines Jahres seit dem Jahr 2021, als Eisen- und Stahlprodukte
im Wert von 36,7 Milliarden Euro exportiert wurden.
6,2 % aller deutschen Eisen- und Stahlexporte gehen in die USA
Insgesamt gingen 6,2 % der deutschen Eisen- und Stahlexporte von
Januar bis August 2025 in die USA. Damit lagen die Vereinigten
Staaten auf Rang 6 der wichtigsten Abnehmerstaaten dieser
Handelsgüter. Die meisten deutschen Eisen- und Stahlexporte wurden
in Staaten der Europäischen Union (EU) geliefert.
Rang 1
belegte Polen mit 3,7 Milliarden Euro oder 9,3 % aller Eisen- und
Stahlexporte, danach folgten Frankreich (3,2 Milliarden Euro
beziehungsweise 8,1 %) und die Niederlande (3,0 Milliarden Euro
beziehungsweise 7,6 %).
Im gesamten Jahr 2024 hatte
Deutschland Eisen und Stahl sowie Waren daraus im Wert von
60,6 Milliarden Euro exportiert. Die Vereinigten Staaten lagen dabei
mit 3,8 Milliarden Euro oder 6,2 % der Gesamtexporte im Jahr 2024
auf Rang 5 der wichtigsten Abnehmerstaaten.
Importe von
Eisen und Stahl in den ersten acht Monaten 2025 insgesamt rückläufig
Nach Deutschland importiert wurden in den ersten acht Monaten 2025
Eisen und Stahl im Wert von 34,0 Milliarden Euro. Das waren 2,7 %
weniger als im Vorjahreszeitraum (darunter USA: 555 Millionen Euro;
+7,6 %). Damit fielen die Eisen- und Stahlimporte in den ersten acht
Monaten 2025 auf den niedrigsten Stand seit 2020: Von Januar bis
August 2020 wurden Eisen und Stahl sowie Waren daraus im Wert von
25,2 Milliarden Euro nach Deutschland importiert.
Wichtigstes Herkunftsland von Eisen- und Stahlimporten war von
Januar bis August 2025 Italien. Von dort kamen 3,9 Milliarden Euro
beziehungsweise 11,4 % der Importe dieser Handelsgüter. Auf Rang 2
und 3 befanden sich Österreich (3,1 Milliarden Euro beziehungsweise
9,0 %) und China (3,0 Milliarden Euro beziehungsweise 8,9 %).
Aluminiumexporte in die USA sinken um 7,4 % zum
Vorjahreszeitraum
In den ersten acht Monaten 2025 exportierte
Deutschland Aluminium und Waren daraus im Wert von insgesamt
12,6 Milliarden Euro. Das waren 5,1 % mehr als im Vorjahreszeitraum.
Mengenmäßig gingen im gleichen Zeitraum die Exporte dieser Güter um
0,2 % zum Vorjahr zurück.
In die Vereinigten Staaten wurden
Aluminium und Waren daraus im Wert von 419 Millionen Euro geliefert.
Das entsprach einem Rückgang um 7,4 % gegenüber dem
Vorjahreszeitraum und einem wertmäßigen Anteil von 3,3 % an den
gesamten deutschen Aluminiumexporten. Die USA lagen damit auf
Rang 10 der wichtigsten Abnehmerstaaten dieser Handelsgüter.
Wie bei Eisen und Stahl gingen auch bei Aluminium und Waren
daraus die meisten Exporte in EU-Mitgliedstaaten, vor allem nach
Frankreich (1,2 Milliarden Euro beziehungsweise 9,7 % der gesamten
Aluminiumexporte), Österreich (1,2 Milliarden Euro beziehungsweise
9,4 %) und Polen (1,1 Milliarden Euro beziehungsweise 9,1 %).
In den ersten acht Monaten des Jahres 2025 importierte
Deutschland Aluminium und Waren daraus im Wert von 13,8 Milliarden
Euro. Das waren 5,0 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Mengenmäßig
gingen die Aluminiumimporte um 1,6 % zurück. Wichtigste
Herkunftsländer für Aluminium und Waren daraus waren in den ersten
acht Monaten 2025 die Niederlande (1,4 Milliarden Euro
beziehungsweise 9,8 % der gesamtem Aluminiumimporte), Österreich
(1,2 Milliarden Euro beziehungsweise 8,7 %) und Italien
(1,1 Milliarden Euro beziehungsweise 8,0 %).
Auftragsbestand im
Verarbeitenden Gewerbe im August 2025: +0,1 % zum Vormonat
August 2025 +0,1 % real zum Vormonat (kalender- und
saisonbereinigt)
+5,0 % real zum Vorjahresmonat
(kalenderbereinigt)
Reichweite des Auftragsbestands 7,9 Monate
Der reale (preisbereinigte) Auftragsbestand im
Verarbeitenden Gewerbe ist nach vorläufigen Ergebnissen des
Statistischen Bundesamtes (Destatis) im August 2025 gegenüber
Juli 2025 saison- und kalenderbereinigt um 0,1 % gestiegen. Im
Vergleich zum Vorjahresmonat August 2024 stieg der Auftragsbestand
kalenderbereinigt um 5,0 %.
Die leicht positive Entwicklung des Auftragsbestands gegenüber dem
Vormonat ist auf Anstiege im Maschinenbau (saison- und
kalenderbereinigt +1,1 %) und im Sonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge,
Schiffe, Züge, Militärfahrzeuge) mit +0,9 % zum Vormonat
zurückzuführen.
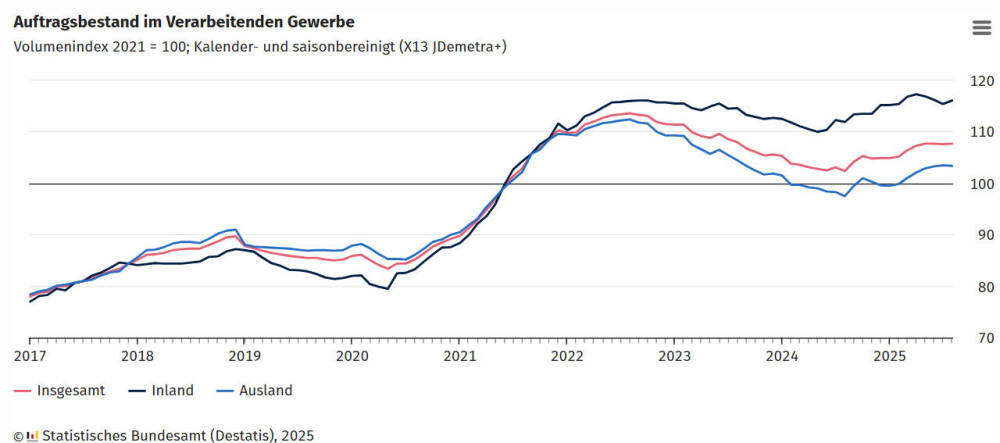
Negativ auf das Gesamtergebnis wirkte sich hingegen der Rückgang in
der Automobilindustrie mit -5,1 % aus. Die offenen Aufträge aus dem
Inland stiegen im August 2025 gegenüber Juli 2025 um 0,6 %, der
Bestand an Aufträgen aus dem Ausland fiel hingegen um 0,1 %. Bei den
Herstellern von Vorleistungsgütern stieg der Auftragsbestand zum
Vormonat Juli 2025 um 1,3 %.
Bei den Herstellern von
Investitionsgütern sank er um 0,1 %, bei den Herstellern im Bereich
der Konsumgüter sank er um 0,4 %. Reichweite des Auftragsbestands
auf 7,9 Monate gestiegen Im August 2025 stieg die Reichweite des
Auftragsbestands auf 7,9 Monate (Juli 2025: 7,8 Monate).
Bei
den Herstellern von Investitionsgütern blieb die Reichweite konstant
bei 10,7 Monaten, bei den Herstellern von Vorleistungsgütern bei
4,3 Monaten und bei den Herstellern von Konsumgütern bei
3,6 Monaten.
Die Reichweite gibt an, wie viele Monate die
Betriebe bei gleichbleibendem Umsatz ohne neue Auftragseingänge
theoretisch produzieren müssten, um die vorhandenen Aufträge
abzuarbeiten. Sie wird als Quotient aus aktuellem Auftragsbestand
und mittlerem Umsatz der vergangenen zwölf Monate im betreffenden
Wirtschaftszweig berechnet.