






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 43. Kalenderwoche:
23. Oktober
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
 Umstellung auf Winterzeit:
26.10.2025
Uhr-Umstellung von 3 Uhr auf 2 Uhr.
Umstellung auf Winterzeit:
26.10.2025
Uhr-Umstellung von 3 Uhr auf 2 Uhr.Freitag, 24. Oktober 2025
Stadtbibliothek Duisburg feiert den „Tag der Bibliotheken“
Die Zentralbibliothek lädt anlässlich des bundesweiten
„Tags der Bibliotheken“ am Freitag, 24. Oktober, von 11 bis 18.30
Uhr im Stadtfenster an der Steinschen Gasse 26 in der Stadtmitte zu
einem abwechslungsreichen Aktionstag ein. Besucherinnen und Besucher
erwartet ein buntes Programm, das zeigt, wie modern, kreativ und
lebendig Bibliothek heute ist. Gleich zu Beginn, ab 11 Uhr, heißt
es: „Entdecken Sie das Bibliotheksuniversum!“
Bei einer
spannenden Smartphone-Rallye durch die Bibliothek können Gäste auf
eigene Faust Fragen lösen und die vielseitigen Angebote der
Bibliothek spielerisch kennenlernen. Im Foyer präsentiert das Team
von „Libby“ zwischen 11 und 17 Uhr die beliebte App für Hörbücher
und englischsprachige Medien. Hier erfahren Interessierte aus erster
Hand, wie einfach digitale Medien mit dem Smartphone oder Tablet
genutzt werden können.
Ein besonderes Highlight ist der
ganztägige Medientrödel. Hier werden liebevoll verpackte Buchpakete
für kleines Geld angeboten. Der gesamte Erlös kommt der Duisburger
Bibliotheksstiftung zugute. Wer die Bibliothek einmal vollständig
erkunden möchte, kann um 11 Uhr oder 14 Uhr an einer Führung durch
die Bibliothek teilnehmen.
In rund 60 Minuten erfahren die
Besucherinnen und Besucher Wissenswertes über die vielfältigen
Medien, Services und Projekte der Stadtbibliothek Duisburg.
Treffpunkt ist jeweils das Foyer. Technikinteressierte können in der
„Machbar“ auf der dritten Etage den Schneideplotter kennenlernen.
Bei den offenen Schnupperstunden um 11 Uhr, 14 Uhr sowie um 17 Uhr
lassen sich eigene kleine Projekte wie Aufkleber oder Beschriftungen
gestalten – Kreativität ausdrücklich erwünscht.
Musikliebhaber kommen zwischen 14 und 16 Uhr auf ihre Kosten: Die
Bibliothek der Dinge präsentiert im Foyer ihren „klangvollen
Bestand“ an Musikinstrumenten. Ob Zupfen, Streichen oder Trommeln –
hier darf ausprobiert werden. Zum Ausklang des Tages lädt der neue
Duisburger Sachbuchzirkel von 17 bis 18.30 Uhr in die zweite Etage
ein.
Hier können Sachbuchfans ihre Lieblingsbücher
vorstellen oder einfach bei inspirierenden Gesprächen zuhören. Der
Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. Weitere Informationen:
www.stadtbibliothek-duisburg.de.

Städtische Bibliothek im Stadtfenster 2014 - BZ-Foto haje

Die alte Stadtbibliothek (ehemals DeFaKa-Haus - Deutsches Familien Kaufhaus) im Winter 2013 - BZ-Foto haje
Tag der Bibliotheken: Bundesweit
befand sich fast jede fünfte Bibliothek in NRW
* 2023
gab es über 1.700 Bibliotheken in NRW.
* Rückgang der Zahl der
Bibliotheken und Beschäftigten im Zeitvergleich.
* Zuwachs bei
Auszubildenden und Studierenden im Bibliothekswesen.
Über
1.700 Bibliotheken waren im Jahr 2023 laut einer freiwilligen
Erhebung der Deutschen Bibliotheksstatistik in Nordrhein-Westfalen
angesiedelt. Wie das StatistischesLandesamt anlässlich des 30. „Tags
der Bibliotheken” am 24. Oktober mitteilt, befand sich damit fast
jede fünfte der bundesweit rund 9.100 Bibliotheken in NRW.
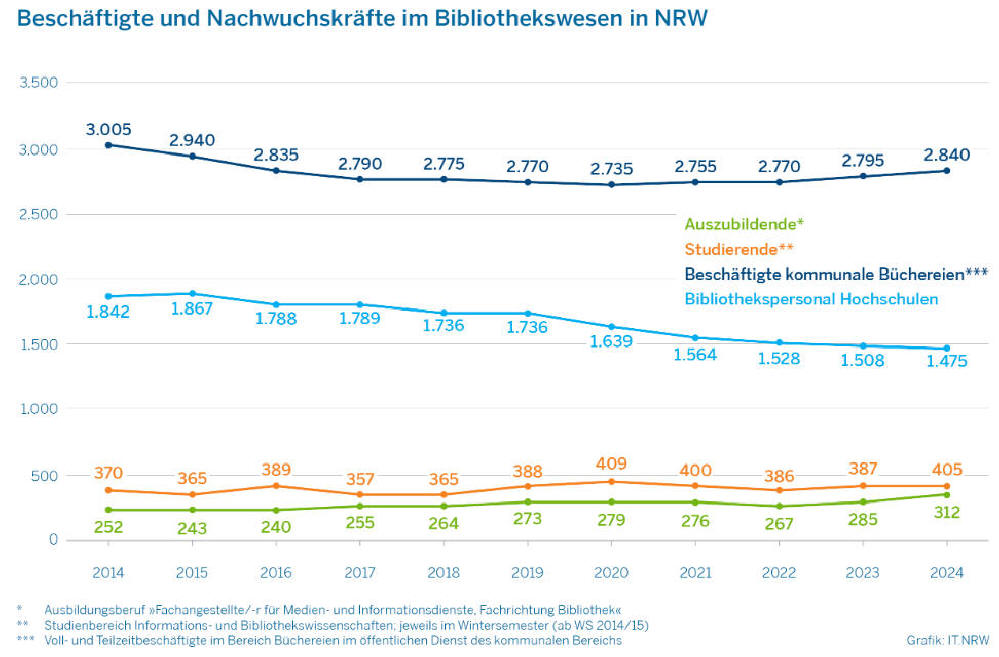
Bei fast 90 % der Einrichtungen in NRW handelte es sich 2023 um
öffentliche Bibliotheken; die übrigen waren wissenschaftliche
(Spezial-)Bibliotheken. Über 22,3 Millionen Mal haben die
Einwohnerinnen und Einwohner Nordrhein-Westfalens im Jahr 2023 eine
öffentliche Bibliothek aufgesucht; das waren rein rechnerisch im
Jahr 1,2 Besuche pro Einwohner/-in.
Rückgang der Zahl der
Haupt- und Zweigstellen von Bibliotheken
In den vergangenen
Jahren ist die Anzahl der Haupt- und Zweigstellen der Bibliotheken
in NRW zurückgegangen: Während es 2014 noch über 1.900 Bibliotheken
gab, waren es im Jahr 2023 nur noch rund 1.700. Damit verringerte
sich die Zahl der Bibliotheken innerhalb von neun Jahren um etwa
11 %.
Weniger Personal in Bibliotheken beschäftigt als vor
zehn Jahren
Auch die Zahl der Beschäftigten in öffentlichen
Büchereien und Hochschulbibliotheken ist im Zeitvergleich
zurückgegangen. So sank die Zahl der Voll- und Teilzeitbeschäftigten
in Büchereien im öffentlichen Dienst des kommunalen Bereichs von
2014 bis 2024 um rund 5 %. Im Jahr 2024 waren dort etwa 2.800
Personen beschäftigt.
Den niedrigsten Stand der letzten
10 Jahre hatte es allerdings im Corona-Jahr 2020 gegeben, seitdem
war die Zahl der Beschäftigten wieder leicht gestiegen. Bei der Zahl
der Beschäftigten in den Bibliotheken der Hochschulen war dagegen in
den letzten 10 Jahren ein fast kontinuierlicher Rückgang erkennbar:
Während es 2014 mehr als 1.800 Beschäftigte gab, waren es Anfang
Dezember 2024 nur noch rund 1.500. Damit hat sich das
Bibliothekspersonal der Hochschulen um fast 20 % verringert.
Mehr Azubis und Studierende im Bibliothekswesen
Zuwachs gab
es demgegenüber beim Nachwuchs im Bibliothekswesen: Im
Wintersemester 2024/25 waren über 400 Studierende im Studienbereich
Informations- und Bibliothekswissenschaften eingeschrieben. Das
waren rund 9 % mehr als noch im Wintersemester 2014/15, als 370
Personen in Fächern dieses Studienbereichs studiert hatten.
Ziel dieser Studienfächer ist es, die Absolventinnen und Absolventen
zur selbstständigen Ausübung bibliothekarischer Tätigkeiten sowie zu
Leitungs- und Führungsaufgaben in Bibliotheken zu befähigen. Auch
die Zahl der Auszubildenden als „Fachangestellte für Medien- und
Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek” ist im Zeitverlauf
gestiegen.
In diesem Ausbildungsberuf verwalten die Azubis
analoge und digitale Medien und pflegen Bibliotheksbestände. 2024
lernten über 300 Personen diesen Ausbildungsberuf. Das waren rund
24 % mehr als 2014.
Offizielle Einweihungsfeier des Sozialgerichts und
Arbeitsgerichts Duisburg
Am 22. Oktober 2025 wurde
das neue gemeinsame Gerichtsgebäude des Sozialgerichts und
Arbeitsgerichts Duisburg offiziell eingeweiht. Dr. Daniela Brückner,
Staatssekretärin des Ministeriums der Justiz des Landes
Nordrhein-Westfalen, nahm die Einweihung in Anwesenheit von rund 50
geladenen Gästen aus Politik, Justiz, Anwaltschaft und
Sozialverbänden vor.

Zu den Gästen zählten unter anderem Edeltraud Klabuhn, Erste
Bürgermeisterin der Stadt Duisburg, Dr. Jens Blüggel, Präsident des
Landessozialgerichts NordrheinWestfalen, sowie Dr. Christoph Ulrich,
Präsident des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf. Begrüßt wurden sie
vom Vizepräsidenten des Sozialgerichts Duisburg, Andreas Ostheimer,
und der Direktorin des Arbeitsgerichts Duisburg, Anja Ulrich.
Die beiden Gerichte, die bereits seit über 44 Jahren eine
„wohl erprobte Wohn- und Arbeitsgemeinschaft“ bilden, sind im
Dezember 2024 in das umfassend sanierte Gebäude an der
Aakerfährstraße 40 in Duisburg-Duissern umgezogen. Der Umzug war ein
echter organisatorischer Kraftakt: Nach jahrelanger Planung der
Neuanmietung wurden Ende November 2024 innerhalb weniger Tage rund
3.500 laufende Meter Akten, zahlreiche Regale, Möbel, Arbeitsplätze
und die IT an den neuen Standort verlagert – und das, ohne den
Verhandlungsbetrieb zu unterbrechen.
Möglich wurde dies
durch den großen Einsatz der Beschäftigten und den reibungslosen
Zusammenhalt beider Gerichte. Dies würdigten auch die
Staatssekretärin und die Erste Bürgermeisterin in ihren Grußworten.
Beide lobten nicht nur die wichtige Arbeit der Gerichte, die sich
täglich für die Rechte von Menschen in schwierigen Lebenssituationen
einsetzen, sondern zeigten sich auch beeindruckt davon, dass der
Umzug trotz laufenden Geschäftsbetriebs in so kurzer Zeit
erfolgreich abgeschlossen werden konnte.
Staatssekretärin
Dr. Brückner hob hervor, dass der gelungene Umzug vom Teamgeist und
Engagement aller Beschäftigten zeuge – Eigenschaften, die für einen
funktionierenden Rechtsstaat von großer Bedeutung seien. In seiner
Begrüßungsrede gab Vizepräsident Ostheimer einen kurzen Rückblick
auf die bewegte Standortgeschichte des 1959 gegründeten
Sozialgerichts, dessen erste Sitzungen einst im Polizeipräsidium
Duisburg stattfanden.
Auch Direktorin Ulrich erinnerte an
die Anfänge des 1927 gegründeten Arbeitsgerichts. Mit einem Dank an
alle Beteiligten – insbesondere an die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Gerichte – würdigten Ostheimer und Ulrich den großen
Einsatz, der den Umzug möglich gemacht hat. Das neue Gebäude biete
nun moderne Arbeitsbedingungen und eine freundliche, helle
Atmosphäre, die den Bürgerinnen und Bürgern ebenso zugutekomme wie
den Beschäftigten.
PRO BAHN plädiert für mehr
Fahrgastbeteiligung, Bürgernähe, Digitalisierung und
Schienenkompetenz
Der Fahrgastverband PRO BAHN nimmt
Stellung zur Zusammenlegung der Aufgabenträger in
Nordrhein-Westfalen zu Schiene.NRW

Drei Aufgabenträger formieren zusammen die neue Anstalt Schiene.NRW.
Bürgernähe und Beteiligung der Fahrgäste fordert der
Fahrgastverband PRO BAHN von einem neuen Gesetz über den
öffentlichen Verkehr in Nordrhein-Westfalen. Der Fahrgastverband ist
mit dem ersten Entwurf des Gesetzes, das von Verkehrsminister Oliver
Krischer den Verbänden zur Stellungnahme vorgelegt wurde, sehr
unzufrieden.
„Nur einen minimalistischen Entwurf zur Gründung
des geplanten, landesweiten Aufgabenträgers Schiene.NRW, ohne groß
reale Probleme im ÖPNV anzugehen“, so kritisieren Lothar Ebbers,
Rainer Engel und Dr. Thomas Probol die geplante Novelle des
ÖPNV-Gesetzes. „Die hohe Kompetenz, die die bisherigen
Aufgabenträger für den Schienennahverkehr gewonnen haben, wird für
das Land nur unzureichend genutzt.“
Das Land
Nordrhein-Westfalen will die Organisation des
Schienenpersonenverkehrs im Land effizienter und schlagkräftiger
machen. Gegenwärtig wird diese Aufgabe von Zweckverbänden für das
Rheinland, Rhein-Ruhr und Westfalen-Lippe getrennt wahrgenommen.
„Auch bei einer landesweiten Organisation des Schienenverkehrs darf
die Bürgernähe nicht verloren gehen“, erklärt Rainer Engel,
stellvertretender Vorsitzender des Fahrgastverbandes.
„Wir
zeigen auf, wie mehr Bürgernähe möglich ist, ohne dass die von der
Landesregierung erwünschten Vorteile verloren gehen. Wir wollen
nicht zurück in die Zeiten einer ortsfernen Bundesbahn, gegen die
die Bürger mit den Füßen abgestimmt hatten und ins Auto umgestiegen
waren.
Über einzelne Bahnhöfe und Bahnstrecken in der Eifel
und Ostwestfalen muss man zuerst vor Ort diskutieren. Wir befürchten
aber, dass mit dem neuen Gesetz darüber in Hochhäusern zwischen Ruhr
und Emscher entschieden wird. Schon jetzt sind die bisherigen
Aufgabenträger zu ortsfern und fahrgastfern“.
Nachdem in
Nordrhein-Westfalen die Organisation der Eisenbahnzüge in die Hand
von kommunalen Zweckverbänden gelegt wurde, hat der Schienenverkehr
einen enormen Aufschwung erlebt. „Diesen Aufschwung darf man nicht
wieder verspielen“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende Probol:
„Obwohl digitale Information gut informieren könnte, stehen
Fahrgäste bei vielen Baustellen und Zugausfällen immer wieder ratlos
auf dem Bahnsteig.
Bessere Information muss eine zentrale
Organisation wie die geplante Schiene.NRW in die Hand nehmen und
braucht dafür einen klaren Auftrag des Gesetzgebers. Mit einer
hochqualitativen Digitalisierung bei Fahrgastauskunft und
Anschlusssicherung kann der Fahrgast einfacher und schneller nach
guten Alternativen suchen.“ Die beiden Vertreter von
Verbraucherinteressen sind sich einig: „Die Gesetzesnovelle benötigt
dringend die Vorgabe regional verorterter Fachgremien und die
Empfehlung einer hochqualitativen Digitalisierung.“
Ebbers
verweist besonders darauf, dass das Mitdenken und Mitreden von
Fahrgast-Institutionen in allen Gremien den öffentlichen Verkehr
sehr stark verbessern kann. „In den Niederlanden gibt es die aktive
Mitarbeit von Verbraucherverbänden, und dort zeigt die Erfahrung,
dass die Hälfte aller Verbesserungsvorschläge angenommen und auch
tatsächlich umgesetzt wird“, weiß Ebbers. „Wenn die Landesregierung
wirklich etwas verändern möchte, dann ist jetzt die Zeit, das neue
Gesetz auf Bürgernähe auszurichten und engagierten Bürgern über ihre
Verbände die Möglichkeit zur Mitgestaltung zu geben.“
„Schienenkompetenz für NRW“, treibt Engel und Probol um:
„Rhein-Ruhr-Express, Regionalzüge und S-Bahnen müssen sich mit
Fernzügen und Güterzügen die gleichen Schienen teilen. Bei
Infrastrukturmaßnahmen muss man Fernverkehr, Nahverkehr und
Güterverkehr gemeinsam denken. Das vorliegende Gesetz wirkt wie ein
Maulkorb, wenn bei der neuen Schiene.NRW nur über Nahverkehr
nachdenken darf.
Die Entwicklung des Standorts
Nordrhein-Westfalen braucht alle Verkehrsarten auf der Schiene. Die
einzige Institution mit nötiger Fachkunde wird Schiene.NRW sein, um
auf allen Feldern mitzureden und gegenüber dem Bund als Eigentümer
der Schienen durchzusetzen, und dafür braucht Schiene.NRW einen
Auftrag, das ist aktive Strukturförderung.“
Ebbers kritisiert
auch die Regelungen über die Finanzierung des öffentlichen Verkehrs.
„Alle Förderpauschalen sollten alle drei Jahre per Gesetz geprüft
werden, um das Verkehrsangebot mindestens aufrechtzuerhalten, besser
noch auszubauen“, ergänzt Ebbers. „Ebenfalls sollte das Sozialticket
ins neue Gesetz aufgenommen werden, wobei der soziale Anteil
zukünftig z. B. aus dem Sozialtopf kommen muss, nicht mehr aus
ÖPNV-Mitteln.“
Abschließend bekräftigen Ebbers, Engel und
Probol noch einmal: „Den angekündigten großen Wurf hat Herr
Verkehrsminister Krischer verpasst. Aber er kann bis zum Einbringen
des Gesetzes in den Landtag deutlich nachbessern.“
Verleihung der Mercator-Ehrennadel 2025
Oberbürgermeister Sören Link verleiht m Donnerstag, 30. Oktober
2025, um 16 Uhr im Rathaus Duisburg im Beisein der Jurymitglieder
und weiterer geladener Gäste in diesem Jahr die Mercator-Ehrennadel
an Dr. Margarete Jäger, Sabine Haustein und Thorsten Fischer.
Eine Jury, bestehend aus Mitgliedern des Kulturausschusses, hat
über die eingereichten Vorschläge beraten und entschieden. Seit 2004
werden drei Persönlichkeiten oder Institutionen mit der
Mercator-Ehrennadel geehrt, deren unermüdliches Wirken das
kulturelle Leben unserer Stadt bereichern – sei es durch Projekte,
Publikationen oder besondere Initiativen in den Bereichen Kultur,
Wissenschaft, Bildung, Heimat- und Brauchtumspflege oder
Stadtgeschichte.
Rhein-City-Run: Zusätzliche Bahnen
auf der Linie U79
Am Sonntag, 26. Oktober, findet der
Rhein-City-Run von der Düsseldorfer City nach Duisburg-Süd statt.
Für die Läuferinnen und Läufer sowie für die Zuschauerinnen und
Zuschauer werden auf der Linie U79 eingesetzt. Für alle
Sportlerinnen und Sportler gelten die Anmeldebestätigung und die
Startnummer als Fahrausweis für die Hinfahrt zum Start und für die
Rückfahrt vom Ziel mit VRR-Verkehrsmitteln.
Linie U79: In
der Zeit von 7 bis 14 Uhr fahren die Bahnen der Linie U79 im
15-Minuten-Takt.
Einschränkungen für die Linie 942: In der Zeit
von 9 bis 14 Uhr wird die Straße Zur Sandmühle teilweise gesperrt.
Dies hat zur Folge, dass die Haltestelle „Kesselsberg“ der Buslinie
942 für die Dauer der Einschränkung zur Ersatzhaltestelle auf die
Düsseldorfer Landstraße in Höhe des Hotels Milser verlegt wird.
Stadtradeln 2025: Auszeichnung der Siegerteams
Bereits zum zwölften Mal fand das Stadtradeln Duisburg statt. Zum
Abschluss werden nun am Freitag, 24. Oktober 2025, um 16 Uhr
Rathaus, die erfolgreichsten Radlerinnen und Radler von
Umweltdezernentin Linda Wagner im Duisburger Rathaus ausgezeichnet.
EU-Reform der Führerscheinrichtlinie: Wichtige
Schritte für mehr Verkehrssicherheit und Digitalisierung in Europa
Keine verpflichtenden ärztlichen Untersuchungen – Fokus auf
Eigenverantwortung
Die Entscheidung des Europäischen Parlaments,
keine verpflichtenden ärztlichen Untersuchungen beim Erwerb oder bei
der Verlängerung von Führerscheinen vorzuschreiben, findet die
Zustimmung des EAC. Stattdessen sollen künftig Selbstauskünfte zur
Fahrtauglichkeit möglich sein.
„Wir begrüßen, dass
verpflichtende ärztliche Untersuchungen mehrheitlich abgelehnt
wurden“, erklärt ACV Geschäftsführer und EAC-Präsident Holger
Küster. „Statt Pflichtuntersuchungen sollten ältere Autofahrer durch
freiwillige Rückmeldefahrten und Auffrischungskurse sensibilisiert
werden – und zwar ohne die Sorge, dass ihnen dabei automatisch der
Führerschein entzogen wird.“
Damit folgt die EU dem Ansatz,
die Eigenverantwortung der Verkehrsteilnehmer zu stärken und
gleichzeitig den Verwaltungsaufwand zu reduzieren.
Digitaler
Führerschein: Einheitliche Umsetzung gefordert
Die Einführung
eines digitalen Führerscheins gilt als Meilenstein auf dem Weg zu
einer modernen europäischen Mobilitätsverwaltung. Der EAC
unterstützt diesen Schritt, mahnt aber eine zügige und einheitliche
Umsetzung in allen EU-Mitgliedstaaten an. Nach aktuellem Stand soll
der digitale Führerschein innerhalb von fünf Jahren nach
Inkrafttreten der neuen Richtlinie europaweit verfügbar sein.
„Die Einführung des digitalen Führerscheins ist ein wichtiger
und richtiger Schritt“, so Küster. „Wir hätten uns allerdings einen
kürzeren Zeitrahmen gewünscht. Die EU-Kommission muss sicherstellen,
dass kein digitaler Flickenteppich entsteht.“
Der EAC betont
zudem, dass niemand durch die Digitalisierung ausgeschlossen werden
darf. Ältere Menschen oder Personen ohne Smartphone sollen weiterhin
die Möglichkeit haben, einen physischen Führerschein zu erhalten.
Begleitetes Fahren europaweit – Ein Erfolgsmodell für junge
Fahrer
Besonders positiv bewertet der EAC die geplante
europaweite Einführung des Begleiteten Fahrens. Diese Maßnahme habe
sich in Deutschland als Erfolgsmodell erwiesen und trage
entscheidend zur Verkehrssicherheit junger Fahrer bei.
„Das
Begleitete Fahren ist ein echtes Erfolgsmodell“, unterstreicht
Küster. „Fahranfänger profitieren enorm und sammeln wichtige
Fahrpraxis. Eine gute Ausbildung und regelmäßige Fahrpraxis sind
entscheidender für sichere Teilnahme am Straßenverkehr als starre
Altersgrenzen.“
Null-Promille-Grenze für Fahranfänger –
Versäumte Chance
Kritisch bewertet der EAC dagegen, dass die EU
keine europaweite Null-Promille-Grenze für Fahranfänger beschlossen
hat. Aus Sicht der Interessengemeinschaft wurde hier eine wichtige
Gelegenheit zur Harmonisierung und Prävention vertan.
„Alkohol und Drogen am Steuer gehören zu den Hauptursachen schwerer
Unfälle“, erklärt Küster. „Wir hätten uns mehr Klarheit gewünscht:
Wer trinkt oder kifft, fährt nicht. Das sollte für alle Fahranfänger
in Europa gelten.“
Führerscheinentzug: Nur bei schweren
Verkehrsverstößen europaweit gültig
Positiv sieht der EAC, dass
künftig schwere Verkehrsverstöße EU-weit Konsequenzen haben können.
Gleichzeitig fordert die Interessengemeinschaft, dass der
Führerscheinentzug auf gravierende Delikte beschränkt bleibt.
„Wir befürworten den europaweiten Führerscheinentzug bei
schweren Verstößen als Signal für mehr Sicherheit auf Europas
Straßen“, sagt Küster. „Ein Fahrverbot sollte aber nur gelten, wenn
es sich um ein schweres Delikt handelt – also eines, für das man
auch im Heimatland den Führerschein verlieren würde.“
Emissionshandel 2027: Kein Grund zur Panik, sondern zum
Handeln – co2online warnt vor Aufschub
Der europäische
Emissionshandel fürs Heizen kommt – verteuert das Heizen aber nur
moderat. Statt Panik vor steigenden Kosten zu schüren, ruft
co2online (gemeinnützige GmbH) dazu auf, jetzt zu handeln: Wer
modernisiert, spart langfristig Geld.
Tanja Loitz,
Geschäftsführerin co2online (Bild: Marco Urban)
Die EU weitet
den Emissionshandel ab 2027 auf das Heizen aus. Das kann Haushalte
belasten. Deshalb fordern einige EU-Mitgliedstaaten, den
Preisanstieg zu verschieben oder abzufedern. co2online warnt: Sorgen
um mögliche Belastungen dürfen nicht zur Ausrede für Untätigkeit
werden.
„Der Emissionshandel ist das effektivste Instrument
für echte CO2-Einsparungen, ohne ihn werden wir unsere Klimaziele
nicht erreichen“, sagt Tanja Loitz, Geschäftsführerin von co2online.
„Gleichzeitig sind viele Menschen verunsichert, weil sie nicht
wissen, was das konkret für sie bedeutet. In Deutschland zahlen
Verbraucherinnen und Verbraucher bereits einen kontinuierlich
steigenden CO2-Preis fürs Heizen; mit dem europäischen
Emissionshandel wird das nationale System lediglich ersetzt, der
Anstieg 2027 dürfte noch sehr moderat ausfallen.“
Der
Heizspiegel von co2online zeigt: Der aktuelle CO2-Preis verteuert
Gas um etwa einen Cent pro kWh. Das entspricht rund 200 Euro im Jahr
für ein durchschnittliches Einfamilienhaus. Steigt der Preis im Jahr
2027 beispielsweise auf 75 Euro pro Tonne CO2, kämen nach
co2online-Berechnungen etwa 70 Euro pro Jahr hinzu. Die Einnahmen
fließen als Fördermittel und Entlastungsmaßnahmen an die
Verbraucherinnen und Verbraucher zurück.
„Ein etwas höherer
CO2-Preis ist kein Grund zur Panik, sondern ein klares Signal an
alle Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer: Wer jetzt modernisiert,
spart langfristig Heizkosten und erhöht den Gebäudewert“, so Loitz
weiter. „Technische Alternativen, wie Wärmepumpen, Solarenergie oder
hybride Lösungen, sind vorhanden und im Betrieb bereits günstiger
als die alte Gasheizung. Statt die Einführung zu blockieren,
brauchen wir: transparente Aufklärung, verfügbare Fördermittel sowie
eine gezielte Unterstützung für besonders verletzliche Haushalte.“
Maßnahmen, die einen abrupten Preissprung abfedern, etwa die
Nutzung von Zertifikatereserven, oder das Vorziehen von
Klimaschutzinvestitionen sind sinnvoll und sollten flankierend
eingesetzt werden. Ein genereller Aufschub des Emissionshandels fürs
Heizen, so co2online, wäre jedoch der falsche Weg: Er verschiebt die
notwendigen Investitionen und erhöht langfristig Aufwand und Kosten.
co2online bietet mit dem kostenlosen ModernisierungsCheck
(www.co2online.de/modernisierungscheck) ein Online-Tool, mit dem
Eigentümerinnen und Eigentümer in wenigen Minuten den energetischen
Zustand ihres Hauses, mögliche Sparpotenziale und passende
Fördermittel prüfen können.
MSV Duisburg – RW Essen:
DVG setzt zusätzliche Busse und Bahnen ein
Für Gäste des
Fußballspiels MSV Duisburg gegen den Rot-Weiß Essen am Sonntag, 26.
Oktober, um 19.30 Uhr in der Schauinsland-Reisen Arena, setzt die
Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) die Sportlinien 902 und 945
ein.

DVG-Foto
Abfahrtszeiten Straßenbahnline 902 Richtung MSV Arena:
ab „Watereck“ um 17.22 und 17.52 Uhr
ab „Meiderich Bf.“ um 17.35
und 18.30 Uhr
Abfahrtszeiten Buslinie 945 Richtung MSV
Arena:
ab „Salmstraße“ (Meiderich) Abfahrt um 17.36, 17.46, 17.56
Uhr
ab „Bergstraße“ um 17.41, 17.51 und 18.01 Uhr
ab
„Meiderich Bahnhof“ ab 17.45 bis 18.10 Uhr alle fünf Minuten
ab
„Großenbaum Bahnhof Ost“ um 18.20 und 18.35 Uhr
ab „Betriebshof
am Unkelstein“ ab 17.28 bis 17.53 Uhr alle fünf Minuten
ab „
Hauptbahnhof“ (Verknüpfungshalle) ab 17.45 bis 19.05 Uhr alle fünf
Minuten
ab „Businesspark Nord“ (Asterlagen) um 18.03 Uhr.
Nach Spielende stehen am Stadion Busse sowie an der Haltestelle
„Grunewald“ Bahnen für die Rückfahrt bereit. Gäste des
Fußballspieles, die eine Tageseintrittskarte im Vorverkauf erworben
haben oder eine Dauerkarte besitzen, können kostenlos die
öffentlichen Verkehrsmittel für die Hin- und Rückfahrt benutzen. Für
die Gäste, die sich an der Stadionkasse ihre Eintrittskarte kaufen,
ist die Rückfahrt mit Bus und Bahn kostenlos.
Neues
Online-Portal: RVR liefert Daten und Zahlen zu 58 Halden im
Ruhrgebiet
Wie hoch ist die Halde Hoheward an der
Stadtgrenze Herten/Recklinghausen? Welche Kunstinstallation krönt
die Halde Rheinpreußen in Moers? Wie wird die Halde Großes Holz in
Bergkamen genutzt? Das neue Haldenportal des Regionalverbandes Ruhr
(RVR) gibt die passenden Antworten. Es liefert zu jeder Halde einen
"Steckbrief" mit Daten und Angaben u. a. zu Größe,
Eigentumsverhältnissen, Nutzung und Zugänglichkeit.
Das
Portal ist im Rahmen des Gesamtregionalen Haldenkonzepts (GRHK)
entstanden. Das Haldenkonzept des RVR zeigt Entwicklungsperspektiven
für die künstlichen Berge im Ruhrgebiet auf. Die Bestandaufnahme
umfasst 46 Halden, die dem RVR bereits gehören, sowie zwölf weitere,
die bis voraussichtlich 2035 Eigentum des Verbandes werden.
Dabei werden die Halden nach ihren grundsätzlichen
Nutzungsschwerpunkten unterschieden: "Tourismus", "Freizeit und
Naherholung" sowie "ruhige Erholung und Naturschutz". Das
gesamtregionale Haldenkonzept bietet eine fundierte Grundlage bei
Entscheidungen zur weiteren Entwicklung der Halden und gibt den
Rahmen für neue Projekte vor. idr - Infos:
https://karten-dev.geoportal.ruhr/application/halden_oeffentlich
Schaurige Halloweenparty im Kinder- und
Jugendzentrum „Die Mühler“
Zu Halloween veranstalten
mehrere städtische Kinder- und Jugendzentren (das Kinder- und
Jugendzentrum „Die Mühle“, die Abenteuerfarm Robinson, das Kinder-
und Jugendzentrum Rumeln und das Regionalzentrum Süd „Sunny“) am
Freitag, 24. Oktober, von 16 bis 19 Uhr im Kinder- und Jugendzentrum
„die Mühler“ auf der Clarenbachstraße 14 in RheinhausenFriemersheim
eine große, schaurige Halloweenparty für Kinder und Jugendliche.
Eingeladen sind alle Kinder, Hexen, Monster, Werwölfe und andere
schreckliche Wesen ab dem Grundschulalter. Die Kinder können sich
sowohl auf eine Gruselstrecke als auch auf eine grauenvolle Party
mit vielen schrecklichen Spielen in der Mühle freuen. Auch auf dem
Außengelände finden fürchterliche Aktionen statt. Der Eintritt ist
kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Kostüme sind
erwünscht. Für das leibliche Wohl wird mit einem vielfältigen
Buffett gesorgt.
Bezirksbibliothek Großenbaum: Lesung mit Igal Avidan
Die Bezirksbibliothek Großenbaum in der Gesamtschule Süd und der
Bürgerverein Duisburg-Großenbaum/Rahm laden am Freitag, 24. Oktober,
um 19 Uhr, in die Räumlichkeiten an der Großenbaumer Allee 168-174,
zu einer in Lesung mit dem israelischen Journalisten und Autor Igal
Avidan ein.
Igal Avidan liest aus einem Buch „… und es wurde
Licht!“ über eine bewegte israelische Gesellschaft, in der Juden und
Araber längst ein Zusammenleben gefunden haben. Geboren wurde Igal
Avidan 1962 in Tel Aviv. In Israel hat er zunächst Englische
Literatur und Informatik und anschließend dann in Berlin
Politikwissenschaft studiert.
Der Nahostexperte arbeitet als
freier Berichterstatter aus Berlin für israelische und deutsche
Zeitungen und Hörfunksender. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung
ist nicht erforderlich
Katja Petrowskaja liest in der
Zentralbibliothek
Die Zentralbibliothek Duisburg lädt
am Freitag, 24. Oktober, um 20 Uhr, im Stadtfenster an der
Steinschen Gasse 26 in Duisburg-Mitte zu einer Lesung mit Katja
Petrowskaja ein. Die ukrainisch-deutsche Schriftstellerin hat mit
ihren Fotokolumnen, die zwischen Februar 2022 und Herbst 2024
entstanden sind, eine Chronik des Krieges in der Ukraine
geschrieben.

C Sasha Andrusyk
Ihr Bericht beginnt am Vorabend des russischen
Überfalls und beschreibt die unfassbare Realität des Krieges, das
Einbrechen des Ungeheuerlichen ins eigene Leben. Krieg verändert
alles – auch das, was und wie wir sehen. Er prägt Bilder,
Wahrnehmungen und Menschen. Diese tiefgreifenden Veränderungen
werden in der Lesung eindrücklich dargestellt.
Ihr
literarisches Debüt hatte Petrowskaja mit dem Werk „Vielleicht
Esther“, welches in mehr als 30 Sprachen übersetzt und vielfach
ausgezeichnet wurde. Der Eintritt beträgt 6 Euro, Anmeldungen sind
erforderlich. Karten sind online über
www.stadtbibliothek-duisburg.de und an den bekannten
Vorverkaufsstellen erhältlich.
Pfarrerin Lahann in
der Kircheneintrittsstelle
Immer freitags können
Unsichere, Kirchennahe oder solche, die es werden möchten, in der
Eintrittsstelle in der Salvatorkirche mit Pfarrerinnen, Pfarrern und
Prädikanten ins Gespräch kommen.
Motive für den Kircheneintritt
gibt es viele: Die Suche nach Gemeinschaft, Ordnung ins Leben
bringen oder der Wunsch, Taufen, Hochzeiten, Bestattungen kirchlich
zu gestalten. Aufnahmegespräche führt das Präsenzteam in der
Eintrittsstelle an der Salvatorkirche immer freitags von 14 bis 17
Uhr. Am Freitag, 24. Oktober 2025 heißt Krankenhauspfarrerin Dörthe
Lahann Menschen in der Südkapelle des Gotteshauses neben dem Rathaus
herzlich willkommen. Infos zur Citykirche gibt es unter
www.salvatorkirche.de.
Rheingemeinde lädt Seniorinnen und Senioren zum
Computerkurs ein
In der Evangelischen Rheingemeinde
Duisburg hilft ein neuer Computerkurs im BBZ Begegnungs- und
Beratungszentrum Wanheimerort an der Paul-Gerhardt-Str. 1 im Umgang
mit Rechner und Notebook.
Immer dienstags um 19 Uhr erklärt
Jörg Pfefferle im neuen Computerraum mit großer Geduld und viel
Einfühlungsvermögen die Grundlagen des Schreibprogramms Word. Maria
Hönes, Ehrenamtskoordinatorin der Rheingemeinde Duisburg, lädt
Interessierte herzlich zum Einstieg in die Computerwelt ein. Los
geht´s ab dem 4. November. Anmeldungen sind ab jetzt möglich unter
Tel.: 0203 / 770134.
Klönen, Kaffee und
jede Menge Kuchen beim Neumühler Turmcafé
Am Sonntag, 2.
November, öffnet wieder das beliebte Turmcafé der Evangelischen
Kirchengemeinde Neumühl von 15 bis 17 Uhr in der Gnadenkirche am
Hohenzollernplatz/Obermarxloher Straße seine Türen. Auch dieses Mal
gibt es zu Kaffee und Tee leckere, meist selbstgebackene Kuchen.
Das Turmcafé wird immer von unterschiedlichen Gruppen der
Gemeinde durchgeführt. Organisation, Service und Bewirtung
übernehmen diesmal die frühere Presbyterin und „Turmcafé-Urgestein“
Gisela Usche und ihr Team. Der Verkaufserlös von Kaffee und Kuchen
fließt wieder in die Instandhaltung der Gnadenkirche. Kuchenspenden
sind gern gesehen und können im Alten Pfarrhaus, Obermarxloher
Straße 40, Tel. 0203 / 580448, abgegeben werden.

NRW: 5,0 Millionen Menschen pendelten 2024 über ihre
Gemeindegrenze zur Arbeit
* Köln, Düsseldorf und Essen
waren die stärksten Einpendelknoten.
* Holzwickede mit höchster
Einpendelquote.
* Über 31.000 Personen pendelten aus dem Ausland
nach NRW.
Im Jahr 2024 sind 5 Millionen Menschen in
Nordrhein-Westfalen über die Grenzen ihres Wohnortes zur Arbeit
gependelt. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, waren das 0,1 %
mehr als ein Jahr zuvor. 4,4 Millionen Personen wohnten in der
Gemeinde, in der sie auch arbeiteten.
Die Städte Köln
(373.902), Düsseldorf (341.422) und Essen (168.226) waren nach wie
vor die drei stärksten Einpendelknoten in NRW und befanden sich
unter den Top 10 mit den meisten Einpendelnden in Deutschland.
Deutschlandweit pendelten die meisten nach München, Berlin und
Frankfurt Deutschlandweit pendelten im vergangenen Jahr
24,7 Millionen Personen (+0,5 % gegenüber 2023) über die Grenzen
ihres Wohnortes hinweg zur Arbeit ein.
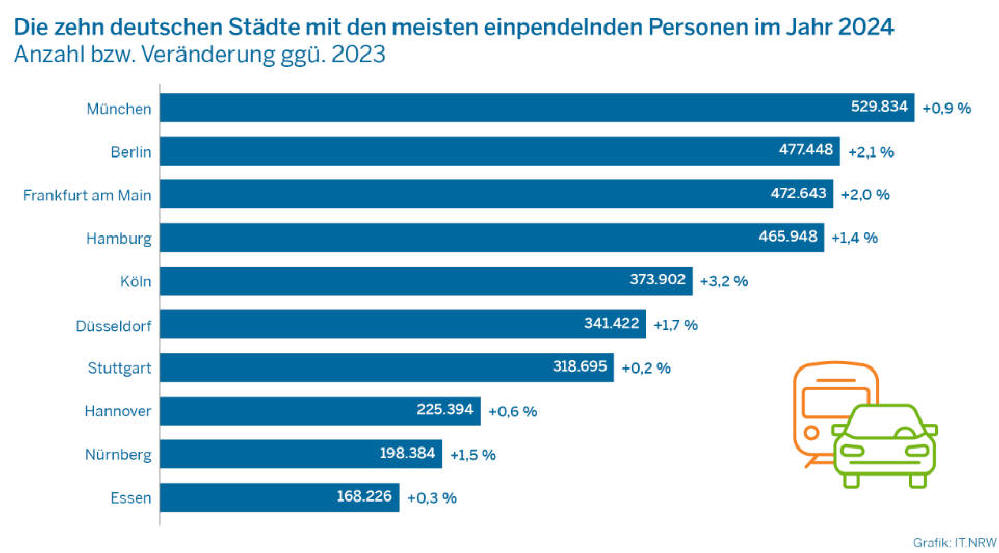
Nach München (529.834), Berlin (477.448) und Frankfurt am Main
(472.643) pendelten die meisten Menschen. Pendleratlas aktualisiert
Im Pendleratlas
https://pendleratlas.statistikportal.de/ stellen die
statistischen Ämter der Länder die Ergebnisse der Pendlerrechnung
2024 interaktiv dar. Unter anderem können hier deutschlandweit
Pendelverflechtungen zwischen einzelnen Städten und Gemeinden bzw.
Gemeindeverbänden abgerufen werden.
Holzwickede mit höchster
Einpendel- und Inden mit höchster Auspendelquote
Die
Pendlermobilität in NRW konzentrierte sich nach wie vor auf die
Nord-Süd-Achse von Bonn bis Duisburg und die West-Ost-Achse von
Mönchengladbach über das Ruhrgebiet bis nach Dortmund und Bielefeld.
In 85 der 396 nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden gab
es 2024 einen Einpendelüberschuss, d. h. dort war die Zahl der
einpendelnden Personen höher als die der auspendelnden Personen. Die
höchsten Einpendelquoten hatten Holzwickede (82,8 %) und Tecklenburg
(78,1 %), die niedrigsten wiesen Schmallenberg (31,7 %) und Gronau
(33,5 %) auf.
Die höchsten Auspendelquoten verzeichneten
Inden (85,9 %), Merzenich und Odenthal (jeweils 84,8 %); die
niedrigsten Münster (26,1 %) und Köln (29,7 %). 31.291 Personen
pendelten aus dem Ausland nach NRW Im vergangenen Jahr pendelten
insgesamt 31.291 Personen mit Hauptwohnsitz im Ausland zu ihrer
Arbeitsstätte in NRW.
Die stärksten Verflechtungen gab es
mit 3.349 Personen zwischen Belgien und Aachen sowie mit 1.412
Personen zwischen den Niederlanden und Aachen. In das gesamte
Bundesgebiet pendelten insgesamt 254.851 Personen aus dem Ausland.
Die meisten pendelten nach Bayern (51.946) und Baden-Württemberg
(32.136), die wenigsten nach Bremen (995) und Hamburg (4.455).
Die stärksten Verflechtungen bestanden mit 7.358 Personen
zwischen Frankreich und Saarbrücken sowie mit 7.220 zwischen Polen
und Berlin. Angaben zu genutzten Verkehrsmitteln auf Landesebene
zeitgleich erschienen Die Pendlerrechnung der Länder kann die
genutzten Verkehrsmittel nicht abbilden.
NRW: 14 % der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer pendelten 2024 mit Bus und Bahn zur Arbeit
* Pkw unangefochten meistgenutztes Verkehrsmittel.
*
Öffentliche Verkehrsmittel spielen in kleineren Gemeinden nur eine
untergeordnete Rolle.
* Rund sieben von zehn Pendelnden
erreichen ihren Arbeitsplatz in weniger als einer halben Stunde.
Der Pkw ist unangefochten das am häufigsten von Pendlerinnen und
Pendlern genutzte Verkehrsmittel: Mit 68 % legten im Jahr 2024 rund
sieben von zehn abhängig Erwerbstätigen in NRW ihren Arbeitsweg
überwiegend mit dem Auto zurück. Wie das Statistische Landesamt auf
Basis von Erstergebnissen des Mikrozensus 2024 weiter mitteilt,
pendelten 14 % der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hauptsächlich
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Arbeitsplatz.
Weitere
10 % fuhren mit dem Fahrrad, Pedelec oder E-Bike. Lediglich 6 %
gingen zu Fuß und nur 1 % nutzte sonstige Verkehrsmittel, wie z. B.
Mofa/Motorrad. Öffentliche Verkehrsmittel spielen in kleineren
Gemeinden nur eine untergeordnete Rolle Die für den Arbeitsweg
genutzten Verkehrsmittel unterscheiden sich regional deutlich.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Kleinstädten pendeln
häufiger mit dem Auto und seltener mit Bus und Bahn als solche aus
Großstädten. So fuhren in 2024 nur 5 % der Pendlerinnen und Pendler
aus Gemeinden mit bis zu 20.000 Einwohnerinnen und Einwohnern mit
öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit, aber 80 % mit dem Pkw.
In Großstädten ab 500.000 Einwohnerinnen und Einwohnern nutzten
dagegen 29 % Bus und Bahn für ihren Arbeitsweg und nur etwas mehr
als die Hälfte (53 %) das Auto. Rund sieben von zehn Pendelnden
erreichten ihren Arbeitsplatz in weniger als einer halben Stunde
Unabhängig von Verkehrsmittel und Wohnort benötigte mit 69 % der
Großteil der Pendelnden im Jahr 2024 üblicherweise weniger als eine
halbe Stunde für den Weg zum Arbeitsplatz: Dabei waren fast ein
Fünftel (18 %) weniger als 10 Minuten unterwegs.
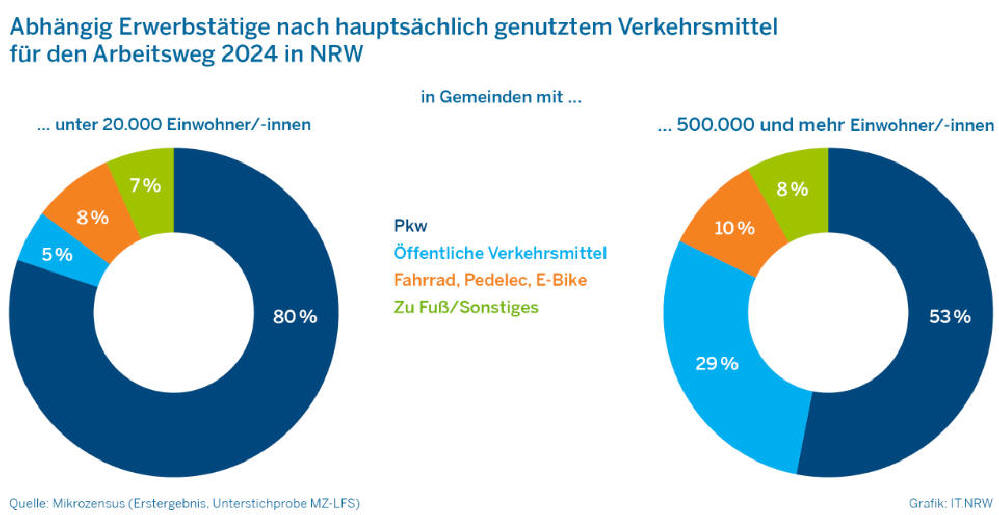
Gut die Hälfte (51 %) erreichte ihren Arbeitsplatz in 10 bis
unter 30 Minuten. Etwa ein Viertel (24 %) der Pendlerinnen und
Pendler benötigte in der Regel 30 bis unter 60 Minuten für die
einfache Pendelstrecke. 6 % waren sogar eine Stunde oder mehr
unterwegs. Knapp die Hälfte wohnte weniger als 10 Kilometer vom
Arbeitsplatz entfernt
Mit 25 % wohnte ein Viertel der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weniger als 5 Kilometer vom
Arbeitsplatz entfernt. Weitere 24 % hatten einen einfachen
Arbeitsweg von 5 bis unter 10 Kilometern. 29 % mussten 10 bis unter
25 Kilometer zu ihrem Arbeitsplatz zurücklegen. 15 % der abhängig
Erwerbstätigen pendelten 25 bis unter 50 Kilometer pro Strecke und
5 % sogar 50 oder mehr Kilometer.