






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 43. Kalenderwoche:
25. Oktober
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Montag, 27. Oktober 2025
Vereidigung Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter
Rund 140 Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter
treten am 1. November ihren Dienst an Förderschulen und
Berufskollegs in Duisburg und Umgebung an. Oberbürgermeister Sören
Link heißt die neuen Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter am
Freitag, 31. Oktober 2025, um 12 Uhr sowie um 13 Uhr im Rathaus
Duisburg, bei ihrer feierlichen Vereidigung im Ratssaal des
Duisburger Rathauses herzlich willkommen. Bürgermeisterin Edeltraud
Klabuhn wird die Begrüßung um 13 Uhr übernehmen.
Neue Lehrer fürs Land, Fußgänger im Fokus
Landesweit
starten Anfang November weit über 3.000 neue Lehramtsanwärterinnen
und -anwärter in den Vorbereitungsdienst. Am Freitag legen fast 200
von ihnen in Gelsenkirchen ihren Diensteid ab. Ministerpräsident
Hendrik Wüst und Schulministerin Dorothee Feller werden dabei sein.
Bereits am Montag sind Innenminister Herbert Reul und
Verkehrsminister Oliver Krischer in Krefeld. Dort starten sie die
landesweite Aktionswoche „Sicher im Straßenverkehr“.
Im
Mittelpunkt in diesem Jahr: Fußgängerinnen und Fußgänger. Sie
gehören zu den Verkehrsteilnehmern, die besonders verletzlich sind.
In Krefeld können Besucherinnen und Besucher bei der
Auftaktveranstaltung etwa den Fußverkehrs-Check absolvieren, die
Gefahren im „Toten Winkel“ eines LKW erkennen lernen oder den
Straßenverkehr aus dem Blickwinkel eines Kindes erleben.
Gedenkfeier zum Volkstrauertag
Die diesjährige
Gedenkfeier zum Volkstrauertag findet am Sonntag, 16. November, auf
dem Waldfriedhof Wanheimerort statt. Die Veranstaltung des
Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. beginnt um 14 Uhr in
der neuen Trauerhalle des Krematoriums, Eingang Düsseldorfer Straße.
Bürgermeisterin Edeltraud Klabuhn hält eine Ansprache.
Anschließend musiziert Wolfgang Schindler, Cellist der Duisburger
Philharmoniker. Außerdem stehen Textrezitationen von Rainer Besel
auf dem Programm. Im Anschluss wird ein Kranz am Mahnmal des
Friedhofs niedergelegt.
Unseriöse Anbieter unter
Handwerkern erkennen
Jeder vierte Mieter oder
Hauseigentümer mit intransparenten Rechnungen oder „Wucherpreisen“
konfrontiert / Wie sich Verbraucher vor dubiosen Geschäftemachern
schützen können
Mehr als 1000 Euro für einen einfachen
Schlüsselnotdienst? Mehrere Tausend Euro für die Beseitigung einer
Rohrverstopfung? Überzogene Preise und dubiose Geschäfte, bei denen
oftmals Menschen in Notlagen ausgenutzt werden, sind offenbar weit
verbreitet. Zu Ärger führen häufig auch Rechnungen, die für den
Kunden nicht nachvollziehbar sind. In einer Umfrage der ADAC Zuhause
Versicherung gab jeder vierte Hauseigentümer oder Mieter an, schon
einmal mit intransparenten Rechnungen oder gar „Wucherpreisen“
konfrontiert worden zu sein.
Die Versicherung des ADAC z.B.
bietet seit dem letzten Jahr einen Schutzbrief für Haus und Wohnung
an, der häufige Notfalldienstleistungen abdeckt und damit auch
verhindert, dass unseriöse Anbieter aus diesen Notlagen Kapital
schlagen können. Verbraucher, die sich selbst auf die Suche nach
Handwerkern begeben müssen, sollten zu ihrer Sicherheit folgende
Tipps beachten:
Internetsuche: Vorsicht bei Notdiensten und
Handwerkern mit dem Kürzel „AAA“ vor dem Firmennamen oder Einträgen.
Sie täuschen eine führende Position oder örtliche Nähe oft nur vor.
Manche Webseiten werden mit Unterseiten gezielt auf Städte oder
Stadtteile optimiert (z. B. „Installateur Berlin“, „Installateur
Hamburg“ usw.), agieren aber von einem zentralen Standort aus.
So können hohe Kosten für eine weite Anfahrt entstehen. Bei
seriösen Firmen beinhaltet das Impressum eine vollständige Adresse
und einen Handelsregister- oder Handwerkskammer-Eintrag. Zudem
sollten Anbieter unter einer regionalen Ortswahl erreichbar sein,
nicht unter einer teuren 0900-Nummer oder nur über Mobilfunk.
- Preisauskunft: Seriöse Anbieter nennen nach Schilderung der
Sachlage auf Anfrage die Gesamtkosten für die zu erbringende
Leistung, einschließlich der Anfahrt und etwaiger Zuschläge. Wird
keine Preisauskunft erteilt, gibt es Grund, misstrauisch zu sein.
Das gilt erst recht, wenn Dienste mit „Sofort-Rabatten“ drängen.
Wenn möglich, sollten Verbraucher einen schriftlichen
Kostenvoranschlag einholen.
- Zeugen hinzuziehen: Je nach
Schaden in Haus oder Wohnung kann es sein, dass zusätzliche Kosten
entstehen. Auch bei Zusatzarbeiten sollte vor der endgültigen
Auftragserteilung eine genaue Preisangabe eingeholt werden. Im
Idealfall ist eine dritte Person bei der Auftragsvergabe anwesend.
Ergibt sich keine Einigung über den Preis, kann der Auftraggeber
kündigen.
- Nicht zur Barzahlung drängen lassen: Unseriöse
Unternehmen bestehen häufig auf Barzahlung. Gerade bei Problemen mit
Notdiensten oder auffällig hohen Rechnungen sollte man nicht direkt
vor Ort bezahlen. Barzahlungen an Handwerker sind außerdem nicht
steuerlich absetzbar. Eine Zahlung per Überweisung ist hier der
bessere Weg.
- Rechnung prüfen: In der Rechnung sollten der
Stundenlohn und die geleistete Arbeitszeit transparent ausgewiesen
sowie Material- und Fahrtkosten separat aufgelistet sein. Zudem
lohnt ein genauerer Blick: Fehlen die Steuernummer oder die laufende
Rechnungsnummer? Werden eventuell Leistungen oder Materialien
berechnet, die bei der Auftragsklärung nicht vereinbart worden sind?
Mit einem Schutzbrief für Haus und Wohnung können Verbraucher
unnötigem Ärger und Stress von vornherein vorbeugen. „Unsere
Pannenhilfe für das Zuhause ist rund um die Uhr erreichbar und
organisiert bei Notfällen – etwa in den Bereichen Elektro, Heizung
und Sanitär – schnell und zuverlässig eine Fachkraft aus unserem
deutschlandweiten Handwerkernetzwerk. Durch diesen Service entfällt
die aufwändige Suche nach Hilfe sowie möglicher Ärger über lange
Wartezeiten oder dubiose Geschäftspraktiken.
Mit den
Handwerkern rechnen wir als Versicherer ab, ohne dass der Kunde in
Vorleistungen gehen muss. Wir übernehmen die Kosten bis zu 500
Euro“, erklärt Sascha Herwig, Vorstandsvorsitzender der ADAC Zuhause
Versicherung. „Die rund 2900 qualifizierten Handwerksbetriebe und
Dienstleister des Netzwerks sind geprüft und unterziehen sich
regelmäßigen Audits im Rahmen eines umfassenden
Qualitätsmanagements.“
Tipps für den Reifenwechsel
und sicheres Fahren bei Eis und Schnee
Seit 2010 gilt in
Deutschland eine situative Winterreifenpflicht. Das heißt: Bei
Glatteis, Schnee oder Reifglätte dürfen nur geeignete Reifen
verwendet werden. Doch welche Reifen gelten rechtlich als
Winterreifen - und welche Strafen drohen bei Verstößen?
Zum Start
der Reifenwechsel-Saison beantwortet der ACV Automobil-Club Verkehr
sieben wichtige Fragen.

Gesetzlich vorgeschrieben ist eine Mindestprofiltiefe von 1,6
Millimetern / Shutterstock
1. Was bedeutet
Winterreifenpflicht?
Die Winterreifenpflicht sorgt oft für
Verwirrung - geregelt ist sie in § 2 Abs. 3a StVO. Demnach dürfen
Fahrzeuge bei Glatteis, Schneematsch oder Reifglätte nur mit
geeigneter Bereifung unterwegs sein. Daher spricht man von einer
situativen Pflicht: Es gibt keinen festen Zeitraum, in dem
Winterreifen vorgeschrieben sind. Autofahrer müssen ihre Bereifung
also immer dann anpassen, wenn die Straßenverhältnisse es erfordern.
Die bekannte "O-bis-O-Regel" (Oktober bis Ostern) ist lediglich
eine Faustregel. Sie ist nicht rechtsverbindlich, aber eine
sinnvolle Orientierung, da in dieser Zeit mit winterlichen
Bedingungen zu rechnen ist.
Als geeignet gelten nur Fahrzeuge,
bei denen alle vier Räder mit Winter- oder Ganzjahresreifen mit
Alpine-Symbol ausgestattet sind. Ausnahmen bestehen lediglich für
bestimmte Sonderfahrzeuge (z. B. Einsatzfahrzeuge), nicht für den
normalen Pkw-Verkehr.
Die Regelung gilt zudem für alle
Fahrzeuge, die in Deutschland unterwegs sind - auch für solche mit
ausländischer Zulassung. Wer etwa mit Sommerreifen aus dem Ausland
in Deutschland fährt und bei winterlichen Straßenverhältnissen
kontrolliert wird, muss ebenfalls mit einem Bußgeld rechnen.
In
schneereichen Regionen oder bei Bergfahrten können Schneeketten
vorgeschrieben sein. Der ACV empfiehlt, die Ketten passend zur
Reifengröße auszuwählen und das Anlegen vorab zu üben - so gelingt
die Montage im Ernstfall schnell und sicher.
2. Welche Reifen
gelten rechtlich als Winterreifen?
Seit dem 1. Oktober 2024
dürfen nur noch Reifen mit Alpine-Symbol (3PMSF) als Winterreifen
verwendet werden. Für M+S-Reifen, die vor dem 1. Januar 2018
produziert wurden, endete zu diesem Zeitpunkt die Übergangsfrist.
Auch Ganzjahresreifen sind erlaubt, sofern sie das Alpine-Symbol
tragen. Sie ersparen den saisonalen Wechsel, bieten aber weniger
Grip und längere Bremswege bei Schnee und Eis. In milden Regionen
sind sie eine praktische Lösung, in schneereichen Gebieten bleiben
klassische Winterreifen die sicherere Wahl.
3. Wie viel
Profil müssen Winterreifen haben?
Gesetzlich vorgeschrieben ist
eine Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern. Unterschreiten Reifen
diesen Wert, drohen Bußgelder, Punkte in Flensburg - und ein
deutlich erhöhtes Unfallrisiko.
Der ACV empfiehlt, bereits ab 4
Millimetern neue Winterreifen aufzuziehen. Denn die Profiltiefe
beeinflusst die Bremsleistung erheblich:
Bei 50 km/h verlängert
sich der Bremsweg auf Schnee mit 1,6 Millimetern Profil auf rund 38
Meter, während neue Reifen mit 8 Millimetern Profil nur etwa 26
Meter benötigen.
4. Wie bleiben Winterreifen sicher und
leistungsfähig?
Neben Profil und Alter beeinflussen weitere
Faktoren die Sicherheit von Winterreifen. Ein entscheidender Punkt
ist der Luftdruck, der sich bei Kälte automatisch verringert. Zu
niedriger Druck mindert die Haftung, verlängert den Bremsweg und
erhöht den Kraftstoffverbrauch - daher sollte er regelmäßig
überprüft werden. Die Herstellerangaben finden sich im Tankdeckel,
in der Bedienungsanleitung oder auf einem Aufkleber im Türrahmen.
Um gleichmäßigen Verschleiß zu fördern, empfiehlt der ACV, die
Reifen etwa alle 10.000 Kilometer zwischen Vorder- und Hinterachse
zu tauschen. So bleibt die volle Leistungsfähigkeit länger erhalten.
E-Autos stellen durch ihr höheres Gewicht besondere Anforderungen.
Zwar sind keine speziellen Winterreifen vorgeschrieben, der ACV rät
aber zu Reifen mit höherem Tragfähigkeitsindex. Modelle mit
niedrigem Rollwiderstand können zudem die Reichweite verbessern.
5. Wann müssen Winterreifen ersetzt werden?
Auch das Alter
spielt eine Rolle: Nach spätestens sechs bis acht Jahren sollten
Winterreifen ausgetauscht werden, da die Gummimischung aushärtet und
ihre Elastizität verliert - selbst bei ausreichendem Profil.
Orientierung bietet die DOT-Nummer an der Reifenflanke: Die letzten
vier Ziffern zeigen Produktionswoche und Jahr, etwa "2218" für die
22. Woche 2018.
Beim Neukauf lohnt sich ein Blick in aktuelle
Winterreifentests. Sie helfen, sichere und preislich attraktive
Modelle zu finden.
6. Welche Strafen drohen bei einem
Verstoß?
Wer bei winterlichen Bedingungen mit Sommerreifen fährt,
muss mit Bußgeldern und einem Punkt im Fahreignungsregister rechnen.
Dank der Kennzeichnung lassen sich Allwetter- und Winterreifen
leicht überprüfen.
Wichtig zu wissen: Allein die Montage der
Winterreifen nützt nicht allzu viel, wenn die gesetzliche
Mindestprofiltiefe nicht eingehalten wird. Auch diese wird von der
Polizei kontrolliert. Bei falscher Bereifung im Winter drohen
Bußgelder zwischen 60 und 120 Euro sowie jeweils ein Punkt in
Flensburg, abhängig von der Schwere des Verstoßes:
60 EUR für das
Fahren mit Sommerreifen,
80 EUR bei Behinderung,
100 EUR bei
Gefährdung und
120 EUR bei Unfallfolge.
Bei zu geringer
Profiltiefe werden 75 EUR und ein Punkt fällig. Ein Fahrverbot ist
in keinem Fall vorgesehen.
7. Wie wirkt sich ein Verstoß auf
den Versicherungsschutz aus?
Ein Verstoß gegen die
Winterreifenpflicht kann nicht nur Geldbußen, sondern auch
Konsequenzen für den Versicherungsschutz nach sich ziehen:
Kaskoversicherung: Leistungen können gekürzt oder verweigert werden,
wenn ein Unfall mit Sommerreifen verursacht wurde.
Haftpflichtversicherung: Selbst ohne eigenes Verschulden droht eine
Mithaftung, da Sommerreifen eine erhöhte Betriebsgefahr darstellen.
In der Praxis liegt diese oft bei etwa 20 Prozent.
Verschuldensvermutung: Wer im Winter mit Sommerreifen fährt, gilt
grundsätzlich als mitschuldig. Nur wenn der Unfall auch mit
Winterreifen unvermeidbar gewesen wäre, entfällt diese Annahme.
Versicherungen prüfen in solchen Fällen häufig auch auf grobe
Fahrlässigkeit. Wird diese angenommen, kann der Leistungsumfang
deutlich gekürzt oder komplett gestrichen werden.
Stadtwerke Duisburg nehmen
12 neue Ladepunkte in Betrieb
In den vergangenen Wochen
hat der lokale Energiedienstleister weitere 12 neue Ladepunkte an
sechs Standorten in Betrieb genommen. Jeweils zwei neue Ladepunkte
stehen ab sofort an der Steigerstraße 11 in Alt-Hamborn, an der
„Obere Holtener Straße“ 41 in Röttgersbach, an der Sandstraße 5 in
Marxloh, „Im Höschegrund“ 74 in Hüttenheim und an der Mattlerstraße
1 in Röttgersbach zur Verfügung.

Im Höschegrund in Hüttenheim können Elektroautos ab sofort an zwei
neuen Ladepunkten der Stadtwerke Duisburg geladen werden. Quelle:
Stadtwerke Duisburg
Ebenfalls zwei neue Ladepunkte gibt es
ab sofort an der Rumelner Straße 101 in Rheinhausen. Diese beiden
Ladepunkte sind mit einer Schnellladefunktion ausgestattet. Die
Stadtwerke sind der erste Ansprechpartner zu allen Fragen rund um
die Elektromobilität in Duisburg.
Der lokale
Energiedienstleister betreibt insgesamt 374 Ladepunkte an 151
Standorten im Stadtgebiet. Davon sind 56 Ladepunkte sogenannte
Schnellladepunkte mit einer Ladeleistung zwischen 49 und 150 kW. Die
neu installierten Ladesäulen entsprechen dem neuesten Stand der
Technik und den aktuellen Anforderungen des Mess- und Eichrechts.
Die Ladesäulen der Stadtwerke Duisburg sind an den Verbund
ladenetz.de angeschlossen, zu dem rund 275 Anbieter von
Ladeinfrastruktur gehören. Insgesamt stehen über 105.000 Ladepunkte
in ganz Deutschland zur Verfügung. Durch Kooperationen auf
internationaler Ebene kommen europaweit rund 390.000 Ladepunkte
hinzu. Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Duisburg können mit einer
entsprechenden Stadtwerke-Ladekarte an diesen Säulen ihr Elektroauto
laden.
Das Laden ist neben der Ladekarte auch durch das
Scannen des angebrachten QR-Codes oder der „ladeapp“ an allen
Ladestationen der Stadtwerke Duisburg möglich. Somit gibt es auch
die Möglichkeit, den Ladevorgang ganz bequem spontan zu starten.
Eine Ladekarte der Stadtwerke Duisburg können Interessierte über das
Online-Formular unter
swdu.de/ladekarte bestellen.
Kundinnen und Kunden
profitieren dabei von einem Preis-Vorteil in Höhe von 60 Euro im
Jahr. Die Energieberaterinnen und -berater der Stadtwerke Duisburg
stehen Interessierten bei allen Fragen rund um die Elektromobilität
von der Fahrzeugauswahl bis zur heimischen Lade-Wallbox samt
passendem Stromtarif telefonisch unter 0203-604 1111 zur Verfügung.
Weitere Informationen gibt es auch im Internet auf
https://www.stadtwerke-duisburg.de/emob-p.
VHS-Vortrag nimmt Tibet in den Fokus
Der Dalai Lama, das im Exil lebende spirituelle Oberhaupt der
Tibeter, ist in diesem Sommer 90 Jahre alt geworden. Die Frage
seiner Nachfolge steht im Raum. Auch China erhebt auf diese
Entscheidung Anspruch.
Der Duisburger Sozialwissenschaftler
Rainer Spallek wird in seinem Vortrag am Montag, 27. Oktober, um 20
Uhr in der VHS im Stadtfenster an der Steinschen Gasse 26 in der
Stadtmitte die komplizierte Situation des tibetischen Volkes
darstellen. Das Teilnahmeentgelt beträgt fünf Euro, eine vorherige
Anmeldung unter www.vhs-duisburg.de ist notwendig.
Praystation an Halloween: Glauben trifft Grusel Jugendabend in
Huckingen
Bei der nächsten Praystation, dem beliebten
Gottesdienstformat aus dem Duisburger Süden, geht es unter dem Titel
„Glauben trifft Grusel“ um die tiefere Bedeutung von Reformation und
Halloween: Der Reformationstag am 31. Oktober ist für Kinder und
Jugendliche anders besetzt. Für sie steht Halloween im Vordergrund,
ein Brauch, der von Amerika nach Deutschland gekommen ist und sich
hier sehr stark verbreitet.
In der Praystation am 31. Oktober
um 19 Uhr in der evangelischen Kirche in Huckingen, Angerhauser
Straße 91, laden junge Leute aus der Gruppe „god.com“ zusammen mit
Jugendpastorin Ulrike Kobbe ein, sich näher mit Themen rund um
Halloween zu beschäftigen, und alle sind eingeladen, verkleidet zu
kommen. Nach dem Gottesdienst gibt es Snacks, Spiele und
Möglichkeiten zum Gruseln. Infos zur Evangelischen
Versöhnungsgemeinde-Duisburg Süd gibt es im Netz unter
www.evgds.de.
Kirchenkneipe nach dem Reformationsgottesdienst
An
einem der vier Freitage jeden Monats öffnet im Gemeindezentrum der
Evangelischen Kirchengemeinde Duisburg Meiderich, Auf dem Damm 8,
die Kirchenkneipe. So auch am 31. Oktober 2025, wo Besucherinnen und
Besucher wieder gute Getränke, leckere Kleinigkeiten und eine
gemütliche Atmosphäre erwarten können, die zum Wohlfühlen einlädt
und Platz für nette Gespräche lässt.
Diesmal startet
die Kirchenkneipe gegen 19 Uhr, direkt nach dem zentralen
Reformationsgottesdienst der Nordgemeinden im Evangelischen
Kirchenkreis Duisburg, die diesen nebenan in der Kirche um 18 Uhr
feiern. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter
www.kirche-meiderich.de oder im Gemeindebüro unter 0203-4519622.
Frau Hönes lädt zum Kuchenbacken an
der Gnadenkirche
Maria Hönes liebt das Backen, und für
die verschiedensten Veranstaltungen zaubert die Ehrenamtsbeauftrage
der Evangelischen Rheingemeinde Duisburg gerne Mal einen Kuchen.
Jetzt sucht sie Kuchenfans, die mit ihr in der gut ausgestatteten
Küche an der Gnadenkirche Wanheimerort süße Leckereien backen, die
dann im „Café 3/4 Takt“ dem „Kirchen Café“ oder anderen
Veranstaltungen verputzt werden.
Besucherinnen und Besucher
schätzen ihre Kuchen, denn den Unterschied zur gekauften Torte aus
dem Gefrierfach schmecken alle. Starten soll die Backaktion im
November, immer freitags vor den Veranstaltungen am Wochenende.
Mitbringen müsse man nichts, sagt Maria Hönes, nur Spaß am Backen
und Freude an der Zusammenarbeit.
Die Zutaten besorgt die
Ehrenamtsbeauftragte frisch vor dem Backtag. Mehr Details zur Aktion
hat Maria Hönes, die alle Rückfragen beantwortet: per Tel.: 0203
770134 oder E-Mail: maria.hoenes@ekir.de
Pfarrer Korn am Service-Telefon der evangelischen Kirche in Duisburg
„Zu welcher Gemeinde gehöre ich?“ oder „Wie kann ich in
die Kirche eintreten?“ oder „Holt die Diakonie auch Möbel ab?“:
Antworten auf Fragen dieser Art erhalten Anrufende beim kostenfreien
Servicetelefon der evangelischen Kirche in Duisburg.
Es ist
unter der Rufnummer 0800 / 12131213 auch immer montags von 18 bis 20
Uhr besetzt, und dann geben Pfarrerinnen und Pfarrer Antworten auf
Fragen rund um die kirchliche Arbeit und haben als Seelsorgende ein
offenes Ohr für Sorgen und Nöte. Das Service-Telefon ist am Montag,
27. Oktober 2025 von Stefan Korn, Pfarrer in der Evangelischen
Kirchengemeinde Alt-Süd, besetzt.

NRW: Gemeinden und Gemeindeverbände konnten 2024 nur
knapp 93 % ihrer Auszahlungen durch Einzahlungen decken
* Deckungsgrad aller Gemeinden und Gemeindeverbände
Nordrhein-Westfalens zusammen das zweite Jahr in Folge deutlich
unter 100 %.
* Thüringen war das einzige Flächenland
Deutschlands, in dem die Gemeinden und Gemeindeverbände in Summe
ihre Auszahlungen durch Einzahlungen decken konnten. * Mehr als 4
von 5 Kreisen und kreisfreien Städten in Deutschland wiesen 2024
mehr Aus- als Einzahlungen auf.
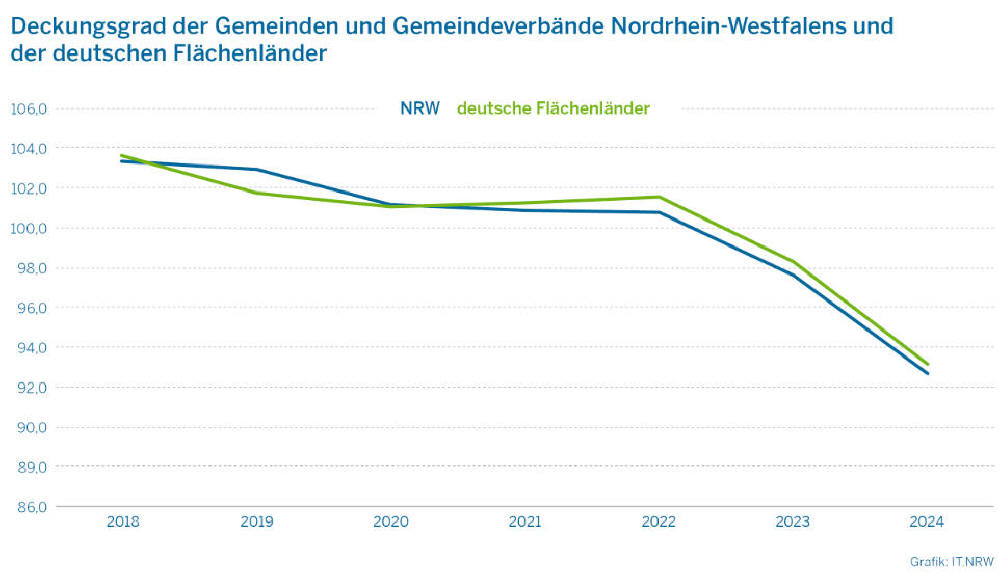
Die Gemeinden und Gemeindeverbände in Nordrhein-Westfalen
zusammengenommen konnten 2024 nur 92,8 % ihrer Auszahlungen durch
Einzahlungen decken. In absoluten Zahlen ausgedrückt entsprach das
einer Unterdeckung in Höhe von 6,8 Mrd. Euro. Wie das Statistisches
Landesamt mitteilt, lag der sogenannte Deckungsgrad somit das zweite
Jahr in Folge deutlich unter 100 %.
Im Jahr 2018 hatte er
noch bei 103,5 % gelegen, d. h. auf kommunaler Ebene haben die
Einzahlungen damals die Auszahlungen übertroffen. Bundesweit lag der
Deckungsgrad 2024 der Gemeinden und Gemeindeverbände aller
Flächenländer mit 93,3 % nur geringfügig über dem Wert von NRW. Die
zeitliche Entwicklung verlief bundesweit sehr ähnlich wie in
Nordrhein-Westfalen.
Thüringen mit höchstem und
Niedersachsen mit niedrigstem Deckungsgrad
In 12 von 13 deutschen
Flächenländern konnten die Gemeinden und Gemeindeverbände in Summe
ihre Auszahlungen nicht decken. Lediglich die kommunale Ebene in
Thüringen hatte 2024 einen Deckungsgrad von über 100 % (101,0 %) und
konnte diesen im Vergleich zu 2018 halten.
Bei den Gemeinden
und Gemeindeverbänden der anderen Flächenländer ist diese Kennziffer
unter 100 % gefallen. In Niedersachsen war der Deckungsgrad der
kommunalen Ebene 2024 mit 89,5 % am niedrigsten. Mehr als 4 von 5
Kreisen und kreisfreien Städten der deutschen Flächenländer 2024 mit
Deckungsgrad unter 100 %
Die Betrachtung der einzelnen
kreisfreien Städte und Kreise (einschließlich kreisangehöriger
Gemeinden) aller deutschen Flächenländer im Jahr 2024 zeigt, dass
mehr als 4 von 5 von ihnen ihre Auszahlungen nicht durch
Einzahlungen decken konnten.
Sie wiesen damit einen
Deckungsgrad unter 100 % auf. 2018 war es umgekehrt, damals hatten
mehr als 4 von 5 von ihnen einen Deckungsgrad von über 100 %. 92,5 %
der nordrhein-westfälischen Kreise und kreisfreien Städte hatten im
Jahr 2024 einen Deckungsgrad unter 100 %. Lediglich die Kreise Olpe,
Soest und Minden-Lübbecke sowie die kreisfreie Stadt Hagen konnten
ihre Auszahlungen noch durch entsprechende Einzahlungen decken.
Beschäftigte mit Einwanderungsgeschichte 2024 in vielen
Mangelberufen überdurchschnittlich stark vertreten
•
Anteile in der Schweiß- und Verbindungstechnik 2024 bei 60 %, in der
Lebensmittelherstellung und bei Köchinnen und Köchen je 54 %, im
Gerüstbau bei 48 %
• Branchen: Mehr als die Hälfte (54 %) der
abhängig Beschäftigten in der Gastronomie hat eine
Einwanderungsgeschichte
• Anteil in der Gesamtwirtschaft bei
einem Viertel (26 %)
Ob in der Produktion und Fertigung, der
Gastronomie, der Pflege oder im Personen- und Güterverkehr: In
vielen Engpassberufen sind Beschäftigte mit Einwanderungsgeschichte
überdurchschnittlich stark vertreten. So hatten 60 % der
Beschäftigten in der Schweiß- und Verbindungstechnik im Jahr 2024
eine Einwanderungsgeschichte, wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) mitteilt.
In der Lebensmittelherstellung sowie bei
Köchinnen und Köchen traf dies auf mehr als die Hälfte der
Beschäftigten zu (je 54 %). Überdurchschnittlich hoch war der Anteil
auch im Gerüstbau (48 %), unter den Fahrerinnen und Fahrern von
Bussen und Straßenbahnen (47 %), in der Fleischverarbeitung (46 %)
sowie unter Servicekräften in der Gastronomie (45 %).
In der
Gesamtwirtschaft hatte gut ein Viertel (26 %) aller abhängig
Beschäftigten eine Einwanderungsgeschichte. Sie selbst oder beide
Elternteile waren also seit dem Jahr 1950 nach Deutschland
eingewandert. In sogenannten Engpassberufen herrscht oder droht laut
Engpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit (BA) ein
Fachkräftemangel.
Knapp ein Drittel der Beschäftigten in der
Altenpflege hat eine Einwanderungsgeschichte
Deutlich über dem
gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt liegt der Anteil der
Beschäftigten mit Einwanderungsgeschichte auch in weiteren
Mangelberufen: so etwa in der Kunststoff- und Kautschukherstellung
(44 %), im Hotelservice (40 %), bei Berufskraftfahrerinnen und
-fahrern im Güterverkehr (39 %), in der Metallbearbeitung (37 %), in
der Altenpflege (33 %), bei Speditions- und Logistikkaufleuten
(32 %) sowie im Metallbau oder der Elektrotechnik (je 30 %).
Der geringste Anteil an Beschäftigten mit
Einwanderungsgeschichte in einem Engpassberuf war im Rettungsdienst
(8 %), in der Justizverwaltung (9 %) und in der Landwirtschaft
(15 %) zu finden. Auch wenn es sich nicht um Mangelberufe laut
Engpassanalyse der BA handelt, sind Menschen mit
Einwanderungsgeschichte in einigen Berufsgruppen ähnlich stark
unterrepräsentiert: Das trifft vor allem auf den
Polizeivollzugsdienst (7 %), Berufe in der öffentlichen Verwaltung
sowie in der Sozialverwaltung und -versicherung (je 9 %), auf
Lehrkräfte (Primarstufe: 9 %, Sekundarstufe: 12 %) sowie auf Berufe
in der Steuerverwaltung (10 %) zu.
Beschäftige mit
Einwanderungsgeschichte in ausgewählten Engpassberufen 2024 Bar
chart with 19 bars. Anteil an allen abhängig Beschäftigten je Beruf
in % Klassifikation der Berufe 2010 (KldB 2010); Berufsuntergruppen.

Branchen: Gastronomie und Gebäudebetreuung anteilig mit den
meisten Beschäftigten mit Einwanderungsgeschichte Der Anteil der
Menschen mit Einwanderungsgeschichte ist nicht nur in vielen
Mangelberufen hoch. Einige Branchen sind insgesamt in besonderem
Maße auf diese Arbeitskräfte angewiesen. Das ist vor allem in der
Gastronomie der Fall: Mehr als die Hälfte (54 %) aller abhängig
Beschäftigten in der Gastronomie, unabhängig vom jeweils ausgeübten
Beruf, hatte 2024 eine Einwanderungsgeschichte.
In der
Gebäudebetreuung, die zum Großteil aus Gebäudereinigung besteht, zu
der aber auch Garten- und Landschaftsbau zählen, hatte die Hälfte
(50 %) der Beschäftigten eine Einwanderungsgeschichte. Einen
überdurchschnittlich großen Anteil hatten Beschäftigte mit
Einwanderungsgeschichte auch in der Beherbergung (43 %), bei Wach-
und Sicherheitsdiensten, in privaten Haushalten mit Hauspersonal
sowie in der Lagerei und Erbringung von sonstigen Dienstleistungen
für den Verkehr (je 42 %) und im Spiel-, Wett- und Lotteriewesen
sowie bei Post-, Kurier und Expressdiensten (je 41 %).
In
zwei beschäftigungsstarken Bereichen mit jeweils mehr als einer
Million Beschäftigten lag der Anteil mit einem knappen Drittel
ebenfalls deutlich über dem Durchschnitt in der Gesamtwirtschaft
(26 %): In Alten- und Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen sowie
in der Kraftwagenproduktion hatten je 32 % der abhängig
Beschäftigten eine Einwanderungsgeschichte.
Deutlich
unterrepräsentiert waren Menschen mit Einwanderungsgeschichte im
Jahr 2024 dagegen im Bereich öffentliche Verwaltung, Verteidigung
und Sozialversicherung (12 %), in der Versicherungsbranche (14 %),
in der Energieversorgung und in der Landwirtschaft (je 15 %). Im
Bereich Erziehung und Unterricht mit 2,8 Millionen Beschäftigten
waren Menschen mit Einwanderungsgeschichte ebenfalls deutlich
unterrepräsentiert (17 %).
Beschäftigte mit
Einwanderungsgeschichte in ausgewählten Branchen 2024 Bar chart with
16 bars. Anteil an allen abhängig Beschäftigten je Branche in %
Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008 (WZ2008);
Wirtschaftsabteilungen.