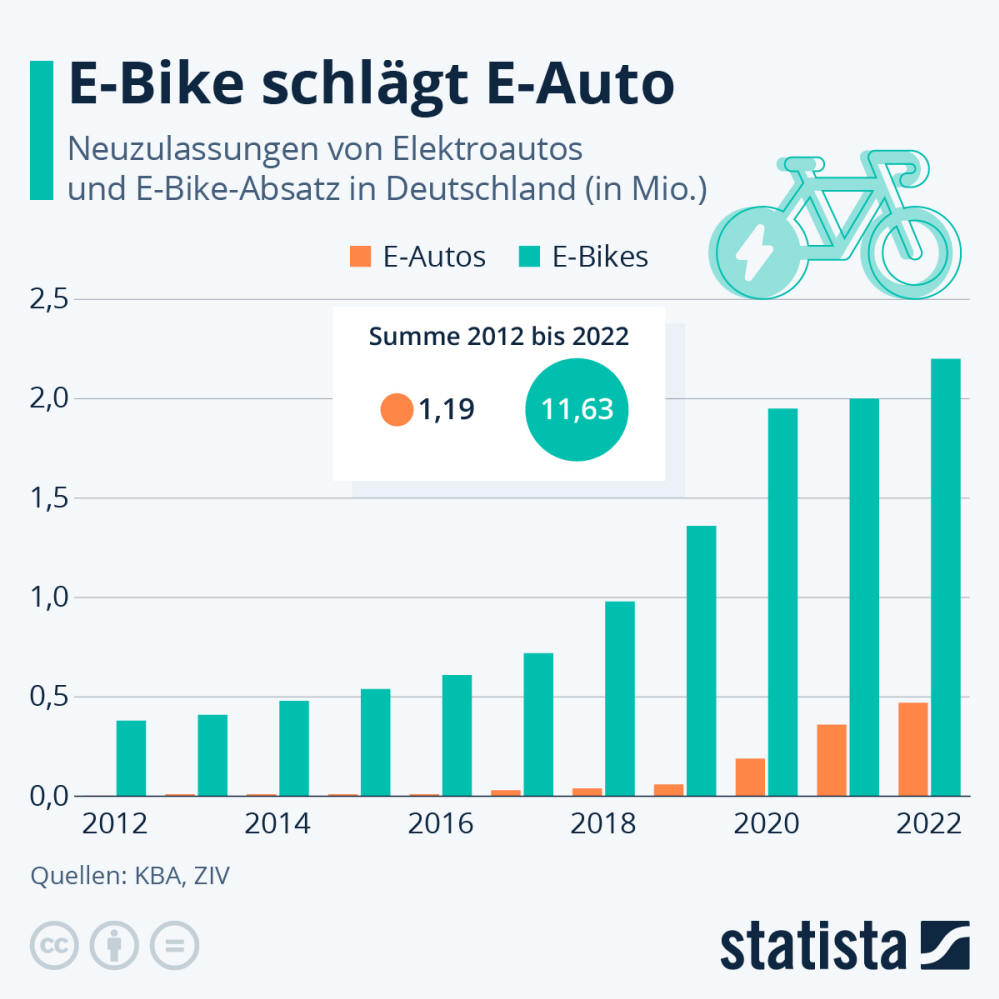|
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 43.Kalenderwoche:
27. Oktober
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
 Sommer-
auf Winterzeit: So. 29.10.2023. Umstellung von 3 auf 2 Uhr
Sommer-
auf Winterzeit: So. 29.10.2023. Umstellung von 3 auf 2 Uhr
Samstag, 28., Sonntag, 29. Oktober 2023 - Welt-Schlaganfalltag
Städte kritisieren Erhöhung der LVR-Umlage 2024
Oberbürgermeister Sören Link und 23 weitere Vertreterinnen und
Vertreter von Städten und Landkreisen haben einen Brief an den
Landschaftsverband Rheinland (LVR) unterzeichnet und fordern in
einem gemeinsamen Appell deutliche Korrekturen bei der
Landschaftsumlage.
Der LVR plant, im kommenden Jahr sein
Personal aufzustocken: 401 Stellen sollen hinzukommen. Das Vorhaben
sehen die Stadt Duisburg und 23 weitere Städte und Landkreise jedoch
mit Sorge. Sie bitten nun in einem Schreiben an den LVR um
„deutliche Korrekturen beim Stellenplan und bei den finanziellen
Auswirkungen“.
Die geplante Stellenaufstockung des LVR würde im kommenden Jahr eine
Steigerung des Personalaufwands um 24,3 Prozent oder 71,7 Millionen
Euro bedeuten. Das wiederum, so die Befürchtung der Städte und
Kreise, zieht eine Erhöhung der Landschaftsumlage von insgesamt rund
182 Millionen Euro nach sich. Und dies vor dem Hintergrund, dass die
Mitgliedskörperschaften mit dem Nachtragshaushalt 2023 bereits eine
erhöhte Landschaftsumlage in Höhe von mehr als 285 Millionen Euro
gegenüber dem Vorjahr zu verkraften und aufzubringen haben.
Oberbürgermeister Sören Link: „Wie viele Kommunen stößt auch die
Stadt Duisburg finanziell an ihre Grenzen. Wir erwarten vom LVR,
dass er diese angespannte Situation der Kommunen bei den eigenen
Planungen berücksichtigt und sich in seinem Einsparverhalten
anpasst.“
Stadtdirektor und Stadtkämmerer Martin
Murrack: „Krisen, Inflation und Rezession stellen die Kommunen und
Kreise vor große Herausforderungen. Eine Entlastung über eine
Senkung der Landschaftsumlage, die für 2023 letztlich auf 15,3
Prozent festgesetzt wurde, wäre also willkommen. Dies könnte über
einen Griff in die Rücklage des LVR geschehen. Genau das ist aber
nicht vorgesehen.
Im Gegenteil: Die Umlage soll nach den
Plänen aus Köln um weitere 5,6 Millionen Euro steigen. Der LVR
verfügt über eine Rücklage von 170 Millionen Euro, von denen er
gerade mal drei Millionen einbringt und 98 Prozent auf den Konten
liegen lässt.
Hier muss der LVR dringend umschwenken und
nennenswerte Teile der Ausgleichsrücklage, die nicht zwingend als
Risikopuffer benötigt werden, zur Entlastung der Landschaftsumlage
einsetzen. Ich möchte dabei auf den Landschaftsverband Westfalen
verweisen, der nur einen Puffer in Höhe von 35 Millionen Euro
vorhält und 83 Millionen Euro seiner Rücklagen zur Entlastung der
Kommunen und Kreise einsetzt.“
Feuerwehr
Duisburg nutzt das Rheinfunk-Konzept
Die
Feuerwehr-Einsatzleitungen im Regierungsbezirk Düsseldorf können
seit Mitte Oktober bei Einsätzen auf dem Rhein nun auch einheitlich
per Funk miteinander kommunizieren. Möglich wurde das sogenannte
RheinfunkKonzept durch eine Vereinbarung der Berufsfeuerwehren
Duisburg, Düsseldorf und Krefeld, der Kreisbrandmeister der Kreise
Kleve, Mettmann und Rhein-Kreis Neuss sowie der Bezirksregierung
Düsseldorf. Direkte gemeindeübergreifende Kommunikation kann in
einem Notfall lebenswichtig sein. Deshalb haben sich die für
Gefahrenabwehr zuständigen Stellen der rheinanliegenden Kommunen des
Regierungsbezirks auf ein optimiertes Kommunikationskonzept
verständigt.
Der Stadt Duisburg kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu: Der
Leitstelle der Feuerwehr werden alle Einsätze auf dem Rhein im
Regierungsbezirk Düsseldorf gemeldet und den rheinanliegenden
Kreisen und Städten des Bezirks auf einer gemeinsamen Plattform zur
Verfügung gestellt, mit dem Ziel, gebietsübergreifende
Einsatzstellen zu identifizieren.
„Durch eine gute
interkommunale Zusammenarbeit können Notfälle auf dem Rhein
zukünftig noch effizienter abgearbeitet werden. Ich bin stolz
darauf, dass der Stadt Duisburg in diesem Konzept so eine bedeutende
Rolle zugesprochen wurde“, betont Stadtdirektor und
Feuerwehrdezernent Martin Murrack. Der Rheinstrom als
Bundeswasserstraße fließt auf rund 215 Kilometer durch
Nordrhein-Westfalen, unter anderem durch den Regierungsbezirk
Düsseldorf.
Hier werden durch den Rhein die
Zuständigkeitsbereiche mehrerer Städte und Kreise berührt und
durchflossen. Die Grenzen, die bei Einsätzen direkt betroffen sein
können, liegen oftmals mitten im Fluss. Das ist beispielsweise der
Fall, wenn eine Person oder ein havariertes Schiff durch die
Fließgeschwindigkeit und die Fließrichtung des Rheins in andere
Gebiete abgetrieben wird.
Jede Stadt und jeder Kreis hat
eigene Zuständigkeiten, sowie Material und Abläufe, die zur
Gefahrenabwehr eingesetzt werden. Und genau hier setzt das Konzept
an: Damit die jeweiligen Einsatzleitungen direkt miteinander
kommunizieren und ihre Einsatzmaßnahmen abstimmen können, wurden
entsprechende Digitalfunk-Rufgruppen festgelegt. Das neue
Rheinfunk-Konzept sieht zusätzlich ein einheitliches Lagebild über
Einsätze auf dem Rhein vor, das den Einsatzleitungen einen schnellen
Gesamtüberblick über die Situation verschafft. Dieses wird zentral
für alle von der Leitstelle der Feuerwehr der Stadt Duisburg
erstellt und geführt.

Die Feuerwehr-Einsatzleitungen der beteiligten Kreise und Städte
nach der Unterzeichnung des Rheinfunk-Konzeptes in der
Bezirksregierung Düsseldorf
Bürgerspaziergang mit dem Oberbürgermeister
Oberbürgermeister Sören Link lädt am Samstag, 18. November, alle
interessierten Bürgerinnen und Bürger zum Spaziergang ein. Der
Rundgang durch den Landschaftspark Duisburg-Nord in Meiderich findet
von 12 bis etwa 15.30 Uhr statt. Freizeit, Erholung, Sport und
Kultur haben im Landschaftspark einen hohen Stellenwert. Es gibt
einen Rundweg mit Informationen zur Industriegeschichte von früher
und heute sowie viel gewachsene Natur, die sich das Gelände von der
Industrie zurückerobert hat. Auch Gärten, Wiesen und Wasserflächen
sind zu sehen.
Anmeldungen werden ab sofort per E-Mail
an unterwegs.mit.dem.ob@stadtduisburg.de bis zum 10. November 2023
entgegengenommen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird die
Teilnahme durch ein Losverfahren entschieden. Bei Fragen steht Lydia
Steinhauer telefonisch unter 0203 283-2413 zur Verfügung. Alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten vor dem Spaziergang den
Treffpunkt sowie weitere Details per E-Mail.
Änderung der Öffnungszeiten des Allwetterbads in Walsum
Das Allwetterbad in Walsum schließt am Samstag und
Sonntag, 28. und 29. Oktober, bereits um 13 Uhr. Grund sind
unerwartete krankheitsbedingte Personalengpässen. DuisburgSport ist
bemüht, den regulären Badebetrieb so schnell wie möglich wieder
aufzunehmen und bittet alle Badegäste um Verständnis für diese
Maßnahme. Aktuelle Informationen gibt es im Internet unter
www.baederportalduisburg.de.
Duisburg hat die erste "Schule der Filmbildung NRW"
Das Albert-Einstein-Gymnasium in Duisburg-Rheinhausen ist die
erste "Schule der Filmbildung NRW". "Film+Schule NRW", eine
gemeinsamen Initiative des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
(LWL) und des NRW-Schulministeriums, hat das Gymnasium
ausgezeichnet. Vorausgegangen war ein zweijähriges
Zertifizierungsprogramm, in dem Filmbildung verbindlich und
systematisch in den Unterricht unterschiedlicher Fächer der
Jahrgangsstufen fünf bis zehn integriert wurde.
So
reichten die Unterrichtsreihen im Fach Deutsch z.B. von der
Literaturverfilmung bis zum Influencer-Clip, zudem steht ein
Filmprojekt mit einem Filmschaffenden und der Besuch der
Schulkinowochen NRW auf dem jährlichen Stundenplan. So sollen
audiovisuelle Kompetenzen entwickelt werden, die die Kinder
befähigen, sich selbstbestimmt in diesen Welten zu bewegen und z.B.
gegen Manipulationen gewappnet zu sein. idr
Monatliche Sprechstunde zum Glasfaserausbau
Die Stadt Duisburg bietet im November wieder Sprechstunden zum
Glasfaserausbau in den Bezirksverwaltungen an. Interessierte
Bürgerinnen und Bürger können sich rund um das Thema Breitbandausbau
informieren sowie beraten lassen. Gigabitkoordinator Falko König von
der Stabsstelle Digitalisierung, wird jeweils von 8 bis 16 Uhr
Auskünfte zu sämtlichen Fragen rund um die moderne
Breitbandversorgung geben.
Die nächste Sprechstunde
findet am Donnerstag, 2. November, in der Bezirksverwaltung Mitte
auf dem Sonnenwall 73-75 statt.
- Weitere Termine sind:
Donnerstag, 9. November, Bezirksverwaltung Süd, Sittardsberger Allee
14
- Mittwoch, 15. November, Bezirksverwaltung Rheinhausen,
Körnerplatz 1
- Dienstag, 21. November, Bezirksverwaltung
Hamborn, Duisburger Straße 213
- Mittwoch, 22. November,
Bezirksverwaltung Walsum, Friedrich-Ebert-Straße 152
-
Donnerstag, 23. November, Bezirksverwaltung Homberg/Ruhrort/Baerl,
Bismarckplatz 1
Zur besseren Planung und um Wartezeiten
zu vermeiden, wird um vorherige Anmeldung per E-Mail unter
breitbandausbau@stadt-duisburg.de gebeten. Zusätzlich zu den vor Ort
angebotenen Terminen können auch individuelle OnlineSprechstunden
via Microsoft Teams vereinbart werden.
Interessierte Bürgerinnen und
Bürger können hierzu das Formular unter
https://breitband.duisburg.de nutzen. Eine entsprechende Einladung
zur persönlichen Sprechstunde wird den Teilnehmenden dann per E-Mail
zugestellt. Eine Übersicht aller Termine in den Bezirksverwaltungen
findet sich auch online unter https://breitband.duisburg.de
Kürbisfest läutet am Sonntag den Herbst in der City ein
Das Duisburger Kürbisfest taucht die Innenstadt am
Sonntag in herbstliches Orange. Parallel dazu lädt der Einzelhandel
zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Was das Fest in diesem Jahr bietet.
Das Herbst-Event findet in diesem Jahr zum dritten Mal statt. Das
Fest verbindet Einflüsse von Erntedank mit Halloween. Der Kürbis
gelte dabei als Symbol und Sympathieträger, heißt es. Die
Vielseitigkeit des orangefarbenen Gemüses soll während des Fests
immer wieder präsent sein.
Vor allem an Kinder richtet
sich das Angebot zum Kürbis-Schnitzen und Basteln. Rund 250 der
eindrucksvollen Gemüsefrüchte dienen als Dekoration und als Rohstoff
zum Schnitzen. Kinder und Erwachsene können sich bei den
Hexenführungen wohlig gruseln, historische Traktoren bestaunen oder
bei der Show der beliebten DONIKKL CREW aktiv mitmachen. Für Ordnung
auf dem Kürbisfest sorgt „Zwille Zimmermann“ als französischer
Gendarm, der von weiteren Walking Acts unterstützt wird. Außerdem
dabei: Marionettentheater, Kinderschminken, eine Naturwerkstatt und
viele Künstler auf der Bühne, einer von ihnen ist Gitarrenlegende
Peter Bursch.
Weil das Erntedankfest ein wichtiger
Charakterzug des Kürbisfests ist, sind auch viele Stände des
Bauernmarkts mit dabei, die frisches Obst und Gemüse aus der Region
anbieten, heißt es beim Veranstalter Duisburg Kontor. Kunsthandwerk
und ein breites gastronomisches Angebot sind am Sonntag ebenfalls
Teil des Kürbisfests. Los geht’s ab 11 Uhr, gefeiert wird bis etwa
18 Uhr.

Foto: Thomas Berns
„Zu wenig und zu schlecht gemacht, um armen Kindern zu
helfen!“
Heinz Hilgers, Kinderschützer und Ideengeber
der Kindergrundsicherung übt deutliche Kritik am Gesetzentwurf der
Koalition. Der Ehrenpräsident des Deutschen Kinderschutzbundes,
Mitbegründer des „Bündnis Kindergrundsicherung, SPD-Mitglied,
ehemaliger Bürgermeister von Dormagen und Mitbegründer des
„Dormagener Modells“ übt im Interview mit dem Deutschen
Kinderbulletin (DKB) deutliche Kritik an den derzeit bekannten
Plänen zur Einführung eine Kindergrundsicherung, da mit den
geplanten Maßnahmen die beschämende Kinderarmut in Deutschland nicht
nachhaltig bekämpft werden kann.
Hilgers: „Für eine wirkliche Reform brauchen wir eine Leistung für
tatsächlich alle Kinder in angemessener Höhe, die echte Teilhabe
ermöglicht. Dafür muss neu berechnet werden, was Kinder für ein
gutes Aufwachsen brauchen. Eine solche Neuberechnung ist aktuell
leider nicht geplant, obwohl sie im Koalitionsvertrag vereinbart
wurde. Zudem muss die Leistung nach der Geburt möglichst automatisch
bei den Familien ankommen, ohne große Antragskämpfe. Familien müssen
von Anfang an eine einzige Behörde als Ansprechpartner haben, wo sie
sich mit allen Problemen digital und analog hinwenden können.
Um das System dann noch gerechter zu gestalten, brauchen wir
zudem unbedingt ein Ende der ungleichen Förderungen von Kindern
entsprechend der Einkommen der Eltern. Staatliche monetäre
Kinderförderung muss dazu dienen, allen Kindern ein gutes Aufwachsen
zu ermöglichen und jeweils in der Höhe einspringen, die Eltern nicht
selbst gestemmt bekommen.
Um Kinderarmut dauerhaft und
effizient zu bekämpfen, braucht es auf mehreren Ebenen
Veränderungen. Auf Bundesebene fordern wir die beschriebene echte
Kindergrundsicherung, um ausreichende Geldmittel in allen Familien
sicherzustellen.
Auf Landesebene brauchen wir gleichzeitig
dringend Verbesserungen im Bildungsbereich. Noch nie zuvor haben die
schulischen Leistungen von Kindern in Deutschland so sehr von ihrem
Elternhaus abgehangen. Wir müssen Kindern über eine gute und
inklusive Schul- und Bildungspolitik den perspektivischen Weg aus
der Armut ermöglichen.
Und drittens braucht es auf kommunaler
Ebene inklusive und individuelle Unterstützung vor Ort. Dabei müssen
die bestehenden Hilfen ausgebaut und verstetigt werden, und der
Umgang mit allen Familien muss mehr von Wertschätzung und
Hilfsbereitschaft geprägt sein.
Es braucht hier gute Präventionsketten wie das Dormagener Model, bei
dem das ganze Hilfesystem um das einzelne Kind herum gut und
effizient zusammenarbeitet und das Kindeswohl im absoluten Fokus
steht. Nur wenn wir alle diese Veränderungen gemeinsam angehen,
werden wir an der verfestigten Kinderarmut in Deutschland etwas
ändern können. Denn Kinder brauchen das alles: ein gutes Frühstück,
eine gute Schule und gute Bezugspersonen, um den Weg aus der
verfestigten Armut zu finden.“ Das Deutsche Kinderbulletin (DKB)
unterstützt die Forderungen von Herrn Hilgers.
Nicht Fisch, nicht Fleisch - bei Jugendlichen mit guter
Betreuung machbar, bei Säuglingen und Kleinkindern bitte nicht!
Knapp zehn Prozent der Erwachsenen in Deutschland leben
vegetarisch oder vegan – Tendenz steigend. Viele davon ernähren auch
ihre Kinder vegetarisch oder vegan. Aber auch immer mehr Kinder und
Jugendliche entscheiden sich selbständig, auf Fleisch oder tierische
Produkte zu verzichten. Während vegetarische Ernährung inzwischen
vor allem im Jugendalter unter bestimmten Voraussetzungen als gut
machbar gilt, sehen die Fachgesellschaften und Kinder- und
Jugendärzt*innen vegane Ernährung weiterhin kritisch – vor allem bei
den Kleinsten.
Dies erklärte heute in Bonn anlässlich
des Weltvegantags am 1.11. Dr. Axel Gerschlauer,
Landespressesprecher der nordrheinischen Kinder- und
Jugendärzt*innen: „ Die Studienlage zu veganer Ernährung in
kritischen Wachstumsphasen ist noch immer nicht ausreichend, so dass
wir Kinder- und Jugend*ärztinnen von einer veganen Ernährung vor
allem im Säuglings- und Kleinkindalter abraten. Aus
wissenschaftlicher Sicht ist die „Optimierte Mischkost“ der Standard
für die Kinderernährung in Deutschland.
Die sich aus
mehreren Bausteinen zusammensetzende Ernährungspyramide sieht unter
anderem auch den mäßigen Verzehr von Fleisch und tierischen
Produkten wie Milch und Käse vor. Durch vegane Ernährung verzichten
Kinder auf mehrere wichtige Bausteine der Pyramide und müssen die
nun fehlenden Nährstoffe anders aufnehmen, um sich gesund zu
entwickeln. Dies ist nur eingeschränkt über natürliche Lebensmittel
möglich, Vitamin B12 zum Beispiel muss immer supplementiert werden.“
•
Säuglinge und Kleinkinder: Nicht vegan
ernähren!
Zu keinem Zeitpunkt reagiert der kindliche Organismus
empfindlicher auf Nähstoffmangel als im Kleinkind- und v.a.
Säuglingsalter. Neben der reinen Kalorienzahl ist eine ausreichende
Menge an einer Vielzahl von Stoffen notwendig, um ein gutes
Körperwachstum und die gesunde Entwicklung aller Organe,
insbesondere des Gehirns, zu ermöglichen. Kritisch ist bei veganer
Ernährung die Versorgung mit Eiweiß und bestimmten Fettsäuren,
Vitaminen Mengen- und Spurenelementen.
Schon kleinere
Schwankungen und Unterversorgungen mit z.B. Vitamin B12 können die
im Wachstum befindlichen und daher besonders empfindlichen Organe
eines Säuglings schädigen, vor allem die neurologische Entwicklung
und geistige Gesundheit massiv und auch dauerhaft gefährden. Daher:
bitte nicht!!! Stillen Ernährt sich die Mutter vegan und stillt,
sollte sie unbedingt Vitamin B12-Präparate nehmen und regelmäßig
ihre Blutwerte ärztlich kontrollieren lassen.
•
Ältere Kinder und Jugendliche: Wenn, dann
bitte richtig!
„Es ist lobenswert, wenn sich Jugendliche für
Tierwohl und Umweltfragen interessieren und engagieren. Der Schritt
zur veganen Ernährung geschieht in dieser Altersgruppe oftmals aus
genau diesen beiden Gründen“ so Gerschlauer. Die Jugendlichen
sollten jedoch wissen, woher sie wichtige Nährstoffe bekommen. Eine
Beratung der Familie durch eine qualifizierte Ernährungsfachkraft
ist unverzichtbar – ausschließliches Eigenstudium durch Literatur
oder z.B. YouTube haben sich in der Praxis als unzureichend
erwiesen.
•
Nicht vergessen: Regelmäßige Blutabnahmen zur
Kontrolle des Versorgungsstatus sind ebenfalls unverzichtbar, um die
Gesundheit vegan ernährter Kinder und Jugendlicher nicht zu
gefährden. Fazit: Säuglinge und Kleinkinder sollten nicht vegan
ernährt werden. Ältere Kinder und Jugendliche können sich vegan
ernähren, benötigen dann aber qualifizierte ökotrophologische und
ärztliche Betreuung.
Herbst: Wer muss Bürgersteig vom Laub freihalten?
Reinigungspflicht kann übertragen werden Wer haftet bei
Unfällen Coburg, 26.10.2022 Viele genießen den goldenen Herbst,
wenn das Laub sich langsam verfärbt. Mit sinkenden Temperaturen
verlieren Bäume aber auch ihre Blätter, Niederschläge nehmen zu.
Beides zusammen verwandelt Bürgersteige in Rutschbahnen. Ohne Räumen
ist ein Unfall schnell passiert.
Wer zum Besen greifen
muss, regeln die meisten Kommunen in ihren Satzungen. Hier schreiben
sie fest, ob und in welchem Umfang sich Hauseigentümer um die
Reinigung der Bürgersteige kümmern müssen. Wer sich der
Reinigungspflicht dauerhaft entzieht, begeht eine
Ordnungswidrigkeit. Den Eigentümern eines Mietshauses steht es
offen, die Reinigungspflicht über den Mietvertrag an die Mieter
weiterzugeben.

Gefährlich: Nasses Herbstlaub kann Bürgersteige schnell in rutschige
Flächen verwandeln. Räumen ist deshalb für Hauseigentümer oder
Mieter in vielen Kommunen Pflicht. Foto: HUK-COBURG
Ereignet sich ein Unfall, hat der nicht nur eine strafrechtliche
Seite. Hier geht es, wie die HUK-COBURG mitteilt, auch um
persönliche Haftung. Bricht sich ein Passant beispielsweise das
Bein, weil vergessen wurde, die Blätter wegzufegen, muss der
Verantwortliche für den Schaden aufkommen. Ohne
Haftpflichtversicherung kann das teuer werden: Im geschilderten Fall
können dem Geschädigten Schmerzensgeld und falls er arbeitet auch
eine Entschädigung für seinen Verdienstausfall zustehen. Bleiben
nach einem Unfall dauerhafte Schäden zurück, können sogar
lebenslange Rentenzahlungen fällig werden.
Ob und in welchem
Umfang ein säumiger Laubräumer haftet, hängt allen Regeln zum Trotz
oft von den speziellen Umständen des Einzelfalls ab. Sollte der
Geschädigte den Rechtsweg beschreiten, steht die
Haftpflichtversicherung ihrem Kunden zur Seite.
MSV Duisburg – Rot-Weiss Essen: DVG setzt zusätzliche Busse
ein
Für Gäste des Fußballspiels MSV Duisburg gegen
Rot-Weiss Essen am Samstag, 28. Oktober, um 14 Uhr in der
Schauinsland-Reisen Arena, setzt die Duisburger Verkehrsgesellschaft
AG (DVG) die Sportlinie 945 ein.
Abfahrtszeiten Buslinie 945 Richtung MSV Arena
- ab
„Salmstraße“ (Meiderich) Abfahrt um 12.06, 12.16, 12.26 Uhr
- ab
„Bergstraße“ um 12.11, 12.21 und 12.31 Uhr
- ab „Meiderich
Bahnhof“ ab 12.15 bis 12.40 Uhr alle fünf Minuten
- ab
„Großenbaum Bahnhof Ost“ um 12.50 und 13.05 Uhr
- ab
„Betriebshof am Unkelstein“ ab 11.58 bis 12.23 Uhr alle fünf Minuten
- ab „Duisburg Hauptbahnhof“ (Verknüpfungshalle) - ab 12.15 bis
13.35 Uhr alle fünf Minuten
- ab „Businesspark Nord“
(Asterlagen) um 12.33 Uhr.
Nach Spielende stehen am Stadion
Busse für die Rückfahrt bereit. Gäste des Fußballspieles, die eine
Tageseintrittskarte im Vorverkauf erworben haben oder eine
Dauerkarte besitzen, können kostenlos die öffentlichen
Verkehrsmittel für die Hin- und Rückfahrt benutzen. Für die Gäste,
die sich an der Stadionkasse ihre Eintrittskarte kaufen, ist die
Rückfahrt mit Bus und Bahn kostenlos.
Stadtarchiv: „Mercators Tiere“ – Zwischen gelehrten
Abbildungen und handfesten Wesen
Das Stadtarchiv
Duisburg, Karmelplatz 5 am Duisburger Innenhafen, lädt am 2.
November um 18.15 Uhr in Kooperation mit der Mercator-Gesellschaft
unter dem Titel „Mercators Tiere“ zu einem Vortrag von Ferdinand
Leuxner ein. Gerhard Mercator (1512-1594) gilt vielen als ein
Universalgelehrter, als genialer Kartograf und wegweisender
Weltbeschreiber an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. Er lebte
in einer Zeit, in der Tiere im Alltag eine große, sogar
überlebenswichtige Rolle spielten.
Sie waren
allgegenwärtig – in der Stadt Duisburg, auf den Feldern ringsum und
nicht zuletzt, geschlachtet und zubereitet, auf dem Tisch. So ist
auch das Werk „Meister Gerhards“ durchzogen von schnüffelnden,
schwimmenden, trötenden und grunzenden Wesen, die bisher allerdings
noch kaum die Beachtung der Forschung gefunden haben. Die
„tierischen“ Anteile im Werk des berühmten Duisburgers sind jedoch
elementar: Sie helfen uns, die Zeit besser zu begreifen, in der der
Kosmograf seine Karten entwarf und an seinen theologischen Texten
feilte. Denn in allen Epochen machten sich die Menschen Gedanken
über die „anderen“ Lebewesen, die sie umgaben.
Tiere
konnten so zu Sternbildern aufsteigen oder wurden zu einem Symbol
für den Teufel selbst erklärt. Wie Forscher und Forscherinnen,
Philosophen und Philosophinnen auf eine Tierart blickten, war dabei
zeit- und gesellschaftsabhängig – und hatte oft wenig mit dem echten
Tier zu tun. Alltag und Wissenschaft sollen auch im Vortrag eine
bedeutende Rolle spielen, denn Mercator scheint beides gewesen zu
sein: Ein praktisch begabter Kartenmacher, der seine Umgebung genau
beobachtete und zugleich ein Gelehrter, der in den Wissenschaften
seiner Zeit reüssierte. Die Anzahl der Teilnehmenden ist begrenzt,
der Eintritt ist kostenfrei.

Himmels-Globus von Gerhard Mercator (Foto: Stadtarchiv Duisburg)
Mercator Matinée: Viel zu langsam viel erreicht
Die Schriftstellerein Barbara Sichtermann spricht am
Sonntag, 29. Oktober, um 11.15 Uhr bei der Mercator-Matinée im
Kultur- und Stadthistorischen Museum, Johannes-Corputius-Platz 1 am
Duisburger Innenhafen, unter dem Titel „Viel zu langsam viel
erreicht“ über die Entwicklung der Frauenrechte. Bis heute wird der
Gedanke der Gleichheit gerne missverstanden: Wir wollen
unterschiedlich sein, divers, individuell und anders – aber als
solche wollen wir gleiche Rechte. Solange die Gleichheit vor dem
Gesetz nur Angehörige verschiedener Stände, Stämme oder Konfessionen
betraf, konnte er sich noch vergleichsweise geräuschlos entwickeln.
Als er bei den Geschlechtern ankam und das Private
politisch wurde, wurde die Irritation heftig und öffentlich. Die
Emanzipation der Frauen ist eine kostbare Leistung der Moderne. Sie
muss weitergehen, damit sie bewahrt werden kann. Die Teilnahme ist
im Museumseintritt enthalten und kostet für Erwachsene 6 Euro, für
Kinder (und ermäßigt) 4 Euro. Das vollständige Programm ist im
Internet unter www.stadtmuseumduisburg.de abrufbar.
VHS-Kurs: Makrofotografie mit und ohne
Figuren
„Makrofotografen sind oft mit
einem Quadratmeter stundenlang beschäftigt“ - ob
dieses Sprichwort stimmt, kann man in einem VHS-Kurs
am Sonntag, 29. Oktober, von 8 bis 12 Uhr im
Landschaftsparkt Duisburg Nord herausfinden.
Treffpunkt ist am Haupteingang zum Landschaftspark.
Neben Insekten und Blumen stehen im Landschaftspark
wunderschöne Strukturen zur Verfügung, die auf
verschiedenste Arten abgelichtet werden können.
Nach einer kurzen Einführung in die Kamera-
und Gestaltungstechnik geht es direkt ans Werk. Der
Kurs startet früh, weil die Morgenstunden die beste
Zeit für Makrofotografie sind. Zusätzlich werden mit
kleinen Alltagsgegenständen wie Figuren kleine
Welten gebaut. Wer möchte, darf gerne Gegenstände
mitbringen. Empfehlenswert ist auch der Kauf einer
Rettungsdecke (ca. zwei Euro) als Unterlage und
Reflektor.
Der Kurs richtet sich an
Einsteiger und Fortgeschrittene. Das
Teilnahmeentgelt beträgt 29 Euro. Ermäßigungen sind
möglich, eine vorherige Anmeldung ist erforderlich:
www.vhs-duisburg.de.
Landschaftspark: Weihnachtliches Konzert der Big Band in der
Gebläsehalle
Am 17. Dezember 2023 präsentiert der
Landschaftspark Duisburg-Nord ein Weihnachtskonzert mit der Big Band
und der Nachwuchs - Big Band Muskito bee bee der Musik- und
Kunstschule Duisburg. Im rauen Charme der beleuchteten Gebläsehalle
spielen unter der Leitung von Rüdiger Testrut Saxophone, Posaunen,
Trompeten echte Weihnachtsklassiker.
Eine Premiere feiert die Big Band mit den Young Voices I und II
von Anne-Sarah Gibson - zwei hervorragende Jugendchöre, die mit
beiden Bands zwei musikalische Welten zusammenbringen, wonach sich
alle lange gesehnt haben. Die Big Band der Musik- und Kunstschule
ist aus dem kulturellen Leben Duisburgs nicht wegzudenken und hat
sich bereits durch Auftritte auf dem „Traumzeitfestival“ und „Jazz
auf’m Platz“ ihr Publikum erspielt, schließlich ist die Band schon
seit mehr als 25 Jahren fester Bestandteil der Duisburger
Musikszene.

Tickets Die Karten gibt es online unter
www.reservix.de und vor Ort im
Besucherzentrum des Parks zu kaufen. Die Ticketpreise in drei
Kategorien liegen bei 22 €, 26 € und bei 30 €. Termin Theatersaal in
der Gebläsehalle, Landschaftspark Duisburg-Nord 17.12.2023, Beginn
17 Uhr, Einlass ab 16 Uhr
PST!
Experimentelles und Improvisiertes
Johannes Nebel (bass,
electronics), Patrick Hengst (drums), Thomas Klein ( keys, synth,
electronics): drei Musiker haben sich 2021 zusammengetan, um
ihre eigene Vision einer einzigartigen Musik zu verwirklichen.
Stilelemente sind hierbei improvisierte elektronischer Musik, 70er
Jahre Groove, Jazz, freie Improvisationen und elektronische
Soundexperimente.
Die Band begibt sich auf eine musikalische
Entdeckungsreise, die von sehr unterschiedlichen Stilen berührt ist
und öfters auch durch ausdrucksstarke melodische Themen glänzt.
Virtuose Instrumentalisten, die ihre einzigartigen musikalischen
Fähigkeiten perfekt aufeinander abgestimmt haben beweisen PST! mit
ihren improvisierten Klanglandschaften und groovigen Beats ihre
Kreativität und ihr Talent für das Zusammenwirken von verschiedenen
Musikstilen.
Die Live-Auftritte von "PST!" sind ein
Erlebnis für sich. Sie haben die Fähigkeit, das Publikum mit ihren
unkonventionellen und fesselnden Klangwelten zu begeistern und zu
faszinieren. Jeder Auftritt ist einzigartig und bietet eine neue
musikalische Reise, welche die Zuhörer auf eine emotionale
Achterbahnfahrt mitnimmt. Beim Konzert vertritt Johannes Nebel den
verhinderten Stammbassisten Stefan Werni.
Simon Camatta
SOLO
Simon Camatta wurde 1976 in Essen geboren. Mit 11 Jahren
bekam er sein erstes Schlagzeug zu Weihnachten. Er studierte Jazz an
der Folkwang Hochschule Essen. Seit 25 Jahren spielt er in den
unterschiedlichsten Bereichen in den halben Welt. Zur Zeit mit The
Dorf, Handsome Couple feat. DJ Illvibe, EssenerNoiseDubEnsemble und
in diversen Improvisationsprojekten, sowie an verschiedenen Theatern
und mit diversen Tanzkompanien. Obendrein ist er auch Solo
unterwegs.
PST ! & Simon Camatta SOLO Samstag, 28.
Oktober 2023, ab 19 Uhr Lokal Harmonie, Harmoniestr. 41, 47119
Duisburg-Ruhrort Eintritt: frei(willig) - Hutveranstaltungen
Festgottesdienste zum
Reformationstag in Duisburg
Für evangelische
Christinnen und Christen ist der 31. Oktober Reformationstag. Sie
erinnern an den Tag, an dem Martin Luther eine kirchliche
Erneuerungsbewegung einleitete. Die Gemeinden im Evangelischen
Kirchenkreis Duisburg laden an dem Tag zu Gottesdiensten ein, die -
jeder auf seine Weise - die Reformation in den Mittelpunkt stellen.
•
Im Duisburger Norden feiern die sechs Gemeinden des
Kirchenkreises nördlich der Ruhr gemeinsam am 31. Oktober um 18 Uhr
in der Obermeidericher Kirche an der Emilstraße. Unter dem Titel
„Vom Ende der Gewissheit“ werden Pfarrerin Sarah Süselbeck und
Pastor i.R. Stephan Kiepe-Fahrenholz Gedanken der Reformation
nachzeichnen, um zu hören, welche Antworten sie heute hat, und zwar
auf die Frage „Was tun, wenn das Weltbild zerbricht, wenn alles, was
sicher scheint, nicht mehr sicher ist?“ und „Wie kann ich leben,
wenn alles um mich herum verändert?“
Für festliche Klänge sorgen
Nadja Stahlbaum am Cello und Evelyn Klaunzer mit ihrer Querflöte
sowie Christine Gladbach mit ihrer wunderbaren Stimme.
•
In der Salvatorkirche feiern am gleichen Tag
Gläubige aus Duisburg Mitte einen Reformationsgottesdienst in der
Salvatorkirche um 18 Uhr zur Frage, was „Gerechtigkeit aus Glauben“
bedeutet. Es predigt Pfarrer Stephan Blank, passende Musik macht
Kirchenmusikdirekt Marcus Strümpe mit seinem Orgelspiel.
•
Weitere Gottesdienste zum Reformationstag werden
auch im Duisburger Süden gefeiert: Die Gemeinden Wanheim und
Wanheimerort feiern ihn zusammen am 31. Oktober in der Gnadenkirche
Wanheimerort um 19 Uhr. Die Gemeinden Großenbaum-Rahm und
Auferstehungsgemeinde feiern am gleichen Tag in der Ungelsheimer
Auferstehungskirche um 19 Uhr den Gottesdienst „Wort und Klang zur
Reformation“.
Am gleichen Tag feiert die Evangelische
Kirchengemeinde Trinitatis einen Fest-Gottesdienst um 18.30 Uhr in
der Wedauer Kirche, Am See. Eric Hansen predigt im Rahmen seiner
Ausbildung zum Prädikanten zum Thema „die Kirche muss sich immer
erneuern“. Infos zum Evangelischen Kirchenkreis Duisburg, den
Gemeinden und ihren Gottesdiensten gibt es im Netz unter
www.kirche-duisburg.de.

Zwei der 100 Lutherfiguren des Künstlers Ottmar Hörl, die 2013 zu
Gast beim Kreiskirchentag in Duisburg waren. Foto: Rolf Schotsch
Wort und Klang zum Reformationstag in Ungelsheim
Konzert, Lesung und Andacht in einem Am Dienstag, 31. Oktober
2023 heißt es ab 19 Uhr „Wort und Klang zum Reformationstag“ in der
Ungelsheimer Auferstehungskirche am Sandmüllersweg. Das Motto für
die Mischung aus Konzert, Lesung und Andacht ist „Denn ein Mensch,
der da isst und trinkt…“ – so beginnt ein Vers aus dem 3. Kapitel
des alttestamentlichen Buches „Prediger“ in der Bibel.
Den Abend gestalten Mitglieder des Blockflötenensembles Duisburg
Neudorf unter der Leitung von Volker Nies, Anke Schmock (Orgel) und
Pfarrer Rainer Kaspers, der die passenden Worte zum Feiertag der
evangelischen Kirche ausgewählt hat und lesen wird. Der Eintritt ist
frei. Im Anschluss sind alle Besucherinnen und Besucher zu einer
Brotzeit eingeladen. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter
https://evaufdu.de.
Wiegenlieder der Welt im Konzert in der Marienkirche
Das nächste Kammerkonzert am Marientor bringt am
Sonntag, den 29. Oktober 2023 um 17 Uhr Wiegenlieder der Welt zu
Gehör. Es sind Titel wie „Berceuse“ oder „Lullaby“, welche große
Komponisten aus allen Jahrhunderten und allen Ländern zu
ergreifenden Werken inspiriert haben. Einige davon aus Klassik und
Romantik präsentiert das „Duo BalKan“ in dem einstündigen Konzert in
der Duisburger Marienkirche, Josef Kiefer Str. 6.
Die
beiden Musiker des Duos sind Önder Baloglu, Violine, und Cagdas
Özkan, Klavier. Der Eintritt ist frei, Spenden am Ende willkommen.
Präsentiert wird das Konzert von der Erato-Akademie für Musik und
Sprache Rhein-Ruhr. Infos zur Marienkirche und zur Evangelischen
Kirchengemeinde Alt-Duisburg gibt es im Netz unter
www.ekadu.de.

"Duo BalKan" (Foto:
https://www.facebook.com/duobalkan).
Pfarrer
Seeger am Service-Telefon der evangelischen Kirche in Duisburg
„Zu welcher Gemeinde gehöre ich?“ oder „Wie kann ich in
die Kirche eintreten?“ oder „Holt die Diakonie auch Möbel ab?“:
Antworten auf Fragen dieser Art erhalten Anrufende beim kostenfreien
Servicetelefon der evangelischen Kirche in Duisburg.
Es ist
unter der Rufnummer 0800 / 12131213 auch immer montags von 18 bis 20
Uhr besetzt, und dann geben Pfarrerinnen und Pfarrer Antworten auf
Fragen rund um die kirchliche Arbeit und haben als Seelsorgende ein
offenes Ohr für Sorgen und Nöte. Das Service-Telefon ist am Montag,
30. Oktober 2023 von Rolf Seeger, Pfarrer in der Evangelischen
Kirchengemeinde Duisburg Wanheim, besetzt.

Haushaltsenergie: Preise trotz Rückgängen weiterhin
deutlich höher als 2020
· Preisanstieg für
Haushaltsenergie zuletzt abgeschwächt
· Leichtes Heizöl, Erdgas
und feste Brennstoffe mit aktuellen Preisrückgängen,
Preissteigerungen bei Fernwärme und Strom
· Preise für
Haushaltsenergie sind seit 2020 wesentliche Treiber der Inflation
Zu Beginn der Heizsaison sind die Preise für zum Heizen
benötigte Energie weiterhin hoch. Zwar stiegen die Preise für
Haushaltsenergie, die Strom, Gas und andere Brennstoffe umfasst,
zuletzt weniger stark, sie waren aber nach wie vor deutlich höher
als 2020. Wie Destatis mitteilt, erhöhten sich die Verbraucherpreise
für Haushaltsenergie im September 2023 im Vergleich zum
Vorjahresmonat um 6,3 %. Im Januar 2023 waren die Preise für
Haushaltsenergie im Vergleich zum Vorjahresmonat noch um 36,5 %
gestiegen.
Der Preisanstieg von Haushaltsenergie
übersteigt weiterhin die Gesamtteuerung: Die Verbraucherpreise
insgesamt nahmen im September 2023 im Vergleich zum Vorjahresmonat
um 4,5 % zu. Insgesamt liegen die Preise für Haushaltsenergie
deutlich über dem Niveau von 2020: Im September 2023 waren sie um
55,7 % höher als im Jahresdurchschnitt 2020, während der Gesamtindex
seitdem um 17,8 % stieg.
Feste Brennstoffe günstiger als ein Jahr zuvor
Für private
Haushalte, die alternativ oder ergänzend mit festen Brennstoffen
heizen, ergeben sich aktuell ebenfalls Preisrückgänge: Brennholz,
Pellets und andere Brennstoffe verbilligten sich im September 2023
um 18,1 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Im September 2022 hatte sich
der Preis hierfür im Vergleich zu September 2021 mehr als verdoppelt
(+103,1 %).
Fernwärme und Strom bisher teurer als ein Jahr
zuvor
Anders sieht es bei Fernwärme und insbesondere bei Strom
aus: Fernwärme verteuerte sich auf Verbraucherseite im September
2023 gegenüber dem Vorjahresmonat leicht um 0,3 %. Und das trotz der
hohen Preise im September 2022, als die Preise im Vergleich zu
September 2021 um 37,2 % gestiegen waren.
Die Strompreise
verzeichneten im September 2023 ein Plus von 11,1 % gegenüber dem
Vorjahresmonat. Dies trifft auch die privaten Haushalte, die sich
für den Einbau einer Wärmepumpe entschieden haben. Auch hier war das
Niveau im Vorjahresmonat bereits sehr hoch: Für Strom hatte die
Teuerungsrate im September des Vorjahrs bei +20,3 % gelegen.
Haushaltsenergie als Preistreiber seit 2020
Über die
letzten drei Jahre betrachtet war Haushaltsenergie ein wesentlicher
Treiber für die Inflationsrate. Im Vergleich zum Jahresdurchschnitt
2020 sind die Verbraucherpreise für alle Haushaltsenergieprodukte,
die zum Heizen verwendet werden, deutlich gestiegen. So lag etwa die
Preiserhöhung bei Erdgas im September 2023 im Vergleich zum
Jahresdurchschnitt 2020 bei +94,0 %. Die Preise für leichtes Heizöl
haben sich sogar mehr als verdoppelt (+124,7 %), Fernwärme wurde um
39,0 % teurer. Die Strompreise erhöhten sich um mehr als ein Drittel
(+35,4 %).

Energetische Sanierung als Umsatztreiber: Elektro-,
Gas-, Wasser-, Heizungsinstallation nominal mit zweistelligem Plus
zum Vorjahr
• Bauhauptgewerbe insgesamt wird belastet
vom Umsatzeinbruch im Gebäudebau und gestützt vom Tiefbau
Die
hohen Baukosten infolge der gestiegenen Zinsen und Preise für
Baumaterialien haben für einen Konjunktureinbruch in der Baubranche
gesorgt. Davon war besonders das Bauhauptgewerbe und hier
insbesondere der Gebäudebau betroffen. Wie Destatis mitteilt, ist
der Umsatz im Bauhauptgewerbe im 2. Quartal 2023 preisbereinigt um
3,4 % gegenüber dem 2. Quartal 2022 gesunken. Zu der negativen
Veränderung trägt überwiegend der Wohnungsbau im Bauhauptgewerbe
(-7,0 %) bei.
Der Umsatz im Ausbaugewerbe verzeichnete
im 2. Quartal 2023 preisbereinigt einen Rückgang von 3,1 % im
Vergleich zum Vorjahresquartal und nominal (nicht preisbereinigt)
aufgrund der gestiegenen Baupreise ein Plus von 9,2 %. Hauptgrund
für die vergleichsweise positive Entwicklung im Ausbaugewerbe war
die Nachfrage nach energetischer Sanierung: Innerhalb des
Ausbaugewerbes legten die nominalen Umsätze für die Installation von
Elektro, Gas, Wasser und Heizung zuletzt zweistellig zu. So
verzeichnete die Elektroinstallation nominal 17,5 % mehr Umsatz im
2. Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahresquartal, der Bereich Gas-,
Wasser-, Heizungs-, Lüftungs- und Klimainstallation legte im selben
Zeitraum um 13,2 % zu.

Spotify: Erstes profitables Quartal seit Anfang 2022
Obwohl Spotify seine
Abopreise in Kernmärkten wie den USA, dem Vereinigten Königreich und
Frankreich zum 1. August um einen US-Dollar respektive einen Pfund
beziehungsweise einen Euro erhöht hatte, blieb der
Premium-Abonnent:innenzuwachs im Vergleich mit den
Vorjahresquartalen in etwa gleich. Zu Ende September hatten 226
Millionen Menschen weltweit ein Premium-Abo, sechs Millionen mehr
als im zweiten Quartal. Auch die Profitabilität des Konzerns
verbesserte sich im Vergleich zu den vorherigen Quartalen deutlich
auf 62 Millionen Euro Nettogewinn.
Seit Anfang 2017 hat der Streamingdienst in acht Quartalen eine
positive Nettobilanz erwirtschaftet, zwei davon im Jahr 2021. Im
vierten Quartal 2018 und im dritten Quartal 2019 konnte Spotify
Einnahmen von 442 Millionen Euro beziehungsweise 241 Millionen Euro
erwirtschaften, was diese beiden Zeiträume zu den erfolgreichsten
der jüngeren Unternehmensgeschichte macht. Selbst der
vergleichsweise große Sprung bei den bezahlten Abonnenten von 144
Millionen auf 155 Millionen zwischen Oktober 2020 und Januar 2021,
der unter anderem auf die anhaltende Pandemie und stärkere
Einschränkungen in den Wintermonaten zurückzuführen sein dürfte,
schlug sich nicht in einer positiven Quartalsbilanz nieder.
Bis 2030 plant Spotify, eine Milliarde Abonnent:innen weltweit
zu erreichen. Bislang verzeichnet Spotify seit 2017 ein
durchschnittliches Wachstum von 26 Millionen Premium-Abos pro Jahr.
Da es unwahrscheinlich ist, dass große Märkte wie China die
Plattform vollumfänglich annehmen, TikTok seinen eigenen Streamingdienst nach
Testläufen in Brasilien und Indien jetzt auch in Australien, Mexiko
und Singapur ausrollt und die weltwirtschaftliche Lage mindestens
für den Rest des Jahres angespannt bleiben dürfte, scheint das
Erreichen dieses Meilensteins zum jetzigen Zeitpunkt
unwahrscheinlich.
Florian Zandt

Tesla stellt Verkaufsrekord schon im dritten Quartal ein
Rund 1,32 Millionen Fahrzeuge hat Tesla im
Geschäftsjahr 2023 bereits ausgeliefert. Wie die Statista-Grafik auf
Basis von Unternehmensdaten zeigt,
hat der E-Autohersteller damit bereits nach einem Dreivierteljahr
mehr Fahrzeuge verkauft als 2022. Das vierte Jahresquartal ist zudem
üblicherweise Teslas stärkstes - schon im vergangenen Jahr konnten
von Oktober bis Dezember mehr als 400.000 Fahrzeuge weltweit
ausgeliefert werden. Die Lieferungen für das Jahr 2023 könnten also
bis über 1,7 Millionen Einheiten ansteigen.
Der
Verkaufsschlager der vergangenen Jahre waren mit deutlichem Abstand
die Modelle
3 und Y. Die elektrischen Mittelklasse-Limousinen machten 2022
einen Anteil von rund 95 Prozent an allen Tesla-Auslieferungen aus.
Im dritten Quartal 2023 konnte Tesla etwa 419.000 Fahrzeuge dieser
Baureihe absetzen. Finanziell zeigt sich das Automobilunternehmen
weiterhin beständig. Gegenüber dem Vorjahresquartal steigt der
Umsatz um etwa neun Prozent an, die Gewinne brechen hingegen
deutlich ein. Als Grund dafür werden vor allem hohe
Produktionskosten angeführt. Trotz eines weiteren Verkaufsrekords,
verfehlt Tesla die Markterwartungen, was der Aktie ein Minus von
etwa fünf Prozent an der Börse einhandelt. René Bocksch

Wie verbreitet sind E-Autos?
29 Prozent der
für die Statista
Consumer Insights befragen Konsument:innen in Deutschland können
sich vorstellen, ein Elektroauto anzuschaffen. Das klingt erstmal
nach guten Nachrichten für die Autohersteller. Die Realität ist
indes noch nicht ganz so weit. So geben hierzulande nur vier Prozent
der Befragten mit Pkw im Haushalt an, dass ihr hauptsächlich
genutzter Wagen einen Elektromotor hat. Das lässt zwar Spielraum für
E-Zweitwagen, ist aber doch weniger als die Neuzulassungen auf
den ersten Blick vermuten lassen. Selbst in China,
das als Vorreiter beim Thema Elektromobilität gilt,
liegt der E-Auto-Anteil nur bei sieben Prozent.
Ähnlich
beliebt ist diese Form der Motorisierung in der Schweiz. Innerhalb
Europas zeigen außerdem britische Autofahrer:innen
überdurchschnittliches Interesse an E-Autos, wie der Blick auf die
Grafik zeigt. Dagegen sind die Verbraucher:innen in Frankreich oder
Österreich eher zurückhaltend. Und welcher Motor hat stattdessen die
Nase vorne? Das ist eigentlich überall der Benziner - sowohl bei der
Neuanschaffung als auch dem aktuellen GFahrzeug. Mathias Brandt

Bayern ist Tesla-Hochburg
In Deutschland
sind derzeit rund 118.800 Pkw der Marke Tesla zugelassen.
Wie die Berechnung von Statista auf Basis von Daten des Kraftfahrt-Bundesamts zeigt,
entscheiden sich in Relation zur Einwohnerzahl in Bayern besonders
viele Menschen für einen Tesla. Auf 100.000 Einwohner kommen hier
190 Tesla. An zweiter Stelle liegt Hessen mit 168 Tesla.
Schlusslichter des Bundesländer-Vergleichs sind Bremen und die
ostdeutschen Bundesländer. Tesla, Inc. ist ein Hersteller von
Elektroautos mit Sitz in Austin, Texas (USA).
Gegründet
im Jahr 2003 brachte das Unternehmen mit dem Modell Tesla Roadster
im Jahr 2008 das erste Auto mit einer Lithium-Ionen-Batterie auf den
Markt und ist mittlerweile weltweit für seine Elektroautos bekannt.
Zu den wichtigsten Absatzmärkten des Unternehmens gehören die USA
und China. Auch in Deutschland steigt
der Tesla-Bestand, allerdings gibt es auf dem Markt der
Elektroautos mittlerweile viel
Konkurrenz. Matthias Janson

Wie smart sind die Autos der Deutschen?
Neben der Vernetzung verschiedener Arten der Mobilität untereinander
steht die Verbindung zwischen Konsumenten und Produkt im Vordergrund
– vor allem durch “smarte” Anwendungen und Funktionen innerhalb des
Pkw. Statista hat im Rahmen der Consumer
Insights Autobesitzer:innen in Deutschland befragt, welche
Funktionen ihr primär genutzter Pkw besitzt. Die Ergebnisse zeigen,
dass knapp die Hälfte der Befragten eine kabellose Verbindung
zwischen ihrem Smartphone und Auto aufbauen kann. Die
Smartphone-Verbindung für freihändiges Telefonieren oder Musik hören
im Fahrzeug ist somit das am weitesten Verbreitete Feature.
Ein eingebautes Display haben rund 43 Prozent in ihrem Auto.
Auch bei der Kontrolle des Fahrzeugs unterstützende Systeme wie der
Parkassistent (40 Prozent) oder Adaptive Cruise Control (30 Prozent)
sind nicht selten. Eine weniger verbreitete, jedoch potenziell
lebensrettende Funktion ist der automatische Notruf, der
beispielsweise nach einem Unfall abgesetzt wird – den sogenannten
eCall haben nur etwa 17 Prozent der Umfrageteilnehmer:innen in ihrem
hauptsächlich genutzten Pkw verbaut. Eine permanente
Internetverbindung (13 Prozent) können hierzulande die wenigsten
Fahrzeuge vorweisen. René Bocksch

Ist der E-Autos-Durchbruch nicht längst da?
"Wann schaffen E-Autos den Durchbruch in Deutschland", fragt
die Tagesschau,
nur um gleich im Teaser des Artikels zu betonen, dass die Autobauer
auf der Internationalen Automobil-Ausstellung besonders ihre E-Autos in
Szene setzen. Tatsächlich ließe sich auch Argumente dafür finden,
dass der Durchbruch längst stattgefunden hat. So wurden im August
laut Kraftfahrt-Bundesamt hierzulande 86.649 Elektro-Pkw neu
zugelassen - das entspricht einem Anteil von rund 32 Prozent. Im
gleichen Monat registrierte die Behörde 75.598 Autos mit
Benzinmotor.
Auch der Blick zurück zeigt, dass
E-Fahrzeuge in Deutschland schon eine feste Größe sind. So wurden
zwischen August 2022 und August 2023 insgesamt 630.056 Elektroautos
neu zugelassen. Im Schnitt lag ihr Anteil an den allen
Neuzulassungen bei fast 20 Prozent. Marktbeobachter:innen fürchten
indes, dass der Trend bald wieder nach unten zeigen könnte. Als
Grund hierfür wird angeführt, dass Unternehmen seit dem 1. September
keinen Umweltbonus mehr für E-Autos bekommen. Das wiederum könnte
sich negativ auf den Gebrauchtwagenmarkt auswirken. Mathias Brandt

E-Bike schlägt E-Auto
Die Elektrifizierung
des Individualverkehrs schreitet voran in Deutschland. So wurden in
Deutschland im vergangenen Jahr rund 470.559 Elektroautos neu
zugelassen. Eine große Anzahl – aber im Vergleich zu den mehr als
zwei Millionen E-Bikes,
die im selben Jahr abgesetzt worden sind, erscheint sie doch klein.
Während der Corona-Pandemie pendelten
die Absatzzahlen jedes Jahr um die zwei Millionen E-Bikes pro Jahr.
Die Pandemie sorgte mit ihren eingeschränkten Freizeitmöglichkeiten
dann für eine anhaltend hohe Nachfrage nach Fahrrädern mit
Elektromotor. Durch die mögliche Unterstützung sind im Vergleich zu
einem normalen Fahrrad längere Strecken möglich, auch Anstiege und
schwere Touren sind leichter zu bewerkstelligen.
Das
Fahrrad wird dadurch für viele Menschen eine echte Alternative bei
der Wahl des Fortbewegungsmittels. Aber auch die Neuzulassungen von
Elektroautos sind in den Pandemiejahren angestiegen. Ein wichtiger
Grund: Die Bundesregierung hatte im Rahmen eines Konjunktur-Pakets
die Förderprämie für Elektroautos erhöht. Mit der Änderung der
"Richtlinie zur Förderung des Absatzes von elektrisch betriebenen
Fahrzeugen", die am 1. Januar 2023 in Kraft trat, wird nur noch der
Erwerb (Kauf oder Leasing) eines rein elektrischen Fahrzeugs mit
Batterie oder Brennstoffzelle vom Bund und den Herstellern
gefördert. Plug-in-Hybride, die extern aufladbar sind, werden nicht
mehr gefördert. In der Infografik werden die Neuzulassungen von rein
batteriebetriebenen Elektroautos abgebildet.
Seit
dem 1. Januar 2023 beträgt der Bundesanteil der Förderung für
batterieelektrische Fahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge mit
Nettolistenpreis bis zu 40.000 Euro statt bisher 6000 Euro jetzt
4500 Euro, mit Nettolistenpreis zwischen 40.000 Euro und bis zu
65.000 Euro statt 5000 nur noch 3000 Euro. Der Herstelleranteil
beträgt jeweils die Hälfte. Elektroautos sollen den Verkehr
nachhaltiger machen. Aus diesem Grund beschloss die Europäische
Union Anfang des Jahres 2023, im weiteren Zusammenhang der
Mobilitätswende, das Aus des Verbrenners. Ab 2035 dürfen in der EU
somit keine mit den fossilen Brennstoffen Benzin oder Diesel
betriebenen Pkw mehr zugelassen werden. Die Automobilbranche, aber
auch die Branchen der Luft- und Schifffahrt, stehen dadurch aktuell
vor enormen Umbrüchen. Matthias Janson