






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 6.Kalenderwoche:
7. Februar
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Donnerstag, 8. Februar 2024
CSDDD: Vorhaben für nachhaltige und faire Lieferketten droht
zu scheitern.
Deutsche Blockade gefährdet jahrelange
Verhandlungen.
Umsetzung ist entscheidend, um
Bürokratie zu vermeiden. Scheitern der CSDDD schadet
Unternehmen.
In der kommenden Woche soll im EU-Rat über die
„Corporate Sustainability Due Diligence Directive“ (CSDDD)
abgestimmt werden.
Die Blockade von Finanzminister
Christian Lindner und Justizminister Marco Buschmann, die eine
Enthaltung Deutschlands bei der entscheidenden Ratsabstimmung am 9.
Februar fordern, kommentiert Juliane Petrich, Referentin Politik und
Nachhaltigkeit beim TÜV-Verband: „Die Blockade der
EU-Lieferkettenrichtlinie schadet nicht nur den Menschenrechten
weltweit, sondern auch dem Ansehen Deutschlands. Wenn ein jahrelang
auf EU-Ebene verhandeltes und von der Bundesregierung mitgetragenes
Abkommen kurz vor Abschluss scheitert, gefährdet das Hin und Her die
Glaubwürdigkeit der deutschen Politik und schadet den Unternehmen.
Viele versuchen bereits, ihre Lieferketten nachhaltiger
auszurichten und fordern von der Politik Planungssicherheit und ein
echtes Level-Playing-Field. In Deutschland gibt es mit dem
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz bereits seit 2023 einen
gesetzlichen Rahmen. Scheitert die CSDDD, bleibt der rechtliche
Flickenteppich in der EU.“
Der TÜV-Verband fordert die
Bundesregierung auf, an der Zustimmung zur CSDDD festzuhalten. Die
in mehr als zwei Jahren ausgehandelte Richtlinie ist ein guter
Kompromiss und berücksichtigt an vielen Stellen die Anliegen und
Sorgen der Wirtschaft. Die Politik sollte sich nun mit aller Kraft
auf die Umsetzung der Richtlinie konzentrieren: Denn für die
Akzeptanz in der Praxis wird es vor allem darauf ankommen, dass die
vorgesehenen Anforderungen und Leitlinien hinreichend konkret sind
und die Mitgliedstaaten die CSDDD einheitlich umsetzen.
Petrich: „Statt überbordender Berichtspflichten und mehr Bürokratie
müssen konkrete Verbesserungen in der Wertschöpfungskette im Fokus
stehen. Dazu leisten Audits und Zertifizierungen einen wichtigen
Beitrag. Sie schaffen das notwendige Vertrauen und unterstützen
damit Unternehmen und Behörden. Gleichzeitig erhöhen sie die
Transparenz für die Verbraucher:innen.
Mit der Richtlinie
hat die EU die Chance, weltweit Vorreiter für nachhaltige
Lieferketten zu werden – vorausgesetzt, dass das Projekt nicht auf
den letzten Metern an der Enthaltung der Bundesregierung im
EU-Ministerrat scheitert.“
Bekämpfung von Gewalt
gegen Frauen: Einigung auf EU-Richtlinie
Die Europäische Kommission begrüßt die zwischen dem
Europäischen Parlament und dem Rat erzielte politische Einigung über
eine Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und
häuslicher Gewalt. Die Kommission hatte den Vorschlag im
März 2022 eingebracht. Die Richtlinie ist ein Meilenstein – das
erste umfassende Rechtsinstrument auf EU-Ebene zur Bekämpfung von
Gewalt gegen Frauen, die in der Europäischen Union nach wie vor
allgegenwärtig ist. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte: „Es
ist höchste Zeit, dass Frauen in den Genuss der grundlegendsten
Rechte kommen.“
Věra Jourová, Vizepräsidentin für Werte
und Transparenz betonte, dass die Richtlinie für alle Frauen in
Europa erhebliche Veränderungen bedeutet: „Dies ist ein wichtiger
Schritt gegen viele Formen der Gewalt in der realen Welt, bringt
aber vor allem tiefgreifende Änderungen für die Online-Welt mit
sich, indem bestimmte Formen der Cybergewalt unter Strafe gestellt
werden. Es war höchste Zeit, wie die jüngsten Entwicklungen zeigen.
Die nicht einvernehmliche Weitergabe von intimen Bildern, darunter
KI-generierte Bilder, kann zu psychischen Problemen und in
Extremfällen sogar zu Selbstmord führen. Durch Cyberstalking und
Cybermobbing werden Frauen aus dem öffentlichen Raum gedrängt. Mit
dieser Richtlinie soll sichergestellt werden, dass die Urheber eines
solchen feigen Verhaltens nicht ungestraft bleiben.“
Die
für Gleichstellung zuständige Kommissarin Helena Dalli bezeichnete
die Einigung auf die Richtlinie als einen Sieg für die
Gleichstellung der Geschlechter in der gesamten Europäischen Union.
„Mit dieser Richtlinie wird der Schutz über physische Gewalt hinaus
auf psychische, wirtschaftliche und sexuelle Gewalt ausgedehnt. Ich
gratuliere dem Rat und dem Europäischen Parlament zu dem heutigen
Durchbruch. Wir müssen uns jedoch weiterhin dafür einsetzen, dass
Vergewaltigung EU-weit als nicht-einvernehmliche Handlung anerkannt
wird.“
Wesentliche Elemente der Richtlinie
Mit der
Richtlinie werden körperliche Gewalt sowie psychische,
wirtschaftliche und sexuelle Gewalt gegen Frauen in der gesamten
EU sowohl offline als auch online unter Strafe gestellt.
Verstümmelung weiblicher Genitalien und Zwangsehen werden als
eigenständige Straftaten unter Strafe gestellt. Darüber hinaus
wird Gewalt im Internet nach den neuen Vorschriften eine Straftat
darstellen, einschließlich des nicht einvernehmlichen Austauschs von
intimen Bildern (einschließlich Deepfakes), Cyberstalking,
Cyber-Belästigung, frauenfeindlicher Hetze und Cyberflashing.
Ein Schlüssel zur Bekämpfung von Cybergewalt ist
die digitale Kompetenz. Aus diesem Grund sieht die neue Richtlinie
auch Maßnahmen zur Entwicklung von Kompetenzen vor, die es den
Nutzern ermöglichen, Cybergewalt zu erkennen und zu bekämpfen,
Unterstützung zu suchen und ihre Begehung zu verhindern. Zwar wurde
keine Einigung über die von der Kommission vorgeschlagene
Kriminalisierung von Vergewaltigung erzielt, aufgrund mangelnder
Einwilligung auf Unionsebene, doch enthält die Richtlinie strenge
Präventionsanforderungen. Das soll die zentrale Rolle der
Einwilligung in sexuellen Beziehungen fördern und gezielte Maßnahmen
zur Verhütung von Vergewaltigungen mit sich bringen.
Die
neue Richtlinie sieht auch Maßnahmen zur Verhütung aller Arten von
Gewalt gegen Frauen, einschließlich häuslicher Gewalt, vor und legt
neue Standards für den Schutz, die Unterstützung und den Zugang der
Opfer zur Justiz fest. So werden beispielsweise die Mitgliedstaaten
verpflichtet, zur Unterstützung von Opfern Hotlines und
Krisenzentren für Vergewaltigungen einzurichten. Weitere Details
entnehmen Sie dieser Pressemitteilung
in voller Länge Hintergrund Wie in der EU-Strategie
für die Gleichstellung der Geschlechter 2020-2025 dargelegt,
setzt sich die Europäische Kommission für die Verhütung und
Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt ein.
Am 1.
Oktober 2023 wurde die Kommission Vertragspartei des Übereinkommens
des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen
und häuslicher Gewalt – des Übereinkommens von Istanbul. Die EU
ist nun an ehrgeizige und umfassende Standards zur Verhütung und
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen in den Bereichen justizielle
Zusammenarbeit in Strafsachen, Asyl und Nichtzurückweisung sowie in
Bezug auf ihre öffentliche Verwaltung gebunden. Dazu gehören
Finanzierungsmaßnahmen, politische und legislative Maßnahmen.
Der Beitritt der EU zum Übereinkommen von Istanbul ist ein
Meilenstein bei den Bemühungen der EU um die Verwirklichung der
Gleichstellung der Geschlechter. Die finanziellen Verpflichtungen
der EU für die Prävention geschlechtsspezifischer Gewalt und die
Reaktion auf diese Gewalt sind von durchschnittlich 91 Millionen
Euro im Jahr 2014 auf 282 Millionen Euro im Jahr 2022 gestiegen.
Der Landschaftspark ist jetzt Gartendenkmal!
Der Landschaftspark Duisburg-Nord einschließlich der
gesamten eingebundenen Infrastruktur und Industrierelikte werden nun
offiziell von der Bezirksregierung Düsseldorf nach fachlicher
Bewertung des Amts für Denkmalpflege unter Schutz gestellt. Er
verbindet Gartenkunst und Landschaftskultur. Die Idee für den
heutigen Landschaftspark, als Transformationsobjekt der IBA
(Internationale Bauausstellung Emscher Park), wurde im Jahr 1989
geboren.

Fotos (c)ThomasBerns
Auf dem Areal entstand nach dem Entwurf von Prof. Peter Latz ein
Landschaftspark, der weder Park noch Landschaft im ursprünglichen
Sinn ist. Mit dem Inkrafttreten des neuen nordrhein-westfälischen
Denkmalschutzgesetztes im Jahr 2022 wurde eine neue Kategorie
„Gartendenkmal“ eingeführt. Nachdem das Ministerium für Heimat,
Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen
den Aufruf für das Programm zur Denkmalförderung 2024 im Juli 2023
veröffentlicht hat, stellte die Bezirksregierung Düsseldorf einen
Antrag auf Aufnahme in die Denkmalliste.
Zu den
charakteristisch wertvollen Merkmalen des Landschaftspark zählt
beispielsweise die diverse Naturlandschaft mit ihren Baumplätzen,
Birken- und Moorlandschaften oder die besondere Infrastruktur.
Verwilderte Bahntrassen, panoramaartige Ausblicke, ein eigenes Rad-
und Wandernetz und ein nachhaltiges Wassersystem. Auch Sichtbezüge
zwischen dem Park, den darin eingebetteten stillgelegten
Industrieanlagen und der kulturlandschaftlichen Umgebung, sowie
künstlerisch wertvolle Ausstattungsstücke, wie die Piazza Metallica
oder die international bekannte Lichtinstallation von Jonathan Park
fielen bei der Beurteilung ins Gewicht.
„Schon 2015 hat
uns der britische Guardian unter die zehn schönsten Parks der Welt
gewählt. Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, die dem Park
gerecht wird.“, erläutert Frank Jebavy, Geschäftsbereichsleiter des
Landschaftsparks. Er führt weiter fort: „Als Gartendenkmal etabliert
sich der Landschaftspark weiter in der Welt der Denkmäler und kann
so authentisch entwickelt und in besonderem Maße gepflegt werden.“
Der Landschaftspark feiert in diesem Jahr seinen 30.
Geburtstag am 1. Juni 2024 im Rahmen der langen Nacht der
Industriekultur und mit weiteren Highlights im Geburtstagsjahr. Mit
durchschnittlich einer Million Besuchern pro Jahr gehört der
Landschaftspark Duisburg-Nord zu den beliebtesten Natur- und
Kulturlandschaften in Nordrhein-Westfalen. Innerhalb von zwei
Jahrzehnten wandelte sich ein stillgelegtes Hüttenwerk zu einer
Großstadtoase und ist heute mit jährlich rund 250 Veranstaltungen
eine Top-Event-Adresse.

Mehr immer aktuell unter
www.landschaftspark.de
Wirtschaft am
Niederrhein ist unzufrieden und vorsichtig
Besonders Industrie
leidet unter hohen Kosten für Energie und Rohstoffe
Nach Pandemie und Energiekrise rutscht die Wirtschaft zum
Jahresstart weiter in die Rezession. Viele Unternehmen sind
unzufrieden und erwarten kein gutes Geschäftsjahr. Ein Lichtblick:
Trotz der unsicheren Zeit behaupten sich die meisten Betriebe noch
gut am Markt. Das zeigt die Konjunkturumfrage der Niederrheinischen
IHK. 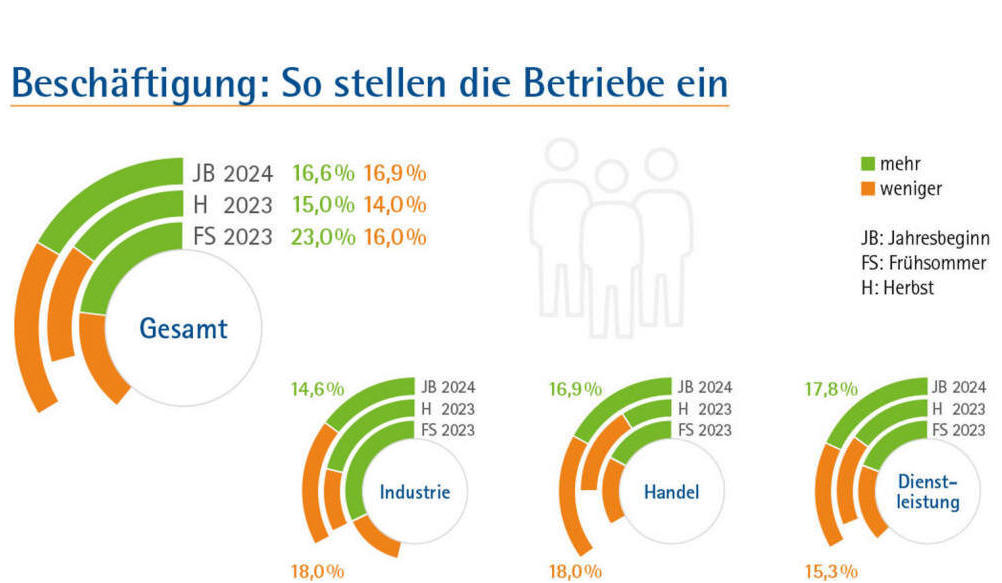
(c)
Niederrheinische IHK
Hohe Kosten, kaputte Infrastruktur,
immer neue Verordnungen: Für die Unternehmen in Duisburg und am
Niederrhein nehmen die Risiken fürs Geschäft zu. Sie nennen mehr
Faktoren als noch vor einem Jahr. Es fehlt ihnen an Sicherheit
seitens der Politik. Eine Konsequenz ist: Rund 30 Prozent der
befragten Unternehmen gaben an, weniger investieren zu wollen. Im
Herbst waren es noch 20 Prozent. Besonders Investitionen in neue
innovative Produkte und Arbeitsplätze bleiben liegen.
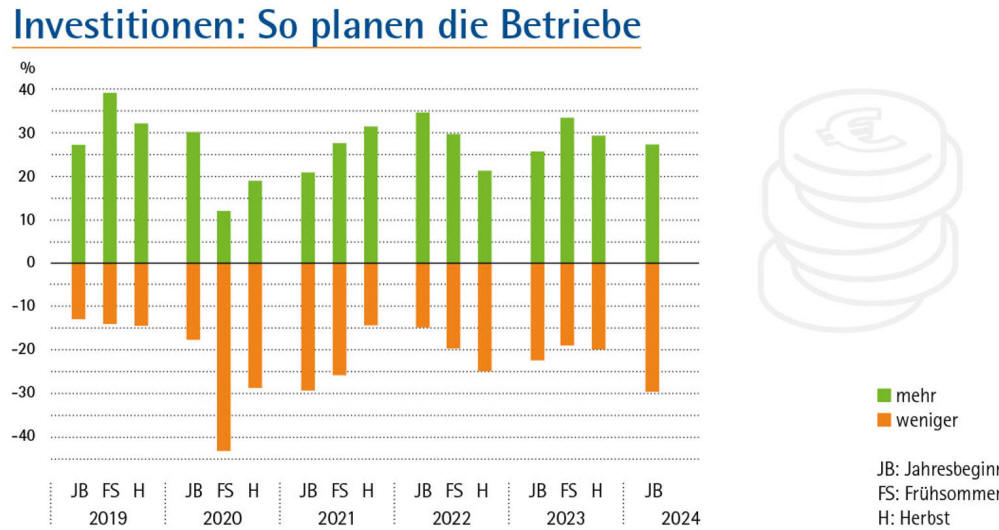
Für die Industrie am Niederrhein sind die Energie- und
Rohstoffkosten besonders wichtig, um im internationalen Wettbewerb
mithalten zu können. Stahlproduzenten und Chemieunternehmen sehen in
den hohen Preisen deshalb ein erhebliches Risiko. Auch fehlende
Fachkräfte und marode Brücken machen ihnen zu schaffen.
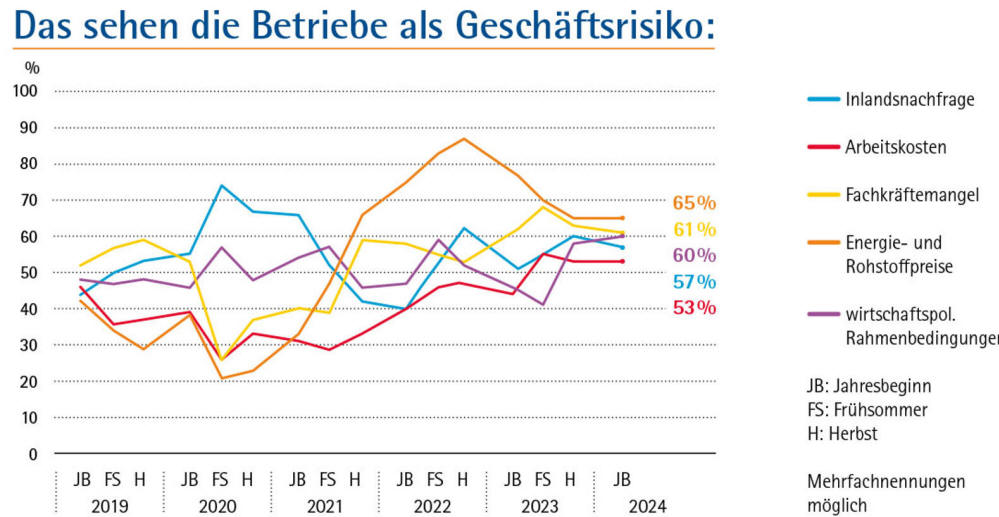
„Die Regierung muss jetzt ihren Richtungsstreit beenden und
eine klare Linie in der Wirtschaftspolitik verfolgen“, so Ocke
Hamann, Leiter Standort, Digital, Innovation und Umwelt bei der
Niederrheinischen IHK.
„Die Unternehmen müssen langfristig
planen können. Was wir definitiv nicht brauchen, ist noch mehr
Bürokratie.“ Der IHK-Konjunkturklimaindex, der die Lage und die
Erwartungen zusammenfasst, ist erneut gesunken. Er liegt mit 94
Punkten weit unter dem zehnjährigen Mittel von 109 Punkten.
Zahl der Woche: 17.505 Kilometer lang ist das
Straßennetz von Straßen.NRW
Der Landesbetrieb Straßen.NRW betreut mit 56
Straßenmeistereien die Verkehrsinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen
- Älteste Verkehrsbrücke von 1817 Sie ist 6,50 Meter lang und
viereinhalb Meter breit, nicht groß für eine Brücke. Aber mit ihrem
Baujahr 1817 ist sie dennoch ganz vorne dabei: Die Plattenbrücke in
Klein-Netterden, einem kleinen Ortsteil von Emmerich am Niederrhein,
ist die älteste Verkehrsbrücke in Nordrhein-Westfalen in
Zuständigkeit von Straßen.NRW. Das alte Ziegelgewölbe ist
mittlerweile durch ein modernes Stahlbetonbauwerk überbaut worden,
das die Verkehrslasten der Straße übernimmt.
Die alte
Brücke steht seit 2004 unter Denkmalschutz und ist eine von
insgesamt 6.714 Brücken in Nordrhein-Westfalen, die durch
Straßen.NRW betreut werden. 400 von ihnen sollen in den kommenden 10
Jahren ersetzt werden, weil sie nicht mehr für die heutigen
Belastungen, insbesondere des Schwerlastverkehrs, ausgelegt sind.
Erst im November hat das Land Nordrhein-Westfalen eine
Sanierungsoffensive für die Verkehrsinfrastruktur vorgestellt.
Allein in diesem Jahr stehen für 35 Brücken Ersatzneubauten
an. Insgesamt werden sich dann 51 Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen
von über 160 Millionen Euro im Bau befinden. Die Brückensanierungen
sind aber nur ein Teil der Sanierungsoffensive, die ebenso die
Straßen und Tunnel betrifft.
"Wir wollen in den
kommenden 10 Jahren in Nordrhein-Westfalen den bestehenden Anteil
von Straßen, Brücken und Tunneln in einem sanierungsbedürftigen
Zustand deutlich abbauen. Dafür legt die Landesregierung etwa beim
Straßenbau den Schwerpunkt auf die Sanierung", sagt
Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Oliver Krischer. Zur aktuellen
Zahl der Woche:
https://www.umwelt.nrw.de/presse/detail/zahl-der-woche-17505-kilometer-lang-ist-das-strassennetz-von-strassennrw-1707310148
Wiederholung der Bundestagswahl 2021: Erneute Feststellung
des endgültigen Wahlergebnisses
Die Wahl zum Deutschen Bundestag 2021 wird am 11. Februar
2024 in 455 von 2 256 Berliner Wahlbezirken wiederholt. Aufgrund der
Wiederholungswahl wird das Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen
Bundestag neu festgestellt. Dabei kann es zu einzelnen, auch
länderübergreifenden, Mandatsverschiebungen im Deutschen Bundestag
kommen. Auch wenn die Wiederholungswahl räumlich auf Berlin begrenzt
ist, können auch in anderen Bundesländern neue Mandatsgewinne und
-verluste entstehen.
NGG-Tipp für Gastro-Beschäftigte in Duisburg:
Weihnachtsgeld im Februar
Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) rät
Gastronomie-Beschäftigten in Duisburg zu einem ge nauen
Blick auf ihre Jahreslohnabrechnung. „Jeder sollte einmal prüfen, ob
er im vergangenen Jahr seine Weihnachtsgeldzahlung tatsächlich
bekommen hat. Etliche Chefs im Gastgewerbe ‚vergessen‘ gerne die
jährliche Sonderzahlung für ihre Angestellten“, sagt Karim Peters.
nauen
Blick auf ihre Jahreslohnabrechnung. „Jeder sollte einmal prüfen, ob
er im vergangenen Jahr seine Weihnachtsgeldzahlung tatsächlich
bekommen hat. Etliche Chefs im Gastgewerbe ‚vergessen‘ gerne die
jährliche Sonderzahlung für ihre Angestellten“, sagt Karim Peters.
Der Lohncheck lohne sich, so der Geschäftsführer der NGG
Nordrhein. Denn bis Ende Februar könnten die Beschäftigten das
fehlende Weihnachtsgeld nachfordern. Für Karim Peters sind die
„Weihnachtsgeld-Muffel“ unter den Gastro-Arbeitgebern ein jährliches
Dauerärgernis. Das gelte gerade für kleinere Betriebe. Karim Peters:
„Eigentlich muss das Weihnachtsgeld mit der letzten
November-Auszahlung auf dem Gehaltskonto auftauchen. All diejenigen,
die die Sonderzahlung im letzten Jahr nicht bekommen haben, sollten
sich schleunigst bei ihrem Chef melden. Am besten schriftlich und
spätestens bis zum 29. Februar. Danach verfällt der Anspruch und das
Geld ist endgültig futsch“, so der NGG-Geschäftsführer.
Die NGG hofft, dass sich möglichst viele in den kommenden Wochen
gegen die „Weihnachtsgeld-Prellerei“ wehren. „Denn Weihnachtsgeld
hängt nicht vom guten Willen des Chefs ab, es ist das gute Recht der
Beschäftigten. Es steht jedem, der mindestens ein Jahr im Betrieb
arbeitet, ein halber Monatslohn als Weihnachtsgeld zu – vom Koch bis
zur Kellnerin und vom Housekeeping bis zum Nachtportier an der
Rezeption“, so Peters.
Geänderte Servicezeit bei der DVG an Karneval
An Altweiber, 8. Februar, sowie an Rosenmontag, 12. Februar,
ist der Kundenservice der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG)
nur eingeschränkt erreichbar. Das Kundencenter der DVG am
Hauptbahnhof, Harry-Epstein-Platz 10, ist an beiden Tagen von 7 bis
12 Uhr geöffnet.
Der telefonische Kundenservice der DVG
unter der Rufnummer 0203 60 44 555 ist von 7 bis 18 Uhr zu
erreichen. Telefonische Fahrplanauskünfte erteilt der
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) rund um die Uhr unter der
kostenfreien Rufnummer 08006 50 40 30.
Traditionelle Altweiberfeier im Ratskeller Hamborn
Die traditionelle Altweiberfeier startet am Donnerstag,
8. Februar, um 12.11 Uhr im Ratskeller Hamborn auf der Duisburger
Straße 213. Die Hamborner Karnevalsvereine haben - nicht nur für die
Möhnen - ein starkes Bühnenprogramm auf die Beine gestellt, dass von
Gabi Pletziger moderiert wird. Traditionsgemäß beginnt das Programm
mit dem Einmarsch der Hamborner Stadtwache und der Kapitulation des
Bürgermeisters Volker Mosblech sowie des Bezirksmanagers Andreas
Geisler und der Schlüsselübergabe an die Obermöhne Ulrike Schneider.
Weitere närrische Höhepunkte sind der Empfang des
Duisburger Stadtprinzen Matthias I. und des Kinderprinzenpaares
Prinz Leonardo I. und Prinzessin Milena I. mit Prinzencrew. Dazu
kommen die Teuflischen Engel, die Dom-Dancer, Solo Mariechen
Nathalie von der KG MCV 1979 e.V., Tanzmariechen Annika von den
Marxloher Jecken und natürlich die Tanzgarden der KVO, Rot-Weiß
Schmidthorst, Echte Freunde KAB St. Barbara und Marxloher Jecken.
Für die musikalische Unterhaltung zwischen den Auftritten sorgt DJ
Michael Kogej. Der Eintritt ist frei.
Blick über
den (Narren)Zaun: Pänz-Pokal-Finale
Vom 29. Januar bis
2. Februar verwandelten 1.000 Pänz den Kölner Einkaufsbahnhof in
eine große Karnevalsfeier. Stimmungstechnisch stand der Pänz-Pokal
dabei den großen Karnevalssitzungen in nichts nach: Es wurde
gesungen, getanzt und vor allem applaudiert. Und das völlig zurecht,
denn die 30 Vereine aus Köln und dem Umland präsentierten ihre
Choreografien mit Bravour und ohne jede Spur von Lampenfieber.

Strahlende Gewinner zeigen ihre Tänze begleitet von Livemusik
Eine gewisse Anspannung breitete sich dann am Finaltag doch noch
unter den 27 anwesenden Vereinen aus. Denn am 5. Februar kam es,
nach dem traditionellen Gruppenfoto vor dem Kölner Dom, zur mit
Spannung erwarteten Siegerehrung. Aus allen anwesenden Tanzgruppen
wurden insgesamt fünf glückliche Gewinner unter Moderation von
Robert Greven, Moderator und Gründer von „DAT KÖLSCHE HÄTZ“,
ausgelost.
Der erste Platz ging dabei an die
Torschwälbchen der KG Bergheimer Torwache, die ihr Glück kaum fassen
konnten. Die Pänz der Torschwälbchen der KG Bergheimer Torwache
wurden, ebenso wie die Vereine auf den weiteren Plätzen, gebührend
von der jubelnden Menge gefeiert. Als besonderes Highlight wurden
die ersten drei Gewinner außerdem noch einmal auf die Bühne gebeten,
wo sie nacheinander ihre besten Tänze erneut präsentieren durften.
Musikalisch begleitet wurden sie dabei von ALUIS, die die Stimmung
anheizten und für Begeisterung im Publikum sorgten. Die aktuelle
Single der Kölsch-Band „Föreinander doh“ hat Ohrwurmpotenzial und
wird bestimmt noch auf vielen Karnevalspartys zu hören sein.
Veranstalter MEKB GmbH mit Sitz in Berlin ist eine
100%-Tochtergesellschaft der DB InfraGO AG und realisiert unter der
Marke „Mein_EinkaufsBahnhof“ gemeinschaftliche Marketingaktivitäten
für die Mieter in rund 80 Top-Bahnhöfen in sieben Regionen
Deutschlands (www.einkaufsbahnhof.de).
Vor 10 Jahren in der BZ:
Kaufmännisches Berufskolleg zeigte Solidarität nach
dem Feuer auf dem Lernbauernhof: 650 Euro aus der
Café-Kasse für den Ingenhammshof
Die Schülerinnen und Schüler
des Kaufmännischen Berufskollegs Duisburg Mitte (KBM)
engagieren sich für den Wiederaufbau der zerstörten
Stallungen auf dem AWO-Ingenhammshof. Am Mittwoch
überreichten sie gemeinsam mit ihrer Schulleiterin
Angelika Hermans eine Spende in Höhe von 650 Euro. Damit
zeigte das KBM seine Solidarität mit dem Lernbauernhof der
AWO-Integrations gGmbH in Duisburg-Meiderich.
Im
Herbst 2013 hatte ein Feuer dort die Stallungen weitgehend
zerstört. Zudem waren acht Tiere bei dem vermutlich durch
Brandstiftung ausgelösten Unglück ums Leben gekommen.
Hofleiterin Margret Haseke sowie Karl-August Schwarthans,
Geschäftsführer der AWO-Integrations gGmbH nahmen am
Mittwoch die „Kaffeekasse“, die 18 Schülerinnen und
Schüler des Berufskollegs mitgebracht hatten, entgegen.

Die Einnahmen aus dem Adventcafé im vergangenen Jahr
hatten die jungen Frauen und Männer dem Ingenhammshof zur
Verfügung gestellt. Die Schülerinnen und Schüler konnten
selbst auswählen, für welchen guten Zweck sie während des
Cafés arbeiten wollten, und entschieden sich einmütig für
den Lernbauernhof in der Nähe des Landschaftsparks Nord.
Die Spende wollten sie danach nicht einfach überweisen,
sondern auch persönlich überreichen. Margret Haseke, die
Leiterin des Hofes, dankte den Gästen für ihren Einsatz.
„Uns tut es sehr gut, dass auch drei Monate nach dem Brand
die Menschen an den Hof denken und uns unterstützen. Wir
können hier fast wieder normal arbeiten. Das war und ist
nur möglich, weil wir über die Spendenmittel verfügen.“
Karl-August Schwarthans, Geschäftsführer der
AWO-Integrations gGmbH erklärte dazu: „Es war längst nicht
alles, was man auf einem Bauernhof braucht und ein Opfer
der Flammen wurde, versichert. Hinzu kommt, dass wir
Hilfsmittel oder Werkzeug mitunter schnell anschaffen
müssen, weil wir es gerade brauchen. Da können wir dann
nicht jedes Mal warten, bis die Versicherung bezahlt.“
Auch Karl-August Schwarthans dankte für das Engagement des
Berufskollegs. Die Gäste vom KBM erhielten am Mittwoch
eine kleine Hofführung und konnten sich selbst ein Bild
davon machen, wie schön es auf dem Ingenhammshof ist und
dass es sich lohnt, diese Oase im Norden möglichst schnell
wieder vollständig aufzubauen.
Finanzen im Blick behalten IHK-Lehrgang mit
Zertifikat
Die Buchhaltung ist ein
wichtiger Bereich in einem Unternehmen. Sie dokumentiert
alle finanziellen Vorgänge. Auf dieser Grundlage werden
wichtige Entscheidungen getroffen. Dieser IHK-Lehrgang
vermittelt das nötige Wissen, um die doppelte Buchführung
in der externen Unternehmensrechnung erfolgreich
anzuwenden. Ziel ist es, den Teilnehmern die Grundlagen im
betrieblichen Rechnungswesen zu vermitteln. Sie lernen
anhand einfacher Beispiele, eine Buchung vorzunehmen.
Zudem erstellen sie eine Bilanz sowie eine Gewinn- und
Verlustrechnung.
Im Kurs werden auch
steuerrechtliche Gesichtspunkte diskutiert. Zuletzt wirft
der Lehrgang einen Blick auf die Kosten- und
Leistungsrechnung. Das erworbene Wissen können die
Teilnehmer in der Zusammenarbeit mit Steuerberatern und
Finanzämtern anwenden. Sie erhalten am Ende des Lehrgangs
ein Zertifikat.
Der Lehrgang findet vom 6. März
bis 12. Mai online statt, immer mittwochs von 17:30 bis
20:45 Uhr und samstags von 09:00 bis 16:30 Uhr. Für Fragen
können Interessierte sich bei Sabrina Giersemehl melden,
0203 2821-382,
giersemehl@niederrhein.ihk.de. Weitere Informationen
und die Möglichkeit sich anzumelden gibt es unter
https://www.ihk.de/niederrhein/veranstaltungen
Stadtgeschichte donnerstags: Von der
Bürgerinitiative zur Wohnungsgenossenschaft
– Die Proteste um den Erhalt der
Rheinpreußensiedlung
Das
Stadtarchiv Duisburg lädt in Kooperation mit
der Mercator-Gesellschaft alle
Geschichtsinteressierten am Donnerstag, 8.
Februar, um 18.15 Uhr in die DenkStätte im
Stadtarchiv, Karmelplatz 5, zu einem Vortrag
von Samanta Kaczykowski (Universität
Münster) ein. Bis 1968 wurden rund 1.200
Wohnungen der historischen
Rheinpreußensiedlung in Homberg-Hochheide
abgerissen, die einst von der Homberger
Firmengruppe "Kun" erbaut worden waren. Als
die Firma unter Josef Kun 1973 Insolvenz
anmeldete, plante man sogar den Abriss der
verbleibenden Wohnungen.
Um dies
zu verhindern, gründeten die Bewohner 1975
die Bürgerinitiative Rheinpreußensiedlung.
Sie protestierten durch verschiedene Mittel
wie Mahnwachen, Hungerstreiks und
Demonstrationen. Obwohl im Jahr 1977 eine
Erhaltungssatzung erlassen wurde, um den
Abriss zu verhindern, blieb die Zukunft der
Bewohnerinnen und Bewohner unsicher, da die
Häuser von den Banken an Privatpersonen
verkauft wurden. Der Konflikt eskalierte in
den folgenden Jahren.
Im Februar
1979 traten etwa 15 Mitglieder der
Initiative vor dem Duisburger Rathaus in
einen unbefristeten Hungerstreik.
Schließlich einigten sich die Stadt und die
Banken auf einen Ankaufspreis von etwa 27
Millionen DM, und durch die finanzielle
Unterstützung des Landes konnte die
Restsiedlung gerettet werden. Der
Hungerstreik endete nach 18 Tagen. Der
Vortrag behandelt die Standpunkte der Stadt
und der Initiative unter besonderer
Berücksichtigung der lokalen
Berichterstattung der Duisburger Zeitungen.
Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung
ist nicht erforderlich.
Popkantor Daniel Drückes lädt zu Singnachmittagen in Wanheim und
Wanheimerort
Musiker und Popkantor Daniel Drückes lädt
alle, die Lust auf gemeinsames Singen in gemütlicher Runde in der
Evangelischen Rheingemeinde Duisburg haben, zweimal im Monat zum
Mitmachen ein. Das nächste Singen in Gemeinschaft gibt es am 14.
Februar 2024 um 14 Uhr im Gemeindehaus Wanheimerort, Vogelsangplatz
1; der zweite Singnachmittag in diesem Monat startet am 15. Februar
2024 um 15 Uhr im Gemeindehaus Wanheim, Beim Knevelshof 45.
Auf dem Programm stehen wie immer bekannte Lieder, Popsongs und
Evergreens. Zwischen dem Singen ist Platz für Kaffee und Kekse. Die
Idee hatte Daniel Drückes gemeinsam mit Ehrenamtskoordinatorin Maria
Hönes: Mit dem zusätzlichen Angebot gilt es ältere und junge
Menschen beim Singen zusammen zu bringen, ganz nach dem Motto
„Singen verbindet Generationen“. Mitsingen darf jede und jeder.
Infos zur Rheingemeinde gibt es im Netz unter
www.gemeinde-wanheim.de und www.wanheimerort.ekir.de.
Pfarrer Hoffmann am
Service-Telefon der evangelischen Kirche in Duisburg
„Zu welcher Gemeinde gehöre ich?“ oder „Wie kann ich in die Kirche
eintreten?“ oder „Holt die Diakonie auch Möbel ab?“: Antworten auf
Fragen dieser Art erhalten Anrufende beim kostenfreien
Servicetelefon der evangelischen Kirche in Duisburg.
Es ist
unter der Rufnummer 0800 / 12131213 auch immer montags von 18 bis 20
Uhr besetzt, und dann geben Pfarrerinnen und Pfarrer Antworten auf
Fragen rund um die kirchliche Arbeit und haben als Seelsorgende ein
offenes Ohr für Sorgen und Nöte. Das Service-Telefon ist am Montag,
12. Februar 2024 von Martin Hoffmann, Pfarrer in der Evangelischen
Kirchengemeinde Duisburg Hochfeld, besetzt.

NRW: Strauchbeerenernte lag 2023 um 6,3 Prozent unter
der Rekorderntemenge von 2022 Im Jahr 2023 haben 165
nordrhein-westfälische Betriebe auf 1 061 Hektar Anbaufläche
7 914 Tonnen Strauchbeeren produziert. Wie das Statistische
Landesamt anhand endgültiger Ergebnisse der Strauchbeerenerhebung
mitteilt, war die Erntemenge damit um 6,3 Prozent geringer als im
Vorjahr (2022: 8 442 Tonnen).
Im Vergleich zum Jahr 2012
(damals: 3 511 Tonnen) hat sich die Erntemenge jedoch mehr als
verdoppelt. Gut die Hälfte der landesweiten Erntemenge
(50,4 Prozent) verzeichneten die Landwirtinnen und Landwirte im
Regierungsbezirk Köln. Auf den Regierungsbezirk Detmold gingen
23,0 Prozent und auf den Regierungsbezirk Düsseldorf 15,0 Prozent
der Strauchbeerenernte im Jahr 2023 zurück. Im Freiland wurden 5 769
Tonnen Strauchbeeren geerntet – anbaustärkste Strauchbeerenart
bleibt die Kulturheidelbeere Mit einer Anbaufläche von 881 Hektar
wurden Strauchbeeren in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr
überwiegend im Freiland kultiviert.
Die anbaustärkste
Strauchbeerenart ist nach wie vor die Kulturheidelbeere, deren
Anbaufläche mit 364 Hektar fast die Hälfte (41,4 Prozent) der
gesamten Freilandfläche für Strauchbeeren beansprucht. Es folgten
rote und weiße Johannisbeeren (220 Hektar) und schwarze
Johannisbeeren (91 Hektar). Von den 5 769 Tonnen im Freiland
geernteten Strauchbeeren entfielen 2 541 Tonnen auf die
Kulturheidelbeeren (44,0 Prozent) und 1 696 Tonnen (29,4 Prozent)
auf die roten und weißen Johannisbeeren.

Unter Schutzabdeckungen wurden 1 370 Tonnen Himbeeren angebaut
Auf 181 Hektar wurden Strauchbeeren unter hohen begehbaren
Schutzabdeckungen bzw. in Gewächshäusern angebaut; hier wurden
überwiegend Himbeeren (124 Hektar) produziert. Insgesamt wurden auf
dieser Fläche 2 145 Tonnen Strauchbeeren erzeugt, darunter
1 370 Tonnen Himbeeren.
IWF-Prognose: Deutschland bleibt
Konjunktur-Schlusslicht - 02.02.2024
Der Internationale
Währungsfonds (IWF) sieht die Zukunft der deutschen Wirtschaft
für das Jahr 2024 in seinem aktuellen Word Economic Outlook (WEO)
vom Januar
2024 negativer als noch im letzten Gutachten aus dem Oktober
2023. Demnach könnte das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) in
diesem Jahr um 0,5 Prozent wachsen. Im Oktober hatte der IWF für
2024 ein Wachsen der Wirtschaftsleistung um 0,9 Prozent vorausgesagt
und die aktuelle Prognose damit um 0,4 Prozentpunkte nach unten
revidiert (siehe Grafik).
Deutschland bleibt auch mit
dieser neuen Prognose weiterhin das Schlusslicht in der Reihe der
stärksten Volkswirtschaften der Welt. Deutschland leide als
Exportnation laut IWF stärker unter dem insgesamt schwachen
Welthandel als andere Länder. Zudem habe die Industrie mit den hohen
Energiepreisen zu kämpfen. Beide Faktoren sorgen dem IWF zufolge für
ein schwaches Wachstum der Wirtschaftsleistung gegenüber dem
vorangegangenen Jahr.
Die weltweite Wirtschaftsleistung
sieht der IWF leicht im Aufwind - die aktuelle Prognose liegt um 0,2
Prozentpunkte höher als im World Economic Outlook (WEO) vom Oktober
2023. Laut IWF liegt die Widerstandsfähigkeit der Vereinigten
Staaten und mehrerer großer Schwellen- und Entwicklungsländer über
den Erwartungen der Experten. Auch die öffentlichen Finanzen vieler
Länder hätten sich stabiler als angenommen erwiesen. Matthias Janson

Wie verbreitet sind E-Autos?
29 Prozent der für
die Statista
Consumer Insights befragen Konsument:innen in Deutschland können
sich vorstellen, ein Elektroauto anzuschaffen. Das klingt erstmal
nach guten Nachrichten für die Autohersteller. Die Realität ist
indes noch nicht ganz so weit. So geben hierzulande nur vier Prozent
der Befragten mit PKW im Haushalt an, dass ihr hauptsächlich
genutzter Wagen einen Elektromotor hat. Das lässt zwar Spielraum für
E-Zweitwagen, ist aber doch weniger als die Neuzulassungen auf
den ersten Blick vermuten lassen. Selbst in China,
das als Vorreiter beim Thema Elektromobilität gilt,
liegt der E-Auto-Anteil nur bei sieben Prozent.
Ähnlich
beliebt ist diese Form der Motorisierung in der Schweiz. Innerhalb
Europas zeigen außerdem britische Autofahrer:innen
überdurchschnittliches Interesse an E-Autos, wie der Blick auf die
Grafik zeigt. Dagegen sind die Verbraucher:innen in Frankreich eher
zurückhaltend. Und welcher Motor hat stattdessen die Nase vorne? Das
ist eigentlich überall der Benziner - sowohl bei der Neuanschaffung
als auch dem aktuelle genutzten Fahrzeug. Renè Bocksch

Gewalt gegen Journalist:innen - so oft kommt es zu Delikten
Die Pressefreiheit in Deutschland ist zunehmend bedroht. Zuletzt gab
es immer wieder Angriffe auf Journalist:innen. Wie die
Statista-Grafik mit Daten des European
Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) zeigt, kam es in der
Bundesrepublik seit 2020 zu mehr als 100 körperlichen Attacken auf
Medienschaffende. Die häufigsten registrierten Fälle sind Angriffe,
die glücklicherweise ohne Verletzungsfolge blieben (156 Vergehen).
Etwa 103-mal wurden Journalist:innen von
anderen Personen bedroht und 90-mal Ausrüstung wie Kameras und
Mikrofone zerstört.
In 36 Instanzen hat das Europäische
Zentrum für Pressefreiheit körperliche Angriffe registriert, bei
denen Pressevertreter:innen zu Schaden gekommen sind. Zwischen
Januar 2020 und November 2023 hat die Non-Profit-Organisation rund
406 Delikte gezählt. In 47 Prozent der Fälle waren diese physischer
Natur, etwa 42 Prozent der Vorfälle waren verbal. 24 Prozent
richteten sich gegen journalistische Ausrüstung, bei etwa 14 Prozent
waren es juristische Repressalien oder Zensur. Zwei Drittel aller
Vergehen werden von Individuen begangen, etwa 16,5 Prozent entfallen
auf die Polizei. Am häufigsten kommt es während Demonstrationen zu
einer Einschränkung
der Pressefreiheit. Insbesondere im Kontext der
Corona-Demonstrationen im Jahr 2020 kam es häufig zu Angriffen
seitens der Demonstrierenden oder Polizist:innen. Renè Bocksch

Welche Werbeformate nerven online am
meisten? STATISTA UMFRAGE Stand 29.01.2024 Das Internet generiert
mittlerweile die
meisten Einnahmen auf dem deutschen Werbemarkt.
Entsprechend häufig begegnen Internetnutzer verschiedenen
Werbeformaten im Netz. Diese können mitunter auch die
Nerven der Betrachter strapazieren. Am unangenehmsten
fällt dabei Videowerbung auf Webseiten auf, die
automatisch mit Ton startet. Diese finden die Hälfte der
im Rahmen der Statista
Consumer Insights befragten Personen am nervigsten.
Ebenfalls weit vorne: Videowerbung auf
Websites, die automatisch ohne Ton startet und Werbung,
die auf den Online-Suchanfragen der jeweils Betroffenen
basiert. Nur 12 Prozent der Befragten halten digitale
Werbung nicht für störend. Eine Möglichkeit, Werbung im
Internet zu Umgehen, sind sogenannte Adblocker.
Als Adblocker (auch Werbeblocker) werden Programme
bezeichnet, die dafür sorgen, dass Werbung auf Webseiten
nicht angezeigt wird.
Im weltweiten Vergleich ist
die Nutzung von Werbeblockern besonders unter
Internetnutzer in Vietnam beliebt: Dort gaben fast 45
Prozent der Befragten an, Adblocker zu nutzen. In
Deutschland lag der Anteil der Nutzer von Werbeblockern
mit rund 39 Prozent knapp über dem weltweiten Durchschnitt
(37 Prozent).

Werbung: Streaming & Co überholt Fernsehen - Stand
29.01.2024
Der globale Markt für Werbung in
Bewegtbild-Formaten entwickelt sich weg vom linearen
Fernsehen und hin zu digitalen Videoformaten, wie etwa
Streaming oder soziale Medien. Das zeigt die aktuelle
Schätzung der Statista
Market Insights. Derzufolge haben die Ausgaben für
digitale Videowerbung die lineare TV-Werbung bereits im
Jahr 2022 überholt. Der Abstand zwischen beiden Märkten
wird in den kommenden Jahren weiter wachsen.
In Deutschland werden die Ausgaben für lineare TV-Werbung
dagegen in den kommenden Jahren noch leicht vor denen der
digitalen Videowerbung liegen. Gleichwohl sinken auch hier
die Ausgaben für TV-Werbung, während die Ausgaben
für Videowerbung steigen. Zur Marktdefinition: TV- &
Videowerbung bezieht sich auf Werbung in
Bewegtbildformaten, die über traditionelle
Übertragungskanäle gesendet wird sowie auf alle
Werbeformen der digitalen Videokanäle. Traditionelle
TV-Werbung gilt nicht als digital und schließt jegliche
Formen von Online-TV-Werbung aus.
Traditionelle TV-Werbung deckt auch alle Werbeausgaben für
Pay-TV-Anbieter und -Netzwerke sowie Free-TV-Netzwerke und
digitale Free-TV-Ableger von terrestrischen Netzbetreibern
ab. Digitale Videowerbung hingegen umfasst alle
Werbeformate innerhalb von webbasierten Videos,
appbasierten Videoplayern, sozialen Medien oder
Streaming-Apps, die auf Computerbildschirmen, Smartphones,
Tablets und anderen mit dem Internet verbundenen Geräten
zu sehen sind.
Unser internationale Analystenteam
von Statista Market Insights erstellt Expertendaten, die
wertvolle Einblicke in mehr als 1000 verschiedene Märkte
in mehr als 190 Ländern bieten. Jeder Markt wird mit
fundierter Branchenexpertise, datenwissenschaftlichen
Ansätzen, einer internationalen Denkweise und einer
Vorliebe für Qualität und methodische Robustheit
abgedeckt.
