






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 6.Kalenderwoche:
8. Februar
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Freitag, 9. Februar 2024
A3/A40: Sperrungen von Verbindungen im Autobahnkreuz
Kaiserberg am Wochenende Die Autobahn GmbH Rheinland
sperrt von Freitag (9.2.) um 22 Uhr bis Montag (12.2.) um 5 Uhr im
Autobahnkreuz Kaiserberg Verbindungen von der A3 auf die A40.
Gesperrt sind folgende Verbindungen:
- Von der A3 aus Köln
kommend die Verbindungen auf die A40 in Fahrtrichtung Essen und in
Fahrtrichtung Venlo
- Von der A3 aus Arnheim kommend die
Verbindung auf die A40 in Fahrtrichtung Essen
Die Autobahn
GmbH Rheinland saniert an diesem Wochenende die genannten
Verbindungen zwischen der A3 und der A40 und den Standstreifen auf
der A3 in Fahrtrichtung Arnheim. Umleitungen sind mit dem roten
Punkt beschildert und leiten den Verkehr in dieser Zeit über die A59
und die A524.
Stadtwerketurm leuchtet an
Rosenmontag bunt
Auch in diesem Jahr wollen die
Stadtwerke Duisburg allen Bürgerinnen und Bürgern an Rhein und Ruhr
einen besonderen Karneval sgruß
senden. Der Stadtwerketurm erstrahlt an Rosenmontag, 12. Februar,
wieder in bunten Farben. Mit Einbruch der Dunkelheit lohnt sich also
ein Blick in Richtung Hochfeld zum Baudenkmal der Stadtwerke
Duisburg AG.
sgruß
senden. Der Stadtwerketurm erstrahlt an Rosenmontag, 12. Februar,
wieder in bunten Farben. Mit Einbruch der Dunkelheit lohnt sich also
ein Blick in Richtung Hochfeld zum Baudenkmal der Stadtwerke
Duisburg AG.
Foto Stadtwerke Duisburg AG
Die
Stadtwerke wünschen allen Duisburgerinnen und Duisburgern eine
schöne Karnevalszeit. Deutscher Lichtdesign-Preis 2020 Der
leuchtende Turm der Stadtwerke begeistert nicht nur die Duisburger
Bürgerinnen und Bürger, auch die Expertinnen und Experten der Jury
des Deutschen Lichtdesign-Preises waren vollauf überzeugt. Der
Stadtwerketurm wurde im September 2020 mit dem renommierten Preis in
der Kategorie „Außenbeleuchtung / Inszenierung – Wahrzeichen“
ausgezeichnet.
Die bestechende Lichtinstallation
entsteht durch eine Kombination aus verschiedenartig geformten
LED-Leuchtkörpern, darunter 180 Strahler und 256 Meter Lichtlinien.
Sie illuminieren die filigrane Stahlkonstruktion des Stadtwerketurms
so, dass sie in der Dunkelheit perfekt zur Geltung kommt. Um die
Leuchtmittel mit Strom zu versorgen, waren 4.500 Meter Kabel
notwendig, 2.400 Meter davon in der Vertikalen innerhalb der
Aufzugröhre in der Mitte des Turms. Weitere Informationen zum
Turm gibt es unter
www.stadtwerketurm.de.
Erfolgreiche Bilanz des Stärkungspakts NRW – Gemeinsam gegen
Armut
Aus dem Stärkungspakt NRW hat die Stadt Duisburg
für das vergangene Jahr Unterstützungsleistungen vom Land in Höhe
von insgesamt rund 6,69 Millionen Euro erhalten. Diese
zweckgebundenen Mittel konnten fast vollständig ausgeschöpft und so
erfolgreich zur Abmilderung der krisenbedingt anfallenden Mehrkosten
aufgrund steigender Energiepreise und Inflation sowie zur
Absicherung der verstärkten Inanspruchnahme der sozialen
Infrastruktur verwendet werden.
Nachdem die ursprünglich
bewilligten Fördermittel von 6,59 Millionen Euro bereits im
laufenden Jahr 2023 verausgabt werden konnten, wurde nochmals eine
Summe von 100.000 Euro beim Land beantragt und von diesem auch
bewilligt. „Durch die Umsetzung des Stärkungspakts ist es uns
gelungen, bei vielen Bürgerinnen und Bürgern, aber auch bei
Einrichtungen der sozialen Infrastruktur, die Folgen der steigenden
Lebenshaltungskosten sowie der Inflation zumindest teilweise
abzufedern.
Dies ist ein großer Erfolg und ich bedanke
mich bei allen Akteuren, mit deren Hilfe und Engagement wir es
geschafft haben, dieses Ziel zu erreichen“, betont Sozialdezernentin
Astrid Neese. Mit den Fördermitteln konnten einige Maßnahmen von der
Stadt selbst, insbesondere vom Amt für Soziales und Wohnen, dem
Jugendamt und dem Amt für Schulische Bildung, zur Unterstützung
Hilfebedürftiger umgesetzt werden.
Genannt seien hier
beispielsweise die Anschaffung von Schulmaterialien und Kleidung für
Kinder und Familien. Darüber hinaus wurden die Mittel aber auch
Einrichtungen der sozialen Infrastruktur, hier insbesondere der
Gesellschaft für Beschäftigungsförderung (GfB), der
Rhein-Ruhr-Bildungsverein e.V., der Tafel, der AWO Integration gGmbH
oder auch den Stadtwerken Duisburg zur Verfügung gestellt, die damit
den größten Teil der Maßnahmen umsetzen konnten.
Durch die
GfB konnten so bei einkommensschwachen Haushalten, ältere Weißware
gegen energieeffiziente Geräte ausgetauscht werden. Darüber hinaus
hat die Tafel Duisburg e. V. die Gelder für 5.100
Lebensmitteltaschen sowie zur Beschaffung von Weihnachtsartikeln für
1.700 Haushalte eingesetzt. Auch Stromschulden konnten unter
Beteiligung der Stadtwerke Duisburg bei einigen Verbrauchern
entgegengewirkt werden.
"Ich bin sehr froh, dass es der
Verwaltung in Duisburg gelungen ist, die Gelder zu fast einhundert
Prozent einzusetzen, obwohl es zunächst unklare Regelungen und daher
einen denkbar kurzen Umsetzungszeitraum gab. So konnten im letzten
Jahr viele Duisburgerinnen und Duisburger entlastet werden. Eine
Fortführung des Programms durch das Land wäre sinnvoll und
wünschenswert, damit Unterstützungen nachhaltig wirken können“, so
Andrea Demming-Rosenberg, Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit,
Soziales und Gesundheit.
14. Februar: Tanzdemo
gegen Gewalt an Frauen und Mädchen
Unter dem Motto
„Rise for Freedom“ (deutsch „Erhebe dich für die Freiheit“)
beteiligen sich Duisburger Kooperationspartnerinnen und -partner am
Mittwoch, 14. Februar, in der Duisburger Innenstadt an der
weltweiten „One Billion Rising“-Tanz-Demo gegen Gewalt an Frauen und
Mädchen. Eröffnet wird die Veranstaltung zwischen dem Forum und den
schwebenden Gärten durch Bürgermeisterin Edeltraud Klabuhn.

Das Organisationsteam des Runden Tisches „Gewaltschutz für Duisburg“
veranstaltet die Tanz-Demo zusammen mit der Frauenhaus Duisburg
gGmbH, der Duisburger Frauenberatungsstelle, Mina e. V., Mabilda e.
V., dem autonomen Frauenhaus, Solwodi e. V. sowie dem Opferschutz
der Duisburger Polizei und dem Referat für Gleichberechtigung und
Chancengleichheit der Stadt Duisburg. Mit diesem Protesttag fordern
die Veranstaltenden ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen
sowie ein konsequentes Bestrafen von Gewaltakten.

Tanzdemo gegen Gewalt gegen Mädchen und Frauen "One Billion Rising"
auf der Königstraße in Duisburg - Fotos Uwe Köppen
„One Billion Rising wurde 2012 ins Leben gerufen, um das
weltweite Ausmaß von Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufzuzeigen und
dagegen zu protestieren. Es würde mich sehr freuen, wenn am 14.
Februar viele Duisburgerinnen und Duisburger an der Tanzdemo
teilnehmen und wir uns gemeinsam gegen Gewalt an Frauen und Mädchen
erheben“, so Elisabeth Koal, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt
Duisburg, und lädt damit zum Mittanzen ein.

Getanzt wird zu „Break the Chain – Spreng
Getanzt
wird zu „Break the Chain – Sprengt die Ketten!“. Auch die
„Duisburger Heroes“ werden sich mit einem Statement an der Tanz-Demo
beteiligen und so ihre Solidarität und Unterstützung für diese
wichtige Veranstaltung zum Ausdruck bringen. Auch dieses Jahr
beteiligt sich das ADTV Tanzhaus Duisburg und tritt mit einer
Tanzgruppe auf. Als besonderes Highlight bietet das ADTV-Tanzhaus am
Samstag, 10. Februar, einen Flashmob-Workshop für alle
Interessierten an, in dem die Choreographie des Tanzes „Break the
Chain“ eingeübt werden kann. Informationen zum Workshop gibt es
online unter https://www.tanzhaus-duisburg.de/tanzkurse/workshops.

16 Wasserstoff-Experten für Duisburg Auszubildende
schließen neue IHK-Qualifikation ab
Wenn es um eine
klimafreundliche Industrie geht, spielt Wasserstoff als
Energieträger eine zentrale Rolle. In Duisburg, am größten
Stahlstandort Europas, ist der Bedarf an Wasserstoff-Experten
deshalb besonders groß. Die Niederrheinische IHK hat das erkannt und
gemeinsam mit der Thyssenkrupp Steel Europe AG, den Hüttenwerken
Krupp Mannesmann (HKM), dem Zentrum für Brennstoffzellen-Technik
GmbH (ZBT) und dem Robert-Bosch-Berufskolleg eine
Zusatzqualifikation entwickelt. Die ersten 16 Auszubildenden haben
nun ihren Abschluss gemacht.
„Unsere Absolventen sind
bundesweite Pioniere. Sie sind bereit für grünen Stahl“, sagt
Matthias Wulfert, Geschäftsführer Aus- und Weiterbildung der
Niederrheinischen IHK. Für die Auszubildenden ist das Wissen um den
richtigen Umgang mit Wasserstoff aktuell ein Alleinstellungsmerkmal
auf dem Arbeitsmarkt. „Wir möchten noch mehr Unternehmen die Chance
bieten, ihre Fachkräfte fit für eine klimafreundliche Industrie zu
machen. Der zweite Durchlauf der Zusatzqualifikation wird deswegen
allen Betrieben mit industriell-technischen Auszubildenden im Bezirk
der Niederrheinischen IHK offenstehen“, so Wulfert.
„Wir freuen uns, dass alle Auszubildenden die Zusatzqualifikation
erfolgreich abgeschlossen haben. Das unterstreicht das große
Engagement aller Beteiligten. Im Mai wollen wir gemeinsam unseren
Partnern den zweiten Durchlauf starten. Unsere Auszubildenden sind
bereit“, so Dr. Veit Echterhoff, Ausbildungsleiter bei Thyssenkrupp
Steel.
Die 16 Auszubildenden der Thyssenkrupp Steel
AG und den Hüttenwerken Krupp Mannesmann absolvierten an 23
Trainingstagen sieben Module. Dabei ging es um den Einsatz, den
sicheren Umgang und den richtigen Transport von Wasserstoff. Am Ende
wartete eine IHK-Prüfung auf die Teilnehmer. Ansprechpartnerin bei
der Niederrheinischen IHK zum Thema ist Elisabeth Noke-Schäfer, 0203
– 2821-223,
noke@niederrhein.ihk.de

Gemeinsam mit Vertretern der Niederrheinischen IHK und der
Thyssenkrupp Steel AG freuen sich die Absolventen über ihre
Zusatzqualifikation Wasserstoff. Foto: Rainer Kaysers
IGBCE fordert Erhöhung der Vergütungen um 12,5 Prozent
Am 7. Februar 2024 haben die Tarifkommissionen der
Gewerkschaften IGBCE und ver.di in Düsseldorf die Forderung für die
diesjährige Tarifrunde bei RWE beschlossen. Die Erhöhung der
Entgelte steht dabei im Fokus: Für die 18.000 Beschäftigten des
Energieunternehmens fordern die Gewerkschaften ein Plus von 12,5
Prozent. Die Forderungshöhe sei absolut gerechtfertigt, betont
IGBCE-Verhandlungsführer Holger Nieden. Er stellt klar: „Die Höhe
ergibt sich aus dem extrem guten wirtschaftlichen Ergebnis des
Konzerns und der extrem guten Leistungen der Leute in den
Betrieben.“
Drei Mal habe Deutschlands größter
Stromerzeuger in den vergangenen drei Jahren per Ad-hoc-Meldung
bekannt gegeben, dass er deutliche höhere Gewinne als erwartet
erwirtschaftet habe. Auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen werde das
Unternehmensergebnis für das Geschäftsjahr 2023 das Vorjahr erneut
deutlich übertreffen und etwa 4,5 Milliarden Euro betragen. „Davon
müssen auch die Beschäftigten profitieren“, unterstreicht Nieden.
Die Tarifkommissionen von IGBCE und ver.di haben
einstimmig folgende Forderungen beschlossen: Erhöhung der
Vergütungstabelle um 12,5 Prozent Deutliche Erhöhung der
Ausbildungsvergütungen Monetäre Sonderleistungen für
Gewerkschaftsmitglieder Die Laufzeit des Vergütungstarifvertrages
soll 12 Monate betragen Die erste Tarifverhandlung findet am 23.
Februar 2024 in Essen statt.
Zusatzbehandlung mit Glenzocimab bei Schlaganfall
erfolgreich getestet
Im Rahmen einer Studie hat ein
internationales Forschungsteam unter Beteiligung des
Universitätsklinikums Essen herausgefunden, dass eine
Zusatzbehandlung mit dem Medikament Glenzocimab das Sterberisiko
nach einem akuten ischämischen Schlaganfall um fast ein Drittel
senkt. Bei einem ischämischen Schlaganfall kann das Gehirn aufgrund
einer blockierten Arterie nicht ausreichend mit Blut und Sauerstoff
versorgt werden. Je schneller das Blut nach einem solchen
Schlaganfall wieder normal fließen kann, umso geringer sind die
Schäden im Gehirn. Dazu müssen die Blutgerinnsel medikamentös
aufgelöst und ggf. zusätzlich mechanisch entfernt werden. idr
Infos:
https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(23)00427-1/fulltext
Hamborner Reit rechnet mit Sonderausgaben
Der Büro- und Einzelhandelsinvestor Hamborner Reit hat seine
Miet- und Pachterlöse im vergangenen Jahr um 4,6 % auf 91,1 Mio.
Euro gesteigert. Der operative Gewinn (FFO) stieg noch stärker um
7,2 % auf 54,7 Mio. Euro, wofür neben den Mietzuwächsen höhere
Zinserträge und geringere Instandhaltungsaufwendungen (infolge der
Verschiebung entsprechender Maßnahmen) sorgten. Weil
Instandhaltungen nachgeholt werden, rechnet das Unternehmen für 2024
mit einem FFO-Rückgang auf 49 bis 50,5 Mio. Euro bei wenig
veränderten Mieteinnahmen (91 bis 92,5 Mio. Euro).
Weiterer Grund für den erwarteten Gewinnrückgang sind erhöhte
Aufwendungen im "Zusammenhang mit der Umsetzung strategischer
Projekte sowie zusätzlichem Personalaufwand infolge von
Neueinstellungen und Nachbesetzung vakanter Stellen". Das Portfolio
wurde 2023 um 10,5 % abgewertet. Der Verschuldungsgrad (LTV) erhöhte
sich von 39,1 auf 43,5 %. Dennoch will die Reit-Gesellschaft die
Dividende um 2,1 % auf 48 Cent je Aktie erhöhen.
VHS:
Deutsch-Amerikanischer Freundeskreis Niederrhein
Monika
Petrich und Mitglieder des Deutsch-Amerikanischen Freundeskreises
Niederrhein stellen am Donnerstag, 15. Februar, von 17 bis 18 Uhr im
Saal des Stadtfensters, Steinsche Gasse 26, in der Duisburger
Stadtmitte die vielfältige Arbeit und das lebendige Vereinsleben des
Freundeskreises vor. Der Vortrag ist kostenlos. Eine vorherige
Anmeldung ist nicht erforderlich.
Zentralbibliothek:
Lesung „Sommer in Odessa“ von Irina Kilimnik
Die
Zentralbibliothek lädt am Freitag, 23. Februar, um 20 Uhr ins
Stadtfenster an der Steinschen Gasse 26 in Duisburg-Mitte zu einer
Lesung von Irina Kilimnik ein. Die Lesung erzählt die Geschichte
einer chaotischen Familie, der jungen Frau Olga auf der Suche nach
ihrem Weg und dem schönen Odessa vor dem Krieg. Olga, eine
Medizinstudentin wider Willen, lebt mit ihrer großen Familie in
Odessa am Schwarzen Meer.
Der Sommer in der Stadt ist
unbeschwert, doch Olgas Leben ist es nicht. Ihr Großvater ist das
unumstrittene Oberhaupt der Familie und verbirgt seine Enttäuschung
darüber, dass seine Nachkommen ausschließlich Frauen sind, kaum.
Lichtblicke in Olgas Leben sind ihre Freunde Mascha und Radj sowie
eine aufblitzende Perspektive der Befreiung. Irina Kilimnik kam im
Alter von 15 Jahren aus der Ukraine nach Deutschland.
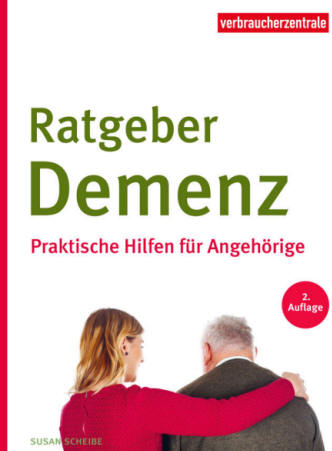
Foto (c) Simone Hawlisch
Ihr Roman ist auch eine Hymne an
das lebendige und multikulturelle Zusammenleben in Odessa. Karten
für diese Veranstaltung des Vereins für Literatur und der
Stadtbibliothek sind zum Preis von zehn Euro zuzüglich Gebühren
erhältlich unter www.stadtbibliothek-duisburg.de sowie bei den
bekannten Vorverkaufsstellen.
Musical in der Glückauf-Halle: „Der
Mann von la Mancha“
In der Glückauf-Halle in
Duisburg-Homberg, Dr.-Kolb-Str. 2, wird am Freitag, 1. März, um 20
Uhr das Musical „Der Mann von la Mancha“ von Dale Wasserman
aufgeführt. In der Produktion des EURO-STUDIO Landgraf stehen
Joachim Nimtz in der Titelrolle, Claus J. Frankl als Sancho Pansa,
Annika Bruhns als Aldonza und weitere auf der Bühne. Die
Uraufführungsproduktion des Erfolgsmusicals wurde 1966 mit fünf
TONY-Awards ausgezeichnet, unter anderem als bestes Musical und
beste Originalkomposition.
Ende des 16. Jahrhunderts in
Spanien: Der Dichter Cervantes wird wegen ketzerischer Äußerungen
von der spanischen Inquisition in den Kerker geworfen. Unter den
Gefangenen gilt das Recht des Stärkeren, und sie rauben den
Neuankömmling erst einmal aus. Sein wertvollster Besitz aber, das
Manuskript zu „Don Quichote de la Mancha“, ist ihnen nur Hohn und
Spott wert – bis Cervantes mit Hilfe seines Dieners beginnt, die
Geschichte von Don Quichote nachzuerzählen und zu spielen. Cervantes
selbst schlüpft dabei in die Rolle des Edelmanns Alonso Quijana, der
sich nach der Lektüre etlicher Heldenromane für den fahrenden Ritter
Don Quichote hält und mit seinem Schildknappen Sancho Pansa
auszieht, um das Böse zu bekämpfen.
Auch wenn Quijanas
Nichte Antonia und ihr Verlobter Dr. Carrasco bemüht sind, Alonso
Quijana von seinem Wahn abzubringen, beharrt dieser auf seiner
Vermischung von Fantasie und Wirklichkeit und kämpft als Don
Quichote gegen Windmühlen, die ihm als bösartige Riesen erscheinen,
oder sieht ein Schloss, wo es nur einen heruntergekommenen Gasthof
gibt. Nach und nach steigen die anderen Gefangenen auf Cervantes‘
Spiel ein.
Und als am Ende Cervantes vor das
Inquisitionstribunal gerufen wird, sind längst Fantasie, Mut und Don
Quichotes unerschütterliche Zuversicht im Kerker aufgeblüht.
Eintrittskarten sind für 19 bis 28 € zuzüglich Vorverkaufsgebühr im
Bürgerservice Homberg, Bismarckplatz 1, erhältlich. Auch an der
Abendkasse sind noch Tickets für den Preis von 22 bis 32 € zu
bekommen. Reservierungen für die Abendkasse sind auch telefonisch
unter (02066) 21-8832 möglich.
VHS: Die
Charente – Land des Cognac
In
Kooperation mit der Deutsch-Französischen
Gesellschaft Duisburg e.V. führt die VHS am
9. Februar mit Frankreich-Experte Ralf
Petersen in einer „Dia-Reise“ durch die
Charente, eine der reizvollsten Gegenden im
Südwesten Frankreichs. Los geht es um 18 Uhr
in der Volkshochschule Stadtmitte auf der
Steinschen Gasse 26. Im Mittelpunkt steht
die Landschaft, ihre Geschichte, die
romanische Kunst und die regionalen
kulinarischen Spezialitäten wie Austern und
Cognac.
Berühmte Städte wie La
Rochelle mit seinem malerischen alten Hafen,
Saintes mit seiner 2000 Jahre alten
Geschichte, Cognac mit seinen Brennereien
und Angoulème, die Comic-Hauptstadt
Frankreichs, werden ebenso vorgestellt, wie
die schönen Atlantik-Inseln Ré und Oleron
und dem Flusstourismus auf der Charente. Das
Teilnahmeentgelt für diese Veranstaltung
beträgt fünf Euro. Eine vorherige Anmeldung
ist erforderlich.
TÜV-Verband Umfrage: Fast jede:r Zweite sieht
negative Auswirkungen der Technologie auf Ressourcenverbrauch.
Messmethoden und einheitliche Standards für die Ermittlung des
Energiekonsums und mehr Transparenz notwendig. Europäischer AI Act
macht Vorgaben zu nachhaltiger KI. Safer Internet Day: TÜV MeetUp zu
Sicherheit und Nachhaltigkeit von Künstlicher Intelligenz in Europa.
Berlin, 6. Februar 2024 – Fast jede:r zweite Bundesbürger:in glaubt,
dass die Datenverarbeitung mit Künstlicher Intelligenz (KI) negative
Auswirkungen auf den Energiebedarf haben wird (47 Prozent). Auf der
anderen Seite sind 36 Prozent der Meinung, dass der Einfluss von KI
auf den Energieverbrauch eher gering oder gar nicht vorhanden ist.
Weitere 17 Prozent antworten mit „weiß nicht“.
Das hat
eine repräsentative Ipsos-Umfrage im Auftrag des TÜV-Verbands unter
1.000 Personen ab 16 Jahren ergeben. „Künstliche Intelligenz kann in
Bereichen wie der Klimaforschung einen positiven Beitrag leisten.
Die Technologie selbst hat aber einen erheblichen CO2-Fußabdruck“,
sagt Patrick Gilroy, Referent Künstliche Intelligenz und Bildung
beim TÜV-Verband, anlässlich des Safer Internet Day. „Vor allem das
Training von KI-Modellen mit großen Datenmengen, aber auch die
laufende Nutzung verschlingen erhebliche Energieressourcen.“
Wissenschaftler:innen schätzen, dass der Energieverbrauch
von Künstlicher Intelligenz bis zum Jahr 2027 auf 85 bis 134
Terawattstunden (TWh) ansteigen könnte, was etwa dem heutigen
Stromverbrauch der Niederlande entsprechen würde. Allerdings sind
diese Berechnungen unsicher, da bis dato insbesondere die
Entwickler:innen großer Sprachmodelle („Large Language Models“) wie
Open AI / Microsoft mit ChatGPT oder Google mit Bard keine Angaben
zum Energieverbrauch ihrer KI-Systeme veröffentlichen. „Für die
zukünftige Ermittlung des Energieverbrauchs einer KI nach
einheitlichen Standards müssen Messmethoden entwickelt werden“, sagt
Gilroy.
„Darüber hinaus sollten die Anbieter der großen
Basismodelle verpflichtet werden, den Energieverbrauch ihrer
KI-System transparent zu machen.“ Entsprechende rechtliche Vorgaben
sind im kürzlich verabschiedeten europäischen AI Act teilweise
verankert. So sollen Im Rahmen der laufenden Normungsarbeiten auch
KI-spezifische Standards für den Ressourcenverbrauch entwickelt
werden. Wirksam werden die Regelungen mit Inkrafttreten der
Verordnung aber erst im Jahr 2026. „Der AI Act setzt nicht nur bei
der Sicherheit, sondern auch beim Thema Nachhaltigkeit Maßstäbe“,
sagt Gilroy.
Jetzt komme es darauf an, wie die
Ressourceneffizienz von KI in der Praxis gemessen wird und auf
dieser Basis verbessert werden kann. Forschungseinrichtungen sowie
Prüf- und Normungseinrichtungen könnten hier wichtige Beiträge
leisten. „Nachhaltigkeit und Sicherheit von Künstlicher Intelligenz
in Europa“ sind auch die zentralen Themen des heutigen TÜV
Online-Meetups, das live übertragen wird: Ist generative KI Teil der
Lösung oder Verstärker aktueller ökologischer und sozialer Probleme?
Befördert oder bremst der europäische AI Act die Entwicklung
sicherer und nachhaltiger KI? Und welche innovativen Start-Ups und
Initiativen zeigen, dass Europa bei der KI-Entwicklung international
mithalten kann?
Evangelische Kirche mitgestalten -
Gemeindemitglieder wählen neue Leitungsgremien
Per
Brief, digital oder direkt am Wahltag vor Ort - im Evangelischen
Kirchenkreis Duisburg sind von den rund 56.000 Gemeindemitgliedern
gut 29.000 Duisburgerinnen und Duisburger aufgerufen, in ihren
Gemeinden neue Leitungsgremien zu wählen. Denn in den
Kirchengemeinden Alt-Duisburg, der Bonhoeffer Gemeinde Marxloh
Obermarxloh, der Rheingemeinde (Wanheim / Wanheimerort), der
Gemeinde Trinitatis (Buchholz / Wedau) und der Versöhnungsgemeinde
Duisburg Süd gibt es insgesamt 75 Kandidierende, die ihre Kirche im
Presbyterium die nächsten vier Jahre ehrenamtlich mitgestalten
möchten.
In sieben Gemeinden des Evangelischen
Kirchenkreises Duisburg gibt es genauso viele Kandidierende wie
Plätze im Presbyterium, dort gelten die Kandidierenden als gewählt.
In Hamborn wurde die Wahl um ein Jahr verschoben. Die
Wahlberechtigten der fünf Gemeinden, in denen nun eine Wahl
stattfindet, haben im Januar eine Benachrichtigung mit allen Infos
zur Stimmabgabe erhalten: So ist es erstmals – und noch bis zum 11.2
– möglich, online das neue Leitungsgremium der Gemeinde zu wählen.
Selbstverständlich kann nach wie vor mit der Wahlbenachrichtigung
eine Briefwahl beantragt werden.
Die Wahlunterlagen
müssen in diesem Fall ausgefüllt bis zum 14.2 bei der
Kirchengemeinde eingegangen sein. Wo und wann am 18.2 in der
Gemeinde persönlich gewählt werden kann, geht ebenfalls aus der
Benachrichtigung hervor. Mit der Teilnahme an der Wahl setzen die
Gemeindemitglieder ein Zeichen der Solidarität, betont Dr. Christoph
Urban, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Duisburg,
„denn sie zeigen, dass ihnen die Zukunft ihrer Gemeinde und ihrer
Kirche am Herzen liegt. Und mit jeder Stimme stärken sie das
ehrenamtliche Engagement in den Presbyterien.“
Die
gewählten Ehrenamtlichen beraten und entscheiden in den Presbyterien
gemeinsam mit Pfarrerinnen und Pfarrern u.a. Fragen der Finanzen,
der Personalentwicklung oder des theologischen Profils der Gemeinde.
Warum Ehrenamtliche sich für die Kandidatur entschlossen haben und
sich zur Wahl in den fünf Gemeinden stellen, ist auf den jeweiligen
Internetseiten der Gemeinden zu erfahren. Eine Zusammenstellung der
entsprechenden Links gibt es im Netz unter www.kirche-duisburg.de;
mehr Infos zur Wahl gibt es Netz unter
https://presbyteriumswahl.de.

1,1 Millionen weniger Niedriglohnjobs im April 2023
gegenüber April 2022
• Anteil der Jobs im
Niedriglohnsektor von 19 % auf 16 % gesunken • Niedriglohnanteil im
Gastgewerbe am höchsten • 2,4 Millionen Beschäftigungsverhältnisse
erhalten Mindestlohn
Knapp jede und jeder sechste abhängig Beschäftigte (16 %) in
Deutschland arbeitete im April 2023 im Niedriglohnsektor. Damit lag
der Verdienst von rund 6,4 Millionen Jobs unterhalb der
Niedriglohnschwelle von 13,04 Euro brutto je Stunde. Wie Destatis
mitteilt, waren das 1,1 Millionen Niedriglohnjobs weniger als im
April 2022 (7,5 Millionen).
Der Anteil dieser Jobs an allen
Beschäftigungsverhältnissen sank somit bundesweit von 19 % auf 16 %.
Eine Erklärung für diese Entwicklung ist der zwischen Januar und
Oktober 2022 von 9,82 Euro auf 12,00 Euro gestiegene Mindestlohn.
• Die Hälfte aller Beschäftigten im Gastgewerbe im
Niedriglohnbereich
Gut jedes zweite Beschäftigungsverhältnis im
Gastgewerbe (51 %) lag im April 2023 im Niedriglohnsektor. In der
Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft (43 %) und im Bereich Kunst,
Unterhaltung und Erholung (36 %) war der Anteil der
Niedriglohnbeschäftigten ebenfalls überdurchschnittlich hoch. In der
öffentlichen Verwaltung (4 %), in der Finanz- und
Versicherungsbranche (6 %), in der Informations- und
Kommunikationsbranche (7 %) sowie im Bereich von Wasser,
Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen (7 %)
waren die Anteile hingegen am niedrigsten. 19 % der Frauen
arbeiteten im Niedriglohnsektor
• Knapp jede fünfte Frau (19 %) arbeitete im April 2023 in
Deutschland im Niedriglohnsektor. Bei den Männern war es knapp jeder
siebte (13 %). Der Anteil an Beschäftigungsverhältnissen im
Niedriglohnsektor sank bei den Frauen mit einem Rückgang von 23 %
auf 19 % im Zeitraum April 2022 bis April 2023 etwas stärker als bei
den Männern. Hier ging er von 16 % auf 13 % zurück.
•
Jede und jeder vierte geringfügig entlohnte Beschäftigte erhielt
Mindestlohn
Im April 2023 wurden deutschlandweit
2,4 Millionen Jobs mit dem gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro
bezahlt. Das entspricht 6,2 % aller mindestlohnberechtigten
Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland. Gut jedes vierte
geringfügig entlohnte Beschäftigungsverhältnis erhielt den
Mindestlohn (26,6 %). J
obs in Voll- oder Teilzeit wurden
dagegen deutlich seltener mit Mindestlohn vergütet (1,4 % bzw. 5,0).
Im gleichen Zeitraum hatten gut 1,0 Million
Beschäftigungsverhältnisse (2,6 %) einen rechnerischen
Stundenverdienst unterhalb des gesetzlichen Mindestlohns. Die
ausgewiesenen Beschäftigungsverhältnisse unterhalb des gesetzlichen
Mindestlohnes können nicht unmittelbar mit Verstößen gegen das
Mindestlohngesetz - sogenannte Non-Compliance - gleichgesetzt
werden. Nicht alle Regelungen des Gesetzes, wie beispielsweise
Praktikumsverhältnissen, können trennscharf in der Statistik
abgegrenzt werden.
NRW: Knapp 70 Prozent der 16- bis 74-Jährigen kauften
2023 online ein
Mehr als zwei Drittel (69,3 Prozent)
der 16- bis 74-Jährigen in Nordrhein-Westfalen haben in den letzten
drei Monaten vor der Befragung Waren und Dienstleistungen online
eingekauft. Dies zeigen die Ergebnisse der Erhebung zur Nutzung von
Informations- und Kommunikationstechnologien 2023. Wie das
Statistische Landesamt Nordrhein-Westfalen weiter mitteilt, gaben
Männer (70,6 Prozent) etwas häufiger als Frauen (68,0 Prozent) an,
in letzter Zeit etwas im Internet bestellt zu haben.
Mit
mehr als drei Viertel (76,6 Prozent) haben die meisten
Onlineeinkäuferinnen und Onlineeinkäufer Kleidung oder Sportartikel
bestellt. Nahezu die Hälfte (48,7 Prozent) kaufte Filme oder Musik
im Internet. Auf Rang drei lagen Eintrittskarten (z. B. für Theater,
Kino, Musik, Sport) mit einem Anteil von 34,8 Prozent. Größte
Geschlechterunterschiede bei den Waren Lebensmitteln, Getränken und
Gütern des täglichen Bedarfs Der im Vergleich zu den Männern
(24,0 Prozent) deutlich höhere Anteil der Frauen (39,6 Prozent), der
Lebensmittel, Getränke und Güter des täglichen Bedarfs online
eingekauft hat, verdeutlicht die bestehenden Unterschiede zwischen
den Geschlechtern im Einkaufsverhalten am deutlichsten.
Mit 81,9 Prozent lag der Anteil der Frauen, der Kleidung und
Sportartikel gekauft hatte, ebenfalls wesentlich höher als der
Anteil der Männer mit 71,7 Prozent. Dagegen gab ein größerer Anteil
der Männer (51,3 Prozent) im Vergleich zu den Frauen (45,9 Prozent)
an, Filme und Musik online eingekauft zu haben.
Online
Einkaufsverhalten unterscheidet sich je nach Alter, Buchungen von
Unterkünften zeigen sich altersunabhängig Teilt man die
Onlinekäuferinnen und -käufer in zwei Altersgruppen, so zeigt sich
folgendes Bild: die jüngere Personengruppe (16- bis 44 Jahre) war
die vergleichsweise aktivere Gruppe des Internethandels; so lag hier
der Anteil derjenigen die in den letzten drei Monaten vor der
Befragung online eingekauft hat bei 77,4 Prozent.
Dieser
Anteil lag bei den 45- bis 74-Jährigen bei lediglich 62,1 Prozent.
Der größte Unterschied zwischen den Altersgruppen in Bezug auf das
Kaufverhalten ist bei der Warengruppe der Filme, Musik und weiterer
digitaler Produkte erkennbar: Während 59,3 Prozent der 16- bis
44-Jährigen Filme und Musik über das Internet gekauft haben, waren
es bei den 45- bis 74-Jährigen nur 36,9 Prozent. Auch bei Kleidung
und Sportartikeln bestehen deutliche Unterschiede beim
Kaufverhalten.
Bei der Gruppe der 16- bis 44-Jährigen
gaben hier 80,4 Prozent, bei den älteren Personen (45- bis
74-Jährigen) 72,4 Prozent an, dass diese Waren im Internet gekauft
wurden. Die geringsten Unterschiede zeigten sich bei den Buchungen
von Unterkünften: hier lagen die 16- bis 44-Jährigen mit
32,2 Prozent und die 45- bis 74-Jährigen mit 31,6 Prozent nahezu
gleichauf.

Mit Olaf Scholz um die Welt
Bundeskanzler
Olaf Scholz startet heute seine diplomatische USA-Reise und
wird im Zuge dessen von Präsident Joe Biden im Weißen Haus erwartet.
Es ist Scholz fünfter Arbeitsbesuch in Washington D.C. und die 102.
Auslandsreise seit seinem Amtsantritt am 8. Dezember 2021. Wie die
Infografik von Statista zeigt, gehören die USA zu den am häufigsten
besuchten Ländern des Bundeskanzlers. Ebenfalls fünfmal war Scholz
beruflich in Spanien. Nur Frankreich (10 Besuche) und Belgien (17
Besuche) standen noch häufiger auf dem Terminkalender.
Dass der Bundeskanzler so oft in Belgien ist, liegt vor
allem an den Verpflichtungen im Rahmen der Europäischen Union,
dessen wichtigste Institutionen ihren Sitz in Brüssel haben.
Sitzungen des Europarats und der Europäischen Kommission, sowie EU-
und NATO-Gipfel hat Olaf Scholz hier in den vergangenen Jahren
einige absolviert. Seit 2021 war der Bundeskanzler in acht
afrikanischen Ländern auf Staatsbesuch,
in Ägypten sogar zweimal. Insgesamt hat Olaf Scholz während seiner
Tätigkeit als deutsches Staatsoberhaupt rund 53 Länder weltweit
besucht und dabei, bis auf Australien, einen Fuß auf jeden Kontinent
gesetzt. Renè Bocksch

Wie beliebt ist Olaf Scholz? INTERNATIONALEN
SPITZENPOLITIKER - Stand 08.02.2024
Olaf Scholz (SPD)
reist heute zu einem Arbeitsbesuch nach Washington D.C. - er ist
dort bereits das fünfte Mal zu Gast, wie die Auslandsreisen-Statistik
des Bundeskanzlers zeigt. Dabei wird er auch mit US-Präsident
Joe Biden zusammentreffen, ein internationaler Spitzenpolitiker, der
bei den Menschen in Deutschland deutlich beliebter ist als Scholz.
Einer Umfrage der Statista
Consumer Insights zufolge lautet das "Markenprofil" des
Bundeskanzlers wie folgt: 92 Prozent kennen ihn, 18 Prozent mögen
ihn, 17 Prozent verfolgen, was er so tut und lässt und 42 Prozent
haben ihn in den Medien wahrgenommen.
Biden dagegen
kennen 89 Prozent, 30 Prozent mögen ihn, 22 Prozent verfolgen, was
er so tut und lässt und 48 Prozent haben ihn in den Medien
wahrgenommen. Damit schlägt er den deutschen Bundeskanzler in drei
von vier Kategorien. Ähnlich sieht das beim französischen
Präsidenten Emmanuel Macron aus - den allerdings hierzulande
deutlich weniger Menschen kenn als Scholz oder Biden. Auch der
Vergleich mit dem Autokraten Wladimir Putin fällt nicht allzu
schmeichelhaft aus, wie der Blick auf die Statista-Grafik aus. Aber
immerhin liegt Scholz in allen Belangen deutlich vor dem türkischen
Präsidenten, Recep Tayyip Erdoğan. Mathias Brandt

Im Gastgewerbe ist Niedriglohn besonders weit verbreitet
- Stand 08.02.2024
Die Hälfte aller Beschäftigten im
Gastgewerbe im Niedriglohnbereich. Das zeigt die Statista-Grafik auf
Basis der Verdiensterhebung
des Statistischen Bundesamts. In der Land-, Forst- und
Fischereiwirtschaft (43 Prozent) und im Bereich Kunst, Unterhaltung
und Erholung (36 Prozent) war der Anteil der
Niedriglohnbeschäftigten ebenfalls überdurchschnittlich hoch. Am
niedrigsten sind die Anteile dagegen in der Finanz- und
Versicherungsbranche und in der öffentlichen Verwaltung. 16 Prozent
der Beschäftigten in Deutschland arbeitete im April 2023 im
Niedriglohnsektor.
Damit lag der Verdienst von rund 6,4
Millionen Jobs unterhalb der Niedriglohnschwelle von 13,04 Euro
brutto je Stunde. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, waren das
1,1 Millionen Niedriglohnjobs weniger als im April 2022 (7,5
Millionen). Der Anteil dieser Jobs an allen
Beschäftigungsverhältnissen sank somit bundesweit von 19 % auf 16 %.
Eine Erklärung für diese Entwicklung ist laut Statistischem
Bundesamt der zwischen Januar und Oktober 2022 von 9,82 Euro auf
12,00 Euro gestiegene Mindestlohn.
In der Verdiensterhebung werden mit Hilfe einer
geschichteten Stichprobe Angaben von 58.000 Betrieben zu Verdiensten
und Arbeitszeiten von abhängig Beschäftigten erhoben. Zum
Niedriglohnsektor zählen alle Beschäftigungsverhältnisse, die mit
weniger als zwei Drittel des mittleren
Bruttostundenverdienstes (13,04 Euro im April 2023 bzw. 12,50
Euro im April 2022) entlohnt werden. Auszubildende werden bei dieser
Analyse ausgeschlossen. Matthias Janson

Wie viele Hundertjährige leben in Deutschland?
Charlotte Kretschmann wurde am 3. Dezember 1909 in Breslau
geboren. Die heute polnische Stadt gehörte damals zur Provinz
Schlesien des Deutschen
Kaiserreichs. Frau Kretschmann gilt mit 114 Jahren als älteste
lebende Deutsche. Damit ist sie in der heutigen Bundesrepublik
eine absolute Ausnahmeerscheinung. Indes dürften Supercentenarians
(Menschen, die mindestens 110 Jahre alt sind) dem UN
World Population Prospects 2022 in naher Zukunft etwas weniger
ungewöhnlich sein.
Gab es laut Schätzung der
UN-Analyst:innen zur Jahrtausendwende hierzulande weniger als 6.000
Menschen im Alter von 100+ Jahren könnten es aktuell bereits über
26.000 sein. Frauen sind in dieser Altersgruppe deutlich häufiger
vertreten als Männer, aktuell machen sie rund 83 Prozent der (über)
Hundertjährigen aus. Das könnte sich laut UN-Prognose aber graduell
ändern - im Jahr 2100 soll der Frauenanteil bei den Superalten "nur"
noch bei 62 Prozent liegen. Mathias Brandt

Reisen Deutsche eher privat oder beruflich?
Für einen Großteil der Deutschen spielten Dienstreisen im
vergangenen Jahr kaum eine Rolle. Das zeigt eine Auswertung unserer
Statista Consumer Insights, laut derer 64 Prozent der Befragten im
entsprechenden Zeitraum gar nicht beruflich verreist sind. Auch
hinsichtlich touristischer
Reisen fokussierten sich die Umfrageteilnehmer:innen eher auf
wenige Unternehmungen. So geben insgesamt 62 Prozent an, ein bis
drei private Reisen getätigt zu haben, 38 Prozent sind insgesamt
zwei bis drei Mal verreist.
Vielreisende gibt es in
Deutschland verhältnismäßig wenige. Der Anteil der Befragten, die in
den zurückliegenden zwölf Monaten mehr als sechs touristische
Ausflüge unternommen haben, liegt echtsprechend bei sechs Prozent.
Laut der Tourismusanalyse
2023 der Stiftung für Zukunftsfragen hatten rund 28 Prozent der
befragten Deutschland für das laufende Jahr Urlaub
in Deutschland geplant, 41 Prozent wollten Urlaub in Europa
machen. Fernreisen zu Zielen außerhalb des europäischen Kontinents
standen bei lediglich etwa 14 Prozent auf dem Plan. Inländischer
Tourismus hatte 2022 rund neun Prozent zum Bruttoinlandsprodukt
beigetragen. Florian Zandt
