






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 4. Kalenderwoche:
22. Januar
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Donnerstag, 23. Januar 2025
Zustand vieler Sportstätten besorgniserregend: Keine
Blockade der Union bei der Altschuldenfrage!
Duisburger
Sportvereine schlagen Alarm. Sie fordern deutlich höhere
Investitionen, einfache Förderprogramme und weniger Bürokratie. Die
Duisburger Bundestagsabgeordneten Bärbel Bas und Mahmut Özdemir
betonen: „Nicht nur der bauliche Zustand unserer Schwimm- und
Sportstätten ist besorgniserregend, auch die damit verbundenen
sozialen Folgen müssen ernst genommen werden, wenn unsere
Sportvereine nicht mehr arbeiten können und immer weniger Kinder aus
Duisburg Schwimmen lernen.“
Untermauert wird der
Hilferuf durch eine Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik
(difu), das im Herbst 2024 über 300 Kämmereien zu dem Zustand ihrer
Sportstätten befragt hat. Fazit: 25 Prozent aller Kommunen können
die Kosten für Sportstätten teilweise oder gar nicht mehr stemmen.
„Der Ausblick ist noch beängstigender – ein Drittel der Kommunen
befürchtet aufgrund der Haushaltslage ihr Sportangebot künftig
einschränken zu müssen“, betonen Bärbel Bas und Mahmut Özdemir.
Folge möglicher Schließungen wäre eine Reduzierung der
Sportangebote, obwohl heute über 28 Millionen Menschen bundesweit in
Sportvereinen aktiv sind. Der Ruf nach zusätzlichem Geld blieb beim
Bund nicht ungehört– obwohl für die Finanzierung die Länder und
nicht der Bund zuständig sind. Allein seit 2015 flossen über das
Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen
Sport, Jugend und Kultur“ Mittel in Höhe von rund 1,24 Milliarden
Euro in kommunale Sportstätten. 2022 waren es etwa 120 Millionen
Euro, die für die Sportstätten an die Kommunen gingen.
Hinzu kommen der „Investitionspakt Sportstätten“, in dem zwischen
2020 und 2022 ein Volumen von 370 Millionen Euro bereitgestellt
wurde, sowie das Programm „ReStart Sport“, das nach der
Corona-Pandemie mit 25 Millionen Euro aufgesetzt wurde, um
Mitglieder für den Vereinssport zurückzugewinnen und das Ehrenamt zu
stärken. „Trotz Sparvorgaben des ehemaligen FDP-Finanzministers
haben sich die Parlamentarier durchgesetzt und die Mittel
bereitgestellt“, stellen Bas und Özdemir klar.
Der Bund
ist tätig geworden, weil die Länder ihrer Pflicht nicht hinreichend
nachkommen. Die Kommunen sind überfordert, zumal ihre Defizite
aufgrund anderer Ausgaben stetig wachsen. Hier hilft nur eine
Investitionsoffensive des Bundes und eine Entlastung bei den
Schulden der Kommunen. Jetzt hat der Bund einen Vorschlag für eine
Grundgesetzänderung vorgelegt, die im Parlament eine
Zweidrittelmehrheit braucht.
„Jetzt ist die Union
gefordert: Ministerpräsident Wüst und sein Kanzlerkandidat Merz
müssen zeigen, ob sie an der Seite der Kommunen stehen und für eine
Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat sorgen!“, fordern Bas
und Özdemir „Verweigern CDU und CSU sich, wird sich am Zustand der
Sportstätten in Duisburg auf Sicht nichts ändern.“
Gemeinsam für die gute Sache: Lions Clubs Duisburg Hamborn
und Rhenania spenden 5.500 Euro an livingroom e.V. Meiderich
Die Lions Clubs Duisburg-Hamborn und Duisburg Rhenania
haben heute gemeinsam eine Spende in Höhe von 5.500 Euro an das
Sozialprojekt livingroom Meiderich übergeben. Die Spenden stammen
aus einer einzigartigen Langzeit-Activity auf dem Marina Markt im
Duisburger Innenhafen in 2024, bei der an acht Sonntagen eine
Aperol-Spritz-Bar betrieben wurde.

Die Spendenübergabe mit XXL-Bauklötzen stand für die Beteiligten
symbolisch für „Großes gemeinsam schaffen“: (v.l.n.r.): Martin
Menkhaus, livingroom-Chef Steffen Brieden, Manuel Wilke, Christel
Tenter, Rhenania-Präsident Ralf Cervik und Einrichtungsleiterin
Linda Burghof - Foto privat
Die Kooperation der beiden
Clubs war ein voller Erfolg und brachte nicht nur einen beachtlichen
Spendenbetrag, sondern auch eine Stärkung der Zusammenarbeit der
Duisburger Lions-Bewegung. Der Spendenbetrag fließt in das
Eltern-Kind-Café der Initiative „livingroom e.V. Meiderich“, das
geflüchtete Familien aus dem Duisburger Norden mit Kindern im Alter
von 0 bis 4 Jahren unterstützt. Ziel ist es, Eltern in ihrem Alltag
zu stärken und ihnen Brücken zu weiteren Institutionen wie Kitas
oder Schulen zu bauen.
Kooperation für die Zukunft
„Die Zusammenarbeit mit dem Lions Club Duisburg Rhenania war eine
große Bereicherung für uns. Gemeinsam haben wir gezeigt, wie stark
wir sind, wenn wir zusammenarbeiten – für die gute Sache und die
Menschen in unserer Stadt“, sagte Christel Tenter,
Activity-Beauftragte des Lions Clubs Duisburg Hamborn, bei der
Spendenübergabe.
Ralf Cervic, Präsident des Lions
Clubs Duisburg Rhenania, unterstrich ebenfalls die Bedeutung der
Kooperation: „Dies war unser erstes gemeinsames Projekt, und es hat
gezeigt, wie gut unsere beiden Clubs harmonieren. Wir freuen uns
darauf, auch in Zukunft gemeinsam etwas zu bewegen.“
Spielbausteine für die Kinder
Zusätzlich zu der finanziellen
Unterstützung übergaben die Lions Clubs große, bunte Spielbausteine
an die Spielgruppe des Eltern-Kind-Cafés. Michael Brieden, Gründer
und Initiator von livingroom e.V., zeigte sich begeistert: „Diese
Spende wird uns helfen, den Familien weiterhin einen geschützten
Raum zu bieten, in dem sie sich entwickeln und vernetzen können.
Denn die Not hier in Meiderich ist riesig. Und die
XXL-Spielbausteine sind ein tolles Highlight für die Kinder.“
Die Spendenaktion verdeutlicht das Engagement der Lions
Clubs Duisburg Hamborn und Duisburg Rhenania für die Region und
zeigt, wie gemeinsames Handeln Großes in Duisburg bewirken kann. Die
beiden Clubs planen bereits weitere Projekte, um auch zukünftig
einen Unterschied zu machen.
Luftlinie versus Straßennetz: Universeller
Zusammenhang gefunden
Die direkte
Verbindung zwischen zwei Orten per Luftlinie ist in der Regel kürzer
als der Weg, den man per Auto zurücklegen muss. Zwei
Physik-Arbeitsgruppen der Universität Duisburg-Essen haben nun
herausgefunden: Die Entfernung zwischen zwei Orten in einem
Autobahn-Netzwerk ist typischerweise 1,3-mal länger als deren
Verbindung per Luftlinie.
Ihre tatsächlich neue
Erkenntnis basiert auf einer umfangreichen Analyse von Daten aus
Europa, Asien und Nordamerika und wurde veröffentlicht im
Fachmagazin npj
Complexity. Durchgeführt wurde die Studie von den Arbeitsgruppen
Statistische Physik komplexer Systeme um Prof. Thomas Guhr sowie
Physik von Transport und Verkehr unter der Leitung von Prof. Michael
Schreckenberg.
Sie ermittelten die Entfernung zwischen
etwa 2.000 Orten innerhalb von Frankreich, Deutschland, Spanien,
China und den USA. Dazu verwendeten sie frei nutzbare Geodaten und
verglichen die Streckenlänge über das Autobahnnetz mit der
jeweiligen geodätischen Entfernung – der direkten Verbindung
zwischen zwei Orten, wie ein Vogel sie fliegen könnte.
Sie fanden heraus, dass das Verhältnis der beiden Strecken recht
universell ist: Die Strecke per Auto ist in der Regel 1,3 (± 0,1)
mal länger als die Luftlinie. „Dieses stabile Verhältnis über Länder
und Kontinente hinweg ist das Ergebnis zweier gesellschaftlicher
Bedürfnisse, die miteinander konkurrieren“, erklären die Leiter der
Studie. „Zum einen möchten wir schnell und effizient an unser Ziel
gelangen, zum anderen möchten wir Kosten und Umweltauswirkungen so
gering wie möglich halten.“
Aus ihren Erkenntnissen
wurde ein neues Modell für die Planung von Autobahn-Netzwerken
abgeleitet, das sie als "teilweise zufälliges Autobahn-Netzwerk"
bezeichnen. Es basiert auf der Idee, bestehende Verbindungen
effizient zu nutzen, indem benachbarte Regionen schrittweise
verbunden werden. Der zufällige Teil des Modells besteht darin,
gewisse Verbindungen zwischen Städten und Orten im Autobahn-Netzwerk
nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit herzustellen.
Definierte Regeln stellen dabei logische Verbindungen und eine gute
Vernetzung sicher. Das Modell könnte künftig die Effizienz von
Verkehrswegen verbessern und gleichzeitig deren Umweltauswirkungen
verringern.
Gault&Millau kürt beste Restaurants
im Ruhrgebiet
Fast 30 Restaurants im Ruhrgebiet haben
es in den Gault&Millau Restaurantguide 2025 geschafft. "Hotspot" in
der Region ist Essen mit gleich elf Gaststätten, die in den
Kulinarikführer aufgenommen wurden, darunter Kettner's Kamota mit
zwei (von fünf möglichen) roten Kochmützen.
Die beste
Bewertung im Ruhrgebiet erhielt das Restaurant "SchwarzGold" in der
historischen Gastiefkühlanlage auf der Kokerei Hansa in Dortmund. Es
erhielt drei rote Kochmützen. Der Gault&Millau Restaurantführer gilt
neben dem Guide Michelin als der einflussreichste Restaurantführer
französischen Ursprungs. idr. Infos:
https://www.gaultmillau-media.com
Programmvorstellung 46. Duisburger Akzente
Wenn sich Duisburg in Kürze wieder für drei Wochen in den
kulturellen Hotspot unserer Region verwandelt, kann das nur eins
bedeuten: endlich wieder Duisburger Akzente! Die 46. Auflage des
beliebten Festivals findet vom 15. März bis 6. April statt.
Künstlerinnen und Künstler inszenieren an 40 Schauplätzen über 90
Veranstaltungen.
Von Aufführungen und Ausstellungen,
über Lesungen, Konzerte und Filme, bis hin zu Rundgängen sowie
Vorträgen. Alljährlich stehen dabei die Performances unter einem
Motto, das sie verbindet. Diesmal: „Sein und Schein". Das Programm
und die vielseitigen Highlights stellen am Donnerstag, 30. Januar
2025, um 12 Uhr Theater Duisburg, Opernfoyer, Neckarstraße 1, 47051
Duisburg-Mitte, Kulturdezernentin Linda Wagner, Petra Schröder,
Geschäftsleiterin der Kulturbetriebe sowie Clemens Richert,
Projektleiter und Koordinator der Duisburger Akzente, vor.
Inflation im Jahr 2024 für 6 von 9 Haushaltstypen
bei oder unter 2 Prozent, Anstieg zum Jahresende nicht überbewerten

Neue Werte des IMK Inflationsmonitors
Die Inflationsrate in
Deutschland ist im Dezember 2024 zwar erneut gestiegen auf 2,6
Prozent. Im Gesamtjahr 2024 lag sie mit 2,2 Prozent aber sehr nah am
Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent.
Ähnlich ist dieses Muster, wenn man auf die Inflationsraten
verschiedener Haushaltstypen blickt, die sich nach Einkommen und
Personenzahl unterscheiden: Im Dezember wiesen alle von ihnen
Inflationsraten an oder etwas über dem Inflationsziel auf.
Im Gesamtjahr erlebten nur drei von neun Haushaltstypen
Inflationsraten oberhalb des EZB-Ziels, während sechs unter oder bei
zwei Prozent lagen, zeigt der neue IMK-Inflationsmonitor. Der
Anstieg zum Jahresende sollte nicht überbewertet werden, so Dr.
Silke Tober, Inflationsexpertin des Instituts für Makroökonomie und
Konjunkturforschung (IMK).
Während insbesondere ärmere
Familien im Mittel der Jahre 2022 und 2023 eine deutlich höhere
Teuerung schultern mussten als Haushalte mit mehr Einkommen, war
ihre Inflationsrate im Dezember 2024 wie im Gesamtjahr 2024
unterdurchschnittlich: Der Warenkorb von Paaren mit Kindern und
niedrigen Einkommen verteuerte sich im Dezember um 2,0 Prozent, im
Gesamtjahr um 1,6 Prozent. Dabei wirkte sich aus, dass sowohl
aktuelle Preisrückgänge bei Haushaltsenergie als auch bei
Kraftstoffen im Warenkorb dieser Haushalte ein relativ hohes Gewicht
haben und auch den zuletzt etwas stärkeren Anstieg der
Lebensmittelpreise weitgehend kompensierten. Das gilt, etwas
abgeschwächt, auch bei Alleinerziehenden sowie bei Paaren mit
Kindern und jeweils mittleren Einkommen

2025 dürfte sich die Inflationsrate weiter normalisieren und bei
gesamtwirtschaftlich zwei Prozent einpendeln, so die Prognose des
IMK. Ein längerfristiger Vergleich, den IMK-Inflationsexpertin Tober
in ihrem neuen Bericht anstellt, zeigt aber auch die Nachwirkungen
der hohen Inflation in den vergangenen Jahren. Insgesamt lagen die
Verbraucherpreise 2024 um 19,9 Prozent höher als fünf Jahre zuvor.
Damit war die Teuerung fast doppelt so stark wie mit der
EZB-Zielinflation von kumuliert 10,4 Prozent in diesem Zeitraum
vereinbar.
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke
verteuerten sich sogar um 35,6 Prozent, Energie war trotz der
Preisrückgänge in letzter Zeit um 40,2 Prozent teurer als 2019.
Deutlich weniger stark, um 15,5 Prozent, haben sich Dienstleistungen
verteuert. Paare mit Kindern und niedrigen und mit mittleren
Einkommen hatten im Fünf-Jahres-Vergleich die höchsten
Inflationsbelastungen zu schultern, Alleinlebende mit sehr hohen
Einkommen die niedrigste.

Für die
Geldpolitik sind indes die mittlerweile wieder entspannte
Preisentwicklung und die normalisierte mittelfristige Perspektive
maßgeblich, betont Ökonomin Tober. Zumal die Wirtschaft im Euroraum
schwächelt und in Deutschland stagniert. Daher hält die Autorin des
IMK Inflationsmonitors weitere Zinsschritte für erforderlich.
„Aktuell sind die Leitzinsen trotz der Zinssenkungen im vergangenen
Jahr noch auf einem Niveau, das die Wirtschaft dämpft“, schreibt
Tober.
Statt einer Nachfragedrosselung benötige die
Wirtschaft im Euroraum und insbesondere in Deutschland einen
positiven Nachfrageschub, der ein günstiges Umfeld für Investitionen
schafft. „Die EZB kann dazu einen Beitrag leisten, indem sie den
Leitzins zügig aus dem restriktiven Bereich herausnimmt.“
Familien mit niedrigen und mit mittleren Einkommen mussten in
fünf Jahren knapp 21 Prozent Inflation schultern

Die längerfristige Betrachtung illustriert, dass Haushalte
mit niedrigem bis mittlerem Einkommen von der starken Teuerung nach
dem russischen Überfall auf die Ukraine besonders stark betroffen
waren, weil Güter des Grundbedarfs wie Nahrungsmittel und Energie in
ihrem Budget eine größere Rolle spielen.
Diese wirkten lange als die stärksten Preistreiber. So betrug auf
dem Höhepunkt der Inflationswelle im Oktober 2022 die Teuerungsrate
für Familien mit niedrigen Einkommen 11 Prozent, die für ärmere
Alleinlebende 10,5 Prozent. Alleinlebende mit sehr hohen Einkommen
hatten damals mit 7,9 Prozent die mit Abstand niedrigste
Inflationsrate.
In der Betrachtung über einen
Fünf-Jahres-Zeitraum sind die Abstände weniger groß, weil sich
zuletzt vor allem Dienstleistungen verteuert haben, die Haushalte
mit höheren Einkommen stärker nachfragen als Ärmere. Allerdings
zeigen sich nach wie vor auch über den gesamten Zeitraum merkliche
Unterschiede bei der Belastung: Seit 2019 stiegen die Preise für den
Warenkorb von Paaren mit Kindern und niedrigen Einkommen um 20,8
Prozent, bei Paaren mit Kindern und mittleren Einkommen um 20,4
Prozent.
Die niedrigste längerfristige Teuerungsrate hatten
mit kumuliert 18,3 Prozent erneut Alleinlebende mit sehr hohen
Einkommen (siehe auch die Tabelle in der pdf-Version). Erschwerend
kommt hinzu, dass Haushalte mit niedrigeren Einkommen wenig
finanzielle Polster besitzen und sich die Güter des Grundbedarfs,
die sie vor allem nachfragen, kaum ersetzen oder einsparen lassen.
Aktuell verteuern sich die spezifischen Warenkörbe von ärmeren
Familien weniger stark als der Durchschnitt, weil sie wegen der
Kinder häufiger ein Auto haben, weshalb sich bei ihnen nicht nur die
gesunkenen Preise für Haushaltsenergie, sondern auch für Kraftstoffe
spürbar auswirken. Alleinlebende mit niedrigen Einkommen besitzen
dagegen selten ein Fahrzeug. Daher lag ihre Inflationsrate im
Dezember 2024 mit 2,2 Prozent etwas höher und auf dem gleichen
Niveau wie bei Alleinlebenden mit mittleren Einkommen.

Den gleichen Wert weisen Paarfamilien sowie Alleinerziehende mit
jeweils mittleren Einkommen aus. Dass wiederum Alleinlebende mit
sehr hohen Einkommen mit 2,6 Prozent im Dezember – wie auch in den
Monaten zuvor – eine höhere Inflationsrate hatten als die übrigen
Haushalte im Vergleich, liegt daran, dass sie stärker als andere
etwa Versicherungen, Reisen oder soziale Dienstleistungen
nachfragen, die in den vergangenen Monaten eine
überdurchschnittliche Teuerungsrate aufwiesen.
Das gilt,
leicht abgeschwächt, auch für Paare mit Kindern und hohen Einkommen
(2,4 Prozent) sowie für Paare ohne Kinder mit mittleren Einkommen
und für Alleinlebende mit höheren Einkommen, deren Warenkörbe sich
um jeweils 2,3 Prozent verteuerten (Abbildung 1).
VHS Duisburg: Goldschmieden lernen
Die
Volkshochschule Duisburg bietet ab dem 7. Februar einen zehnwöchigen
Kurs an, um das Goldschmieden zu erlernen. Der Kurs findet jeweils
freitags von 17.30 bis 21.15 Uhr in der VHS-FABRIK an der Steinschen
Gasse in der Stadtmitte statt und ist sowohl für Neulinge als auch
für fortgeschrittene Anfängerinnen und Anfänger geeignet. Die
Teilnehmenden haben die Möglichkeit, Schmuck oder andere Werkstücke
nach eigenen Vorstellungen herzustellen.
Sie lernen
unter Anleitung einer erfahrenen Goldschmiedemeisterin sowohl die
Werkzeuge kennen als auch die einzelnen Schritte bis zur Herstellung
des fertigen Schmuckstücks. Überwiegend wird im Kurs mit Silber
gearbeitet, das im Kurs erworben werden kann und nach Verbrauch
berechnet wird. Für einen Ring fallen beispielsweise etwa zehn Euro
an Materialkosten an.
Die Teilnahmegebühr beträgt 146
Euro. Eine Anmeldung wird erbeten online über die Homepage der VHS
unter www.vhs-duisburg.de (Kursnummer 251SR2868) oder per E-Mail an
h.pieper@stadt-duisburg.de. Weitere Informationen gibt es
telefonisch unter (0203) 283 2775.
7. Fachtag
Kinderschutz am 22. Januar 2025 - inklusive der Verleihung des
Gerd-Unterberg-Preises
der bekannte Leitsatz „Handeln,
bevor es zu spät ist!“ prägt den Alltag aller Menschen, die
beruflich und ehrenamtlich mit der Gefährdung von Kindeswohl
konfrontiert sind. Ob Kinder- und Jugendhilfe, Polizei,
Krankenhäuser, Schulen oder Justiz – sie alle leisten dabei wichtige
Beiträge zum Kinderschutz und arbeiten an vielen Stellen Hand in
Hand. Und leider ist der Bedarf für dieses Thema weiterhin groß;
umso wichtiger daher der regelmäßige Austausch unter den
Beteiligten.
Um diesen zu ermöglichen und dem Leitsatz
zu folgen, lädt der Verein RISKID e.V. – unter dem Vorsitz des
ehemaligen Chefarztes und heutigen Senior Consultant der Helios
Kinderklinik in Hamborn Dr. Peter Seiffert und dem niedergelassenen
Kinder- und Jugendarzt Dr. Ralf Kownatzki – am kommenden Mittwoch,
22. Januar 2025, zum bereits 7. Fachtag Kinderschutz ins
Abteizentrum Hamborn (An der Abtei 1, 47166 Duisburg) ein.
Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr, für Sie als
Pressevertreter:innen besteht aber die Möglichkeit, bereits ab 13
Uhr mit einem Teil der Referent:innen und Organisator:innen zu
sprechen. Bitte geben Sie uns zur besseren Planbarkeit kurz
Bescheid, ob Sie diesen Vorab-Termin wahrnehmen möchten.
Eröffnet wird der Fachtag unter anderem mit Grußworten der vor Ort
anwesenden Bundestagspräsidentin Bärbel Bas sowie von MdL NRW
Christina Schulze Föcking. In den anschließenden Vorträgen
beleuchten weitere exzellente Referenten wie Duisburgs
Polizeipräsident Alexander Dierselhuis aus unterschiedlichsten
Blickwinkeln die Herausforderungen im Kinderschutz.
Teil
des Programms ist ebenfalls wieder die Verleihung des
Gerd-Unterberg-Preises, benannt nach dem inzwischen verstorbenen
Leitenden Duisburger Staatsanwalt, der sich beruflich und darüber
hinaus stets für den Schutz und das Wohl von Kindern eingesetzt hat.
Der diesjährige Preisträger ist der renommierte Kinderschutz-Experte
Dr. med. Michael Hipp.
Er ist unter anderem Facharzt für
Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie sowie ehemaliger Leiter
des Sozialpsychiatrischen Dienstes Hilden und Mitbegründer des
Förderkreises KIPKEL e.V. (Prävention für Kinder psychisch kranker
Eltern im Kreis Mettmann). Die Laudatio hält die Beigeordnete der
Stadt Wuppertal, Annette Berg.
Stadtbibliothek und VHS laden ein zum „Tag der
Handschrift“
Stadtbibliothek und VHS Duisburg laden am
Donnerstag, 23. Januar, in der Zeit von 16 bis 18 Uhr in das
Stadtfenster, Steinsche Gasse 26 in der Duisburger Innenstadt, zum
„Tag der Handschrift“ ein. An verschiedenen Stationen kann
Handschrift erlebt und erprobt werden. Im Eingangsbereich wartet ein
Medienschrank zum Thema Handschrift auf Interessierte.

Die Stadtbibliothek führt ihre Sammlung von historischen Büchern
beim Tag der Handschrift am 23.01.2024 in der VHS. Foto: Tanja
Pickartz / Stadt Duisburg
Auf dem Weg zum Vortragssaal der
VHS trifft man dann auf Texttafeln mit einer essayistischen
Auseinandersetzung mit dem Thema. Vor dem Saal gibt es geballte
Schreibgeräteexpertise: Hier gibt es unter anderem Antworten auf die
Frage, ob Goldfedern besser für die Handschrift sind. Und man kann
sich auf einen graphomotorischen Test einlassen. Der VHS-Saal selbst
steht ganz im Zeichen der Kalligrafie.
Udo Schwidder
beschriftet kalligrafisch individuelle Lesezeichen und lädt zu
ersten kalligrafischen Gehversuchen ein. Gleiches bietet auch Hanshi
Zhao vom Konfuzius-Institut Metropole Ruhr an, allerdings in
chinesischer Kalligrafie. Einen Tisch weiter erläutert Mahmoud
Kandil die wesentlichen Merkmale arabischer Kalligrafie. Im ersten
Obergeschoss des Stadtfensters gibt es zwei Aktionsbereiche. Im Café
ist ein Stand dem Goldenen Buch der Stadt gewidmet.
Aus
nächster Nähe kann man die künstlerisch gestalteten Seiten zu den
unterschiedlichsten feierlichen Anlässen betrachten. Dort wird auch
die handgeschriebene Luther-Bibel in 18 Bänden aus dem
Reformationsjubiläumsjahr 2017 präsentiert. An dem Werk haben
unzählige Menschen aus Duisburg und Umgebung gearbeitet.

Auch für Kinder gibt es Angebote beim Tag der Handschrift am
23.01.2024 in der VHS. Foto: Tanja Pickartz / Stadt Duisburg
In der Kinder- und Jugendbibliothek in der ersten Etage wird wieder
ein Programm für die jüngsten Besucher angeboten. Dort gibt es eine
Schreibund Malwerkstatt für Kinder und das gemeinsame Betrachten und
Lesen des Bilderbuchs „Post für dich“. In der dritten Etage der
Stadtbibliothek finden um 16 und 17 Uhr Führungen durch die Sammlung
„Historische und Schöne Bücher“ statt. Wegen der begrenzten
Gruppengröße wird für diese Führungen um vorherige OnlineAnmeldung
unter https://stadtbibliothek-duisburg.easy2book.de/ gebeten.
Stadtarchivar Dr. Andreas Pilger stellt historische
Handschriften vor und hilft beim Entziffern alter handgeschriebener
Dokumente. In einer Lernkabine in der dritten Etage kann man an
einem HandletteringWorkshop unter Leitung von Eleonora Reimer
teilnehmen und beispielsweise individuelle Glückwunschkarten
gestalten und mitnehmen. In einer weiteren Arbeitskabine steht die
Handschrift als Politikum und als VHS-Online-Kurs im Zentrum.
Kinderprinzencrew zu Gast beim Turmcafé
Leckeres vom Kuchenbuffet, Tanz und Gesang in der Neumühler
Gnadenkirche
Am Sonntag, 2. Februar öffnet das beliebte
Neumühler Turmcafé diesmal schon um 14.30 Uhr in der evangelischen
Gnadenkirche an der Obermarxloher Straße 40 bis 17 Uhr seine Türen,
diesmal mit närrisch-fröhlichen Überraschungsbesuchern. Zu Kaffee
und Tee gibt es wieder leckere, zum größten Teil selbst gebackene
Kuchen.
Das Turmcafé geht auf eine Initiative von
Gemeindegliedern zurück und wird immer von unterschiedlichen Gruppen
der Gemeinde durchgeführt. Gastgeber ist diesmal das Presbyterium
der Evangelischen Kirchengemeinde Neumühl, das für die Gäste sowohl
leckere als auch fröhliche Überraschungen bereithält. Dazu gehört
auch traditionell der Besuch der aktuellen Duisburger
Kinderprinzencrew, die den Gästen des „Närrischen Turmcafés“ einen
lustig-unterhaltsamen sowie musikalisch-tänzerischen Besuch
abstattet.
Die vier jungen „Fröhlichmacher“ um
Kinderprinz Phil II., Prinzessin Mia I., Hofmarschall Yanick und
Pagin Lea haben mit ihren Auftritten und Darbietungen schon mächtig
für Furore und Begeisterung gesorgt und werden das Neumühler
Kirchenschiff in einen „Dampfer“ fröhlicher Menschen verwandeln. Vor
ihrem Auftritt steht für die Besucher zunächst einmal der Sturm auf
das schon fast legendär-leckere Kuchenbuffet an.
Der
Verkaufserlös des immer am ersten Sonntag eines Monats
stattfindenden Turmcafés kommt stets der Instandhaltung der über 110
Jahre alten Neumühler Gnadenkirche zugute. Kuchenspenden sind gern
gesehen und können im Alten Pfarrhaus, Obermarxloher Straße 40, Tel.
0203 / 580448, abgegeben werden. Reiner Terhorst

Die Duisburger Stadt-Kindeprinzencrew 2023 bei der Ausgabe 2023 des
närrischen Turmcafés in der Gnadenkirche Neumühl, Foto: Bartosz
Galus.
Kostenfreie Sonntags-Suppenküche der
Gemeinde Ruhrort-Beeck bleibt in der Verlängerung
Das
Angebot einer kostenfreien sonntäglichen Suppe nach dem Gottesdienst
gibt es in der Evangelischen Kirchengemeinde Ruhrort-Beeck schon
seit zwei Jahren. Die Suppenküche am Ostackerweg 75 öffnet aber
weiterhin jeden Sonntag um 12 Uhr. Das Angebot ist und bleibt
kostenlos und wird aus Kirchensteuern finanziert. Ein Ausweis zur
Bedürftigkeit ist für den Besuch der Suppenküche nicht nötig.
In der Gemeinde gibt es gute Gründe für die Verlängerung:
Das Angebot habe sich inzwischen etabliert, es gebe einen festen
Stamm von Gästen, die sonntags das Angebot nutzen, und „man merkt,
dass den Leuten die Gemeinschaft und der Austausch untereinander
wichtig ist“ betont Presbyteriumsmitglied Oliver Teichert. Infos zur
Gemeinde unter
www.ruhrort-beeck.de.

Maik Züllinger,
Hausmeister in der Evangelischen Kirchengemeinde Ruhrort-Beeck, beim
Einschenken einer Suppenportion (Foto: Lukas Eggen).
Wedauer Frauenfrühstück mit guten Gesprächen... zum Thema
„Neubeginn“ Bei einem leckeren Frühstück zu Themen
diskutieren, die alle angehen. Das ist das Rezept der Treffen im
Duisburger Süden. Es funktioniert gut, weiß das Team um Elke Jäger,
der ehemaligen Leiterin des evangelischen Jugendzentrums Arlberger,
durch die Erfahrungen früherer Treffen. Das nächste ökumenische
Frauenfrühstück gibt es am 1. Februar 2025 um 10 Uhr im Wedauer
Gemeindehaus, Am See 6, wo sich alles um das Thema „Neubeginn“
dreht.
Karten zu zehn Euro gibt es bei Elke Jäger (Tel.:
0203 / 70 77 71) und Uta Fischer (Tel.: 0203 / 70 78 96). Die beiden
und das gesamte ökumenische Vorbereitungsteam laden Frauen aus dem
Duisburger Süden herzlich ein und freuen sich über eine rege
Teilnahme.

Öffentliche Bildungsausgaben 2023 um 4,3 % (vorher: 4,4
%) gestiegen
184 Milliarden Euro für Bildung aus
öffentlicher Hand Pro-Kopf-Ausgaben bei 2 200 Euro Knapp die Hälfte
der Ausgaben entfiel auf die Schulen
Die Bildungsausgaben
von Bund, Ländern und Gemeinden sind im Jahr 2023 auf
gut 184 Milliarden Euro gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) weiter mitteilt, waren das nominal (nicht
preisbereinigt) 4,3 % oder 8 Milliarden Euro mehr als im Jahr 2022.
Umgerechnet auf die Gesamtbevölkerung gaben die öffentlichen
Haushalte damit im Jahr 2023 insgesamt 2 200 Euro je Einwohnerin und
Einwohner für Bildung aus (2022: 2 100 Euro), bezogen auf die
Einwohnerinnen und Einwohner unter 30 Jahren waren es 7 200 Euro
(2022: 7 000 Euro).
Der Anteil der öffentlichen
Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag allerdings 2023
mit 4,5 % unter dem Niveau des Vorjahres (2022: 4,6 %). Knapp die
Hälfte der Ausgaben floss in die Schulen Für die Schulen wurde 2023
mit 90 Milliarden Euro knapp die Hälfte (49 %) der öffentlichen
Bildungsausgaben verwendet. 44 Milliarden Euro beziehungsweise 24 %
entfielen auf die Kindertagesbetreuung und 36 Milliarden Euro (20 %)
auf die Hochschulen.
Die restlichen 15 Milliarden Euro
(8 %) wurden für die Förderung von Bildungsteilnehmerinnen und
-teilnehmern (9 Milliarden Euro bzw. 5 %), für Jugend- und
Jugendverbandsarbeit (3 Milliarden Euro beziehungsweise 2 %) und für
das Sonstige Bildungswesen (3 Milliarden Euro beziehungsweise 1 %)
ausgegeben. Rückgang der Bildungsausgaben auf Bundesebene Die
Bildungsausgaben des Bundes lagen im Jahr 2023 mit 12 Milliarden
Euro um 0,9 Milliarden Euro oder 7 % unter dem Vorjahreswert.
Dies ist insbesondere auf niedrigere Zuweisungen an das
Sondervermögen für den Digitalpakt Schule im Berichtsjahr 2023
zurückzuführen. Durch unregelmäßige Zuführungen an Sondervermögen
kann es im Zeitverlauf zu Ausgabenschwankungen kommen. Von den
Bundesmitteln wurden jeweils gut 5 Milliarden Euro für Hochschulen
(44 %) und für die Förderung von Bildungsteilnehmerinnen und
Bildungsteilnehmern (45 %) verwendet.
Für das Sonstige
Bildungswesen wurden 0,6 Milliarden Euro (5 %) ausgegeben, für die
Jugend- und Jugendverbandsarbeit 0,5 Milliarden Euro (4 %) und für
die Schulen 0,3 Milliarden Euro (2 %). Für die Kindertagesbetreuung
fielen beim Bund keine nennenswerten Ausgaben an. Länder und
Gemeinden verzeichnen Mehrausgaben Die Länder gaben insgesamt
126 Milliarden Euro aus und stellten damit gut zwei Drittel (68 %)
der öffentlichen Bildungsausgaben im Jahr 2023.
Im
Vergleich zu 2022 stiegen die Ausgaben der Länder um 4 Milliarden
Euro oder 3 %. Von den Landesmitteln wurden 70 Milliarden Euro
(55 %) für den Schulbereich, 31 Milliarden Euro (25 %) für die
Hochschulen und 21 Milliarden Euro (17 %) für die
Kindertagesbetreuung aufgewendet. Die restlichen 4 Milliarden Euro
(3 %) entfielen auf die Förderung von Bildungsteilnehmerinnen und
Bildungsteilnehmern, das Sonstige Bildungswesen und die Jugend- und
Jugendverbandsarbeit.
Auf Gemeindeebene lässt sich ein
Anstieg der Ausgaben um 4 Milliarden Euro (+11 % auf insgesamt 47
Milliarden Euro beobachten. Die Gemeinden verwendeten mit 23
Milliarden Euro (48 %) knapp die Hälfte ihrer Gesamtausgaben im
Bildungsbereich für die Kindertagesbetreuung, weitere 20 Milliarden
Euro (42 %) wurden im Schulbereich ausgegeben.
Jeweils 2
Milliarden Euro wurden für die Förderung von Bildungsteilnehmerinnen
und Bildungsteilnehmern (5 %) und die Jugend- und
Jugendverbandsarbeit (4 %) aufgebracht. Auf den Bereich Sonstiges
Bildungswesen entfielen bei den Gemeinden kaum Ausgaben (0,5
Milliarden Euro beziehungsweise 1 %), auf den Bereich Hochschulen
gar keine.
12 % der allgemeinbildenden Schulen sind Privatschulen
Die Zahl der Privatschulen in Deutschland nimmt zu: Im
Schuljahr 2023/24 waren rund 3 800 allgemeinbildende Schulen
hierzulande in privater Trägerschaft. Das war knapp jede achte
allgemeinbildende Schule (12 %), wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) anlässlich des Internationalen Tages der Bildung am 24.
Januar mitteilt.
Zugleich gab es knapp 29 000 öffentliche
allgemeinbildende Schulen. Die Zahl der Privatschulen ist in den
vergangenen zehn Jahren um 8 % gestiegen: Im Schuljahr 2013/2014
hatte es gut 3 500 Privatschulen gegeben. Im selben Zeitraum ging
die Zahl der öffentlichen Schulen um 4 % zurück (2013/14: 30 300
Schulen).
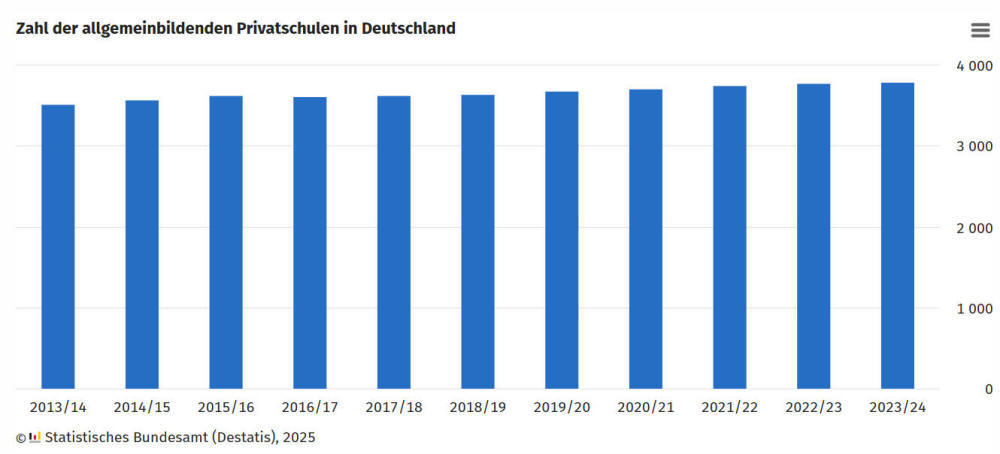
Der Anteil der Privatschülerinnen
und -schüler blieb im Zehn-Jahres-Vergleich jedoch weitgehend
konstant: Im Schuljahr 2023/24 ging wie in den Jahren zuvor seit
2013/14 knapp ein Zehntel (9 %) der Kinder und Jugendlichen, welche
allgemeinbildende Schulen besuchten, auf Privatschulen. Insgesamt
waren das 2023/24 rund 801 100 von insgesamt knapp
8,8 Millionen Schülerinnen und Schülern.
Im Schuljahr
2013/14 hatten 730 400 der insgesamt 8,4 Millionen Schülerinnen und
Schüler eine Privatschule besucht. Diese Konstanz ist unter anderem
darauf zurückzuführen, dass die Privatschulen durchschnittlich
kleiner als die öffentlichen sind und die Schließungen von
öffentlichen Schulen durch Vergrößerungen der verbliebenen
öffentlichen Einrichtungen ausgeglichen wurden.
Eltern
bezahlten im Schnitt 2 032 Euro pro Jahr für einen Privatschulplatz
Für einen Platz an einer Privatschule muss häufig Schulgeld gezahlt
werden. Für rund 595 000 Kinder und Jugendliche wurde in der Lohn-
und Einkommensteuer 2020 Schulgeld geltend gemacht. 2 032 Euro im
Jahr zahlten deren Eltern im Durchschnitt für einen
kostenpflichtigen Privatschulplatz.
Für knapp 7 %
kostete der Platz mindestens 5 000 Euro im Jahr, knapp ein Viertel
(23 %) machte zwischen 2 000 und 5 000 Euro steuerlich geltend,
knapp die Hälfte (48 %) zwischen 500 und 2 000 Euro und für 22 %
beliefen sich die Gebühren auf weniger als 500 Euro im Jahr.
Deutliche Unterschiede zeigen sich auf
regionaler Ebene: Am höchsten war das durchschnittlich
steuerlich geltend gemachte Schulgeld in Hessen mit 3 230 Euro je
Kind, am niedrigsten in Sachsen mit 1 239 Euro.
Zahl der Kita-Kinder mit Betreuungszeit von mehr als 35
Wochenstunden von 2014 bis 2024 um 30 % gestiegen
•
Zahl der Kinder mit Betreuungszeit von bis zu 25 Stunden pro Woche
im selben Zeitraum um 8 % zurückgegangen
• Pädagogisches
Kita-Personal binnen zehn Jahren um 46 % zugenommen, 67 % arbeiten
nicht in Vollzeit
• Top-3-Erziehungsberufe: Zahl der
Absolvent/-innen auf neuem Höchststand
Lange
Betreuungszeiten werden in den Kindertageseinrichtungen hierzulande
immer häufiger. Die Zahl der Kinder mit einer vertraglich
vereinbarten Betreuungszeit von mehr als 35 Stunden in der Woche hat
von 2014 bis 2024 um 30 % zugenommen, wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) mitteilt.
Knapp zwei Drittel (64 %) dieser
Kinder hatten zuletzt eine festgelegte Betreuungszeit von mehr als
45 Wochenstunden. Ebenfalls gestiegen ist in den vergangenen zehn
Jahren die Zahl der Kinder mit einer Betreuungszeit von 25 bis 35
Wochenstunden (+25 %).
Einen Rückgang gab es hingegen
bei Kindern mit einer kürzeren Betreuungszeit von bis zu 25 Stunden
in der Woche: Deren Zahl nahm von 2014 bis 2024 um 8 % ab. Die
durchschnittlich vereinbarte Betreuungszeit stieg damit in den
vergangenen zehn Jahren von 35,3 auf 36,1 Stunden pro Woche. Im
selben Zeitraum ist die Zahl der betreuten Kinder insgesamt um ein
Fünftel (20 %) gestiegen – von 3,29 Millionen auf 3,94 Millionen.
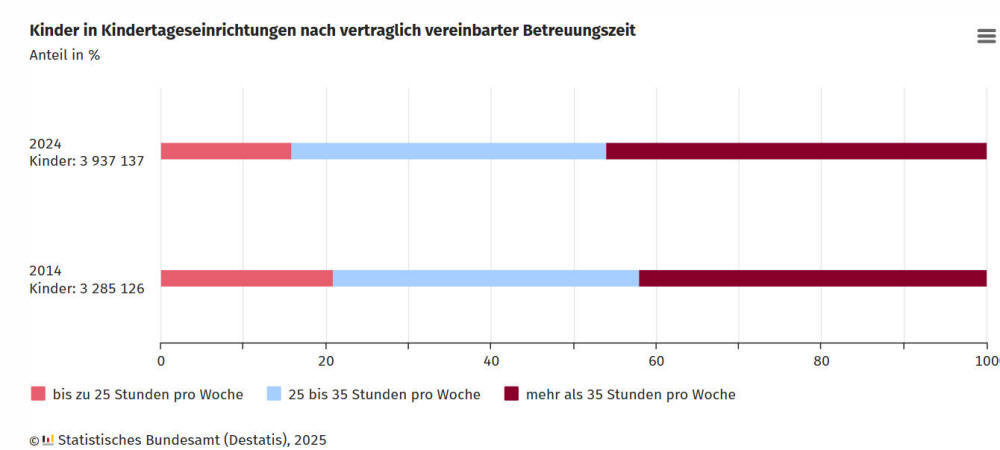
46 % mehr pädagogisches Personal als zehn Jahre zuvor
Um
lange Betreuungszeiten gewährleisten zu können, wird ausreichend
Personal benötigt. Die Zahl der pädagogisch tätigen Personen in
Kindertageseinrichtungen ist in den vergangenen zehn Jahren um 46 %
gestiegen. Rund 724 100 Betreuungskräfte arbeiteten 2024 in
Kindertageseinrichtungen, im Jahr 2014 waren es noch gut 494 300
Personen.
67 % des pädagogischen Kita-Personals arbeiten in
Teilzeit
Obwohl die Zahl der pädagogischen Betreuungskräfte
binnen zehn Jahren stark gestiegen ist, gilt die Personalsituation
in vielen Einrichtungen als angespannt. Ein Grund für die personelle
Notlage vieler Kitas dürfte darin liegen, dass der Anteil der
Kita-Betreuungskräfte in Vollzeit vergleichsweise gering ist: 67 %
des pädagogischen Kita-Personals im Jahr 2024 arbeiteten weniger als
38,5 Stunden pro Woche (2014: 65 %).
Zur Einordnung: Nach
Ergebnissen des Mikrozensus für das Jahr 2023 arbeiteten 31 % aller
abhängig Erwerbstätigen nicht in Vollzeit. Für das Jahr 2024 liegen
noch keine Daten vor.
55 600 Menschen 2023 mit
Ausbildungsabschluss in Top-3-Erziehungsberufen
Für die
pädagogische Arbeit in der Kindertagesbetreuung qualifiziert unter
anderem eine schulische Ausbildung in einem der drei häufigsten
Erziehungsberufe. Im Jahr 2023 schlossen rund 55 600 Menschen eine
solche Ausbildung als Erzieher/in, Sozialassistent/in oder
sozialpädagogische/r Assistent/in beziehungsweise als
Kinderpfleger/in ab. Das war ein neuer Höchststand, obwohl für
Schleswig-Holstein die entsprechende Zahl nicht vorlag.
Knapp die Hälfte (44 %) der Absolvierenden, die einen beruflichen
Abschluss an Berufsfachschulen, Fachschulen oder Fachakademien
erlangten, erwarb diesen in einem der Top-3-Erziehungsberufe. Im
Jahr 2013 hatten bundesweit noch 44 100 Absolventinnen und
Absolventen eine Ausbildung in einem dieser Erziehungsberufe
abgeschlossen. Dabei bildet ein Ausbildungsabschluss als
Sozialassistent/in in der Regel die Basis für eine Laufbahn in
Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens, in einigen
Bundesländern ist der Abschluss Voraussetzung für die weiterführende
Ausbildung als Erzieher/in sowie als Heilerziehungspfleger/in.
Erzieher/in unter Top 10 der Berufe mit den meisten
Anerkennungsverfahren ausländischer Abschlüsse
Für die
Kinderbetreuung wird auch auf Fachkräfte aus dem Ausland gesetzt. 2
778 Verfahren zur Anerkennung eines ausländischen Berufsabschlusses
als Erzieher/in gab es im Jahr 2023. Davon wurden 1 743 positiv, 624
negativ und 222 noch nicht beschieden. 186 Verfahren wurden ohne
Bescheid beendet. Besonders häufig ging es um die Anerkennung von
Abschlüssen aus Spanien (324), der Ukraine (237) und der Türkei
(231).
Insgesamt zählt der Abschluss als Erzieher/in zu den
Top 10 in der Rangliste der Berufe mit den meisten
Anerkennungsverfahren ausländischer Abschlüsse. Die Verfahren zur
Anerkennung eines ausländischen Berufsabschlusses als Erzieher/in
machten knapp 3 % aller Anerkennungsverfahren aus.