






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 5. Kalenderwoche:
27. Januar
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Dienstag, 28. Januar 2025
Neudorf: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft
Duisburg und der Polizei Duisburg: Tötungsdelikt - Mordkommission
ermittelt
Ein 41-jähriger Duisburger ist am
Sonntagabend (26. Januar, gegen 20:10 Uhr) auf der Grabenstraße
lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann erlag kurze Zeit später
seinen Verletzungen im Krankenhaus. Ausweislich der bisherigen
Ermittlungen konnten Schussverletzungen an ihm festgestellt werden.
Da die Staatsanwaltschaft Duisburg die Tat als
Tötungsdelikt wertet, wurde bei der Polizei Duisburg eine
Mordkommission eingerichtet. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die
Angaben zu der Tat, möglichen Verdächtigen oder auch einem
vermeintlichen Fluchtauto machen können. Insbesondere suchen die
Ermittler einen Mann und eine Frau, die Erste Hilfe geleistet haben.
Sie und weitere Zeugen werden dringend gebeten, sich an das
Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 zu wenden.
Brandstiftungen – Polizei ermittelt Tatverdächtige
In den vergangenen Wochen kam es im Stadtgebiet
wiederholt zu Bränden, bei denen Brandstiftung als Ursache
festgestellt wurde. Die Polizei hat nun vier Tatverdächtige
ermittelt, die Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr sind.
Ob sich der Verdacht gegen die vier Personen bestätigt, ist
derzeit Gegenstand der Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und
Kriminalpolizei. Die Stadt Duisburg unterstützt diese Ermittlungen
vollumfänglich. Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund des
schwebenden Verfahrens keine weiterführenden Fragen beantworten
können.
Letzte Klageverfahren in Sachen
CO-Pipeline ebenfalls erfolglos
Die letzten beiden noch
anhängigen, von der Stadt Hilden betriebenen Klageverfahren gegen
den Planfeststellungsbeschluss der Bezirksregierung Düsseldorf, mit
dem diese die Errichtung und den Betrieb einer
Rohrfernleitungsanlage zum Transport von gasförmigem Kohlenmonoxid
(CO) von Köln-Worringen nach Krefeld-Uerdingen zugelassen hatte,
sind durch Beschlüsse des Oberverwaltungsgerichts vom 24.01.2025 nun
rechtskräftig abgeschlossen.
Damit sind sämtliche
Verfahren in Sachen CO-Pipeline erfolglos geblieben. Die CO-Pipeline
soll die linksrheinisch gelegenen Chemieparks der früheren Bayer
Material Science AG, nunmehr Covestro Deutschland AG, in
Krefeld-Uerdingen und Dormagen verbinden, ist etwa 67 km lang und
verläuft überwiegend rechtsrheinisch. Die Errichtung und den Betrieb
dieser Pipeline hatte die Bezirksregierung Düsseldorf mit
Planfeststellungsbeschluss vom 14.02. 2007, der in der Folgezeit
mehrfach geändert wurde, zugelassen.
Das
Oberverwaltungsgericht hatte durch Urteil vom 31.08. 2020 in einem
Leitverfahren, das durch vier Privatkläger geführt worden war, die
Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss einschließlich der bis
dahin erteilten Änderungsgenehmigungen abgewiesen.
Dieses Urteil ist seit dem 14.12. 2021 rechtskräftig, nachdem das
Bundesverwaltungsgericht die dagegen eingelegten Beschwerden gegen
die Nichtzulassung der Revision zurückgewiesen hatte. Die Stadt
Hilden hatte in den jetzt entschiedenen Verfahren gegen zwei
Planänderungsbeschlüsse vom 02.03.2009 und vom 18.08.2009 geklagt,
die auch schon Gegenstand des vom Oberverwaltungsgerichts
entschiedenen Verfahrens waren.
Das Verwaltungsgericht
Düsseldorf hat mit Urteilen vom 13.06.2023 die Klagen der Stadt
Hilden gegen die Planänderungsbeschlüsse abgewiesen und sich zur
Begründung auf die genannte rechtskräftige Entscheidung des
Oberverwaltungsgerichts bezogen, in der sämtliche in diesem
Verfahren in Rede stehenden rechtlichen und tatsächlichen Fragen
bereits abschließend entschieden worden seien. Die hiergegen
eingelegten Rechtsmittel der Stadt Hilden hatten keinen Erfolg.
Das Oberverwaltungsgericht hat mit den Beteiligten heute
bekanntgegebenen Beschlüssen vom 24.01.2025 die Anträge der Stadt
Hilden auf Zulassung der Berufung gegen die Urteile des
Verwaltungsgerichts Düsseldorf abgelehnt. Damit sind sämtliche
Verfahren in Sachen der CO-Pipeline erfolglos geblieben und nunmehr
rechtskräftig abgeschlossen.
Aktenzeichen: 20 A 1371/23 und 20 A
1372/23 (I. Instanz: VG Düsseldorf 3 K 5632/09 und 3 K 6200/09)
Kreiswahlleiter und Stadtdirektor Martin Murrack hat
gemeinsam mit dem Wahlteam den aktuellen Stand der Vorbereitungen
zur Bundestagswahl am 23. Februar 2025 vorgestellt.
„Knapp einen Monat vor dem Wahltermin sind wir gut vorbereitet. Das
Team um den Stabsstellenleiter Andreas Weinand arbeitet mit
Hochdruck an der Umsetzung sämtlicher organisatorischer Maßnahmen,
um eine reibungslose Wahl zu gewährleisten“, so Murrack.

Dezernent Martin Murrack und Andreas Weinand; Leiter Stabstelle
Wahlen mit Briefwahltonnen. Foto: Tanja Pickartz / Stadt Duisburg
Am 23. Februar werden in Duisburg die Abgeordneten der beiden
Bundestagswahlkreise 114 Duisburg I und 115 Duisburg II gewählt. Die
Stadt ist in insgesamt 323 Wahlbezirke unterteilt, die auf diese
beiden Wahlkreise aufgeteilt sind.
Wahlkreis 114
Duisburg I: Hierzu gehören die Stadtbezirke Rheinhausen,
Süd sowie Teile des Stadtbezirks Mitte (Altstadt, Neuenkamp,
Kaßlerfeld, Neudorf-Nord, Neudorf-Süd, Dellviertel, Hochfeld,
Wanheimerort).
Wahlkreis 115 Duisburg II:
Dieser umfasst die Stadtbezirke Walsum, Hamborn, Meiderich/Beeck,
Homberg/Ruhrort/Baerl sowie den Stadtteil Duissern aus dem
Stadtbezirk Mitte.
Wahlbenachrichtigungen ab 5. KW
Die
Wahlbenachrichtigungen werden an rund 313.000 Wahlberechtigte
Duisburgerinnen und Duisburger im Laufe der 5. Kalenderwoche
zugestellt, dann kann auch sofort Briefwahl beantragt werden. Zur
Vereinfachung ist dies wieder mit dem auf der Wahlbenachrichtigung
befindlichen QR-Code möglich. Ebenso kann unter Eingabe der
persönlichen Daten online auf „briefwahl.duisburg.de“ die Briefwahl
beantragt werden.
•
Erstmals wird die Zahl der Briefwahlbezirke von 105 auf 125 erhöht,
um dem voraussichtlich steigenden Briefwahlaufkommen gerecht zu
werden. Das Wahlamt hat auch seine Kapazitäten in den Bereichen
Druck und Kuvertierung erweitert, um die logistischen
Herausforderungen zu meistern und alle Briefwahlanträge rechtzeitig
abarbeiten zu können.
•
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesucht
Für die Durchführung der
Wahl werden insgesamt rund 4.500 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer
benötigt. „Die Zahl der Rückmeldungen ist bisher erfreulich, dennoch
benötigen wir weiterhin freiwillige Helferinnen und Helfer. Jede
Zusage hilft uns weiter, die immensen Herausforderungen dieser
vorgezogenen Wahl zu meistern“, betonte Weinand.
Wahlhelfende erhalten in Duisburg ein Erfrischungsgeld, das
deutlich höher ausfällt als die Bundespauschalen. Durch
zahlreiche Präsenzschulungen sowie OnlineSeminare werden sie auf
ihre Aufgaben vorbereitet.
Mehr...
Vor 15 Jahren in der BZ: Lärmsanierung in Neudorf ausgeweitet -
Bürgerverein Neudorf erhielt vom Bundestag und dem
Bundesverkehrsministerium konkrete Angaben zur Lärmsanierung
Zur ersten Veröffentlichung im Juli 2009 zur Umsetzung ist es jetzt
nach Intervenierung beim Eisenbahnbundesamt und DBProjektbau
Gutachterteam gelungen, weitere 335 Meter Lärmschutzwand zu erhalten
- zuvor 1,565 Kilometer, nun 1,9 Kilometer Gesamtlänge.
Nach
Abschluss der Aufnahme aller Güterstrecken im Juni 2005 war es dem
Bürgerverein doch noch gelungen, eine ganze Strecke zusätzlich auf
die eigentlich schon abgeschlossene Lärmsanierungsliste zu bekommen.
Im September 2003 wurde nach Protesten des Bürgervereins an den
damaligen Bundeskanzler und Verkehrsminister Stolpe nach Ablehnung
die Neudorfer "Rennstrecke" mit bis 2009 240 Zügen tägliche auf der
2321 längs der Lothar- , Waldhorn und Steinbruchstraße doch auf die
Lärmsanierungsliste gesetzt.
Allerdings gibt es noch zwei Punkte,
die zur parlamentarischen Prüfung durch den
Bundestags-Petitionsausschuss anstehen sollten.
Punkt 1:
Erschütterungen und bedrohlicher Güterzugbetrieb
Forderung:
Langsamfahrstrecke auf der Stecke 2321 im Bereich Duisburg-Neudorf
Es geht um permanent auftretende Schäden an Gebäuden (Dachziegel
lösen sich und fallen auf die Straße, regelmäßige Kosten für
Dachdecker ca. 1500 Euro alle zwei bis drei Jahre um Sicherheit zu
gewähren), Risse im Mauerwerk, Vitrinen und Duschkabinen
zersplittern durch schwerste Erschütterungen und speziell im
Kreuzungsbereich an der Strecke 2321 in dem Bereich Duisburg-Neudorf
Höhe Einmündung Steinbruchstraße Duisburg-Wedau durch oftmalige
Vollbremsungen.
Leben, Gesundheit und Gebäude sind gefährdet und
der Verursacher verschanzt sich hinter Planfestellung und Paragraph
75 Abs 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes.
Punkt 2
Unfallvorsorge
Grund: Der Unfall mit Güterzug-Achsbruch in der
Nacht zum Dienstag, den 30. Juni 2009, als im toskanischen
Urlaubsort Viareggio Flüssiggas-Güterwagen explodierten und die
Feuersbrunst reichlich Tote sowie immensen Sachschaden forderte.
Auch deshalb hat und wird es in Deutschland Mahnfeuer gegen den
Bahnlärm, Erschütterungen und Gefahr durch Unfälle mit Güterzügen
geben.
525 Euro Armutsnachteil: Neue
Studie untersucht Chancengleichheit am Finanzmarkt

Vermögensarme Menschen in Deutschland sind am Finanzmarkt häufig
strukturell benachteiligt. Das ist das zentrale Ergebnis einer von
der Hans-Böckler-Stiftung geförderten neuen Studie von Finanzwende
Recherche.* Wie groß die Benachteiligung ist, zeigt ein für die
Studie neu entwickelter Indikator: der Armutsnachteil. Er beziffert,
wie viel Geld den rund 35 Millionen Erwachsenen, die zur unteren
Vermögenshälfte in Deutschland gehören, pro Jahr im Vergleich zu
Wohlhabenderen entgeht.
Im Jahr 2024 lag der Armutsnachteil
der Studie nach bei 525 Euro. Gemessen am durchschnittlichen
Bruttovermögen einer vermögensarmen Person (Details zu Höhe und
Zusammensetzung unten) ist das ein erheblicher Betrag. Der
Armutsnachteil beschreibt die Summe, über die eine vermögensarme
Person zusätzlich verfügen könnte, wenn sie die Konditionen der
wohlhabenderen Vermögensmitte erhielte. 280 Euro dieses
Armutsnachteils erklären sich dadurch, dass die Portfolios
Vermögensarmer renditeschwächer sind. Hinzu kommen bei ihnen höhere
Produktkosten, die noch einmal 245 Euro verursachen.
„Wenn
man sich anschaut, dass die Betroffenen oft nicht mehr als ein paar
Tausend Euro an Vermögen haben, ist das eine Menge Geld”, sagt
Britta Langenberg, Leiterin des Bereichs Verbraucherschutz bei
Finanzwende Recherche. Es sei unverständlich, dass die Perspektive
von Menschen mit wenig Geld in der öffentlichen Diskussion
eigentlich keine Rolle spiele. Langenberg: „Über Geld spricht man in
Deutschland nicht, über wenig Geld erst recht nicht.”
„Die
Studie zeigt sehr deutlich, dass es angesichts der sehr großen
Vermögensungleichheit in Deutschland ins Leere läuft, Menschen mit
wenig Vermögen einfach auf den Finanzmarkt, Aktienfonds oder ETFs zu
verweisen, und dann wird das schon mit der finanziellen Situation“,
sagt Christina Schildmann, Leiterin der Forschungsförderung der
Hans-Böckler-Stiftung. „Denn wer kaum etwas hat – und wir reden hier
über die Hälfte der Bevölkerung und mehr – kann es sich kaum
leisten, potenziell gewinnträchtige, aber auch schwankungsanfällige
Anlagen zu wählen. Die Untersuchung entlarvt damit den Mythos,
private Anlageformen könnten voraussetzungslos und für alle
gewinnbringend soziale Sicherung leisten“, so Schildmann.
Die Studie „Der Armutsnachteil” entstand in Zusammenarbeit mit
Forscherinnen am Institut für Sozioökonomie der Universität
Duisburg-Essen. Kern der Studie ist eine genaue Analyse der
Vermögensverhältnisse erwachsener Personen in Deutschland auf Basis
des sozio-oekonomischen Panels (SOEP). Dafür wurden drei
Bevölkerungsgruppen gebildet: Erstens die vermögensarme Hälfte der
Bevölkerung mit einem Bruttovermögen von im Schnitt 6.000 Euro.
Nächste Gruppe ist die wohlhabendere Vermögensmitte mit
einem im Schnitt deutlich höheren Bruttovermögen von 149.000 Euro.
Schließlich gibt es die oberen 10 Prozent, die im Schnitt 925.000
Euro an Bruttovermögen besitzen. Superreiche finden sich an deren
oberster Spitze, bewegen sich mit Vermögen im Multimillionen- und
Milliardenbereich aber noch einmal in einer anderen Welt.
Betrachtet man die Anlageportfolios der drei Gruppen, zeigen sich
große Unterschiede. Die mit Abstand wichtigste Anlageklasse in der
vermögensarmen Hälfte ist das eigene Auto – obwohl es sich dabei
nicht um ein Anlageprodukt im klassischen Sinne handelt. Schließlich
verlieren Autos permanent an Wert und verursachen gleichzeitig
Kosten. Hinzu kommen bei den unteren 50 Prozent der
Vermögensverteilung sichere, aber renditeschwache Anlagen wie
Spareinlagen oder Lebensversicherungen.
Anlageschwerpunkt der
Vermögensmitte ist die eigene Immobilie, eine im
Betrachtungszeitraum lukrativere Form der Geldanlage. Das macht sich
in der Rendite pro Jahr bemerkbar: Die Vermögensmitte kommt hier mit
ihrem Durchschnittsportfolio auf nominal 5,9 Prozent Rendite pro
Jahr, bei der vermögensarmen Hälfte der Bevölkerung sind es nur 1,9
Prozent nominal.
„Unterschiedliche Renditen und vor allem das
niedrigere Startkapital von vermögensarmen Menschen sorgen dafür,
dass der Graben zwischen den Vermögensgruppen immer weiter wächst”,
sagt Moritz Czygan, Referent bei Finanzwende Recherche und Ko-Autor
der Studie. „Die strukturellen Nachteile sind so groß, dass die oder
der Einzelne sie durch individuelle Entscheidungen kaum überwinden
kann.”
Ein Blick auf die vermögensarme Hälfte der Bevölkerung
zeigt auch, dass bestimmte Gruppen hier besonders häufig vertreten
sind – und damit öfter unter Armutsnachteilen leiden. So gehören zum
Beispiel 57 Prozent der Menschen in Ostdeutschland zu dieser Gruppe,
bei den Menschen mit Migrationshintergrund sind es mehr als zwei
Drittel (67 Prozent). Noch höher ist die Quote der Vermögensarmen
bei den Alleinerziehenden, hier liegt sie bei 76 Prozent. „In der
öffentlichen Diskussion fehlt allzu oft die Perspektive von Menschen
mit wenig Geld ”, sagt Langenberg. „Wenn es um Geldgeschäfte und um
privaten Vermögensaufbau geht, müssen wir ihre Lebenswirklichkeit
stärker berücksichtigen.”
Hausärztliche
Versorgung Projekt zur Gesundheitsförderung vor Ort gestartet
Vertreter:innen von 6 Universitäten aus Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben das Forschungsprojekt
„Positive Health Innovation“ gestartet. Beteiligt sind auch
Wissenschaftler:innen der Universität Duisburg-Essen. Die
Forschenden möchten die Qualität der Vorsorge und
Gesundheitsförderung vor Ort in Praxen von Hausärzt:innen
verbessern.
Die Grundlage bildet das Konzept zur
„Positiven Gesundheit“, das die niederländische Ärztin und
Forscherin Dr. Machteld Huber entwickelt hat. Das Vorhaben
koordinieren Forschende der Universität Witten/Herdecke. Es wird
durch den Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses mit 2,5
Millionen Euro über 3 Jahre gefördert. Das Team am
Forschungsstandort Essen erhält davon rund 500.000 Euro.

UK Essen / Hausarztpraxis Mortsiefer und Breer KölnU
Durch das „Positive Health“-Konzept werden Patient:innen motiviert,
mehr Verantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen.
Mithilfe eines Spinnennetz-Diagramms lernen sie, ihre Gesundheit in
sechs Bereichen einzuschätzen und zu bewerten. Das Diagramm
unterstützt Patient:innen dabei, mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt
individuelle Gesundheitsziele zu entwickeln und die nächsten
Schritte festzulegen.
„Ziel unserer Forschung in Essen
ist, die hausärztlich initiierte Gesundheitsförderung vor Ort in den
Praxen zu stärken sowie Schnittstellenprobleme zwischen
Hausärzt:innen und lokalen Unterstützungsangeboten zu überwinden“,
sagt Dr. Philip Schillen, Leiter des Essener Teilprojekts
„PositiveHealth – Entwicklung und Pilotierung eines neuen Dialogs
zur Gesundheitsförderung in der Primärversorgung“.
Im
Zuge der Auswertung soll festgestellt werden, wie Hausärzt:innen
gemeinsam mit Vertreter:innen von bestehenden Gesundheitsnetzen dazu
beitragen können, dass es Patient:innen besser geht und ein
gesundheitsförderndes Umfeld geschaffen werden kann. Für das
Forschungsteam in Essen liegt ein Arbeitsschwerpunkt auf der
Einführung des Beratungskonzepts in den Gesundheitsnetzen der drei
Studienzentren des Projekts.
Innerhalb Essens untersucht
das Team die Gesundheitsversorgung nördlich der Autobahn A40. Mit
einer Positive-Health-Beratung können sehr unterschiedliche
gesundheitlich relevante Bedürfnisse identifiziert werden. Eine
wichtige Rolle spielt die Vermittlung psychosozialer Hilfen,
beispielsweise durch die Unterstützung von sozialer Interaktion im
Viertel oder durch Vermittlung einer Beratung bei Überschuldung oder
Drogenabhängigkeit.
„Mit unseren Erkenntnissen möchten
wir dazu beitragen, dass Patient:innen auf sie passende Angebote im
Stadtteil stärker als bislang nutzen“, ergänzt Projektleiter Dr.
Schillen, der am Institut für Allgemeinmedizin des
Universitätsklinikums Essen arbeitet. Das Konzept sieht Lotsen in
den Gesundheitsnetzen vor, die beteiligte Hausärzt:innen und
Patient:innen bei der Umsetzung unterstützen.
EVG erwartet von der DB AG substantielles Angebot schon in der
ersten Verhandlungsrunde
Die EVG startet mit einer
klaren Erwartungshaltung in die vorgezogenen Tarifverhandlungen mit
der Deutschen Bahn. „Wir erwarten gleich am ersten Verhandlungstag
ein substantielles Angebot, über das sich ernsthaft verhandeln
lässt“, machte die Co-Verhandlungsführerin der EVG, Cosima
Ingenschay, deutlich. „Wenn auch die DB AG will, dass der neue
Tarifvertrag noch vor der vorgezogenen Bundestagswahl abgeschlossen
wird, müssen wir die wenige Zeit, die uns bleibt, nutzen, um in den
Themen voranzukommen“, sagte sie.

Die EVG fordert für alle ihre bei der Deutschen Bahn beschäftigten
Mitglieder 7,6 Prozent mehr Lohn, inklusive EVG-Zusatzgeld
(EVG-ZUG). Für Schichtarbeitende, die besonders belastet sind, soll
es ein weiteres EVG-Zusatzgeld in Höhe von 2.6 Prozent mehr geben,
verbunden mit der Möglichkeit, einen Teil davon in bis zu 3
zusätzliche freie Tage tauschen zu können.
„Mit dem
EVG-Zusatzgeld setzen wir neue tarifpolitische Akzente, von der alle
Mitglieder, in dieser Runde aber vor allem Beschäftigte profitieren
sollen, die bei ständig wechselnden Arbeitszeiten oder Nachtarbeit
besonderen Belastungen ausgesetzt sind“, erklärte
EVG-Co-Verhandlungsführerin Cosima Ingenschay. Darüber hinaus sei es
der EVG wichtig, jetzt einen Tarifvertrag zu verhandeln, der für
Beschäftigungssicherung auch über den Regierungswechsel hinaus
sorgt.
„Angesichts der zunehmend schwieriger werdenden
wirtschaftlichen Situation in Deutschland und den immer lauter
werdenden politischen Rufen nach einer Zerschlagung der DB AG, sehen
wir hier akuten Handlungsbedarf. Wenn man sich anschaut, was derzeit
in unserem Land passiert, ist es ganz wichtig für unsere Kolleginnen
und Kollegen bestehende Vereinbarungen zum Kündigungsschutz zu
verlängern“, so Cosima Ingenschay.
Ausschließlich für
ihre Mitglieder fordert die EVG einen Bonus von 500 Euro, zudem
sollen Verwerfungen in der Entgeltstruktur ausgeglichen werden. Die
Auftaktrunde der Tarifverhandlungen zwischen EVG und DB AG findet am
Dienstag, den 28.1.2025, in Frankfurt statt. Die zweite Runde ist ab
Dienstag, 4.2.2025, in Berlin geplant. Am Tag zuvor, am Montag,
3.2.2025, hat die EVG zu einer großen Demonstration in Berlin
aufgerufen. Dabei geht es um das große Thema „Zukunft Bahn“, zudem
auch gute Tarifverträge gehören, für die die EVG in dieser
Tarifrunde wieder kämpft.
Für die EVG verhandeln die
stellvertretenden Vorsitzenden Kristian Loroch und Cosima
Ingenschay. Zur Verhandlungsdelegation gehören elf Vertreterinnen
und Vertreter aus unterschiedlichen Unternehmen der DB AG.
"Elektromobilität: TotalEnergies betreibt Ladesäulen an
Standort von thyssenkrupp in Duisburg"
TotalEnergies hat
am Standort von thyssenkrupp in Duisburg fünf Elektroladesäulen in
Betrieb genommen. An den insgesamt zehn Ladepunkten können sowohl
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von thyssenkrupp als auch
Besucherinnen und Besucher des Standorts ihre Elektrofahrzeuge mit
einer Ladeleistung von bis zu 22 kW aufladen.
Die
Ladesäulen werden zu 100 Prozent mit Strom aus erneuerbaren
Energiequellen versorgt. Im Zuge der Kooperation übernahm
thyssenkrupp die Vorarbeiten am Standort. TotalEnergies
verantwortete die Installation der Ladesäulen und sichert darüber
hinaus den laufenden Betrieb und die Instandhaltung der
Ladeinfrastruktur, die Stromversorgung sowie die Abrechnung der
Ladevorgänge.

Jan Petersen, Geschäftsführer TotalEnergies Charging Solutions
Deutschland: „Durch die Zusammenarbeit mit thyssenkrupp verbinden
wir unser Angebot für Gewerbekunden mit dem Ausbau der öffentlichen
Ladeinfrastruktur in der Region und unterstreichen so unser
Engagement für den Ausbau der Elektromobilität in Deutschland.“
TotalEnergies ist seit 1955 in Deutschland
präsent und sichert derzeit bundesweit rund 4.000 Arbeitsplätze. Das
Unternehmen betreibt in Leuna mit der TotalEnergies Raffinerie
Mitteldeutschland GmbH eine der modernsten Rohölverarbeitungsanlagen
Europas und bietet seinen Kunden eine breite Palette an
Energieprodukten an: Schmierstoffe, Flüssiggas, Heizöl, Kraftstoffe
für die Luft- und Schifffahrt, Bitumen sowie Spezialprodukte für die
Industrie.
TotalEnergies ist im Bereich Petrochemie
sowie im Vertrieb von Erdgas aktiv und bietet mit Hutchinson
intelligente Lösungen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie an.
Im Bereich Elektromobilität betreibt das Unternehmen ein Netz von
über 6.000 Ladepunkten. Mit dem 2023 eröffneten LNG-Importterminal
Deutsche Ostsee, zu dem das Unternehmen eine schwimmende Speicher-
und Regasifizierungseinheit (FSRU) beisteuert und LNG liefert, ist
TotalEnergies einer der wichtigsten LNG-Versorger des Landes.
TotalEnergies erhielt 2023 und 2024 von der
Bundesnetzagentur Zuschläge für den Bau von drei Windparks in der
Nord- und Ostsee und beteiligt sich gemeinsam mit RWE an zwei
Offshore-Windprojekten. Insgesamt verfügen die fünf Projekte über
eine Nettokapazität von 6,5 GW.
Darüber hinaus
entwickelt das Unternehmen in Deutschland große PVFreiflächenanlagen
sowie Onshore-Windkraft und bietet Photovoltaiklösungen für
Industrie, Gewerbekunden und Privathaushalte an. Mit den Übernahmen
von Quadra Energy, Kyon Energy und Nash Renewables treibt
TotalEnergies die Entwicklung seines integrierten Stromgeschäfts in
Deutschland voran.
Stadtwerke
Duisburg nehmen neue Ladepunkte im Süden der Stadt in Betrieb
Der Ausbau von Ladeinfrastruktur für Elektromobilität in der
gesamten Stadt geht konsequent voran, um allen Menschen in Duisburg
die Gelegenheit zu geben, ihre Mobilität klimafreundlich zu
gestalten. In den vergangenen Wochen hat der lokale
Energiedienstleister weitere zehn neue Ladepunkte im Süden der Stadt
in Betrieb genommen.
Jeweils zwei neue Ladepunkte stehen
jetzt an der Wedauer Straße in Wedau auf Höhe der Hausnummer 319, an
der Großglocknerstraße in Wedau auf Höhe der Hausnummer 35, an der
Dauner Straße in Huckingen auf Höhe der Hausnummer 2, an der
Weißdornstraße in Großenbaum auf Höhe der Hausnummer 2 und „An der
Fliesch“ in Huckingen auf Höhe der Hausnummer 18.
Der lokale
Energiedienstleister betreibt insgesamt 206 Ladepunkte an 86
Standorten im Stadtgebiet. Davon sind 24 Ladepunkte sogenannte
Schnellladepunkte mit einer Ladeleistung zwischen 49 und 150 kW.
Zusätzliche 36 Ladepunkte an 12 Standorten befinden sich aktuell im
Bau und für weitere 90 Ladepunkte an 37 Standorten wurden
Prüfanträge bei der Stadtverwaltung eingereicht.
Die
Stadtwerke treiben den Ausbau kontinuierlich voran. Das Ziel ist,
einen Bestand von 500 Ladepunkten aufzubauen. Die neu installierten
Ladesäulen entsprechen dem neuesten Stand der Technik und den
aktuellen Anforderungen des Mess- und Eichrechts. Die Ladesäulen der
Stadtwerke Duisburg sind an den Verbund ladenetz.de angeschlossen,
zu dem rund 260 Anbieter von Ladeinfrastruktur gehören. Insgesamt
stehen über 19.000 Ladepunkte in ganz Deutschland zur Verfügung.
Eine Ladekarte der Stadtwerke Duisburg können Interessierte
über das Online-Formular unter swdu.de/ladekarte bestellen.
Kundinnen und Kunden profitieren dabei von einem Preis-Vorteil in
Höhe von 60 Euro im Jahr. Die Energieberaterinnen und -berater der
Stadtwerke Duisburg stehen Interessierten bei allen Fragen rund um
die Elektromobilität von der Fahrzeugauswahl bis zur heimischen
Lade-Wallbox samt passendem Stromtarif telefonisch unter 0203-604
1111.
Weitere Informationen gibt es auch im Internet auf
https://www.stadtwerke-duisburg.de/emob-p.
Auch Geschäftskunden,
die ihren gesamten Fuhrpark auf Elektroautos umstellen wollen,
erhalten bei den Stadtwerken kompetente Beratung zu möglichen
Fahrzeugmodellen und Planung einer effizienten Ladeinfrastruktur auf
dem eigenen Firmengelände. Weitere Informationen gibt es auch hierzu
im Internet unter https://www.stadtwerke-duisburg.de/emob-g.

An der Wedauer Straße können Elektroautos ab sofort unkompliziert an
einer Ladesäule der Stadtwerke Duisburg geladen werden. Quelle:
Stadtwerke Duisburg
Rund 70 Prozent haben noch nie ein E-Auto gefahren –
Wechsel vom Verbrenner- zum Elektroantrieb waren 2024 so selten wie
vor 3 Jahren
Nach eigener Fahrerfahrung steigt aber die
Umstiegsbereitschaft stark an – Wegweisende Ergebnisse durch das
neue HUK-E-Barometer
2024 stiegen in nicht einmal 4 von 100
Fällen private Fahrzeughalter vom Verbrenner- auf einen
Elektroantrieb um
Besonders geringe Fahrerfahrung mit E-Autos
haben Ältere, Wenig-Fahrer und Frauen
In Stuttgart ist die
Verbreitung von E-Autos unter den 20 größten Städten Deutschlands am
höchsten, in Leipzig am niedrigsten.
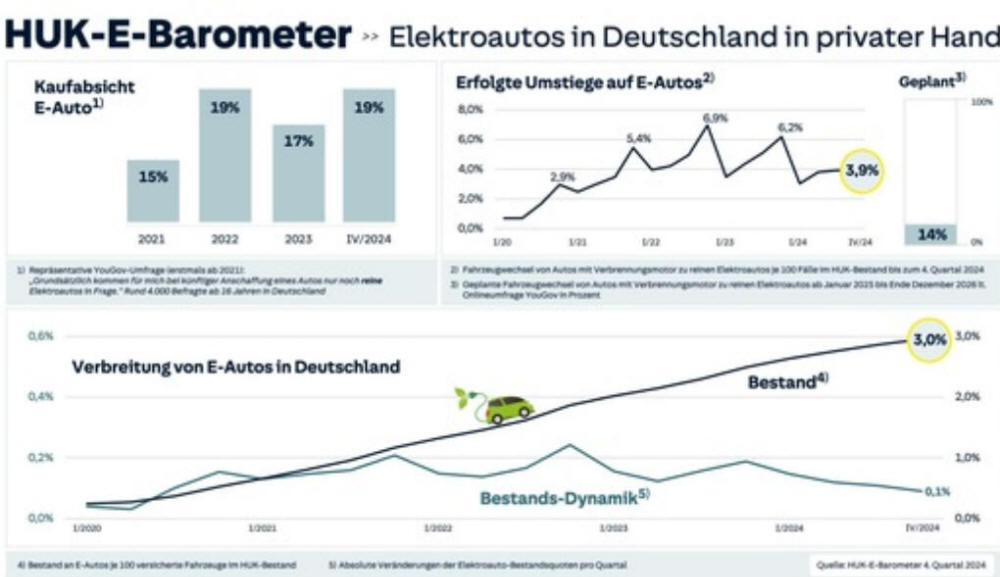
Im vergangenen Jahr sind private Halter bei Fahrzeugwechseln so
selten von Verbrennungs- auf reine Elektromotoren umgestiegen wie
zuletzt vor drei Jahren. Dies ergibt das neu entwickelte
HUK-E-Barometer. Für 2024 zeigt es in nicht einmal vier von 100
Wechselfällen einen Umstieg. Das vierte Quartal 2024 erreichte bei
Umstiegen sogar den schlechtesten Jahresend-Quartalswert seit 2020.
Denn hier gab es ansonsten immer eine Jahresschlussrallye.
Das Verhalten und die Einstellung der Bundesbürger zu E-Autos
hängen aber stark davon ab, ob eigene Fahrerfahrungen hiermit
vorliegen. So saß bislang noch nicht einmal jeder dritte Deutsche,
der den Besitz eines Führerscheins angibt, jemals schon am Steuer
eines E-Autos (30 %). Demzufolge werden Elektroautos in Deutschland
insgesamt aktuell auch nur zu 45 Prozent als "gut" oder "sehr gut"
eingeschätzt. Diejenigen aber, die bereits ein E-Auto selbst
gefahren haben (ohne es zu besitzen), finden E-Autos zu 53 Prozent
"gut" oder "sehr gut" und wer selbst eines schon besitzt, hat diese
Meinung sogar zu 82 Prozent.
"Der Schlüssel zur Akzeptanz
und Verbreitung von Elektroautos in Deutschland hängt ganz offenbar
von der persönlichen Erfahrung ab", erklärt Dr. Jörg Rheinländer,
Vorstandsmitglied der HUK-COBURG. "Die aktuellen Ergebnisse des
HUK-E-Barometers zeigen, dass Fahrer, die E-Autos kennen, diese
Autos viel positiver sehen, gerade wenn es um Kriterien wie Komfort,
Leistungsfähigkeit oder Verlässlichkeit geht."
Am wenigsten
Erfahrung mit Elektroautos bei Älteren, Wenig-Fahrern und Frauen
Deutlich unterrepräsentiert bei der Fahrerfahrung mit reinen
Elektroautos zeigen sich Frauen gegenüber Männern (21 % zu 33 % bei
Männern), Personen ab 55 Jahren (19 % zu 33 % der Jüngeren) und
Viel- gegenüber Wenig-Fahrern.
So haben unter denen, die im
Jahr maximal 5000 Kilometer fahren, nur 18 Prozent selbst schon ein
E-Auto gesteuert. Mehr als doppelt so viele sind es hingegen unter
denjenigen, die jährlich mehr als 20.000 Kilometer zurücklegen (43
%). Ein etwas überraschendes Ergebnis, da E-Autos insbesondere auf
Kurzstrecken etwa innerhalb der Stadt sich als vorteilhaft
präsentieren.
Zuwachs des Bestands an E-Autos in privater
Hand fällt auf Vier-Jahres-Tief
Der Anteil privat gehaltener
reiner E-Autos betrug laut HUK-E-Barometer Ende 2024 bundesweit nur
3,0 Prozent. Für die Zunahme dieser Quote wird auch ein
Dynamik-Faktor ermittelt. Das ernüchternde Ergebnis: Die Dynamik der
Zunahme des E-Auto-Anteils war 2024 so schwach ausgeprägt wie
zuletzt Anfang 2020 – also vor vier Jahren, als der Markt der
Elektroautos sich gerade erst zu entwickeln begann und die Messreihe
des HUK-E-Barometers startet.
Stuttgart beim Bestand vorn,
Frankfurt aber bei den Umsteigern gleichauf
Regional gibt es
deutliche Unterschiede bei der Entwicklung der Elektromobilität. So
hat Stuttgart unter den 20 größten deutschen Städten mit 3,9 Prozent
den mit Abstand höchsten Anteil an reinen Elektroautos in privatem
Besitz. Dahinter folgen Münster, München und Bielefeld mit jeweils
2,9 Prozent. Am Ende der Skala stehen Bremen und Dresden (je 1,7 %)
sowie Leipzig (1,6 %).
Bestand an privat gehaltenen E-Autos
in den 20 größten deutschen Städten zum 31.12.2024 (bei der
HUK-COBURG versicherte Fahrzeuge in Prozent):
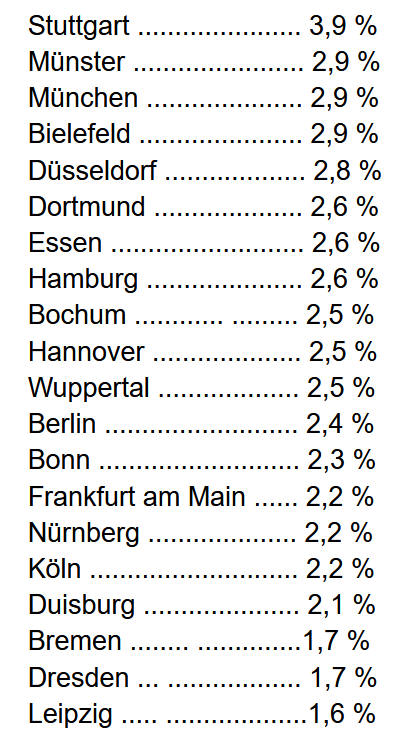
Betrachtet man die Häufigkeit der Fälle, in denen 2024 bei einem
Fahrzeugwechsel der private Halter von einem Verbrenner- zu einem
reinen Elektromotor wechselte, ergibt sich aber eine andere
Rangfolge. Bei dieser Betrachtung muss sich Stuttgart den ersten
Rang mit Frankfurt am Main teilen (jeweils 4,0 %). Knapp dahinter
folgen Münster (3,9 %) und Düsseldorf (3,6 %).
Leipzig, Bremen
und Dresden bilden auch hier die Schlusslichter. Umstiege von Autos
mit Verbrennungsmotoren - zu reinen E-Autos in den 20 größten
Städten 2024 (in Prozent der Fahrzeugwechsel im HUK-COBURG-Bestand):
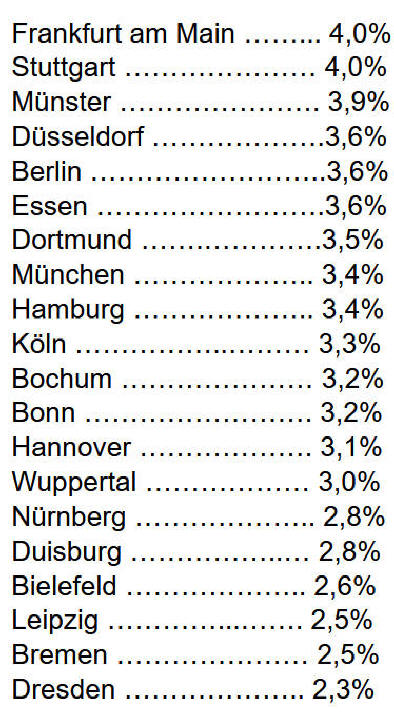
Zum Teil deutlich ausgeprägter war 2024 der Wechsel zu elektrischen
Fahrzeugen in ausgewählten Landkreisen. Hier fällt etwa der Kreis
Starnberg mit einer Umstiegsquote von 8,0 Prozent ins Auge. Eine
Erklärung kann in den wesentlich mehr vorhandenen Einfamilienhäusern
mit eigenen Ladesäulen in den Landkreisen als in den Großstädten
liegen.
Theaterstück „Der erste letzte Tag“ in der
Stadthalle Walsum
Das Schauspiel „Der erste letzte Tag“
wird am Sonntag, 16. März, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) in der
Stadthalle Walsum auf der Waldstraße 50 gezeigt. „Der erste letzte
Tag“ ist ein Theaterstück nach dem Roman von BestsellerAutor
Sebastian Fitzek. Das Stück erzählt von einem schicksalhaften
Roadtrip und einem besonderen Selbstversuch.
Bei aller
Komik stellt Sebastian Fitzek in seinem Roman „Der erste letzte Tag“
auch sehr existenzielle Fragen nach Sinn, Verpflichtung,
Individualität und Mitläufertum. Am Ende wartet eine
unvorhergesehene Wendung auf die Zuschauer, die sie die Welt mit
anderen Augen sehen lässt. Das Stück: Zwei völlig gegensätzliche
Menschen werden durch äußere Umstände gezwungen, einen ganzen Tag
miteinander zu verbringen. Livius Reimer und die aufgekratzte Lea
von Armin müssen sich nach gestrichenem Flug den letzten verfügbaren
Mietwagen teilen, um von München nach Berlin zu kommen.
Während der angepasste Lehrer und angehende Vater seine Ehe retten
will, obwohl ihn seine Frau Yvonne betrogen hat, ändern sich die
Pläne von Lea, die in Livius‘ Augen das fleischgewordene Klischee
einer „Tofu-Terroristin“ ist, von einer Minute zur nächsten. Kein
Wunder, wollte die quirlige Journalistin doch eigentlich zu einem
Interview mit den „Last Day Men“ reisen, einer Gruppe von Leuten,
die einen Tag lang so leben, als wäre es ihr letzter.
Von der Idee beflügelt, überredet Lea Livius dazu, diesem Beispiel
zu folgen und den gemeinsamen Roadtrip fortan durch die Brille der
Endlichkeit zu betrachten. Nichtsahnend, welche Chaoswelle seine
Zustimmung in Gang setzt, lässt sich Livius auf das Experiment ein.
Sehr zur Freude des Publikums jagt ab sofort ein skurriles Abenteuer
das nächste. Lea bittet im Altersheim eine wildfremde Greisin um
Verzeihung – was bei Livius dummerweise als Enkeltrick gedeutet wird
und beide zur Flucht zwingt.
An einer Raststätte rettet
Lea ein Dutzend Schweine und tauscht dafür den nagelneuen Mietwagen
ein, woraufhin sie ihre Fahrt in einer rostigen Klapperkiste
fortsetzen müssen. Gemeinsam quartieren sie eine Gruppe Obdachloser
in einem Leipziger Luxushotel ein, wofür Livius seine kompletten
Ersparnisse hergibt. Schließlich will er ja nicht an Morgen denken.
In Dessau-Roßlau erleben sie unfreiwillig hautnah die
unkonventionellen Massagemethoden eines tschetschenischen
Wellness-Gurus und treffen in einer Hamburger Pizzeria auf Leas
Ehemann, der gar nicht erfreut ist, seine Braut wiederzutreffen,
nachdem sie ihn während der Trauung sitzen ließ. Und als ob das
alles nicht schon turbulent genug wäre, befördert das Smartphone
immer dann diskreditierende Reiseimpressionen zu Yvonne, wenn es am
ungünstigsten scheint – nur wenige Stunden, bevor die Eheberatung
beginnen soll…
Karten für die Veranstaltung sind von
montags bis freitags, von 8 bis 12 Uhr, in Zimmer 315 (3. Etage) im
Bezirksrathaus Walsum auf der Friedrich-EbertStraße 152 erhältlich.
Tickets kosten je nach Kategorie zwischen 16 bis 25 Euro zuzüglich
zehn Prozent Vorverkaufsgebühr. Weitere Informationen gibt es
telefonisch unter (0203) 283-5731.
Aktuell gibt es auch noch
die Möglichkeit ein halbes Theaterabonnement abzuschließen, dieses
umfasst die zwei Theaterstücke „Der erste letzte Tag“ am 16. März
sowie „Spatz und Engel“ am 8. Mai. Das Abonnement kostet zwischen 29
bis 45 Euro.

NRW-Straßenverkehr: Anzahl der Verkehrsunfälle mit
Personenschaden im Winter 2023/24 leicht rückläufig im Vergleich zum
Winter 2022/23
Im Winter 2023/2024 haben sich auf den
nordrhein-westfälischen Straßen 12 232 Verkehrsunfälle mit
Personenschaden ereignet. Wie Information und Technik
Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt anhand vorläufiger
Ergebnisse mitteilt, waren das 1,1 Prozent weniger als im Winter
zuvor (12 367).. Von Anfang Dezember 2023 bis Ende Februar 2024 sind
bei Unfällen im Straßenverkehr 94 Personen gestorben und 1 971
Personen schwer verletzt worden.
Im Vergleich zum
Vorjahreswinter wurden vier Personen mehr getötet (+4,4 Prozent),
die Anzahl der Schwerverletzten ging um 103 Personen (−5,0 Prozent)
zurück. Im Vergleich zum Winter 2019/2020, vor Beginn der
Corona-Pandemie, ist die Zahl der Unfälle mit Personenschaden im
Winter 2023/24 um 6,8 Prozent gesunken; es wurden 2,1 Prozent
weniger Personen getötet und 29,9 Prozent weniger Personen schwer
verletzt.
Schwierige Straßenverhältnisse und
Witterungseinflüsse als Unfallursache
In den Wintermonaten
2023/2024 ereigneten sich insgesamt 438 Unfälle mit Personenschaden
aufgrund von Glätte durch Schnee oder Eis; das waren 22,1 Prozent
mehr als in den Wintermonaten des Vorjahres.. Hierbei wurden vier
Personen getötet und 85 Personen schwer verletzt. Ein Großteil
dieser Unfälle ereignete sich zwischen dem 11. und 19. Januar 2024
(266 Unfälle).
Glätte durch Regen war in den
Wintermonaten für 123 Unfälle mit Personenschaden ursächlich
(+13,8 Prozent) und führte zu 21 Schwerverletzten.
Sichtbehinderungen durch blendende Sonne führten in diesem Zeitraum
in 50 Fällen zu einem Unfall mit Personenschaden. Dabei wurden
sieben Personen schwer verletzt. 18 Unfälle ereigneten sich infolge
von Unwettern oder sonstigen Witterungseinflüssen, wobei drei
Personen schwer verletzt wurden.
Schlechte Sicht
aufgrund von starkem Regen, Hagel oder Schneegestöber führte im
vergangenen Winter zu sieben Unfällen mit insgesamt drei
Schwerverletzten. Die meisten Unfälle mit Personenschaden ereigneten
sich im Sommer 2023 Zu den häufigsten Unfallursachen zählten im Jahr
2023 ungenügender Sicherheitsabstand (6 961 Unfälle, 16 Todesfälle),
das Nichtbeachten der die Vorfahrt regelnden Verkehrszeichen (6 119
Unfälle, 38 Todesfälle) und nicht angepasste Geschwindigkeit (5 141
Unfälle, 90 Todesfälle).
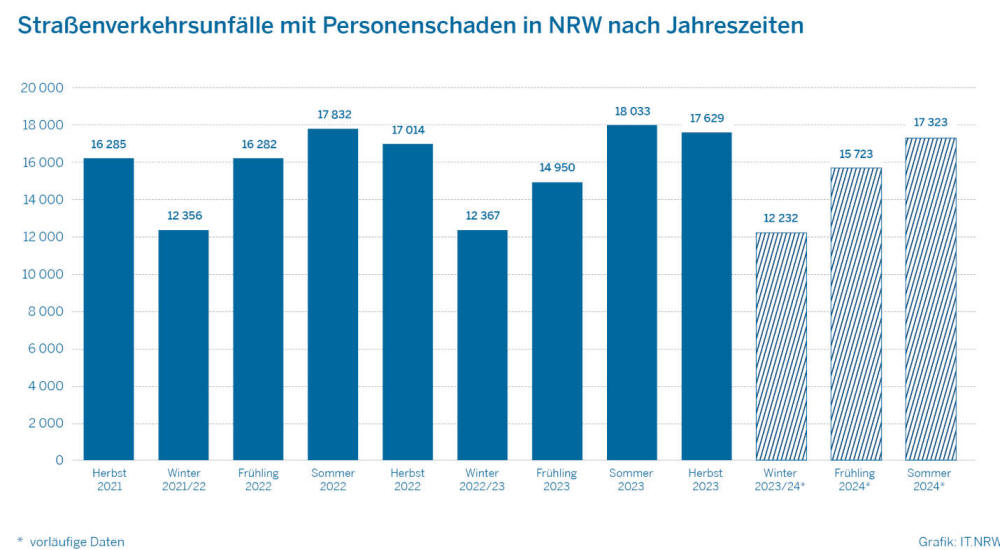
Die unfallstärkste Jahreszeit seit Herbst 2021 war der Sommer
2023 (Juni bis August) mit insgesamt 18 033 Unfällen mit
Personenschaden. Die höhere Anzahl der Verkehrsunfälle mit
Personenschaden in den wärmeren Monaten lässt sich u. a. dadurch
erklären, dass mehr Personen mit Fahrrädern und Motorrädern oder
auch zu Fuß unterwegs sind und der Freizeitverkehr zunimmt. Wie das
Statistische Landesamt weiter mitteilt, handelt es sich bei den
Unfallursachen um Mehrfachzählungen. Bei einem Unfall werden bis zu
acht Ursachen angegeben. (IT.NRW)
Straßenverkehrsunfälle im November 2024: 4 % weniger
Verletzte als im Vorjahresmonat - Zahl der Verkehrstoten gegenüber
November 2023 ebenfalls gesunken
Im November 2024
sind in Deutschland rund 28 000 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen
verletzt worden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach
vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 4 % oder 1 200 Verletzte
weniger als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Verkehrstoten sank um 12
auf 199 Personen. Die Polizei registrierte im November 2024
insgesamt 217 200 Straßenverkehrsunfälle und damit 5 % weniger als
im Vorjahresmonat (-11 900).
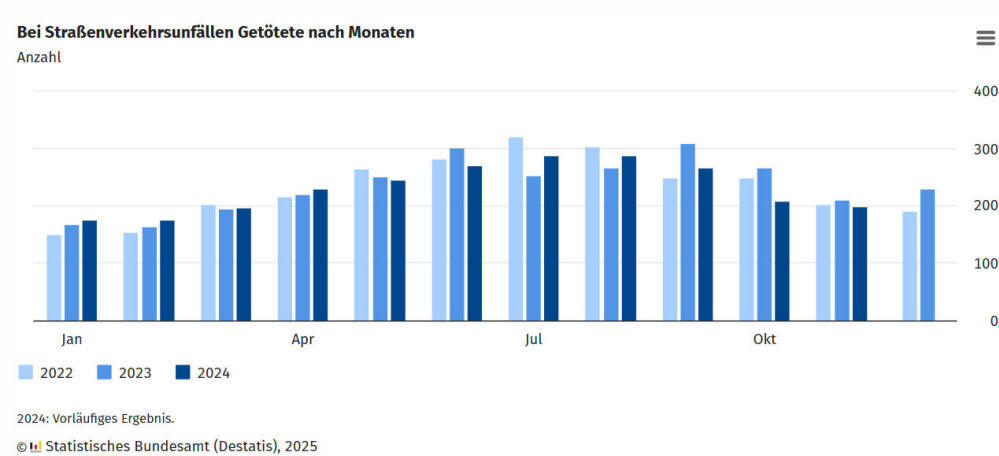
Im Zeitraum Januar bis November 2024 erfasste die Polizei
2,3 Millionen Straßenverkehrsunfälle und damit in etwa so viele wie
im Vorjahreszeitraum. Darunter waren 267 400 Unfälle mit
Personenschaden, bei denen 2 545 Menschen getötet wurden.
Damit ist die Zahl der Verkehrstoten im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum um 65 (-2 %) gesunken. Die Zahl der Unfälle mit
Personenschaden nahm um 5 700 (-2 %) ab. Die Zahl der Verletzten im
Straßenverkehr sank im selben Zeitraum um 2 % oder 7 800 Menschen
auf 334 400.