






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 6. Kalenderwoche:
5. Februar
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Donnerstag, 6. Februar 2025
A59: Vollsperrung der Auffahrrampe der A59 aus Fahrtrichtung
Düsseldorf auf die A40 in Fahrtrichtung Venlo am Kreuz Duisburg
Von Donnerstag (6.2.) um 20 Uhr bis Freitag (7.2.) um 5 Uhr
wird die Auffahrrampe der A59 aus Fahrtrichtung Düsseldorf auf die
A40 in Fahrtrichtung Venlo am Kreuz Duisburg vollgesperrt.
Eine Umleitung über die Anschlussstelle Duisburg-Meiderich wir per
rotem Punkt ausgeschildert. Sollten die durchzuführenden Arbeiten am
Donnerstag (6.2.) nicht fertiggestellt werden können, gibt es für
die Nacht von Freitag (7.2.) auf Samstag (8.2.) einen
Ausweichtermin.
Breitbandausbau in Mündelheim
und Serm gestartet
Ab dem 5. Februar haben in
Mündelheim und Serm die Arbeiten für den Breitbandausbau begonnen.
Stadtdirektor und Digitalisierungsdezernent Martin Murrack nahm
gemeinsam mit Vertretern der Epcan GmbH und Muenet GmbH & Co. KG den
symbolischen Spatenstich vor. Der Glasfaserausbau in den beiden
Stadtteilen wird von den Unternehmen finanziert und durchgeführt.

Spatenstich Breitbandausbau in Duisburg Mündelheim mit
Bezirksbürgermeisterin (Süd) Beate Lieske (3. v.r.) Stadtdirektor
Martin Murrack (2.v.r.), Gigabitkoordinator Falko König (1.v.r.) -
Foto Ilja Höpping / Stadt Duisburg
Durch den Ausbau
werden die Bürgerinnen und Bürger mit einer zukunftssicheren
Kommunikationsinfrastruktur ausgestattet. Insgesamt wird auf 27
Kilometern Glasfaser verbaut und damit rund 800 Haushalte an das
Netz angeschlossen. „Wir begrüßen das privatwirtschaftliche
Engagement von Epcan und Muenet ausdrücklich.
Der
Glasfaserausbau mit und – wie hier – ohne staatliche Hilfe, stärkt
die digitale Zukunftsfähigkeit unserer Stadt, ihrer Bewohnerinnen
und Bewohner sowie der Wirtschaft. Dies ist ein weiterer wichtiger
Schritt zu einer vernetzten und zukunftsfähigen Stadt“, so Martin
Murrack, Stadtdirektor und Digitalisierungsdezernent.
Die
neuen Glasfaseranschlüsse ermöglichen unter anderem sicheres
Arbeiten im Homeoffice, reibungsloses Streaming, moderne
TelemedizinAngebote und zukunftsorientierte Bildungsangebote.
Darüber hinaus trägt ein leistungsfähiges Breitbandnetz zur
Attraktivität des Standorts für ansässige und neu anzusiedelnde
Unternehmen bei.
Bis zum Jahre 2030 soll das
privatwirtschaftliche Glasfasernetz flächendeckend im gesamten
Stadtgebiet ausgebaut sein. Ergänzend dazu werden auch die „Weiße
Flecken“-Förderprogramme von Bund und Land genutzt, um die
unterversorgten Gebiete (mit einem Download von weniger als 30
Mbit/s), in denen kein marktgetriebener Ausbau stattfindet, an das
Glasfasernetz anzubinden. Weitere Informationen zum Glasfaserausbau
in Duisburg gibt es online unter https://breitband.duisburg.de.
Bundestagswahl 2025: deutlich
weniger Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber als 2021
Zur
Bundestagswahl am 23. Februar 2025 treten insgesamt 4.506
Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber an. Wie die Bundeswahlleiterin
weiter mitteilt, finden sich darunter 1.422 Frauen (32 %). Bei der
letzten Wahl am 26. September 2021 hatten sich 6.211 Kandidatinnen
und Kandidaten beworben (2.024 oder 33 % Frauen). Damit treten 2025
knapp 1.700 weniger Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber an als 2021.
Bei der kommenden Bundestagswahl bewerben sich 806
Personen nur in einem Wahlkreis sowie 1.841 Kandidatinnen und
Kandidaten ausschließlich auf einer Landesliste. 1.859 Personen
kandidieren sowohl in einem Wahlkreis als auch auf einer
Landesliste. Auf den 229 Landeslisten der 29 Parteien (2021: 338
Landeslisten von 40 Parteien), die in den Ländern für die
Bundestagswahl 2025 zugelassen wurden, treten insgesamt 3.700
Personen an (2021: 4.927).
Darunter sind 1.298 oder 35 %
Frauen (2021: 1.752 oder 36 %). Wahlkreisbewerberinnen und
Wahlkreisbewerber der SPD, der Unionsparteien CDU und CSU sowie der
FDP kandidieren in allen 299 Wahlkreisen. GRÜNE und Die Linke sind
jeweils in 297 Wahlkreisen zugelassen worden, die AfD in 295
Wahlkreisen.
Deutlich zurückgegangen ist die Zahl der
parteilosen Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber – von 197 bei der
Bundestagswahl 2021 auf 62 bei der Bundestagswahl 2025. Die
Gesamtzahl der Wahlkreisbewerberinnen und Wahlkreisbewerber liegt
bei 2.665 (2021: 3.360), darunter 712 oder 27 % Frauen (2021: 960
oder 29 %).
Je Wahlkreis bewerben sich durchschnittlich
8,9 Personen. Den Stimmzettel mit den meisten Wahlvorschlägen gibt
es im Wahlkreis 82 „Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg – Prenzlauer
Berg Ost“ mit 20 Listenpositionen. Die wenigsten Wahlvorschläge mit
jeweils 11 Listenpositionen finden sich auf den Stimmzetteln in fünf
Wahlkreisen in Thüringen. 587 der 733 gegenwärtigen Abgeordneten des
Deutschen Bundestages kandidieren erneut. Dies entspricht einem
Anteil von 80 %.
94 Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber
sind nach der Bundestagswahl 2021 volljährig geworden und damit
erstmals wählbar. Die jüngste Bewerberin bei der Bundestagswahl 2025
ist 18 Jahre alt und kandidiert im Wahlkreis 295 „Zollernalb –
Sigmaringen“ in Baden-Württemberg. Die mit 88 Jahren älteste
Bewerberin kandidiert für eine Landesliste in Hamburg. Das
Durchschnittsalter der 4.506 Bewerberinnen und Bewerber liegt bei
der Bundestagswahl 2025 bei 45,3 Jahren (2021: 45,5 Jahre).
Bezirksbibliothek Rheinhausen trotz Bauarbeiten geöffnet
Die Rheinhauser Bibliothek auf der Händelstraße 6 ist
trotz der andauernden Sanierungsarbeiten geöffnet. Auch wenn noch
nicht alles wieder an seinen angestammten Platz geräumt werden
konnte, steht der übliche Service wieder zur Verfügung. Die
beliebten Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene, wie
Vorleseveranstaltungen, Kabarett und Spieleabend finden ebenfalls
wieder statt.
Alle Informationen gibt es auch im
Internet unter www.stadtbibliothekduisburg.de. Für Fragen zur
Ausleihe steht das Team der Bibliothek vor Ort oder telefonisch
unter 02065 905-8467 zur Verfügung. Die Bezirksbibliothek ist
dienstags bis freitags von 10.30 bis 13 und 14 bis 18.30 Uhr
geöffnet, samstags von 10 bis 13 Uhr.
Zahl der Woche: 233,5 Millionen Euro für den Erhalt von
Landesstraßen
2024 floss mehr Geld in die
Straßensanierung als geplant 05.02.2025 220 Millionen Euro hatte das
Land Nordrhein-Westfalen 2024 für den Erhalt der Landesstraßen im
Haushalt eingeplant. Tatsächlich ausgegeben werden konnten am Ende
sogar 233,5 Millionen Euro.
„Wir tragen jetzt die
Hypothek vergangener Jahrzehnte ab, in denen man sich mit vielen
Neubauten geschmückt hat, aber auf Verschleiß gefahren ist. Den
Preis dafür zahlen wir jetzt. Deshalb sind hohe Investitionen in
Erhaltungsmaßnahmen entscheidend, um die Infrastruktur für die
Zukunft fit zu machen. Wir investieren mehr als jede Landesregierung
zuvor in die Sanierung", erklärt NRW-Verkehrsminister Oliver
Krischer.

Die steigenden Investitionen in die Landesstraßenerhaltung sind
zentraler Baustein, um den Sanierungsstau der Verkehrsinfrastruktur
in NRW abzubauen. Für die Erhaltung von Bundesstraßen, die sich im
Zuständigkeitsbereich des Landesbetriebs Straßenbau
Nordrhein-Westfalen befinden, wurden im vergangenen Jahr 175,5
Millionen Euro investiert. Dies bedeutet gegenüber dem Jahr 2023
eine Steigerung um 27,4 Millionen Euro (Ist-Ausgabe 2023: 148,1
Millionen Euro).
Auch die Bilanz der Baumaßnahmen lässt
sich sehen: Insgesamt 151 Maßnahmen sah das
Landesstraßenerhaltungsprogramm für 2024 vor, viele davon mit
mehrjährigen Bauzeiten. Davon konnten 66 Maßnahmen im vergangenen
Jahr fertig gestellt werden, 38 sind im Bau, 47 in Vorbereitung.
Zusätzlich konnten 77 weitere Maßnahmen auf
sanierungsbedürftigen Straßenabschnitten vorgezogen und angegangen
werden. Somit weist die Bilanz der Straßenerhaltungsmaßnahmen zum
Jahresende 2024 insgesamt 181 Maßnahmen und damit 30 mehr als
vorgesehen auf.
Ziel ist es, in den kommenden zehn
Jahren den sanierungsbedürftigen Anteil von Straßen, Brücken und
Tunneln in Nordrhein-Westfalen deutlich abzubauen. Das
NRW-Straßennetz besteht aus rund 17.000 Kilometer Straßen, mehr als
7.300 Brücken-Teilbauwerken in der Zuständigkeit des Landes sowie
weiteren Straßen und Brücken, für die der Bund und die Kommunen
zuständig sind.
Mit der im November 2023 gestarteten
Sanierungsoffensive geht NRW die große Herausforderung an, die
vorhandene Straßeninfrastruktur zukunftsfest zu machen. Bis Ende
2024 konnten 304 Kilometer an Bundes- und Landesstraßen fertig
saniert werden, 87 Kilometer Straßenkilometer sind derzeit in der
Realisierung. 12 Brücken wurden bereits durch Ersatzneubauten
ersetzt, 39 Brücken befinden sich derzeit in der Realisierung und
für das Ersatzneubautenprogramm 2025 sind 42 Brücken vorgesehen.
Der Erhalt der Infrastruktur, besonders der
Brücken, ist vielerorts aber akut gefährdet. "Wir haben uns
jahrzehntelang zu wenig um die vorhandene Infrastruktur gekümmert.
Das holt uns jetzt mit kaputten Brücken ein", sagte Oliver Krischer,
Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes
Nordrhein-Westfalen, bei einem Informationsbesuch zum Zustand der
Straßenbrückeninfrastruktur in Wipperfürth.
Allein in die
Zuständigkeit des Landes Nordrhein-Westfalen fallen derzeit
insgesamt 6.422 Brücken (7.308 Teilbauwerke), die durch den
Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen betreut werden. "Ein
großer Teil der Brücken in Nordrhein-Westfalen wurde in den 60er und
70er Jahren gebaut. Sie sind nicht für die heutigen
Verkehrsbelastungen ausgelegt. Eine Folge wird in den nächsten
Jahren und Jahrzehnten voraussichtlich ein vermehrt schlechterer
Zustand unserer Brücken sein, die deshalb vielfach saniert oder neu
gebaut werden müssen", sagte Minister Krischer.
"Da gibt
es eine Bugwelle, der wir begegnen, in dem wir der Sanierung, dem
Erhalt und dem Ersatz von Brücken Vorrang einräumen. Knappes Geld
und noch knappere Personalkapazitäten werden wir dort einsetzen
müssen, wo sie am dringendsten gebraucht werden."
Elektromobilität in Duisburg: Immer mehr Menschen installieren
Wallboxen zu Hause
Um Emissionen zu vermeiden, steigen
immer mehr Menschen in der individuellen Mobilität auf Elektroautos
um. Und gleichzeitig installieren sich immer mehr Besitzerinnen und
Besitzer von Elektroautos eine Wallbox, also eine eigene
Stromtankstelle für zu Hause.
Solche Wallboxen sind beim
Netzbetreiber anmeldepflichtig und eine Analyse der Zahlen in
Duisburg durch die Stadtwerke zeigt, dass die Zahl der privaten
Stromtankstellen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen ist.
Insgesamt sind in Duisburg 1.359 solcher Wallboxen beim
Netzbetreiber Netze Duisburg GmbH gemeldet. 276 dieser Wallboxen
sind erst im Jahr 2024 hinzugekommen.

Ein Blick auf die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt, wie
rasant diese Zahl gewachsen ist. Während im Jahr 2020 nur 23
Wallboxen angemeldet wurden, waren es im Jahr 2021 schon 355 und im
Jahr 2022 sogar 401. Seitdem ist die Zahl wieder leicht rückläufig,
aber noch immer auf hohem Niveau. 2023 wurden 293 neue Wallboxen
angemeldet.
Für alle Menschen in Duisburg, die ihre
Mobilität auf klimafreundliche Elektroantriebe umstellen wollen,
bieten die Stadtwerke Duisburg aktuell ein Bündelpaket bestehend aus
einer Wallbox zum Aufladen zuhause samt attraktivem Ladestromtarif
an. Die E-Mobility-Kombi umfasst die Wallbox Keba P30 PV inklusive
smarten Zubehör, die Installation der Wallbox sowie den passenden
Stromtarif PartnerStrom Vario. Eine Ladekarte zum Laden an den
öffentlichen Ladesäulen der Stadtwerke Duisburg im Wert von 50 Euro
gibt es obendrauf. Weitere Infos gibt es auch im Internet unter
https://www.swdu.de/emob-kombi.
Der PartnerStrom Vario
ist in zwei Varianten wählbar und berücksichtigt die
Netzentgeltreduzierung nach § 14a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG).
So können die Kunden eine pauschale (Modul 1) oder prozentuale
Erstattung (Modul 2) für die Dimmbarkeit ihrer Wallbox erhalten.
Auch Betreiber von Wärmepumpen, Klimaanlagen und
Stromspeichern mit einem Leistungsbezug von über 4,2 kW, weitere
sogenannte steuerbare Verbrauchseinrichtungen neben der Wallbox,
können den PartnerStrom Vario abschließen. Steuerbare
Verbrauchseinrichtungen dürfen im Falle einer festgestellten
Netzüberlastung temporär durch den Netzbetreiber „gedimmt“ werden.
Dimmung bedeutet in diesem Zusammenhang eine Reduzierung der
Leistung, die weiterhin mindestens 4,2 kW beträgt. Diese Dimmung
dient als Steuerungsmechanismus zur Vermeidung von Überlastungen im
Stromnetz. Die in den Tarifen enthaltene Netzentgeltreduzierung wird
Betreiberinnen und Betreibern somit aufgrund der Möglichkeit dieser
temporären Dimmung gewährt. Weitere Informationen gibt es im
Internet unter www.swdu.de/steuerbar.
Die Stadtwerke
Duisburg treiben auch den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur
kontinuierlich voran. Das Ziel ist, einen Bestand von 500
Ladepunkten aufzubauen. Schon heute betreibt der lokale
Energiedienstleister 206 Ladepunkte an 86 Standorten im Stadtgebiet.
Die Ladesäulen der Stadtwerke Duisburg sind an den Verbund
ladenetz.de angeschlossen, zu dem rund 260 Anbieter von
Ladeinfrastruktur gehören. Insgesamt stehen über 19.000 Ladepunkte
in ganz Deutschland zur Verfügung.
Durch
Kooperationen auf internationaler Ebene kommen europaweit rund
278.000 Ladepunkte hinzu. Kundinnen und Kunden der Stadtwerke
Duisburg können mit einer entsprechenden Stadtwerke-Ladekarte an
diesen Säulen ihr Elektroauto laden. Das Laden ist neben der
Ladekarte auch durch das Scannen des angebrachten QR-Codes oder der
„ladeapp“ an allen Ladestationen der Stadtwerke Duisburg möglich.
Somit gibt es auch die Möglichkeit, den Ladevorgang ganz bequem
spontan zu starten.
Eine Ladekarte der Stadtwerke
Duisburg können Interessierte über das Online-Formular unter
swdu.de/ladekarte bestellen. Kundinnen und Kunden profitieren dabei
von einem Preis-Vorteil in Höhe von 60 Euro im Jahr.
Die
Energieberaterinnen und -berater der Stadtwerke Duisburg stehen
Interessierten bei allen Fragen rund um die Elektromobilität von der
Fahrzeugauswahl bis zur heimischen Lade-Wallbox samt passendem
Stromtarif telefonisch unter 0203-604 1111 zur Verfügung. Weitere
Informationen gibt es auch im Internet auf
https://www.stadtwerke-duisburg.de/emob-p.
Auch
Geschäftskunden, die ihren gesamten Fuhrpark auf Elektroautos
umstellen wollen, erhalten bei den Stadtwerken kompetente Beratung
zu möglichen Fahrzeugmodellen und Planung einer effizienten
Ladeinfrastruktur auf dem eigenen Firmengelände. Weitere
Informationen gibt es auch hierzu im Internet unter
https://www.stadtwerke-duisburg.de/emob-g.
Ruhrgebietsstädte mit hoher Solaranlagendichte Ruhrgebiet
Duisburg (8.525 bzw. 16,97) auf Platz zwölf
Beim Ausbau
der Solarenergie ist das Ruhrgebiet ganz vorne mit dabei. Das zeigt
der Photovoltaik-Monitor des Energieunternehmens Enpal, für den
Zuwachs sowie Bestand von Photovoltaikanlagen 2024 in den 20 größten
deutschen Städten untersucht wurden. In Dortmund wurden im
vergangenen Jahr 3.961 neue Solaranlagen neu in Betrieb genommen,
das entspricht 6,68 Anlagen je 1.000 Einwohnern.
Damit
liegt die Stadt auf Platz fünf im bundesweiten Kommunenranking der
Neu-Anlagen. Auf Rang sieben und acht folgen Bochum und Duisburg mit
6,02 bzw. 5,67 Anlagen pro 1.000 Einwohnern. Mit 5,63 neuen
Anlagen/1.000 Einwohnern liegt auch Essen auf Platz zehn in der
oberen Hälfte.
Beim Vergleich des Grundbestandes von
PV-Anlagen in den 20 größten Städten, landet Dortmund mit 14.087
Photovoltaikanlagen oder 23,74 Anlagen je 1.000 Einwohnern auf Platz
vier. Bochum rangiert mit 7.155 bzw. 19,56 direkt dahinter. Essen
(10.847 bzw. 18,56) wird auf Platz sieben gelistet, Duisburg (8.525
bzw. 16,97) auf Platz zwölf. In die Analyse flossen rund 4,8
Millionen Installationen von Solaranlagen aus dem
Marktstammdatenregister ein. idr - Infos:
https://www.enpal.de/photovoltaik#info
Eigenheimbesitzer wollen in Solaranlagen, Wärmepumpen und
Elektroautos investieren – politische Vorlieben spielen fast keine
Rolle
Hausbesitzer, die im eigenen Haus leben, planen in
hohen Anteilen die Anschaffung neuer Energietechnologien: Bis 2029
wollen zwei Drittel der Eigenheimbewohner in Deutschland eine
Solarstromanlage betreiben – fast doppelt so viel wie heute. Bei
Wärmepumpen und Elektroautos übersteigen die Anschaffungspläne die
heutige Verbreitung sogar deutlich. Dieser Trend ist unabhängig von
der Parteipräferenz. Zu diesen Ergebnissen kommt eine repräsentative
Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach unter mehr als 4.000
selbstnutzenden Hauseigentümern.
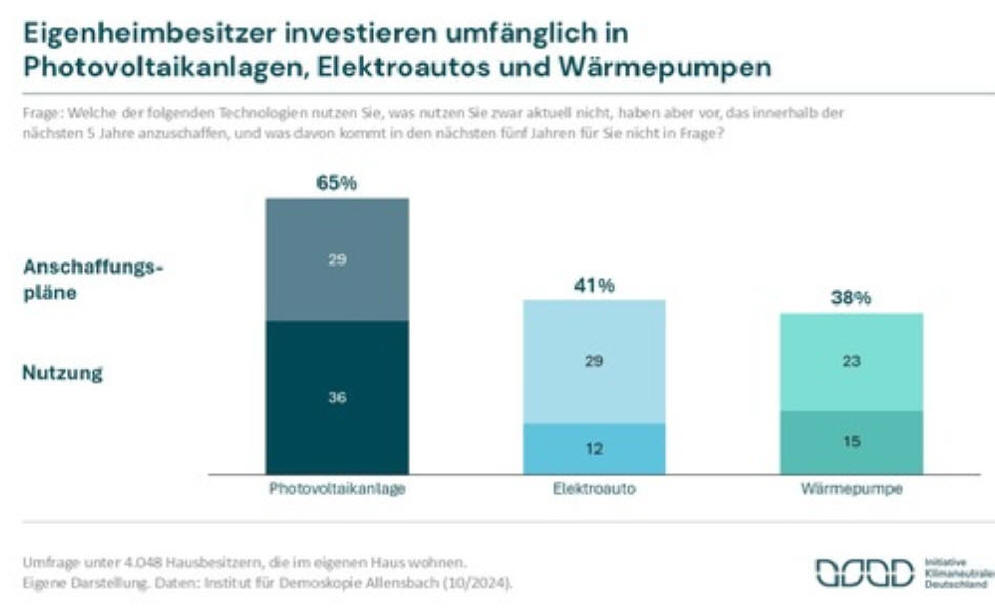
Bis 2029 könnten demnach 65 Prozent aller Eigenheimbewohner in
Deutschland eine Solarstromanlage besitzen, 41 Prozent ein
Elektroauto und 38 Prozent eine Wärmepumpe. Das ist beinahe eine
Verdoppelung bei Solaranlagen (derzeit 36 Prozent), mehr als eine
Verdoppelung bei Wärmepumpen (aktuell 15 Prozent) und mehr als eine
Verdreifachung bei Elektroautos (aktuell 12 Prozent).
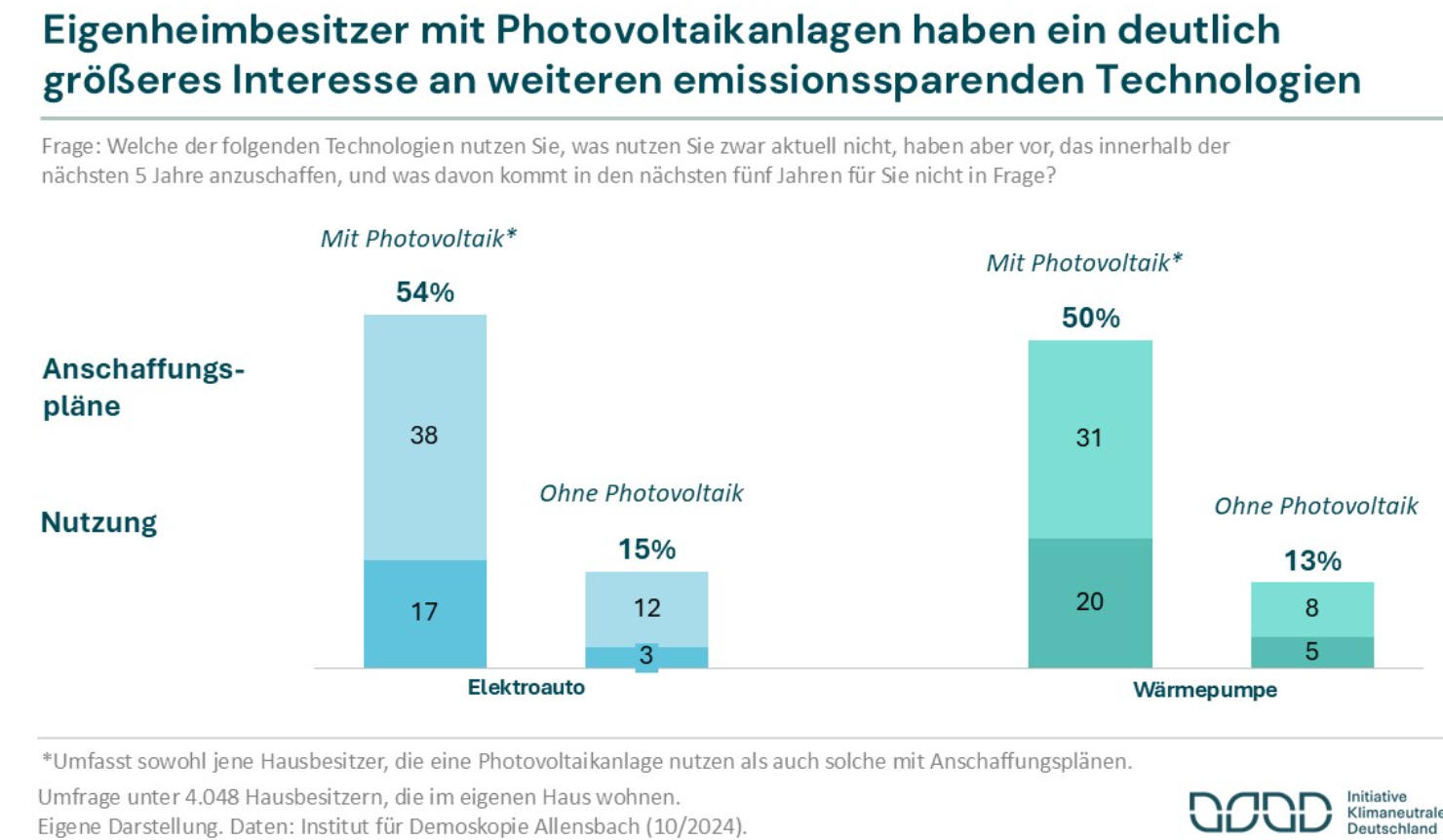
Solaranlagen kommt dabei eine Schlüsselrolle zu: So zeigen
Hausbesitzer, die bereits heute ihren eigenen Solarstrom erzeugen
oder die Installation einer Solaranlage planen, ein sehr hohes
Interesse, auch in Wärmepumpen und Elektroautos zu investieren. Ihr
Anteil ist viermal größer als bei Hausbesitzern ohne
Solarstromanlage bzw. entsprechenden Anschaffungsplänen. Dieser
Zusammenhang gilt unabhängig von Einkommen und politischen
Vorlieben.
•
Parteipolitische Präferenzen spielen kaum eine Rolle
Die Umfrage zeigt, dass parteipolitische Präferenzen von
Hauseigentümern bei der Technologiewahl insgesamt nur eine
untergeordnete Rolle spielen. Jeweils rund ein Drittel der Wähler
von Union (37 Prozent), SPD (37 Prozent), FDP (44 Prozent), AfD (34
Prozent) und BSW (28 Prozent) haben bereits eine PV-Anlagen
installiert. Bei den Unterstützern der Grünen (50 Prozent) und der
Linken (50 Prozent) ist es sogar jeder zweite.
Auch bei den
Anschaffungsplanungen für PV-Anlagen zeichnet sich ein über
Parteipräferenzen hinweg ausgeglichenes Bild ab: 34 Prozent der
Grünen-Wähler, 33 Prozent der BSW-Wähler und 32 Prozent der
SPD-Wähler unter den Eigenheimbesitzern planen bis 2029 eine
Investition, gefolgt von jeweils 30 Prozent bei Unions- und 29
Prozent bei FDP-Wählern. Damit liegt die Investitionsbereitschaft
bei diesen Wählern im Bundesdurchschnitt von 29 Prozent. Bei den
Unterstützern der Linken (25 Prozent) und der AfD (23 Prozent) ist
die Bereitschaft zum Kauf einer Solarstromanlage etwas geringer als
im Bundesdurchschnitt.
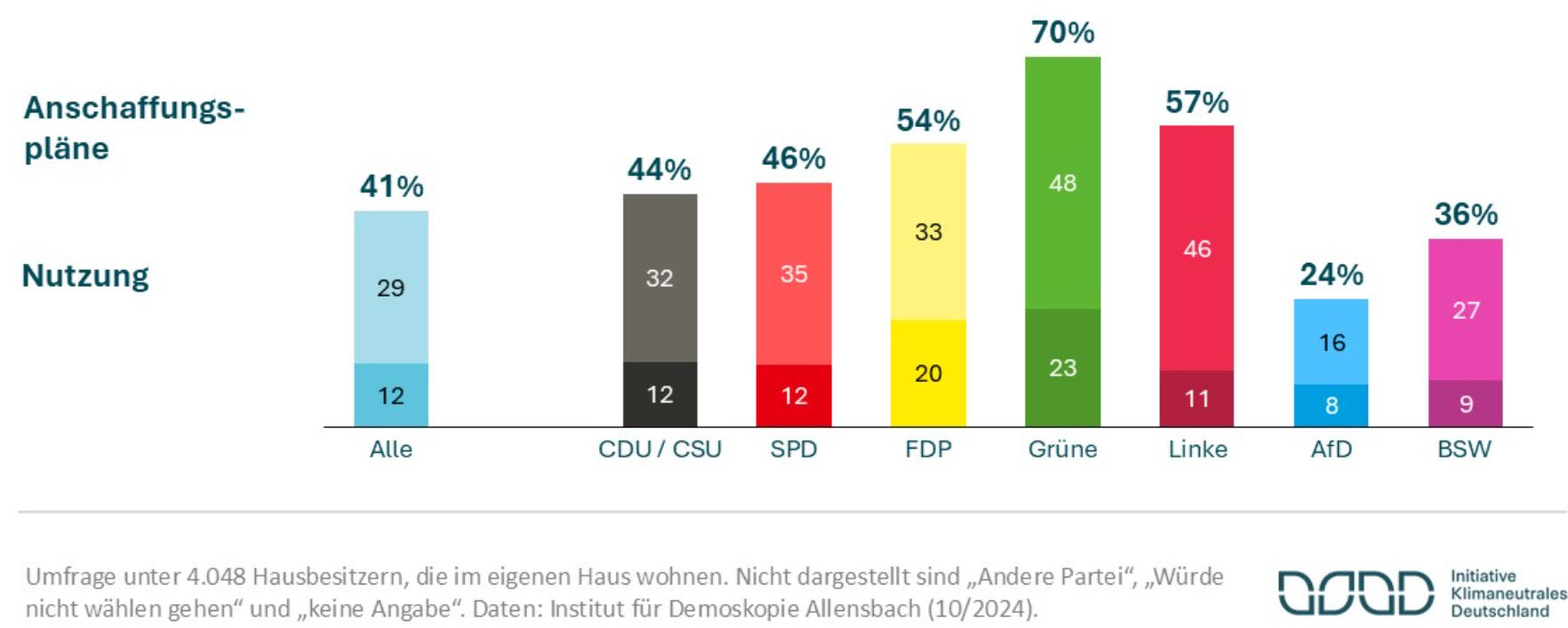
„Unsere Daten zeigen, dass die Investitionspläne von
Hausbesitzern in moderne Energietechnologien relativ wenig von
Parteipräferenzen abhängen. Vielmehr stehen insbesondere bei der
Investition in Photovoltaikanlagen – der zentralen Technologie in
diesem Feld – finanzielle Erwägungen im Vordergrund. Den Ausbau
privater Photovoltaikanlagen voranzubringen, erwarten Hausbesitzer
dabei erstaunlicherweise nicht nur von den Grünen, sondern auch von
der CDU.“, sagt Dr. Steffen de Sombre vom Institut für Demoskopie
Allensbach, der die Studie verantwortet hat.
•
Investitionsbereitschaft löst sich von der Höhe des
Haushaltseinkommens
Bisher war die Frage, ob Eigenheimbesitzer in
Solaranlagen, Wärmepumpen oder Elektroautos investieren, stark vom
Einkommen abhängig. So finden sich in rund der Hälfte der Haushalte
mit einem monatlichen Nettoeinkommen von 5.000 Euro und mehr schon
heute eine Solarstromanlage auf dem Dach. Bei Haushaltseinkommen von
bis zu 2.500 Euro ist das nur bei 24 Prozent der Eigenheimbesitzer
der Fall, bei Einkommen von 2.500 Euro bis unter 5.000 Euro hingegen
bei 35 Prozent der Hauseigentümer.
Die Umfrage zeigt nun,
dass das Haushaltseinkommen für die Investitionsbereitschaft in
Solaranlagen keine dominierende Rolle spielt: Bei Haushaltseinkommen
von mehr als 2.500 Euro im Monat streben über alle Einkommensklassen
hinweg rund 30 Prozent der Hauseigentümer den Bau einer
Solarstromanlage an. Ähnlich hoch ist der Anteil der Haushalte mit
einem Einkommen von 2.500 Euro bis 5.000 Euro, die ein Elektroauto
anschaffen wollen (30 Prozent).
Bei der Wärmepumpe fällt die
Anschaffungsbereitschaft hingegen etwas kleiner aus. Sie liegt bei
Werten von 23 Prozent in der Einkommensklasse von 2.500 bis 5.000
Euro und 31 Prozent bei den Haushalten mit einem Einkommen von mehr
als 7.500 Euro.
Hauseigentümer, die bisher keine Investition
in Erwägung ziehen, nennen hierfür über alle drei Technologien
hinweg die Anschaffungskosten als Hauptgrund. Das betrifft vor allem
die Befragten mit einem Haushaltseinkommen von weniger als 2.500
Euro. Hier ist die Anschaffungsbereitschaft auch am geringsten.
Umgekehrt nennt allerdings die Mehrheit der Eigenheimbesitzer,
die moderne Energietechnologien bereits nutzen oder deren
Anschaffung planen, die Ersparnis bei den Energiekosten als
Motivation: Bei den Betreibern von Photovoltaikanlagen sind es 81
Prozent, bei jenen von Wärmepumpen 58 Prozent. Bei denjenigen, die
ein Elektroauto fahren oder anschaffen wollen, geben 43 Prozent als
Grund an, dass sie zuhause laden können.
„Diese Zahlen
zeigen, dass Technologien wie Wärmepumpen und Elektroautos längst
vor allem im ländlichen Raum angekommen sind. Hier gehen
Pragmatismus und technologische Aufgeschlossenheit vor Ideologie.
Mit den richtigen Rahmenbedingungen kann die nächste Bundesregierung
diesen Technologieboom verstetigen. Davon würde neben den
Hausbesitzern auch der deutsche Mittelstand profitieren, also
Hersteller und Installateure.", sagt Carolin Friedemann, Gründerin
und Geschäftsführerin der Initiative Klimaneutrales Deutschland
(IKND). Die Initiative hatte die Umfrage in Auftrag gegeben.
Peter Wegner, Präsident des Verbands Wohneigentum, ergänzt: „Nach
den harten Debatten scheint das Gebäudeenergiegesetz allmählich auf
der Sachebene anzukommen. Hauseigentümerinnen und -eigentümer
erwarten schlicht, dass die kommende Bundesregierung vernünftige und
– ganz wichtig – verlässliche Investitionsbedingungen schafft.
Flankiert werden müssen diese durch niedrigschwellige Beratungs- und
Informationsangebote.“
Die Umfrage ist vor dem Hintergrund
entstanden, dass rund 80 Prozent der Wohngebäude in Deutschland Ein-
oder Zweifamilienhäuser sind und darin 41,5 Millionen Menschen leben
– vielfach in kleinen Städten und auf dem Land. Diese Menschen sind
von den Transformationsthemen Energieerzeugung, zukunftsfähiges
Heizen und Autofahren besonders betroffen.
Duisburger Architektur des Jugendstils und Art Déco
Das Stadtarchiv Duisburg, Karmelplatz 5 am Innenhafen,
lädt am Donnerstag, 6. Februar, um 18.15 Uhr in Kooperation mit der
MercatorGesellschaft zu einem Vortrag von Karina Sosnowski ein.
Thema des Abends in der Reihe „Stadtgeschichte donnerstags“ ist die
„Duisburger Architektur des Jugendstils und Art Déco von Hanns
Wissmann, Wilhelm Brenschede u. a.“
Um 1900 befindet
sich das Gebiet der Kunstproduktion und Architektur in einer
hochspannenden Phase. Der akademischen, traditionellen und
konservativen Formensprache stellen sich immer mehr progressive
Kräfte entgegen, die — vom Geist der Moderne getrieben — eine
erneuerte, reformierte Kunstproduktion fordern. Das Fundament für
den Jugendstil und das Art Déco bildet die englische „Arts &
Crafts-Bewegung“, die die moderne Kunstproduktion auf dem
europäischen Kontinent stark beeinflusst.
Form, Funktion
und dekorative Wirkung bilden das Primat in der Kunstvorstellung
bedeutender Kunsttheoretiker der Zeit, die selbst als Künstler tätig
waren. In dieser Zeit wird die Vorstellung von der Einheit der
Künste und damit des „Gesamtkunstwerkes“ geboren. Hermann Muthesius
ist einer der wichtigsten Botschafter der „Arts & Crafts Bewegung“
im wilhelminischen Kaiserreich und wird um 1910 in Duisburg-Duissern
stadtplanerisch tätig.
Auf der Keetmanstraße, die in das
stadtplanerische Gebiet Muthesius‘ fällt, befinden sich besonders
schöne Beispiele der Art Déco-Architektur von Wissmann und
Brenschede, die zu dieser Zeit ein gemeinsames Duisburger
Architekturbüro betreiben. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.

Gebäude in Duissern im Stile des Art Déco (2024) - Foto Karina
Sosnowski
Duisburger Akzente 2025 mit
hochkarätigem Literaturprogramm
Ein breitgefächertes
Literaturprogramm greift das diesjährige Thema der 46. Duisburger
Akzente „SEIN und SCHEIN“ auf. Die Stadtbibliothek und der „Verein
für Literatur Duisburg“ haben ein vielfältiges Angebot
zusammengestellt. Alle Veranstaltungen finden in der
Zentralbibliothek, Steinsche Gasse 26, statt.
Die
Lesungen sind jeweils von 20 bis 22 Uhr. Zum Auftakt am Dienstag,
18. März, ist der Bochumer Revier-Autor Frank Goosen
mit einem eigens für den Abend zusammengestellten Programm
zu Gast. In „Mein Ich und seine Bücher“ liefert er einen Überblick
über sein literarisches Schaffen.
Am Freitag, 21. März,
stellt Autorin Olga Grjasnowa im Gespräch mit
Wolfgang Schwarzer ihren Roman „Juli August September“ vor.
In
diesem schildert sie die Geschichte „einer ganz normalen jüdischen
Familie in Berlin“, die weniger normal ist, als sie auf den ersten
Blick scheint. Es ist ein Roman über eine Frau, deren Identität sich
aus lauter Splittern zusammensetzt, die scheinbar alle nicht
zusammenpassen – bis sie es auf unerwartete Weise doch tun.
Ein weiteres Highlight: Schauspieler und Synchronsprecher
Christian Brückner liest am Dienstag, 25. März, aus „Die
vertauschten Köpfe“. Die Erzählung ist Thomas Manns
satirisch-poetische Antwort auf den Rassenwahn der NS-Diktatur, die
den Literaturnobelpreisträger wie zahlreiche andere Schriftsteller
1933 ins Exil gezwungen hat.
Am Freitag, 28. März,
präsentiert Michael Kumpfmüller seinen Roman „Wir
Gespenster“, in dem die ermordete Lilli versucht, ihren eigenen Tod
aufzuklären. In Kooperation mit der Gesellschaft für
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit wurde Shelly Kupferberg
eingeladen. Die Autorin liest am Montag, 31. März, aus
„Isidor“. In dem Werk begibt sie sich auf die Spuren ihres
Großonkels Isidor Geller – einer schillernden Persönlichkeit, die
ihren Weg aus dem ärmlichen ostgalizischen, jüdisch-orthodoxen
Milieu nach Wien machte, und dort erfolgreicher Jurist,
Kommerzialrat und Berater des österreichischen Staates wurde.
Abgerundet wird das Programm der Bibliothek in diesem Jahr
durch zwei Veranstaltungen zur Nacht der Bibliotheken am
Freitag, 4. April. Ab 19 Uhr präsentieren Lale
Öztürk, Morea Remy und Jay Nightwind auf der Bühne im
Stadtfenster ein Feuerwerk der Comedy-Kunst. Um 19 Uhr und um 20.30
Uhr bietet Manfred Bellingrodt einen Fotoworkshop an.
Bei
einer Foto-Tour durch die Bibliothek lernen die Teilnehmenden, wie
man mit einfachen Techniken mit Kamera oder Smartphone besondere
Aufnahmen erschaffen und Geschichten erzählen kann. Weitere
Informationen, der Online-Ticketshop und die Anmeldung zu den
Workshops finden sich auf www.stadtbibliothek-duisburg.de. Karten
für die Lesungen (ab 6 Euro im Vorverkauf) sind auch bei den
bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.
Vorlesespaß in Ruhrort
Die Stadtteilbibliothek Ruhrort,
Amtsgerichtsstraße 5, lädt am Freitag, 7. Februar, ab 16 Uhr kleine
Leute ab vier Jahren zu einer Vorleseveranstaltung ein. Es werden
spannende und lustige Geschichten erzählt, die die Fantasie anregen
und zum Mitmachen einladen. Ob Abenteuergeschichten, Märchen oder
lustige Erzählungen – für jeden Geschmack ist etwas dabei.
Nach dem Vorlesen können die Kinder ihrer Kreativität freien
Lauf zu lassen und gemeinsam basteln. Anmeldungen sind online auf
der Seite www.stadtbibliothek-duisburg.de (unter „Veranstaltungen“)
möglich. Fragen beantwortet das Team gerne persönlich oder
telefonisch unter 0203 89729. Geöffnet hat die Stadtteilbibliothek
Ruhrort mittwochs und donnerstags von 14 bis 18 Uhr, freitags von
10.30 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr.
SchoKi-Programm in der Stadtteilbibliothek Ruhrort
Die Stadtteilbibliothek Ruhrort, Amtsgerichtsstraße 5 lädt am
Freitag, 14. Februar, um 16 Uhr alle kleinen Geschichtenfans von
zwei bis drei Jahren und ihre Eltern zu einer besonderen
Veranstaltung ein. Unter dem Motto „Mit Büchern wachsen“ wird ein
Bilderbuch vorgestellt – begleitet von Spielen, Liedern und jeder
Menge Spaß. Dabei steht nicht das Lesenlernen im Vordergrund,
sondern das gemeinsame Erleben von Geschichten.
Beim
SchoKi-Programm dreht sich alles um die spielerische Sprachförderung
und die Freude an Büchern. Natürlich dürfen die Kinder auch gerne
von einem Großelternteil oder einer anderen erwachsenen Person
begleitet werden. Die Teilnahme ist kostenfrei.
SchoKi-Veranstaltungen finden in allen Duisburger Bibliotheken
regelmäßig statt. Anmeldungen sind bequem online auf
www.stadtbibliothek-duisburg.de möglich. Geöffnet hat die
Stadtteilbibliothek Ruhrort mittwochs und donnerstags von 14 bis 18
Uhr, freitags von 10.30 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, samstags von 10
bis 13 Uhr.
Highspeed-Internet für Huckingen:
Infoveranstaltung der DCC am 12. Februar
Die Duisburg
CityCom (DCC) veranstaltet für alle Anwohnerinnen und Anwohner in
Huckingen am Mittwoch, 12. Februar, einen Infoabend. Ab 18.30 Uhr
werden in der Festhalle des Steinhofs, Düsseldorfer Landstr. 347,
alle individuellen Fragen rund um das Thema Glasfaseranschluss
beantwortet. Zur besseren Planung wird um eine Voranmeldung auf
glasfaserduisburg.de/info-huckingen gebeten. Auf dieser
Internetseite gibt es außerdem alle Infos rund um die erreichte
Quote, den geplanten Ausbau sowie den aktuellen Stand des Projektes.
Zuvor hatte die DCC für die Planung des flächendeckenden
Ausbaus des Glasfasernetzes im Stadtteil Huckingen im Jahr 2025 um
die Unterstützung der Anwohnerinnen und Anwohner gebeten.
Interessentinnen und Interessenten können sich bis Ende April
registrieren, um die erforderliche Quote von 30 Prozent zu
erreichen. Sobald diese Anzahl der Haushalte in Huckingen ihr
Interesse an einem Anschluss bekunden, beginnt der Ausbau.
Im Rahmen dieser Nachfragebündelung entfallen für alle
Interessentinnen und Interessenten die Ausbau- und Anschlusskosten
in Höhe von 850 Euro. Außerdem gibt es das schnellste Internet schon
ab 19,99 Euro pro Monat. Weil die DCC den Anschluss bis in die
Wohnung verlegt (Fiber To The Home), sind allerschnellste
Datenübertragungsraten möglich. So sind beim Produkt „Glasfaser Home
1000“ beispielsweise 1000 Mbit/s Download und 500 Mbit/s Upload
gleichzeitig möglich. Der Hausanschluss ans Glasfasernetz ist im
Rahmen dieses Trassenausbaus kostenlos.
Weitere
Informationen zu Angeboten und Tarifen der DCC – auch außerhalb von
Huckingen – gibt es im Internet auf der Seite glasfaserduisburg.de.
Dort finden Interessierte auch Ansprechpartner, die von Montag bis
Freitag erreichbar sind: Für Privathaushalte unter 0203/604-2001 (8
bis 20 Uhr) oder per Mail unter service@duisburgcity.com sowie für
Geschäftsleute unter 0203/604-3222 (8 bis 16 Uhr) oder per Mail
unter kundenservice@duisburgcity.com. Darüber hinaus ist der
Kundenservice für alle Fragen rund um die Angebote für
Privathaushalte auch samstags von 8 bis 18 Uhr erreichbar.
Workshop: 3D-Druck-Führerschein in
der Zentralbibliothek
Die Zentralbibliothek, Steinsche
Gasse 26 in der Duisburger Innenstadt, bietet in den kommenden
Wochen mehrere Einführungs-Workshops zum 3DDruck in ihrer MachBar
an. Interessierte ab 14 Jahren erhalten in kleinen Gruppen von
maximal vier Personen einen Einblick in die Möglichkeiten dieser
Technik, mit der von der Herstellung eines lustigen Gadgets bis zu
einem nützlichen Tool vieles möglich ist. Der erste Termin ist am
Dienstag, 18. Februar, um 16 Uhr.

Bis Mitte Juli wird
der Workshop jeweils zweimal monatlich an unterschiedlichen
Wochentagen und zu verschiedenen Zeiten angeboten. Am Ende des
90-minütigen Workshops erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
einen 3D-Druck-Führerschein, mit dem sie zukünftig den Rechner und
Drucker in der MachBar eigenständig für ihre Projekte nutzen können.
Das Angebot ist kostenlos, Voraussetzungen ist ein gültiger
Bibliotheksausweis und ein Mindestalter von 14 Jahren. Alle Termine
und die Möglichkeit zur Anmeldung sind online auf
www.stadtbibliothek-duisburg.de (unter „Veranstaltungen“) zu finden.
Ökumenisches Friedensgebet in Salvator vor
Menschenkette und Lichtermeer am Innenhafen
Evangelische und katholische Kirche sind zusammen mit Caritas und
Diakonie Teil des Bündnisses für Toleranz und Zivilcourage Duisburg
und rufen deshalb mit zur Menschenkette am 14. Februar am Innenhafen
auf, die dort ein Lichtermeer bilden wird. „Wir setzen damit
gemeinsam ein Zeichen gegen Ausgrenzung, Antisemitismus und
Rassismus, ein Zeichen für ein respektvolles Miteinander in
Vielfalt“ sagen Superintendent Dr. Christoph Urban und Stadtdechant
Andreas Brocke.
Sie laden die Gläubigen im Namen der
beiden Kirchen und Wohlfahrtsverbände auch vorab zu einem
„Ökumenischen Friedensgebet für Demokratie und Vielfalt“ um 17.30
Uhr in die benachbarte Salvatorkirche. Von dort aus gehen
anschließend alle gemeinsam zum nahen Innenhafen, der von 18 bis
18.30 Uhr zum Lichtermeer werden soll. Neben den Kerzen sollen keine
weiteren Symbole oder Fahnen mitgebracht werden – „getrennt in den
Farben, vereint in der Hoffnung“ heißt dazu auch im Aufruf des
Bündnisses.
Das Bündnis für Toleranz und Zivilcourage ist ein Zusammenschluss
zivilgesellschaftlicher Organisationen und Einrichtungen aus
Duisburg. Mitglieder sind u. a. der DGB, die katholische und
evangelische Kirche, jüdische Gemeinde, der AWO, Caritas, Diakonie,
Paritätische Duisburg, der Jugendring mit den Duisburger
Jugendverbänden, der Stadtsportbund und viele mehr.
Land NRW unterstützt Schlaraffenband Ruhr
Das
Schlaraffenband Ruhr gehört zu den elf Projekten, die durch das
NRW-Umweltministerium im Programm "Qualifizierung des
bürgerschaftlichen Engagements" unterstützt werden. Ein
Beratungsbüro wird sie über einen Zeitraum von bis zu zwölf Monaten
bei der Umsetzung der konkreten Maßnahmen beraten.
Mit
dem Schlaraffenband Ruhr wollen die Ernährungsräte Essen, Bochum und
Dortmund sogenannte Naschorte entlang von Radwegen im Ruhrgebiet
schaffen, z. B. am RuhrtalRadweg und dem künftigen Radschnellweg
RS1. Alle fünf Kilometer sollen Rastmöglichkeiten entstehen, wo
Obstbäume, Beerensträucher und Kräuter wachsen. Radfahrer und
Spaziergänger können dort eine Pause einlegen und kostenlos naschen.
idr - Infos:
http://www.ptj.de/projektfoerderung/buergerschaftliches-engagement/qualifizierung
Petrus zwischen Jerusalem und Rom -
Süd-Gemeinde lädt zum Bibel-Abend-Essen
Auf die
Spuren von Petrus begeben sich am 14. Februar um 18 Uhr
Besucherinnen und Besucher des im Huckinger Gemeindehauses,
Angerhauser Straße 91. Leitfaden des Abends, zu dem die Evangelische
Versöhnungsgemeinde Duisburg-Süd herzlich einlädt, ist die Bibel,
doch die Reisen des Apostels zwischen Jerusalem und Rom sollen mit
allen Sinnen erfahrbar werden. Dazu gehört mediterranes Essen mit
Wein und anderen Getränken.
Der Abend soll auch
bewegend werden, denn im passend dekorierten Gemeindehaus werden die
biblischen Texte an verschiedenen Orten gelesen und die einzelnen
Gänge verspeist. Hinzukommen viele Hintergrundinformationen, die die
Bibeltexte in die damalige Welt einordnen helfen. Für Essen und
Getränke sollten Interessierte 10 Euro einplanen.
Anmeldungen sind bei Christine Ahrens (christine.ahrens@ekir.de),
Pfarrerin Ulrike Kobbe (0203 9331907), Pfarrer Bodo Kaiser (0203
60847747) oder Pfarrer Ernst Schmidt (0203 39203597) möglich. Infos
zur Gemeinde gibt es im Netz unter
www.evgds.de.
Abendessen nach dem
Gottesdienst - Durchblicke-Team lädt in die Obermeidericher Kirche
ein
Das Team um Hans-Bernd Preuß hat ein neues Thema
für den nächsten „Durchblicke-Gottesdienst“ vorbereitet und lädt zur
Feier herzlich in die evangelische Kirche Duisburg Obermeiderich,
Emilstraße 27, ein. Dort geht es am Sonntag, 9. Februar 2025 um 18
Uhr mit viel Musik, Texten, Liedern, Gebeten und Impulsen um die
Aufforderung der Jahreslosung: Prüfet alles und behaltet das Gute!
Übrigens: Nach dem Gottesdienst ist wie immer die
Gelegenheit, bei Abendessen und Getränken gute Begegnungen
miteinander zu erleben. Auch dazu lädt das Durchblicke-Team herzlich
ein. Weitere Infos zum Gottesdienstformat gibt es im Netz unter
www.obermeiderich.de/durchblicke. Im Anhang senden wir Ihnen ein
Bild, das Musikerinnen und Musiker beim Gottesdienst September 2023
zeigt, zur honorarfreien Verwendung (Foto: Michael Rogalla,
www.obermeiderich.de).
Pfarrer
Blank am nächsten Freitag in der Duisburger Kircheneintrittsstelle
Immer freitags können Unsichere, Kirchennahe oder solche, die es
werden möchten, in der Eintrittsstelle in der Salvatorkirche mit
Pfarrerinnen, Pfarrern und Prädikanten ins Gespräch kommen und über
die Kirchenaufnahme reden. Motive für den Kircheneintritt gibt es
viele: Die Suche nach Gemeinschaft, Ordnung ins Leben bringen oder
der Wunsch, Taufen, Hochzeiten, Bestattungen kirchlich zu gestalten.
Aufnahmegespräche führt das Präsenzteam in der
Eintrittsstelle an der Salvatorkirche immer freitags von 14 bis 17
Uhr. Am Freitag, 7. Februar 2025 heißt Pfarrer Stephan Blank
Menschen in der Südkapelle des Gotteshauses neben dem Rathaus
herzlich willkommen. Infos zur Citykirche gibt es unter
www.salvatorkirche.de.

50 % der Erwachsenen in Deutschland sind verheiratet
Zahl und Anteil der Verheirateten binnen 30 Jahren
nahezu kontinuierlich gesunken: 1993 waren noch 60 % der Bevölkerung
ab 18 Jahren verheiratet
Jede zweite erwachsene Person in
Deutschland ist verheiratet. Das entsprach 35,0 Millionen Menschen,
die Ende 2023 in einer Ehe lebten. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) zum Welttag der Ehe am 9. Februar mitteilt, waren das gut
50 % der Bevölkerung ab 18 Jahren hierzulande. Zahl und Anteil der
Verheirateten sinken jedoch seit Jahren nahezu kontinuierlich: 30
Jahre zuvor hatten noch rund 39,3 Millionen volljährige Menschen in
einer Ehe gelebt, das waren 60 % aller Erwachsenen.
Jede
dritte erwachsene Person ist ledig – Anteil deutlich gestiegen Im
selben Zeitraum stieg die Zahl der volljährigen ledigen Personen und
ihr Anteil an der Bevölkerung ab 18 Jahren deutlich. Ende 2023 waren
22,6 Millionen Menschen ab 18 Jahren ledig, also nicht verheiratet,
verwitwet oder geschieden. 1993 waren gut 15,8 Millionen Erwachsene
ledig. Der Anteil der Ledigen an der Bevölkerung ab 18 Jahren ist
binnen 30 Jahren von 24 % auf rund 33 % gestiegen.
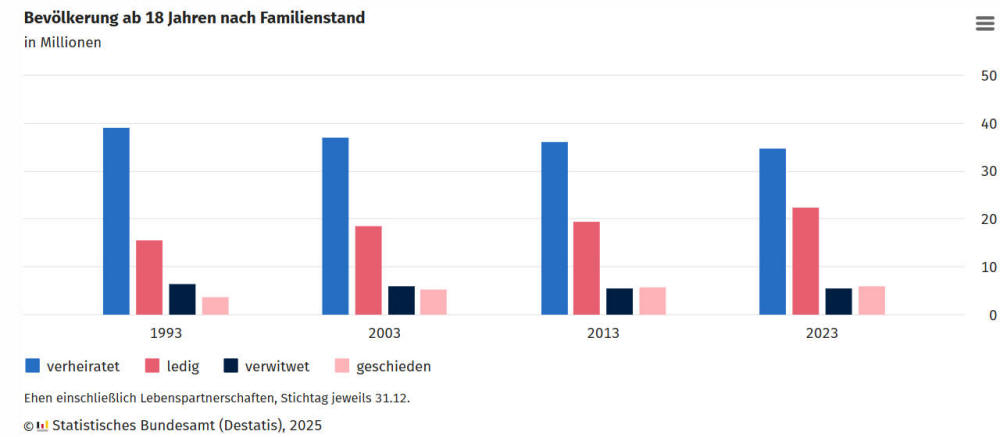
Durchschnittsalter bei der ersten Heirat auf neuem Höchststand
Dass der Anteil der Verheirateten seit Jahren schrumpft, geht auch
damit einher, dass die Menschen bei ihrer ersten Heirat immer älter
sind – sofern sie überhaupt heiraten.
Das Durchschnittsalter
bei der ersten Eheschließung ist binnen 30 Jahren um rund sechs
Altersjahre gestiegen und hat einen neuen Höchststand erreicht: Im
Jahr 2023 waren Frauen bei ihrer ersten Heirat im Schnitt 32,8 Jahre
alt, Männer 35,3 Jahre.
1993 hatte das Durchschnittsalter bei
der ersten Eheschließung für Frauen bei 26,8 Jahren und für Männer
bei 29,2 Jahren gelegen.
Zahl der Eheschließungen auf
zweitniedrigstem Stand seit 1950
Die Zahl der Eheschließungen
insgesamt ist langfristig rückläufig. 2023 wurden insgesamt
361 000 Ehen geschlossen, das war der zweitniedrigste Stand seit
1950. Mehr als drei Viertel (78 %) der 722 000 Eheschließenden
heirateten zum ersten Mal, waren zuvor also weder geschieden noch
verwitwet.
Gut 97 % der Ehen schlossen Paare
unterschiedlichen Geschlechts und knapp 3 % Paare gleichen
Geschlechts. Nach der Einführung der Ehe für alle im Oktober 2017
gehen seit dem Berichtsjahr 2018 auch gleichgeschlechtliche
Eheschließungen in die Statistik ein.
NRW: 2024
wurden vier Prozent weniger Strauchbeeren geerntet
Im
Jahr 2024 haben 149 nordrhein-westfälische Betriebe auf 1 076 Hektar
Anbaufläche 7 596 Tonnen Strauchbeeren produziert. Wie das
Statistische Landesamt anhand endgültiger Ergebnisse der
Strauchbeerenerhebung mitteilt, war die Erntemenge damit um vier
Prozent geringer als im Vorjahr (2023: 7 914 Tonnen).
Damit sank die Erntemenge das zweite Jahr in Folge und liegt auf dem
Niveau von 2021. Im Vergleich zum Jahr 2012 (damals: 3 511 Tonnen)
hat sich die Erntemenge mehr als verdoppelt. Die Landwirte im
Regierungsbezirk Köln verzeichneten gut die Hälfte der landesweiten
Erntemenge (55,7 Prozent).
Auf rund 40 Prozent der
Freilandfläche wurden Heidelbeeren angebaut
Mit einer
Anbaufläche von 904 Hektar wurden Strauchbeeren in NRW im
vergangenen Jahr überwiegend im Freiland kultiviert. Die
anbaustärkste Strauchbeerenart ist nach wie vor die
Kulturheidelbeere, deren Anbaufläche mit 355 Hektar mehr als ein
Drittel (39,3 Prozent) der gesamten Freilandfläche für Strauchbeeren
beansprucht. Es folgten rote und weiße Johannisbeeren (243 Hektar)
und schwarze Johannisbeeren (95 Hektar).
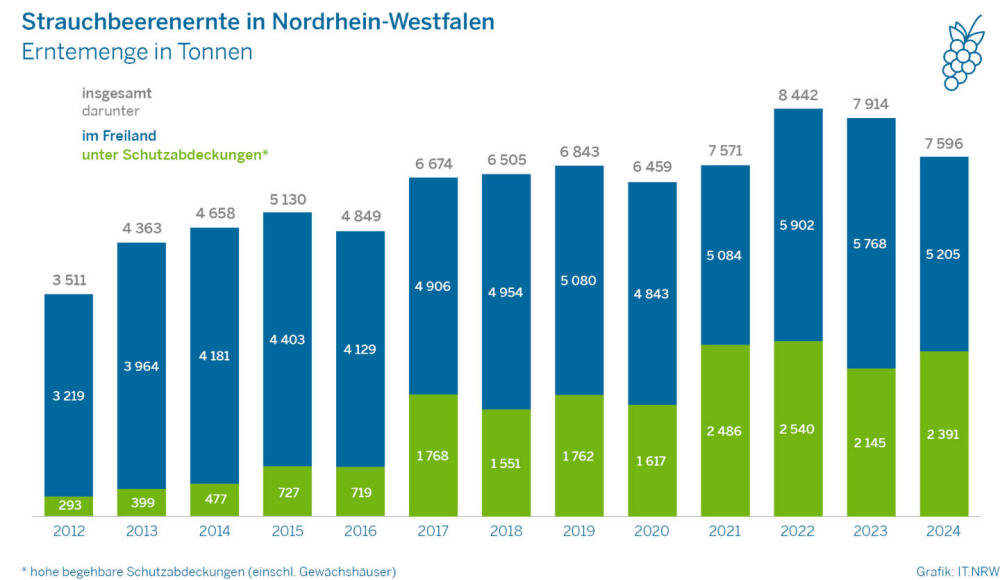
Von den 5 205 Tonnen im Freiland geernteten Strauchbeeren
entfielen 2 103 Tonnen auf die Kulturheidelbeeren (40,4 Prozent) und
1 663 Tonnen (31,9 Prozent) auf die roten und weißen Johannisbeeren.
Unter Schutzabdeckungen wurden 1 717 Tonnen Himbeeren angebaut Auf
172 Hektar wurden Strauchbeeren unter hohen begehbaren
Schutzabdeckungen bzw. in Gewächshäusern angebaut; hier wurden
überwiegend Himbeeren (130 Hektar) produziert. Insgesamt wurden auf
dieser Fläche 2 391 Tonnen Strauchbeeren erzeugt, darunter
1 717 Tonnen Himbeeren.