






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 9. Kalenderwoche:
26. Februar
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Donnerstag, 27. Februar 2025
Land bringt Altschuldenentlastungsgesetz für Kommunen auf
den Weg
Das Landeskabinett hat den Entwurf eines
Gesetzes zur anteiligen Entschuldung der Kommunen in
Nordrhein-Westfalen beschlossen. Ab dem Haushaltsjahr 2025 soll eine
viertel Milliarde Euro zur Verfügung stehen, um die Städte anteilig
von übermäßigen Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zu
entlasten. Als nächster Schritt wird der Gesetzentwurf in die
Verbändeanhörung gegeben.
Die NRW-Städte konnten in den
vergangenen Jahren bereits einen erheblichen Teil ihrer
Liquiditätskredite tilgen, so das Land. Sie haben von Ende 2016 bis
Ende 2023 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung um rund 25
Prozent oder sieben Milliarden auf 20,9 Milliarden Euro reduziert.
Zugleich haben die Kommunen Finanzmittelüberschüsse aus den
vergangenen Jahren dafür eingesetzt, um in ihre jeweilige
Infrastruktur zu investieren oder Schulden zu tilgen: 2023 überstieg
der Wert der kommunalen Investitionen erstmals zehn Milliarden Euro.
Mit dem Altschuldenentlastungsgesetz wird eine wesentliche
Forderung aus dem Kommunalfinanzbericht Ruhr erfüllt, den der
Regionalverband Ruhr (RVR) jährlich vorlegt. Auch das Aktionsbündnis
"Für die Würde unserer Städte" besteht seit langem auf Entlastung.
Die Übernahme kommunaler Kredite in die Landesschuld werde
den Städten und Gemeinden Luft zum Atmen verschaffen, aber ohne
Beteiligung des Bundes sei die Unterstützung nicht ausreichend, so
das Bündnis. Der RVR und die Initiative erwarten, dass der Bund
seine Zusage zur Beteiligung an einer Kommunalentschuldung einhält.
Hier richtet sich der Appell an die neu zu formierende
Bundesregierung. idr
Ärztlicher Notdienst an Karneval einsatzbereit –
Videosprechstunde auch für Erwachsene möglich
Wer an den bevorstehenden
Straßenkarnevalstagen im Rheinland akute gesundheitliche Beschwerden
hat, kann den Notdienst der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte
kontaktieren. Erste Anlaufstellen hierfür sind die ambulanten
allgemeinen und fachärztlichen Notdienstpraxen im Landesteil.
Informationen zu Adressen und Öffnungszeiten der insg. gut 90
Notdienstpraxen der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO)
gibt es unter www.kvno.de/notdienst oder über die kostenlose
Servicenummer 116 117. Die Nummer ist rund um die Uhr erreichbar.
Die Telefon-Kapazitäten werden zu Karneval noch einmal verstärkt.
Hausbesuche für nicht mobile Patientinnen und Patienten
Erkrankte, die den Weg in eine örtliche Notdienstpraxis nicht auf
sich nehmen können, haben die Möglichkeit, über die 116 117 einen
ärztlichen Hausbesuch zu erfragen. Die Rufnummer gibt zudem Auskunft
über die Erreichbarkeiten der regionalen Augen-, HNO-,
kinderärztlichen Notdienste im Rheinland.
• Neu:
Videosprechstunde künftig auch für Erwachsene
Analog zur bereits
für erkrankte Kinder und Jugendliche etablierten kinderärztlichen
Videosprechstunde startet die KVNO ab Samstag, den 1. März, ein
digitales Pendant für Erwachsene. Im Rahmen der
allgemeinmedizinischen Videosprechstunde haben dann auch „große“
Erkrankte die Möglichkeit, online eine ärztliche Erstmeinung zu
erhalten. Oftmals lässt sich schon durch diese digitale
Arztkonsultation das Aufsuchen einer ambulanten Notdienstpraxis
inklusive Anfahrt vermeiden.
Sollte die Gabe von
verschreibungspflichtigen Medikamenten notwendig sein, ist - wie
beim pädiatrischen Angebot - das Ausstellen eines E-Rezeptes
möglich. Angefragt werden können beide Videosprechstunden-Formate
entweder telefonisch über die Servicenummer 116 117 oder online über
www.kvno.de/kinder bzw. www.kvno.de/erwachsene
Nach
Erfassung des jeweiligen gesundheitlichen Beschwerdebildes erhalten
Anrufende per E-Mail einen Termin-Link. Wichtig: Patientinnen und
Patienten sollten unbedingt ihre Versichertendaten bzw. die des
erkrankten Kindes zur Hand haben. Um die Videosprechstunde zu
nutzen, wird neben einer stabilen Internetverbindung ein Smartphone,
Tablet, Notebook oder einen Computer mit Kamera und Mikrofon
benötigt. Während des digitalen Arzt-Patienten-Gesprächs sollte eine
möglichst ruhige Umgebung ohne weitere anwesende Personen aufgesucht
werden.
• Die kinderärztliche Videosprechstunde ist
samstags, sonntags und feiertags (auch Rosenmontag) von 10 bis 22
Uhr verfügbar. Das Online-Angebot für Erwachsene ab 1. März in der
Zeit von 9-21 Uhr an Samstagen, Sonntagen sowie an Feiertagen,
ebenfalls an Rosenmontag.
• Praxis-Vertretungen zwischen
Altweiber und Aschermittwoch
Zwischen dem 27. Februar (Altweiber)
und 5. März (Aschermittwoch) werden einige Arztpraxen im Rheinland
urlaubsbedingt geschlossen bleiben. Während der Sprechstundenzeiten
übernehmen dann andere Praxen vor Ort vertretungsweise die ambulante
Versorgung. Patientinnen und Patienten sollten rechtzeitig auf
entsprechende Praxis-Aushänge und Angaben auf den
Praxis-Anrufbeantwortern oder Homepages achten.
Studie: Besser Lernen mit Schilddrüsenhormonen
Schilddrüsenhormone sorgen u. a. für bessere Konzentration und
leichteres Lernen. Mediziner der Universität Duisburg-Essen
untersuchen jetzt, wie sich mit diesen Hormonen der Arbeitsspeicher
des Gehirns beeinflussen lässt. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft
fördert das Vorhaben mit 246.300 Euro.
Der Fokus ist auf
Schilddrüsenhormone im Hippocampus gerichtet, dem lernenden Gehirn,
in dem lebenslang neue Nervenzellen gebildet werden können. Fehlen
die Hormone, funktioniert das Gedächtnis nicht mehr so gut. Die
Wissenschaftler wollen die Prozesse verstehen, um Substanzen zu
entwickeln, die die Neuroplastizität des Gehirns fördern. idr
Klimafreundliche Mobilität: DVG startet Linienbetrieb
von elf Wasserstoffbussen
Die Duisburger
Verkehrsgesellschaft AG (DVG) arbeitet gemeinsam mit der Stadt
Duisburg an der Modernisierung der Infrastruktur für einen
zukunftsfähigen und nachhaltigen ÖPNV. In den vergangenen Jahren
haben DVG und Stadt bereits viel erreicht.
Ab dem 1. März
2025 erfolgt ein weiterer Schritt hin zu einem emissionsarmen
öffentlichen Nahverkehr. Elf wasserstoffbetriebene
Brennstoffzellenbusse werden dann im Linienbetrieb durch Duisburg
fahren. Sie sorgen emissionsfrei und leise für bessere Luft und
weniger Lärm. Fahrgäste und Fahrpersonal profitieren von einer
komfortablen und multifunktionalen Innenausstattung der 12 Meter
langen Busse mit Klimatisierung, großzügigen Sondernutzungsflächen
sowie Assistenzsystemen.

Stellen gemeinsam die neuen Wasserstoffbusse der DVG vor (v. l.):
DVG-Technikvorstand Andreas Gutschek, Oliver Krischer, Minister für
Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, Sören Link,
Oberbürgermeister der Stadt Duisburg und Oliver Wittke,
Vorstandssprecher des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR). Duisburger
Verkehrsgesellschaft AG (DVG)
Kurz vor dem Start des
Linienbetriebs haben die DVG-Vorstände Marcus Wittig (Vorsitz) und
Andreas Gutschek (Technik) heute im Beisein von Oliver Krischer,
Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes
Nordrhein-Westfalen, Oberbürgermeister Sören Link, und Oliver
Wittke, Vorstandssprecher des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) die
neuen wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenbusse der
Öffentlichkeit vorgestellt.
Minister Oliver Krischer:
„Wir wollen mehr Menschen zum Umstieg auf Bus und Bahn bewegen. Das
gelingt mit attraktiven Angeboten im Nahverkehr und wie hier mit
modernen Wasserstoffbussen. Das Land fördert die Umstellung auf
klimafreundliche Antriebe. Ich freue mich, dass die neuen
Wasserstoffbusse den Duisburger Stadtverkehr künftig
klimafreundlicher machen.“
„Die neuen Wasserstoffbusse
verbessern den Nahverkehr in unserer Stadt und sorgen für deutlich
weniger Abgase. Dank der Unterstützung des Landes
Nordrhein-Westfalen kommen wir so in Duisburg der Verkehrswende mit
smarten Lösungen ein großes Stück näher“, betont Oberbürgermeister
Sören Link.
„Mein besonderer Dank gilt den Fördergebern,
die diesen wichtigen Transformationsprozess mit erheblichen Mitteln
unterstützt haben. Die Inbetriebnahme der ersten elf
Wasserstoffbusse samt Wasserstoff-Tankanlage ist ein weiterer
wichtiger Schritt hin zu einem komplett emissionsfreien Nahverkehr
in Duisburg. Wir wollen als Verkehrsunternehmen diesen Weg weiter
gehen.
Dabei sind wir auch in Zukunft auf Fördergelder
angewiesen. Denn ohne effektive Unterstützung von Bund und Land
werden wir nicht in der Lage sein, diesen entscheidenden Beitrag zum
Klimaschutz und zur Steigerung der Lebensqualität in Duisburg zu
leisten“, sagt Marcus Wittig, Vorstandsvorsitzender der DVG.
„Die umweltfreundlichen Wasserstoffbusse bieten für den Einsatz im
ÖPNV gleich mehrere Vorteile. Mit Reichweiten von bis zu 400
Kilometern und kurzen Betankungszeiten sind sie so flexibel
einsetzbar wie herkömmliche Busse. Geräuscharm und nahezu
emissionsfrei leisten sie einen wichtigen Beitrag zur
Luftreinhaltung“, erläutert DVG-Technikvorstand Andreas Gutschek.
„Mit der Förderung von 25 wasserstoffbetriebenen Bussen samt
Tankinfrastruktur für die Duisburger Verkehrsgesellschaft leisten
das Land NRW und der VRR einmal mehr einen wichtigen Beitrag, um
energieeffiziente Antriebssysteme alltags- und linientauglich zu
machen.
Denn die Transformation des ÖPNV hin zum Elektro- und
Wasserstoffbetrieb ist ein nachhaltiger Beitrag zur Reduktion des
lokalen Abgasausstoßes und somit ein wesentlicher Punkt für bessere
Luft in den Städten. Darüber hinaus wird mit attraktiven und
modernen Fahrzeugen die Akzeptanz des ÖPNV gesteigert und der
Umweltverbund gestärkt“, erklärt Oliver Wittke, Vorstandssprecher
des VRR.
Gefördert mit Landesmitteln
Die DVG hat 25
Wasserstoffbusse im Juli 2023 bestellt. Der Bushersteller Solaris
hat bereits elf Solobusse vom Typ Solaris Urbino 12 hydrogen an die
DVG geliefert. Bis Ende 2025 werden vierzehn Gelenkbusse vom Typ
Solaris Urbino 18 hydrogen die Busflotte erweitern.
Die
Anschaffung dieser 25 Wasserstoffbusse und die für den Betrieb
erforderliche Wasserstoff-Tank- und Werkstattinfrastruktur ist für
die DVG mit erheblichen Investitionen verbunden. Insgesamt
investiert die DVG rund 20,5 Millionen Euro für die 25 Fahrzeuge und
erhält dafür über den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) Fördermittel
vom Land in Höhe von rund 7 Millionen Euro.
Für die
Tank- und Werkstattinfrastruktur sind rund 20 Millionen Euro
Investitionen erforderlich, von denen rund 18 Millionen Euro vom
Land gefördert werden. Die jetzt in Betrieb genommene mobile
Wasserstoff-Tankstelle von Air Liquide wurde ohne Fördermittel
angemietet. Sie überbrückt den Zeitraum, bis die geförderte fest
installierte Wasserstoff-Tankstelle errichtet und in Betrieb
genommen wird.
Wasserstoff-Busse mit neuester Technologie
Die Busse vom Typ Solaris Urbino hydrogen werden mit Wasserstoff
betrieben, der gasförmig in den auf dem Fahrzeugdach platzierten
Tanks gespeichert wird. Die elektrische Energie wird durch
umgekehrte Elektrolyse erzeugt, in einer Batterie
zwischengespeichert, und dann dem Elektro-Antrieb zugeführt. Die
einzigen Nebenprodukte dieses Prozesses sind Wärme und Wasserdampf.
In jedem Bus werden ultramoderne Brennstoffzellenmodule mit
einer Leistung von 70 Kilowatt und 100 Kilowatt verwendet. Der
Antrieb besteht aus Traktionsmotoren mit jeweils 160 Kilowatt
(Solowagen) und 240 Kilowatt (Gelenk) Leistung. Mit einer
Tankfüllung erzielen die Busse eine Reichweite von bis zu 400
Kilometern.
Komfortable und sichere Ausstattung,
mobilitätseingeschränkte Fahrgäste im Blick
In den
vollklimatisierten Bussen empfängt die Fahrgäste ein freundlicher
Innenraum. Die DVG hat mobilitätseingeschränkte Fahrgäste besonders
im Blick. Im Bereich der zweiten Tür verfügen die Busse über gleich
zwei Sondernutzungsflächen in Fahrtrichtung links und rechts für
Rollstühle und Kinderwagen. Für weitere Fahrgäste sind in diesen
Bereichen Klappsitze vorgesehen. TFT-Bildschirme informieren die
Passagiere.
Der Fahrpersonalarbeitsplatz ist ebenfalls
komfortabel ausgestattet, unter anderem durch eine Klimatisierung,
einen ebenfalls klimatisierten Sitz mit Lordoseunterstützung und
einen elektrisch verstellbaren Innenspiegel. Sicherheit vermittelt
eine Fahrpersonalkabinentür.
Fortschrittliche
Fahrerassistenzsysteme warnen das Fahrpersonal, wenn Fußgänger oder
Radfahrer in der Nähe des Fahrzeugs auftauchen. Eine
Videoüberwachungsanlage sorgt für zusätzliche Sicherheit.

H2-Tankstelle: DVG-Technikvorstand Andreas Gutschek, Oliver Wittke,
Vorstandssprecher des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) und Oliver
Krischer, Minister für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen bei
der Betankung eines Wasserstoffbusses (v. l.).
EU-Kommission stellte Clean Industrial Deal vor
Zum
Clean Industrial Deal, den die EU-Kommission am 26. Februar
vorgestellt hat, übermittelt ein Sprechers des
Bundesbauministeriums: „Die sektorübergreifende Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft ist ein Kernanliegen, das
wir jetzt in Europa gemeinsam, entschlossen und rasch angehen
müssen. Auch die Entwicklung der Baukosten muss bei der
industriepolitischen Neuausrichtung eine wichtige Rolle spielen.
Das betrifft z. B. die Förderung CO2-armer Baustoffe ebenso wie
den Ausbau von Technologien zur Abscheidung, Nutzung oder
Speicherung von CO2 in der Baustoffproduktion. Der geplante
Bürokratieabbau, insbesondere bei Berichts- und
Dokumentationspflichten für Unternehmen, kann die Bauwirtschaft
wirksam entlasten.
Und auch die nun vorgesehenen
vereinfachten EU-Beihilferegelungen können zu höheren Investitionen
in klimaneutrale Technologien beitragen, etwa bei der Schaffung
neuer Produktionskapazitäten für serielle und modulare Bauweisen.“
Weitere Information zum Clean Industrial Deal:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_550
Erfolgreiches Leseförderprojekt in der
Stadtbibliothek
Bereits zum dritten Mal führte die
Stadtbibliothek gemeinsam mit den Duisburger Lions-, Leo und
Rotarier-Clubs für Schulkinder in den dritten Klassen ein
Leseförderprojekt durch. An zwei Tagen hatten insgesamt 200 Kinder
die Gelegenheit, Rüdiger Bertram in der Zentralbibliothek live zu
erleben.
Der bekannte Autor hat inzwischen 80 Bücher
veröffentlicht, die unter anderem auch ins Türkische und Chinesische
übersetzt wurden und sich bei Kindern großer Beliebtheit erfreuen.

Leseförderprojekt der Stadtbibliothek, v. l. n. r. Michael Euteneuer
(Lions Club Rhenania), Rüdiger Bertram, Miriam Rakowski (Rotary Club
Alte Abtei), Jörg Mascherrek (Rotary Club Duisburg) und Kinder der
GGS Hans Christian Andersen - Foto Stadtbibliothek Duisburg
Nach der Lesung aus „Bookman“ durften die Kinder ihn ins
Kreuzverhör nehmen und haben dabei viel in Erfahrung gebracht –
unter anderem, dass Ideen für neue Geschichten manchmal auch kommen,
wenn man beim Bäcker ansteht und dass man Fantasie trainieren kann
wie einen Muskel. Nach der Lesung erhielten alle Kinder ein
signiertes Exemplar von Bookman mit einer Autogrammkarte geschenkt.
In den nächsten Wochen wird im Unterricht weiter mit den Büchern
gearbeitet. Die Ergebnisse werden nach den Osterferien in der
Zentralbibliothek präsentiert
IHK bildet
Fachexperten für Elektromobilität aus
Die CO2-Preise
steigen. Der Klimawandel macht die Elektromobilität
dringlicher. Unternehmen, die auf Elektroautos setzen und eigene
Ladesäulen betreiben, profitieren von den Kostenvorteilen. Für alle,
die im Unternehmen E-Mobilitäts-Projekte vorantreiben wollen, bietet
die Niederrheinische IHK einen Lehrgang an. Der Kurs richtet sich an
Fach- und Führungskräfte.
Ein technisches Verständnis
oder Berufserfahrung im Umfeld der Elektrotechnik sind von Vorteil.
Der Zertifikatslehrgang findet online statt. Er läuft vom 29. April
bis 16. Juli, dienstags und mittwochs, von 14 bis 17:30 Uhr.
IHK-Ansprechpartnerin ist Sabrina Giersemehl, 0203 2821-382,
giersemehl@niederrhein.ihk.de. Weitere Informationen und Anmeldung
unter
www.ihk.de/niederrhein/veranstaltungen.
Für gemeinnützige Projekte in Duisburg: Beim DU_kultu|en Award
winken Initiativen und Vereinen 3 x 10.000 Euro
Der
Preis richtet sich an gemeinnützig tätige Einrichtungen, Initiativen
und Vereine, die das Leben in Duisburg bereichern. Die Awards sollen
beim DU_kultur|en Festival Ende Mai verliehen werden.
Bundestagspräsidentin Bärbel Bas ist Teil der Jury.
Am 23. und
24. Mai 2025 findet in der Duisburger Innenstadt das zweite
DU_Kultur|en_Festival, in diesem Jahr sogar über zwei Tage.
Das Festival soll Menschen zusammenbringen, Vorurteile abbauen
und mit Musik und Kunst zum Perspektivwechsel anregen, schreiben die
Veranstalter.
Neu in diesem Jahr: Die TARGOBANK vergibt den
DU_Kultur|en_Award 2025
Ziel ist es, Institutionen zu prämieren,
die sich in Duisburg mit kulturellen Angeboten dafür einsetzen,
Vielfalt als Stärke und Chance für die Gesellschaft zu etablieren.
„Mit dem neuen Award möchten wir über die
Veranstaltungstage des Festivals hinaus gemeinnützige Institutionen
unterstützen, die sich in Duisburg für kulturelle Vielfalt
einsetzen“, sagt Deborah Werheit CSR-Referentin der TARGOBANK.
Dabei gebe es bewusst nur wenige Vorgaben und einen einfachen
Bewerbungsprozess über die Event-Website. Unter www.du-kulturen.de
sind ab sofort Bewerbungen um den Preis möglich.
Denkbar sind
gemeinnützige Organisationen, die sich für Sprache, Kunst, Musik,
Tanz oder auch Sport einsetzen. Wichtig ist, dass dabei ein
weltoffenes Menschenbild gefördert wird. Vergeben wird ein Preisgeld
von 3 x 10.000 Euro. Bewerbungen sind ab sofort möglich. Die Frist
endet am 15. April 2025.
Die Einsendungen werden von
einer Jury bewertet, bestehend aus:
• Bärbel Bas –
Bundestagspräsidentin und Duisburgerin
• Aslı Sevindim –
Abteilungsleiterin der Abteilung „Integration“ im Ministerium für
Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes
Nordrhein-Westfalen
• Marijo Terzic – Leiter des Kommunalen
Integrationszentrum in Duisburg
• Sascha Devigne – Chefredakteur
STUDIO 47
• Tine Vogt – Geschäftsleitung TARGOBANK Kundencenter
Die Preisverleihung findet auf dem „DU_Kultur|en_Festival“
statt. Die Erstellung der Trophäen übernimmt die Duisburger
Werkstatt für Menschen mit Behinderung. „Wir freuen uns darüber,
dass wir mit dem Award einen weiteren Impuls für kulturelle Vielfalt
setzen können. Der Award wird derzeit von der Duisburger Werkstatt
für Menschen mit Behinderung erstellt und der Prototyp sah bereits
großartig aus.
Denn er verkörpert genau das, worum es uns
geht: Vielfalt und ein weltoffenes Menschenbild“, sagt Dirk Suceska,
Pressesprecher der TARGOBANK. Weitere Informationen zum Festival und
dem Programm wollen die Macher in den nächsten Wochen enthüllen.

Foto-Credit: Duisburg Kontor | Merle Eckardt
Zum 150. Geburtstag von Hans Böckler: DGB, Hans-Böckler-Stiftung und
Köln ehren ersten DGB-Vorsitzenden
26. Februar:
vor 150 Jahren wurde der erste Vorsitzende des Deutschen
Gewerkschaftsbundes (DGB), Hans Böckler, geboren. Mit einer
gemeinsamen Kranzniederlegung ehren die Stadt Köln, der DGB und die
Hans-Böckler-Stiftung ihn auf dem Melaten-Friedhof in Köln. Hans
Böckler gilt als Vater der Montanmitbestimmung und Begründer der
Einheitsgewerkschaft. Viele Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte
von Arbeitnehmer*innen gehen auf seinen Einsatz zurück.
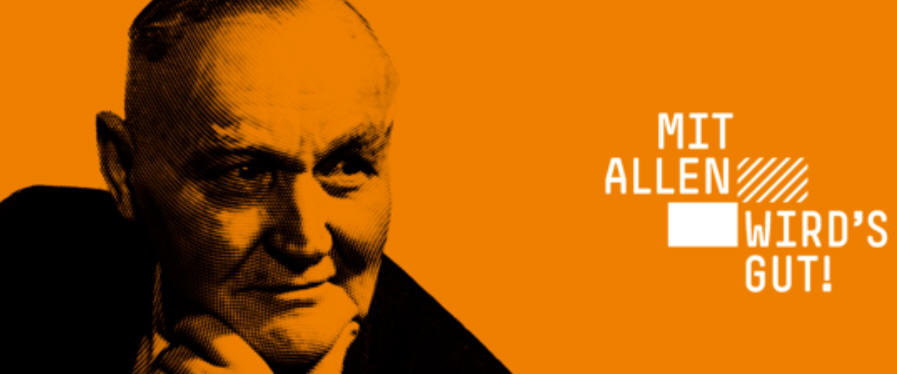
„Er hat die
Mitbestimmung verankert“
Anja Weber,
Vorsitzende des DGB NRW, erklärt: „Es gibt kaum einen richtigeren
Zeitpunkt als diesen, um Hans Böckler zu gedenken. In Zeiten, in
denen die politischen Fliehkräfte zunehmen und die Spaltung der
Gesellschaft wächst, hat uns der erste DGB-Vorsitzende Wichtiges zu
sagen. Einheit und Solidarität waren die Werte, auf deren Fundament
er den DGB begründete.
Und noch ein weiteres wichtiges
Vermächtnis von Hans Böckler bleibt uns: Er machte deutlich, dass
die Vernachlässigung von sozialer Gerechtigkeit die Demokratie
gravierend schwächt. Politische und wirtschaftliche Demokratie waren
für ihn zwei Seiten einer Medaille. Das gilt bis heute:
Mitbestimmung und Tarifverträge müssen als wichtiger Pfeiler unserer
Demokratie dringend gestärkt werden.“
Claudia Bogedan,
Geschäftsführerin der Hans-Böckler-Stiftung, sagt: „`Mit allen
wird´s gut‘, Kooperation bringt uns weiter, Egoismus blockiert alle.
Das ist eine zentrale Botschaft von Hans Böckler für heute. Er hat
die Sozialpartnerschaft mitbegründet und die Mitbestimmung
verankert.
Nach den Gräueln der NS-Zeit bestand er darauf,
dass der parlamentarischen Demokratie eine Demokratie in der
Wirtschaft zur Seite gestellt werden muss, damit die Demokratie
stabil ist. Heute wissen wir, dass er recht hatte, wie Forschung
statistisch signifikant nachweist. Wertschätzung von Wissenschaft
und Bildung gehört ebenfalls zum Erbe von Hans Böckler. Mit unserem
Dreiklang aus Forschung, Beratung und Stipendien für begabte junge
Menschen führen wir als Hans-Böckler-Stiftung dieses Erbe fort.“
Witich Roßmann, Vorsitzender des DGB Köln: „Hans Böckler hat
unmittelbar nach der Befreiung Kölns alle Gewerkschaftsströmungen in
einer Einheitsgewerkschaft zusammengebracht und dieses Modell von
Köln für Deutschland durchgesetzt – noch heute ein Vorbild für die
europäischen Gewerkschaften. Mit Führungsstärke und achtsamer
Moderation. Seine unangefochtene Autorität leitete der geborene
Nordbayer und rheinische Wahlkölner nicht aus dem Amt, sondern
seiner Persönlichkeit her.“
Hans Böckler wurde am 26. Februar
1875 im mittelfränkischen Trautskirchen geboren und lebte und
arbeitete seit 1920 in Köln. Er leitete den Kölner
Metallarbeiterverband (DMV) und den Landesbezirk Rheinland des
Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes bis zur Zerschlagung der
Gewerkschaften am 2. Mai 1933 durch die Nationalsozialisten. Nach
zahlreichen Verhaftungen und gewaltsamen Übergriffen überlebte Hans
Böckler die Nazizeit in Köln-Bickendorf.
Nach der Befreiung
Kölns durch die US-Armee begann der 70-Jährige mit dem Aufbau einer
„Einheitsgewerkschaft“, zunächst in Köln, dann in allen drei
Westzonen. Er organisierte den großen Generalstreik der
DGB-Gewerkschaften im November 1948 gegen Hunger,
Schwarzmarktkriminalität, ungerechte Verteilung, für Mitbestimmung
und Wirtschaftsdemokratie.
Der neu gegründete Deutsche
Gewerkschaftsbund wählte den 74-Jährigen 1949 mit überwältigender
Mehrheit zu seinem ersten Bundesvorsitzenden. Am 4. Januar 1951,
mitten in den dramatischen Verhandlungen mit Bundeskanzler Adenauer
um die Montanmitbestimmung, verlieh ihm die Stadt Köln – zusammen
mit Konrad Adenauer – die Ehrenbürgerwürde. Nur wenige Tage nach der
erfolgreichen Durchsetzung der Montanmitbestimmung starb er am 16.
Februar 1951.
Agentur für Arbeit Duisburg an
Rosenmontag (3. März 2025) geschlossen
Die Agentur
für Arbeit Duisburg an der Wintgensstraße 29-33 ist am 3. März 2025
(Rosenmontag) ganztägig geschlossen. Für telefonische Anfragen ist
die kostenfreie Rufnummer 0800 4 5555 00 wie gewohnt von 8:00 bis
18:00 Uhr erreichbar. Kundinnen und Kunden der Agentur für Arbeit
Duisburg stehen darüber hinaus die eServices unter
www.arbeitsagentur.de/eServices zur Verfügung.
Stadtwerketurm leuchtet an Rosenmontag bunt
Auch in
diesem Jahr wollen die Stadtwerke Duisburg allen Bürgerinnen und
Bürgern an Rhein und Ruhr einen besonderen Karnevalsgruß senden. Der
Stadtwerketurm erstrahlt an Rosenmontag, 3. März, wieder in bunten
Farben. Mit Einbruch der Dunkelheit lohnt sich also ein Blick in
Richtung Hochfeld zum Baudenkmal der Stadtwerke Duisburg AG. Die
Stadtwerke wünschen allen Duisburgerinnen und Duisburgern eine
schöne Karnevalszeit.

Foto Stadtwerke Duisburg AG
Deutscher Lichtdesign-Preis 2020
Der leuchtende Turm der Stadtwerke begeistert nicht nur die
Duisburger Bürgerinnen und Bürger, auch die Expertinnen und Experten
der Jury des Deutschen Lichtdesign-Preises waren vollauf überzeugt.
Der Stadtwerketurm wurde im September 2020 mit dem renommierten
Preis in der Kategorie „Außenbeleuchtung / Inszenierung –
Wahrzeichen“ ausgezeichnet.
Die bestechende
Lichtinstallation entsteht durch eine Kombination aus
verschiedenartig geformten LED-Leuchtkörpern, darunter 180 Strahler
und 256 Meter Lichtlinien. Sie illuminieren die filigrane
Stahlkonstruktion des Stadtwerketurms so, dass sie in der Dunkelheit
perfekt zur Geltung kommt. Um die Leuchtmittel mit Strom zu
versorgen, waren 4.500 Meter Kabel notwendig, 2.400 Meter davon in
der Vertikalen innerhalb der Aufzugröhre in der Mitte des Turms.
Weitere Informationen zum Turm gibt es auch im Internet
Bildquelle: Stadtwerke Duisburg AG unter
www.stadtwerketurm.de.
Solarbetriebene DHL Packstation in
Duisburg-Beeck eröffnet
- Automat an der Karolinger
Str. 24 hat 66 Fächer
- Bedienung einfach per App mit dem
Smartphone
- Paketempfang und -versand rund um die Uhr
Die
DHL hat eine neue Packstation an der Karolinger Str. 24 mit dem
Zugang an der Werntgenstr. in Duisburg-Beeck in Betrieb genommen.
Die Kapazität des neuen, solarbetriebenen Automaten umfasst 66
Fächer. Kundinnen und Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr
ihre Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken.

Die App-gesteuerte Packstation kommt dabei ohne Bildschirm aus. Für
die Nutzung benötigen Kundinnen und Kunden lediglich die kostenlose
Post & DHL App. Mit der Nutzung der Packstationen können sie aktiv
zum klimaneutralen Paketversand beitragen.
Die Nutzung des kostenlosen Services Packstation trägt zur
Reduzierung von CO2-Emissionen sowie des Verkehrs innerhalb von
Städten bei. Im Vergleich zu einer Haustür-Zustellung werden bei
einer Packstationssendung bei der Auslieferung im Durchschnitt 30
Prozent CO2 eingespart.
Bücherfreunde Rheinhausen treffen sich in der
Bezirksbibliothek
Die Bücherfreunde
Rheinhausen treffen sich am Donnerstag, 6. März, um 16.30
Uhr erneut in der Bezirksbibliothek auf der Händelstraße
6 in DuisburgRheinhausen. Alle, die gerne lesen und immer
auf der Suche nach lohnenden Titeln sind, sind herzlich
eingeladen.
Dabei kommt es nicht darauf an,
ob die eigenen Vorlieben eher bei der Belletristik oder
Sachliteratur liegen, ob man sich für Aktuelles
interessiert oder lieber in Klassikern schmökert. Bei
einer Tasse Kaffee können alle, die möchten, ihre
aktuellen Lieblingsbücher vorstellen oder auch einfach
nur zuhören. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist
kostenlos; eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Das Treffen findet an jedem ersten Donnerstag im
Monat immer um 16.30 Uhr statt. Für Fragen steht das Team
der Rheinhauser Bibliothek vor Ort oder telefonisch unter
02065 905-8467 gerne zur Verfügung. Die Bezirksbibliothek
ist dienstags bis freitags von 10.30 bis 13 Uhr und von
14 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr
geöffnet.
Bücher-Programm für Kinder in der Meidericher Bibliothek
Gemeinsam Geschichten hören und erleben – das können Kinder bei
zwei Veranstaltungen im März in der Bezirksbibliothek Meiderich,
Von-der-MarkStraße 71. Los geht es für die Kleinsten im Alter von
zwei und drei Jahren mit ihren Eltern am Dienstag, 11. März, um 16
Uhr. Gaby Weber stellt ein Bilderbuch vor, dazu wird zusammen
gesungen und Spaß gehabt. Am Dienstag, 18. März, dreht sich um 16
Uhr bei Gunnar Risch alles um „Kommissar Kugelblitz“. Kinder ab 6
Jahren können mitlesen und -rätseln.
Die Teilnahme ist
kostenfrei. Informationen zu den weiteren Terminen und die Anmeldung
finden sich auf www.stadtbibliothek-duisburg.de unter
Veranstaltungen. Fragen beantwortet das Team der Bibliothek
persönlich oder telefonisch unter 0203/4499366. Die Öffnungszeiten
der Bibliothek sind dienstags bis freitags von 10.30 bis 13 Uhr und
von 14 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr.
„SchoKi“-Programm in der Bezirksbibliothek Rheinhausen
Die Rheinhauser Bibliothek lädt am Mittwoch, 12. März,
um 16 Uhr alle kleinen Geschichtenfans von zwei bis drei Jahren und
ihre Eltern zu einer besonderen Veranstaltung ein. Beim Programm für
Schoßkinder („SchoKi“) dreht sich alles um die spielerische
Sprachförderung und die Freude an Büchern.
Unter dem
Motto „Mit Büchern wachsen“ wird ein Bilderbuch vorgestellt –
begleitet von Spielen, Liedern und jeder Menge Spaß. Dabei steht
nicht das Lesenlernen im Vordergrund, sondern das gemeinsame Erleben
von Geschichten. Natürlich dürfen die Kinder auch gerne von einem
Großelternteil oder einer anderen erwachsenen Person begleitet
werden. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Die
„SchoKi“-Veranstaltungen finden in allen Duisburger Bibliotheken
regelmäßig statt. Anmeldungen sind bequem online auf
www.stadtbibliothek-duisburg.de möglich. Die Öffnungszeiten der
Bezirksbibliothek Rheinhausen sind dienstags bis freitags von 10.30
bis 13 Uhr und von 14 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 13
Uhr.
BMDV, DVR und DGUV starten Plakatkampagne
gegen Drogen und Ablenkung am Steuer
Berlin, 26.02.2025
– Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV),der
Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) und die
Berufsgenossenschaften, Unfallkassen sowie ihr Spitzenverband
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) machen in einer
bundesweiten Plakatkampagne auf die Gefahren von Alkohol, Cannabis
und Smartphones am Steuer aufmerksam. Neue Motive der „Runter vom
Gas“-Kampagne warnen auf mehr als 700 Plakaten an Autobahnen und
Raststätten.

Die Kampagne setzt auf eindringliche Bilder und klare Botschaften,
um Verkehrsteilnehmende für drei unterschiedliche Unfallursachen zu
sensibilisieren. Die Plakate zeigen die potenziellen Folgen von
Alkohol- und Cannabiskonsum sowie Smartphone-Nutzung am Steuer auf
und appellieren an die Eigenverantwortung der Fahrerinnen und
Fahrer.
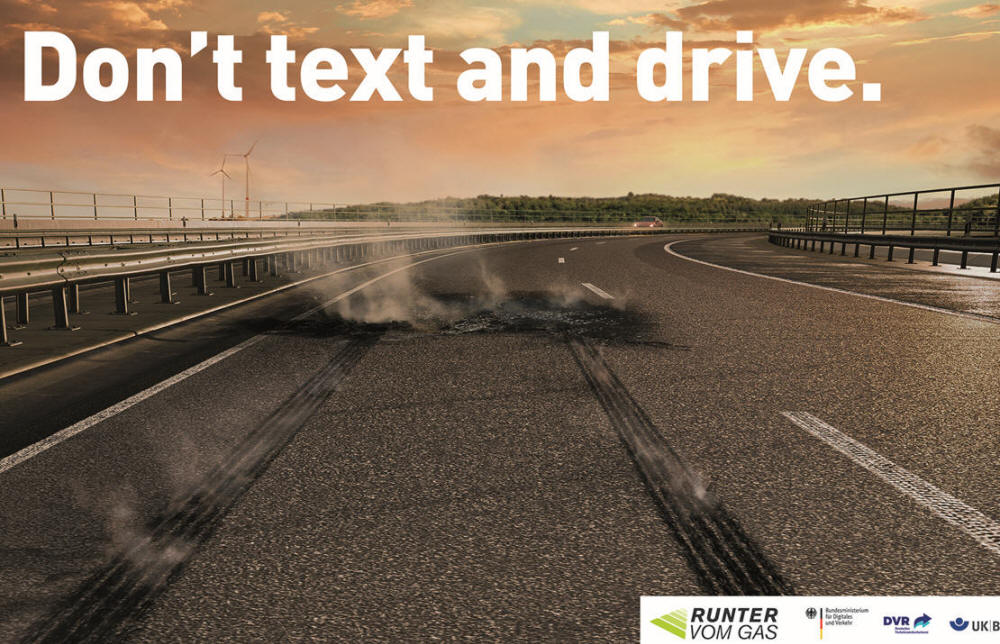
Sie zeigen international verständliche Botschaften in englischer
Sprache, um auch Reisende und Berufskraftfahrende aus dem Ausland zu
erreichen. Auf einem der Motive versinkt etwa ein Pkw im Bierglas,
auf einem anderen fliegt ein Unfallauto neben einem Joint durch die
Luft.

Plakate appellieren: Don’t drink and drive
Bundesminister Dr.
Volker Wissing: „Wer unter dem Einfluss von Alkohol und anderen
Drogen oder abgelenkt durch sein Smartphone am Straßenverkehr
teilnimmt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere
Menschen. Drogen und Straßenverkehr passen absolut nicht zusammen.
Und auch das Smartphone ist Gift für die Konzentration am
Steuer. Mit unserer neuen Plakatkampagne wollen wir die
Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer eindringlich vor diesen
Gefahren warnen und um mehr Verantwortungsbewusstsein im
Straßenverkehr werben. Fahren Sie stets mit klarem Kopf und freiem
Blick!“
Darauf weist auch der DVR als Mitinitiator der
Kampagne hin. DVR-Präsident Manfred Wirsch „Die neuen Motive der
Kampagne ‚Runter vom Gas‘ sprechen eine klare Sprache: Alkohol,
Cannabis und Smartphone-Nutzung im Straßenverkehr sind
lebensgefährlich. Ganz im Sinne der Vision Zero wollen wir ein
starkes Zeichen für mehr Sicherheit auf unseren Straßen setzen. Wer
trinkt oder kifft, fährt nicht. Und wer sein Handy benutzen möchte,
steuert den nächsten Parkplatz an. Mit den Botschaften auf den
aktuellen Autobahnplakaten appellieren wir an das
verantwortungsvolle Handeln aller Verkehrsteilnehmenden.“
Im
Jahr 2023 ereigneten sich in Deutschland 15.652 Verkehrsunfälle mit
Personenschaden unter Alkoholeinfluss. Dabei sind 198 Menschen ums
Leben gekommen, 18.686 sind verletzt worden, davon 4.262 schwer.
Hinzu kommen täglich acht polizeilich registrierte Unfälle mit
Personenschaden durch den Einfluss weiterer Drogen. Auch die
Ablenkung am Steuer durch elektronische Geräte wie Smartphones ist
inzwischen weit verbreitet. Wer während der Fahrt textet, erhöht das
Unfallrisiko erheblich.
Die Kampagne wird durch Informationen
auf der Website www.runtervomgas.de sowie den Social-Media-Kanälen
(Facebook: www.facebook.com/RunterVomGas und Instagram:
www.instagram.com/runtervomgas_offiziell) begleitet.
Zur
Kampagne „Runter vom Gas“:
Initiatoren der
Verkehrssicherheitskampagne „Runter vom Gas“ sind das
Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) und der Deutsche
Verkehrssicherheitsrat (DVR). Mit klaren Botschaften sensibilisiert
„Runter vom Gas“ seit 2008 für die Risiken im Straßenverkehr sowie
die vielfältigen Unfallursachen – und trägt dadurch zu mehr
Sicherheit auf Deutschlands Straßen bei. Die Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung ist Kooperationspartner der Plakatierung.

Staatsdefizit erhöht sich im Jahr 2024 auf 118,8
Milliarden Euro
Sowohl Bund, Länder, Gemeinden als auch
die Sozialversicherung verzeichnen Defizite Das Finanzierungsdefizit
des Staates lag nach vorläufigen Berechnungen im Jahr 2024 bei 118,8
Milliarden Euro. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter
mitteilt, war das staatliche Defizit somit um 15,0 Milliarden Euro
höher als im Jahr 2023. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) in
jeweiligen Preisen errechnet sich für das Jahr 2024 eine
Defizitquote von 2,8 % (2023: 2,5 %).
Bei den Ergebnissen
handelt es sich um Daten in der Abgrenzung des Europäischen Systems
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 2010. Sie bilden die
Grundlage für die Überwachung der Haushaltslage in den
Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) nach dem Stabilitäts-
und Wachstumspakt (Maastricht-Kriterien) und sind nicht identisch
mit dem Finanzierungssaldo des Öffentlichen Gesamthaushalts in
Abgrenzung der Finanzstatistiken.
Finanzierungsdefizit des
Bundes sinkt gegenüber dem Vorjahr um 30,5 Milliarden Euro
Mit
62,3 Milliarden Euro entfiel gut die Hälfte des gesamtstaatlichen
Finanzierungsdefizits im Jahr 2024 auf den Bund. Allerdings konnte
der Bund sein Finanzierungsdefizit damit gegenüber dem Vorjahr um
30,5 Milliarden Euro verringern. Bei Ländern und Gemeinden gab es
hingegen deutliche Defizitzuwächse: Das Defizit der Länder
verdreifachte sich im Vorjahresvergleich auf 27,3 Milliarden Euro
(2023: 9,0 Milliarden Euro).
Das Defizit der Gemeinden
erhöhte sich um 7,6 Milliarden Euro auf 18,6 Milliarden Euro. Die
Sozialversicherung wies im Jahr 2024 ein Finanzierungsdefizit von
10,6 Milliarden Euro auf, nachdem sie 2023 noch einen Überschuss von
9,0 Milliarden Euro erreicht hatte. Damit verzeichneten erstmals
seit dem Jahr 2009 alle vier Teilsektoren des Staates ein
Finanzierungsdefizit.
Steuereinnahmen und Sozialbeiträge
steigen
Die Einnahmen des Staates in Abgrenzung der
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen betrugen 2 012,9 Milliarden
Euro und überschritten damit im Jahr 2024 erstmals die Marke von 2
Billionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Einnahmen des
Staates um 4,8 %.
Die Steuereinnahmen des Staates erhöhten
sich im Jahr 2024 um 3,5 %. Bei der Mehrwertsteuer wurde ein Zuwachs
von 2,4 % verzeichnet, die Einnahmen aus Einkommensteuern stiegen um
3,6 %. Die Sozialbeiträge waren um 6,5 % höher als im Vorjahr. Die
Zinseinnahmen des Staates stiegen gegenüber dem Vorjahr um 13,9 %.
Höhere Einnahmen aus der Lkw-Maut aufgrund des im Dezember 2023
eingeführten CO2-Zuschlags trugen ebenfalls zum Anstieg der
staatlichen Einnahmen bei.
Trotz auslaufender
Energiepreisbremsen steigen die Ausgaben stärker als die Einnahmen
Die Ausgaben des Staates in Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnungen erhöhten sich im Jahr 2024 um 5,3 % auf 2 131,6
Milliarden Euro. Sie stiegen damit stärker als die Einnahmen.
Die Zinsausgaben lagen im Jahr 2024 um 24,2 % höher als im
Vorjahr. Die monetären Sozialleistungen stiegen um 7,0 %. Dies
resultierte in erster Linie aus höheren Ausgaben für Renten und
Pensionen. Erheblich mehr wurde auch für das Pflegegeld und für das
Bürgergeld ausgegeben.
Die sozialen Sachleistungen nahmen um
8,0 % zu. Dies lag unter anderem an Mehrausgaben für
Krankenhausbehandlungen, Medikamente und Pflege sowie an höheren
Ausgaben in den Bereichen der Jugend-, Eingliederungs- und
Sozialhilfe. Dagegen sanken die Subventionen um 35,6 %, weil die
Entlastungsmaßnahmen (Energiepreisbremsen) für hohe Energiepreise
Ende 2023 endeten.
Auftragseingang im Bauhauptgewerbe 2024 um 0,7 %
niedriger als im Vorjahr
Auftragseingang im
Bauhauptgewerbe, Jahr 2024
-0,7 % zum Vorjahr (real)
+1,1 %
zum Vorjahr (nominal)
Auftragseingang im Bauhauptgewerbe,
Dezember 2024
-7,7 % zum Vormonat (real, saison- und
kalenderbereinigt)
+0,1 % zum Vorjahresmonat (real,
kalenderbereinigt)
+0,6 % zum Vorjahresmonat (nominal)
Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist
im Jahr 2024 um 0,7 % gegenüber dem Vorjahr gesunken. Mit einem
Volumen von 103,5 Milliarden Euro lag der nominale (nicht
preisbereinigte) Auftragseingang um 1,1 % über dem Vorjahresniveau
und damit im zweiten Jahr in Folge im dreistelligen
Milliardenbereich, wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
mitteilt.
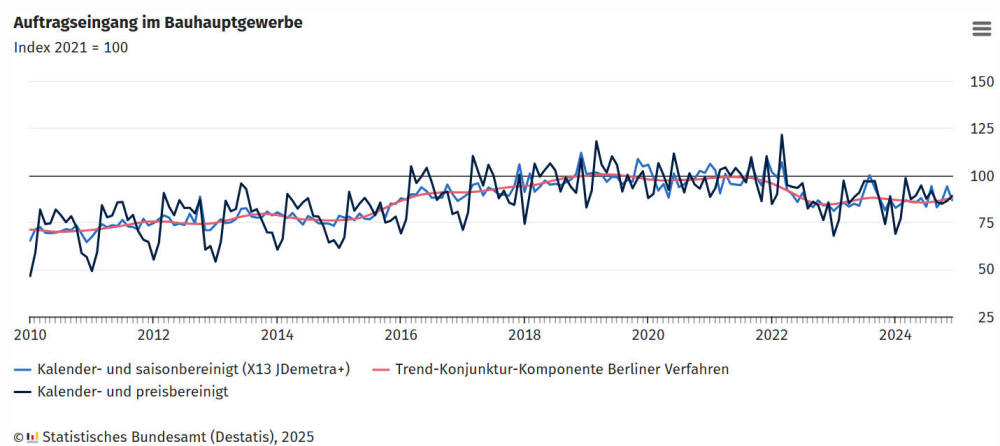
Im Hochbau lagen die
Auftragseingänge mit 47,2 Milliarden Euro real 5,0 % und nominal
4,0 % unter dem Vorjahresergebnis.
Dabei verzeichnete der
Wohnungsbau mit real -3,5 % (nominal: -2,4 %) geringere Einbußen als
der Nichtwohnungsbau (real: -5,8 %, nominal: -4,8 %). Der
Auftragseingang im Tiefbau lag dagegen mit 56,3 Milliarden Euro real
3,4 % und nominal 5,7 % höher als im Vorjahr. Großaufträge, vor
allem bei der Autobahn-, Brücken- und Tunnelsanierung und beim
Ausbau des Stromnetzes, trugen maßgeblich zum diesem Rekordergebnis
bei.
Auftragseingang sinkt im Dezember 2024 um 7,7 %
zum Vormonat
Im Dezember 2024 lag der reale (preisbereinigte)
Auftragseingang im Bauhauptgewerbe kalender- und saisonbereinigt
7,7 % unter dem November 2024. Im Vorjahresvergleich lag der reale
Auftragseingang im Dezember 2024 kalenderbereinigt 0,1 % niedriger.
Der Auftragseingang betrug rund 8,7 Milliarden Euro. Das waren
nominal (nicht preisbereinigt) 0,6 % mehr als im Dezember 2023.
Jahresumsatz im Bauhauptgewerbe real gesunken
Der
Jahresumsatz im Bauhauptgewerbe lag im Jahr 2024 real 1,0 %
niedriger als im Vorjahr. Nominal lag er 0,8 % höher und erreichte
einen neuen Höchststand von 114,8 Milliarden Euro. Innerhalb der
einzelnen Bauarten erwirtschaftete der gewerbliche Tiefbau mit
25,1 Milliarden Euro den höchsten Jahresumsatz, der gewerbliche
Hochbau folgte mit 24,8 Milliarden Euro.
In dieser
Statistik werden alle Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr
tätigen Personen erfasst. Im Jahr 2024 waren das rund 9 500 Betriebe
und damit 1,5 % weniger als im Vorjahr. Damit sank die Zahl dieser
Betriebe im Jahr 2024 erstmals nach 14 Jahren (2009: 7 000 Betriebe)
kontinuierlichen Wachstums.
In den befragten Betrieben
waren 2024 im Jahresdurchschnitt 534 200 Personen tätig. Das waren
rund 2 200 oder 0,4 % weniger als im Jahr zuvor. Die Entgelte lagen
im gleichen Zeitraum nominal 4,7 % über dem Vorjahresergebnis und
ergaben eine Gesamtsumme von 25,2 Milliarden Euro. Dabei wurden etwa
614 Millionen Arbeitsstunden (-0,6 % gegenüber 2023) auf Baustellen
geleistet.