






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 20. Kalenderwoche:
13. Mai
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Mittwoch, 14. Mai 2025
Stadt Duisburg warnt vor Waldbrandgefahr und verschärft das
Grillverbot
Das trockene Wetter und die sommerlichen
Temperaturen sollen auch in den nächsten Tagen anhalten. Dies führt
zu einer erhöhten Brandgefahr. Der Graslandfeuerindex liegt heute
bereits auf Stufe 3 und soll morgen (14. Mai) die Stufe 4 erreichen.
Das Grillen ist bei einem Graslandfeuerindex ab Stufe 4 –
der zweithöchsten Stufe – aus Brandschutzgründen generell im
öffentlichen Raum, also auch auf ausgewiesenen Grillflächen,
untersagt. Außerhalb dieser Flächen ist Grillen ohnehin ganzjährig
verboten. Der aktuelle Graslandfeuerindex ist online auf der
Homepage des Deutschen Wetterdienstes unter www.dwd.de abrufbar.
Die Stadt Duisburg weist ausdrücklich nochmals auf das
bestehende Rauchverbot im Wald in der Zeit vom 1. März bis 31.
Oktober hin. Ganzjährig gilt außerdem ein absolutes Grill- und
Feuerverbot im Wald und in Waldnähe. Zuwiderhandlungen können mit
einem Bußgeld geahndet werden.
Verstöße stellen eine
Ordnungswidrigkeit dar und können mit einer Geldbuße von bis zu
1.000 Euro, verbotenes Grillen in Grünanlagen und im Wald sogar mit
bis zu 5.000 Euro bestraft werden. Das maximal mögliche Bußgeld ist
gesetzlich mit 25.000 Euro festgelegt.
Weitere Informationen
rund um die Themen Grillen / Waldbrandgefahr im Stadtgebiet sind
online abrufbar unter:
https://duisburg.de/allgemein/fachbereiche/grillen.php
Bezirksvertretung Meiderich/Beeck zeichnet
ehrenamtliches Engagement aus Die Bezirksvertretung
Meiderich/Beeck hat am 12. Mai 2025 in einer feierlichen Zeremonie
Heinrich Uldrich aus Duisburg-Laar mit der Ehrenadel für
ehrenamtliches Engagement im Bezirk ausgezeichnet. Die Ehrung
übernahm Bezirksbürgermeister Peter Hoppe, der dessen
außerordentlichen Verdienste und seine jahrzehntelange Verbundenheit
mit dem Schützenwesen würdigte.

Bezirksbürgermeister Peter Hoppe (links) und Oberbürgermeister Sören
Link (mitte) verleihen die Ehrennadel des Bezirks.Meiderich/Beeck
für besonderes ehrenamtliches Engagement an Heinrich Uldrich
(rechts). Foto: Tanja Pickartz / Stadt Duisburg
Auch
Oberbürgermeister Sören Link richtete persönliche Worte an den
Geehrten sowie alle Anwesenden. In seiner Rede betonte er die
Bedeutung des Ehrenamts als unverzichtbare Stütze des
gesellschaftlichen Miteinanders: „Heinrich Uldrich steht für das,
was unsere Stadt ausmacht – Gemeinschaft, Verantwortung und
Zusammenhalt. Solches Engagement ist nicht selbstverständlich und
verdient höchsten Respekt.“
Heinrich Uldrich ist seit 1988
im Vorstand der Schützenbruderschaft St. Ewaldi in Duisburg-Laar
aktiv und prägte das Vereinsleben mit unermüdlichem Einsatz.
Sechsmal wurde er zum Schützenkönig gekrönt und organisierte die
Jubiläumsfeste zum 100- und 125-jährigen Bestehen des Vereins
maßgeblich mit. Mit seiner Arbeit, insbesondere im Bereich der
Jugendarbeit, hat er Generationen junger Menschen an die Werte des
Ehrenamts und die Gemeinschaft des Schützenwesens herangeführt.
Seine Tochter führt als erste Vorsitzende bereits seine Spuren
im Verein fort. Die Veranstaltung war nicht nur eine Würdigung
seiner persönlichen Verdienste, sondern auch ein klares Bekenntnis
zur Bedeutung des Ehrenamts in Duisburg.
Verleihung der Ehrennadel des Bezirks Mitte für
besonderes ehrenamtliches Engagement
Bezirksbürgermeisterin Elvira Ulitzka verleiht am Donnerstag, 15.
Mai 2025, um 18 Uhr AV Concept Store, Kuhlenwall 20, 47051 Duisburg,
die Ehrennadel des Bezirks Mitte für besonderes ehrenamtliches
Engagement.
Im Beisein von Oberbürgermeister Sören Link wird
die freischaffende Künstlerin Claudia A. Grundei sowie Karl-Heinz
Dietz für seine Verdienste im Naturschutz mit der Auszeichnung
geehrt.
Vorstellung der Kinderfeuerwehr Homberg
Die Kinderfeuerwehr Homberg hat sich im letzten Jahr
gegründet und ihren Dienst aufgenommen. Insgesamt 16 Kinder treffen
sich seitdem alle 14 Tage, um sich mit dem Thema Brandschutz und
Feuerwehr auseinander zu setzen. Ziel ist es mitunter, die Kinder-
und Jugendarbeit zu stärken und die Nachwuchsgewinnung in der
Freiwilligen Feuerwehr sicherzustellen und zu fördern.
Oberbürgermeister Sören Link, Christian Umbach, stellvertretender
Leiter der Feuerwehr Duisburg und Jens Heinrich,
Kinderfeuerwehrwart, stellen am Montag, 19. Mai, um 17 Uhr Feuer-
und Rettungswache Homberg Rheindeichstraße 22 47198
Duisburg-Homberg, die Kinderfeuerwehr vor. Die Kinder geben zudem
Einblicke in ihren Dienst und demonstrieren auch eine kleine
Löschübung.
Stadtgespräch in Duisburg: Schwarze Perspektiven im Dialog –
Erfahrungen, Herausforderungen, Empowerment
Das Zentrum
für Erinnerungskultur der Stadt Duisburg lädt am Mittwoch, 14. Mai,
um 18 Uhr in der Tarık-Turhan-Galerie im Stadtarchiv (Karmelplatz 5)
zu einem öffentlichen Stadtgespräch ein, das sich mit der Bedeutung
Schwarzer Perspektiven in unserer Stadtgesellschaft beschäftigt.
Gemeinsam mit Dr. Rahab Njeri, Expertin für rassismuskritische
Beratung an der Universität zu Köln, und Stève Hiobi, Autor des
Buches „All About Africa“ und Social-Media-Creator, werden
unterschiedliche Fragen diskutiert. Beispielsweise: warum sind
Schwarze Perspektiven in unserer Gesellschaft wichtig? Wie können
öffentliche Institutionen rassismuskritischer werden? Warum ist das
Wissen über Afrika oft unzureichend und welche Folgen hat das für
das Zusammenleben?
Im Zentrum des Gesprächs stehen Schwarze
Perspektiven und Erfahrungen – und wie diese in unserer Gesellschaft
und insbesondere in Duisburg sichtbar gemacht werden können. Wir
betrachten die (post-)kolonialen Spuren in der Stadt und deren
Einfluss auf die Gegenwart, insbesondere im Hinblick auf
antischwarze Stereotype und Diskriminierungen.
Mit den
Stadtgesprächen des Zentrums für Erinnerungskultur wird ein
wichtiger Raum für den Austausch über rassismuskritische Themen
geschaffen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich an
diesem Dialog zu beteiligen. Die Teilnahme am Stadtgespräch ist
kostenfrei, um vorherige Anmeldung per E-Mail an
zfe@stadt-duisburg.de wird gebeten.
Das Stadtgespräch findet
im Rahmen der Sonderausstellung „ÜBERSEeHEN. Auf (post-)kolonialer
Spurensuche“ des Zentrums für Erinnerungskultur im Kultur- und
Stadthistorischen Museum Duisburg statt. Die Ausstellung beleuchtet
die (post-)kolonialen Geschichten und deren Einfluss auf die heutige
Gesellschaft.
Soziale Roboter zum Anfassen: Die
RuhrBots kommen in die Zentralbibliothek
Soziale
Roboter begegnen uns längst nicht mehr nur in Science-FictionFilmen.
Am Dienstag, 3. Juni, besteht in der Zentralbibliothek an der
Steinschen Gasse von 10.30 bis 16 Uhr Gelegenheit, die sozialen
Roboter hautnah zu erleben, auszuprobieren und mit Forschenden ins
Gespräch zu kommen.
Alle Interessierten sind herzlich
willkommen. Ob als sprechender Infoassistent, interaktive Bedienung
im Restaurant oder als kommunikativer Begleiter in
Pflegeeinrichtungen – die kleinen Helfer mit der menschenähnlichen
Gestalt sind auf dem Vormarsch. Auch in der öffentlichen Verwaltung
eröffnen sie neue Möglichkeiten, um Prozesse bürgerfreundlicher,
zugänglicher und effizienter zu gestalten.
Das
interdisziplinäre Forschungsprojekt „RuhrBots – Kompetenzzentrum
Soziale Robotik“ erforscht genau diesen Zukunftseinsatz: Wie können
soziale Roboter in Stadtverwaltungen sinnvoll integriert werden?
Welche technischen, psychologischen und wirtschaftlichen Bedingungen
müssen dafür erfüllt sein? Und wie gelingt eine diversitätsgerechte
Digitalisierung, von der alle Bürger profitieren?
Gefördert
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit rund vier
Millionen Euro arbeitet das RuhrBots-Team – bestehend unter anderem
aus der Hochschule Ruhr West, der Hochschule Niederrhein, der
Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW, der
Evangelischen Hochschule Nürnberg und dem Fraunhofer-Institut für
Mikroelektronische Schaltungen und Systeme (IMS) – an innovativen
Lösungen. Im Mittelpunkt steht der Mensch: Die Roboter sollen nicht
ersetzen, sondern sinnvoll unterstützen.
Bezirksregierung setzt sich für Vereinbarkeit von Beruf und Pflege
ein
Im Rahmen des Landesprogramms „Vereinbarkeit Beruf &
Pflege NRW“ hat Regierungspräsident Thomas Schürmann die Charta zur
Vereinbarkeit von Beruf und Pflege im Namen der Bezirksregierung
Düsseldorf unterzeichnet. Das Landesprogramm ist eine Kooperation
des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW mit den
Landesverbänden der Pflegekassen und dem Verband der Privaten
Krankenversicherung.
„Es ist ein sehr schönes Signal, dass
auch die Bezirksregierung Düsseldorf am Landesprogramm
„Vereinbarkeit von Beruf & Pflege“ teilnimmt. Jeder weitere Beitritt
stärkt die NRW-weite Initiative und das regionale Netzwerk. Das
Landesprogramm verbessert die Fachkräftebindung und wirkt sich
positiv auf die Stabilisierung der häuslichen Pflege aus, indem
erwerbstätige pflegende Angehörige Unterstützung vor Ort erfahren“,
erklärt Heike Weiß, Leiterin der Abteilung Pflege und Alter im
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes
Nordrhein-Westfalen.
Der demografische Wandel stellt sowohl
unsere Gesellschaft als auch Unternehmen vor erheblichen
Herausforderungen. Aufgrund der Alterung der Belegschaft und einem
steigenden Fachkräftemangel wird die Vereinbarkeit von Beruf und
Pflege immer relevanter. Daher wird insbesondere durch die
nachhaltige Unterstützung berufstätiger pflegender Angehöriger ein
wichtiger Beitrag zur Fachkräftesicherung geleistet und die
Erwerbstätigkeit von pflegenden Mitarbeitenden aufrechterhalten.
Thomas Schürmann betonte: „Allein in Nordrhein-Westfalen pflegen
derzeit neben dem Beruf geschätzt mehr als 700.000 Erwerbstätige
pflegebedürftige Angehörige. Deshalb setzen wir als Bezirksregierung
ein wichtiges Zeichen, um allen Pflegenden zu zeigen, dass sie nicht
auf sich allein gestellt sind. Wir haben bereits drei Pflege-Guides
durch die AOK Rheinland/Hamburg und AOK NordWest qualifizieren
lassen, die als Ansprechpersonen für unsere Mitarbeitenden bei
Fragen zu Pflege- und Notfallsituationen zur Verfügung stehen.“
Die Pflege-Guides bieten Unterstützung, indem sie als erste
Anlaufstelle dienen, Informationen zu externen Hilfsangeboten
weitergeben, über gesetzliche Regelungen und Vereinbarkeitsangebote
informieren sowie zwischen pflegenden Mitarbeitenden und der
Personalabteilung vermitteln.
Der Beitritt zur Charta der
Vereinbarkeit von Beruf und Pflege ergänzt die bereits bestehenden
Unterstützungsangebote der Bezirksregierung Düsseldorf, wie die
Sozialen Ansprechpersonen (SAPen), das MUT-Team, die
24/7-Notfall-Hotline und die betriebspsychologische Sprechstunde.
Die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege berücksichtigt dabei
auch strukturelle, geschlechterbezogene Aspekte und die körperliche
sowie psychische Gesundheit der pflegenden Kolleginnen und Kollegen.
Pflege-Guides sind zudem beim Betrieblichen Gesundheitsmanagement
(BGM) und im Gleichstellungsbüro aufzufinden.
Sicher
Inline-Skaten und Rollschuhfahren: Bei der Anschaffung von Inlinern
und Roller Blades auf geprüfte Sicherheit achten.
Helm
und Schutzausrüstung verringern das Verletzungsrisiko. TÜV-Verband
gibt Tipps zu Technik und Fahrverhalten – ideal für Anfänger:innen
und Kinder.
Inline-Skaten und Rollschuhfahren erfreuen sich
großer Beliebtheit – besonders bei Kindern. Der Sport auf Rollen
stärkt Motorik, Gleichgewichtssinn und Ausdauer, fördert die
Bewegung im Freien und macht obendrein Spaß. Doch wer ohne geeignete
Schutzausrüstung oder technische Grundkenntnisse startet, riskiert
Stürze und Verletzungen.
„Inline-Skates und Rollschuhe
fördern Körperwahrnehmung, Selbstvertrauen und Koordination“, sagt
André Siegl, Experte für Arbeits- und Gesundheitsschutz beim
TÜV-Verband. „Inliner und Roller Blades sind aber keine Spielzeuge,
sondern Sportgeräte. Damit die Freude am Fahren nicht durch Unfälle
getrübt wird, ist eine gute Sicherheitsausstattung und methodisches
Lernen von Anfang an unerlässlich.“ Der TÜV-Verband zeigt, worauf
Anfänger:innen achten sollten – von der Auswahl der passenden Skates
über sicheres Bremsen bis zum Verhalten im Straßenverkehr.

Foto Pixabay
Inline-Skates und Rollschuhe kaufen: Die
wichtigsten Tipps
Beim Kauf von Inline-Skates oder Rollschuhen
zählt mehr als nur das Design. Eine gute Wahl richtet sich nach
Alter, Fahrverhalten und Sicherheitsaspekten – insbesondere bei
Einsteiger:innen. Rollschuhe mit zwei Achsen und vier nebeneinander
angeordneten Rollen bieten gute Kippstabilität und erleichtern das
Halten des Gleichgewichts.
Inline-Skates mit standardmäßig
vier, bei besonderen Modellen mit drei oder fünf
hintereinanderliegenden Rollen sind wendiger und schneller,
erfordern aber mehr Körperbeherrschung. „Inline-Skates verlangen
mehr Gleichgewichtssinn und Koordination, sind aber vielseitiger
einsetzbar – vom Bürgersteig bis zur Asphaltstrecke“, sagt Siegl.
Wichtig ist die Passform: Der Schuh sollte gut und möglichst
ohne am Fuß reibende Nähte gepolstert sein. Er darf nicht drücken,
sollte aber auf keinen Fall zu groß sein, da sonst der Halt verloren
geht und das Risiko eines Sturzes steigt. Eine feste Fersenführung
schützt vor dem Umknicken, ein weiches Innenfutter erhöht den
Komfort.
Riemen oder Klickverschlüsse sind für Kinderhände
leichter zu bedienen als klassische Schnürsenkel – das fördert die
Selbstständigkeit beim Anziehen und sorgt für Motivation beim Üben.
Das Material sollte regelmäßig kontrolliert werden – lose Schrauben
oder beschädigte Rollen können ein Sicherheitsrisiko sein.
Für Kinder sind „mitwachsende“ Modelle mit verstellbarer Größe
besonders sinnvoll. Sie lassen sich über mehrere Schuhgrößen
anpassen und sparen Kosten. „Für junge oder unsichere Kinder sind
Kombiskates empfehlenswert, die sich vom Rollschuh in Inline-Skates
umbauen lassen“, sagt Siegl. So können junge Fahrer:innen mit einem
stabileren Modell beginnen und später umsteigen.
Grundsätzlich sollten Eltern beim Kauf auf geprüfte Sicherheit
achten. „Produkte mit dem GS-Zeichen für ‚geprüfte Sicherheit‘
erfüllen die EU-weiten Sicherheitsbestimmungen sowie Anforderungen
der DIN-Norm DIN EN 71 für Spielzeuge. Darüber hinaus wurden die
Produkte durch unabhängige Prüfstellen kontrolliert“, sagt Siegl.
Auch in Sachen Funktionsfähigkeit, Materialgüte und Verarbeitung
gibt das GS-Zeichen Orientierung: Dazu zählen ein stabiles Gehäuse,
leichtgängige Rollen, atmungsaktive und schadstofffreie Materialien
oder sauber verarbeitete Nähte.
Produkte, die von Kindern
bis 14 Jahren verwendet werden, fallen unter die europäische
Spielzeugrichtlinie. Darüber hinaus müssen Rollsportgeräte bei einem
Körpergewicht von 20 bis 100 kg die sicherheitstechnischen
Anforderungen von Inline-Skates nach DIN EN 13843 und von
Rollschuhen nach DIN EN 13899 erfüllen.
Ohne Helm und Schoner
geht nichts: Die richtige Schutzausrüstung
Entscheidend für die
Sicherheit ist eine komplette Schutzausrüstung. Dazu gehören ein
Helm sowie Knie-, Ellenbogen- und Handgelenkschoner. „Ein Sturz auf
den Kopf kann schwerwiegende Folgen haben – ein Helm schützt den
Kopf und kann schwere Verletzungen verhindern oder lindern“, sagt
Siegl. „Protektoren schützen vor Hautabschürfungen, Prellungen und
sogar Knochenbrüchen – insbesondere an Handgelenken und Ellenbogen,
die bei Stürzen instinktiv zuerst den Boden berühren.“ Für geübte
Skater:innen, die mit hoher Geschwindigkeit unterwegs sind,
empfiehlt sich eine Protektorenhose und gegebenenfalls ein
Rückenprotektor.
Wichtig ist: Die Schutzausrüstung muss
richtig sitzen – fest, ohne zu rutschen oder einzuschneiden. Für
Kinder sind Modelle praktisch, die die Kinder selbstständig anziehen
können. Eltern sollten beim Kauf von Schutzausrüstung ebenfalls auf
geprüfte Sicherheit und ein Prüfzeichen von achten. – das
freiwillige GS-Zeichen bietet auch hier einen Hinweis, dass der
Hersteller das Produkt von einer GS-Stelle, wie einem
TÜV-Unternehmen, geprüft wurde und hohe
Produktsicherheitsanforderungen erfüllt.
Die ersten Meter auf
Skates: Gleichgewicht halten, Bremsen und sicheres Fallen lernen
Der Einstieg ins Skaten beginnt idealerweise in einem
verkehrsberuhigten Bereich auf ebenem Gelände mit fester
Bodenstruktur – ein Schulhof, ein leerer Parkplatz oder eine breite
Spielstraße bieten gute Voraussetzungen. Wichtig: Kinder sollten
sich die ersten Schritte selbst erarbeiten dürfen, ohne geschoben
oder gezogen zu werden.
Gleichgewicht halten: „Nur wer das
Gleichgewicht aus eigener Kraft hält, entwickelt die nötige
Körperkontrolle für sicheres Skaten“, erklärt Siegl. Die richtige
Körperhaltung hilft dabei, Stabilität zu gewinnen: Knie leicht
beugen, den Po nach hinten schieben und die Arme locker nach vorn
strecken. Diese Position stabilisiert den Oberkörper, verlagert das
Gewicht nach unten und gibt Anfänger:innen ein sicheres Standgefühl.
Bewegungen sollten ruhig und gleichmäßig erfolgen – hektisches
Strampeln oder Stehenbleiben aus Angst führen oft zum Umkippen.
Kontrolliert fallen: Mindestens genauso wichtig wie das
Fahren ist das kontrollierte Fallen. „Kinder sollten üben, sich bei
einem Sturz gezielt nach vorn fallen zu lassen – auf Knie und Hände,
die durch Knie, Ellenbogen- und Handgelenkschoner geschützt sind“,
sagt Siegl. Das reduziert die Wucht des Aufpralls und schützt vor
Verletzungen am Hinterkopf und Rücken. Auch das Abrollen über
Unterarme oder das leichte Abstützen mit den Handflächen kann
trainiert werden, um Reflexe zu schulen und Verletzungen zu
vermeiden.
Wer frühzeitig lernt, wie sich ein Sturz anfühlt
und wie er abgemildert werden kann, verliert die Angst und gewinnt
Sicherheit auf Rollen – ein entscheidender Schritt für langfristigen
Spaß am Skaten. Kleine Stürze gehören zum Lernen dazu – wichtig ist,
dass Eltern Ruhe bewahren und Verletzungen ernst nehmen. Kleine
Schürfwunden sollten sofort gereinigt und desinfiziert werden. Bei
stärkeren Prellungen, Schwellungen oder Schmerzen am Gelenk: lieber
ärztlich abklären lassen.
Richtig bremsen: Beim Bremsen
sind viele Anfänger:innen unsicher. Allround-Inline-Skates haben
meist eine Fersenbremse mit der dann ein sogenannter Heelbrake
praktiziert werden kann. Das Fersenbremsen kann durch ausreichend
Training schnell und gut erlernt werden. Sie ist zwar praktisch,
kann aber zum abrupten Stopp führen und das Gleichgewicht stören.
Einige Inline-Skates für den Leistungssport, wie Speed-Skates,
Hockey-Skates oder Street-Skates haben keine Bremsen. „Wer sicher
bremsen will, sollte alternative Techniken erlernen“, rät Siegl.
„Bei Inline-Skates ohne Bremsen wird für schnelles Abbremsen
meist der „T-Stop“ angewendet. Um die Geschwindigkeit zu reduzieren
und dann zum Stehen zu kommen, wird oft die V-Bremse praktiziert.“
Bei diesen Bremstechniken werden die Füße jeweils, wie ein T oder V
positioniert. Auch kontrolliertes Ausrollen vor einem Hindernis
gehört zur Grundtechnik. Wird aus dem spielerischen Spaß am Rollen
ein erstzunehmender Freizeitsport, empfehlen sich professionelle
Kurse zu Lauf-, Brems- und Falltechniken.
Bremsen mit
Rollschuhen: Rollschuhe sind anders aufgebaut als Inline-Skates. Die
Stopper sind an beiden Skates vorn an der Grundplatte befestigt. Die
Bremstechnik unterscheidet sich von den Inline-Skates stark. Zum
Bremsen muss die Ferse angehoben oder das Bein angewinkelt werden
und der Fuß samt Rollschuh nach vorne gekippt werden und Druck auf
den Fußballen bzw. auf die Zehen und somit auf den Stopper ausgeübt
werden. Dies muss langsam und mit Anpassung an die
Skate-Geschwindigkeit intensiviert werden. Wird bei höherer
Geschwindigkeit zu viel Druck ausgeübt, können Skater:innen leicht
nach vorne kippen und stürzen, daher ist hier einiges Üben angesagt.
Inline-Skaten und Rollschuhfahren im Straßenverkehr
Ob
Spielstraße oder Gehweg – Anfänger:innen sollten nur dort fahren, wo
sie sich sicher bewegen können. „Bordsteine, Schlaglöcher und Laub
stellen echte Gefahren dar“, erklärt Siegl. „Der ideale Übungsort
ist eine Fläche ohne Verkehr und mit ausreichend Platz. Ideal sind
an Sonntagen die leeren Parkplätze von Super- oder Baumärkten an, um
die eigenen Fähigkeiten als Skater:in auszubauen.“
Im
Straßenverkehr gelten Skater:innen als Fußgänger:innen – sie müssen
auf achtsame Weise den Gehweg nutzen und dürfen Radwege nur dann
befahren, wenn ein Zusatzschild dies erlaubt. Besonders an
Kreuzungen, Garagenzufahrten oder Einmündungen ist Vorsicht geboten.
„Langsam heranfahren, bremsbereit bleiben und Blickkontakt mit
anderen Verkehrsteilnehmer:innen suchen – das sind einfache, aber
wirksame Sicherheitsregeln“, sagt Siegl. Für Kinder ist es
hilfreich, diese Situationen mit den Eltern vorab durchzuspielen.
RVR-Energiebilanz:
Treibhausgas-Emissionen sanken innerhalb von zehn Jahren um 21
Prozent
Im Ruhrgebiet wurden 2022 rund 82 Millionen
Tonnen Treibhausgas-Emissionen freigesetzt; das waren 21 Prozent
weniger als 2012. Das zeigt die Fortschreibung der regionalen
Energie- und Treibhausgas-Bilanz des Regionalverbandes Ruhr (RVR).
Der Endenergieverbrauch im Ruhrgebiet sank in diesem Zeitraum um 14
Prozent auf rund 230 Terawattstunden - und das trotz gestiegener
Einwohner- und Beschäftigtenzahlen.
Der kontinuierliche
Ausbau der erneuerbaren Energien führt insbesondere beim Strom zu
einem spürbaren Rückgang der Treibhausgas-Emissionen. Neben den
Klimaschutzmaßnahmen der Kommunen, der Wirtschaft und der privaten
Haushalte hatten auch externe Effekte wie die Corona-Pandemie und
die Energiekrise als Folge des Ukraine-Kriegs großen Einfluss auf
die Energieverbräuche.
RVR-Regionaldirektor Garrelt
Duin sagt zum Ziel der Klimaneutralität 2045: "Das Ruhrgebiet will
Industrieregion bleiben und klimaneutral werden. Um die Energiewende
zu schaffen, müssen Wirtschaft und Verbraucher stärker zu
Mitgestaltern gemacht werden, so der Koalitionsvertrag zwischen CDU,
CSU und SPD. Insofern erwarten wir von der neuen Bundesregierung,
dass sie den Ausbau Erneuerbarer Energien und den
Wasserstoffhochlauf konsequent fördert sowie Anreize für
energiesparendes und klimaschonendes Handeln der Verbraucher
schafft."
Die Kommunen im Ruhrgebiet haben gemeinsam mit dem
RVR schon früh Klimaschutzstrategien entwickelt, um die
Treibhausgase zu reduzieren. Ein Baustein der im Ruhrparlament
verabschiedeten regionalen Strategie Grüne Infrastruktur ist die
Multifunktionalität von Flächen, um Themen wie Ausbau erneuerbarer
Energien, Flächenverbrauch und wirtschaftliche Entwicklung gemeinsam
zu denken.
Zahlreiche Kommunen prüfen bereits, wie man auf
Freiflächen Photovoltaik-Anlagen mit anderen Nutzungen wie
Parkplätzen und Landwirtschaft kombinieren kann. 2024 ging mit einer
Leistung von 5,6 Megawattpeak die größte schwimmende PV-Anlage des
Landes NRW in Wesel ans Netz. Weitere Großprojekte wie die
Errichtung eines der größten Solar-Carport-Anlagen Deutschlands auf
dem Messeparkplatz P10 in Essen (Leistung: 11 Megawattpeak) oder der
Bau des Solarparks Fröndenberg auf einer ehemaligen Deponie
(Leistung: 15 Megawattpeak) sind in Planung.
Beim RVR laufen
Interessenbekundungsverfahren für Solar und Windenergie auf
verbandseigenen Flächen. Mit der regelmäßigen Erhebung zu den
Treibhausgas-Emissionen im Ruhrgebiet legt der RVR alle zwei Jahre
valide und vergleichbare Daten für alle Kommunen im Verbandsgebiet
vor. Für das Ruhrgebiet mit 53 Kommunen liegen flächendeckend
detaillierte 2022er Bilanzen vor. Das ist deutschlandweit einmalig.
idr
VHS Rheinhausen bietet kostenfreie Balfolk-Tanztreffs
Die Volkshochschule bietet einen offenen, kostenfreien
Balfolk-Tanztreff in der Zweigstelle auf der Arndtstraße in
Duisburg-Rheinhausen an, bei dem Tanzfreudige verschiedene Tänze
erlernen. Die nächsten Tanztreff-Termine sind mittwochs am 23.
April, 14. Mai, 11. sowie 25. Juni, jeweils von 18.30 bis 20.30 Uhr.
Neulinge und Menschen mit Tanzerfahrung tanzen zusammen.
Die
Tanztreffs werden von Tomas Renner, der selbst erfahrener
Balfolk-Tänzer und -Dozent ist, moderiert und die Tänze werden
angeleitet. Balfolk, das ist Freude an der Musik, an der Bewegung
und am Miteinander. Balfolk hat seinen Ursprung im Frankreich der
1970er Jahre. Heute ist Balfolk in den Benelux-Ländern und in
Frankreich sehr populär.
Beim Balfolk gibt es Paartänze,
Kettentänze und Gruppentänze. Teilnehmen können Einzelpersonen und
Paare. Interessierte können auch an einzelnen Terminen teilnehmen.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Eine vorherige Anmeldung zu
den Terminen online über die Homepage der VHS unter
www.vhs-duisburg.de oder in den Geschäftsstellen der VHS (0203 283
8475, vhs-west@stadt-duisburg.de) ist erforderlich.
Strick- und Häkelspaß: „Maschengedöns“ in der
Zentralbibliothek
Wer immer schon wissen wollte, wie
man strickt oder häkelt, oder mit einem angefangenen Projekt nicht
weiterkommt, ist herzlich zum „Maschengedöns“ in der
Zentralbibliothek auf der Steinschen Gasse 26 in der Duisburger
Innenstadt eingeladen.

Die Expertinnen der „Flinken Nadeln“ geben von 15 bis 17 Uhr
Tipps zum Umgang mit Nadeln und Wolle. Sie erklären, wie man Maschen
anschlägt und abnimmt und stehen mit Rat und Tat zur Seite. Das
Angebot richtet sich an alle Interessierten ab 14 Jahren und findet
monatlich in der MachBar in der dritten Etage der Bibliothek statt.
Die Teilnahme ist kostenlos, eigene Nadeln und Wolle
müssen mitgebracht werden. Die „Flinken Nadeln“ unterstützen mit
ihrer Handarbeit den Bunten Kreis Duisburg e. V. bei seinem Einsatz
für Familien mit zu früh geborenen und schwerkranken Kindern. Um
eine vorherige Online-Anmeldung auf www.stadtbibliothek-duisburg.de
(unter „Veranstaltungen“) wird gebeten. Woll-Spenden werden bei den
Workshops gerne angenommen.
Parkkonzert mit den
„Wahren Freunden“ im Jubiläumshain
Das nächste
Parkkonzert im Jubiläumshain an der Ziegelhorststraße in
Duisburg-Hamborn findet am Sonntag, 18. Mai, um 11 Uhr mit einem
Konzert der Musikgruppe „Wahre Freunde“ statt. Wer hier dabei ist,
erlebt Volksmusik, Schlager, Lieder mit Gefühl, verpackt mit einer
guten Prise Humor.
Auch in diesem Jahr werden die
Parkkonzerte wieder vom Lions Club Duisburg-Hamborn unterstützt. Der
Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es im Internet unter
https://www.facebook.com/ParkkonzerteHamborn Weitere Parkkonzerte
finden an diesen Terminen statt:
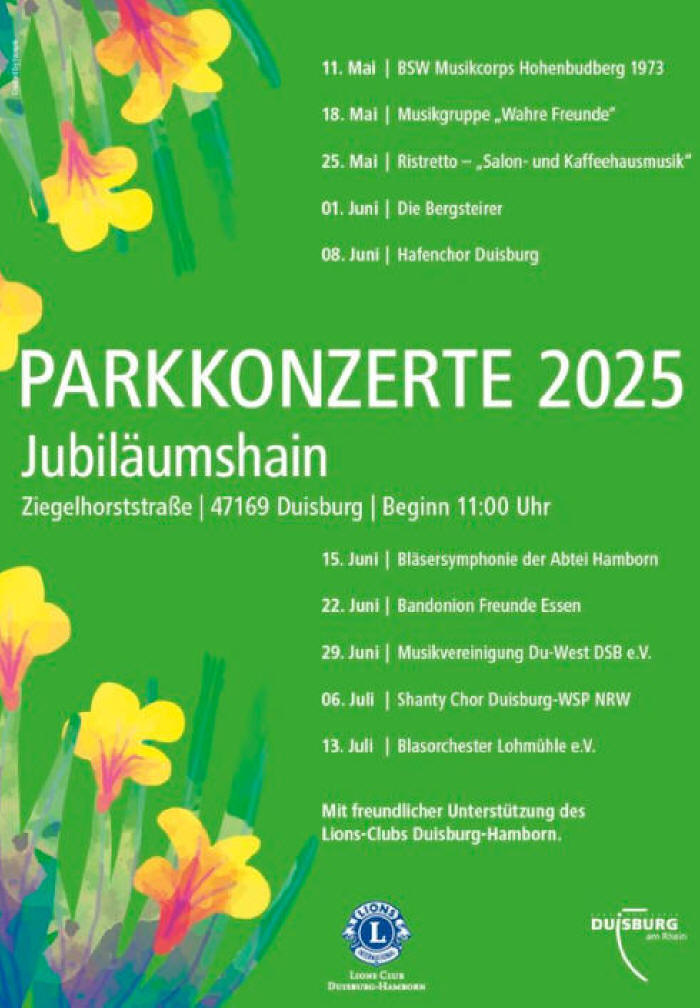
25.05.2025 Ristretto – „Salon- und Kaffeehausmusik“
01.06.2025
Die Bergsteirer
08.06.2025 Hafenchor Duisburg
15.06.2025
Bläsersymphonie der Abtei Hamborn
22.06.2025 Bandonion Freunde
Essen
29.06.2025 Musikvereinigung Du-West DSB e.V. 06.07.2025
Shanty Chor Duisburg-WSP NRW 13.07.2025 Blasorchester Lohmühle e.V.
„Gospels and more“ Offenes Chorprojekt in Großenbaum
Annette Erdmann (Foto: Rolf Schotsch), Kantorin der Evangelischen
Versöhnungsgemeinde Duisburg-Süd weiß , welche positiven
Auswirkungen aktives Singen auf das menschliche Wohlbefinden hat.
Davon berichten ihr Chormitglieder und sie kennt es aus eigener
Erfahrung: „Singen heißt Energie tanken, Stress abbauen und die
Seele befreien“. Und: „Gerade in der aktuellen Zeit tut es gut,
gemeinsam von Hoffnung zu singen.“

Alle, die Freude am Singen haben, sind herzlich eingeladen, beim
Gospelprojekt der Kantorei mitzuwirken. Kraftvolle, mitreißende
Gospels und auch gefühlvolle Balladen stehen auf dem Programm,
darunter auch der bekannte Song „You raise me up“. Geprobt wird
jeweils mittwochs von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr: am 14. Mai im
Gemeindehaus, Lauenburger Allee 21 oder nach Absprache in der
Versöhnungskirche, Lauenburger Allee 23.
Wer mitmachen
möchte, kann sich bis zum 4. Mai bei Kantorin Annette Erdmann
anmelden (per E-Mail an annette.erdmann@ekir.de oder telefonisch
0203 / 76 77 09). Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter
www.evgds.de.
Singnachmittage mit Popkantor Daniel Drückes in Wanheim und
Wanheimerort
Musiker und Popkantor Daniel Drückes lädt
alle, die Lust auf gemeinsames Singen in gemütlicher Runde in der
Evangelischen Rheingemeinde Duisburg haben, zweimal im Monat zum
Mitmachen ein. Das nächste Singen in Gemeinschaft gibt es am 14. Mai
2025 um 14 Uhr im Gemeindehaus Wanheimerort, Vogelsangplatz 1; der
zweite Singnachmittag in diesem Monat startet am 15. Mai 2025 um 15
Uhr im Gemeindehaus Wanheim, Beim Knevelshof 45.
Auf dem
Programm stehen wie immer bekannte Lieder, Popsongs und Evergreens.
Zwischen dem Singen ist Platz für Kaffee und Kekse. Die Idee zu den
Musiknachmittagen zum Mitmachen hatte Daniel Drückes gemeinsam mit
Ehrenamtskoordinatorin Maria Hönes: Mit dem zusätzlichen Angebot
gilt es ältere und junge Menschen beim Singen zusammen zu bringen,
ganz nach dem Motto „Singen verbindet Generationen“. Mitsingen darf
jede und jeder.

Stationäre Hautkrebsbehandlungen binnen 20 Jahren um
87,5 % gestiegen
Die Tage werden wärmer, und damit
zieht es die Menschen zunehmend ins Freie. Der Sonnenschein birgt
jedoch auch Gesundheitsrisiken: Übermäßige UV-Strahlung und
Sonnenbrände können Krankheiten wie Hautkrebs auslösen. Innerhalb
von 20 Jahren hat die Zahl der Krankenhausbehandlungen wegen
Hautkrebs fast stetig zugenommen.
116 900 Menschen wurden
2023 mit der Diagnose Hautkrebs im Krankenhaus stationär behandelt.
Das waren 87,5 % mehr Fälle als im Jahr 2003, wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) mitteilt. Zum Vergleich: Die stationären
Krankenhausbehandlungen insgesamt sind im selben Zeitraum um 1,2 %
gefallen.
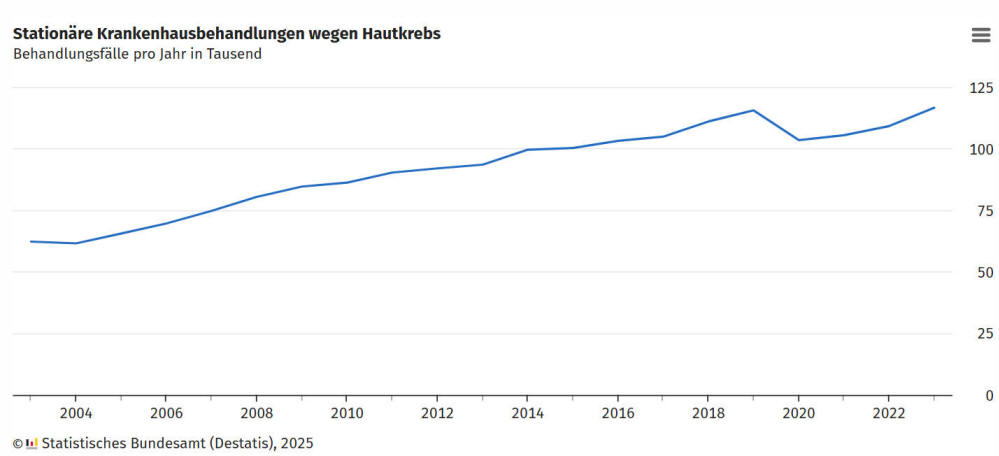
Behandlungsfälle aufgrund von hellem Hautkrebs besonders stark
gestiegen Zugenommen haben vor allem die Behandlungsfälle aufgrund
des sogenannten hellen Hautkrebses. Sie haben sich binnen 20 Jahren
mehr als verdoppelt (+117,0 %): von 41 900 Fällen im Jahr 2003 auf
91 000 im Jahr 2023. Wegen des sogenannten schwarzen Hautkrebses gab
es 2023 rund 26 000 stationäre Behandlungen und damit gut ein
Viertel (26,9 %) mehr als 2003. Vor allem heller Hautkrebs steht in
Verdacht, durch Sonnenlicht mitausgelöst zu werden.
Hautkrebs
bei 8,1 % aller stationären Krebsbehandlungen Hauptdiagnose
Hautkrebs war bei 8,1 % aller stationären Krebsbehandlungen im Jahr
2023 die Hauptdiagnose. Der Anteil der Hautkrebs- an allen
Krebsbehandlungen hat sich binnen 20 Jahren nahezu verdoppelt: Im
Jahr 2003 hatte er noch bei 4,1 % gelegen. Männer sind dabei
häufiger betroffen als Frauen: Auf sie entfielen zuletzt 56,1 % der
stationären Behandlungen wegen Hautkrebs, aber nur 48,2 % aller
Krankenhausbehandlungen insgesamt.
Zahl der Todesfälle wegen
Hautkrebs binnen 20 Jahren um 60,8 % gestiegen
An Hautkrebs
starben im Jahr 2023 rund 4 500 Menschen. Das waren 60,8 % mehr als
im Jahr 2003 mit 2 800 solcher Todesfälle. Im selben Zeitraum ist
die Zahl der Todesfälle wegen Krebserkrankungen insgesamt lediglich
um 10,1 % gestiegen. Wie bei den meisten Krebserkrankungen sind auch
bei Hautkrebs vor allem ältere Menschen betroffen: So war mehr als
die Hälfte (52,8 %) der 2023 an Hautkrebs Verstorbenen 80 Jahre und
älter.
Relativ gesehen ist das Risiko, an Hautkrebs zu
versterben, in der Altersgruppe der 30- bis 34-Jährigen am höchsten:
Hier war Hautkrebs in 1,0 % der Todesfälle die Todesursache, während
der Anteil über alle Altersgruppen hinweg bei nur 0,4 % lag.
Drei Prozent der Bevölkerung in NRW besaß die polnische
Staatsangehörigkeit
Zum Zensusstichtag am 15. Mai 2022
lebten 536.103 Personen mit einer polnischen Staatsangehörigkeit in
NRW. Somit waren 3,0 % der Bevölkerung polnische Staatsangehörige.
Anlässlich der Präsidentschaftswahlen in Polen am 18. Mai 2025
liefert das Statistische Landesamt auf Basis der Ergebnisse des
Zensus 2022 Fakten zur Struktur der polnischen Bevölkerung in NRW.
Knapp zwei Drittel aller polnischen Personen in NRW sind
Doppelstaatlerinnen oder Doppelstaatler Von den polnischen
Staatsangehörigen in NRW waren 18,6 % im Mai 2022 unter 18 Jahren
alt. Demgegenüber waren 81,4 % der Polinnen und Polen – etwas über
436.000 Personen – volljährig. Fast zwei Drittel bzw. 65,7 % der
Polinnen und Polen in NRW besaßen neben der polnischen auch die
deutsche Staatsangehörigkeit.
Insgesamt waren rund 352.000
Personen deutsch-polnische Doppelstaatlerinnen bzw. Doppelstaatler.
Genau 34 % der Polinnen und Polen besaßen ausschließlich die
polnische Staatsangehörigkeit und 0,3 % waren Staatsangehörige von
Polen und einem weiteren Land. Emmerich und Weeze: Jede/jeder Zehnte
hat die polnische Staatsangehörigkeit Auf Ebene der Gemeinden zeigen
sich deutliche Unterschiede in Bezug auf den Anteil polnischer
Personen an der Gesamtbevölkerung.
So besaß im Mai 2022 jede
zehnte Person in Emmerich am Rhein (10,4 %) und in Weeze (10,1 %)
die polnische Staatsangehörigkeit. Auch in anderen Gemeinden im
Kreis Kleve fand sich ein überdurchschnittlich hoher Anteil von
Polinnen und Polen, so zum Beispiel in den Städten Straelen mit 8,9
%, Kleve mit 8,5 % oder Kevelaer mit 8,3 %. Demgegenüber fanden sich
die geringsten Anteile in einzelnen Gemeinden im Kreis Höxter und im
Kreis Steinfurt.
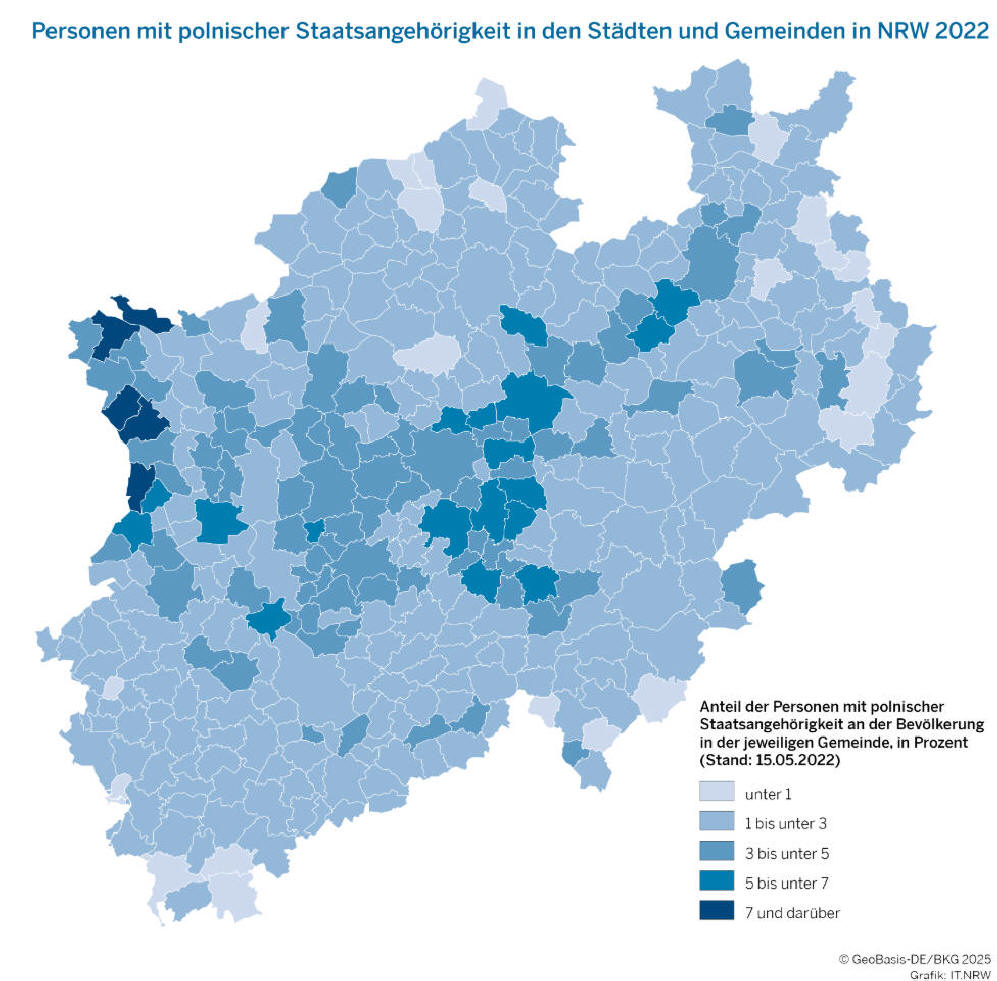
Zu nennen sind insbesondere die Stadt Marienmünster, in der 0,4
% der Bevölkerung polnisch war, und die Gemeinde Hopsten sowie die
Stadt Brakel mit einem Anteil von jeweils 0,5 % polnischer
Staatsangehöriger. Insgesamt leben mehr als eine halbe Million
Polinnen und Polen in NRW, die meisten in Dortmund und Köln Gemessen
an den absoluten Werten lebten im Mai 2022 auf Gemeindeebene die
meisten Polinnen und Polen in der Stadt Dortmund.
Dort
besaßen 22.787 Personen die polnische Staatsangehörigkeit. Mit
22.737 Polinnen und Polen folgte Köln dicht dahinter auf Platz zwei.
In Essen wohnten 19.490 polnische Staatsangehörige. Damit belegte
Essen Platz drei. Bei Betrachtung der Kreise und kreisfreien Städte
in NRW verliert Essen allerdings seinen dritten Platz: Im Märkischen
Kreis besaßen 2022 insgesamt 20.269 Personen die polnische
Staatsangehörigkeit.