






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 20. Kalenderwoche:
15. Mai
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Freitag, 16. Mai 2025
Alt-Hamborn: Großer Feuerwehr- und Rettungsdienst-Einsatz
auf der Duisburger Straße Auf der Duisburger Straße kam es
heute Mittag in Höhe des Hamborner Rathauses zu mehreren
medizinischen Notfällen. Gegen 13.10 Uhr prallte ein Auto aus
bislang ungeklärter Ursache gegen einen Oberleitungsmast der
Straßenbahn. Der Pkw-Fahrer wurde verletzt und in seinem Fahrzeug
eingeschlossen.
Die Feuerwehr konnte den Autofahrer mit
hydraulischem Rettungsgerät aus seinem Fahrzeug befreien, er wurde
anschließend dem Rettungsdienst für die medizinische Versorgung
übergeben. In der Zwischenzeit kam es in der Nähe zu einem Sturz
einer E-RollerFahrerin, um die sich ein zusätzlich alarmierter
Rettungsdienst kümmerte. Auch in der wartenden Straßenbahn musste
eine Person medizinisch notversorgt werden.
Alle drei
Patienten wurden nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort für
weiterführende Untersuchungen und Behandlungen in ein Krankenhaus
gefahren. Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr und zehn
des Rettungsdienstes vor Ort im Einsatz. Die Feuerwehr konnte den
Einsatz bereits beenden. Auf der Duisburger Straße kommt es aktuell
noch zu deutlichen Verkehrsbehinderungen.
Rhein-Ruhr-Marathon: Beeinträchtigungen bei Bussen und
Bahnen
Am Sonntag, 18. Mai, startet die 42. Auflage des
Rhein-Ruhr-Marathons. Tausende Sportlerinnen und Sportler gehen dann
auf die durch eine grüne Linie markierte Strecke. Läuferinnen und
Läufer, die sich immer an dieser Ideallinie orientieren, haben im
Ziel nicht nur zwölf Stadtteile Duisburgs durchlaufen, sondern auch
stolze 42,195 Kilometer zurückgelegt.
Shuttlebusse der DVG
fahren die Wechselpunkte des Staffelmarathons an und ermöglichen so
den Zuschauern und Läufern der Laufveranstaltung, die Läufer auf
ihrem Weg mehrfach anzufeuern. Von 8 bis 11 Uhr pendeln alle 15 bis
120 Minuten Busse zwischen Start- und Zielpunkt im Stadion im
Sportpark Duisburg und verschiedenen Streckenpunkten:
Laufkilometer 5: Haltestelle „Marientor“
Laufkilometer 10:
Haltestelle „Waldfriedhof“
Laufkilometer 15: Haltestelle
„Eibenweg“
Abfahrts- und Ankunftshaltestelle der
Shuttlebusse im Sportpark Duisburg ist der Parkplatz P2 am Stadion.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Marathons können die Shuttlebusse
kostenlos nutzen.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie
Zuschauerinnen und Zuschauer erreichen den Start- und Zielpunkt des
Marathons am besten mit der Stadtbahnlinie U79, Ausstieg an den
Haltestellen „Grunewald“ und „Kulturstraße“.
Umleitungen für
den normalen Linienverkehr
Damit die Läuferinnen und Läufer durch
den Straßenverkehr nicht behindert werden, kommt es am
Veranstaltungstag zwischen 7 und 15 Uhr zu Straßensperrungen und
Umleitungen für die Autofahrer, die sich auch auf den Fahrplan der
DVG auswirken.
Betroffen sind die Stadt- und
Straßenbahnlinien U79, 901 und 903 sowie die Buslinien 909, 910,
911, 912, 914, 916, 917, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926,
927, 928, 929, 930, 931, 933, 934, 939, 940, 941, 942 sowie die
Nachtexpresslinien 1 bis 6. Die DVG informiert an den betroffenen
Haltestellen über Umleitungen und verlegte Haltepunkte.
Die
Linie 901 entfällt in der Zeit von 7 bis 11.45 Uhr auf dem
Streckenabschnitt „Vinckeweg“ bis „Scholtenhofstraße“.
Die
Linien 930 und 931 entfallen in dem Zeitraum der Veranstaltung.
Die Linie 939 entfällt in der Zeit von 7 bis 10.30 Uhr.
Die
Nachtexpresslinien 1 bis 6 entfallen in der Zeit von 6.30 bis 9 Uhr.
Alle Informationen rund um den Marathon mit digitalen
interaktiven Karten zu den Buslinien hat die DVG auf Ihrer Webseite
unter dvg-duisburg.de/rheinruhrmarathon zusammengefasst.
Anmeldestart für Duisburger Schulkinder zur
Stadtranderholung 2025
Die beliebte Sommerferienaktion
„Stadtranderholung“ des Jugendamts Duisburg steht in den
Startlöchern: Um 10 Uhr am kommenden Dienstag, 20. Mai, wird die
Online-Anmeldung freigeschaltet. Die Ferienfreizeit findet wie
gewohnt in der zweiten Sommerferienhälfte vom 4. bis zum 22. August
2025 statt.
Die Standorte der Stadtranderholung,
Informationen zu Kosten und Verpflegung sowie der Link zur Anmeldung
sind auf der Internet-Seite
www.duisburg.de/stadtranderholung
zu finden. Das Portal
bleibt bis Freitag, 13. Juni, 10 Uhr geöffnet. In diesem Jahr werden
Betreuungsplätze für 1.500 Kinder an 18 Standorten angeboten.
Teilnehmen können Duisburger Schulkinder ab der abgeschlossenen
1. Schulklasse bis einschließlich zum vollendeten 13. Lebensjahr.
Eine Anmeldung ist nur für den gesamten dreiwöchigen Zeitraum
möglich. Die Betreuungszeit ist montags bis freitags von 8 bis 16
Uhr. Auch 2025 erwartet die Kinder wieder ein abwechslungsreiches,
spannendes und vielfältiges Ferienprogramm.
DMB: Mittelstand wertet Regierungserklärung als gutes
Zeichen für versprochenen Aufbruch
Die erste
Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz sendet aus
Sicht des Deutschen Mittelstands-Bund (DMB) ein wichtiges Signal für
wirtschaftspolitische Reformen. Die angekündigten Schritte lassen
auf eine wirtschaftsfreundliche Politik hoffen, die insbesondere
kleine und mittlere Unternehmen in der aktuellen Lage dringend
benötigen.
Entscheidend ist nun, dass den Ankündigungen auch
konkrete Maßnahmen folgen. Marc S. Tenbieg, geschäftsführender
Vorstand des DMB, äußert sich wie folgt: „Mit seiner ersten
Regierungserklärung hat Bundeskanzler Merz aus Sicht des Deutschen
Mittelstands-Bund (DMB) ein wichtiges Signal für die deutsche
Wirtschaft gesetzt.
Das oberste Ziel muss aus Perspektive
des Mittelstandes jetzt sein, neue Zuversicht im Land zu verbreiten
– und das ist Merz heute gut gelungen. Die Wirtschaft braucht
Perspektiven, und die Leitlinien des Bundeskanzlers bieten die
Aussicht auf nachhaltige Entlastung bei Bürokratie,
Unternehmensbesteuerung und Energiekosten.
Wichtig ist, dass
wie angekündigt zügig erste Maßnahmen wie die 30%-Abschreibungen,
Senkung der Stromsteuer und die Abschaffung des
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes umgesetzt werden.
Bundeskanzler Merz hat völlig recht: Es braucht eine gemeinsame
Kraftanstrengung, um aus der Krise herauszukommen.
Der
Mittelstand tut alles dafür, um diesen Aufschwung mitzugestalten.
Nun kommt es aber darauf an, dass die im Koalitionsvertrag
versprochenen Maßnahmen schnell und spürbar umgesetzt werden. Die
ersten 100 Tage werden entscheidend sein, um Zuversicht zu
verbreiten. Versprechen müssen gehalten, Sofortmaßnahmen zügig
umgesetzt, die Wettbewerbsfähigkeit verbessert werden.“
17. Wissenschaftsforum Mobilität: Mobilitätskonflikte gemeinsam
lösen
Wie lassen sich wirtschaftliche, ökologische und
soziale Ziele auf dem Weg zu nachhaltiger Mobilität in Einklang
bringen? Diese zentrale Frage stand im Fokus des 17.
Wissenschaftsforums Mobilität, das am 15. Mai 2025 rund 400
Expert:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik im Duisburger
CityPalais zusammenbrachte.

Die jährlich stattfindende Konferenz wurde erneut vom Lehrstuhl für
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre & Internationales
Automobilmanagement der Universität Duisburg-Essen organisiert.
Eröffnet wurde das Forum von UDE-Rektorin Prof. Dr. Barbara Albert,
Veranstalterin Prof. Dr. Heike Proff sowie Prof. Dr. Kienle, die
kurzfristig für Ministerin Ina Brandes einsprang und die Grußworte
aus dem nordrhein-westfälischen Ministerium für Kultur und
Wissenschaft übermittelte.
Unter dem diesjährigen Leitthema
„Solving Conflicts on the Way to Sustainable Mobility“ diskutierten
die Teilnehmer:innen, wie umweltfreundliche technologische
Entwicklungen, soziale Akzeptanz und wirtschaftliche Tragfähigkeit
zusammengebracht werden können. Im Fokus stand dabei neben der
Elektromobilität, wie Mobilität in Städten verbessert werden kann
und ÖPNV auf dem Land geschaffen werden kann.
Das
vielfältige Programm umfasste über 60 Fachvorträge in fünf
parallelen Tracks – unter anderem zu Mobility-Management und
-Engineering, urbaner Mobilität, IT, Dienstleistungen und
Rahmenbedingungen. Zwei prominent besetzte Podiumsdiskussionen, eine
Poster-Session im „Knowledge Café“ sowie eine begleitende
Ausstellung innovativer Projekte rundeten das Forum ab.
Zukunftsforscher Lars Thomsen eröffnete die Konferenz mit einer
inspirierenden Keynote und setzte dabei den inhaltlichen Rahmen für
den Tag.
„Wenn wir glauben, dass der Status quo der
Mobilität das Beste ist, was wir tun können, dann fehlt uns der
Blick in die Zukunft.“ Prof. Dr. Barbara Albert unterstrich die
Rolle der Universität: „Die Universität Duisburg-Essen steht für
exzellente Wissenschaft, die Innovationen für Wirtschaft und
Gesellschaft generiert.
Das Wissenschaftsforum Mobilität
zeigt eindrucksvoll, wie wir mit interdisziplinären Perspektiven
Antworten auf zentrale Zukunftsfragen geben.“ Auch Veranstalterin
Prof. Dr. Heike Proff betonte die Notwendigkeit neuer Denkansätze:
„wir müssen mutig weiter, größer und innovativer denken, weil sich
nur dann neue Handlungsräume eröffnen – wer zu eng denkt, kommt aus
den Zielkonflikten in der Transformation der Mobilität nicht
heraus“.

Nachwuchs im Fokus
Erstmals öffnete das Wissenschaftsforum
auch gezielt seine Türen für den Nachwuchs: 60 Schüler:innen der 11.
Jahrgangsstufe der Theodor-König-Gesamtschule Duisburg nutzten die
Gelegenheit, sich über Studienmöglichkeiten und technologische
Innovationen zu informieren und mit Unternehmen vor Ort ins Gespräch
zu kommen. Mit seinem interdisziplinären Ansatz und praxisnahen
Impulsen leistete das Forum erneut einen wichtigen Beitrag zur
Mobilitäts- und Verkehrswende – und zeigte, wie gemeinsame Lösungen
für eine nachhaltige Zukunft möglich werden.
SPD-Fraktion lässt erste Maßnahmen gegen „Autoposer“-Szene umsetzen.
Die „Autoposer“-Szene in Duisburg Wanheim stört die Anwohnerinnen
und Anwohner vor Ort in besonders hohem Maße. Nachts lassen junge
Erwachsene Motoren laut aufheulen und fahren mit stark überhöhter
Geschwindigkeit am Rheinufer entlang. Anwohnerinnen und Anwohner
können nachts nicht schlafen, nicht sicher über die Straße gehen und
fühlen sich bedroht.
Auf Initiative der SPD-Fraktion wurden
jetzt erste Maßnahmen umgesetzt: Auf der Wittlaerer Straße wurde
eine Geschwindigkeitsüberwachung (Blitzer) installiert sowie die
Zahl und Frequenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Städtischen Außendienstes (SAD) erhöht. So soll die Geschwindigkeit
der Autos reduziert und der störende Verkehr insbesondere nachts
deutlich reduziert werden.
Der SPD-Fraktionsvorsitzende
Jannik Neuhaus erklärt dazu: „Dass junge Erwachsene durch ein
Wohngebiet mit teilweise über 70 km/h insbesondere nachts rasen und
Menschen stören, ist für uns als SPD-Fraktion mehr als
unverständlich. Deshalb war für uns klar: Dort muss jetzt etwas
passieren. Wir haben uns darum gekümmert, dass ein Blitzer die
Temposünder erfasst, dadurch Strafen bekommen und zukünftig nicht
mehr durch das Wohngebiet rasen. Damit die „Autoposer“-Szene in dem
gesamten Wohngebiet besser überwacht und Ordnungswidrigkeiten
reduziert und geahndet werden, haben wir darüber hinaus dafür
gesorgt, dass das Ordnungsamt auch nachts mit erhöhter Präsenz vor
Ort sein wird.“
Sommerferien in Rheine:
Sporthelfer-Ausbildung für Jugendliche
Jetzt anmelden und vom
12. bis 19. Juli unvergessliche Ferien erleben! Duisburg
(15.05.2025). Schnell noch die Chance nutzen und vom 12. – 19. Juli
bewegte Sommerferien in der Jugendherberge Rheine verbringen. Im
Preis von 350 € (Mitglieder in einem Sportverein) bzw. 450 €
(Sonstige) sind die An- und Abreise ab Duisburg, die Unterkunft in
der Jugendherberge mit Vollverpflegung, die kompakte
Sporthelfer-Ausbildung I und II sowie das Freizeitprogramm
enthalten.
Unter fachlicher Anleitung lernen Jugendliche im
Alter von 13-17 Jahren, neue Ideen und Trends in Spiel- und
Sportangebote einzubauen. Die Ausbildung berechtigt sie anschließend
zur eigenständigen Planung und Anleitung von Stundenanteilen für
Kinder oder Gleichaltrige. Damit legen sie den ersten Schritt in
Richtung Sportlizenzsystem und zukünftiger Übungsleiter-Tätigkeit.
Neben dem sportlichen Input kommt auch die Freizeit nicht zu
kurz: Ob bei Ausflügen ins nahgelegene Kombibad oder beim
gemeinsamen Grillen – hier ist für jeden etwas dabei! Weitere
Informationen gibt es telefonisch bei der Sportjugend Duisburg unter
0203 / 3000 851 oder per E-Mail an sportjugend@ssb-duisburg.de.
Rotary Clubs Duisburg informierten über FASD auf dem Marina
Markt im Duisburger Innenhafen
Die Rotary Clubs aus
Duisburg setzen ein klares Zeichen für Aufklärung und Prävention: Am
Sonntag, den 11. Mai 2025, informierten sie mit einem eigenen Stand
auf dem Marina Markt im Duisburger Innenhafen über das Thema FASD
(Fetal Alcohol System Disorders).

Die Aktion stieß auf große Resonanz und regte viele interessante
Gespräche an. Auch Mitglieder der Selbsthilfegruppe FASD waren vor
Ort. FASD bezeichnet eine Reihe von körperlichen und geistigen
Beeinträchtigungen, die bei Kindern durch Alkoholkonsum der Mutter
während der Schwangerschaft entstehen können.
Bereits
kleinste Mengen Alkohol können die Entwicklung des ungeborenen
Kindes nachhaltig schädigen. Die Folgen sind meist lebenslang: Lern-
und Konzentrationsprobleme, Verhaltensauffälligkeiten sowie
körperliche und geistige Entwicklungsstörungen zählen zu den
typischen Symptomen. „FASD ist zu 100 Prozent vermeidbar – wenn in
der Schwangerschaft vollständig auf Alkohol verzichtet wird“,
betonen die Vertreter der Duisburger Rotary Clubs.
Genau
darüber klärten sie am Stand auf und kamen mit zahlreichen
Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch. Ziel ist es, das
Bewusstsein für diese so leicht vermeidbare Behinderung zu schärfen.
Über die Rotary Clubs Duisburg: Die Duisburger Rotary Clubs
engagieren sich seit vielen Jahren in sozialen Projekten – lokal und
international.
Mit ihrer Teilnahme am Marina Markt wollten
sie dazu beitragen, ein wichtiges Thema in die Öffentlichkeit zu
tragen und präventive Aufklärungsarbeit zu leisten. Außerdem
unterstützen die Clubs ein Projekt, das in Duisburger Schulen über
die Problematik FASD aufklärt: Eine der wichtigsten Zielgruppen,
nämlich Jugendliche der Klassen 7 bis 9 erfahren durch ärztliche
Mitarbeiterinnen der ÄGGF (Ärztliche Gesellschaft zur
Gesundheitsförderung e.V.) Genaueres über die einschneidenden und
lebenslangen Folgen von Alkoholkonsum für das ungeborene Kind in der
Schwangerschaft.
Unsicherheit durch US-Regierung:
Konjunkturindikator auf „gelb-rot“
Die erratische
Wirtschaftspolitik des US-Präsidenten Donald Trump hinterlässt
Spuren in den Aussichten für die konjunkturelle Entwicklung in den
kommenden Monaten: Das Risiko, dass die deutsche Wirtschaft in
nächster Zeit in eine Rezession gerät, ist in den vergangenen Wochen
leicht gestiegen.
Das signalisiert der monatliche
Konjunkturindikator des Instituts für Makroökonomie und
Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung. Für den
Zeitraum von Mai bis Ende Juli 2025 weist der Indikator, der die
neuesten verfügbaren Daten zu den wichtigsten wirtschaftlichen
Kenngrößen bündelt, eine Rezessionswahrscheinlichkeit von 31,4
Prozent aus.
Anfang April, unmittelbar bevor Trump hohe
Zölle auf US-Importe aus zahlreichen Ländern ankündigte, betrug sie
für die folgenden drei Monate noch 27,3 Prozent. Trotz des relativ
moderaten Anstiegs schaltet der nach dem Ampelsystem arbeitende
Indikator auf „gelb-rot“, da sich auch die statistische Streuung des
Indikators, in der sich die Verunsicherung der
Wirtschaftsakteur*innen ausdrückt, erhöht hat. Im Vormonat zeigte
der Indikator noch die günstigere Phase „gelb-grün. „Gelb-rot“
signalisiert zwar keine akute Rezessionsgefahr, aber erhöhte
konjunkturelle Unsicherheit.
Die aktuelle Zunahme des
Rezessionsrisikos beruht in erster Linie auf der globalen
Verunsicherung, wesentlich ausgelöst durch Trumps Zolldrohungen.
Zwar hat sich vor allem an den Kapitalmärkten in den letzten Tagen
die Stimmung wieder verbessert, nachdem die USA einen großen Teil
der neuen Zölle zeitweilig wieder ausgesetzt haben.
„Der
Mangel an Verlässlichkeit bei der gegenwärtigen US-Administration
birgt aber jederzeit die Gefahr, wichtige Einflussgrößen für das
Funktionieren eines reibungsfreien Welthandels unter Druck zu
setzen, wie die US-Staatsanleihenkurse oder den Wechselkurs des
US-Dollar“, beschreibt IMK-Konjunkturexperte Dr. Thomas Theobald das
fundamentale Gefühl vieler Wirtschaftsakteur*innen. Überdies blieben
trotz des temporären Zurückruderns der US-Regierung in vielen Fällen
Basiszölle in Kraft – etwa 10 Prozent für Lieferungen aus der EU, 30
Prozent für Importe aus China –, „die deutlich oberhalb jener
Zollsätze liegen, die vor Trumps Amtseinführung galten“, so
Theobald.
Die zuletzt positive Entwicklung bei den deutschen
Exporten, bei Industrieproduktion und Auftragseingängen beeinflusst
die neue Prognose des IMK-Indikators hingegen nur wenig. Das liegt
daran, dass sich die neusten vorliegenden Daten dazu auf den März
beziehen.
Der Algorithmus des Indikators interpretiert die recht
guten Zahlen bei Produktion und Ausfuhren als Einmaleffekt, der sich
daraus ergibt, dass sich Unternehmen wichtige Güter schnell noch vor
Zolleinführung sichern wollten. Bei den Aufträgen steige wiederum
das Risiko von Stornierungen, wenn der Welthandel durch die
US-Zollpolitik stärker leiden sollte als im März noch erwartet.
Durch die Vorzieheffekte drohe sogar ein konjunktureller Rückschlag
bei den Exporten im zweiten Quartal.
In der Gesamtschau der
Daten prognostiziert das IMK weiterhin eine konjunkturelle
Stagnation in diesem Jahr, wobei sich die Aussichten dank gestärkter
Binnennachfrage durch privaten Verbrauch und öffentliche
Investitionen in der zweiten Jahreshälfte aufhellen dürften.
Um Deutschland resilienter zu machen gegen negative
außenwirtschaftliche Effekte mahnt Prof. Dr. Sebastian Dullien, der
wissenschaftliche Direktor des IMK, eine „möglichst schnelle“
Umsetzung erster wirtschaftspolitischer Maßnahmen der neuen
Bundesregierung an. Als zentral nennt Dullien die rasche Einführung
der geplanten Sonderabschreibungsregeln für Unternehmen, zusätzliche
Investitionen in die öffentliche Infrastruktur sowie die Dämpfung
der Energiepreise.
Bundesweit
erste internationale Fachausstellung zur Klimaanpassungswirtschaft:
Resilience Expo startet im Juni in NRW
Grundstein für
die internationale Vernetzung in einem wachstumsstarken Markt
14.05.2025 Extreme Wetterereignisse, Wasserknappheit und steigende
Temperaturen erfordern weltweite Anpassungsstrategien.
Bei
der bundesweit ersten Resilience Expo werden am Montag, 23. Juni
2025, im Zeughaus Neuss erstmalig innovative Lösungen und
Geschäftsmodelle ausgestellt, die die Folgen des Klimawandels
abmildern. Unternehmen und Investoren erhalten die Möglichkeit,
zukunftsweisende Entwicklungen zu präsentieren, neue Märkte zu
erschließen und sich zu vernetzen.
Die Resilience Expo
versammelt Unternehmen, Wissenschaft, Interessenverbänden sowie
Fachverwaltungen und Politik – aus dem Rheinischen Revier, aus
Nordrhein-Westfalen, bundesweit und international. Ziel ist es,
gemeinsam eine langfristige grenzüberschreitende
Vernetzungsplattform für die Klimaanpassungswirtschaft zu
etablieren.
Umweltminister Oliver Krischer unterstreicht die
Bedeutung der neuen Resilience Expo: „Mit der Resilience Expo setzen
wir in Nordrhein-Westfalen ein starkes Zeichen für die klimagerechte
Transformation. Die Expo vereint Wirtschaft, Wissenschaft und
Politik in einem vielseitigen Format und macht deutlich, welche
Chancen in resilienten Technologien und nachhaltigen
Geschäftsmodellen stecken. Damit schaffen wir eine Plattform, die
die Kräfte bündelt, das wachsende Angebot an wirksamen Lösungen
präsentiert – und Nordrhein-Westfalen als Modellregion für eine
resiliente Transformation international sichtbar macht.“
Die Resilience Expo verknüpft regionale Innovationen aus
Nordrhein-Westfalen mit internationalen Entwicklungen. Bestehende
Initiativen sollen gebündelt, Synergien genutzt und der
internationale Austausch gestärkt werden. Neben der klassischen
Ausstellung bietet die Resilience Expo mit Workshops und
Diskussionsformaten vielfältige Möglichkeiten zur Vernetzung.
Ziel ist es, Konzepte und Produkte nicht nur zu präsentieren,
sondern aktiv zu diskutieren und so langfristig weiterzuentwickeln.
Die Expo wird in den kommenden drei Jahren vom Bund und vom Land
Nordrhein-Westfalen finanziert. Als internationale Ausstellung
stärkt sie den Standort Nordrhein-Westfalen und trägt zum
wirtschaftlichen und strukturellen Wandel des Rheinischen Reviers
bei.
Um den Einstieg so attraktiv wie möglich zu gestalten,
ist die Teilnahme für Unternehmen und weitere Interessierte aus
Forschung, Interessenverbänden, Verwaltung oder Politik kostenfrei.
Insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen soll so der
Zugang erleichtert werden, um ihre Ideen zu präsentieren und
Kontakte zu knüpfen.
Unternehmen, die sich an dieser oder
der nächsten Resilience Expo beteiligen möchten, können fortlaufend
ihr Interesse unter exhibit@resilience-expo.com bekunden.
Weitere Informationen zur Resilience Expo sowie zur Anmeldung zur
Veranstaltung und zum Newsletter finden Sie unter www.resilience-expo.com.
Die Resilience Expo ist ein Ankerprojekt der Landesregierung
im Rahmen des Strukturwandels im Rheinischen Revier. Bund und Land
unterstützen die nachhaltige Transformation des Rheinischen Reviers
im Zuge des Kohleausstiegs mit mehr als 14,8 Milliarden Euro. Das
Land flankiert die Förderung aus Bundesmitteln mit eigenen
Haushaltsmitteln. Bislang sind 317 Projekte mit einem Fördervolumen
von rund 2,2 Milliarden Euro bewilligt.
Medientrödel
in der Bezirksbibliothek Hamborn
Die Hamborner
Bibliothek im Rathaus-Center Schreckerstraße lädt von Dienstag, 3.
Juni, bis Samstag, 7. Juni, während der Öffnungszeiten zu einem
großen Bücher- und Medientrödel ein. Gelegenheits- und Vielleser
finden ein großes Sortiment von Romanen, aber auch Sachbücher,
Kinder- und Jugendliteratur.
Daneben warten auch Filme,
Hörbücher, CDs, DVDs und Blu-Rays auf Schnäppchenjäger aller
Altersgruppen. Alle Medien werden gegen eine Spende ab 50 Cent
zugunsten der Duisburger Bibliotheksstiftung abgegeben, die damit
Projekte zur Leseförderung finanziert.
Fragen beantworten
die Mitarbeitenden der Bibliothek gerne persönlich oder telefonisch
unter 0203 283-5373 während der Öffnungszeiten dienstags bis
donnerstags von 10.30 bis 13 Uhr und 14 bis 18.30 Uhr, samstags von
10 bis 13 Uhr.
ERK-Prüfbericht: Klimaziele knapp erreicht
Der Expertenrat für Klimafragen (ERK) sieht die deutschen
Klimaziele für die vergangenen Jahre knapp erreicht. In dem jährlich
erscheinenden Bericht haben die Expertinnen und Experten die
Emissionsdaten des Umweltbundesamts geprüft. Relevant war dabei die
Frage, ob das Emissionsbudget 2021-2030 unter- oder überschritten
wird.
Trotz Zielerreichung auf nationaler Ebene stehen
insbesondere die Sektoren Verkehr und Gebäude weiterhin vor großen
Herausforderungen. Die Vorgaben der europäischen Lastenteilung,
Treibhausgasemissionen zu senken, wurden verfehlt.
„Deutschland hat seine Klimaziele erreicht und das ist erst einmal
eine gute Nachricht. Das zeigt: die Maßnahmen der vergangenen Jahre,
vor allem die Energiewende und das reformierte Gebäudeenergiegesetz,
zeigen Wirkung. Aber: es gibt keinen Grund für die neue Regierung,
sich zurückzulehnen. Der Handlungsdruck ist weiterhin groß, wenn die
Klimaschutzziele 2030 und 2040 erreicht werden sollen.
Das
bedeutet, vor allem die für Klimaschutz und Energie relevanten
Ministerien müssen jetzt schnell arbeitsfähig werden. Die Aufgabe
ist nicht zu unterschätzen, da der Koalitionsvertrag an vielen
klimapolitischen Stellen unscharf ist.“, kommentiert Carolin
Friedemann, Geschäftsführerin der Initiative Klimaneutrales
Deutschland den Bericht.
Bereits in wenigen Monaten, genauer
bis Ende September, müssen gemäß Klimaschutzgesetz bereits geeignete
Maßnahmen für ein klimaneutrales Deutschland über alle Sektoren
hinweg vorliegen. Diese werden dann vom ERK geprüft. Anschließend
muss die neue Regierung bis März 2026 ihr Klimaschutzprogramm
finalisieren, das auch die Zeit bis 2040 berücksichtigt.
Friedemann weiter: „Gerade im Gebäudesektor bedarf es nach wie vor
großer Anstrengungen. Dabei ist das Gebäudeenergiegesetz
entscheidend, um den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen
insbesondere im Bereich Wohnen deutlich zu senken. Unsere Studie zu
Sanierung im Eigenheim zeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger
verunsichert sind und Sanierungspläne oftmals auf Eis gelegt wurden.
Daher muss die Regierung jetzt schnell Klarheit herstellen, wie es
mit Anforderungen und Fördermodellen weitergeht.“
Jährlich
prüft der Expertenrat für Klimafragen die Emissionsdaten des
Umweltbundesamts sowie Projektionen bis 2030. Er bewertet, ob
Deutschland die Klimaziele laut Bundes-Klimaschutzgesetz einhält,
und berücksichtigt dabei auch EU-Vorgaben. Die Ergebnisse werden der
Bundesregierung und dem Bundestag vorgelegt.
Hier finden Sie den
Bericht des Expertenrats für Klimafragen.
Solarbetriebene DHL-Packstation in Duisburg-Wanheim eröffnet
Der Automat an der Molbergstraße 10 (Zugang über Beim
Görtzhof) hat 82 Fächer. Die Bedienung ist einfach per App mit dem
Smartphone möglich. Paketempfang und -versand ist rund um die Uhr
möglich.
Kundinnen und Kunden können dort ab sofort rund um
die Uhr ihre Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken.
Die App-gesteuerte Packstation kommt dabei ohne Bildschirm aus. Für
die Nutzung benötigen Kundinnen und Kunden lediglich die kostenlose
Post & DHL App. Mit der Nutzung der Packstationen können sie aktiv
zum klimaneutralen Paketversand beitragen.
Diesen
gewährleisten Deutsche Post und DHL mit dem Programm GoGreen (dank
Kompensationen entstehender Emissionen durch Investitionen in
weltweite Klimaschutzprojekte) für alle nationalen und
internationalen Briefe sowie zusätzlich für alle Päckchen und Pakete
von privaten Kundinnen und Kunden.
Die Nutzung des
kostenlosen Services Packstation trägt zur Reduzierung von
CO2-Emissionen sowie des Verkehrs innerhalb von Städten bei. Im
Vergleich zu einer Haustür-Zustellung werden bei einer
Packstationssendung bei der Auslieferung im Durchschnitt 30 Prozent
CO2 eingespart. Denn die Zustellerinnen und Zusteller können pro
Stopp an der Packstation mehrere Dutzend Pakete abliefern und
abholen.
„Die DHL Packstation ist ein Kernelement bei der
Umsetzung einer nachhaltigen Logistik“, sagt Holger Bartels, Leiter
des Multikanalvertriebs Post & Paket Deutschland von DHL Group. Die
App-gesteuerte Packstation benötigt kein Display, da die Kundin oder
der Kunde sie ausschließlich mit seinem Smartphone bedient.

„Wir
haben die App-gesteuerten Packstationen intensiv getestet. Die
Rückmeldungen der Kundinnen und Kunden sind sehr positiv und es hat
sich gezeigt, dass die allermeisten Packstationskunden mit der
Nutzung von Apps auf ihrem Smartphone bestens vertraut sind. Ein
Großteil der App-gesteuerten Packstationen – so wie diese – ist mit
Solarzellen auf dem Dach ausgestattet, sodass sich der neue
Packstationstyp mit regenerativen Energien komplett selbst versorgen
kann.
„Da wir keine externe Stromquelle mehr benötigen,
können wir die DHL Packstation jetzt auch an Orten aufstellen, wo
dies vorher nicht möglich gewesen wäre. Wir werden unseren Service
damit noch näher zu unseren Kundinnen und Kunden bringen“, sagt
Bartels.
Schlemmen in netter Gesellschaft beim
Gemeindefrühstück in Wanheimerort
In der Evangelischen
Rheingemeinde Duisburg gibt es im Gemeindehaus Vogelsangplatz 1 in
Wanheimerort am 16. Mai 2025 um 9.30 Uhr das nächste Schlemmen in
netter Gesellschaft.
Auch bei diesem Frühstucks-Treffen gibt
es am Büffet wieder alles, was neben Lachs, Rührei, Marmeladen,
Brötchen und Kaffee zu einem guten Frühstück gehört. Kosten von zehn
Euro sollten eingeplant werden. Maria Hönes, Ehrenamtskoordinatorin
der Gemeinde, beantwortet Fragen und nimmt Anmeldungen zum Frühstück
entgegen (Tel.: 0203 / 770134).
Neudorf: Gemeinde lädt zum
Auspannen ein
Am Freitag, 16. Mai 2025 gibt es in der
Evangelischen Kirchengemeinde Hochfeld-Neudorf eine gute Gelegenheit
zum Auspannen und zum gemütlichen Wochenausklang: Um 18 Uhr geht es
in Gemeinschaft mit anderen beim Klönen um Gott und die Welt, denn
im Gemeindezentrum an der Gustav-Adolf-Str. 65 öffnet wieder die
Kirchenkneipe.
Engagierte, die die Aktion vorbereiten, laden
herzlich zum Klönen ein. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter
www.hochfeld-neudorf.de.

Gesundheitsausgaben in Pflegeeinrichtungen im Jahr 2023
um 6,3 % gestiegen
• Gesundheitsausgaben in
Pflegeeinrichtungen binnen zehn Jahren nahezu verdoppelt • Ausgaben
für häusliche Pflege binnen zehn Jahren verdreifacht
• 407 000
Personen erhielten 2023 Hilfe zur Pflege
Die
Gesundheitsausgaben in ambulanten, stationären und teilstationären
Pflegeeinrichtungen sind im Jahr 2023 um 6,3 % gegenüber dem Vorjahr
gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter
mitteilt, wurden in diesen Einrichtungen 82,4 Milliarden Euro
ausgegeben.
Die Ausgaben in den stationären und
teilstationären Pflegeeinrichtungen (48,2 Milliarden Euro) sind im
Jahr 2023 um 6,7 % gestiegen, während sich die Kosten in ambulanten
Pflegeeinrichtungen (34,2 Milliarden Euro) um 5,8 % gegenüber dem
Vorjahr erhöht haben.
Zu den Einrichtungen der stationären
und teilstationären Pflege zählen unter anderem Altenpflegeheime
sowie Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege. Die
Gesundheitsausgaben insgesamt waren im Jahr 2023 um 0,1 % niedriger
als ein Jahr zuvor. Maßgeblich für den leichten Rückgang waren die
auslaufenden Corona-Maßnahmen.
Gesundheitsausgaben in
Pflegeeinrichtungen steigen binnen zehn Jahren um 94,2 % Zwischen
2013 und 2023 haben sich die Gesundheitsausgaben in Einrichtungen
der ambulanten, stationären und teilstationären Pflege von
42,4 Milliarden Euro um 94,2 % auf 82,4 Milliarden Euro erhöht.
Die Gesundheitsausgaben in ambulanten Pflegeeinrichtungen
stiegen um 132,9 %. In der stationären und teilstationären Pflege
waren die Ausgaben 2023 um knapp drei Viertel (+73,8 %) höher als
zehn Jahre zuvor. Die gesamten Gesundheitsausgaben sind im
Zehnjahresvergleich um 59,4 % gestiegen. In diesen Zeitraum fiel
insbesondere die Einführung des neuen weiter gefassten
Pflegebedürftigkeitsbegriffs 2017.
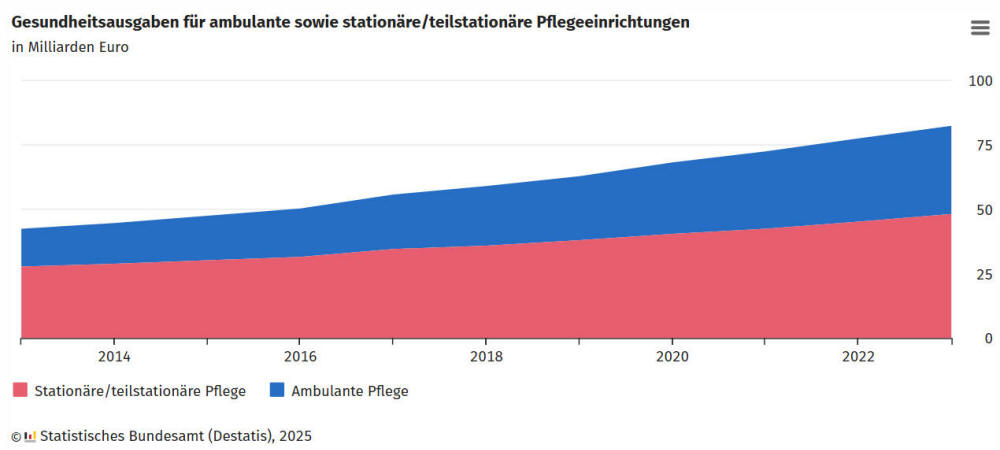
Ausgaben für häusliche Pflege binnen zehn Jahren verdreifacht
Die Gesundheitsausgaben für pflegerische Leistungen, die von
privaten Haushalten oder Angehörigen erbracht werden, lagen im Jahr
2023 bei 21,6 Milliarden Euro. Damit haben sich die Ausgaben für
häusliche Pflege gegenüber dem Vorjahr um 8,3 % erhöht. 2013 lagen
die Ausgaben für pflegerische Leistungen im häuslichen Bereich bei
7,2 Milliarden Euro und haben sich somit binnen zehn Jahren fast
verdreifacht (+198,7 %). Auch hier ist die Einführung des neuen
weiter gefassten Pflegebedürftigkeitsbegriffs 2017 zu
berücksichtigen.
Zwei Drittel der Pflegebedürftigen werden
überwiegend durch Angehörige zu Hause versorgt
Die Zahl der
Pflegebedürftigen im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes (SGB XI)
hat sich binnen zehn Jahren mehr als verdoppelt: Im Dezember 2023
waren in Deutschland 5,7 Millionen Menschen pflegebedürftig, zehn
Jahre zuvor waren es noch 2,6 Millionen. Die starke Zunahme der
Pflegebedürftigen zeigt, dass sich hier neben der Alterung der
Gesellschaft starke Effekte durch die Einführung des weiter
gefassten Pflegebedürftigkeitsbegriffs zum 1. Januar 2017 auswirken.
Seither werden Menschen eher als pflegebedürftig eingestuft als
zuvor. Der Pflegevorausberechnung zufolge
könnte die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland bis
2055 auf etwa 7,6 Millionen Pflegebedürftige zunehmen. Der Großteil
der Pflegebedürftigen (86 % beziehungsweise 4,9 Millionen) wurde
2023 zu Hause versorgt.
Zwei Drittel der Pflegebedürftigen
(67 % beziehungsweise 3,8 Millionen) wurden zu Hause überwiegend
durch Angehörige betreut. 1,1 Millionen Pflegebedürftige (19 %)
wurden zu Hause mithilfe oder vollständig von ambulanten Pflege-
oder Betreuungsdiensten versorgt. Rund
0,8 Millionen Pflegebedürftige (14 %) wurden vollstationär in
Pflegeheimen betreut.
Zahl der Empfängerinnen und Empfänger
von Hilfe zur Pflege zuletzt gestiegen
Rund
407 000 Pflegebedürftige erhielten im Jahr 2023 die Sozialleistung
Hilfe zur Pflege. Davon waren knapp zwei Drittel (63 %) Frauen.
Auf die Hilfe hat Anspruch, wem nicht zuzumuten ist, die für die
Hilfe zur Pflege benötigten Mittel aus seinem Einkommen und Vermögen
(nach den Vorschriften des SGB XI) aufzubringen. Gegenüber dem Jahr
2022 nahm die Zahl um 8,1 % zu.
Im Vergleich zu 2013 sank
die Zahl der Personen, die Hilfe zur Pflege erhalten, um 8,3 %. Ein
Großteil der Empfängerinnen und Empfänger von Hilfe zur Pflege
(82 %) wurde in einer Einrichtung gepflegt, knapp ein Fünftel (19 %)
insbesondere zu Hause.
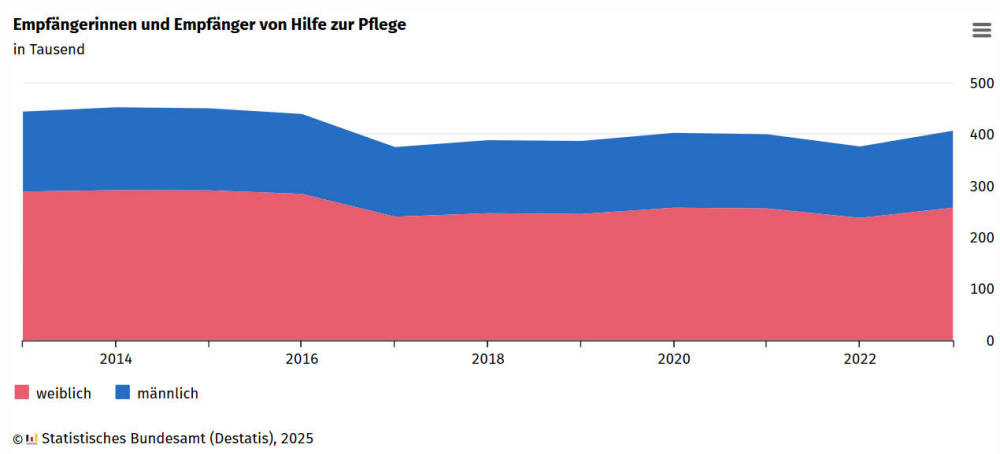
Zahl der Deutschlandstipendien im Jahr 2024 um 5 %
gestiegen
33 000 Studierende erhielten eine Förderung nach dem
Stipendienprogramm-Gesetz
Im Jahr 2024 haben 33 000
Studierende ein Deutschlandstipendium nach dem
Stipendienprogramm-Gesetz erhalten. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) mitteilt, stieg die Zahl der Stipendiatinnen und
Stipendiaten damit gegenüber dem Jahr 2023 um 5 %. Ihr Anteil an
allen Studierenden lag – gemessen an der vorläufigen Gesamtzahl der
Studierenden des Wintersemesters 2024/2025 – bei 1,2 %. Mit dem
Deutschlandstipendium werden seit dem Sommersemester 2011
Studierende gefördert, deren Werdegang herausragende Leistungen in
Studium und Beruf erwarten lässt.
Hochschulen werben für Stipendien 34
Millionen Euro von privaten Mittelgebern ein Die
Deutschlandstipendien in Höhe von monatlich 300 Euro werden je zur
Hälfte vom Bund und von privaten Mittelgebern finanziert, die von
den Hochschulen akquiriert werden müssen. Die Förderung läuft in der
Regel über mindestens zwei Semester.
2024 warben die
Hochschulen von privaten Mittelgebern Fördermittel in Höhe von
insgesamt 34 Millionen Euro ein, das waren 2,6 % mehr als im
Vorjahr. Die Mittelgeber waren 2024 vor allem Kapitalgesellschaften
(3 075 Mittelgeber mit insgesamt 9,8 Millionen Euro Fördersumme),
sonstige juristische Personen des privaten Rechts, wie zum Beispiel
eingetragene Vereine, eingetragene Genossenschaften oder Stiftungen
des privaten Rechts (2 446 Mittelgeber mit insgesamt 14,2 Millionen
Euro Fördersumme) sowie Privatpersonen und Einzelunternehmen (2 076
Mittelgeber mit insgesamt 4,7 Millionen Euro Fördersumme).
Anteil der Stipendiatinnen und Stipendiaten im Saarland am höchsten
Wie bereits in den Vorjahren waren die Hochschulen im Saarland
bei der Einwerbung privater Fördermittel für
Deutschland-Stipendiatinnen und -Stipendiaten am erfolgreichsten.
2024 konnten hier 1,9 % der Studierenden – bezogen auf die
Studierendenzahl im Wintersemester 2024/2025 – mit einem
Deutschlandstipendium gefördert werden. Den geringsten Anteil
Geförderter mit einem Deutschlandstipendium gab es 2024 in Thüringen
mit 0,5 % der Studierenden.