






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 21. Kalenderwoche:
22. Mai
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Freitag, 23. Mai 2025
Nach ernüchternden
Wohnungsbauzahlen: Bundesbauministerium will
zügig einen Wohnungsbauturbo vorlegen
Zu den am 23. Mai vom Statistischen
Bundesamt veröffentlichten
Fertigstellungszahlen im Wohnungsbau 2024
erklärt Verena Hubertz, Bundesministerin für
Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen:
„In Deutschland wird zu wenig und zu langsam
gebaut. Im vergangenen Jahr wurden knapp
252.000 Wohnungen errichtet – ein Rückgang
von über 42.000 Wohnungen gegenüber 2023.
Das ist auch ein Resultat der ungünstigen
Umstände und Rahmenbedingungen. Zudem sind
Genehmigungsverfahren zu kompliziert und
langwierig, Baukosten zu hoch und
Förderbedingungen zu undurchsichtig.
Was wir jetzt brauchen, ist ein
Dreiklang aus Tempo, Technologie und
Toleranz, um wieder Schwung in den
Wohnungsmarkt zu bringen und auch den
Bauüberhang von rund 760.000 genehmigten,
aber noch nicht fertig gebauten Wohnungen,
zu aktivieren. Wir werden zügig einen
Wohnungsbauturbo vorlegen, steuerliche
Anreize verbessern und Neubauförderprogramme
radikal vereinfachen. Gleichzeitig setzen
wir die soziale Wohnraumförderung auf
Rekordniveau fort. Um Baukosten zu senken,
werden wir die Planungs- und
Genehmigungsverfahren beschleunigen und auf
serielles und modulares Bauen setzen, denn
das ist die Zukunft.
All das wird nur
funktionieren, wenn wir auch bauen wollen
und Bauen und Stadtentwicklung als Chance
für die Gesellschaft begreifen. Ich möchte,
dass der Friseur, die Busfahrerin, die junge
Familie oder der alleinlebende Rentner auch
die passende Wohnung finden. Dafür müssen
die Bagger wieder rollen und wir müssen
bauen, bauen, bauen. Und das zu bezahlbaren
Preisen.“
14,4 % weniger fertiggestellte Wohnungen im Jahr 2024
• Insgesamt 251 900 Wohnungen
fertiggestellt – Rückgang im Neubau bei
allen Gebäudearten außer Wohnheimen
•
Bauüberhang verringert sich auf 759 700
genehmigte, aber noch nicht fertiggestellte
Wohnungen zum Jahresende 2024, davon 330 000
bereits im Bau
• Durchschnittliche Dauer
zwischen Baugenehmigung und Fertigstellung
eines Wohngebäudes seit 2020 um 6 Monate
verlängert
Im Jahr 2024 wurden in
Deutschland 251 900 Wohnungen gebaut. Wie
das Statistische Bundesamt (Destatis)
mitteilt, waren das 14,4 % oder 42 500
Wohnungen weniger als im Vorjahr. Das war
der erste deutliche Rückgang, nachdem die
Zahl fertiggestellter Wohnungen in den
Jahren 2021 bis 2023 jeweils um 294 000
gelegen hatte. Zuvor war die Zahl neuer
Wohnungen von ihrem Tiefststand von 159 000
im Jahr 2009 bis auf den bisherigen
Höchststand von 306 400 im Jahr 2020
gestiegen. In diesen Ergebnissen sind sowohl
Wohnungen in neuen Wohn- und
Nichtwohngebäuden als auch neue Wohnungen in
bestehenden Gebäuden enthalten.
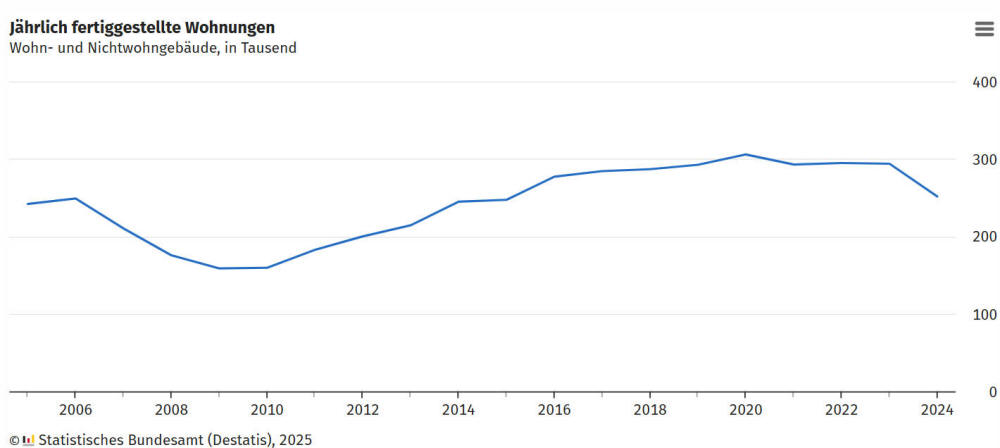
Besonders starke Rückgänge bei neuen Ein- und
Zweifamilienhäusern
Von den im
Jahr 2024 fertiggestellten Wohnungen
befanden sich 215 900 in neu errichteten
Wohngebäuden. Das waren 16,1 % oder 41 400
Wohnungen weniger als im Vorjahr. Besonders
starke Rückgänge gab es bei den meist von
Privatpersonen errichteten Ein- und
Zweifamilienhäusern: Mit 54 500
Einfamilienhäusern wurden 22,1 % oder 15 400
weniger fertiggestellt als im Vorjahr.
Die Zahl neuer Wohnungen in
Zweifamilienhäusern fiel um 26,2 % oder
6 300 auf 17 600. In Mehrfamilienhäusern,
der zahlenmäßig stärksten und vor allem von
Unternehmen gebauten Gebäudeart, wurden
135 300 Neubauwohnungen geschaffen, das
waren 13,4 % oder 21 000 weniger als im Jahr
2023. In neu errichteten Wohnheimen stieg
die Zahl fertiggestellter Wohnungen dagegen
um 17,6 % oder 1 300 auf 8 500.
In
neuen Nichtwohngebäuden entstanden 4 800
Wohnungen und damit 15,0 % oder 800 weniger
als im Vorjahr. Nach Bauherrengruppen
betrachtet entfielen von den im Jahr 2024
fertiggestellten Neubauwohnungen 112 500 auf
Unternehmen (-11,8 % oder -15 100 zum
Vorjahr) und 95 400 auf Privatpersonen
(-20,4 % oder -24 500).
Von Trägern
der öffentlichen Hand wurden 9 500
Neubauwohnungen fertiggestellt (-20,5 % oder
-2 500). Die Zahl fertiggestellter Wohnungen
in bereits bestehenden Wohngebäuden blieb im
Jahr 2024 mit 30 300 gegenüber dem Vorjahr
konstant.
Durchschnittlich
26 Monate von der Genehmigung bis zur
Fertigstellung im Neubau
Die
durchschnittliche Abwicklungsdauer von
Neubauwohnungen in Wohngebäuden, also die
Zeit von der Genehmigungserteilung bis zur
Fertigstellung, hat sich bei den im Jahr
2024 fertiggestellten Wohngebäuden auf 26
Monate weiter verlängert. Im Jahr 2023 hatte
der Bau einer Wohnung noch 24 Monate
gedauert, im Jahr 2020 lediglich 20 Monate.
Neubauwohnungen mit durchschnittlich
96,2 Quadratmetern Wohnfläche Eine
Neubauwohnung – von der Einzimmerwohnung bis
zum Einfamilienhaus – hatte im Jahr 2024
eine durchschnittliche Wohnfläche von
96,2 Quadratmetern. Damit hielt der Trend zu
kleineren Wohnungen an. Die bisher größte
Wohnfläche je Wohnung war im Jahr 2007 mit
116,4 Quadratmetern gemessen worden, seitdem
nahm die durchschnittliche Wohnungsgröße
tendenziell ab.
Bauüberhang
verringert sich im zweiten Jahr in Folge
Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen
fiel im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um
17,1 % auf 215 300 und war damit deutlich
geringer als die Zahl der fertiggestellten
Wohnungen.
Dadurch ging die als
Bauüberhang bezeichnete Zahl bereits
genehmigter, aber noch nicht
fertiggestellter Wohnungen im
Vorjahresvergleich im zweiten Jahr in Folge
zurück, und zwar um 67 000 auf 759 700
Wohnungen zum Jahresende 2024. Davon
befanden sich 330 000 Wohnungen bereits im
Bau (179 200 Wohnungen waren "unter Dach"
beziehungsweise im Rohbau fertiggestellt).
Der bisher höchste Bauüberhang war im
Jahr 1995 mit 928 500 Wohnungen gemessen
worden. 29 000 erloschene Baugenehmigungen
für Wohnungen im Jahr 2024 Der Rückgang des
Bauüberhangs ist auch auf die hohe Zahl
erloschener Baugenehmigungen zurückzuführen,
bei denen in der Regel die mehrjährige
Gültigkeitsdauer der Genehmigung abgelaufen
ist.
Im Jahr 2024 erloschen 29 000
Baugenehmigungen, das war der höchste Wert
seit 2002 und ein Anstieg um rund ein
Viertel gegenüber den Vorjahren (2023:
22 700; 2022: 22 800). Zur Anzahl der im
Bauüberhang enthaltenen Bauvorhaben, deren
Genehmigung zwar noch nicht erloschen sind,
die aber nicht mehr weiterverfolgt werden,
liegen keine Informationen vor.
7,3 % weniger umbauter Raum bei
Nichtwohngebäuden Auch die Bauaktivität bei
Nichtwohngebäuden ist im Jahr 2024 deutlich
zurückgegangen. Nichtwohngebäude sind zum
Beispiel Fabrikgebäude und Lagerhallen,
Büro- und Verwaltungsgebäude oder
landwirtschaftliche Betriebsgebäude.
Der zentrale Indikator für die
Bauaktivität bei Nichtwohngebäuden ist der
umbaute Raum. Bei den im Jahr 2024
fertiggestellten Nichtwohngebäuden
verringerte sich der umbaute Raum gegenüber
dem Jahr 2023 um 7,3 % auf 177,7 Millionen
Kubikmeter. Besonders stark war der Rückgang
bei den Handels- und Warenlagergebäuden mit
-20,3 % beziehungsweise -12,9 %.
Die DVG macht Platz für
Schützen
Von Freitag,
23. Mai, bis Sonntag, 25. Mai, finden in Duisburg-Serm
Schützenumzüge statt. Deshalb weicht die DVG zeitweise auf eine
Umleitungsstrecke aus.
Verfahrenslotsen
unterstützen junge Menschen bei der Eingliederungshilfe
Nicht alle finden sich im komplexen System der Eingliederungs-
und Jugendhilfe problemlos zurecht. Umso wichtiger ist eine
kompetente und verlässliche Unterstützung: Die Verfahrenslotsen der
Stadt Duisburg – spezialisierte Fachkräfte im Jugendamt – begleiten
junge Menschen mit (drohenden) Behinderungen und ihre Familien auf
dem Weg zur passenden Hilfe.
Die Verfahrenslotsen
informieren über individuelle Leistungsansprüche, beraten umfassend
und stehen auf Wunsch bei Behördengängen, Antragsverfahren,
Widersprüchen oder Konflikten mit Leistungsträgern, Ämtern und
anderen Einrichtungen zur Seite. Ziel ist es, Familien spürbar zu
entlasten und den Zugang zu notwendigen Unterstützungsangeboten zu
erleichtern.
Im Mittelpunkt steht dabei die
gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit
Behinderung – von der medizinischen Rehabilitation (z. B.
Sprachtherapie, Frühförderung) über Hilfen zur schulischen oder
beruflichen Bildung (etwa Schul- oder Studienassistenz) bis hin zur
Unterstützung im Alltag und bei der Mobilität. Die Beratung durch
die Verfahrenslotsen ist kostenfrei und kann flexibel erfolgen –
persönlich, telefonisch, per Videokonferenz oder E-Mail.
Die
barrierefrei erreichbaren Büros befinden sich in der Obermauerstraße
1–3 in Duisburg-Mitte. Offene telefonische Sprechzeiten bietet das
Team unter 0203/283-7847 immer montags und freitags von 10 bis 12
Uhr sowie mittwochs von 12 bis 16 Uhr an. Außerhalb dieser Zeiten
können ebenfalls individuelle Termine vereinbart werden – auch
außerhalb der Dienststelle. Schriftliche Anfragen sind per E-Mail an
verfahrenslotsen@stadt-duisburg.de zu richten.
Weitere
Informationen gibt es online auf der städtischen Internetseite unter
www.duisburg.de/verfahrenslotsen.

Verfahrenslotsen v.l.: Christina Gemerzki, Peter Zeyen, Milena
Höltgen und Mirko Greifenberg. Die Verfahrenslotsen helfen sich im
oft komplizierten System der Eingliederungshilfe und Jugendhilfe
zurechtzufinden. Sie klären über Ansprüche und Leistungen auf,
beraten individuell und begleiten auf Wunsch bei Behördengängen,
Antragsstellungen, Widerspruchsverfahren oder Konflikten mit
unterschiedlichen Trägern, Ämtern und weiteren Einrichtungen. Foto:
Tanja Pickartz / Stadt Duisburg
Mehr Naturschutz im
Ruhrgebiet: RVR Ruhr Grün schafft sechs neue
Bundesfreiwilligendienst-Stellen
Der Eigenbetrieb Ruhr
Grün des Regionalverbandes Ruhr (RVR) erweitert sein Engagement für
den Naturschutz und schafft sechs neue Stellen im
Bundesfreiwilligendienst (BFD). Die BFD-Plätze bieten
Naturbegeisterten die Chance, aktiv zum Erhalt der biologischen
Vielfalt im Ruhrgebiet beizutragen. Die Freiwilligen werden unter
anderem bei Projekten zur Wald- und Gewässerpflege sowie beim Schutz
bedrohter Arten mitwirken.
Die Arbeit bietet einen
umfassenden Einblick in die vielfältigen ökologischen Aufgaben des
RVR und ermöglicht wertvolle Praxiserfahrung im Naturschutz. "Mit
den zusätzlichen Bundesfreiwilligendienst-Stellen geben wir mehr
Menschen die Möglichkeit, praktische Erfahrungen im Naturschutz zu
sammeln und gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zur Biodiversität
unserer Region zu leisten.
Dies ist ein weiterer Baustein
auf dem Weg zur grünsten Industrieregion ", betont Carsten
Uhlenbrock, Betriebsleiter von RVR Ruhr Grün. Der
Bundesfreiwilligendienst beginnt am 1. August 2025. Interessierte
können sich ab sofort auf der RVR-Karriereseite bewerben:
https://www.rvr.ruhr/politik-regionalverband/ueber-uns/startseite-karriere/
- idr
Verwaltungsvereinbarung zur Städtebauförderung
in Kraft getreten: Städtebauliche Investitionen mit 790 Mio. Euro
können starten
Die Städtebauförderung steht für starke
Quartiere, ein attraktives Lebensumfeld und ein gutes Miteinander in
der Nachbarschaft. Seit über 50 Jahren leisten Bund, Länder und
Kommunen mit der Städtebauförderung einen maßgeblichen Beitrag zu
lebenswerten Quartieren für die Bewohnerinnen und Bewohner sowohl in
städtischen als auch in ländlichen Räumen.
Die Wirkung der
Städtebauförderung umfasst die Entwicklung und Umsetzung von
Strategien für resiliente und zukunftsfähige Lebensräume – von
Hitzeanpassungsplänen über attraktive Sport- und Bewegungsräume bis
hin zur sozialgerechten Quartiersentwicklung. Mit der Unterzeichnung
der Verwaltungsvereinbarung zur Städtebauförderung durch alle
Bundesländer wurde nun die rechtliche Voraussetzung dafür
geschaffen, dass die Gewährung der Bundesförderung an die Länder zur
städtebaulichen Unterstützung der Städte und Gemeinden erfolgen
kann.
Dazu Verena Hubertz, Bundesministerin für Wohnen,
Stadtentwicklung und Bauwesen: „Die Städtebauförderung ist das
wichtigste Instrument der Stadtentwicklung in Deutschland. Etwa
12.400 bislang geförderte Gesamtmaßnahmen sprechen eine deutliche
Sprache. 1 Euro Städtebauförderung bewirkt durchschnittlich rund 7
Euro private und öffentliche Folgeinvestitionen. Das ist gut
investiertes Geld in lebendige Gemeinschaften und lebenswerte
Städte. Wir wollen deshalb die Mittel in dieser Legislaturperiode
schrittweise verdoppeln. Ich danke dem Haushaltsausschuss, dass wir
es geschafft haben, die Förderung auch im Jahr 2025 verlässlich
weiterzuführen.“
Die Bund-Länder-Vereinbarung ist am
vergangenen Freitag in Kraft getreten. Zuvor hatte der
Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages trotz noch fehlenden
Bundeshaushalts 2025 die Bereitstellung der Finanzmittel für das
Jahr 2025 ermöglicht und damit für die notwendige Planungssicherheit
bei den Ländern und Kommunen gesorgt. Auch im Jahr 2025 stellt der
Bund erneut 790 Millionen Euro für die Städtebauförderung bereit.
An den Kosten der Städtebauförderung beteiligen sich Bund,
Land und Kommune je zu einem Drittel. Im aktuellen Koalitionsvertrag
für die 21. Legislaturperiode haben sich die Regierungsparteien
zudem darauf verständigt, die Mittel für die Städtebauförderung
schrittweise zu verdoppeln. Weitere Informationen zur
Städtebauförderung finden Sie unter:
https://www.staedtebaufoerderung.info
Spielerisch die Welt der Logistik entdecken - Ideen-Wettbewerb
Logistikids 2025 gestartet
Beim Wettbewerb Logistikids
geht es darum, dass Kinder Logistik spielerisch entdecken. In diesem
Jahr geht es um die Frage, wie die Kiwi zu uns nach Hause kommt und
wie heute im Onlineshop Bestelltes, morgen da ist. Bis zum 3.
November können Grundschulen und Kindergärten ihre Projekte
einreichen.
Ob basteln, filmen, malen, bauen: Bei ihren
Projekten dürfen sich die jungen Teilnehmenden kreativ ausprobieren
und dabei erleben, wie wichtig Transport und Logistik für unser
tägliches Leben sind. Mindestens fünf Kinder pro Gruppe sollten es
sein, im Alter zwischen fünf und elf Jahren.
Die besten
Beiträge werden mit bis zu 1.000 € Preisgeld sowie Sachpreisen
belohnt. Weitere Informationen, Teilnahmebedingungen und ein
Anmeldeformular finden Sie unter
www.ihk.de/niederrhein/logistikids
NRW vor Warnstreik-Welle in Brauereien?
Beschäftigte fordern Lohn-Plus
24,2 Millionen
Bierflaschen in Duisburg unterwegs – aber bald wohl ein paar weniger
Überall Bierkisten: im Keller, in der Küche. Und auch im
Kofferraum, wenn die Kisten geholt oder weggebracht werden. Rein
statistisch sind in Duisburg in der Spitze – also an „heißen
Biertrink-Tagen“ – rund 24,2 Millionen Mehrwegflaschen Bier im
Umlauf: volle und leere. Und natürlich die, die gerade getrunken
werden. Darauf hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten
hingewiesen.
Die NGG Nordrhein beruft sich dabei auf Zahlen
des Deutschen Brauerbundes. Der Brauerei-Verband zählt bis zu vier
Milliarden Mehrweg-Glasflaschen, die bundesweit zwischen den
Brauereien, den Getränkehändlern, den Supermärkten und den
Haushalten unterwegs sind.
Doch die NGG Nordrhein warnt: Die
Bierflaschen in den Haushalten in Duisburg könnten demnächst weniger
werden. Denn in etlichen Brauereien in Nordrhein-Westfalen komme es
in den nächsten Tagen und Wochen zu Warnstreiks. Und das, obwohl
„bierdurstige Feiertage“ vor der Tür stehen: Christi Himmelfahrt und
Pfingsten. „Auch der Sommer-Durst könnte leiden: Eine gedrosselte
Bierproduktion würde dann auch Grillabende und Sommerfeste trockener
ausfallen lassen“, sagt Adnan Kandemir.
Der Geschäftsführer
der NGG Nordrhein nennt die Gründe für die drohende Drosselung beim
Bier am Zapfhahn und in der Flasche: „In den nordrhein-westfälischen
Brauereien hat sich so einiges an Ärger zusammengebraut. Die
Arbeitgeber treten beim Lohn gewaltig auf die Bremse. Damit
provozieren sie jetzt einen ‚Knoten in der Bierleitung‘ – nämlich
eine ganze Reihe von Warnstreiks in vielen nordrhein-westfälischen
Brauereien“, so Adnan Kandemir.
Vom Sudkessel über das Labor
bis zum Fasskeller: Die NGG fordert für alle Brauerei-Beschäftigten
ein Lohn-Plus von 6,6 Prozent in diesem Jahr. „Mindestens müssen
aber alle, die Vollzeit arbeiten, 280 Euro pro Monat mehr verdienen.
Davon profitieren dann vor allem auch die, die nicht – wie zum
Beispiel die Brauer – weiter oben auf der Lohn-Leiter stehen.
Außerdem sollen auch die Azubis mehr bekommen: 130 Euro pro Monat“,
fordert Adnan Kandemir.
Die Arbeitgeber haben nach Angaben
der Gewerkschaft bislang jedoch lediglich 2,2 Prozent für dieses und
2 Prozent für das kommende Jahr angeboten. „Das ist ein eindeutig zu
dünnes Lohn-Plus für ordentlich gebrautes Bier“, so Kandemir. Zur
dritten und damit entscheidenden Verhandlungsrunde treffen
Gewerkschaft und die rheinisch-westfälischen Brauerei-Arbeitgeber am
kommenden Mittwoch (Hinweis f.d. Red.: 28. Mai) zusammen.
Der VdK Duisburg-Neudorf besucht den Landtag
Der Duisburger SPD-Abgeordnete Frank Börner, konnte diese Woche
Mitglieder des Sozialverbands VdK aus Duisburg-Neudorf begrüßen. Der
VdK wurde 1950 als „Verband der Kriegsbeschädigten,
Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands“ gegründet. Er
vertritt die Interessen von Sozialrentnern, Menschen mit
Behinderung, Unfallopfern sowie Kriegs- und Wehrdienstopfern.
Bundesweit zählt er mehr als 2,2 Millionen Mitglieder.
In
Nordrhein-Westfalen sind es mehr als 400.000 - organisiert in 43
Kreisverbänden und rund 800 Ortsverbänden. Die Mitglieder hatten
sich einen guten Tag für den Besuch ausgesucht: das Plenum tagte und
sie konnten eine Stunde auf der Besuchertribüne die Debatte der
Parlamentarier zum Thema Bildung live verfolgen.
Anschließend war Zeit mit Frank Börner zu diskutieren und Fragen zu
stellen. Es ging u. a. um den Fachkräftemangel in der Pflege und die
damit verbundenen Probleme. Auch das Thema Inklusion bzw.
Barrierefreiheit im Alltag und im öffentlichen Raum bewegte die
Duisburger Gäste. „Das war ein interessanter und lebhafter Austausch
– vielen Dank für euren Besuch“, verabschiedete Börner die
Duisburger nach Hause.

Foto Büro Börner
VDI zum Frühjahrsgutachten der Wirtschaftsweisen: „Wir
brauchen jetzt eine Innovationsagenda“ - 5-Punkte-Programm gefordert
Deutschlands Wirtschaft stagniert, das bestätigt auch die heutige
Konjunkturprognose der Wirtschaftsweisen. Der VDI spricht sich jetzt
für eine Strukturreform und eine Ausrichtung der Politik auf
Innovationen aus.
VDI-Direktor Adrian Willig sagt zum
Frühjahrsgutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: “Die Zeichen stehen leider nach
wie vor auf Nullwachstum. Die deutsche Wirtschaft tritt nach zwei
Rezessionsjahren in Folge weiter auf der Stelle. Das ist
erschreckend. Es braucht dringend einen Schub; einen Ruck nach
vorne.
Die politischen Akteure haben die Zeichen bereits
erkannt und sollten jetzt schnell in die Umsetzung der politischen
Vorhaben kommen. Wir müssen uns dabei aber fragen, in welchen
Schlüsseltechnologien wir künftig unseren Wohlstand verdienen
wollen. Dazu braucht es jetzt eine klare Innovationsagenda, die
gemeinsam mit den Machern unseres Landes – den Ingenieuren und
Ingenieurinnen – angegangen werden muss. Für diese Strukturreform
schlägt der VDI ein 5-Punkte-Programm für mehr Innovationen vor.”
Das 5-Punkte-Programm des VDI:
- Eine langfristige
Technologie- und Innovationsstrategie mit klaren Zielen und
Prioritäten, über Legislaturperioden hinaus.
- Einen Aufbruch in
eine neue Zeit der Innovation, damit Deutschland als integraler Teil
von Europa im globalen Wettbewerb in Schlüsseltechnologien eine
führende Rolle spielt.
- Mehr Vertrauen, gesellschaftliche
Akzeptanz und faktenbasierte Debatten über Chancen und Risiken von
Technologien.
- Wettbewerbsfähige sowie verlässliche
Rahmenbedingungen, um Patente, Forschungsergebnisse und
Entwicklungen erfolgreich in die industrielle Anwendung zu bringen
und Wertschöpfung in Deutschland zu generieren.
- Eine umfassende
Fachkräftestrategie, einschließlich einer konsequenten und
verbindlichen MINT-Bildung in allen Schulformen.
„Es ist kein
Naturgesetz, dass Deutschland wirtschaftlich erfolgreich bleibt. Der
Innovationsmotor stottert in Deutschland. Innovationen werden in
Deutschland oft zu langsam oder auch gar nicht gezielt bis zur
Marktreife gebracht. Ingenieure und Ingenieurinnen liefern die
Machbarkeit für die Herausforderungen unserer Zeit. Es braucht
endlich wieder eine klare Vision für Technik und Innovation als
Grundlage unseres Wohlstands. Wenn Deutschland weiter zur Weltspitze
gehören will, braucht es Strukturreformen und eine echte
Innovationsstrategie der neuen Bundesregierung“, so Willig.
VDI als Gestalter der Zukunft
Mit unserer Community und unseren
rund 130.000 Mitgliedern setzen wir, der VDI e.V., Impulse für die
Zukunft und bilden ein einzigartiges multidisziplinäres Netzwerk,
das richtungweisende Entwicklungen mitgestaltet und prägt. Als
bedeutender deutscher technischer Regelsetzer bündeln wir
Kompetenzen, um die Welt von morgen zu gestalten und leisten einen
wichtigen Beitrag, um Fortschritt und Wohlstand zu sichern.
Mit Deutschlands größter Community für Ingenieurinnen und
Ingenieure, unseren Mitgliedern und unseren umfangreichen Angeboten
schaffen wir das Zuhause aller technisch inspirierten Menschen.
Dabei sind wir bundesweit, auf regionaler und lokaler Ebene in
Landesverbänden und Bezirksvereinen aktiv. Das Fundament unserer
täglichen Arbeit bilden unsere rund 10.000 ehrenamtlichen
Expertinnen und Experten, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen
einbringen.
Grundschüler lernen den Landtag kennen
Frank Börner, Duisburger SPD-Abgeordneter, empfing
diese Woche besonders quirligen Besuch im Düsseldorfer Landtag. Vier
vierte Klassen der Grundschule Am Röttgersbach machten sich mit
ihren Lehrkräften auf den Weg in die Landeshauptstadt. Die 100
Schülerinnen und Schüler haben das vom Landtag organisierte
Grundschulprogramm durchlaufen, mit dem Ziel, dass die Kinder sich
auf spielerische Weise mit dem Landtag und der parlamentarischen
Demokratie beschäftigen.
Außerdem konnten sie mit Frank
Börner diskutieren und ihm alle Fragen stellen, die ihnen wichtig
waren. „Ich bin beeindruckt, wie gut vorbereitet und interessiert
die Kinder waren. Wir hätten gerne noch länger miteinander sprechen
können. Danke an die gute Vorbereitungsarbeit der Lehrkräfte.
Demokratie braucht Demokraten! Und das fängt bei den Kleinsten an.
Deshalb ist mir ein Austausch mit Kindern und Jugendlichen immer
besonders wichtig.“

Foto Büro Börner
Tag der Nachbarschaft in der Stadtteilbibliothek
Beeck: Gemeinsam entdecken, spielen und lesen
Die
Stadtteilbibliothek Beeck am Lange Kamp 5 lädt am Freitag, 23. Mai,
herzlich zum Tag der Nachbarschaft ein. Zwischen 14 und 17 Uhr
erwartet die Besucherinnen und Besucher ein buntes Programm zum
Kennenlernen, Mitmachen und Erleben. Bei einer gemütlichen Tasse
Kaffee können Nachbarinnen und Nachbarn ins Gespräch kommen, lesen,
spielen, zuhören und die Bibliothek neu entdecken.
Kleine
Mitmachaktionen laden zum Ausprobieren ein – und wer dabei ist, hat
sogar die Chance, einen kleinen Preis zu gewinnen. Ob Jung oder Alt
– alle sind willkommen!
Niederrheinpokalendspiel: So bringt die DVG die Fans zur
Arena
Für Gäste des Niederrheinpokalendspiels MSV
Duisburg gegen Rot-Weiß-Essen am Samstag, 24. Mai, um 16.30 Uhr in
der Schauinsland-Reisen Arena, setzt die DVG ihre Sportlinie 945
ein.
Abfahrtszeiten Buslinie 945 Richtung MSV Arena:
ab
„Salmstraße“ (Meiderich) Abfahrt um 14.36, 14.46, 14.56 Uhr
ab
„Bergstraße“ um 14.41, 14.51 und 15.01 Uhr
ab „Meiderich Bahnhof“
ab 14.45 bis 15.10 Uhr alle fünf Minuten
ab „Großenbaum Bahnhof
Ost“ um 15.20 und 15.35 Uhr
ab „Betriebshof am Unkelstein“ ab
14.28 bis 14.53 Uhr alle fünf Minuten
ab „Hauptbahnhof“
(Verknüpfungshalle) ab 14.45 bis 16.05 Uhr alle fünf Minuten
ab
„Businesspark Nord“ (Asterlagen) um 15.03 Uhr.

DVG-Foto
Nach Spielende stehen am Stadion Busse für die Rückfahrt bereit.
Gäste des Fußballspieles, die eine Tageseintrittskarte im Vorverkauf
erworben haben oder eine Dauerkarte besitzen, können kostenlos die
öffentlichen Verkehrsmittel für die Hin- und Rückfahrt benutzen. Für
die Gäste, die sich an der Stadionkasse ihre Eintrittskarte kaufen,
ist die Rückfahrt mit Bus und Bahn kostenlos.
Vertiefung des Binnenmarkts und Abbau von Hindernissen
als Ziel
Der TÜV-Verband begrüßt die neue
EU-Binnenmarkstrategie der EU-Kommission, empfiehlt aber
Nachbesserungen in einzelnen Bereichen. „Der Binnenmarkt ist das
Herzstück der Europäischen Union. Er sichert die wirtschaftliche und
politische Souveränität der EU im Wettbewerb der globalen
Wirtschaftsblöcke“, sagt Johannes Kröhnert, Leiter Büro Brüssel beim
TÜV-Verband.
„Einheitliche und verlässliche Markt- und
Wettbewerbsregeln stärken die in der EU ansässigen Unternehmen. Ein
gut funktionierender Binnenmarkt ist dabei das beste
Entbürokratisierungsprogramm: Eine Regel für alle ersetzt 27
Einzelregelungen der Mitgliedsstaaten.“ Es sei daher wichtig,
bestehende Binnenmarkthindernisse weiter abzubauen, von der
uneinheitlichen Umsetzung harmonisierter Binnenmarktregelungen über
die immer noch stark fragmentierten Dienstleistungsmärkte bis hin
zur fehlenden gegenseitigen Anerkennung von Berufsabschlüssen.
Wichtig aus Sicht des TÜV-Verbands: Der Abbau von Bürokratie und
die Vereinfachung von Regelungen darf nicht zulasten des hohen
Schutzniveaus in Europa gehen. Es muss sichergestellt werden, dass
die EU-Binnenmarktgesetzgebung klar formuliert ist, einheitlich
angewendet und konsequent kontrolliert wird. Kröhnert: „Gute
Regulierung ist kein Wachstumshemmnis – im Gegenteil: Sie schafft
Rechts- und Planungssicherheit und sorgt für einheitliche
Wettbewerbsbedingungen.“
Produktregulierung: Anpassungen für
mehr Nachhaltigkeit und Digitalisierung
Eine zentrale Säule des
Binnenmarkts ist der freie Warenverkehr, der auch durch einheitliche
Produktanforderungen ermöglicht wird. Die Kommission plant, die
europäische Produktegesetzgebung an die Digitalisierung und
Kreislaufwirtschaft anzupassen.
Ein wichtiges Element ist
der Digitale Produktpass (DPP), der zukünftig für fast alle
Produktkategorien eingeführt werden soll. Der Pass soll
Informationen zu Herkunft, Materialien oder Inhaltsstoffen eines
Produkts enthalten, aber auch zu Reparierbarkeit, Ersatzteilen und
fachgerechter Entsorgung.
„Der digitale Produktpass wird
auch eine wichtige Informationsquelle für Verbraucher. Und er macht
die geltenden Anforderungen an die Sicherheit und
Umweltverträglichkeit eines Produkts sichtbar“, sagt Kröhnert. „Der
digitale Produktpass kann sein volles Potenzial aber nur dann
entfalten, wenn die enthaltenen Angaben vollständig und richtig
sind.
Die im Produktpass hinterlegten Informationen sollten
daher von unabhängigen Stellen validiert und verifiziert werden.“
Ein Ersatz für die unabhängige Prüfung von Produkten sei der
Digitale Produktpass aber nicht. Der TÜV-Verband hat zur
Überarbeitung der Produktgesetzgebung in einem Positionspapier
mehrere Vorschläge unterbreitet.
Online-Handel: Unsichere
Produkte fluten EU-Länder
Großer Handlungsbedarf besteht beim
Online-Handel. „Die EU wird mit Produkten regelrecht geflutet, die
nicht den geltenden Sicherheits- und Umweltanforderungen
entsprechen“, sagt Kröhnert. Die EU-Kommission schätzt, dass im
Online-Handel in bestimmten Sektoren zwischen 50 bis 100 Prozent
aller aus Drittstaaten importierten Produkte nicht den EU-Standards
entsprechen.
Die EU-Kommission plant deshalb, die
Marktüberwachung europaweit besser zu koordinieren und Ressourcen zu
bündeln. „Eine stärkere Marktüberwachung in den einzelnen EU-Ländern
ist notwendig, wird das Problem angesichts der Masse der
importierten Produkte aber nicht lösen“, betont Kröhnert.
„Effizienter wäre es, auf unabhängige Drittprüfungen in den
Herkunftsländern zu setzen, damit möglichst nur konforme und sichere
Produkte in den EU-Binnenmarkt gelangen.“ Darüber hinaus könnten
sich Anbieter mit einer unabhängigen Verifizierung als
vertrauenswürdig erweisen und deren Produkte beim Zoll und der
Marktüberwachung privilegiert werden. Auch dazu hat der TÜV-Verband
Empfehlungen erarbeitet.
Europäische Qualitätsinfrastruktur
stärken
Aus Sicht des TÜV-Verbands ist für den globalen Erfolg
des europäischen Binnenmarkts eine weitere Stärkung und
Modernisierung der sogenannten Qualitätsinfrastruktur entscheidend.
„Die europäische Wirtschaft wird weltweit für ihre Innovationskraft
und die hohe Qualität und Sicherheit ihrer Produkte geschätzt“, sagt
Kröhnert.
„Das System aus Normung, Akkreditierung,
Konformitätsbewertung und Marktüberwachung ist ein wichtiger Garant
für Qualität Made in Europe“, sagt Kröhnert. Diese weltweit
anerkannte Qualitätsinfrastruktur muss weiter modernisiert und
digitalisiert werden. „Digitale Zertifikate, Normen und Standards
können einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Effizienz des
Systems leisten“, betont Kröhnert. Die neue Binnenmarktstrategie
müsse dieses Thema daher noch stärker adressieren.
Darüber
hinaus ist eine stärkere Harmonisierung der Regelungen für die
Akkreditierung von Prüforganisationen notwendig. „Ein effizientes
System für die Kontrolle der Prüforganisationen sorgt für das
notwendige Vertrauen in deren Unabhängigkeit und Kompetenz“, sagt
Kröhnert. Wichtig sei eine europaweit einheitliche Auslegung und
Anwendung der Akkreditierungsvorgaben ohne nationale Alleingänge.
Dafür schlägt der TÜV-Verband vor, den Aufbau einer europäischen
Akkreditierungsbehörde zu prüfen.
Stadtteilbibliothek
Wanheimerort: Workshop Portraitzeichnen
Die
Stadtteilbibliothek Wanheimerort bietet Jugendlichen von zehn bis 14
Jahren am Freitag, 23. Mai, ab 15 Uhr in den Räumlichkeiten an der
Düsseldorfer Straße 544 einen Workshop an, in denen sie das
Portraitzeichnen erlernen können. Die Grafikdesignerin und
Künstlerin Riswane Rowinsky erklärt die ersten Schritte – vom
Betrachten des Modells über die Erstellung einer Skizze bis zum
Zeichnen eines fertigen Portraits.
Gezeigt wird, wie man
schnell und realistisch Portraits zeichnen kann. Vorkenntnisse sind
nicht erforderlich. Der Workshop wird durch das Programm
„Kulturrucksack NRW“ gefördert. Alle benötigten Materialien werden
gestellt. Es können aber auch eigene Utensilien mitgebracht werden.
Die Teilnahme beträgt 2 Euro zugunsten der Duisburger
Bibliotheksstiftung. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur
Anmeldung gibt es online unter
www.stadtbibliothek-duisburg.de
Günter Baby Sommer / Michel Godard
Günter
Baby Sommer ist einer der bedeutendsten Vertreter des
Zeitgenössischen europäischen Jazz, welcher mit einem hoch
individualisierten Schlaginstrumentarium zugleich eine
unverwechselbare musikalische Sprache entwickelt hat. Sommer wurde
1943 in Dresden geboren und studierte an der Hochschule für Musik,
Carl Maria von Weber‘.
Seine musikalischen Beiträge zu den
wichtigsten Jazzgruppen der DDR wie dem Ernst-Ludwig-Petrowksy-Trio,
dem Zentralquartett und der Ulrich Gumpert Workshopband ermöglichten
Sommer den Einstieg in die internationale Szene. So arbeite Sommer
nicht nur im Trio mit Wadada Leo Smith und Peter Kowald sondern traf
mit so wichtigen Spielern wie Peter Brötzmann, Fred van Hove,
Alexander von Schlippenbach, Evan Parker und Cecil Taylor zusammen.
Sommers Solospiel sensibilisierte ihn für Kolloborationen
mit Schriftstellern wie Günter Grass. Sommers Diskografie umfasst
über 100 Audio-Datenträger. Als Professor an der Musikhochschule in
Dresden nimmt er Einfluss auf die professionelle Vermittlung des
Zeitgenössischen Jazz an die nachfolgenden Generationen.
Michel Godard - Als Schöpfer und Forscher weckt, findet und webt
Michel Godard Verbindungen zwischen den Jahrhunderten und den
Musikkulturen. Natürlich durch die Praxis der Improvisation und ihre
Codes, aber auch durch die vielfältigen Begegnungen mit Musikern aus
aller Welt. Als klassischer Tubist, bevor er zum unumgänglichen
Tubisten der europäischen Jazz-Ensembles wurde, fand er ein völlig
vergessenes Instrument wieder, das er am CNSM in Paris unterrichtete
und das zufällig der Vorläufer der Tuba ist: die Schlange.
Heute ist sein Schaffen diese Alchemie, die aus den Edelmetallen der
verschiedenen musikalischen Kulturen, die ihn bewohnen, gebildet
wird. Michel Godard teilt eine zeitlose Musik; er ist ein
multidimensionaler Musiker, der neuen Generationen von Forschern und
Schöpfern neue Perspektiven eröffnet.
Günter Baby Sommer /
Michel Godard Freitag 23. Mai 2025 | 20:00 Uhr Das PLUS am Neumarkt,
Neumarkt 19, 47119 Duisburg-Ruhrort Eintritt frei! /// Um Spenden
wird gebeten! Veranstalter: KULTURPROJEKTE NIEDERRHEIN e.V. und
Deutsch-Französische Gesellschaft Duisburg e.V.
Meidericher Gemeinde lädt zur Kirchenkneipe ein
An einem der vier Freitage jeden Monats öffnet im
Gemeindezentrum der Evangelischen Kirchengemeinde Duisburg
Meiderich, Auf dem Damm 8, die Kirchenkneipe.
So auch am 23.
Mai 2025, wo Besucherinnen und Besucher nach dem
19-Uhr-Wochenabschlussandacht ab 19.30 Uhr wieder gute Getränke,
leckere Kleinigkeiten und eine gemütliche Atmosphäre erwarten
können, die zum Wohlfühlen einlädt und Platz für nette Gespräche
lässt. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter
www.kirche-meiderich.de oder im Gemeindebüro unter 0203-4519622.

NRW: Zahl der Scheidungen erstmals seit 2008 wieder
gestiegen
* Rund 30.000 Scheidungen im Jahr 2024 – 1,6
% mehr als im Vorjahr
* Unterschiedliche Entwicklung in den
kreisfreien Städten und Kreisen
* Über drei Prozent mehr
betroffene minderjährige Kinder
Im Jahr 2024 haben sich in
Nordrhein-Westfalen 29.578 Ehepaare scheiden lassen, das waren 1,6 %
mehr als im Jahr zuvor. Wie Information und Technik
Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, gab es
damit erstmals seit 16 Jahren wieder einen leichten Anstieg der
Scheidungszahl. Zuvor war sie kontinuierlich von 46.098 im Jahr 2008
auf 29.116 im Jahr 2023 gesunken.
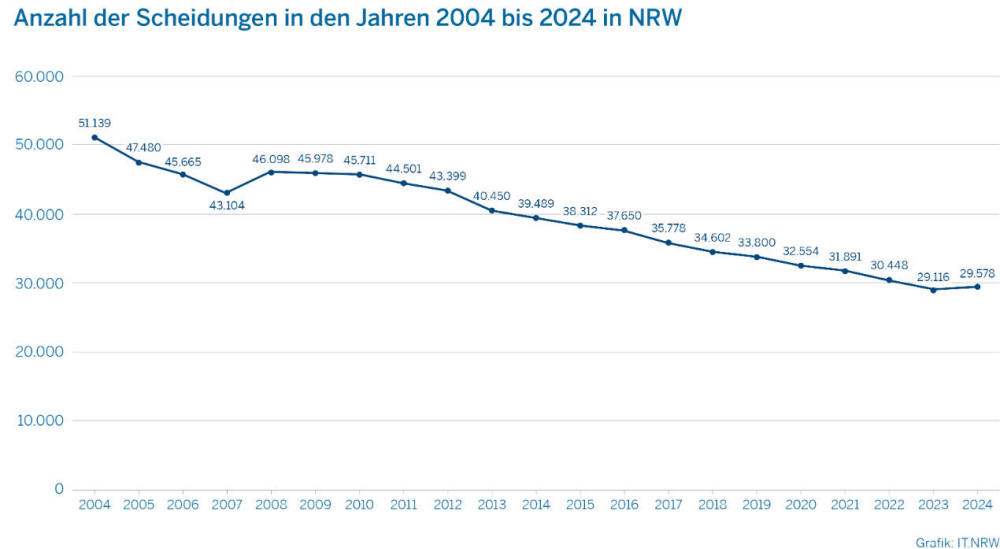
Trotz der Trendumkehr lag die Scheidungszahl 2024 auf dem
zweitniedrigsten Stand der letzten 20 Jahre. Unter den Geschiedenen
im Jahr 2024 waren 331 gleichgeschlechtliche Paare. Ein Jahr zuvor
waren 304 gleichgeschlechtliche Ehen gerichtlich geschieden worden.
Kreise und kreisfreie Städte mit unterschiedlicher Entwicklung
Regional betrachtet ließen sich in 30 kreisfreien Städten und
Kreisen mehr Ehepaare scheiden als im Vorjahr.
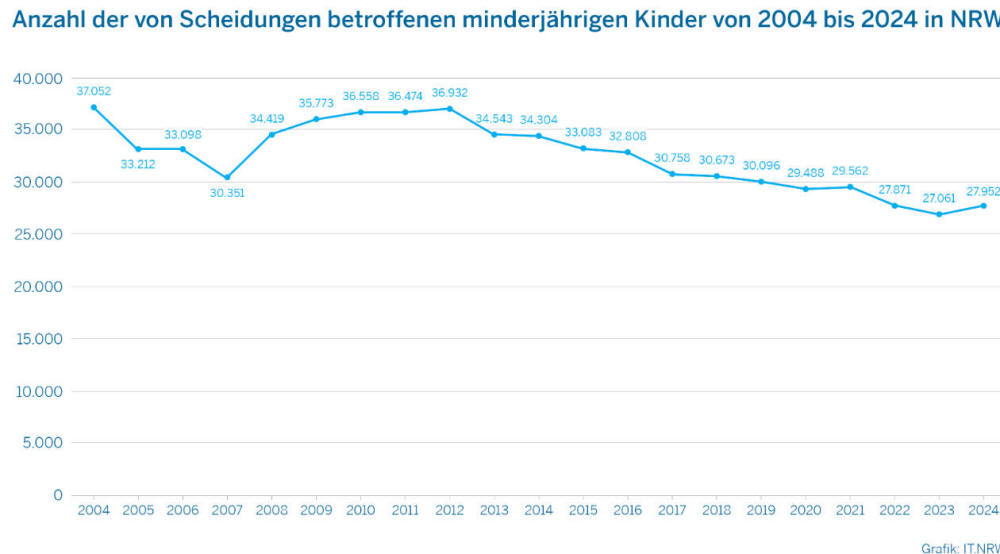
Die größte Zunahme an Scheidungen gegenüber dem Vorjahr gab es
im Kreis Lippe mit 41,1 %, im Rhein-Erft-Kreis mit 38,5 % und im
Kreis Herford mit 24,7 %. Entgegen der landesweiten Entwicklung war
in 23 kreisfreien Städten und Kreisen die Scheidungszahl niedriger
als 2023.
Die größten Rückgänge an Scheidungen waren in
Leverkusen (– 32,5 %), im Kreis Olpe (– 20,3 %) und im
Rheinisch-Bergischen Kreis (– 17,0 %) zu verzeichnen. Über drei
Prozent mehr betroffene minderjährige Kinder Landesweit waren 27.952
minderjährige Kinder 2024 von der Scheidung ihrer Eltern betroffen.
Das waren 3,2 % mehr als ein Jahr zuvor. Die Zahl der betroffenen
minderjährigen Kinder ist damit erstmals seit 2021 wieder
angestiegen. In den Jahren 2009 bis 2012 hatte es mehr als 35.000
betroffene Minderjährige gegeben, danach war die Zahl gesunken.
Ausländerinnen und Ausländer zahlen eine um 9,5 % höhere
Miete pro Quadratmeter als Deutsche
• Ausländerinnen und
Ausländer zahlen im Schnitt 7,75 Euro Nettokaltmiete pro
Quadratmeter, Deutsche 7,08 Euro
• Menschen ohne deutsche
Staatsangehörigkeit wohnen häufiger in kleineren Wohnungen, die
teurer sind
• Bei Wohndauer von 20 oder mehr Jahren:
Ausländerinnen und Ausländer mit 9,1 % höheren Quadratmetermieten
Ausländerinnen und Ausländer zahlen durchschnittlich um 9,5
% höhere Quadratmetermieten für ihre Wohnungen als Deutsche. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) nach Ergebnissen des Zensus 2022
mitteilt, betrug bei Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit die
durchschnittliche Nettokaltmiete 7,75 Euro pro Quadratmeter
Wohnfläche, bei Deutschen im Schnitt 7,08 Euro pro Quadratmeter.
Die durchschnittliche Nettokaltmiete bildet die Bestandsmieten
sämtlicher Mietverhältnisse in Deutschland ab – auch solche, die
schon sehr lange bestehen. Zum Vergleich von Wohnungen
unterschiedlicher Größe ist die Nettokaltmiete pro Quadratmeter
Wohnfläche ein geeignetes Maß.
Ausländerinnen und Ausländer wohnen häufiger
in kleineren Wohnungen und zur Miete Ein Erklärungsansatz für die
höheren Durchschnittsmieten könnte die Wohnungsgröße sein: Ein
Viertel (25 %) der Ausländerinnen und Ausländer wohnte 2022 in
Wohnungen mit weniger als 60 Quadratmetern Wohnfläche, bei Deutschen
waren es nur knapp jede und jeder Achte (12 %).
Die
durchschnittliche Nettokaltmiete für Haushalte in Wohnungen unter
60 Quadratmeter lag im Jahr 2022 bei 8,01 Euro und damit 15,6 %
höher als bei Haushalten in Wohnungen mit 60 oder mehr Quadratmetern
(6,93 Euro). Im Durchschnitt wohnten Ausländerinnen und Ausländer
auf einer Wohnfläche von 85,7 Quadratmetern, während Deutsche im
Schnitt Wohnungen mit einer Wohnfläche von 109,6 Quadratmetern
bewohnten.
Mehrheitlich wohnten Menschen ohne deutsche
Staatsangehörigkeit zur Miete: Während 54 % der Deutschen im Jahr
2022 im selbst genutzten Wohneigentum wohnten, traf dies nur auf gut
ein Fünftel (22 %) der Ausländerinnen und Ausländer zu.
Bei
gleicher Wohndauer zahlen Ausländerinnen und Ausländer höhere Mieten
Profitieren Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit
möglicherweise von niedrigeren Mieten bei bereits länger bestehenden
Mietverhältnissen? Dass Deutsche tendenziell länger bestehende
Mietverhältnisse mit niedrigeren Mieten haben, scheidet als
Erklärung für die Unterschiede aus. Zwar wohnten 22 % der
Ausländerinnen und Ausländer weniger als ein Jahr an ihrer aktuellen
Anschrift – gegenüber 7 % der Deutschen.
Und andersherum
wohnten mehr als die Hälfte (51 %) der Deutschen zehn Jahre oder
länger an ihrer Anschrift, während es bei Menschen mit ausländischer
Staatsangehörigkeit 20 % waren. Aber auch nach Wohndauer
aufgeschlüsselt zeigt sich: Ausländerinnen und Ausländer zahlen
durchschnittlich höhere Quadratmetermieten.
Insbesondere bei
langer Wohndauer gibt es Unterschiede: Ausländerinnen und Ausländer,
die 20 Jahre oder länger an ihrer Anschrift wohnten, hatten
durchschnittlich um 9,1 % höhere Quadratmetermieten als Menschen mit
deutschem Pass bei gleicher Wohndauer. Bei einer Wohndauer von
15 bis unter 20 Jahren betrug der Unterschied 5,9 %, bei einer
Wohndauer von 10 bis unter 15 Jahren 7,0 %.
Bei neueren
Mietverhältnissen, die kürzer als ein Jahr bestanden, zahlten
Ausländerinnen und Ausländer 3,5 % höhere Quadratmetermieten als
Deutsche. Durchschnittliche Nettokaltmiete nach Wohndauer und
Staatsangehörigkeit
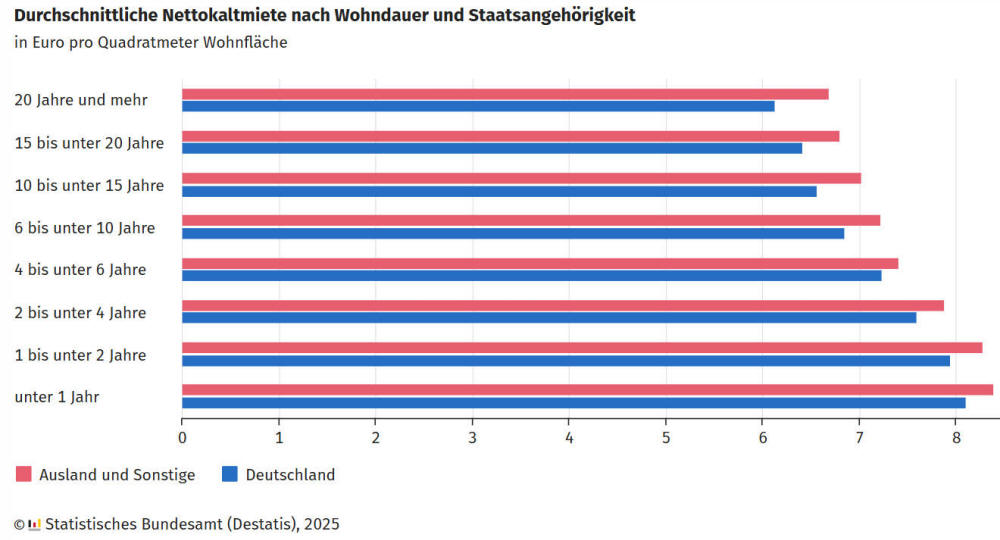
In Großstädten, größeren und kleineren Gemeinden haben
Ausländerinnen und Ausländer durchweg höhere Quadratmetermieten Auch
der Wohnort erklärt die Differenz bei den Mieten nicht vollständig.
Sowohl auf dem angespannten Wohnungsmarkt in Großstädten als auch in
kleineren Gemeinden zahlten Ausländerinnen und Ausländer höhere
Quadratmetermieten als Deutsche.
Während der Unterschied in
Großstädten ab 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 7,3 % betrug,
lag er in mittelgroßen Städten (50 000 bis unter
100 000 Einwohnerinnen und Einwohner) bei 6,6 %, in kleineren
Städten (10 000 bis unter 50 000 Einwohnerinnen und Einwohner) bei
9,3 % und in Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnerinnen und
Einwohnern bei 10,6 %.