






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 24. Kalenderwoche:
11. Juni
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Donnerstag, 12. Juni 2025
Sondereffekte sorgen für erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 der
Stadtwerke
USA und EU: Zusammenarbeit stärken
US-Generalkonsulin Shah bei IHK Preeti V. Shah war am 11.
Juni zu Gast bei der Niederrheinischen IHK. Seit September 2024
leitet sie das US-Generalkonsulat in Düsseldorf. Mit IHK-Präsident
Werner Schaurte-Küppers sprach sie über die aktuelle
wirtschaftspolitische Lage.

Generalkonsulin Shah und IHK-Präsident Schaurte-Küppers waren sich
einig: Der gemeinsame Dialog ist wichtig für die
Handelspartnerschaft. Fotos Niederrheinische IHK/Jacqueline Wardeski
Beide sind sich einig: Die globalen
Handelsbeziehungen erfordern, dass wir im Dialog bleiben und unsere
Partnerschaft stärken. US-Handelskonsul Jay Carreiro begleitete
Shah.
„Die USA bleiben für unsere Unternehmen der zentrale
Handelspartner außerhalb Europas. Wir müssen sicherstellen, dass
unsere Lieferketten weiter funktionieren und die Geschäfte laufen.
Das gelingt nur, wenn wir uns trotz geopolitischer Spannungen
regelmäßig austauschen und weiter vertrauensvoll zusammenarbeiten“,
betonte Schaurte-Küppers.
Shah zeigte sich beeindruckt vom
Industrie- und Logistik-starken Niederrhein. Die Generalkonsulin
informierte sich insbesondere bei mittelständischen Unternehmern der
Region, wie sich die aktuelle wirtschaftliche Lage auf sie auswirkt.
Im Gespräch ging es aber auch um Themen wie Fachkräftemangel,
Digitalisierung und Energiewende.
„NRW ist mit seinen 1.800
US-Unternehmen und vielen lokalen Firmen, die in den USA
investieren, ein wichtiger Partner für unser Konsulat. Es gibt viele
Bereiche, in denen wir zusammenarbeiten können, um gemeinsam den
Wohlstand zu steigern.“

IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Stefan Dietzfelbinger (2.v.l.) und
IHK-Präsident Werner Schaurte-Küppers (3.v.r.) haben die
amerikanische Generalkonsulin Preeti V. Shah (M.) in Duisburg
empfangen. Gemeinsam mit US-Handelskonsul Jay Carreiro (M.l.) und
Unternehmern vom Niederrhein tauschten sie sich über die
wirtschaftspolitische Lage aus.
Nationaler
Veteranentag – ab sofort immer am 15. Juni!
Am 15. Juni
2025 findet der erste Nationale Veteranentag der Bundesregierung
statt. Seine Einführung beruht auf einem Beschluss des Deutschen
Bundestages. Als Tag der Anerkennung macht er auf die Bedeutung und
die Leistung von Veteraninnen und Veteranen für Frieden, Freiheit,
Demokratie und eine starke Gesellschaft aufmerksam. Der Nationale
Veteranentag soll das Band zwischen Bundeswehr und Gesellschaft
stärken.

Die zentrale Festveranstaltung findet am 15. Juni 2025 ab 13 Uhr
am Reichstagsgebäude in Berlin statt. Ein unbeschwertes Fest für
alle mit einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm, Musik,
Fragerunden, Informationsangeboten und weiteren innovativen Formaten
- ein Tag des Dialogs und des Miteinanders.

Der Deutsche Bundestag, Abgeordnete sowie das Amt des
Wehrbeauftragten stellen sich gemeinsam mit Veteraninnen und
cVeteranen vor. Zahlreiche Vereine und Verbände sind ebenfalls
vertreten. Neben Verteidigungsminister Boris Pistorius wird auch
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner als Schirmfrau an der
Veranstaltung teilnehmen.
In ganz Deutschland laden Länder,
Städte und Kommunen, Veteranenverbände und weitere Akteure zu
vielfältigen Veranstaltungen ein. Die Veteranen und Veteraninnen
freuen sich ganz besonders auf den persönlichen Austausch mit den
Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Auf der Homepage des Veteranentags (www.veteranentag.gov.de)
sind weitere Informationen sowie das bundesweite Programm zu finden.
Beschluss des Deutschen Bundestages: aus der Mitte der
Gesellschaft
Die Einführung des Nationalen Veteranentags beruht
auf einem Beschluss des Deutschen Bundestages: Im April 2024 haben
die Abgeordneten mit großer Mehrheit beschlossen, einen Nationalen
Veteranentag einzuführen sowie die Versorgung von Veteraninnen und
Veteranen und ihrer Familien zu verbessern.
Der Nationale
Veteranentag soll das Band zwischen Bundeswehr und Gesellschaft
stärken. “Wer für die Sicherheit und Freiheit unseres Landes alles
gibt, der verdient mehr als Dankesworte. Der Deutsche Bundestag hat
den Nationalen Veteranentag ins Leben gerufen. Wir möchten diesen
Tag gemeinsam feiern. Unsere Veteraninnen und Veteranen verdienen
Anerkennung, Respekt und Unterstützung.”

Julia Klöckner, Präsidentin des Deutschen Bundestag, Schirmfrau des
Nationalen Veteranentages (Foto: Tobias Koch)
Akteure aus
Politik und Verwaltung (Bund, Länder, Städte und Gemeinden),
Veteranenverbände sowie gesellschaftliche Netzwerke sind neben der
Bundesregierung und dem Deutschen Bundestag aktiv an der Umsetzung
beteiligt.

Das Bundesministerium der Verteidigung, als Dienstherr aller aktiven
Soldatinnen und Soldaten und mit seiner Schnittstelle zu den
Veteranenverbänden über das Veteranenbüro der Bundeswehr, wurde mit
der Koordinierung der Ausgestaltung beauftragt. Es geht um die
Anerkennung derjenigen, die in letzter Konsequenz bereit sind, das
Äußerste für andere zu geben, und die ihr Leib und Leben für unser
Land einsetzen. Und es geht um ihre Familien. Boris Pistorius
(SPD), Verteidigungsminister
Stadtranderholung
2025 in Duisburg – Anmeldung noch möglich
Die
Anmeldephase für die Duisburger Stadtranderholung in den
Sommerferien läuft auf Hochtouren – und es gibt sogar noch freie
Plätze. Die Stadtranderholung wird vom 4. bis 22. August angeboten.
Voraussetzungen für die Teilnahme: Das Kind hat die 1. Klasse
abgeschlossen, ist höchstens 13 Jahre alt und die letzten drei
Wochen der Sommerferien sind noch nicht mit Urlaub verplant.
Wichtige Hinweise: Einige der 18 Standorte sind bereits
ausgebucht. Anmeldungen sind generell noch bis zum 15. Juni möglich.
Verfügbar sind unter anderem noch Plätze auf dem AWO-Bauspielplatz,
am Ingenhammshof oder im Stadtpark Meiderich. Auch „Die Insel“, die
„Alte Schmiede“ oder das Kinder- und Jugendzentrum Driesenbusch
melden noch freie Plätze.
Informationen zu den Kosten und
Anmeldemöglichkeiten auch an weiteren Standorten gibt es unter
https://stadtranderholung-duisburg.easy2book.de/ Für Rückfragen
steht das Team der Stadtranderholung telefonisch unter 0203 283
983110 gerne zur Verfügung.
RVR startet Besucherbefragungen an der Halde
Rheinpreußen und am Lohheider See
Die Meinung der
Naherholenden ist gefragt: Um Infrastruktur und Freizeitangebote auf
der Halde Rheinpreußen in Moers und im Baerler Busch in Duisburg zu
optimieren, führt der Regionalverband Ruhr (RVR) vom 13. bis 15.
Juni eine Besucherbefragung durch. Die Interviewer sind an der Halde
und am Lohheider See unterwegs.
Ziel der Befragungen ist es,
Erkenntnisse zu Besucherstruktur und Freizeitaktivitäten sowie zu
Nutzungshäufigkeit und Erreichbarkeit zu gewinnen. Der RVR bittet
Besucherinnen und Besucher um ihre Mitwirkung, um ein möglichst
umfassendes Bild zu erhalten.
Die Befragung ist Teil einer
übergreifenden Untersuchung des RVR zur Nutzung seiner
Liegenschaften zwischen der Halde Rheinpreussen, dem Waldsee, dem
Baerler Busch und dem Lohheider See. idr
Brückentag am 20. Juni: Wichtige Informationen zur
Erreichbarkeit der Stadt
Die Stadtverwaltung Duisburg
ist am Freitag, 20. Juni (Brückentag nach Fronleichnam), nur
eingeschränkt erreichbar. Einzelne Dienststellen sind von dieser
Regelung ausgenommen, wie beispielsweise der Notruf der Feuerwehr
und der Städtische Außendienst, die wie gewohnt erreichbar sind. Das
telefonische Servicecenter „Call Duisburg“ ist nur mit einem
eingeschränkten Notdienst besetzt.
Die
Bürgerservicestationen, das Amt für Soziales und Wohnen, das Amt für
Schulische Bildung, das Amt für Rechnungswesen und Steuern, das Amt
für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz, das Umweltamt, der
Innendienst des Bürger- und Ordnungsamtes, die Ausländerbehörde, die
Einbürgerungsbehörde, das Straßenverkehrsamt, alle Dienststellen im
Stadthaus (wie beispielsweise Erteilung von Parkausweisen und
Katasterauskünfte), sowie in großen Teilen das Jugendamt und das
Stadtarchiv sind am Brückentag nicht erreichbar, ebenso das
Standesamt.
Eheschließungstermine vom Standesamt, die für
diesen Tag vereinbart wurden, finden statt. Bestatter können sich
erst am Montag, 23. Juni, für die Beurkundung von Sterbefällen und
Ausstellung von Leichenpässen an das Standesamt wenden. Die
städtischen Kindertageseinrichtungen sowie die Schulen sind von den
Betriebsferien an diesem Tag nicht betroffen. Einige Einrichtungen
haben jedoch bereits im Vorfeld die Schließung für diesen Tag
eingeplant.
Die Zentralbibliothek auf der Steinschen Gasse
ist am Freitag, 20. Juni, und Samstag, 21. Juni, zu den gewohnten
Zeiten geöffnet. Die Open Libraries in Beeck, Wanheimerort und
Vierlinden stehen Kundinnen und Kunden mit gültigem Ausweis an allen
Tagen, auch am Feiertag, wie gewohnt zur Verfügung. Alle anderen
Zweigstellen der Bibliothek bleiben geschlossen. Der Bücherbus fährt
an diesem Tag nicht. Das Online-Angebot der Stadtbibliothek kann mit
einem gültigen Bibliotheksausweis uneingeschränkt genutzt werden.
Die städtischen Bäder, das Museum der Deutschen
Binnenschifffahrt sowie das Kultur- und Stadthistorische Museum
haben an diesem Tag ebenso wie gewohnt geöffnet. Die Musik- und
Kunstschule ist am 20. Juni geschlossen. Der Unterricht an der
Volkshochschule findet statt. Die Geschäftsstellen der
Volkshochschule sind geschlossen. Die gesamte Stadtverwaltung ist ab
Montag, 23. Juni, wieder wie gewohnt erreichbar.
An
Brückentagen können durch den Abbau von Rückstellungen für nicht
genommenen Urlaub oder Freizeitausgleich sowie die Reduzierung von
Energiekosten weitere Einsparungen zur Haushaltskonsolidierung
erzielt werden. Durch die CO2-Reduzierung (Strom, Pendelverkehr)
ergeben sich auch positive Effekte für die Umwelt.
Wichtiger
Hinweis zur Erreichbarkeit und dem Besuch von städtischen
Einrichtungen:
Die Kontaktdaten der Dienststellen sind auf der
Internetseite der Stadt Duisburg unter www.duisburg.de einsehbar
oder können telefonisch unter (0203) 94000 über Call Duisburg
erfragt werden. Viele Anliegen lassen sich auch online erledigen.
Eine Übersicht hierzu gibt es auf der städtischen Internetseite
unter dem Stichwort „Bürgerportal“. Eine Online-Terminvergabe im
Bereich der Bürgerservicestationen ist ausschließlich unter
www.duisburg.de/termine möglich.
Rekordbeteiligung
beim SpardaLeuchtfeuer
Jetzt abstimmen und Sport in Duisburg und
der Umgebung fördern!
Der beliebte
Online-Förderwettbewerb SpardaLeuchtfeuer ist in diesem Jahr mit
einer Rekordbeteiligung gestartet: Aktuell machen bereits über 440
gemeinnützige Sportvereine mit – mehr als im vergangenen Jahr zum
Abstimmungsstart. Weitere Bewerbungen sind noch bis zum 17. Juni
2025 möglich.
Ab sofort ist auf der Wettbewerbsseite
www.spardaleuchtfeuer.de das Voting freigeschaltet. Dabei gibt es
für die Vereine insgesamt 250.000 Euro zu gewinnen. Wer sich also
für den Sport in Duisburg und der Umgebung einsetzen möchte, sollte
jetzt aktiv werden und seine Stimme abgeben.

Die Abstimmung beim SpardaLeuchtfeuer 2025 ist gestartet!
„Den Erfolg des SpardaLeuchtfeuers tragen alle, die mitmachen:
Sportvereine ebenso wie Abstimmende“, erklärt Dominik Kanders,
Filialleiter der Sparda-Bank in Duisburg. „Ich freue mich riesig,
dass sich so viele Vereine beteiligen – vor allem, weil wir aus
organisatorischen Gründen diesmal kürzere Vorlaufzeiten haben.“
Das wirkt sich auch auf die Abstimmung aus: Das Voting endet
bereits am 1. Juli 2025. Umso wichtiger, dass jetzt möglichst viele
Menschen an der Abstimmung teilnehmen. Das ist ganz einfach über die
Wettbewerbsseite möglich und lohnt sich: „Jeder Klick kommt
letztlich dem lokalen Sport zugute“, betont Dominik Kanders. „Wir
fördern die 150 Vereine mit den meisten Stimmen jeweils mit bis zu
6.000 Euro.“
Dabei sein und abstimmen – so funktioniert’s!
Wer das unterstützen möchte, sucht sich unter
www.spardaleuchtfeuer.de seinen Lieblingsverein heraus, gibt die
eigene Mobilfunknummer ein und erhält per SMS kostenlos einen
Abstimmcode. Mit diesem lässt sich innerhalb von 48 Stunden für den
Favoritenverein abstimmen.
Neu in diesem Jahr: Nach Abgabe
der Stimme öffnet sich ein Fenster mit drei Fragen. Damit können die
Abstimmenden helfen, den Wettbewerb weiterzuentwickeln. Neben
Altersgruppe und einer möglichen Vereinsmitgliedschaft geht es
darum, wie die Teilnehmenden auf den Wettbewerb aufmerksam geworden
sind. „Die häufig ehrenamtlich getragenen Vereine brauchen einfach
noch viel mehr Sichtbarkeit – dazu wollen wir gerne beitragen“,
berichtet der Filialleiter.
Nicht vergessen: Lieblingsverein
auf Instagram nominieren
Aktuell hilft in diesem Fall einfach:
Weitersagen! Bewerbungen von gemeinnützigen Sportvereinen aus
Duisburg und der Umgebung sind bis zum 17. Juni um Mitternacht
möglich. Noch mehr Aufmerksamkeit verspricht der ebenfalls ab sofort
startende Instagram-Sonderpreis.
Auch hier lohnt es sich,
mitzumachen: Dafür einfach @spardawest auf Instagram folgen und per
Kommentar den Lieblingsverein unter dem Gewinnspiel-Post nominieren.
Die so ins Spiel gebrachten Vereine haben die Chance auf einen von
zehn mit 1.000 Euro dotierten Sonderpreisen. Auch für die
Kommentierenden ist etwas im Lostopf: Insgesamt gibt es zehn
Sportartikel-Gutscheine zu gewinnen.
Das SpardaLeuchtfeuer
wird also auf allen Kanälen von einer starken Gemeinschaft getragen.
Das gilt auch für die Preisgelder: Diese stammen aus den
Reinerträgen des Gewinnsparvereins bei der Sparda-Bank West und
werden damit von den Sparerinnen und Sparern finanziert.
Dominik Kanders: „Es sind also sehr viele Menschen daran beteiligt,
die Sportvereine zu unterstützen. Jetzt setze ich darauf, dass
möglichst viele dieses Feuer weitergeben, Vereine in Duisburg und
der Umgebung zum Mitmachen aktivieren, abstimmen und auf Instagram
vorbeischauen.“ Mehr Informationen unter
www.spardaleuchtfeuer.de
ACV stellt
kostenlose Verkehrsfibel für Grundschulkinder bereit
27.235 – so viele Straßenverkehrsunfälle mit Kindern unter 15 Jahren
erfasste das Statistische Bundesamt im Jahr 2023. Zwar ist diese
Zahl gegenüber den frühen 1990er-Jahren nahezu halbiert, jedoch
zeigen die jüngsten Erhebungen wieder einen leichten Anstieg. Ein
alarmierender Trend, dem aktiv begegnet werden muss.

Grundschulkinder mit der ACV Verkehrsfibel bei einer Verteilaktion
des Hefts in der Johannesschule in Köln-Höhenhaus / Bildrechte:ACV,
Foto: Jürgen Naber
Zum Kindersicherheitstag 2025 macht der
ACV Automobil-Club Verkehr deutlich: Kinder brauchen besonderen
Schutz und gezielte Unterstützung im Straßenverkehr. ACV Lernheft
für Kinder: Spielerisch Verkehrssicherheit vermitteln Der ACV setzt
sich bereits seit vielen Jahren aktiv für die Sicherheit von Kindern
im Straßenverkehr ein. Bereits 2020 startete der Club eine
Kampagne gegen Elterntaxis.
Aktuell führt er sein Engagement mit der 2024 ins Leben
gerufenen Initiative Schulweg-Champions fort. Im Mittelpunkt steht
dabei ein in Kooperation mit der Polizei Köln entwickeltes Lernheft
für Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren. Das Heft vermittelt
wichtige Verkehrsregeln auf spielerische Weise und bietet Eltern und
Bezugspersonen wertvolle Tipps zur Förderung der Verkehrskompetenz
ihrer Kinder.
Angelehnt an das Maskottchen des ACV
begleiten die Kinder im Lernheft den kleinen Pfau Pavo durch sein
„Schulwegabenteuer“. Dort erlebt er verschiedene
Verkehrssituationen, denen auch Kinder auf ihrem Schulweg begegnen
können. Dabei werden zunächst grundlegende Verhaltensregeln wie das
Stehenbleiben am Bordstein vermittelt, bevor komplexere Szenarien
wie das Überqueren einer Straße zwischen parkenden Autos behandelt
werden.
Die Bildergeschichte wird durch Sprechblasen,
Ausmalbilder und Rätsel ergänzt, die das Verständnis der Kinder
vertiefen. Bezugspersonen erhalten über ausführlichere Erklärtexte
hilfreiche Zusatzinformationen. Kostenlose Verteilung – bundesweit
und mehrsprachig Seit Beginn der Initiative verteilt der ACV die
Schulfibel auf vielfältige Weise kostenlos: In Köln wurden
Grundschulen im Rahmen einer groß angelegten Aktion direkt versorgt.
Auch bei Veranstaltungen wie dem Weltkindertagsfest in Köln
kam das Heft zum Einsatz. Darüber hinaus bringen die 76 bundesweit
aktiven ACV Ortsclubs das Lernheft in viele Regionen Deutschlands.
Das Heft steht außerdem auf der
ACV Website
kostenlos zum Download bereit – auch in mehreren Fremdsprachen sowie
in einer Version auf Kölsch.
Für Schulklassen kann im ACV
Shop ein kostenloser Klassensatz mit 30 Exemplaren bestellt werden.
Die Polizei Köln, die den ACV bei der inhaltlichen Entwicklung
fachlich umfassend beraten hat, sieht in der Verkehrsfibel ein
wertvolles Instrument für die Präventionsarbeit in Kitas und
Grundschulen.
ACV Geschäftsführer Holger Küster ordnet die
Initiative ein: „Mit Schulweg-Champions möchten wir Kinder
frühzeitig dabei unterstützen, Verkehrsregeln zu lernen und
gefährliche Situationen im Straßenverkehr zu erkennen. Wir setzen
dabei in unserem Lernheft bewusst auf eine kindgerechte und
fantasievolle Geschichte, die den Kindern ermöglicht, aktiv
mitzuwirken.
Gleichzeitig legen wir großen Wert auf
fachliche Fundierung, die auch durch unsere enge Zusammenarbeit mit
der Polizei Köln sichergestellt ist.“ Weitere Informationen zur
Initiative Schulweg-Champions gibt es unter:
www.acv.de/schulweg-champions
Stadtführung: „Stadtgeschichte draußen – Nachkriegsmoderne
in Duissern“
Die Veranstaltungsreihe „Stadtgeschichte
draußen“ wird am Donnerstag, 12. Juni, um 17 Uhr mit einer Führung
zur „Nachkriegsmoderne in Duissern“ fortgesetzt. Treffpunkt ist an
der Lutherkirche, Martinstraße 39, in Duissern. Annika Enßle vom
Stadtarchiv richtet bei dem Rundgang den Blick auf jene Gebäude, die
nach 1945 errichtet wurden.
Ihre Anwesenheit zwischen den
bürgerlichen Altbauten bezeugt nicht nur die Kriegszerstörung,
sondern auch den rasanten Wiederaufbau des Stadtteils. Die
Stilmerkmale und Entstehungsumstände dieser Bauten der sogenannten
Nachkriegsmoderne überliefern den kulturellen Wandel und die
Zukunftsvorstellung der Nachkriegszeit.
Bei der Veranstaltungsreihe laden Stadtarchiv und „Mercators Nachbarn“ gemeinsam zu historischen und kunstgeschichtlichen Rundgängen durch die Stadt ein. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Zentrum für Erinnerungskultur: Lesung „Spielfeld der
Herrenmenschen – Kolonialismus und Rassismus im Fußball“ mit Ronny
Blaschke
Das Zentrum für Erinnerungskultur lädt am
Donnerstag, 12. Juni, um 18 Uhr in den Räumlichkeiten des
Stadtarchives am Karmelplatz 5 (Innenhafen) zu einer Lesung mit
Ronny Blaschke aus seinem Buch „Spielfeld der Herrenmenschen.
Kolonialismus und Rassismus im Fußball“ ein.

Foto Sebastian Wells
Der Journalist
und Buchautor beleuchtet in seiner Arbeit die dunklen Seiten der
Fußballgeschichte und untersucht, wie Kolonialismus und Rassismus
auch in der Welt des Sports verankert sind. Die Lesung findet in
Kooperation mit dem Festival für Fußballliteratur „Nachspielzeit“
statt und wird von dem Duisburger Sportler und Berater Bülent Akşen,
moderiert.
Die Veranstaltung bietet eine tiefgehende
Auseinandersetzung mit der historischen und aktuellen Bedeutung von
Rassismus im Fußball und regt zum Nachdenken und Diskutieren an. Der
Eintritt ist frei. Es wird um vorherige Anmeldung per E-Mail an
zfe@stadtduisburg.de gebeten.
Duisburg: NGG ruft
zur Gründung von Betriebsräten auf
Viele der 8.680 Unternehmen in
Duisburg haben ein „Betriebsrats-Vakuum“
Einer sollte
dem Chef immer sagen, was Sache ist: In Duisburg arbeiten rund
203.500 Beschäftigte in rund 8.680 Betrieben. „Aber längst nicht
alle haben in ihren Jobs eine starke Stimme gegenüber dem Chef:
Viele der Beschäftigten in Duisburg haben keine
Arbeitnehmervertretung. Dabei ist jedes ‚Betriebsrats-Vakuum‘ eine
vertane Chance“, sagt Adnan Kandemir von der Gewerkschaft
Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG).
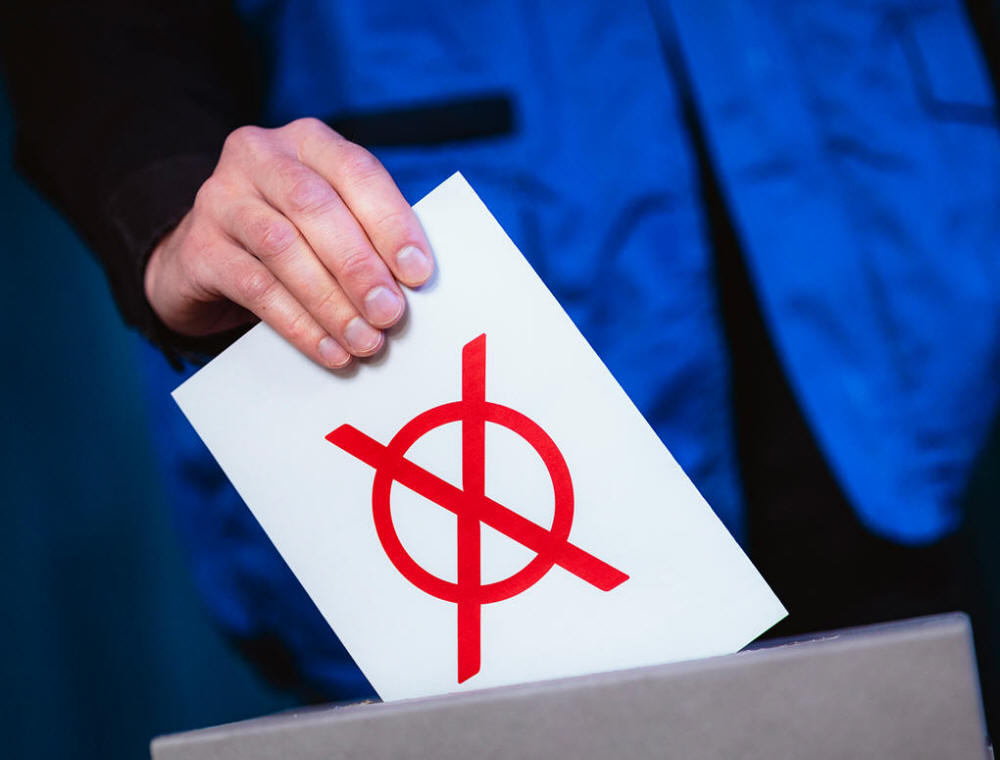
NGG-Foto | Florian Göricke
Denn gerade Betriebsräte seien gut
für die Unternehmen: „Vom Ärger über die Arbeitszeit bis zum
besseren Arbeitsschutz – ein Betriebsrat packt die heiklen Themen im
Unternehmen an. Er kümmert sich darum, dass die Azubis vernünftig
ausgebildet und anschließend übernommen werden. Und genauso um die
Beschäftigten, denen die Arbeit über den Kopf wächst“, sagt
Kandemir. Ein Betriebsrat sei das „Scharnier zwischen Belegschaft
und Chefetage – ein Sprachrohr der Beschäftigten gegenüber dem
Chef“, so der Geschäftsführer der NGG Nordrhein.
Die
Situation vieler Beschäftigter sei durchaus kritisch: Viele Branchen
in Duisburg spürten bereits die aktuelle Wirtschaftskrise. Außerdem
plane die neue Bundesregierung Änderungen für Arbeitsbedingungen.
Dazu zähle etwa das Abrücken von der täglichen Höchstarbeitszeit,
das Auswirkungen auf viele Betriebe in Duisburg haben werde, so die
NGG Nordrhein.
„Gerade deshalb ist es jetzt wichtig, dass es
einen Betriebsrat gibt. Der macht das, was ein einzelner
Beschäftigter nicht kann: Er setzt sich bei der Unternehmensleitung
für die Interessen der gesamten Belegschaft ein. Und er kümmert sich
auch um Einzelfälle – um individuelle Probleme von Beschäftigen“,
sagt Adnan Kandemir. Ein Betriebsrat sei wichtig für den
reibungslosen Ablauf und für das Klima im Unternehmen. Er mache
gerade auch in Krisenzeiten „Jobs sicherer und besser“.
Die
NGG Nordrhein appelliert daher an die Unternehmen in Duisburg, in
denen es noch keinen Betriebsrat gibt, jetzt eine
Arbeitnehmervertretung zu gründen: „Ab fünf Beschäftigten kann und
sollte es einen Betriebsrat geben. Je mehr Beschäftigte es gibt,
desto mehr können sich auch im Betriebsrat engagieren“, sagt
Kandemir.
Dort, wo es bereits einen Betriebsrat gebe, werde
dieser im kommenden Jahr neu gewählt. Wer jetzt aber in Duisburg
einen Betriebsrat gründe, stelle damit schon heute die Weichen für
die nächsten fünf Jahre: Denn neu gegründete Betriebsräte würden
nicht bei den regulären Betriebsratswahlen im kommenden Jahr erneut
zur Wahl stehen, sondern erst 2030. Von Hotels bis zur
Ernährungswirtschaft – die NGG Nordrhein bietet für ihre Branchen
eine „Starthilfe“ für die Gründung eines Betriebsrats an:
region.BGOberhausen@ngg.net oder (0208) 305 82 12.
Parkkonzert im
Jubiläumshain: Bläsersymphonie der Abtei Hamborn
Die
beliebte Parkkonzertreihe im Jubiläumshain setzt sich am kommenden
Sonntag, 15. Juni, um 11 Uhr mit der Bläsersymphonie der Abtei
Hamborn fort. Das 2020 gegründete symphonische Blasorchester
zeichnet sich durch eine große Besetzung mit allen Holz- und
Blechblasinstrumenten sowie Schlagwerk und Kontrabässen aus.
Aber auch außergewöhnliche Instrumente sind im Orchester
vertreten – wie die Celesta. Das gespielte Repertoire reicht von
Unterhaltungsmusik über Filmmusik bis hin zu Originalkompositionen
in den oberen Schwierigkeitsgraden. Der Eintritt ist frei. Auch in
diesem Jahr werden die Parkkonzerte wieder vom Lions-Clubs
Duisburg-Hamborn unterstützt.

Aktuelle Informationen gibt es auch im Internet unter:
https://www.facebook.com/ParkkonzerteHamborn. Weitere
Konzerttermine:
22. Juni Bandonion Freunde Essen
29. Juni
Musikvereinigung Du-West DSB e.V.
6. Juli Shanty Chor
Duisburg-WSP NRW
13. Juli Blasorchester Lohmühle e.V.
Swingfoniker-Chor lädt zur
musikalischen Reise ein
Kartenvorverkauf für das
Konzert in der Marxloher Kreuzeskirche startet Die Marxloher
Kreuzeskirche wird 120 Jahre alt, und der Chor „Swingfoniker“, der
schon oft zu Gast in dem Gotteshaus war, feiert den
Kirchengeburtstag zum Abschluss der Festwoche mit einem großen
Konzert. Karten gibt´s jetzt im Vorverkauf.
Das Programm
hat Chorleiter Lutz Peller unter das Motto „Lieder bauen Brücken –
gerade in schwierigen Zeiten“ gestellt: In einer Zeit weltweiter
„schräger Töne“ setzen die Swingfoniker auf vielstimmigen Wohlklang
und nehmen ihre Zuhörer musikalisch mit auf eine Reise: von Irland
bis Schottland, von England bis Amerika. Lieder der alten Heimat
begegnen denen der neuen Welt.
Im Repertoire sind wie
gewohnt Filmtitel und moderne Songs u.a. von Coldplay und Paul
McCartney. Für programmatische Abwechslung sorgen die
Männerformation und das Damen-Duo KlangPur. Die Evangelische
Bonhoeffer Gemeinde Marxloh-Obermarxloh lädt zum Konzert in der
Kreuzeskirche ein, Kaiser-Friedrich-Str. 40, am Sonntag, 22. Juni
2025, 17 Uhr; Einlass ist um 16.30 Uhr.
Karten zum Preis von
12 Euro sind im Gemeindebüro an der Lutherkirche, Wittenbergerstr.
15, nach dem Sonntagsgottesdienst um 12 Uhr und beim Chorvorstand
unter 0163-2998500 erhältlich. Infos zu den Swingfonikern gibt es im
Netz unter www.swingfoniker.de, zur Festwoche und zur Gemeinde gibt
es im Netz unter
www.bonhoeffer-gemeinde.org.

Swingfoniker
(Foto: www.swingfoniker).
Gemeinde-Café
Dreivierteltakt in Wanheimerort
Die Evangelische
Rheingemeinde Duisburg öffnet zum Monatsausklang das „Café
Dreivierteltakt“, bei dem Seniorinnen und Senioren zu Kaffee, Tee
und Kuchen zusammenkommen, die Begleit-Musik genießen, dazu
schunkeln und sogar tanzen. Für den guten Ton sorgt Frank Rohde, der
zu seinem Spiel an der elektronischen Orgel auch singt.
Es
gibt dabei nicht nur Klänge im Dreivierteltakt, doch alle Lieder
haben Rhythmus und sind vielen bekannt. Das nächste
gesellig-musikalische Treffen im Beratungs- und Begegnungszentrum
(BBZ) Wanheimerort, Paul-Gerhardt-Straße 1, ist am Samstag, 21. Juni
2025 um 15 Uhr.
Es hat das Thema "Karneval" und
Besucherinnen und Besucher sind gerne im Kostüm gesehen, Pflicht ist
die Verkleidung jedoch nicht. Bei sieben Euro Eintritt sind Kaffee
und Kuchen inbegriffen; Anmeldungen
sind bei Maria Hönes telefonisch möglich (Tel.: 0203 770134).

Frank Rohde an
seinem Keyboard (Foto: Maria Hönes)

Atypische Beschäftigung 2024 weiter rückläufig
• Der Anteil atypisch Beschäftigter sinkt 2024 auf 17,2 %
• Beschäftigungszuwachs bei der Normalbeschäftigung,
insbesondere bei Teilzeit mit mehr als 20 Wochenstunden
• Drei
von vier Kernerwerbstätigen (74,8 %) sind normalbeschäftigt, weitere
8 % selbstständig
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes
(Destatis) lag der Anteil atypisch Beschäftigter an allen
Kernerwerbstätigen im Jahr 2024 bei 17,2 %. Damit hält der
kontinuierliche Rückgang seit Beginn der 2010er Jahre an.
Atypische Beschäftigung umfasst Arbeitsverhältnisse außerhalb der
Normalbeschäftigung, also keine unbefristeten,
sozialversicherungspflichtigen Tätigkeiten mit mehr als 20
Arbeitsstunden pro Woche. Normalbeschäftigte üben ihre Tätigkeiten
zudem nicht in Leih- oder Zeitarbeit aus.
Im Jahr 2010 hatte der Anteil atypisch Beschäftigter noch bei 22,6 %
gelegen. In diesem Zeitraum ist bei allen Formen der atypischen
Beschäftigung ein Rückgang zu verzeichnen: Der Anteil befristet
Beschäftigter sank von 8,1 % auf 5,9 %, der von
Teilzeitbeschäftigten bis 20 Wochenstunden von 14,1 % auf 10,9 % und
der von geringfügig Beschäftigten von 7,2 % auf 4,2 %.
Zeitarbeit erreichte 2017 seinen größten Beschäftigungsanteil mit
2,5 %. Im Jahr 2024 lag er bei 2,1 %. Der auch 2024 deutlich höhere
Anteil von Frauen in atypischer Beschäftigung von 25,0 % gegenüber
den 10,2 % bei den Männern lag vor allem an der
Teilzeitbeschäftigung mit einem Umfang von bis zu 20 Stunden pro
Woche.
19,4 % der Frauen in Kernerwerbstätigkeit gingen
einer solchen Beschäftigung nach, aber nur 3,4 % der Männer. Zudem
waren Frauen mit 6,5 % deutlich häufiger geringfügig beschäftigt als
Männer (2,2 %). Dabei sind die Anteile entsprechend
teilzeitbeschäftigter Frauen seit 2010 von 26,3 % um knapp 7
Prozentpunkte zurückgegangen.
Ebenso sank ihr Anteil in
geringfügiger Beschäftigung von 12,0 % um 5,5 Prozentpunkte. Der
Anteil atypisch Beschäftigter Frauen insgesamt ging zwischen 2010
und 2024 von 34,2 % sogar um 9,2 Prozentpunkte zurück. Demgegenüber
gab es bei den Männern wenig Veränderungen. Ihr Anteil atypisch
Beschäftigter sank im selben Zeitraum von 12,7 % nur um 2,5
Prozentpunkte.
Drei von vier Kernerwerbstätigen in einem
Normalarbeitsverhältnis Knapp drei von vier (74,8 %)
Kernerwerbstätigen waren 2024 in einem Normalarbeitsverhältnis
beschäftigt. Im Jahr 2010 war der Anteil mit 65,8 % noch deutlich
geringer.
Der Anstieg ist unter anderem auf die
Teilzeitbeschäftigung mit mehr als 20 Wochenstunden zurückzuführen,
deren Anteil zwischen 2010 und 2024 von 7,3 % auf 14,1 % gestiegen
ist. Entsprechend dem höheren Frauenanteil in atypischer
Beschäftigung lag ihr Anteil an Normalbeschäftigten 2024 bei 69,1 %,
während Männer in 79,8 % der Fälle normalbeschäftigt waren.
Auch im Rahmen von Normalarbeit waren Frauen häufiger als Männer in
substanzieller Teilzeit mit mehr als 20 Wochenarbeitsstunden. Das
traf 2024 auf immerhin jede vierte kernerwerbstätige Frau (25,1 %)
zu, während es nur 4,2 % der Männer waren.
Gegenüber dem
Rückgang bei Teilzeit in atypischer Beschäftigung der Frauen hat ihr
Anteil in der substanziellen Teilzeit deutlich zugelegt. Er stieg
seit 2010 von 14 % um gut 11 Prozentpunkte. Der Anteil der
Selbstständigen unter den Kernerwerbstätigen lag 2024 bei 7,9 %. Ihr
Anteil ist seit 2010 langsam und kontinuierlich von 11,1 % um gut 3
Prozentpunkte gesunken.
Die strukturelle Verschiebung am
deutschen Arbeitsmarkt zeigt sich mit Blick auf die absoluten Zahlen
noch deutlicher. Während zwischen 2010 und 2024 fast 4,8 Millionen
Normalbeschäftigte hinzugekommen sind, ging die Zahl der atypisch
Beschäftigten um rund 1,5 Millionen zurück.
291 955 Einbürgerungen im Jahr 2024
•
Zahl der Einbürgerungen steigt um 46 % zum Vorjahr auf neuen
Höchststand
• Syrien bleibt mit 28 % das häufigste Herkunftsland
von Eingebürgerten
• Besonders hohe Anstiege bei Einbürgerungen
russischer und türkischer Staatsangehöriger
Im Jahr 2024
haben 291 955 Ausländerinnen und Ausländer die deutsche
Staatsbürgerschaft erworben. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) mitteilt, stieg die Zahl der Einbürgerungen somit
gegenüber dem Vorjahr um 91 860 oder fast die Hälfte (+46 %) auf
einen neuen Höchststand: Nie zuvor seit der Einführung der Statistik
im Jahr 2000 gab es mehr Einbürgerungen.
Am häufigsten
wurden im Jahr 2024 Syrerinnen und Syrer eingebürgert. Mehr als jede
vierte eingebürgerte Person (83 150 oder 28 %) war im Besitz der
syrischen Staatsangehörigkeit. Danach folgten mit großem Abstand
Personen mit türkischer (22 525 oder 8 %), irakischer (13 545 oder 5
%), russischer (12 980 oder 4 %) und afghanischer (10 085 oder 3 %)
Staatsangehörigkeit.
Unter den fünf am
häufigsten vertretenen Staatsangehörigkeiten stieg die Zahl der
Einbürgerungen von Russinnen und Russen prozentual am stärksten:
Während im Jahr 2023 nur etwa 1 995 Personen mit russischer
Staatsangehörigkeit eingebürgert wurden, waren es 2024 mit 12 980
Personen mehr als sechsmal so viele (+551 %).
Die Zahl der
Einbürgerungen türkischer Staatsangehöriger hat sich im
Vorjahresvergleich mehr als verdoppelt (+11 790 oder +110 %) und
stieg damit absolut gesehen noch stärker als die Zahl der
Einbürgerungen von Russinnen und Russen.
Die Zahl der
Einbürgerungen syrischer Staatsangehöriger stieg gegenüber dem
Vorjahr um 7 665 oder 10 %. Bei der Interpretation der Ergebnisse
sind rechtliche Änderungen an den Einbürgerungsvoraussetzungen zu
berücksichtigen, die mit dem Gesetz zur Modernisierung des
Staatsangehörigkeitsrechts (StARModG) am 27. Juni 2024 in Kraft
getretenen sind.
So ist nach neuer Rechtslage eine
Einbürgerung bereits nach einer Aufenthaltsdauer von fünf statt
bisher acht Jahren (§ 10 Abs. 1 StAG) möglich. Bei besonderen
Integrationsleistungen wie zum Beispiel guten schulischen oder
beruflichen Leistungen kann die Mindestaufenthaltsdauer auf bis zu
drei Jahre statt wie bisher sechs oder sieben Jahre verkürzt werden
(§ 10 Abs. 3 StAG). Zudem ermöglicht das Gesetz generell den
Beibehalt der bisherigen Staatsangehörigkeit.
7 % aller
Einbürgerungen 2024 nach Nachweis besonderer Integrationsleistungen
Im Jahr 2024 waren Einbürgerungen nach § 10 Abs. 1 StAG zusammen
mit den Miteinbürgerungen von Ehegatten und Kindern (§ 10 Abs.
2 StAG) mit einem Anteil von 86 % aller Einbürgerungen mit Abstand
die häufigsten Einbürgerungsformen.
Etwa 7 % der
Einbürgerungen erfolgten nach einer verkürzten Aufenthaltsdauer
durch besondere Integrationsleistungen (§ 10 Abs. 3 StAG). Im Jahr
2023, als noch durchgängig längere Mindestaufenthaltsdauern für den
Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit vorausgesetzt wurden,
hatten 67 % der Eingebürgerten die deutsche Staatsangehörigkeit
nach § 10 Abs. 1 StAG oder als Miteinbürgerung nach § 10 Abs. 2 StAG
erhalten.
Demgegenüber erhielten 22 % der Eingebürgerten die
deutsche Staatsangehörigkeit aufgrund des Nachweises besonderer
Integrationsleistungen nach § 10 Abs. 3 StAG.
Unterschiedliche Aufenthaltsdauer bis zur Einbürgerung je nach
Staatsangehörigkeit
Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in
Deutschland zum Zeitpunkt der Einbürgerung lag im Jahr 2024 bei
11,8 Jahren und somit leicht über dem Vorjahreswert von 10,9 Jahren.
Bei syrischen Staatsangehörigen betrug die durchschnittliche
Aufenthaltsdauer 7,4 Jahre (2023: 6,8 Jahre).
Damit setzte
sich die Beobachtung aus den Vorjahren fort, dass Syrerinnen und
Syrer, die während der Fluchtmigration in den Jahren 2015 und 2016
nach Deutschland kamen, häufig eine Einbürgerung beantragen, sobald
sie die Voraussetzungen erfüllen. Türkische Staatsangehörige hielten
sich hingegen zum Zeitpunkt der Einbürgerung im Durchschnitt bereits
23,1 Jahre in Deutschland auf (2023: 23,3 Jahre).
Die
durchschnittliche Aufenthaltsdauer russischer Staatsangehöriger lag
bei 14,5 Jahren (2023: 14,4 Jahre). Zusammen mit dem vergleichsweise
geringen Anteil an Einbürgerungen, die im Jahr 2023 unter Beibehalt
der bisherigen Staatsangehörigkeit erfolgt sind (23 %), lässt dies
vermuten, dass weniger die für eine Einbürgerung erforderliche
verkürzte Aufenthaltsdauer, sondern eher die Neuregelung zum
Beibehalt der bisherigen Staatsangehörigkeit zum deutlichen Anstieg
von Einbürgerungen russischer Staatsangehöriger im Jahr 2024
beigetragen hat.
Irakische und afghanische Staatsangehörige
hielten sich zum Zeitpunkt der Einbürgerung durchschnittlich 8,7
beziehungsweise 8,9 Jahre (2023: 8,8 bzw. 9,2 Jahre) in Deutschland
auf.
Höchste Einbürgerungsquote bei staatenlosen Personen
Die Einbürgerungsquote zeigt, welcher Anteil der in Deutschland
lebenden Menschen mit einer bestimmten Staatsangehörigkeit im
jeweiligen Jahr eingebürgert wurde. Von den fünf häufigsten
Staatsangehörigkeiten unter allen Einbürgerungen wiesen Syrerinnen
und Syrer 2024 die höchste Einbürgerungsquote auf: 9 % der zu
Jahresbeginn in Deutschland lebenden syrischen Staatsangehörigen
erwarben im Laufe des Jahres die deutsche Staatsangehörigkeit.
Auf einem niedrigeren Niveau lagen die Einbürgerungsquoten der
Irakerinnen und Iraker (6 %) und Russinnen und Russen (5 %). Obwohl
Personen mit türkischer Staatsangehörigkeit die zweitgrößte
eingebürgerte Gruppe darstellen, wiesen diese nur eine
Einbürgerungsquote von 2 % auf.
Die höchste
Einbürgerungsquote wies die Gruppe der staatenlosen Personen auf.
Über ein Fünftel (22 % oder 4 130) der zu Beginn des Jahres 2024 in
Deutschland lebenden staatenlosen Personen erwarben bis Jahresende
die deutsche Staatsangehörigkeit.