






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 24. Kalenderwoche:
14. Juni
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Montag, 16. Juni 2025
Huckingen: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft
Duisburg und der Polizei Duisburg: Mordkommission ermittelt nach
Leichenfund
Ein Zeuge wandte sich am Freitagabend (13.
Juni) an die Polizei, weil er seinen 42-jährigen Bekannten seit
mehreren Tagen nicht mehr erreichen konnte.
Einsatzkräfte
der Duisburger Polizei suchten daraufhin gegen 20:30 Uhr ein
Mehrfamilienhaus auf der Angerhauser Straße Ecke Mündelheimer Straße
auf, in dem der Mann wohnte. In einer Wohnung stießen die Polizisten
auf den verstorbenen 42-Jährigen Wohnungsinhaber. Der eingesetzte
Notarzt bescheinigte aufgrund von festgestellten Verletzungen, die
augenscheinlich auf eine körperliche Gewalteinwirkung zurückzuführen
sind, eine nichtnatürliche Todesart.
Die Staatsanwaltschaft
Duisburg wertet die Tat als Tötungsdelikt, woraufhin die Polizei
Duisburg eine Mordkommission eingerichtet hat. Das
Kriminalkommissariat 11 sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die
insbesondere ab dem Wochenende vom 6. Juni verdächtige Beobachtungen
rund um die Angerhauser Straße Ecke Mündelheimer Straße gemacht
haben. Wenn Sie auffällige Personen oder Fahrzeuge festgestellt
haben melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0203
2800.
Wenn die Temperaturen steigen: BBK-Verhaltensempfehlungen
bei Hitze Sommer, Sonne, Sonnenschein – die wärmsten
Monate im Jahr sind für die meisten Menschen ein Grund zur Freude.
Doch zu viel Hitze und Dürreperioden trüben nicht nur das positive
Lebensgefühl, sondern können auch stark gesundheitsgefährdend sein.
Das BBK gibt Ihnen Tipps, wie Sie sich schützen und für die
heißesten Tage vorsorgen können.
Mit Blick auf die anstehenden Sommermonate
in Deutschland gibt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe (kurz: BBK) Handlungsempfehlungen zur Vorsorge und
zum Verhalten bei Hitze. Besonders ältere Menschen, pflegebedürftige
Personen, chronisch Kranke sowie Kinder und Schwangere sind durch
hohe Temperaturen gefährdet.
Wann sprechen wir von Hitze?
Der Deutsche Wetterdienst (kurz: DWD) bezeichnet Wetterbedingungen,
„die durch hohe Temperaturen, unbehinderte Einstrahlung, schwachen
Wind und zum Teil durch feuchte Luft (Schwüle) gekennzeichnet sind“,
als extreme Hitze. Sie führen zu einem besonders starken
Wärmeempfinden der Menschen, das in der „Gefühlten Temperatur“
wiedergegeben wird.
Ab Gefühlten Temperaturen von 38 °C
spricht der DWD von extremer Wärmebelastung. Definition von
„Gefühlter Temperatur“
Definition „Gefühlte Temperatur“ des Deutschen
Wetterdiensteswww.dwd.de
Wenn an zwei aufeinander
folgenden Tagen eine mindestens „starke Wärmebelastung“
von 32 bis 38 °C Gefühlter Temperatur vorhergesagt wird und es
nachts nur zu einer unzureichenden Abkühlung kommt oder aber extreme
Belastungen von 38 °C oder mehr erwartet werden, gibt der DWD eine
Hitzewarnung heraus.
Die Hitzewarnungen erhalten Sie über
die Gesundheitswetter- und die Warnwetter-App des DWD oder im
Internet, dort können Sie auch den Hitzenewsletter abonnieren:
Hitzewarnungen des DWD und
Informationen zum Thema Hitzewww.hitzewarnungen.de

Achten Sie deshalb auf Ihre Mitmenschen und zögern Sie nicht
gegebenenfalls den Notruf zu wählen. Grundregeln bei Hitze Das
Wichtigste vorweg: ausreichend trinken! Mineralwasser, Saftschorlen
und Kräuter- oder Früchtetees sind am besten dafür geeignet, dem
eigenen Körper genug Flüssigkeit zuzuführen. Trinken Sie mindestens
1,5 bis 2 Liter am Tag (am besten kühl oder lauwarm) und meiden Sie
koffein- oder alkoholhaltige Getränke.
Außerdem: Falls Sie
regelmäßig Medikamente einnehmen müssen, besprechen Sie frühzeitig
mit Ihrem Arzt, ob eine Anpassung der Dosierung bei Hitze sinnvoll
ist. Unterwegs bei Hitze Wenn Sie bereits im Vorhinein einen Vorrat
an Lebensmitteln und Getränken angelegt haben, können Sie sich an
extrem heißen Tagen zusätzlich schützen, indem Sie darauf zugreifen
und den Gang zum Supermarkt nicht auf sich nehmen.
Legen Sie
körperliche Betätigungen möglichst in die kühleren frühen oder
späten Tagesstunden. Denken Sie daran, sich mit einem
Sonnenschutzmittel mit ausreichendem Lichtschutzfaktor einzucremen.
Tragen Sie im Freien eine Kopfbedeckung und möglichst helle, luftige
Kleidung. Meiden Sie die pralle Sonne und halten Sie sich bevorzugt
im Schatten auf. Lassen Sie in keinem Fall Menschen oder Tiere
alleine im Auto zurück – auch nicht kurzzeitig. Es besteht
Lebensgefahr!
Zuhause mit Hitze umgehen
Lüften Sie Ihre
Räume bevorzugt zu den kühleren Tageszeiten, wie zum Beispiel am
frühen Morgen. Halten Sie geschlossene Fenster abgedunkelt Und was
Sie vorsorglich tun können: Schaffen Sie sich Schattenplätze, etwa
durch Sonnenschirme oder Sonnensegel. Vermeidung von Waldbränden
Anhaltende Trockenperioden und durchgängig hohe Temperaturen
steigern ebenfalls das Waldbrandrisiko.
Der Deutsche
Feuerwehrverband (kurz: DFV) gibt folgende Verhaltensempfehlungen:
Werfen Sie keine Zigaretten oder andere brennende Gegenstände in die
Natur und erst recht nicht aus dem Fahrzeug. Lassen Sie niemals
Fahrzeuge mit heißen Abgasanlagen auf trockenen Feldern oder Wiesen
stehen, daran kann sich die Vegetation entzünden.
Respektieren Sie ausgeschilderte Verbote und Grillen Sie in der
Natur nur auf dafür ausgewiesenen Plätzen. Bei Bränden oder
Rauchentwicklung: Rufen Sie sofort den Notruf 112. Verhindern Sie
Entstehungsbrände durch eigene Löschversuche – aber nur wenn Sie
sich selbst dabei nicht gefährden. Gefahren beim Baden Badestellen
und Gewässer laden im Sommer zwar vielerorts zur Abkühlung ein, aber
besonders beim Baden außerhalb von Schwimmbädern drohen Gefahren.
Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise der Deutschen
Lebens-Rettungs-Gesellschaft (kurz: DLRG): Gehen Sie bei Gewittern
nicht schwimmen und springen Sie nicht überhitzt ins Wasser. Denn
ein Sprung ins kalte Wasser kann zu Problemen mit dem Kreislauf
führen. Gehen Sie nur an bewachten Badestellen schwimmen und
beachten Sie die örtlichen Warnhinweise.
Eltern sollten
kleine Kinder am und im Wasser nie aus den Augen lassen. Wasser ist
ein kostbares Gut Insbesondere bei ausbleibenden Niederschlägen
können auch Sie Wasser sparen. Ihre Pflanzen sollten Sie dann nicht
mit Leitungswasser gießen. Verwenden Sie zum eigenen Abkühlen kalte
Fußbäder oder kühlende Körperlotionen und duschen Sie lauwarm. Auch
die Handgelenke und Unterarme unter kaltes Wasser zu halten kann
lindernd wirken.
Informationsmaterialien und Handlungshilfen
Das BBK stellt umfangreiche Materialien zur Verfügung, um
Kommunen, Einrichtungen und Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen.
Dazu gehören Leitfäden zur Risikoanalyse und Vorsorge bei
Hitzewellen, spezifische Handlungsempfehlungen für
Pflegeeinrichtungen sowie praxisorientierte Checklisten und
Arbeitshilfen für die kommunale Ebene. Sie finden diese Materialien
auf der BBK-Website und unter
www.bbk.bund.de/hitze.
26. Juni: Hochschultag an der UDE - Von A wie Anmeldung bis
Z wie Zukunftsplanung
Geschafft – endlich ist das
Abitur in der Tasche! Und wie geht's jetzt weiter? Kurz vor dem
Bewerbungsschluss für zulassungsbeschränkte Studiengänge lädt die
Universität Duisburg-Essen zum Hochschultag am 26. Juni ein. Auf dem
Programm für Studieninteressierte stehen Infos zu Stipendien,
Bewerbungsverfahren, Studiengängen und vieles mehr.
Wie
sieht ein Hörsaal von innen aus? Was lerne ich dort eigentlich? Und
braucht man einen Einser-Schnitt fürs Stipendium? Auf diese und
viele weitere Fragen gibt es vor Ort die passenden Antworten beim
ersten uniweiten Hochschultag an der Universität Duisburg-Essen am
26. Juni. Neben diversen Info-Ständen und Vorträgen, werden auch
Campus- und Laborführungen sowie Schnuppervorlesungen angeboten.
Das Besondere: Zeitgleich findet das jährliche Sommerfest der
Uni am Campus in Duisburg statt – mit Musik, Foodtrucks und
Festivalstimmung.
Das Programm:
•
8-13 Uhr Veranstaltungen der Studiengänge (Infoveranstaltungen,
Laborführungen, Campus-Touren, Schnuppervorlesungen)
•
13 Uhr: Beginn Sommerfest auf dem Campus in Duisburg
•
16-18 Uhr: UDE Stipendientag im Foyer LA und Hörsaal LX in
Duisburg
•
16-19.30 Uhr: Langer Abend der Studienberatung mit Beratung im
Foyer LA und Vorträgen (Bewerbung, Einschreibung, Lehramt) und
Studies erzählen aus ihrem Alltag in Hörsaal LX Das gesamte Programm
gibt es unter:
www.uni-due.de/abz/studieninteressierte/hochschultag.
Anmeldungen sind teilweise erforderlich. Weitere Informationen Silke
Gramsch, Akademisches Beratungs-Zentrum, 0203/379-2404,
silke.gramsch@uni-due.de
Ein lautes Zeichen gegen Diskriminierung: 20 Jahre
„Rage Against Racism“-Festival
Die Stimme gegen
Rassismus zu erheben, kann nicht laut genug sein – das beweist das
weit über die Duisburger Stadtgrenzen hinaus bekannte Festival „Rage
Against Racism“ seit nunmehr 20 Jahren. Am Freitag und Samstag, 20.
und 21. Juni, feiert das beliebte Metal-Festival sein Jubiläum – wie
immer bei kostenlosem Eintritt und unter freiem Himmel.
Vor
der eindrucksvollen Kulisse der historischen Friemersheimer Mühle an
der Clarenbachstraße in Duisburg treten 14 nationale und
internationale Bands auf – darunter etablierte Acts aber auch
vielversprechende Newcomer. Gemeinsam setzen sie ein kraftvolles
musikalisches Zeichen gegen Diskriminierung und
Fremdenfeindlichkeit. Zu den Headliner zählen unter anderem „The
Unguided“ aus Schweden sowie „Dymytry“ aus Tschechien.
„Das
Festival dient nicht nur der Unterhaltung, sondern auch als
Plattform für soziales Engagement und Aufklärungsarbeit. Wir möchten
junge Menschen ermutigen, sich gegen Extremismus und Diskriminierung
zu positionieren“, betont Jan Wirtgen, Vorsitzender des
veranstaltenden Vereins „Inne Mühle e.V.“
Seit zwei
Jahrzehnten wird das Festival von vielen ehrenamtlich helfenden
Hände getragen. Es steht für gelebte Vielfalt, Solidarität und den
friedlichen Protest gegen Ausgrenzung, Hass und Intoleranz. Von
Beginn an versteht sich „Rage against Racism“ als Motor für
gesellschaftliche Teilhabe und Offenheit.
„Wir wollen jedem
die Möglichkeit geben, dabei zu sein und ein Teil dieser Bewegung zu
sein. Deshalb bleibt der Eintritt trotz steigender Kosten und
knapper Kassen frei. Wir ermutigen jeden dazu, das zu geben, was er
kann oder bereit ist zu geben“, erklärt Wirtgen und meint damit das
2024 erstmals eingeführte Pay-what-you-want-Modell.
Die Idee
dazu stammt von der ISTHochschule für Management in Düsseldorf, die
das Festival seit drei Jahren wissenschaftlich begleitet.
Organisiert wird die Veranstaltung vom Verein „Inne Mühle e. V.“,
der Leitung des städtischen Kinder- und Jugendzentrums „Die Mühle“
und in enger Abstimmung mit dem Jugendamt der Stadt Duisburg.
Hauptsponsor ist die Sparkasse Duisburg. Auch das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gehört zu den
Unterstützern. Weitere Informationen zum Festival gibt es online
unter
www.rageagainstracism.de
Regenwälder am Amazonas
und was wir damit zu tun haben
Vortragsabend im Rahmen der
Duisburger Umweltwoche
Der Weltladen Duisburg lädt im
Rahmen der Duisburger Umweltwochen zu einem Vortrag in die
Karmel-Begegnungsstätte, Karmelplatz 1–3 ein. Am Donnerstag, 26.
Juni 2025 berichtet dort um 19 Uhr Dr. Rainer Putz vom Regenwald
Institut Freiburg über die aktuelle Situation im brasilianischen
Regenwald und zeigt, wie unser Konsumverhalten dessen Zukunft
mitbestimmt.
Ein Beispiel für nachhaltigen Regenwaldschutz
gibt es direkt am Vortragsabend: Es werden vegane
Körperpflegeprodukte vorgestellt, die in fairer Zusammenarbeit mit
traditionellen Gruppen im Amazonasgebiet hergestellt werden. Der
Eintritt frei – alle Interessierten sind herzlich willkommen!
Der Duisburger Weltladen ist ein Fachgeschäft des fairen Handels
und wird als Verein seit über 40 Jahren durch ausschließlich
ehrenamtliche Mitarbeitende geführt und wirtschaftlich erfolgreich
betrieben. Mehr Infos zum Weltladen gibt es unter
www.weltladen-duisburg.de oder unter Tel.: 0203 / 358692 oder per
Mail:
weltladenduisburg@t-online.de.

Bild vom Amazonas-Regenwald - Foto: https://regenwald-institut.de/
Wirtschaftlicher, sozialer und ökologische
Nachhaltigkeit: Nur wenige Ziele erreicht – Investitionen können
Wende bringen
Die Krisen der vergangenen Jahre haben
dem Wohlstand und der Nachhaltigkeit in Deutschland geschadet. Das
ergibt eine neue Studie, die das Institut für Makroökonomie und
Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung gefördert hat.*
Ein Lichtblick sind die Investitionspläne der Bundesregierung.
Corona, Ukrainekrieg, Inflation, Populismus: Die Serie der Krisen im
laufenden Jahrzehnt hat der deutschen Wirtschaftspolitik die Bilanz
verhagelt.
Das geht aus der Analyse von Prof. Dr. Fabian
Lindner von der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Technik und
Prof. Dr. Anita Tiefensee von der Hochschule des Bundes in Berlin
hervor. Für das IMK haben sie anhand von 15 zentralen Indikatoren
den Stand der ökonomischen, finanzpolitischen, sozialen und
ökologischen Nachhaltigkeit dokumentiert.
Ihrer Auswertung
zufolge konnten in den Jahren 2020 bis 2024 „nur die wenigsten
Nachhaltigkeitsziele“ erreicht werden. Immerhin sei es aber
gelungen, durch staatliche Anti-Krisenpolitik schlimmere
Auswirkungen für Wirtschaft und Gesellschaft zu verhindern.
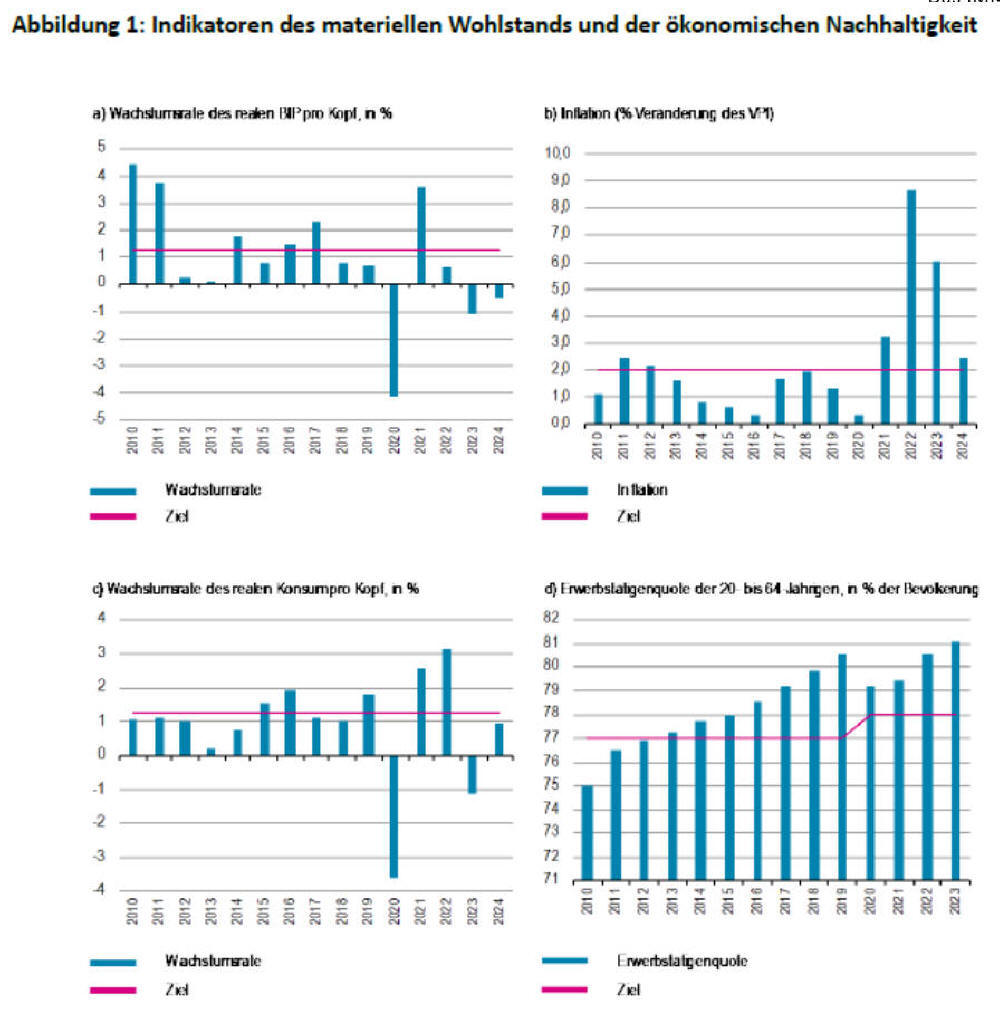
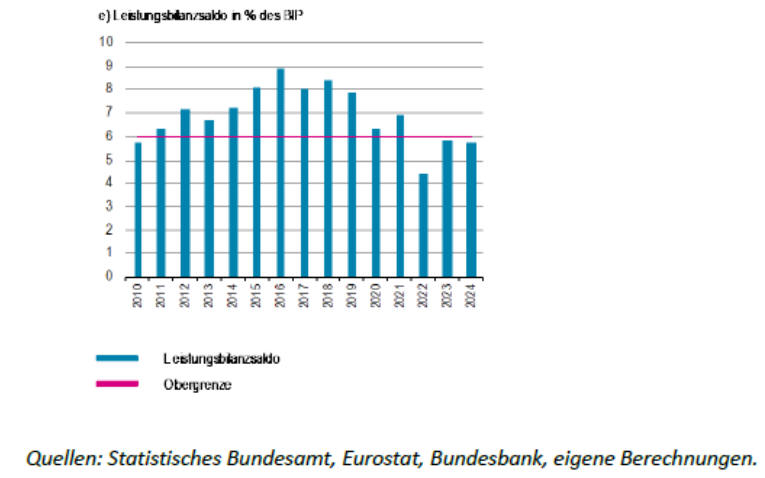
Damit Deutschland in Sachen Nachhaltigkeit wieder Tritt fasst,
seien künftig massive öffentliche Investitionen nötig. Angesichts
der jüngsten Reform der Schuldenbremse und des Infrastrukturfonds
der Bundesregierung sei hier Besserung in Sicht. „Die
Grundgesetzänderung bei den Schuldenregeln ist eine riesige Chance
für Deutschland, den Trend bei Nachhaltigkeit und Wohlstand zu
drehen“, sagt auch der Wissenschaftliche Direktor des IMK, Prof. Dr.
Sebastian Dullien.
„Um den materiellen Wohlstand und die
ökonomische Stabilität ist es nach der Corona- und Inflationskrise
insgesamt nicht gut bestellt“, schreiben Lindner und Tiefensee. Das
Bruttoinlandsprodukt (BIP) war laut ihren Berechnungen 2024 nur 0,3
Prozent höher als 2019, pro Kopf sogar 1,6 Prozent niedriger, weil
seitdem die Bevölkerung um 1,6 Millionen Personen zugenommen hat.
Verantwortlich für die schwache Entwicklung seien neben den
Energiepreissteigerungen unter anderem höhere Zinsen, die
restriktive Finanzpolitik nach dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichts im Herbst 2023 sowie nachlassende Exporte
nach China gewesen.
Die Inflation ist im Vergleich zu den
Vorjahren 2024 zwar wieder gesunken, lag mit 2,5 Prozent aber immer
noch über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank von zwei
Prozent. Das hat auch den privaten Konsum belastet, der im
vergangenen Jahr pro Kopf 1,3 Prozent geringer ausfiel als 2019.
Lediglich die Beschäftigung hat sich „sehr positiv“ entwickelt: Das
Ziel der Bundesregierung wurde übererfüllt, die Beschäftigungsquote
übertraf 2024 mit 81,1 Prozent sogar das Vorkrisenniveau – auch dank
des großzügigen Einsatzes von Kurzarbeit in Krisenzeiten.
Die Leistungsbilanz hat sich zwar zielkonform entwickelt, der
Überschuss war mit 5,8 Prozent des BIP zuletzt aber nur knapp unter
seinem zulässigen Höchstwert. Der hohe Überschuss ist nicht zuletzt
Donald Trump ein Dorn im Auge, der Europa deswegen mit noch höheren
Zöllen droht. Auch bei den Staatsfinanzen haben die Krisen Spuren
hinterlassen: Das strukturelle staatliche Defizit lag 2024 mit 1,4
Prozent über der Grenze des EU-Fiskalpakts von 0,5 Prozent, der
Schuldenstand war mit 63 Prozent des BIP ebenfalls etwas zu hoch.
Beide Werte haben sich laut Lindner und Tiefensee allerdings
im Vergleich zu den Vorjahren – auch infolge der Inflation –
verbessert, zudem stehe Deutschland besser da als die meisten
EU-Länder, die im Schnitt auf eine Schuldenquote von 81,6 Prozent
kommen.
Die Schuldentragfähigkeit sei nicht gefährdet. Für
viel bedenklicher halten die Forschenden die klägliche
Investitionsquote: Netto investierte der Staat 2024 nur 0,1 Prozent
der Wirtschaftsleistung. Die Mittel, die nötig sind, um den
Investitionsstau aufzulösen, seien ohne zusätzliche Schulden nicht
aufzubringen. Insofern sei das Sondervermögen für Infrastruktur
unbedingt zu begrüßen. Im Hinblick auf soziale Nachhaltigkeit seien
ebenfalls alle Zielwerte verfehlt worden, heißt es in der Studie.
Der Anteil der Armutsgefährdeten an der Bevölkerung
lag 2023 – dem letzten Jahr, für das Daten verfügbar sind –
bei 16,6 Prozent, gut drei Prozentpunkte über dem anvisierten
Zielwert. Dass die Quote seit 2021 immerhin minimal gesunken ist,
erklären Lindner und Tiefensee unter anderem mit dem höheren
Mindestlohn. Die Einkommensungleichheit hat ihrer Analyse zufolge
2023 zum zweiten Mal in Folge zugenommen: Das Einkommen des oberen
Fünftels der Haushalte war 4,6-mal so hoch wie das des unteren
Fünftels.
TÜV Cybersecurity Studie: IT-Sicherheitsvorfälle in 15
Prozent der Unternehmen – plus 4 Punkte zu 2023.
Phishing die dominierende Angriffsmethode. Neun von zehn Unternehmen
bewerten eigene Cybersicherheit als gut. TÜV-Verband: Überfällige
nationale Umsetzung der NIS2-Richtlinie zügig verabschieden. Die
Hälfte der Unternehmen kennt die Regulierung bisher nicht.
Illustration: 15 Prozent der deutschen Unternehmen verzeichneten
2024 einen Cyberangriff. Quelle: TÜV Cybersecurity Studie 2025.
Die Cybersicherheitslage in der deutschen Wirtschaft verschärft
sich: 15 Prozent der Unternehmen verzeichneten in den vergangenen 12
Monaten nach eigenen Angaben einen IT-Sicherheitsvorfall. Dabei
handelt es sich um erfolgreiche Cyberangriffe, auf die die
Unternehmen aktiv reagieren mussten.
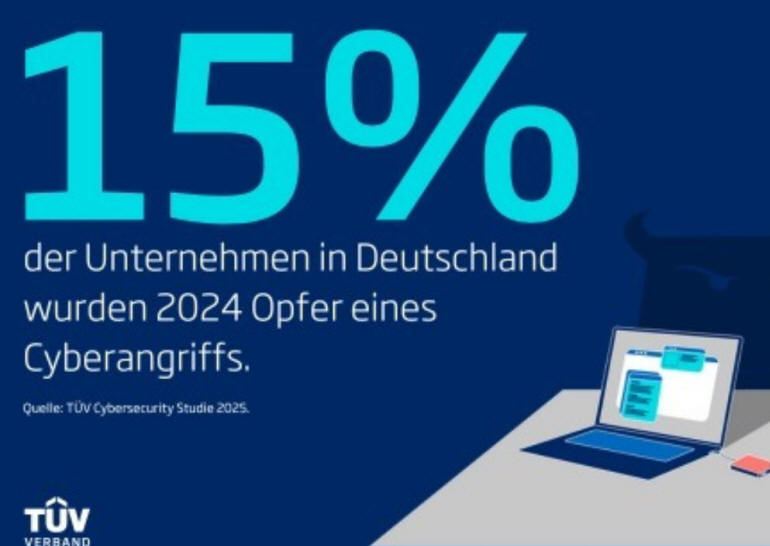
Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Ipsos-Umfrage im
Auftrag des TÜV-Verbands unter 506 Unternehmen ab 10 Mitarbeitenden.
Im Vergleich zur Studie vor zwei Jahren ist der Anteil erfolgreich
gehackter Unternehmen um 4 Prozentpunkte gestiegen. „Die deutsche
Wirtschaft steht im Fadenkreuz staatlicher und krimineller Hacker,
die sensible Daten erbeuten, Geld erpressen oder wichtige
Versorgungsstrukturen sabotieren wollen“, sagte Dr. Michael Fübi,
Präsident des TÜV-Verbands, bei Vorstellung der „TÜV Cybersecurity
Studie 2025“ in Berlin.
„Bei ihren Cyberattacken setzen die
Angreifer verstärkt auf moderne Technologien wie Künstliche
Intelligenz.“ Allerdings scheinen viele Unternehmen die Risiken zu
unterschätzen. Neun von zehn Unternehmen (91 Prozent) bewerten ihre
Cybersicherheit als gut oder sehr gut. Und jedes vierte Unternehmen
(27 Prozent) gibt an, dass IT-Sicherheit für sie nur eine kleine
oder gar keine Rolle spielt. Fübi: „Unternehmen sollten
Cybersicherheit ernst nehmen und dafür die notwendigen Ressourcen
bereitstellen.“
Dennoch spricht sich eine Mehrheit für
gesetzliche Vorgaben aus: 56 Prozent sind der Meinung, dass alle
Unternehmen verpflichtet sein sollten, angemessene Maßnahmen für
ihre Cybersecurity zu ergreifen. „Die Bundesregierung sollte die
überfällige nationale Umsetzung der NIS2-Richtlinie zügig
verabschieden“, sagte Fübi. „Die Regelung sieht gesetzliche
Mindestanforderungen für die Cybersicherheit von rund 30.000
Unternehmen sicherheitskritischer Branchen vor.“ Kritisch sei, dass
laut Umfrage bisher nur die Hälfte der Unternehmen die
NIS2-Richtlinie kennen.
BSI-Präsidentin Claudia Plattner:
„Die Studie des TÜV-Verbandes zeigt, dass auf dem Weg zur
Cybernation Deutschland noch eine Menge Arbeit vor uns liegt. Was
mich besonders besorgt, ist die geringe Bekanntheit der
NIS-2-Richtlinie. Umso wichtiger ist ihre zügige Umsetzung in
nationales Recht. Verständlicherweise weisen Unternehmen darauf hin,
dass regulatorische Vorgaben herausfordernd sind: auch, weil sie zu
Bürokratie und damit zu Mehraufwand führen können.
Richtig
umgesetzt können sie uns aber dabei helfen, die Resilienz unserer
Wirtschaft umfassend zu erhöhen. Wir als BSI legen dabei unseren
Schwerpunkt auf Hilfestellung und Kooperation – und unterstützen
Unternehmen auch heute schon mit umfangreichen Informations- und
Beratungsangeboten. Unser Credo lautet ‚Cybersicherheit vor
Bürokratie‘. Das betrifft übrigens auch den Cyber Resilience Act
(CRA), im Rahmen dessen das BSI die Übernahme der Marktüberwachung
anstrebt.“
Phishing die mit Abstand häufigste Angriffsmethode
Laut den Ergebnissen der Umfrage ist die mit Abstand häufigste
Angriffsmethode derzeit Phishing: In der Regel handelt es sich dabei
um E-Mails, die zu einer Schadsoftware führen. 84 Prozent der
betroffenen Unternehmen berichten von Phishing-Angriffen – 12
Prozentpunkte mehr als vor zwei Jahren. Ein Grund für den Anstieg
ist der Einsatz Künstlicher Intelligenz. „Mit Hilfe der gängigen
KI-Systeme können Phishing-Mails personalisiert, Texte perfekt
formuliert oder auch Sprachnachrichten gefälscht werden“, sagte
Fübi. An zweiter Stelle stehen „sonstige Schadsoftware-Angriffe“ (26
Prozent). Dabei handelt es sich um so genannte Malware, die zum
Beispiel dazu dient, sensible Daten abzugreifen.
Wie die
Schadsoftware in das IT-System eines Unternehmens gelangt, lässt
sich nicht immer nachvollziehen. Ransomware-Angriffe (12 Prozent)
und andere Methoden wie Passwort-Angriffe (12 Prozent) sind
rückläufig. Bei Ransomware-Attacken werden sensible Daten
verschlüsselt oder gestohlen. Dann wird das Management erpresst.
„Ransomware-Angriffe bleiben ein großes Problem für die Wirtschaft“,
sagte Fübi. „Aber viele Unternehmen haben sich besser auf Ransomware
eingestellt, vor allem, wenn es um die Sicherung ihrer Daten geht.“
Eine wichtige Rolle spielt Künstliche Intelligenz sowohl bei
Angriffen als auch bei ihrer Abwehr. Jeder zweite
IT-Sicherheitsverantwortliche beobachtet Cyberangriffe im
Unternehmen, die mit Hilfe von KI erfolgt sind (51 Prozent). In
großen Unternehmen ab 250 Mitarbeitenden liegt der Wert bei 81
Prozent. Nach Ansicht von 82 Prozent der Befragten ermöglicht es KI
den Angreifern, gezielt Schwachstellen in den IT-Systemen ihres
Unternehmens auszunutzen. Und 89 Prozent stimmen der Aussage zu,
dass KI dazu beiträgt, Angriffe effizienter und zielgerichteter
durchzuführen.
Auf der anderen Seite nutzen erst 10 Prozent
der Unternehmen KI für die Abwehr von Cyberangriffen, weitere 10
Prozent planen den Einsatz – vor allem, um Bedrohungen besser zu
erkennen (70 Prozent), Anomalien in Datenbeständen und Datenströmen
zu identifizieren (59 Prozent), Schwachstellen zu analysieren (58
Prozent) oder automatisiert auf Angriffe zu reagieren (51 Prozent).
Mit diesen Maßnahmen schützen sich Unternehmen
Die
Unternehmen haben in der vergangenen 24 Monaten zahlreiche Maßnahmen
ergriffen, um sich besser vor Cyberangriffen zu schützen. Hierzu
zählen Investitionen in sichere Hardware (65 Prozent), Einführung
neuer Cybersecurity-Software (48 Prozent), Beratung durch externe
Expert:innen (59 Prozent) oder Schulungen der Mitarbeitenden (53
Prozent).
„Sehr wichtig sind Notfallübungen, um Abläufe für
den Ernstfall einzuüben, und Pentests, mit denen technische
Schwachstellen im eigenen Unternehmen ausfindig gemacht werden
können“, sagte Fübi. Jeweils 22 Prozent der befragten Unternehmen
haben Notfallübungen oder Pentests durchgeführt. 27 Prozent der
Unternehmen haben ihr Budget für die IT-Sicherheit erhöht. Zum
Vergleich: Vor zwei Jahren waren es noch 52 Prozent. Fübi: „Die
Ausgaben für Cybersicherheit müssen mit den steigenden Anforderungen
Schritt halten.“
Ein wichtiges Instrument sind Normen und
Standards. Sie geben vor, was Unternehmen technisch und
organisatorisch tun müssen, um ihre Cybersicherheit zu verbessern.
Für 70 Prozent der Befragten sind Normen und Standards wichtig oder
sehr wichtig, um den Schutz vor Cyberangriffen stetig zu verbessern.
In der Umfrage geben 22 Prozent an, bestimmte Normen und Standards
für die IT-Sicherheit vollständig zu erfüllen. Weitere 53 Prozent
orientieren sich zumindest daran, setzen diese aber nur teilweise
um. „Normen und Standards helfen Unternehmen dabei, die
Cybersicherheit auf ein höheres Level zu bringen und diese fest in
einer Organisation zu verankern“, betonte Fübi.
Handlungsbedarf bei Politik und Wirtschaft
Aus Sicht des
TÜV-Verbands besteht angesichts der technischen und geopolitischen
Entwicklungen die Notwendigkeit, das Sicherheitsniveau in der
Wirtschaft auch mit Hilfe gesetzlicher Vorgaben zu erhöhen. Diese
Ansicht teilt die Mehrheit der befragten
Sicherheitsverantwortlichen: 55 Prozent sagen, dass strengere
gesetzliche Vorgaben für die Cybersecurity von Unternehmen das
Internet sicherer machen. Die europäische Network and Information
Security Directive (NIS2-Richtlinie) legt Mindestanforderungen für
Unternehmen in 18 sicherheitskritischen Branchen wie Energie,
Gesundheit, Transport oder digitalen Diensten fest. Allerdings hinkt
Deutschland bei der Umsetzung wegen des Regierungswechsels
hinterher.
„Die neue Bundesregierung muss jetzt handeln und
das nationale Umsetzungsgesetz zügig verabschieden“, sagte Fübi.
„Fatal ist, dass bisher nur die Hälfte der Unternehmen die
NIS2-Richtlinie kennt. Hier ist noch viel Aufklärungsarbeit
notwendig.“ Die Unternehmen sollten sich frühzeitig mit der
anstehenden Regulierung auseinandersetzen. Darüber hinaus müsse auch
der Cyber Resilience Act (CRA) wie vorgesehen ab Ende 2027 umgesetzt
werden. Die EU-Verordnung sieht IT-Sicherheitsanforderungen für
Hardware- und Software-Produkte vor, die digitale Komponenten
enthalten und digital vernetzt sind.
Der vollständige
Studienbericht der „TÜV Cybersecurity Studie 2025“ und eine
Präsentation mit den Kernergebnissen ist abrufbar unter:
www.tuev-verband.de/studien/tuev-cybersecurity-studie-2025
Methodik-Hinweis: Grundlage der Studienergebnisse ist eine
repräsentative Umfrage des Marktforschungsunternehmens Ipsos im
Auftrag des TÜV-Verbands unter 506 Unternehmen ab 10 Mitarbeitenden
in Deutschland. Befragt wurden Verantwortliche für IT-Sicherheit,
darunter leitende Cybersecurity-Expert:innen, IT-Leiter und
Mitglieder der Geschäftsleitung.
Ohne Angst verschieden sein und zügig prüfen, was geht -
Wichtigste Ergebnisse der aktuellen Tagung des Duisburger
Kirchenparlamentes
In naher Zukunft noch weniger
Gemeindemitglieder und noch weniger Finanzmittel. Genau deshalb hat
die Duisburger Synode, das höchste Gremium des Evangelischen
Kirchenkreises, bei seiner Tagung am letzten Wochenende zahlreiche
Prüfaufträge erteilt, die ausloten, wie dem kreiskirchlichen Defizit
von 800.000 Euro begegnet werden soll.
Diese Summe wird
schon in fünf Jahren bei den gemeindeübergreifenden Aufgaben fehlen;
deshalb sollen die jetzt präsentierten Vorschläge bis zur
Herbstsynode geprüft, weiter ausgearbeitet und ggf. geeignete
Zeitpläne für die Umsetzung erstellt werden. Im November soll das
Kirchenparlament konkrete Entscheidungen treffen. Zu dem Paket an
Maßnahmen gehören mögliche Fusionsgespräche mit dem Dinslakener
Nachbarkirchenkreis, eine einheitliche Trägerschaft der Kitas im
Kirchenkreis, eine Reduktion der Gemeindepfarrstellen und der
Übergang des Bildungswerkes und der Beratungsstelle in diakonische
Trägerschaft.
Die Vorschläge hatte eine Arbeitsgruppe aus
Engagierten der elf Gemeinden sowie weiteren Mitgliedern erarbeitet.
Grundlage dafür waren die Ergebnisse eines umfangreichen
Beteiligungs- und Umfrageprozesses in Einrichtungen, Gemeinden und
Ausschüssen, der die Leitfrage verfolgte, wie dem kreiskirchlichen
Defizit begegnet werden soll. Der gesamte Prozess steht unter der
bezeichnenden Überschrift „Wirken mit Weniger“.
Die
Synodalen - die gewählten Vertreterinnen und Vertreter aus den
Gemeinden und berufene Mitglieder - verabschiedeten auf der Tagung
zudem eine Stellungnahme zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und zur
aktuellen Migrationsdebatte. Ihr Tenor: Entschieden gegen jede Form
von Ausgrenzung und - in Anlehnung an die Worte von Johannes Rau –
„ohne Angst verschieden sein“.
Die Stellungnahme bezieht
eine klare Position aus christlicher Perspektive: Die
gesellschaftliche Entwicklung hin zu wachsender Ungleichheit und
politischer Verhärtung werde mit Sorge beobachtet. So kritisiert die
Synode in der Stellungnahme, dass Migration oft als Sündenbock für
strukturelle Versäumnisse in Bildung, Wohnungsbau und Sozialpolitik
herhalten müsse. Gleichzeitig warnt sie vor der zunehmenden
Einflussnahme rechter, menschenfeindlicher Kräfte und der Aushöhlung
demokratischer Werte. Deshalb wollen sich die Gemeinden für
Vielfalt, Menschenrechte und Demokratie einsetzen.
Der
Wortlaut der Stellungnahme ist unter www.kirche-duisburg.de
nachzulesen. Stichwort Kreissynode: Die Kreissynode leitet den
Kirchenkreis. Sie ist vergleichbar mit dem Parlament auf politischer
Ebene. Die Kreissynode setzt sich zusammen aus Pfarrerinnen und
Pfarrer, gewählten Presbyterinnen und Presbyter, die von den
einzelnen Kirchengemeinden als Delegierte entsandt werden, sowie
berufenen Mitgliedern.
Laut Kirchenordnung der Evangelischen
Kirche im Rheinland dürfen Theologen in einer Kreissynode nicht in
der Mehrzahl sein. Die Kreissynode trifft sich in der Regel zweimal
im Jahr und tagt ein oder zwei Tage. Infos zum Evangelischen
Kirchenkreis Duisburg, den Gemeinden und Einrichtungen gibt es im
Netz unter www.kirche-duisburg.de.

Foto: Rolf Schotsch
Tagesausflug am 20. August ins Nikolauskloster Jüchen
und Gut Hombroich
Die
Evangelische Kirchengemeinde Alt-Duisburg lädt zum Tagesausflug am
20. August ins Nikolauskloster Jüchen und Gut Hombroich mit
Busfahrt, Andacht, Mittagsessen, Spazierengehen, Kaffeetrinken und
Zeit für Einkäufe im Hofladen auf Gut Hombroich.
Anmeldungen und Ticketverkauf solange Vorrat reicht (50 Euro inkl.
Fahrt, Mittagessen & Kaffee und Kuchen) sind im Duisserner
CaféNotkirche an der Martinstr. 35, dienstags und donnerstags von 9
bis 12 Uhr, nur noch bis zum bis 10. Juli möglich. Rückfragen vorab
beantwortet Pfarrer Stefan Korn (Tel.: 0203 330490). Infos zur
Gemeinde gibt es im Netz unter
www.ekadu.de.
André Boße - Voyage, Voyage -
Veranstaltung des Kreativquarter Ruhrort und der
Deutsch-Französischen Gesellschaft Duisburg e.V.
Wir
essen, trinken, rauchen Französisch. Wir bereisen das Land, für das
wir sogar einen Spitznamen erfunden haben, den in Frankreich selbst
niemand nutzt: den der ›Grande Nation‹.
Aber die Popmusik
Frankreichs kennen wir häufig nur am Rande. Kulturjournalist André
Boße unternimmt in seinem Buch ›Voyage, Voyage‹ eine Reise durch
Frankreich und die französische Popmusik – von den Hits der
Yéyé-Jahre über French Pop und Nouvelle Chanson bis hin zu Rock,
HipHop, Raï und Electro.
Das Buch gilt bereits jetzt als
Standardwerk für alle, die French Pop neu für sich entdecken oder
tiefer in die Materie eintauchen wollen. André Boße bringt das
Buch auf die Bühne – als Lese-, Erzähl-, Hör- und Live-Musik-Abend.
Die Live-Premieren in Münster und Köln waren jeweils ausverkauft. Es
folgten Shows in Buchhandlungen und auf der Reeperbahn.
Unterstützt wird André Boße dabei von der seit vielen Jahren in
Münster lebenden französischen Sängerin Alexandra Romary sowie der
Cellistin Judith Brormann. Zu dritt spielen sie im zweiten Teil des
Abends ausgewählte Stücke aus der Geschichte des French Pop. Mit
Liedern von Mylène Farmer, Françoise Hardy, Jane Birkin, Pomme,
Alain Souchon, Renauld und vielen mehr.

André Boße - Voyage, Voyage Mittwoch, 18. Juni 2025, 19:00 Uhr Das
PLUS am Neumarkt, Neumarkt 19, 47119 Duisburg-Ruhrort Eintritt
frei(willig) – Hutveranstaltung Foto © André Kleine-Wilke
Aktiver Tierschutz ist wichtiger denn je:
Ökumenischer Tiergottesdienst an der Marxloher Kreuzeskirche
Der Ökumenische Tiergottesdienst im Duisburger Norden
hat eine lange Tradition. Im letzten Jahr, zur 26. Ausgabe, kamen
über 200 Menschen, meist mit ihren Hunden und weiteren Haustieren,
zum Außengelände der Marxloher Kreuzeskirche an der
Kaiser-Friedrich-Straße 40. In diesem Jahr „steigt“ der
Tiergottesdienst am gleichen Ort an einem Samstag, eingebettet in
die Festwoche zum 120-jährigen Jubiläum der Kreuzeskirche.
So beginnt am Samstag, 21. Juni um 12 Uhr die „tierisch-einfühlsame
Erfolgsgeschichte“ mit einem fröhlichen Begrüßungslied des Chors
Vielklang. Dann gibt es von der evangelischen Pfarrerin Anja Humbert
und der katholischen Pastoralreferentin Schwester Mariotte
Hillebrand auch nachdenklich-motivierende Worte, die eine Zukunft
mahnen, die das Leben aller schützt, auch der Tiere. Und natürlich
wird wieder gemeinsam gesungen und gebetet.
Die
mitgebrachten Tiere werden am Schluss gesegnet. Mit von der Partie
sind auch das Kirchenmobil der katholischen Propsteigemeinde St.
Johann mit Kaffeespezialitäten und der Verein Cocker und Setter in
Not mit einem Verkaufsstand. Und es gibt noch etwas ganz Besonderes,
berichtet Anja Humbert. Erstmals findet ein
Hunde-Geschicklichkeits-Parcours statt, bei dem es auch einige
Preise zu gewinnen gibt.
Urkunden und Medaillen stehen
zudem für alle Gottesdienst-Teilnehmer zur Verfügung. Die Kollekte
des Gottesdienstes und die Erlöse aus der Bewirtung kommen auch in
diesem Jahr der Duisburger Tiertafel zugute. Bei schlechtem Wetter
findet der Tiergottesdienst in der Kreuzeskirche statt.
Im
Anschluss daran beginnt gegen 13.30 Uhr das Gemeindefest an der
Kreuzeskirche. Dort gibt es Unterhaltung, Spaß und leckeres Essen,
so dass der Tag zum richtigen Familientag wird. Für die kleinen
Besucher ist eine Vielzahl an kreativen Überraschungen vorbereitet.
Zum Konzept des Tiergottesdienstes Beim allerersten Tiergottesdienst
hatte wohl niemand damit gerechnet, dass er ein „Selbstläufer“
wird. „Aber“, so Anja Humbert und Mariotte Hillebrand, „aktiver
Tierschutz ist, wie viele negative Auswüchse zeigen, heute wichtiger
denn je.“
Dass es das Wort Tierschutz überhaupt geben
müsse, sei schon fast ein Skandal an sich. Hungernde, ausgebeutete
und misshandelte Tiere hätten nichts mit Gottes Schöpfung zu tun. So
soll der Tiergottesdienst auch stets Motivation sein, solchen
Auswüchsen aktiv und engagiert entgegenzuwirken. Es lohne sich
immer, Gottes Schöpfung zu bewahren.
Die Hunde waren bisher
stets in der Überzahl, aber auch Katzen, Vögel, Hamster, Kaninchen
und Meerschweinchen füllten frühere Gottesdienste teils lautstark
mit Leben. Vereinzelt waren auch schon mal Pferde, Ziegen und Esel
vertreten, und vor einigen Jahren sogar eine chinesische
Schildkröte. Text: Reiner Terhorst

Tiergottesdienst 2024 an der Marxloher Kreuzeskirche. Zu sehen sind
Jessica Wachtel und Schwester Mariotte Hillebrand von der
katholischen Kirche beim Segnen; im Hintergrund ist Pfarrerin Anja
Humbert zu sehen. Foto: Reiner Terhorst
Wiesengottesdienst am Turm der Duisserner
Lutherkirche – mit Gegrilltem und Slush-Eis danach
Das
breite Grün hinter dem Kirchturm der Lutherkirche, Martinstr. 35,
bietet einen schönen Blick auf das Gotteshaus. Deshalb lädt der
Duisserner Bezirk der Evangelischen Kirchengemeinde Alt-Duisburg
schon seit mehreren Jahren im Sommer zum schon traditionellen
Wiesengottesdienst.
Den nächsten feiert die Gemeinde mit
allen Gästen am Sonntag, 22. Juni 2025 um 11 Uhr zum Thema „Durch
dich blüht die Gemeinde auf!“ Anschließend lädt die Evangelische
Gemeinde Alt-Duisburg zu Grillwürstchen mit Brötchen und Getränken.
Weitere Besonderheit: diesmal ist die Slush-Eis-Maschine des
kreiskirchlichen Jugendreferates mit dabei und spendiert die heiß
begehrte Erfrischung in drei Geschmacksrichtungen.
Eine
Anmeldung ist nicht nötig. Bei schlechtem Wetter wird der
Gottesdienst kurzfristig in die Kirche verlegt, die nur einen
Katzensprung entfernt ist. Infos zur Evangelischen Kirchengemeinde
Alt-Duisburg gibt es im Netz unter www.ekadu.de. I

Gemeindewiese hinter der Duisserner Lutherkirche - vor einem
Open-Air-Gottesdienst(Foto: Stefan Korn)
Gemeinde lädt zum Marktcafé in Meiderich
Zu
Kaffee und lecker Frühstück mit Geselligkeit und Freundlichkeit lädt
die Evangelische Kirchengemeinde Meiderich jeden zweiten Samstag zu
den Marktzeiten in das Gemeindezentrum, Auf dem Damm 8, ein. Den
nächsten Termin zum Schlemmen und Klönen gibt es am 21. Juni 2025.
Geöffnet ist das Marktcafé der Gemeinde ab 9.30 Uhr und
somit zu der Zeit, in der manche ihr Einkäufe am Meidericher
Wochenmarkt machen. Nach kurzem Fußweg lässt sich im Gemeindezentrum
bei Kaffee, Brot, Brötchen, Wurst- und Käseaufschnitt und Marmeladen
der Einkaufsstress vergessen.
Das Angebot bereiten
Ehrenamtliche zu, das Frühstück gibt´s zum Selbstkostenpreis. Infos
zur Gemeinde gibt es im Netz unter www.kirche-meiderich.de oder im
Gemeindebüro unter 0203-4519622.

NRW: Säuglingssterblichkeit 2024 nahezu auf
Vorjahresniveau
* 529 Säuglingssterbefälle und 685
Totgeborene im Jahr 2024
* Säuglingssterblichkeit lag bei 3,5 je
1.000 Lebendgeborenen
* Säuglingssterblichkeit der Mädchen und
Jungen hat sich angeglichen S
In Nordrhein-Westfalen sind im
Jahr 2024 insgesamt 529 Kinder in ihrem ersten Lebensjahr gestorben.
Das sind 9 Säuglingssterbefälle weniger als 2023 mit 538 Fällen. Wie
Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches
Landesamt mitteilt, lag die Säuglingssterblichkeit im Jahr 2024 bei
3,5 je 1.000 Lebendgeborenen und blieb somit auf dem Niveau des
Vorjahres.
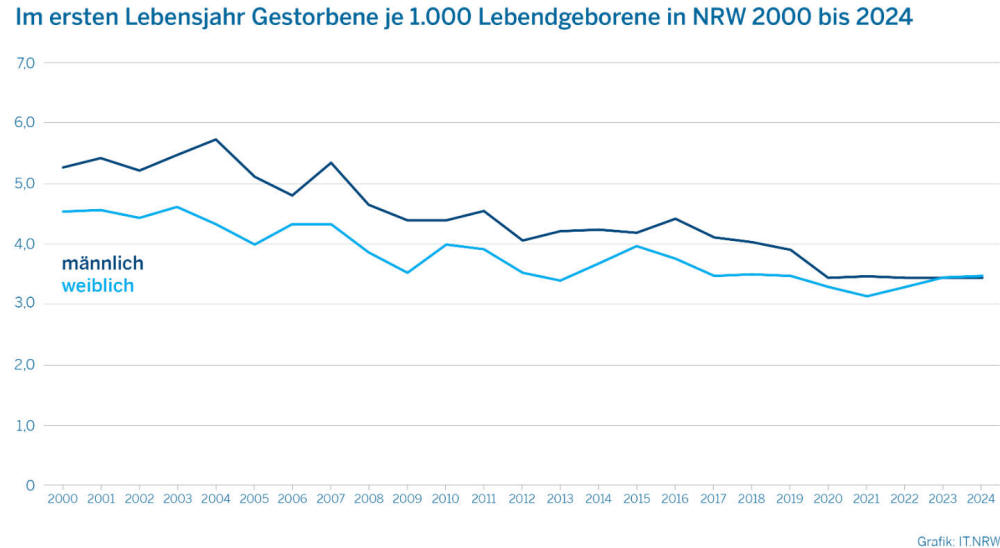
Im Jahr 2000 lag die Säuglingssterblichkeit noch bei 4,9
und sank somit im Langzeitvergleich. Seit dem Jahr 2020 stagniert
sie hingegen. Säuglingssterblichkeit von Jungen und Mädchen gleicht
sich an Die Säuglingssterblichkeit der Jungen lag Anfang der 2000er
Jahre noch über der Säuglingssterblichkeit der Mädchen.
In
den letzten Jahren war zu beobachten, dass sich die
Säuglingssterblichkeit von Jungen und Mädchen zunehmend angleicht.
Im Jahr 2024, lag diese, wie bereits im Vorjahr, auf einem ähnlichen
Niveau (Jungen: 3,4; Mädchen 3,5).
Regionale Unterschiede
bei der Säuglingssterblichkeit
Die landesweit höchste
Säuglingssterblichkeit gab es 2024 in Hagen mit 11,3, gefolgt vom
Kreis Wesel mit 6,8 sowie der Stadt Gelsenkirchen mit 6,0 im ersten
Lebensjahr Gestorbenen je 1 000 Lebendgeborenen. Auf regionaler
Ebene unterliegt die Säuglingssterblichkeit aufgrund von geringen
Fallzahlen größeren Schwankungen.
Zahl der Totgeborenen sinkt
um 4,6 %
Im Jahr 2024 gab es in Nordrhein-Westfalen 685
Totgeborene. Das waren 33 Fälle (–4,6 %) weniger als im Jahr 2023
(damals: 718). Damit gab es im vergangenen Jahr 4,5 Totgeborene auf
1 000 Geburten. Da auch die Zahl der Geburten im Vergleich zum
Vorjahr sank, blieb die Quote der Totgeborenen auf einem ähnlichen
Niveau (2023: 4,6). Die meisten Totgeburten je 1.000 Geburten
entfielen 2024 auf den Kreis Olpe (10,4) sowie die Stadt Krefeld mit
7,5 und die Städteregion Aachen mit 7,0. (IT.NRW)
NRW: Fast 20 % mehr Unternehmensinsolvenzen als im
Vorjahresquartal
* Höchster Stand der
Unternehmensinsolvenzen seit dem 1. Quartal 2016
* Die meisten
Insolvenzverfahren im Wirtschaftsbereich „Handel; Instandhaltung und
Reparatur von KFZ“
* Rückgang bei den betroffenen Beschäftigten
und den voraussichtlichen Forderungen
Im 1. Quartal 2025
haben die Amtsgerichte in Nordrhein-Westfalen 1.572 beantragte
Unternehmensinsolvenzen gemeldet. Wie Information und Technik
Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, waren das
19,7 % mehr als im 1. Quartal 2024. Damals hatte es 1.313 gemeldete
Unternehmensinsolvenzen gegeben. Die Zahl der
Unternehmensinsolvenzen erreichte im 1. Quartal 2025 den höchsten
Stand seit neun Jahren (1. Quartal 2016: 1.669 Verfahren).
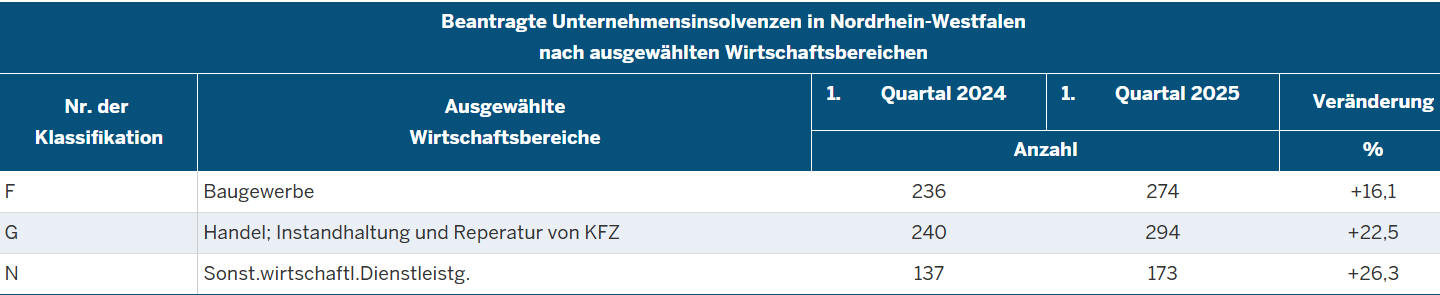
Die meisten gemeldeten beantragten Insolvenzverfahren gab es im
1. Quartal 2025 mit 294 Verfahren im Wirtschaftsbereich „Handel;
Instandhaltung und Reparatur von KFZ“, darunter die Mehrheit im
Einzelhandel. Gegenüber dem Vorjahresquartal war das ein Anstieg von
22,5 %. Höher als im 1. Quartal 2025 war die Zahl zuletzt vor sechs
Jahren mit 298 gemeldeten Verfahren gewesen.
Es folgten die
Wirtschaftsbereiche „Baugewerbe“ mit 274 Verfahren und die
„sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen“ mit 173 Verfahren;
dazu zählen zum Beispiel der Garten- und Landschaftsbau, Reisebüros
und Wach- und Sicherheitsdienste.
Rund 10.000 betroffene
Beschäftigte und 2,0 Milliarden Euro an voraussichtlichen
Forderungen
Die Zahl der insgesamt von einer
Unternehmensinsolvenz betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
war im 1. Quartal 2025 mit 10.296 Beschäftigten um 33,5 % niedriger
als im entsprechenden Vorjahresquartal. Damals hatte es 15.472
betroffene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegeben. Die Höhe der
voraussichtlichen Forderungen der Unternehmensinsolvenzen summierte
sich im 1. Quartal 2025 auf 2,0 Milliarden Euro.
Damit waren
die Forderungen um 45,4 % niedriger als im Vorjahresquartal. Damals
hatte die Höhe der summierten Forderungen bei 3,7 Milliarden Euro
gelegen. Nach ersten Auswertungen lag im 1. Quartal 2025 der
Großteil der betroffenen Beschäftigten und der voraussichtlichen
Forderungen im Wirtschaftsbereich „Verarbeitendes Gewerbe“.
Der Gesamtrückgang der betroffenen Beschäftigten und der
voraussichtlichen Forderungen war trotz steigender Zahl an
Unternehmensinsolvenzen darauf zurückzuführen, dass es eine
geringere Zahl von Insolvenzanträgen wirtschaftlich bedeutender
Unternehmen und Unternehmensketten gab.
Gesamtzahl der
Insolvenzen fast 5 % höher als im Vorjahresquartal
Die
Gesamtzahl der gemeldeten Insolvenzverfahren in NRW (Unternehmens-
und Privatinsolvenzen) war im 1. Quartal 2025 mit 7.421 Verfahren um
4,8 % höher als im entsprechenden Vorjahresquartal (1. Quartal 2024:
7.079 Verfahren).
Neben den Unternehmensinsolvenzen gab es
unter anderem 4.378 Verbraucherinsolvenzen, deren Zahl um 0,5 %
gesunken ist (1. Quartal 2024: 4.401 Verfahren). Weitere
Quartalsergebnisse finden sich in der Eckdatentabelle
https://statistik.nrw/wirtschaft-und-umwelt/unternehmen/insolvenzen/beantragte-insolvenzverfahren-nach-art-der-verfahren-und-schuldnerinnen-schuldner-quartalsergebnisse.