






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 31. Kalenderwoche:
29. Juli
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Mittwoch, 30. Juli 2025
DVG aktualisiert Haltestellennamen
Die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG arbeitet gemeinsam mit der
Stadt Duisburg an der Verbesserung des Öffentlichen
Personennahverkehrs (ÖPNV). In den vergangenen Jahren haben DVG und
Stadt bereits viel erreicht. Deshalb verbessern DVG und Stadt das
ÖPNVAngebot in Duisburg weiter.
Ab Mittwoch, dem 27. August,
werden daher diverse Haltestellen umbenannt. Änderungen bei den
Haltestellennamen Die DVG passt die Haltestellennamen an, weil
einige Haltestellennamen in Duisburg Bezug auf Gegebenheiten vor Ort
nehmen, die nicht mehr existieren. Einige Haltestellen bekommen
einen Namen, der deutlicher der Umgebung zugeordnet werden kann.
Alter Name
Neuer Name
Evangelische
Kirche Agavenweg (924, 928)
Agavenweg (924, 928)
Rheinbrücke
Baerl Rheinbrücke (923)
Baerl Rheinbrücke
(923)
Katholische
Kirche
Benediktstraße (933)
Dümpten
Bahnhof (919, 939)
Dümpten Alter Bahnhof
Kaiser-Wilhelm-Krankenhaus
Meiderich Kirche (909)
Matthes &
Weber (931)
Recyclingzentrum Mitte
Sparkasse
Uettelsheimer Weg (926)
Diese und weitere Infos zu allen
Fahrplananpassungen gibt es auf der Webseite der DVG unter
www.dvg-duisburg.de/netzkonzept-mitte. Verkehrsinformationen zu Bus
und Bahn gibt es im Internet unter www.dvg-duisburg.de, bei der
DVGTelefonhotline unter der Rufnummer 0203 60 44 555 und in der
myDVG Bus&Bahn-App.
Digitale Fallübergabe
im Notdienst - KVNO-Pilotprojekt mit konkreten Verbesserungen –
Roll-out für ganz Nordrhein dringend notwendig
Nach
über sechs Monaten im Live-Betrieb in Bonn ist klar: Die
elektronische Vernetzung der beiden Rufnummern 116 117 sowie 112,
bringt für Patienten, den Rettungsdienst, die Disponenten in der
Leitstelle sowie die Ärztinnen und Ärzte in der ambulanten
Versorgung viele Vorteile. Das Pilotprojekt zeigt aber auch, dass
die teilweise deutlichen Vorteile nur dann das gesamte
Gesundheitssystem entlasten können, wenn politische Weichen gestellt
werden. Die KVNO bietet sich weiter als Partner an.
Seit
November 2024 läuft der Schulterschluss im Notdienst in der
Bundesstadt Bonn. Zum Start sagte Dr. med. Frank Bergmann,
Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein
(KVNO): „Es ist mehr Zusammenarbeit gefragt, wenn wir den wachsenden
Anforderungen in der Akut- und Notfallversorgung auch künftig
gerecht werden wollen. Gemeinsam mit der Stadt Bonn haben wir einen
wichtigen Schritt getan. Die Steuerung über einen zentralen
Kontaktpunkt ermöglicht eine systemschonende und am medizinischen
Bedarf orientierte Zuweisung der Anrufenden.“
Die Prognose
des KVNO-Chefs zum Projektstart: „Das verbessert nicht nur die
Patientensicherheit, sondern hilft auch dabei, Informationsabbrüche,
Wartezeiten und weitere Reibungsverluste zu vermeiden.“
•
Heute (29. Juli 2025) ist klar:
Diese Erwartungen haben sich erfüllt. Bereits über 1.200-mal konnten
die Anrufenden nach erfolgter strukturierter medizinischer
Einschätzung jeweils vom KVNO-Patientenservice an den Notruf 112
oder umgekehrt übergeben werden. Bergmann: „Gerade die direkte
Übergabe samt aller wichtigen Informationen an den Notruf spart
wertvolle Zeit und kann Leben retten!“
•
Bessere Verfügbarkeit und weniger
Kosten für das belastete System
Ebenso bietet der umgekehrte Weg
eine deutliche Entlastung für den Rettungsdienst. „Jeder Fall, der
von der rettungsdienstlichen Maßnahme in die vertragsärztliche
Versorgung überführt werden kann, steigert auch die Verfügbarkeit
des Rettungsdienstes für die tatsächlichen Notfallpatienten.
Gleichzeitig fallen enorme Kosten weg, da die vertragsärztliche
Behandlung nur einen Bruchteil der Rettungsdienst- und stationären
Versorgungskosten benötigt.“
•
Herausforderung Roll-out für ganz
Nordrhein
Warum also nicht ein Roll-out für ganz Nordrhein oder
gleich ganz NRW? Bergmann erklärt: „In Nordrhein-Westfalen fehlt
bisher eine digitale Infrastruktur, die die Systeme des ambulanten
Bereitschaftsdienstes (116 117) und die des Rettungsdienstes (112)
effizient miteinander verbindet.“
•
Wichtig für den Erfolg eines
solchen Roll-outs sei es, dass die Frage der Umsetzung und der
Zeitpunkt der Einführung nicht dem individuellen Ermessen einzelner
Leitstellen überlassen bleiben, so Bergmann. „Es braucht eine klare
politische und finanzielle Rahmensetzung sowie betriebliche
Unterstützung, damit alle 52 Leitstellen in NRW diese wichtige
Infrastruktur zeitnah und koordiniert einführen können.“
•
Wunsch nach politischer
Verbindlichkeit
Ohne eine solche Verbindlichkeit bestünde die
Gefahr, dass regionale Pilotprojekte, wie aktuell in Köln und
Mettmann geplant, nicht priorisiert werden - trotz vorhandener
technischer Machbarkeit und Kooperationsbereitschaft, so der
KVNO-Vorstand. „Diese Piloten können nur erfolgreich sein, wenn sie
politisch durch verbindliche strukturelle und wirtschaftliche
Planungssicherheit flankiert werden.“
•
Arbeitsgruppe in Abstimmung mit
handelnden Personen
„Wir wollen und werden uns weiter für eine
zukunftsfeste Versorgung in Nordrhein und NRW einsetzen und begrüßen
daher auch die in der Zwischenzeit entstandene Arbeitsgruppe mit dem
MAGS, allen Fachverbänden der Rettungsleitstellen in NRW und den
beiden Kassenärztlichen Vereinigungen“, so Bergmann. „Wir wünschen
uns als Ergebnis einen klaren Fahrplan, um die elektronische
Vernetzung der Rufnummern 116 117 und 112 so schnell wie möglich in
NRW umsetzen zu können.“
Die Kassenärztliche Vereinigung (KV)
Nordrhein stellt die ambulante medizinische Versorgung für fast zehn
Millionen Menschen im Rheinland sicher. Zu ihren Mitgliedern zählen
rund 24.000 Vertragsärzte, Psychotherapeuten und Ermächtigte.
Für die Mitglieder trifft die KV Nordrhein unter anderem
Vereinbarungen mit den Krankenkassen, die die Grundlage für die
Behandlung der Patienten, die Honorierung der Ärzte und die
Qualitätssicherung bilden. Zu den weiteren Aufgaben zählen das
Abrechnen der ärztlichen Leistungen und die Verteilung des Honorars
an die Ärzte. Darüber hinaus setzt sich die KV Nordrhein als
Interessenvertreter ihrer Mitglieder ein, die sie in allen Fragen
von der Abrechnung bis zur Zulassung berät.
Telekom verbessert
Mobilfunk in Duisburg
- Jetzt 151
Standorte im Stadtgebiet von Duisburg - rund 100 % der Bevölkerung
versorgt
- Notrufe und Warnungen an allen Standorten möglich
-
Bessere Abdeckung entlang A40, A42 sowie A59 und Bahnstrecken
Dortmund-Köln und Nordrhein-Westfalen-West
Im Stadtgebiet von
Duisburg ist der Mobilfunk jetzt noch besser. Die Telekom hat dafür
in den vergangenen vier Wochen drei Antennenstandorte neu in Betrieb
genommen. Elf Standorte wurden mit LTE und zwei mit 5G erweitert.
Damit hat die Telekom die Flächenabdeckung mit mobilem Internet im
Stadtgebiet verbessert. Die Versorgung der Haushalte mit schnellem
Mobilfunk steigt ebenfalls auf rund 100 Prozent. Die neu gebauten
Mobilfunkstandorte sind im Stadtgebiet von Duisburg.
Ein
Standort dient der Versorgung entlang der Bahnstrecke
Nordrhein-Westfalen-West. Im Stadtgebiet von Duisburg hat die
Telekom die bestehenden Mobilfunkantennen modernisiert. „Der Bedarf
an Bandbreite nimmt ständig zu – rund 30 Prozent pro Jahr. Deshalb
machen wir beim Mobilfunkausbau weiter Tempo“, sagt Katja Kunicke,
Unternehmenssprecherin Deutsche Telekom. Die Telekom betreibt im
Stadtgebiet Duisburg jetzt 151 Standorte.
Mit rund 36.000
Mobilfunkstandorten verfügt die Telekom über das beste Mobilfunknetz
Deutschlands. Das bestätigen die aktuellen Testsiege in den
Fachmagazinen Chip, connect, ComputerBild und Imtest.
Die
Mobilfunkstandorte der Telekom im Kreis unterstützen die
Notruftechnologie Advanced Mobile Location (AML) sowie das
Warnsystem Cell Broadcast. Bei Notrufen an die 112 wird der Standort
des Anrufers dank AML automatisch an die Rettungsleitstelle
übermittelt. Cell Broadcast sendet Gefahrenmeldungen an
Mobiltelefone in der betroffenen Funkzelle, beispielsweise bei
Großbränden, Gasexplosionen oder Überschwemmungen.
Weitere
Informationen
Wer mehr über die Verfügbarkeit von Mobilfunk in
seinem Stadtgebiet erfahren will, kann sich unter
www.telekom.de/netzausbau informieren.
IRONMAN 70.3
bleibt bis 2028 – klares Bekenntnis zur Sportstadt Duisburg
Duisburg
bietet auch in den kommenden Jahren ein Zuhause für die weltweite
IRONMAN-Serie: Der Vertrag zwischen dem Veranstalter IRONMAN Germany
GmbH und der Stadt Duisburg wurde bis einschließlich 2028
verlängert. Damit wird das Bekenntnis zur Sportstadt Duisburg als
Austragungsort des internationalen Triathlon-Spektakels erneut
bekräftigt.

Ironman 2024 in Duisburg.Die Radstrecke führte über die Brücke der
Solidarität..Bild: Ilja Höpping / Stadt Duisburg
Der IRONMAN
70.3 Duisburg steht für Spitzensport, eindrucksvolle Bilder,
tausende Zuschauer und eine enorme Strahlkraft für die Region. Für
Oberbürgermeister Sören Link ist die Vertragsverlängerung ein
starkes Signal für die Sportstadt Duisburg: „Veranstaltungen wie der
IRONMAN 70.3 geben unserer Stadt eine internationale Bühne. Wenn
Athletinnen und Athleten aus aller Welt kommen, begeistert ins Ziel
laufen und gerne hier wieder antreten, ist das ein schönes
Kompliment – für unsere Infrastruktur, für die besondere Atmosphäre,
die Duisburg ausstrahlt, und natürlich für das Zusammenspiel hinter
den Kulissen, wodurch ein solches Megaevent überhaupt erst möglich
wird.“
Diese positive Resonanz spiegelt sich auch in der
Einschätzung der Veranstalter wider: „Wir freuen uns, dass Duisburg
für viele Athletinnen und Athleten längst ein fester Bestandteil
ihrer IRONMAN-Reise geworden ist und wir diese Reise für die
nächsten drei Jahre weiterhin gemeinsam fortführen können“, sagt
Daniel Gottschall, Regional Director Germany / Luxembourg von
IRONMAN Germany GmbH.
Der nächste IRONMAN 70.3 Duisburg
findet am 7. September 2025 statt. Mehr als 2.000 Athletinnen und
Athleten aus aller Welt werden erwartet. Die Strecke bleibt dem
erfolgreichen Konzept treu: 1,9 Kilometer Schwimmen in der
Regattabahn, 90 Kilometer Radfahren durch die Region und 21,1
Kilometer Laufen mit Zieleinlauf an der Schauinsland-Reisen-Arena.
Nach der einmaligen Verlegung 2024 in den Innenhafen kehrt
der IRONMAN 70.3 Duisburg künftig an seinen bewährten
Veranstaltungsort in den Sportpark Duisburg zurück. „Es ist gut zu
hören, dass die Abläufe, die Wegeführung und das Gesamtbild bei den
Teilnehmenden so positiv ankommen“, sagt Marc Rüdesheim,
stellvertretender Betriebsleiter von DuisburgSport, die unter
anderem für den Sportpark verantwortlich sind und als operative
Schnittstelle zwischen Veranstalter und Stadtverwaltung agieren.
„Wenn Veranstalter und Teilnehmende spüren, dass in Duisburg
nicht nur die Bedingungen stimmen, sondern auch der Wille da ist,
solche Formate möglich zu machen, ist das eine starke Grundlage für
eine langfristige Partnerschaft. Wir freuen uns auf die kommenden
drei Jahre.“
Internationaler Tag der Freundschaft am 30. Juli – Junge
Menschen mit Beeinträchtigung häufig sozial isoliert
Am 30. Juli ist
der Internationale Tag der Freundschaft – ein Gedenktag, der vor 14
Jahren von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen wurde.
Freundschaften sind insbesondere für junge Menschen ein zentraler
Bestandteil ihrer Lebenswelt und spielen eine entscheidende Rolle
für ihre persönliche Entwicklung.
Anlässlich dieses
Aktionstages möchten wir auf alarmierende Ergebnisse aus dem
Inklusionsbarometer Jugend der Aktion Mensch aufmerksam machen. Im
Rahmen der ersten bundesweiten Vergleichsstudie zu Teilhabechancen
wurden junge Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zwischen 14 und
27 Jahren u. a. zu ihren sozialen Beziehungen befragt. Die
Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede:
Mit 27 Prozent
fällt es jungen Menschen mit Beeinträchtigung deutlich schwerer,
neue Freundschaften zu schließen – im Vergleich zu nur 9 Prozent der
Jugendlichen ohne Beeinträchtigung.
Studie herunterladen
29 Prozent der Befragten mit
Beeinträchtigung sehen kaum Chancen, eine feste Beziehung zu finden
– gegenüber 17 Prozent der Jugendlichen ohne Beeinträchtigung.
Einsamkeit betrifft mehr als jeden vierten jungen Menschen mit
Beeinträchtigung (26 Prozent) und somit anteilig doppelt so viele
wie bei Jugendlichen ohne Beeinträchtigung (13 Prozent).
„Räumliche Barrieren, mangelnde Mobilität und eine unzureichende
Inklusion in Bildungs- und Freizeitangeboten erschweren es jungen
Menschen mit Beeinträchtigung zusätzlich, Freundschaften zu
schließen. Dabei wissen wir: Wer früh Erfahrungen in inklusiven
Umfeldern sammelt, wächst selbstverständlicher in eine vielfältige
Gesellschaft hinein. So entstehen Unsicherheiten oder Vorurteile im
Umgang mit Menschen mit Behinderung häufig gar nicht erst. Wir
fordern daher Inklusion von Anfang an in allen Lebensbereichen
junger Menschen“, so Christina Marx, Sprecherin der Aktion Mensch.
Langenscheidt: Jugendwort des Jahres 2025: Die Top 10
sind da
Jugendliche zwischen 11 und 20 Jahren waren
aufgerufen, ihr Jugendwort des Jahres einzureichen. Wie bereits in
den Jahren zuvor, sind es vor allem die Social Media, die die
Sprache von Gen Z und Gen Alpha prägen. Eltern, Großeltern, Onkel
und Tanten verstehen dann oft nur Bahnhof.

Und dies sind die Top 10, ihre Bedeutung und wie sie genutzt werden:
•
„Checkst du“ – Wird genutzt, um
sicherzugehen, dass das Gegenüber wirklich versteht, worum es gerade
geht. Diese neue Variante des „Verstehst du?“ steht meist am Ende
eines Satzes, um nachzufragen, ob der oder die andere überhaupt
zugehört hat.
•
„Das crazy“ – Dieser Ausdruck
wird als Allzweckwaffe der Sprachlosigkeit genutzt. Er wird immer
dann verwendet, wenn jemand nicht weiß, was er sagen soll, keine
Lust hat zu antworten oder einfach nur höflich bleiben will, um das
Gespräch am Laufen zu halten. Er ist somit vergleichbar mit einem
„Aha, cool“ oder „Okay“.
•
„Digga(h)“ – Ein klassisches
Slangwort als Synonym für Bro, Bruder, Freund und Freundin oder
einfach irgendeine Person. Funktioniert auch als Anrede, Ausruf oder
Reaktion und ist damit locker, direkt und universell einsetzbar.
•
„Goonen“ – Ein Slangwort für
Selbstbefriedigung. Ursprünglich wurde es benutzt, wenn es nicht bei
einer kurzen Handlung blieb, sondern auf eine Dopaminsucht schließen
ließ. Inzwischen wird es als allgemeines Synonym genannt.
(Anmerkung des Langenscheidt-Gremiums: Für uns gehören auch sexuelle
Begriffe zur Jugendsprache. Wir möchten transparent damit umgehen,
aber auf Risiken hinweisen. Langes Selbstbefriedigen kann eine
Dopaminsucht begünstigen und zu einer ungesunden Beziehung mit der
eigenen Sexualität führen.)
•
„Lowkey“ – Der Begriff bedeutet
so viel wie „ein bisschen“, „unauffällig“ oder „unterschwellig“. Er
wird benutzt, um etwas auszudrücken, ohne dabei zu dramatisch zu
wirken – beispielsweise, wenn es um Gefühle geht, Ansichten oder
auch Geschmäcker.
•
„Rede“ – Meint „Lauter! Alle
sollen es hören!“ und wird genutzt, wenn jemand genau das
ausspricht, was alle fühlen und denken. Diese Zustimmung mit
Nachdruck ist besonders beliebt in Gesprächen – und wenn man merkt:
„Der hat gerade komplett delivert!“
•
„Schere“ – Ein Begriff, der aus
der Gaming-Szene kommt und ebenso wie „Diggah“ bereits im letzten
Jahr in den Top 10 war. Er wird genutzt als digitaler Handschlag,
der ausdrückt „Mein Fehler!“. Wer Mist baut und dazu steht, hebt
metaphorisch die Schere. Im Fußball wäre dies die gehobene Hand zur
Entschuldigung nach einem Foul.
•
„Sybau“ – Ein Wort, das süßer
klingt als es gemeint ist. Es steht für „Shut your bitch ass up“ und
wird gerne in Videos und Kommentarspalten geschrieben. Ältere
Generationen sagten noch „Halt die Fresse“ – wobei sybau im
Gegensatz dazu auch durchaus ironisch und mit Augenzwinkern
rüberkommen soll.
•
„Tot“ – Ein Begriff, der etwas
oder eine Situation beschreibt, die komplett daneben ist – oder
einfach lahm, peinlich oder unbeabsichtigt uncool. Beispiel: Stehst
mit Freundinnen auf ‘ner Homeparty, Musik leise, alle sitzen am
Handy. Tot.“
•
„Tuff“ – Ein Slangwort, das für
„krass“ oder „cool“ steht. Es ist damit eine positive Art zu sagen,
wie beeindruckt man ist. Ob Aussehen, Skills oder Aktionen – „tuff“
passt immer, wenn es richtig „ballert“.
Jugendsprache: von
unverständlich bis absurd
„Viele Begriffe wie ‚sybau‘ oder ‚das
crazy‘ wirken auf den ersten Blick absurd“, weiß Patricia Kunth,
Marketing Managerin bei Langenscheidt und Verantwortliche für das
Jugendwort des Jahres. „Doch Jugendsprache lebt von Abkürzungen,
Bedeutungsverschiebungen und kreativen Wortbildungen oder
Neuschöpfungen, die nicht jeder sofort versteht.“
Obwohl
dies bereits ihre dritte Jugendwort-Kampagne ist, ist sie erneut
beeindruckt, wie schnell Trends aufgegriffen, weiterentwickelt und
in den Sprachgebrauch übernommen werden. Kunth weiter: „Manche
Begriffe verschwinden nach kurzer Zeit wieder, und andere bleiben,
weil sie gut klingen, vielfältig nutzbar und von angesagten
Online-Persönlichkeiten oft verwendet werden. Auch die diesjährige
Top 10 zeigt, wie stark die Online-Welt Jugendsprache beeinflusst.
Ein Wort trifft den Zeitgeist – und plötzlich spricht das halbe
Internet so.“
Wo Jugendsprache draufsteht, ist auch
Jugendsprache drin
Über die Website Jugendwort.de durften die
Begriffe seit dem 29. Mai eingereicht werden. Die Anzahl der
Einreichungen lag im sechsstelligen Bereich. 88,62 Prozent wurden
von den Generationen Z und Alpha eingereicht und damit im Voting
berücksichtigt.
Die Top 10 zeigen, dass Jugendwörter nicht
zwingend aus dem Deutschen stammen müssen. Viele Begriffe, die
Jugendliche heute verwenden, kommen schließlich aus dem Englischen.
In den vergangenen Jahren waren auch Ausdrücke aus dem türkischen
oder arabischen Sprachraum dabei.
Und auch wenn grundsätzlich
jeder sein persönliches Jugendwort des Jahres vorschlagen durfte,
wurden nur jene im Voting berücksichtigt, die von Teilnehmenden im
Alter zwischen 11 und 20 Jahren eingereicht worden waren. Ebenfalls
ausgeschlossen werden in jedem Jahr Begriffe, die eine
Diskriminierung jedweder Art zum Ausdruck bringen oder im Rahmen
einer Kampagne eingereicht wurden und nicht zum typischen
Sprachgebrauch der Jugendlichen gehören. In diesem Jahr waren dies
„Ralf Schumacher“, „Fotzenfritz“, „Jet2Holiday“ sowie „Agatha“.
Am 3. September werden die Top 3 bekanntgegeben und das Voting
geht in die finale Runde. Die Verkündung des Jugendwortes 2025
erfolgt dann am 18. Oktober um 14 Uhr live auf der Frankfurter
Buchmesse.
Vor 10 Jahren in der BZ: Das (nicht vorhandene)
Paternosterproblem
Im Rathaus geht es wieder aufwärts -
Nicht nur für den Oberbürgermeister
Weil
Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) es so wollte, standen
seit dem 1. Juni 2015 alle 'Paternoster' in Deutschland still. Von
Jochem Knörzer

Auch im Duisburger Rathaus wurde der Paternoster 'an die
Kette gelegt'
Möglicherweise aus Arbeitsmangel und
Langeweile kam die, mit 45 Jahren auch nicht mehr ganz
junge, Genossin auf die, für normal arbeitende und
denkende Menschen absurde, Idee, eine Verordnung, die noch
aus der Feder der Vorgängerin, Ursula von der Leyen,
stammte, umzusetzen. So stufte sie diese, mit 'satten' 45
Zentimeter pro Sekunde fahrenden, Aufzüge als 'gefährlich'
ein und wollte eine 'Führerscheinpflicht' einführen.
Der gesunde Menschenverstand hat sich,
parteiübergreifend, gegen diese 'Bürokratie-Posse' gewehrt
und, zum Glück, obsiegt!
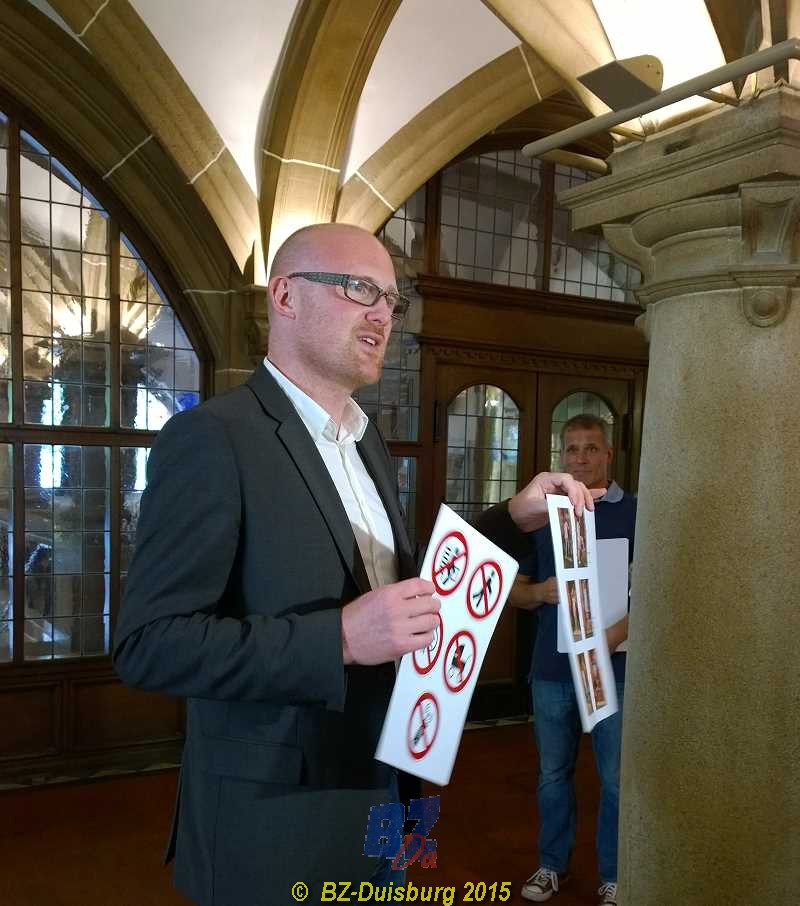
Oberbürgermeister Sören Link stellte mit launischen Worten,
die nicht pro Nahles klangen, die neuen Aufkleber vor, die bildlich darstellen, wie
man den Paternoster sicher benutzt und als Piktogramme
zeigen, was man nicht machen darf.

Damit hat der Oberbürgermeister 'seine' Vorkehrungen
getroffen und konnte den "Beamten-Bagger" wieder in
Betrieb nehmen.

Über sechs Wochen stand er still, seit Donnerstag,
16.07.2015, 14:04 Uhr, fährt er wieder - Gott sei Dank!

Sören Link ließ es sich natürlich nicht nehmen, als Erster
wieder den fahrenden Paternoster zu betreten.

Endlich ging es für den Duisburger OB mal wieder aufwärts.

Und der 'Hausherr des Rathauses', Ralf Baum, sorgte
schnell für die Anbringung der
'Paternoster-Bedienungsanleitungen'. Noch 14 Jahre,
dann bekomme ich die 'Silberne Ehrennadel' für 25 Jahre
unfallfreie Paternosterfahrten ...
EU im Würgegriff des US-Potentaten Trump - ÖDP kritisiert
Einknicken der EU-Kommission als „Bankrotterklärung für konsequenten
Klimaschutz“.
EU im Würgegriff des US-Potentaten Trump
ÖDP kritisiert Einknicken der EU-Kommission als „Bankrotterklärung
für konsequenten Klimaschutz“. „EU-Kommissionspräsidentin Ursula von
der Leyen (CDU) hat unseren Planeten verraten.“
Drastisch
urteilt Prof. Dr. Herbert Einsiedler als Vorstandsmitglied der
Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP – Die Naturschutzpartei) über
den jüngsten „Deal“ zur Begrenzung der drohenden US-Zölle, mit dem
die Trump-Administration der EU-Kommissionspräsidenten eine
Vereinbarung zu Lasten von Verbrauchern und Wirtschaft abgenötigt
hat.
Diese „Einigung“ macht ökonomisch keinen Sinn, befürchten
Wirtschaftsexperten und rechnen mit Schäden in Milliardenhöhe.
Mit der Verhandlung torpedierte die EU-Chefin zudem – und schlimmer
noch! – ihren eigenen Green Deal, um sich die Gunst des Rambos im
Weißen Haus mit einem mehr als wackligen Versprechen zu sichern: Die
Staaten des alten Kontinents müssen innerhalb von drei Jahren für
750 Milliarden Dollar fossile Brennstoffe – und damit
klimaschädliche CO2-Schleudern - aus der Neuen Welt kaufen.
Heißt konkret: Klimaschutz ade! „Wir brauchen schnellstens 100
Prozent erneuerbare Energie“, fordert stattdessen
ÖDP-Bundesvorstandsmitglied Helmut Kauer: „Das schützt nicht nur das
Klima, sondern uns auch vor solchen Erpressungen durch das Ausland.“
Der ÖDP-Bundesvorsitzende Günther Brendle-Behnisch spricht vom Kotau
von der Leyens vor dem Möchtegern US-Potentaten Trump: „Das war ein
Offenbarungseid.“
Einsiedler ergänzt: „Damit wird die
Energiewende sabotiert und dem Green Deal der Todesstoß versetzt.“
Selbst wenn,
was einige Medien und EU-Politiker in Brüssel munkeln, dieser
Energiezukauf der Europäer in Trumpland „unrealistisch“ ist, bleibt
das bloße Abnicken zur Erpressung des US-Präsidenten ungeheuerlich.
Für Brendle-Behnisch ein „Kniefall vor der Macht“. Besser wäre es,
empfiehlt der ÖDP-Chef und selbst ehemaliger Unternehmer, „sich auf
andere Märkte zu konzentrieren und sich möglichst schnell aus diesem
Würgegriff zu befreien.“
Deutscher-Mittelstands-Bund (DMB) zum USA-EU-Zollabkommen
„Die jüngste Einigung zwischen der US-Regierung und der Europäischen
Union beendet vorerst die drohende Eskalation im transatlantischen
Handelskonflikt um Zölle. Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
in Deutschland und Europa schafft das zwar eine ‚Atempause‘ und
temporär etwas mehr Planungssicherheit.
Aus Sicht des
Deutschen Mittelstands-Bund (DMB) ist die neue Einigung jedoch kein
Erfolg – sie ist vielmehr Ausdruck europäischer Schwäche im
internationalen Handel. Die Leidtragenden sind insbesondere der
deutsche und europäische Mittelstand: Höhere Zölle sowie zusätzliche
bürokratische Hürden verteuern Exporte, erschweren Lieferketten und
führen zu erhöhtem Zeit- und Kostenaufwand. Dadurch wird die
internationale Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstands massiv
gefährdet.
Der ‚Deal‘ ist auch ein politisches Alarmsignal:
Die USA nutzen die Zölle zunehmend als machtpolitisches Instrument
zur Deckung finanzieller Defizite im eigenen Land. Sie untergraben
damit die Prinzipien eines freien und fairen Welthandels. Während
die USA ihre ‚America First‘-Strategie konsequent verfolgen, tragen
die europäischen Unternehmen die Hauptlast dieser Vereinbarung.
Zwar verhindert die Einigung kurzfristig weitere Eskalationen,
doch bleibt die Planungssicherheit durch die unberechenbare
Handelspolitik der USA fragil. Gleichzeitigt wurden zentrale
Streitpunkte wie die europäische Dienstleistungssteuer,
Digitalregulierung und Künstliche Intelligenz vertagt und nicht
gelöst. Europa darf sich mit diesem Kompromiss nicht zufriedengeben.
Die EU muss den Dialog weiter aktiv fortführen und auf
Nachverhandlungen drängen. Europa muss seine ökonomischen Interessen
konsequent vertreten, seine Wettbewerbsfähigkeit stärken und sowohl
wirtschaftlich als auch sicherheitspolitisch unabhängiger werden.
Nur dann kann Europa seine Rolle als größter Wirtschaftsraum der
Welt behaupten und langfristig Innovationen, Arbeitsplätze sowie
Wohlstand sichern.
Dazu gehört auch eine zukunftsgerichtete,
innovationsfreundliche und selbstbewusste Handelsstrategie –
einschließlich eines verstärkten Engagements für neue
Freihandelsabkommen. Hier braucht es mehr Tempo, insbesondere bei
der überfälligen Ratifizierung bestehender Verträge wie dem
Mercosur-Abkommen sowie bei der intensiven Weiterverhandlung mit
wichtigen Partnerstaaten wie Indien, Indonesien und Australien.
Europa muss aber vor allem seine eigene Sicherheitspolitik
grundlegend stärken. Die Schwäche Europas im Handel mit den USA ist
eng mit seiner sicherheitspolitischen Abhängigkeit verbunden:
Solange Europa auf den militärischen Schutz der USA angewiesen ist,
bleibt es auch wirtschaftlich erpressbar. Nur wenn die Europäische
Union in Verteidigungsfragen unabhängiger agiert, kann sie ihre
wirtschaftlichen Interessen glaubhaft und durchsetzungsstark
vertreten – und ihre Stellung als größter Wirtschaftsraum der Welt
behaupten, Innovationen fördern sowie langfristig Arbeitsplätze und
Wohlstand sichern.“
AUSGERUFEN | Kerry Kenny Band – accoustic session
Kerry Kenny aus Bloomsburg/Pennsylvania (USA) ist eine brilliante
Bandleaderin, Songwriterin und Gesangsvirtuosin. Ihr musikalischer
Background stammt aus dem Irish Pub ihrer Familie genauso wie aus
den Beatles LPs ihres Vaters. Auf Reisen durch Asien und Europa hat
sie weitere Einflüsse aufgesogen und präsentiert heute eine
Live-Performance befreit von den Zwängen eines bestimmten Genres.

Foto Joseph Pecora
Nach der
Veröffentlichung ihres Debut-Albums „PINING TIME“ in 2023 und ihrer
Single „ROBERT McGEE“, aufgenommen während der Europa Tournee 2024,
hat die KERRY KENNY BAND nun ihr zweites brandaktuelles Album
„BRUTAL BEST“ im Gepäck. Es enthält Songs voller ansteckender
Melodien, beeindruckender Soli und dynamischen Grooves, die auch an
diesem Abend zu Gehör gebracht werden. Hinzu kommen bekannte Hits
aus Kerrys schier unerschöpflichem All American Songbook.
Im Das PLUS am Neumarkt spielt die KERRY KENNY BAND ein Akustik-Set,
das Line-Up wurde speziell für Ihre diesjährige Europa-Tournee
zusammengestellt und besteht aus: Vocals/Guitar: KERRY KENNY
Drums/Percussion: MARC GRASSO Bass: DOMINIK HAYCK Guitar: CHRIS
KLUWE
AUSGERUFEN | Kerry Kenny Band – accoustic session
Mittwoch, 30. Juli 2025, 19 Uhr Das PLUS am Neumarkt, Neumarkt
19, 47119 Duisburg-Ruhrort Eintritt frei(willig) – Solidarische
Hutveranstaltung
Irisches und
schottisches in der Hamborner Friedenskirche
In der
Hamborner Friedenskirche, Duisburger Straße 174, sind am 30. Juli um
19.30 Uhr Elke Jensen, und Hans-André Stamm zu Gast. Die
Mezzosopranistin, die im Konzert auch die Tin-Whistle-Flöte spielt,
und der Organist werden mit irischen und schottischen Liedern und
von keltischer Folklore inspirierten Orgelwerken das Publikum in
mythische Landschaften der grünen Insel und der schottischen
Highlands entführen.
Auch für dieses Konzert der Reihe der
Sommerkonzerte an der Friedenskirche gilt: Wenn das Wetter
mitspielt, kann das kulturinteressierte Publikum nach der Aufführung
im Kirchgarten mit den Musikerinnen und Musikern bei einem Getränk
ins Gespräch kommen.
Der Eintritt zu den Konzerten kostet jeweils
zehn Euro. Schüler, Studenten, Schwerbehinderte zahlen bei Vorlage
des Ausweises nur fünf Euro. Tiina Marjatta Henke beantwortet
Rückfragen und hat mehr Infos zu den Konzerten
(tiinamarjatta@posteo.de).

Hans-André Stamm (Foto: Barbara Frommann)

Kinderschutz: Rund 69 500 Kinder und Jugendliche im Jahr
2024 vom Jugendamt in Obhut genommen
• Weniger
Inobhutnahmen durch unbegleitete Einreisen (-22 %), aber mehr durch
dringende Kindeswohlgefährdungen (+10 %) und Selbstmeldungen (+10 %)
• Größter Anstieg bei körperlichen Misshandlungen und
Vernachlässigungen
• Eine Maßnahme dauerte im Schnitt gut zwei
Monate – fast zwei Wochen mehr als
Die Jugendämter in
Deutschland haben im Jahr 2024 rund 69 500 Kinder oder Jugendliche
zu ihrem Schutz vorübergehend in Obhut genommen. Das waren gut 5 100
Jungen und Mädchen weniger als im Jahr zuvor (-7 %). Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ist damit die
Zahl der Schutzmaßnahmen erstmals wieder zurückgegangen, nachdem sie
zuvor drei Jahre in Folge angestiegen war.
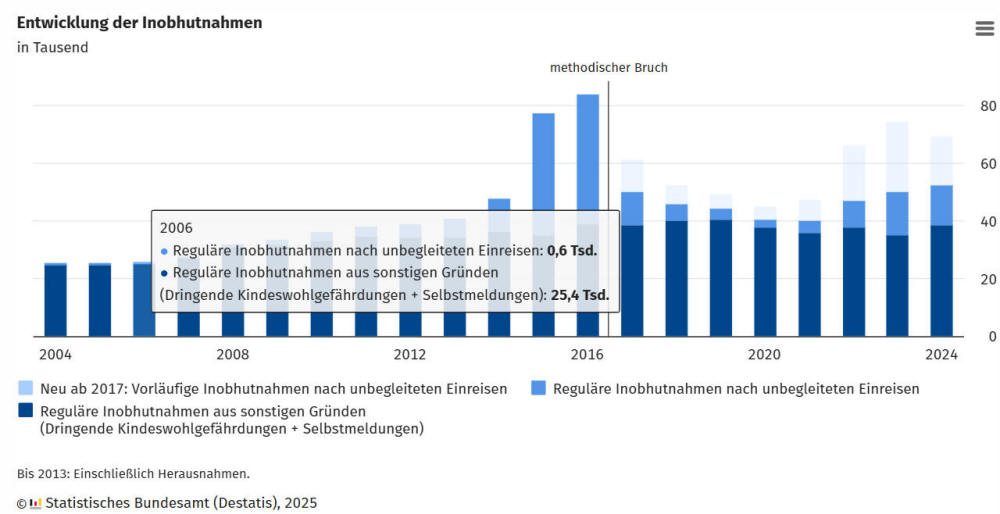
Trotz Rückgang: die meisten Inobhutnahmen wegen unbegleiteter
Einreisen
Trotz ihres Rückgangs wurden 2024 die meisten
Schutzmaßnahmen (44 %) aufgrund von unbegleiteten Einreisen
durchgeführt. Dazu zählten vorläufige
Inobhutnahmen (24 %), die direkt nach der Einreise eingeleitet
wurden, und reguläre
Inobhutnahmen (20 %), die in der Regel – nach einer bundesweiten
Verteilung der Betroffenen – daran anschließen.
Weitere 42 %
der Schutzmaßnahmen erfolgten wegen dringender
Kindeswohlgefährdungen und 13 % aufgrund von Selbstmeldungen, also
weil Kinder oder Jugendliche aus eigenem Antrieb Hilfe beim
Jugendamt gesucht hatten. Größter Zuwachs bei körperlichen
Misshandlungen und Vernachlässigungen Neben der unbegleiteten
Einreise (44 %) zählten 2024 zu den häufigsten Anlässen für eine
Schutzmaßnahme: Überforderungen der Eltern (25 %),
Vernachlässigungen (12 %), körperliche Misshandlungen (11 %) und
psychische Misshandlungen (8 %).
Während im Vergleich zu
2023 vor allem unbegleitete Einreisen an Bedeutung verloren haben,
sind die Nennungen bei 9 von insgesamt 13 möglichen Anlässen
gestiegen: Am größten war das Plus bei körperlichen Misshandlungen
(+1 026 Nennungen) und Vernachlässigungen (+939 Nennungen).
Deutlich zugenommen haben auch Überforderungen der Eltern
(+896 Nennungen) und psychische Misshandlungen (+843 Nennungen). Bei
den Anlässen waren Mehrfachnennungen möglich. Fast zwei Wochen mehr
als im Vorjahr: Maßnahme dauerte im Schnitt gut zwei Monate Während
der Schutzmaßnahme wurden gut drei Viertel (77 %) der Betroffenen in
einer Einrichtung und knapp ein Viertel bei einer geeigneten Person
oder in einer betreuten Wohnform untergebracht.
Dabei konnte
zwar knapp jeder dritte Fall (30 %) in weniger als einer Woche
beendet werden, jeder fünfte Fall (21 %) dauerte allerdings drei
Monate oder länger. Im Schnitt endete eine Inobhutnahme nach
62 Tagen – also gut zwei Monaten. Vergleichsweise schnell beendet
werden konnten zum Beispiel Schutzmaßnahmen aufgrund von
Selbstmeldungen der betroffenen Jungen oder Mädchen: 2024 dauerten
sie im Schnitt 36 Tage.
Höher war der Klärungs- und
Hilfebedarf offenbar bei dringenden Kindeswohlgefährdungen. In
diesen Fällen endete die Inobhutnahme im Schnitt erst nach 57 Tagen.
Am längsten dauerten die Maßnahmen nach unbegleiteten Einreisen aus
dem Ausland: Mit durchschnittlich 74 Tagen waren sie gut doppelt so
lang wie bei den Selbstmeldungen (36 Tage).
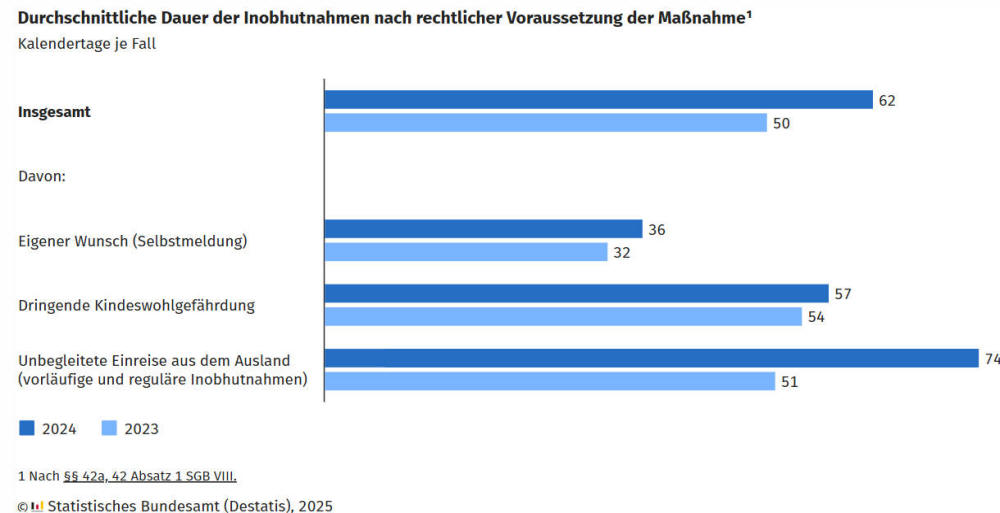
Im Vergleich zum Vorjahr stieg die durchschnittliche Dauer der
Schutzmaßnahmen um 12 Tage – also knapp 2 Wochen – an. Das Plus
betrifft sowohl Selbstmeldungen (+4 Tage) als auch Fälle von
dringender Kindeswohlgefährdung (+3 Tage). Am höchsten fiel der
Zuwachs aber bei den Inobhutnahmen nach unbegleiteter Einreise aus:
Mit 23 Tagen lag er fast zweimal über dem Durchschnitt (12 Tage).
Rund ein Viertel der Betroffenen kehrt an bisherigen
Aufenthaltsort zurück Im Anschluss an die Inobhutnahme kehrte etwa
ein Viertel (24 %) der Minderjährigen an den vorherigen
Aufenthaltsort zurück. Weitere 45 % der Kinder oder Jugendlichen
wurden nach der Schutzmaßnahme an einem neuen Ort untergebracht, und
zwar am häufigsten in einem Heim, einer betreuten Wohngruppe oder
einer anderen Einrichtung.
In jeweils etwa jedem zehnten
Fall wurden die Betroffenen von einem anderen Jugendamt übernommen
(9 %) oder beendeten die Inobhutnahme selbst (13 %), teils auch,
indem sie aus der Maßnahme ausrissen. In weiteren 9 % der Fälle
wurde die Inobhutnahme anderweitig beendet. Diese Angaben zum
Maßnahmen-Ende beziehen sich nur auf reguläre Inobhutnahmen (ohne
vorläufige Inobhutnahmen).
22,5 Millionen Tonnen
gefährliche Abfälle in Deutschland im Jahr 2023
• Menge
gefährlicher Abfälle sinkt auf niedrigsten Stand seit 2015
•
Bau- und Abbruchabfälle weiterhin mit größtem Anteil am
Gesamtaufkommen
m Jahr 2023 sind 22,5 Millionen Tonnen
gefährliche Abfälle in Deutschland angefallen. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) mitteilt, sank die Menge gefährlicher Abfälle
damit um 2,4 % oder 0,6 Millionen Tonnen gegenüber dem Jahr 2022
(23,1 Millionen Tonnen) und erreichte den niedrigsten Stand seit
2015 (22,3 Millionen Tonnen).
Gefährliche Abfälle sind
Abfallarten mit bestimmten Gefährlichkeitsmerkmalen, die eine
Bedrohung für Mensch und Umwelt darstellen. Sie können
beispielsweise brandfördernd, krebserregend oder reizend sein. Für
sie sind Begleitscheine zu führen und sie müssen speziellen
Entsorgungswegen und -verfahren zugeführt werden, die eine sichere
und umweltverträgliche Zerstörung der enthaltenen Schadstoffe
gewährleisten.
Bau- und Abbruchabfälle machen über ein
Drittel aller gefährlichen Abfälle aus
Nach Abfallarten
betrachtet machten Bau- und Abbruchabfälle wie schon in den
Vorjahren den größten Anteil an der Gesamtmenge gefährlicher Abfälle
aus. Im Jahr 2023 betrug ihr Anteil 8,6 Millionen Tonnen oder 38,4 %
des Gesamtaufkommens.
Die zweitgrößte Menge stammte aus
Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen
sowie aus der Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch
und für industrielle Zwecke (darunter Kläranlagen und Wasserwerke)
mit zusammen 7,0 Millionen Tonnen oder 31,0 %.
Im Jahr 2022
hatten die Anteile beider Abfallarten 40,2 % (9,3 Millionen Tonnen)
beziehungsweise 29,3 % (6,8 Millionen Tonnen) der Gesamtmenge
gefährlicher Abfälle betragen. Mehr als 60 % der gefährlichen
Abfälle aus zwei Wirtschaftsabschnitten Der Großteil der
gefährlichen Abfälle wurde im Jahr 2023, wie in den Vorjahren, in
zwei Wirtschaftsabschnitten erzeugt: 9,1 Millionen Tonnen oder
40,3 % der Abfälle stammten aus dem Abschnitt "Wasserversorgung;
Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von
Umweltverschmutzungen" (2022: 9,4 Millionen Tonnen; 40,8 %).
Dazu zählen beispielsweise Entsorgungsanlagen wie Deponien oder
Anlagen zur Aufbereitung flüssiger und wasserhaltiger Abfälle mit
organischen Stoffen, die bei unsachgemäßer Entsorgung über das
Abwasser indirekt in Gewässer und damit in die Umwelt gelangen
können. 4,9 Millionen Tonnen oder 21,5 % der gefährlichen Abfälle
(2022: 4,7 Millionen Tonnen; 20,4 %) stammten aus dem
Wirtschaftsabschnitt "Verarbeitendes Gewerbe", und dort insbesondere
aus Betrieben zur Herstellung von Maschinen, Metallerzeugnissen und
chemischen Erzeugnissen.
Überwiegender Anteil durch
Primärerzeuger 16,1 Millionen Tonnen (71,6 %) der gefährlichen
Abfälle stammten im Jahr 2023 von Primärerzeugern, bei denen die
Abfälle im eigenen Betrieb erstmalig angefallen sind. Das waren
5,3 % oder 0,9 Millionen Tonnen weniger als im Jahr 2022.
6,4 Millionen Tonnen (28,4 %) waren sogenannte sekundär erzeugte
Abfallmengen aus Zwischenlagern oder von Abfallentsorgern, bei denen
der Abfall nicht ursprünglich entstanden ist. Die Menge gefährlicher
Abfälle sank hier gegenüber 2022 um 5,5 % oder 0,3 Millionen Tonnen.