






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 31. Kalenderwoche:
30. Juli
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Donnerstag, 31. Juli 2025
Beeinträchtigung durch Vandalismus DB Fernverkehr
Dauer: Von
31.07.2025 bis 01.08.2025 ICE/IC
Aufgrund von Vandalismusschäden - Polizei vermutet
Brandstiftung -zwischen Düsseldorf und Duisburg kommt es im
Fernverkehr der Deutschen Bahn zu Beeinträchtigungen. Dadurch kommt
es zu (Teil-) Ausfällen, Umleitungen und Verspätungen.
Es soll sich um einen Brand in einem Kabeltunnel
handeln. Die Polizei geht von einem Sabotageakt aus. Die Strecke
soll bis Freitagmittag gesperrt bleiben. Die wichtige Bahnstrecke
der Deutschen Bahn zwischen Duisburg und Düsseldorf wurde
lahmgelegt, die mit massiven Beeinträchtigungen des Zugverkehrs,
sagte ein Bahnsprecher.
Die Störung werde voraussichtlich
noch bis Freitagmittag dauern. Ersatzverkehr mit Bussen ist
eingerichtet. Die Busse fahren zwischen den Hauptbahnhöfen Duisburg
und Düsseldorf sowie vom Duisburger Hbf zum Düsseldorfer Flughafen.
Die S1 und der RE2 fahren wegen der Störung nur bis Duisburg
Hauptbahnhof, nicht wie geplant bis Düsseldorf. Der RE3 fährt nur
zwischen Gelsenkirchen und Oberhausen. Auch hier fällt die
Teilstrecke bis Düsseldorf aus. Verschiedene weitere
Regionalexpresslinien werden zwischen Duisburg Hbf und Düsseldorf
Hbf umgeleitet, deshalb halten sie nicht am Düsseldorfer Flughafen.
Defektes Stellwerk in Duisburg: Übersicht der betroffenen
Linien auf der Strecke , die mit 700 bis 800 Verbindungen täglich
eine der wichtigsten bundesweit ist, so ein Bahnsprecher. Die
beschädigten Kabel sorgten außerdem für Störungen im Fernverkehr.
Betroffen seien die ICE-Linien nach Berlin und Frankfurt am
Main ebenso wie die Verbindungen in Richtung Norddeutschland,
Süddeutschland und in die Niederlande, teilte die Bahn mit. Es komme
zu Umleitungen und Verspätungen. Außerdem werden einzelne Bahnhöfe
nicht angefahren. Es dürften mehrere 10.000 Reisende von den
Bahnproblemen betroffen sein. Dementsprechend viele Menschen mussten
jetzt anderweitig ans Ziel kommen.
Kaum Verspätungen durch Sperrung der A59: Konzept der DVG für die
Linie 903 geht auf
Seit gestern Abend ist die A59 zwischen dem
Autobahnkreuz Duisburg-Nord und dem Autobahnkreuz Duisburg gesperrt.
Die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) zieht am ersten Tag
nach dem morgendlichen Berufsverkehr eine erste, positive Bilanz.
Die Straßenbahnlinien 903 und 901 fuhren in den
Morgenstunden ohne signifikante Verspätungen. Die DVG bittet deshalb
die Fahrgäste, während der Sperrung auch weiterhin die Linie 903 zu
nutzen. Da es zurzeit keinen Schulverkehr gibt, stellt die Linie 903
eine sinnvolle Alternative zum Individualverkehr dar.
Von
Verkehrsbehinderungen betroffen war zeitweise die Buslinie 916
aufgrund der im Berufsverkehr überlasteten Straßen im Bereich der
Aakerfährbrücke. Die Busse der Linie 916 waren durch den Stau
zeitweise mit bis zu 20 Minuten Verspätung unterwegs.
Sollte
es erforderlich sein, wird die DVG die durch den Entfall des SB40
verfügbaren Ressourcen auf anderen Linien als Unterstützung
einsetzen, um beispielsweise staubedingte Verspätungen aufgrund der
Autobahnsperrung auszugleichen.
Deutschland im Stau: Erstes August-Wochenende wird zur Geduldsprobe
Alle Bundesländer in den Ferien
Heimreiseverkehr
nimmt deutlich zu
Stauprognose vom 1. bis 3. August

©imago images/Steinsiek.ch
Das erste Augustwochenende dürfte
zu den staureichsten des Sommers zählen. Autofahrerinnen und
Autofahrer müssen sich auf erhebliche Verzögerungen einstellen,
sowohl auf dem Weg in den Urlaub als auch bei der Rückreise.
Besonders viele Reisende starten jetzt in die Ferien, da nun auch in
Baden-Württemberg und Bayern die Sommerferien beginnen. Damit sind
nun alle Bundesländer in den Ferien. Gleichzeitig nimmt der
Rückreiseverkehr deutlich zu, denn in zwei Wochen enden die Ferien
in den ersten Bundesländern.

Wer flexibel ist, sollte auf einen Reisetag unter der Woche
ausweichen, idealerweise zwischen Dienstag und Donnerstag. In der
Ferienzeit ist der Berufsverkehr werktags deutlich geringer, was
sich positiv auf den Verkehrsfluss auswirkt.
Bei gutem Wetter
sorgen zusätzlich zahlreiche Tagesausflügler und spontan Reisende
für Belastung auf den Straßen. Besonders häufig kommt es zu
Verzögerungen an den bundesweit 1.200 Baustellen.
Zur
Entlastung des Ferienverkehrs gilt auf den wichtigsten Autobahnen
ein Lkw-Fahrverbot für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen. Es greift an allen
Samstagen vom 1. Juli bis einschließlich 31. August, jeweils
zwischen 7 und 20 Uhr. Unverändert bleibt das ganzjährig geltende
Lkw-Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen - es gilt von 0 bis 22 Uhr
auf dem gesamten Straßennetz.
Staugefährdete Autobahnen (in
beiden Richtungen)
• Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee
• A1 Köln – Dortmund sowie Bremen – Hamburg
• A3 Frankfurt –
Nürnberg – Passau
• A4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden
• A5 Frankfurt – Karlsruhe – Basel
• A6 Mannheim – Nürnberg
•
A7 Hamburg – Flensburg sowie Würzburg – Füssen/Reutte
• A8
Karlsruhe – München – Salzburg
• A9 Berlin – Nürnberg – München
• A10 Berliner Ring
• A11 Berlin – Dreieck Uckermark
• A19
Dreieck Wittstock – Rostock
• A24 Hamburg – Berlin
• A61
Mönchengladbach – Ludwigshafen
• A81 Stuttgart – Singen
• A93
Inntaldreieck – Kufstein
• A95/B2 München –
Garmisch-Partenkirchen
• A96 München – Lindau
• A99 Umfahrung
München
Auch auf den europäischen Ferienrouten ist Geduld
gefragt, sowohl bei der An- als auch bei der Rückreise. Besonders
staugefährdet sind die Transitrouten in und durch Österreich, die
Schweiz, Italien und Frankreich.
Zu den Problemstrecken
zählen im Reisesommer unter anderem Tauern-, Inntal-, Rheintal-,
Pyhrn-, Fernpass-, Brenner-, Karawanken- und Gotthard-Route sowie
die Fernstraßen zu den italienischen, kroatischen und französischen
Küsten.
Auch bei Reisen nach Nordeuropa muss mit
Verzögerungen gerechnet werden, ebenso auf den Hauptachsen aus und
in Richtung Polen, Tschechien und die Niederlande.
An
zahlreichen Grenzübergängen finden weiterhin stichprobenartige
Kontrollen statt. Die Schwerpunkte deutscher Kontrollen liegen an
den Grenzen zu Österreich, Polen, Tschechien, Frankreich und der
Schweiz. Wartezeiten von 30 bis 60 Minuten sind keine Seltenheit.
Auch Polen kontrolliert bei der Einreise. Mit Staus ist etwa an den
Grenzübergängen A4 Ludwigsdorf (Görlitz), A11 Pomellen (Stettin),
A12 Frankfurt (Oder) und A15 Forst zu rechnen.
Reisende, die
nach Griechenland oder in die Türkei fahren, müssen mit längeren
Aufenthalten an den Grenzen rechnen, die teilweise mehrere Stunden
dauern können.
Gute Arbeitsbedingungen für
Paketboten und Kuriere - Bundesministerin Bärbel Bas begrüßt
Entfristung des Paketboten-Schutz-Gesetzes
Das
Bundeskabinett hat heute ein Gesetz beschlossen, das die europäische
Maschinenverordnung in Deutschland durchführbar macht und damit
wesentlich zur Planungssicherheit der deutschen Wirtschaft beiträgt.
Darüber hinaus enthält das Gesetz eine Regelung zur Entfristung des
ansonsten Ende 2025 auslaufenden Gesetzes zur Einführung einer
Nachunternehmerhaftung in der Kurier-, Express- und Paketbranche zum
Schutz der Beschäftigten (Paketboten-Schutz-Gesetz).
Eine
zum Jahreswechsel 2023/2024 von der Bundesregierung vorgelegte
Evaluierung zeigt, dass die Nachunternehmerhaftung für
Sozialversicherungsbeiträge in dieser Branche wirkt. Die Entfristung
der Regelung ist ein weiterer Baustein zur Förderung der
Beitragsehrlichkeit und des fairen Wettbewerbs in der Paketbranche.
Mit dem am 23. November 2019 in Kraft getretenen
Paketboten-Schutz-Gesetz wurde die Nachunternehmerhaftung für
Sozialversicherungsbeiträge für die stark wachsende Kurier-,
Express- und Paketbranche eingeführt.
Ziel des Gesetzes war
es, Paketdienstleister durch die Einführung der
Generalunternehmerhaftung zu einer sorgfältigeren Auswahl der von
ihnen beauftragten Nach- bzw. Subunternehmer anzuhalten. Dadurch
sollten Missstände in der Branche wie Schwarzarbeit und illegale
Beschäftigung bekämpft und die Solidargemeinschaft vor
Beitragsausfällen geschützt werden.
Die Regelung wurde
zunächst mit einer befristeten Gültigkeit bis zum 31. Dezember 2025
beschlossen. Nach heutigem Kabinettsbeschluss soll sie entfristet
werden und geht jetzt ins parlamentarische Verfahren.

©
Foto F. Pinjo / BMAS.
Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas:
„Paketboten arbeiten hart, um uns das Leben zu erleichtern. Mit dem
Paketboten-Schutz-Gesetz aus dem Jahr 2019 haben wir Missbrauch und
mangelnder Zahlungsmoral einen Riegel vorgeschoben. Die Regelung
fördert den fairen Wettbewerb in der Branche und hat zu mehr
ordentlicher Beschäftigung geführt. Deshalb entfristen wir die
Regelung jetzt, damit die Paketbotinnen und Paketboten weiter von
dieser positiven Entwicklung profitieren.“
73.
Stadtranderholung 2025 startet am 4. August
Mit Beginn
der zweiten Ferienhälfte startet am 4. August die 73.
Stadtranderholung. Die Ferienfreizeit des Jugendamtes bietet an
insgesamt 18 Standorten, die über das ganze Stadtgebiet verteilt
sind, über 1.500 Kindern drei Wochen lang ein buntes Ferienprogramm.
TÜV-Verband begrüßt NIS-2-Umsetzung – und fordert
Nachbesserungen
Nationales Umsetzungsgesetz der
EU-Richtlinie führt zu höherer Cybersicherheit in der deutschen
Wirtschaft. Ausnahmeregelungen schärfen oder streichen. Unternehmen
sollten klare Vorgaben haben, wie Nachweise für die Umsetzung zu
erbringen sind.
Das Bundeskabinett hat am 30. Juli 2025 das
nationale Umsetzungsgesetz der europäischen NIS-2-Richtlinie
beschlossen.
Dazu sagt Marc Fliehe, Fachbereichsleiter
Digitalisierung und Bildung beim TÜV-Verband: „Deutschland ist Ziel
hybrider Angriffe und Cyberattacken auf Unternehmen, kritische
Infrastrukturen und politische Institutionen gehören zur
Tagesordnung. Die Umsetzung der NIS-2-Richtlinie in nationales Recht
ist ein wichtiger Schritt, um die Cybersicherheit in der deutschen
Wirtschaft zu verbessern. Das Gesetz ist längst überfällig und muss
angesichts der Bedrohungslage im Cyberraum zügig beschlossen werden.
Mit dem aktuellen Entwurf liegt eine solide Grundlage vor – jetzt
braucht es den politischen Willen, offene Punkte im
parlamentarischen Verfahren konstruktiv und schnell zu klären.“
Aus Sicht des TÜV-Verbands ist es nun Aufgabe des Bundestags,
den Gesetzesentwurf an entscheidenden Stellen zu schärfen, um die
Wirksamkeit in der Praxis zu erhöhen. Besonders relevant sind dabei
folgende Punkte:
1. Ausnahmeregelungen klar definieren oder
streichen
Aus Sicht des TÜV-Verbands wirft die neu eingeführte
Ausnahme für „vernachlässigbare“ Geschäftstätigkeiten erhebliche
Fragen auf.
Der Begriff ist unbestimmt und wird im Gesetz
nicht näher definiert. Es bleibt unklar, nach welchen Kriterien eine
Tätigkeit als vernachlässigbar gelten soll. „Ohne präzise Vorgaben
besteht die Gefahr uneinheitlicher Auslegung und einer
Rechtsunsicherheit für Unternehmen“, sagt Fliehe. Zudem könnte diese
nationale Sonderregelung zu einem faktischen Ausschluss
regulierungspflichtiger Tätigkeiten führen, die laut
NIS-2-Richtlinie eigentlich erfasst sein sollten.
Der
TÜV-Verband sieht daher die Gefahr, dass der deutsche Gesetzgeber
mit dieser Öffnungsklausel vom europäischen Harmonisierungsziel
abweicht und fordert eine eindeutige und EU-rechtskonforme
Ausgestaltung dieser Ausnahme.
2. Nachweispflichten
überarbeiten
In der NIS-2-Richtlinie ist eine regelmäßige
Nachweispflicht für „besonders wichtige Einrichtungen“ vorgesehen,
die aus Sicht des TÜV-Verbands im deutschen Gesetz nicht ausreichend
umgesetzt ist. „In der Praxis läuft es auf stichprobenartige
Einzelfallprüfungen hinaus, was nicht der Intention der Richtlinie
entspricht und sicherheitstechnisch bedenklich ist“, sagt Fliehe.
„Die Behörden müssen die Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen
überprüfen und durchsetzen können.“
In diesem Zusammenhang
sieht der TÜV-Verband auch die Verlängerung der Nachweisfristen für
die Betreiber kritischer Infrastrukturen von zwei auf drei Jahre
sehr negativ. Fliehe: „Die Betreiber kritischer Infrastrukturen sind
regelmäßig gezielten Cyberangriffen ausgesetzt. Eine Verlängerung
des Nachweiszyklus ist vor diesem Hintergrund mehr als
kontraproduktiv.“
3. Vertrauen schaffen durch unabhängige
Zertifizierungen
Nur bei Einbindung unabhängiger Dritter ist aus
Sicht des TÜV-Verbands sichergestellt, dass das notwendige Vertrauen
in die Umsetzung von Cybersicherheitsanforderungen geschaffen werden
kann. Deshalb regt der TÜV-Verband an, Zertifizierungen durch
akkreditierte und unabhängige Konformitätsbewertungsstellen
verbindlich in dem Prozess der Nachweiserbringung (§ 39 BSIG-E)
durch die Hersteller vorzusehen.
4. Absicherung der
Lieferketten ausformulieren
Mit Blick auf die weitgefassten
Formulierungen zur Absicherung der Lieferkette ist es erforderlich,
den Unternehmen eine Handreichung und Orientierungshilfe zur
Gestaltungstiefe der Maßnahmen zur Absicherung der Lieferkette an
die Hand zu geben. In diesem Sinne ist beispielsweise die Forderung
„Security by Design“ recht vage und bedarf weiterer Detaillierungen.
Eine Orientierungshilfe kann sowohl Mindestmaßnahmen
aufzeigen als auch Interpretations- und Auslegungsspielräume
reduzieren und leistet somit einen Beitrag zur Erhöhung der Klarheit
und Handlungssicherheit der Verpflichteten.
Hintergrund: Das
NIS-2-Umsetzungsgesetz (NIS2UmsuCG) gilt für rund 30.000 Unternehmen
in Deutschland. Es verpflichtet die Unternehmen unter anderem zur
Durchführung und Einführung von Risikoanalysen und
Sicherheitskonzepten, Maßnahmen zur Vorbeugung und Reaktion auf
IT-Sicherheitsvorfälle, Zugangskontrollen, Verschlüsselung,
Multi-Faktor-Authentifizierung, Mitarbeiterschulungen, Notfallplänen
sowie Maßnahmen für die Absicherung der Lieferkette. Diese
Anforderungen müssen „dem Stand der Technik“ entsprechen und
unterscheiden sich je nach Größe, Branche und Kritikalität des
Unternehmens.
Ausbildungslücke belastet KMU –
DMB-Vorstand Tenbieg: „Koalition muss Zusagen einhalten und schnell
handeln.“
Anlässlich des Ausbildungsstarts am 1. August
fordert der Deutsche Mittelstands-Bund (DMB) die Bundesregierung
auf, ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag einzulösen und die
berufliche Ausbildung nachhaltig zu stärken. „Für den Mittelstand
ist es essenziell, dass die Ausbildungslücke nicht noch dramatischer
zunimmt“, sagt Marc S. Tenbieg, geschäftsführender DMB-Vorstand.
Im vergangenen Jahr blieben mehr als ein Drittel der
Ausbildungsstellen unbesetzt, gleichzeitig finden viele junge
Menschen keinen Ausbildungsplatz – die Ausbildungslücke vergrößert
sich somit von Jahr zu Jahr. Darunter leiden insbesondere kleine und
mittlere Unternehmen. Denn diese Betriebe stellen die überwiegende
Mehrheit der Ausbildungsplätze. Aus Sicht des DMB muss die
Bundesregierung dringend Maßnahmen ergreifen, um das Passungsproblem
auf dem Ausbildungsmarkt zu lösen.
Marc S. Tenbieg,
geschäftsführender DMB-Vorstand, betont: „Die Bundesregierung hat
sich im Koalitionsvertrag zum Ziel gesetzt, dass jeder junge Mensch
eine Ausbildung absolvieren kann. Das ist lobenswert – aktuell sind
wir von diesem Ziel jedoch noch weit entfernt. Bei der praktischen
Berufsausbildung erleben wir eine verkehrte Welt: Obwohl gerade in
mittelständischen Betrieben Fachkräfte fehlen, absolvieren immer
mehr junge Menschen keine Ausbildung.

Foto DMB
Als Mittelstandsverband begrüßen wir das Vorhaben
von Union und SPD, die Berufsorientierung in Schulen sowie die
Jugendberufsagenturen zu stärken. Allerdings darf es nicht bei
politischen Lippenbekenntnissen bleiben – die Umsetzung von
zielführenden und vermittelnden Maßnahmen auf dem Ausbildungsmarkt
muss schnellstmöglich erfolgen. Für den Mittelstand ist es
essenziell, dass die Ausbildungslücke nicht noch dramatischer
zunimmt.“
Verbundausbildung muss gefördert werden
Akuter
Handlungsbedarf besteht aus Verbandsperspektive vor allem in der
besseren Vernetzung zwischen Ausbildungsbetrieben und Schulen. „Hier
spielen die Jugendberufsagenturen als Bindeglied eine
Schlüsselrolle, sie müssen gezielt gefördert werden“, sagt Tenbieg.
Der Verbands-Vorstand spricht sich zudem für die Förderung der
sogenannten Verbundausbildung aus, bei der sich mehrere Betriebe bei
der praktischen Berufsausbildung ergänzen.
„Gerade im
ländlichen Raum kann die Kooperation von Unternehmen ein sinnvoller
Weg sein, um jungen Menschen einen erfolgreichen Einstieg ins
Berufsleben zu ermöglichen. Dafür braucht es neben der Bereitschaft
der Unternehmen aber auch die entsprechende Unterstützung durch die
Kommunen.“
Eine aktuelle repräsentative Umfrage im Auftrag
des DMB zeigt: KMU können vor allem durch ihre regionale
Verwurzelung, flache Hierarchien und den starken Zusammenhalt unter
den Mitarbeitenden punkten. „Der Mittelstand genießt einen
exzellenten Ruf in der Bevölkerung. Nun gilt es insbesondere jungen
Menschen diese Vorteile näherzubringen, um im Wettbewerb um Talente
erfolgreich zu sein“, sagt Tenbieg.
Der Deutsche
Mittelstands-Bund (DMB) e.V. ist der Bundesverband für kleine und
mittelständische Unternehmen in Deutschland. Der DMB wurde 1982
gegründet und sitzt in Düsseldorf. Unter dem Leitspruch „Wir machen
uns für kleine und mittelständische Unternehmen stark!“ vertritt der
DMB die Interessen seiner rund 33.000 Mitgliedsunternehmen mit über
800.000 Beschäftigten.
Damit gehört der DMB mit seinem
exzellenten Netzwerk in Wirtschaft und Politik zu den größten
unabhängigen Interessen- und Wirtschaftsverbänden in Deutschland.
Der Verband ist politisches Sprachrohr und Dienstleister zugleich,
unabhängig und leistungsstark.
Spezielle Themenkompetenz
zeichnet den DMB in den Bereichen Digitalisierung, Nachfolge,
Finanzen, Internationalisierung, Energiewende und Arbeit & Bildung
aus. Als dienstleistungsstarker Verband bietet der DMB seinen
Mitgliedsunternehmen zudem eine Vielzahl an Mehrwertleistungen.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.mittelstandsbund.de.
MSV Duisburg – VfB Stuttgart II: DVG setzt
zusätzliche Busse ein
Für Gäste des Fußballspiels MSV
Duisburg gegen den VfB Stuttgart II am Samstag, 2. August, um 16.30
Uhr in der Schauinsland-Reisen Arena, setzt die DVG ihre Sportlinie
945 ein.
Abfahrtszeiten Buslinie 945 Richtung MSV Arena:
ab
„Salmstraße“ (Meiderich) Abfahrt um 14.36, 14.46, 14.56 Uhr
ab
„Bergstraße“ um 14.41, 14.51 und 15.01 Uhr
ab „Meiderich Bahnhof“
ab 14.45 bis 15.10 Uhr alle fünf Minuten
ab „Großenbaum Bahnhof
Ost“ um 15.20 und 15.35 Uhr
ab „Betriebshof am Unkelstein“ ab
14.28 bis 14.53 Uhr alle fünf Minuten
ab Hauptbahnhof
(Verknüpfungshalle) ab 14.40 bis 16.05 Uhr alle fünf Minuten
ab
„Businesspark Nord“ (Asterlagen) um 15.03 Uhr .

DVG-Foto
Nach Spielende stehen am Stadion Busse für die Rückfahrt bereit.
Gäste des Fußballspieles, die eine Tageseintrittskarte im Vorverkauf
erworben haben oder eine Dauerkarte besitzen, können kostenlos die
öffentlichen Verkehrsmittel für die Hin- und Rückfahrt benutzen. Für
die Gäste, die sich an der Stadionkasse ihre Eintrittskarte kaufen,
ist die Rückfahrt mit Bus und Bahn kostenlos.
Die
richtigen Worte im richtigen Moment finden Freier Redner:
Zertifikatslehrgang startet im August
Geburt,
Hochzeit, Abschied – besondere Lebensereignisse verdienen besondere
Worte. Freie Redner begleiten Menschen dabei: mit einfühlsamen
Texten und dem richtigen Gespür. Der Zertifikatslehrgang der
Niederrheinischen IHK „Freier Redner (IHK)“ vermittelt das nötige
Handwerkszeug.
Der Kurs umfasst 50 Unterrichtseinheiten
und richtet sich an alle, die Reden professionell gestalten möchten.
Die Teilnehmer lernen, Sprache gezielt einzusetzen, ihren eigenen
Stil zu entwickeln und wirkungsvoll aufzutreten. Im Mittelpunkt
stehen praxisnahe Übungen, bei denen Schritt für Schritt eine eigene
Rede entsteht. Diese wird zum Abschluss des Lehrgangs präsentiert.
Der Lehrgang startet am 30. August als
Blended-Learning-Format. Die Teilnehmer kommen teils nach Duisburg,
teils lernen sie über Microsoft Teams. Der Unterricht findet
samstags von 9:00 bis 18:00 Uhr sowie einmal freitags von 13:00 bis
17:00 Uhr statt. Das Seminar endet am 27. September. Bei
erfolgreicher Teilnahme gibt es ein IHK-Zertifikat.
Fragen
beantwortet Sabrina Althoff unter Tel. 0203 2821-382 oder per E-Mail
an althoff@niederrhein.ihk.de. Anmeldung und weitere Informationen:
www.ihk.de/niederrhein/veranstaltungen
Lehmbruck-Museum feiert das Keltische
Schnitterfest Lughnasadh
Das
Lehmbruck-Museum feiert am 1. August ab 17 Uhr Lughnasadh, das
keltische Schnitterfest, das den Beginn der Erntezeit markiert. Die
Besucher können gemeinsam essen oder picknicken, dafür sind unter
freiem Himmel Tische aufgestellt (Reservierung erforderlich).
Zum Programm gehören Kurzführungen durch die Ausstellung
"Mechanik und Menschlichkeit. Eva Aeppli und Jean Tinguely"; eine
Lesung und Musik runden den Abend ab.

Foto: Museum
Lughnasadh – das keltische Erntedankfest oder
Schnitterfest – feiert den Beginn der Erntezeit. Es ist ein Fest der
Fülle, aber auch des Abschieds: Was reif ist, wird geschnitten. Was
vergeht, macht Raum für Neues. Im Dialog mit diesem alten Fest
treffen die Werke von Eva Aeppli und Jean Tinguely auf besondere
Resonanz.
Das Museum greift die Tradition des alten
Erntefests auf und ladt zu einem stimmungsvollen Open-Air-Event ein.
Kunst und Natur verbinden sich mit der eigenwilligen, poetischen
Welt von Eva Aeppli und Jean Tinguely. Gemeinsam soll es ein
sommerlicher Abend voller Farben und Sinnlichkeit geben.
Programm:
Ein sommerlich geschmücktes Ambiente mit gedeckten
Tischen unter freiem Himmel Kurzführungen zur Ausstellung „Mechanik
und Menschlichkeit. Eva Aeppli und Jean Tinguely“ Gemeinsames Essen
oder Picknick: Reservieren Sie im Vorfeld Ihren Tisch und bringen
Sie Ihr Lieblingsessen selbst mit! Sollte kein Platz mehr frei sein,
können Sie sich eine Picknickdecke mitbringen.
Auch
unangemeldete Gäste sind herzlich willkommen! Für sie stehen Brot
und Bier bereit – zum Teilen, und Verweilen. Eine Lesung und
Musik begleiten den Abend. Tischreservierungen nimmt das Team der
Kunstvermittlung telefonisch unter 0203 283 2195 oder per E-Mail an
kunstvermittlung@lehmbruckmuseum.de entgegen. Es gilt: Pay What You
Want! Sie können an diesem Tag ihren Eintrittspreis selbst
festlegen.
Hinschauen und erinnern: Eine Führung zu Schwarzen
Perspektiven auf postkoloniale Spuren
Das „Zentrum für
Erinnerungskultur“ lädt am Sonntag, 3. August, um 15 Uhr zu einem
Rundgang durch die Ausstellung „ÜBERSEeHEN, im Kultur- und
Stadthistorischen Museum, auf (post)kolonialer Spurensuche in
Duisburg“.
Welche Geschichten erzählen Schwarze Menschen aus
Duisburg über Kolonialismus, Widerstand und Kontinuitäten bis heute?
Wie hängen globale Bewegungen wie „Black Lives Matter“ mit
lokalen Erinnerungsräumen zusammen?
Welche Rolle spielen
Schwarze Netzwerke, Bildungsarbeit und Kinderliteratur in der
postkolonialen Auseinandersetzung?

Naomi Dibu - Foto Tanaj Pickartz
Die Führung mit der
Aktivistin, Politikwissenschaftlerin und kuratorischen Assistentin
Naomi Dibu nimmt die koloniale Geschichte Duisburgs aus einer
schwarzen, widerständigen Perspektive in den Blick. Neben der
Auseinandersetzung mit lokalen kolonialen Spuren beleuchtet Naomi
Dibu insbesondere die Perspektiven und Erfahrungen Schwarzer
Menschen.
Im Zentrum stehen dabei Fragen der Sichtbarkeit,
Selbstermächtigung und der historisch gewachsenen Rassifizierung
Schwarzer Körper. Bezug genommen wird unter anderem auf die Arbeit
von Organisationen wie Phoenix e.V. und CEBIE, auf Erinnerungsarbeit
in Kinderbüchern sowie auf gegenwärtige Formen des Widerstands – von
Workshops bis zur „Black Lives Matter“-Bewegung in Deutschland.
Der Rundgang versteht sich als Einladung, Schwarze Geschichte
und Gegenwart neu zu lesen – als Teil der Stadtgeschichte Duisburgs
und als Ausdruck fortdauernder Kämpfe um Anerkennung und
Gerechtigkeit. Die Führung ist im Museumseintritt enthalten. Um
Anmeldung wird gebeten unter zfe@stadt-duisburg.de oder unter Tel.
0203-283 2640
Balkonkraftwerke: Kleine
Kraftpakete für große Wirkung
Wer Strom selbst
erzeugt, spart bares Geld – und leistet gleichzeitig einen wichtigen
Beitrag zur Energiewende. Mit einem Balkonkraftwerk gelingt der
Einstieg besonders einfach. Die Stadtwerke Duisburg informieren,
warum sich die Investition für nahezu jedermann lohnt. Und das gilt
auch für Mieterinnen und Mieter in Wohnungen. Balkonkraftwerke
sind kompakte Photovoltaik-Anlagen, die auf dem Balkon, der Terrasse
oder dem Flachdach installiert werden können.
Der gewonnene
Strom wird direkt in den eigenen Haushalt eingespeist und reduziert
so den Bedarf an Strom aus dem öffentlichen Netz. Der besondere
Vorteil: Für die Installation sind weder aufwendige Technik noch
bauliche Veränderungen nötig. Die Inbetriebnahme erfolgt in wenigen
Schritten – und wer unsicher ist, kann sich bei den Stadtwerken
Duisburg beraten lassen.
Wie viel bringt ein
Balkonkraftwerk wirklich? Je nach Wetterlage und Jahreszeit variiert
der Ertrag. An einem sonnigen Tag im Juni oder Juli erzeugt ein
Balkonkraftwerk auf dem Flachdach bis zu 5 Kilowattstunden (kWh)
Strom – das reicht beispielsweise aus, um einen handelsüblichen
Kühlschrank über zwei Wochen lang zu betreiben oder mehrere
Waschladungen zu erledigen. Auch bei bewölktem Himmel sind bis zu 2
kWh Tagesertrag möglich.
Im Jahresdurchschnitt kommen so
rund 600 kWh zusammen, von denen etwa 400 kWh direkt selbst genutzt
werden können – der Rest ist Überschuss und wird ins öffentliche
Stromnetz eingespeist.
Zum Vergleich: Ein
1-Personen-Haushalt verbraucht etwa 1.500 kWh im Jahr. Mit einem
Balkonkraftwerk lassen sich davon rund 400 kWh einsparen In einem
4-Personen-Haushalt liegt der Verbrauch bei ca. 4.500 kWh. Hier
können jährlich 500 kWh durch Sonnenenergie ersetzt werden.

Auch Mieterinnen und Mieter können mit einem Balkonkraftwerk
schnell und unkompliziert in die eigene Stromerzeugung einsteigen.
Foto Stadtwerke Duisburg
Alltagstaugliche Entlastung für
jede Wohnung
Die Stromerzeugung erfolgt über den Tag verteilt,
vor allem zwischen 9 und 19 Uhr. Das deckt typischerweise den
Strombedarf für Licht, Computer, Fernseher oder Kühlschrank. An
sonnigen Tagen im Sommer kann in einem 1-Personen-Haushalt bis zu
drei Viertel des Tagesverbrauchs gedeckt werden. Auch ein
4-Personen-Haushalt kann immerhin ein Drittel des Tagesbedarfs
selbst erzeugen. Mit einem Balkonkraftwerk wird also Strom genau
dann erzeugt, wenn er gebraucht wird – ganz ohne komplizierte
Technik oder Speicherlösungen.
Die Stadtwerke Duisburg
unterstützen beim Einstieg Die Stadtwerke Duisburg bieten komplette
Balkonkraftwerk-Pakete inklusive Solarmodul, Wechselrichter und
Zubehör an – ideal für Einsteigerinnen und Einsteiger. Mit der
Stadtwerke-Kundenkarte profitieren Interessierte von besonderen
Angeboten:
https://www.stadtwerke-duisburg.de/privatkunden/energiedienstleistungen/balkonkraftwerk-kundenkartenangebot.
In Kombination mit einem passenden Stromtarif gibt es das
Balkonkraftwerk sogar im rundum-sorglos-Paket:
www.stadtwerke-duisburg.de/pv-kombi
Wärmepumpen-Run statt Zwang
Deutsche
Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer sind bereit für die hauseigene
Energiewende: Bis 2029 wollen vier von zehn eine Wärmepumpe zum
Heizen nutzen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage
des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Initiative
Klimaneutrales Deutschland. Der Anteil der selbstgenutzten
Eigenheime mit Wärmepumpe könnte sich mehr als verdoppeln und damit
eine enorme Nachfragewelle auslösen, von der Handwerk und
Mittelstand profitieren.
Derzeit heizen laut der
Allensbach-Umfrage 15 Prozent der selbstnutzenden Hausbesitzerinnen
und -besitzer in Deutschland mit einer Wärmepumpe. Bis 2029 könnte
sich diese Zahl mehr als verdoppeln, auf fast 40 Prozent. Dass viele
von ihnen gerade ihre Pläne in die Tat umsetzen, zeigen aktuelle
Zahlen des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie BDH: Im
ersten Halbjahr 2025 wurden erstmals mehr Wärmepumpen verkauft als
Gasheizungen.
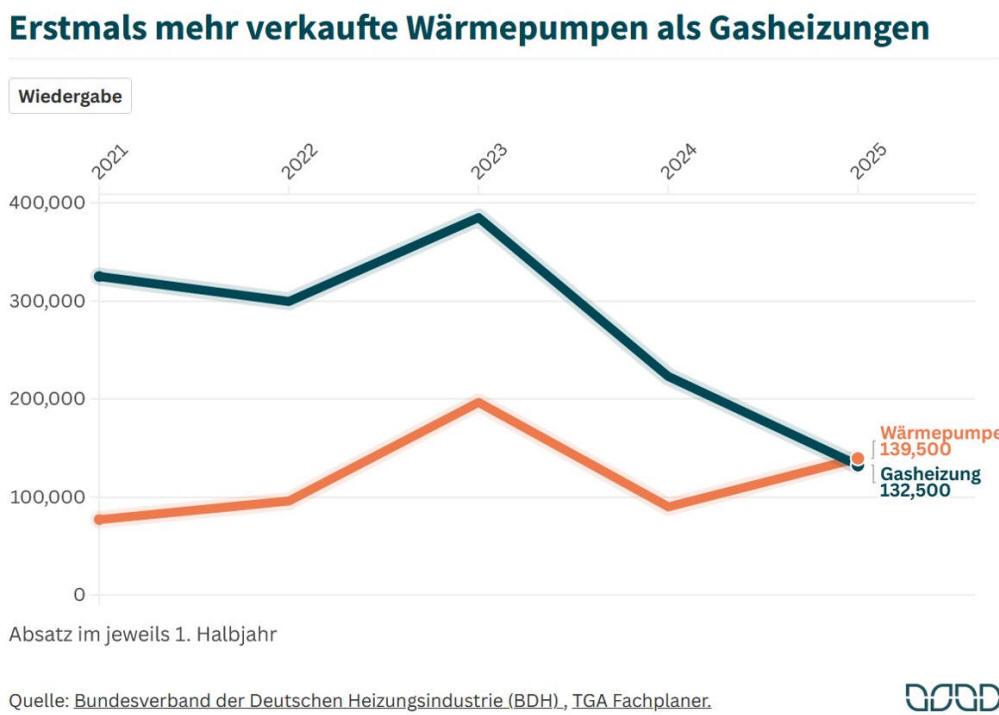
Milliardenpotenzial für den deutschen Mittelstand
Deutschlandweit wohnen rund 13,5 Millionen Haushalte im eigenen
Haus. Wenn sich die Anschaffungspläne aus der Umfrage realisieren,
könnten allein in den kommenden Jahren über drei Millionen
zusätzliche Wärmepumpen installiert werden – das bisherige bisherige
Spitzenjahr 2023 kommt auf 356.000 verkaufte Anlagen. Für Hersteller
und Installateure bedeutet das ein riesiges Umsatzpotenzial. In
wirtschaftlich herausfordernden Zeiten eine gute Botschaft.
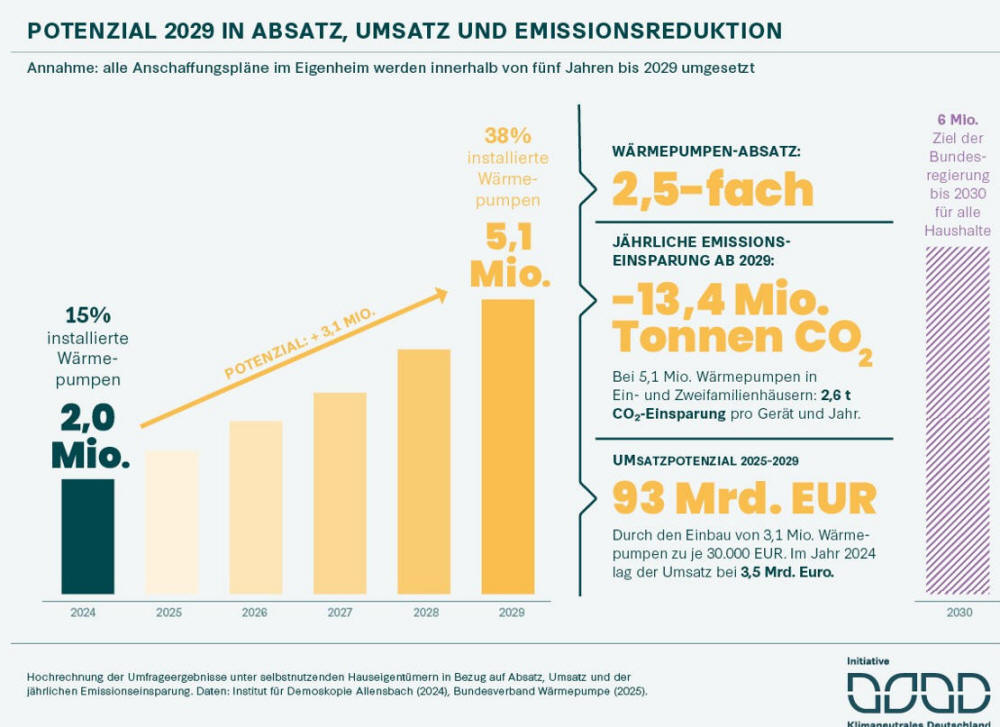
Carolin Friedemann, Gründerin und Geschäftsführerin der IKND,
bewertet die Daten wie folgt: „Immer mehr Hausbesitzende entscheiden
sich aus Überzeugung für eine Wärmepumpe, denn sie wünschen sich
Unabhängigkeit von Öl und Gas und sie sehen, dass sich die
Investition rechnet. Derzeit sehen wir einen echten Wärmepumpen-Run
– ganz ohne Zwang. Um diesen Trend zu verstetigen, braucht es nun
Planungssicherheit statt Signale des Rückschritts. Verunsicherung
ist Gift für Heizkosten, Mittelstand und Klima.“
Wärmepumpen
als Motor für Klimaschutz
Der vor Kurzem bekanntgewordene
Klimaschutzbericht 2025 des Bundesumweltministeriums konstatiert
erneut, dass der Gebäudesektor zu viele Emissionen verursacht. Ohne
eine Senkung der Treibhausgase in diesem Bereich sind die Klimaziele
nicht zu schaffen. Sollte sich die Anschaffungspläne für Wärmepumpen
der Hausbesitzenden bis 2029 materialisieren, könnten allein diese
Haushalte jährlich ein Zehntel der heutigen Emissionen im
Gebäudesektor einsparen.
Methodik
Die Umfrage wurde im
Herbst 2024 vom Institut für Demoskopie Allensbach durchgeführt.
Befragt wurden 4.089 Hausbesitzer ab 18 Jahren, die im eigenen Haus
wohnen. Die Befragung wurde online durchgeführt. Sie ist
repräsentativ für die Gesamtheit aller Hausbesitzer in Deutschland,
die im eigenen Haus wohnen.
Bei 17,3 Millionen Haushalten
(lt. Zensus), die in Ein- oder Zweifamilienhäusern leben, und einer
Eigentumsquote von 78 Prozent entspricht das rund 13,5 Millionen
Haushalten.
TÜV-Verband: Partikelmessung zieht
viele defekte Dieselfahrzeuge aus dem Verkehr
Wichtiger
Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität. Prüforganisationen werten
4,5 Millionen Abgasuntersuchungen aus. 3 Prozent der Fahrzeuge
fallen mit erheblichen Mängeln durch. TÜV-Verband fordert
Partikelmessung für weitere Emissionsklassen.
Die Messung der
Partikelkonzentration (PN-Messung) bei der Abgasuntersuchung (AU)
von Fahrzeugen zeigt Wirkung. Seit Juli 2023 wird bei Pkw und Lkw
mit Dieselmotor ab der Emissionsklasse Euro 6/VI eine neue
Messmethode direkt am Auspuff-Endrohr angewendet, um die
gesundheits- und umweltschädliche Feinstaubkonzentration in den
Abgasen zu ermitteln.
Im Jahr 2024 sind in Deutschland in
der Emissionsklasse Euro 6/VI fast 4,5 Millionen Dieselfahrzeuge
geprüft worden. 3,0 Prozent haben die Abgasuntersuchung im ersten
Anlauf nicht bestanden. In absoluten Zahlen entspricht das rund
132.600 Fahrzeugen. Das hat eine gemeinsame Auswertung der
TÜV-Prüforganisationen sowie DEKRA, GTÜ, KÜS und der anerkannten
AU-Werkstätten ergeben. „Mit der Partikelmessung werden Fahrzeuge
mit defekten oder manipulierten Abgasreinigungssystemen sicher
erkannt und aus dem Verkehr gezogen“, sagt Robin Zalwert, Referent
für nachhaltige Mobilität beim TÜV-Verband.
Mängel wie
defekte Dieselpartikelfilter oder fehlerhafte Sensoren müssen
innerhalb von vier Wochen behoben und das Fahrzeug erneut vorgeführt
werden. Zalwert: „Die PN-Messung trägt zur Verbesserung der
Luftqualität bei und leistet damit einen wichtigen Beitrag für
Gesundheit, Umwelt und Klima.“
Besonders wichtig sei, dass
bei den Abgasmessungen so genannte „Groß-Verschmutzer“ (Gross
Polluter) identifiziert werden. Studien haben gezeigt, dass ein
Groß-Verschmutzer-Anteil von nur fünf Prozent des Fahrzeugbestandes
für rund ein Viertel aller verkehrsbedingten Schadstoffemissionen
verantwortlich sein kann.
Mängelquoten an der Abgasanlage
steigen mit dem Alter
Laut den Ergebnissen der Auswertung steigt
die Mängelquote bei der Abgasuntersuchung mit dem Alter der
Fahrzeuge. Bei den unter 5 Jahre alten Fahrzeugen liegt sie bei 2,0
Prozent, bei 5 bis 10 Jahre alten Fahrzeugen beträgt sie 4,0 Prozent
und bei Fahrzeugen, die älter als 10 Jahre sind, liegt sie mit 6,1
Prozent weit über dem Durchschnitt.
„In den kommenden Jahren
wird der aktuell noch geringe Anteil älterer Euro-6-Fahrzeuge stetig
ansteigen“, sagt Zalwert. Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes
(KBA) steigt das Durchschnittsalter der Pkw in Deutschland stetig
und liegt derzeit bei 10,6 Jahren.
„Die Halter älterer Autos
sind aufgefordert, in die Pflege ihrer Fahrzeuge zu investieren und
dabei die Abgassysteme im Auge zu behalten“, sagt Zalwert.
„Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Fahrzeug bei der HU und AU
durchfällt.“ Positiv wertet Zalwert, dass Nutzfahrzeuge mit einem
zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen mit einer
Mängelquote von 2,2 Prozent unter dem Durchschnitt liegen „Das
spricht für einen insgesamt guten Zustand des Lkw-Bestands in
Deutschland, der sich aus einer Kombination aus regelmäßiger Wartung
und unabhängigen Prüfungen ergibt“, sagt Zalwert.
Viele
Defekte wären ohne Endrohrmessung unentdeckt geblieben
Die
Analyse der Abgasuntersuchungen hat ergeben, dass nur etwa ein
Drittel der bei der Endrohrmessung festgestellten Mängel auch mit
dem elektronischen Fahrzeugdiagnosesystem entdeckt worden wären.
Zwei Drittel der Defekte wären dagegen mit einer reinen
On-Board-Diagnose (OBD) unentdeckt geblieben. Vor Einführung der
neue Messmethode gab es eine intensive Diskussion über den Sinn der
Endrohrmessung. Kritiker waren der Ansicht, die OBD reiche aus. „Die
PN-Messung am Endrohr hat ihre Wirksamkeit eindrucksvoll unter
Beweis gestellt“, sagt Zalwert.
Aus Sicht des TÜV-Verbands
und der anderen Prüforganisationen ist die Partikelmessung ein
Erfolgsmodell, das auf weitere Emissionsklassen ausgeweitet werden
sollte. Insbesondere Dieselfahrzeuge der Emissionsklasse Euro-5b
kommen dafür in Frage. Zalwert: „In dieser Fahrzeuggruppe ist davon
auszugehen, dass sich im Straßenverkehr noch zahlreiche hoch
emittierende Dieselfahrzeuge befinden. Die Einführung einer
PN-Messung auch hier wäre ein konsequenter und wirksamer Schritt zur
weiteren Verbesserung der Luftqualität.“
Das vollständige
Auswertung der Abgasuntersuchungen ist abrufbar unter:
https://www.tuev-verband.de/positionspapiere/technische-fahrzeugueberwachung-durch-partikelanzahlmessung-staerken
Volkspark Rheinhausen: Sonntagskonzert mit der
Musikgruppe Wahre Freunde
Die Musikgruppe Wahre Freunde
ist am kommenden Sonntag, 3. August, um 15 Uhr im Volkspark
Rheinhausen beim Sonntagskonzert zu Gast. Die Gruppe präsentiert
Volksmusik, Schlager und gefühlvolle Songs zum Mitsingen, verpackt
mit einer großen Prise Humor. Der Eintritt ist frei.

Unterstützt wird die Konzertsaison vom Bauverein Rheinhausen und vom
Förderverein für Kultur- und Brauchtumspflege Rheinhausens &
Rumeln-Kaldenhausens.
Weitere Sonntagskonzerte finden am 10.
August mit den HeybergMusikanten sowie am 17. August mit „Die
Bergsteirer“ statt. Aktuelle Informationen sind online via Facebook
abrufbar unter: www.facebook.com/SonntagskonzerteRheinhausen/

Bruttoinlandsprodukt im 2. Quartal 2025 um 0,1 %
niedriger - Deutsche Wirtschaft verliert nach positivem Jahresbeginn
an Fahrt
Bruttoinlandsprodukt (BIP), 2. Quartal 2025
-0,1 % zum Vorquartal (preis-, saison- und kalenderbereinigt) 0,0 %
zum Vorjahresquartal (preisbereinigt) +0,4 % zum Vorjahresquartal
(preis- und kalenderbereinigt)
Das
Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 2. Quartal 2025 gegenüber dem 1.
Quartal 2025 – preis-, saison- und kalenderbereinigt – um 0,1 %
gesunken, nachdem es zum Jahresbeginn 2025 noch gestiegen war
(revidiert +0,3 % im 1. Quartal 2025 zum Vorquartal; bisher: +0,4
%).
Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter
mitteilt, waren die Investitionen in Ausrüstungen und Bauten im 2.
Quartal 2025 nach vorläufigen Erkenntnissen niedriger als im
Vorquartal. Die privaten und staatlichen Konsumausgaben stiegen
dagegen preis-, saison- und kalenderbereinigt an.
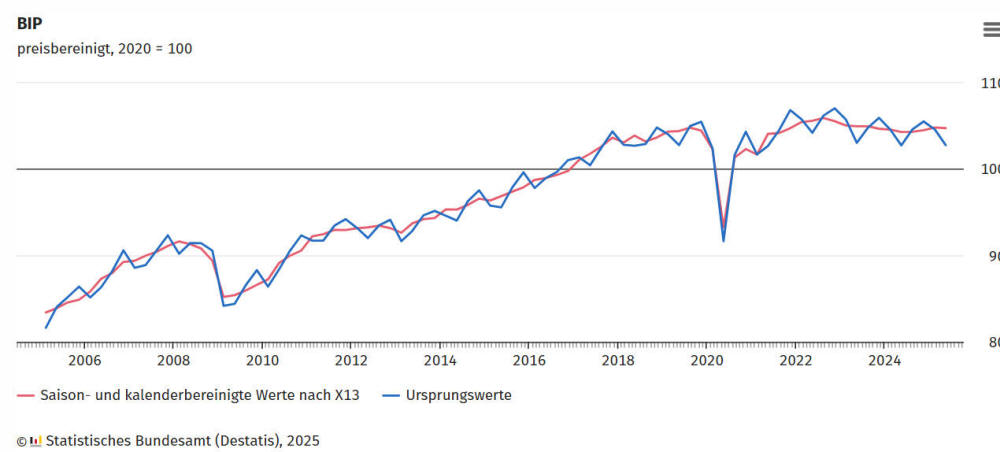
Bruttoinlandsprodukt im Vorjahresvergleich unverändert Im
Vorjahresvergleich lag das BIP im 2. Quartal 2025 preisbereinigt auf
demselben Niveau wie im 2. Quartal 2024 (0,0 %), wobei im 2. Quartal
2025 ein Arbeitstag weniger zur Verfügung stand. Preis- und
kalenderbereinigt war es um 0,4 % höher als im Vorjahresquartal.
NRW: Auf eine Person kamen 2023 im Schnitt 11,5
Quadratmeter Seefläche
* Seen in NRW hatten 2023 eine
Fläche von 207,0 Quadratkilometer.
* Spitzenreiter war der Kreis
Olpe mit 63,4 Quadratmeter Seefläche pro Person.
* Im Kreis
Recklinghausen ist die Fläche von Anlagen für den Badebetrieb am
größten.
Der Sommer ist da und Seen sind bei den Menschen
wieder angesagt: Ende 2023 erstreckten sich Seen in
Nordrhein-Westfalen auf einer Fläche von 207,0 Quadratkilometer. Wie
das Statistisches Landesamt mitteilt, kam damit rein rechnerisch auf
eine Einwohnerin bzw. einen Einwohner in NRW eine Fläche von
11,5 Quadratmeter See.
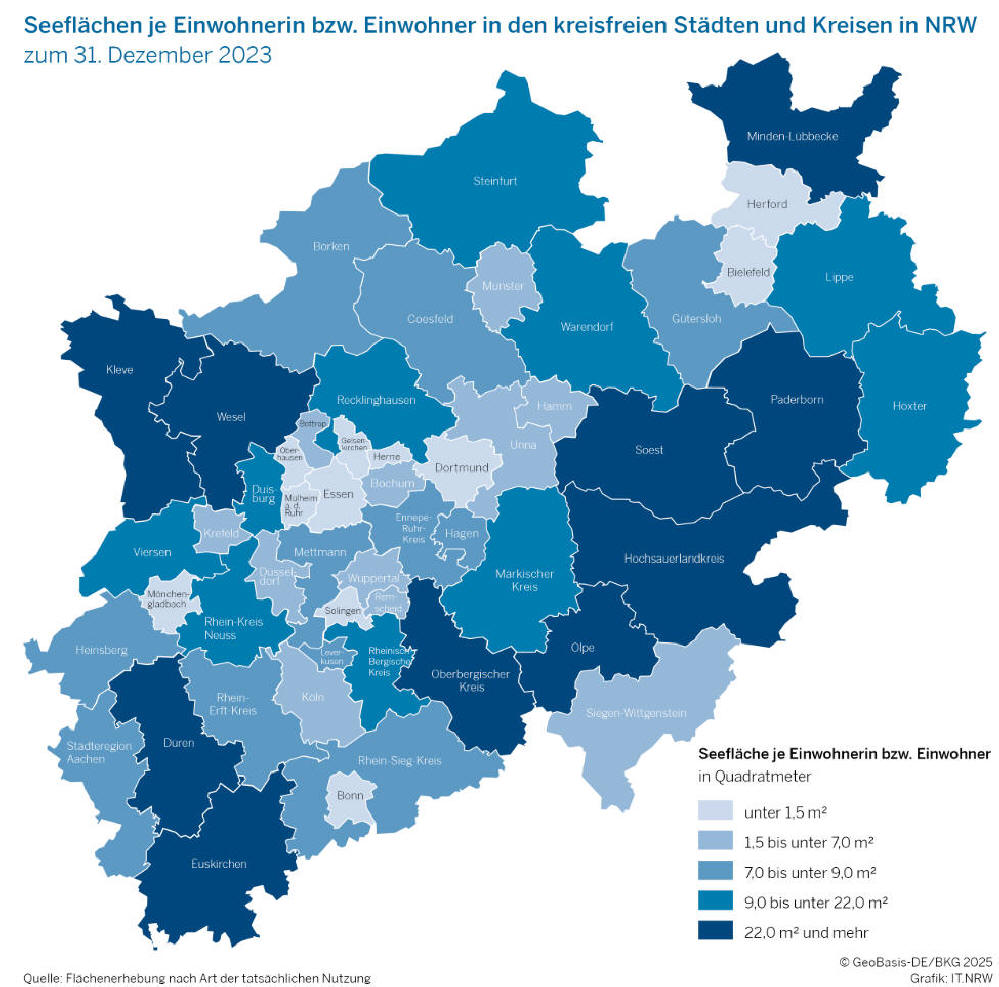
Daten der Abbildung
https://www.it.nrw/system/files/media/document/file/215_25_kartogramm.xlsx
XLSX, 11,71 KB
In den Kreisen Wesel, Kleve und Soest gibt es
die größten Seeflächen Im Kreis Olpe kam mit 63,4 Quadratkilometer
die größte Seefläche auf eine Person; gefolgt vom Kreis Kleve
(59,1 Quadratkilometer) und Wesel (56,6 Quadratkilometer). Die
landesweit größten Flächen von Seen gab es Ende 2023 in den Kreisen
Wesel (25,9 Quadratkilometer), Kleve (18,9 Quadratkilometer) und
Soest (12,0 Quadratkilometer).
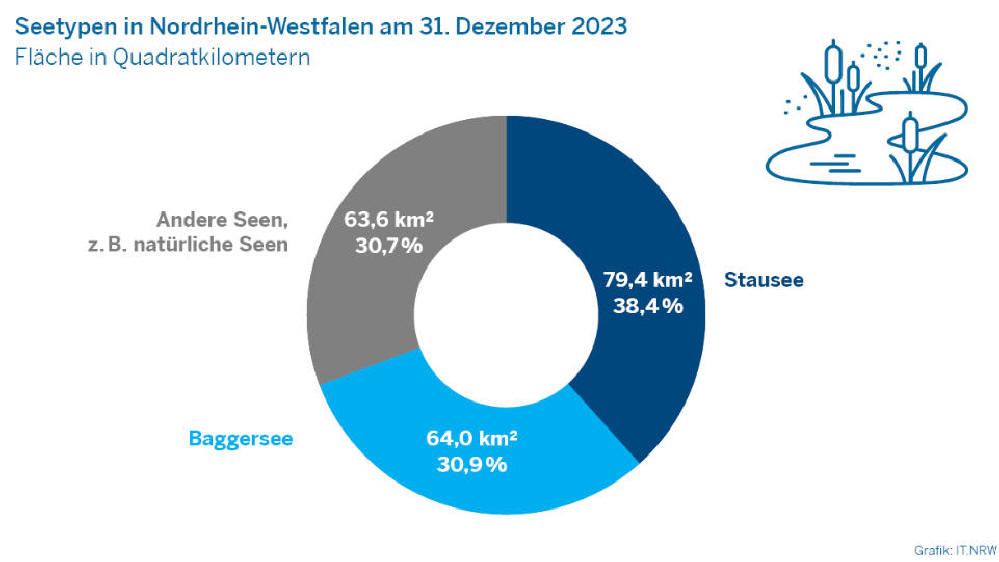
Stauseen mit einem Anteil von knapp 40 % an der Seefläche
insgesamt Die Seen in NRW lassen sich in verschiedene Arten
unterteilen: Stauseen bilden mit 38,4 % den größten Anteil der
Seeflächen, gefolgt von Baggerseen mit 30,9 %. Die restlichen Seen
wie natürliche Seen haben mit 30,7 % einen ähnlich großen Anteil an
der Fläche aller Seen. In welchen der Seen auch gebadet werden darf,
wird in der Statistik nicht erhoben.
Ein Drittel der
Gewässerflächen waren Seen
Die Seen machten Ende 2023 rund ein
Drittel (33,5 %) der gesamten Gewässerflächen in NRW
(618,8 Quadratkilometer) aus. Alle stehenden Gewässer, wozu die Seen
und Teiche zählen, erstreckten sich insgesamt über
295,1 Quadratkilometer. Über die Hälfte der landesweiten
Gewässerflächen waren Fließgewässer mit 315,7 Quadratkilometern.
Hafenbecken nahmen eine Fläche von 8,1 Quadratkilometern ein.
Recklinghausen mit größter Fläche für Badebetrieb- und
Schwimmsportanlagen Neben Seen sind auch Schwimmbäder und offizielle
Seebäder beliebte Ausflugsziele im Sommer. Anlagen für den
Badebetrieb und Schwimmsport erstreckten sich Ende 2023 über
11,4 Quadratkilometer. In den Kreisen Recklinghausen
(0,7 Quadratkilometer), Wesel (0,6 Quadratkilometer) und Steinfurt
(0,5 Quadratkilometer) waren diese Flächen am größten.
NRW: Bauproduktion im Mai um 2,1 Prozent gesunken
* NRW-Bauproduktion im Hochbau rückläufig und im
Tiefbau in etwa auf Vorjahresniveau.
* Hochbau: Rückgang der
Bauproduktion in allen Bausparten.
* Tiefbau: Rückgang im
Straßenbau sowie im gewerblichen und industriellen Tiefbau.
Die Produktion im nordrhein-westfälischen Bauhauptgewerbe ist im Mai
2025 um 2,1 % niedriger gewesen als ein Jahr zuvor. Wie das
Statistische Landesamt mitteilt, war die Produktion im Hochbau um
4,0 % und im Tiefbau um 0,1 % niedriger als im Mai 2024. Innerhalb
des Hochbaus konnten im Mai 2025 durchweg rückläufige Entwicklungen
der Bauproduktion in den einzelnen Bausparten beobachtet werden: Im
Wohnungsbau war ein Rückgang der Bauproduktion gegenüber dem
vergleichbaren Vorjahresmonat zu konstatieren (−4,5 %).
'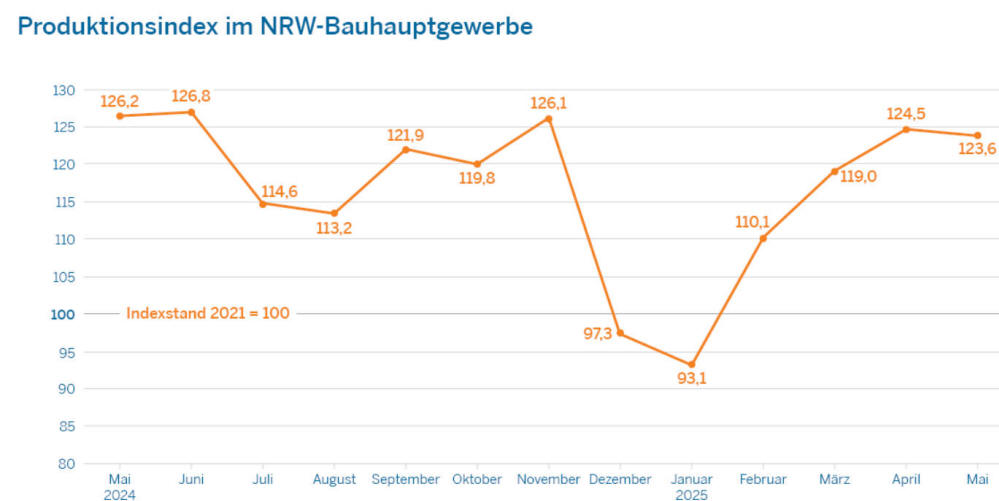
Im gewerblichen und industriellen Hochbau (−4,0 %) sowie im
öffentlichen Hochbau (−1,3 %) war die Bauproduktion ebenfalls
niedriger als im Mai 2024. Innerhalb des Tiefbaus entwickelten sich
die Bauleistungen in den einzelnen Bausparten unterschiedlich: Im
sonstigen öffentlichen Tiefbau stieg die Bauproduktion (+3,5 %)
gegenüber dem Vorjahresmonat.
Rückgänge waren im Straßenbau
(−0,2 %) und im gewerblichen und industriellen Tiefbau (−2,4 %) zu
beobachten. Bauproduktion im Hoch- und Tiefbau auch weiterhin über
dem Niveau von April 2019 Im Mai 2025 ermittelten die Statistiker im
Vergleich zum entsprechenden Monatsergebnis des Jahres 2019 einen
Anstieg der Bauproduktion im Bauhauptgewerbe (+9,0 %).
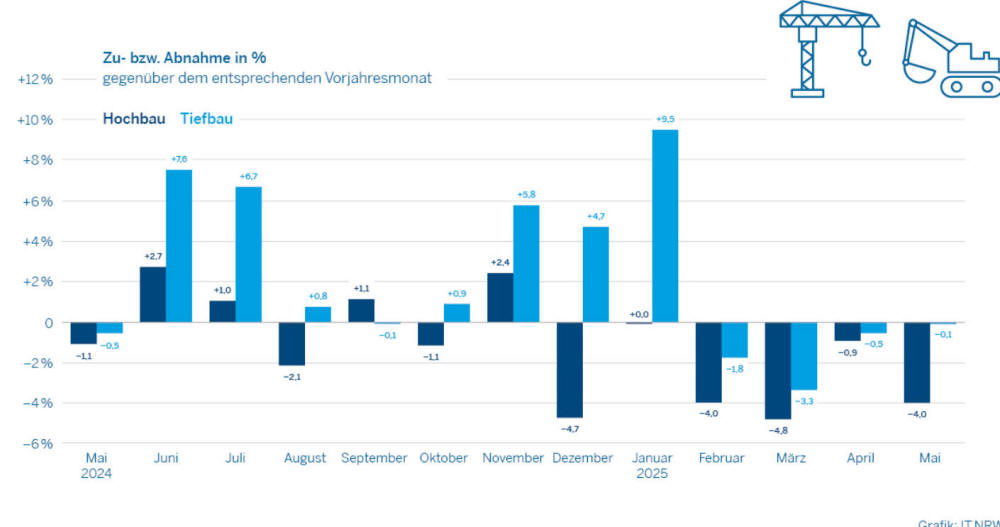
Sowohl im Hochbau (+1,9 %) als auch im Tiefbau (+16,9 %) lag die
Bauproduktion über dem Niveau von Mai 2019. Das kumulierte Ergebnis
der Bauproduktion für die ersten fünf Monate des Jahres 2025 war um
1,4 % niedriger als in der entsprechenden Vergleichsperiode 2024.