






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 31. Kalenderwoche:
31. Juli
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Freitag, 1. August 2025 - Tag des Bieres
Freitag, 1. August 2025 +++ 12:30 Uhr | Brandanschlag in NRW
Wegen Reparatur an zweitem Anschlagsort Fern- und Regionalverkehr
weiterhin erheblich gestört
Nach einem mutmaßlichen Brandanschlag
auf Infrastrukturlangen der Deutschen Bahn in Düsseldorf am
Donnerstagvormittag kommt es weiterhin zu erheblichen
Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr.
Auf dem
betroffenen Abschnitt sind täglich rund 700 Züge unterwegs. Mehrere
zehntausend Fahrgäste müssen sich auch am heutigen Tag auf deutlich
längere Fahrtzeiten und Zugausfälle einstellen. Die DB hat die
ersten Reparaturarbeiten an der Strecke zwischen Duisburg und
Düsseldorf in der Nacht abgeschlossen.
Bei den letzten
Prüfungen der Kabel in der vergangenen Nacht stellte das
Expertenteam fest, dass es einen weiteren Schaden an der Strecke
gibt. Die DB hat den zweiten Schaden, der vermutlich ebenfalls auf
Fremdeinwirkung zurückzuführen ist, an die ermittelnden Behörden
gemeldet.
Die Spurensicherung ist seit dem frühen Mittag
abgeschlossen. Nun konzentrieren sich die Techniker:innen der DB auf
die Reparatur des zweiten Schadens. Weitere Mitarbeitende und
Material sind dafür organisiert worden.
Nach Abschluss der
Reparatur der beschädigten Anlagen müssen die Kabel umfangreich
geprüft werden. Erst dann kann die Strecke wieder in Betrieb
genommen werden. Zurzeit ist davon auszugehen, dass diese Arbeiten
noch mindestens den heutigen Tag über andauern.
Beeinträchtigung durch Vandalismus DB Fernverkehr
Dauer: Von
31.07.2025 bis 01.08.2025 ICE/IC
Aufgrund
von Vandalismusschäden - Polizei vermutet Brandstiftung -zwischen
Düsseldorf und Duisburg kommt es im Fernverkehr der Deutschen Bahn
zu Beeinträchtigungen. Dadurch kommt es zu (Teil-) Ausfällen,
Umleitungen und Verspätungen.
Es soll sich um einen
Brand in einem Kabeltunnel handeln. Die Polizei geht von einem
Sabotageakt aus. Die Strecke soll bis Freitagmittag gesperrt
bleiben. Die wichtige Bahnstrecke der Deutschen Bahn zwischen
Duisburg und Düsseldorf wurde lahmgelegt, die mit massiven
Beeinträchtigungen des Zugverkehrs, sagte ein Bahnsprecher.
Die Störung werde voraussichtlich noch bis Freitagmittag dauern.
Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. Die Busse fahren zwischen
den Hauptbahnhöfen Duisburg und Düsseldorf sowie vom Duisburger Hbf
zum Düsseldorfer Flughafen.
Die S1 und der RE2 fahren wegen
der Störung nur bis Duisburg Hauptbahnhof, nicht wie geplant bis
Düsseldorf. Der RE3 fährt nur zwischen Gelsenkirchen und Oberhausen.
Auch hier fällt die Teilstrecke bis Düsseldorf aus. Verschiedene
weitere Regionalexpresslinien werden zwischen Duisburg Hbf und
Düsseldorf Hbf umgeleitet, deshalb halten sie nicht am Düsseldorfer
Flughafen.
Defektes Stellwerk in Duisburg: Übersicht der
betroffenen Linien auf der Strecke , die mit 700 bis 800
Verbindungen täglich eine der wichtigsten bundesweit ist, so ein
Bahnsprecher. Die beschädigten Kabel sorgten außerdem für Störungen
im Fernverkehr.
Betroffen seien die ICE-Linien nach Berlin
und Frankfurt am Main ebenso wie die Verbindungen in Richtung
Norddeutschland, Süddeutschland und in die Niederlande, teilte die
Bahn mit. Es komme zu Umleitungen und Verspätungen. Außerdem werden
einzelne Bahnhöfe nicht angefahren. Es dürften mehrere 10.000
Reisende von den Bahnproblemen betroffen sein. Dementsprechend viele
Menschen mussten jetzt anderweitig ans Ziel kommen.
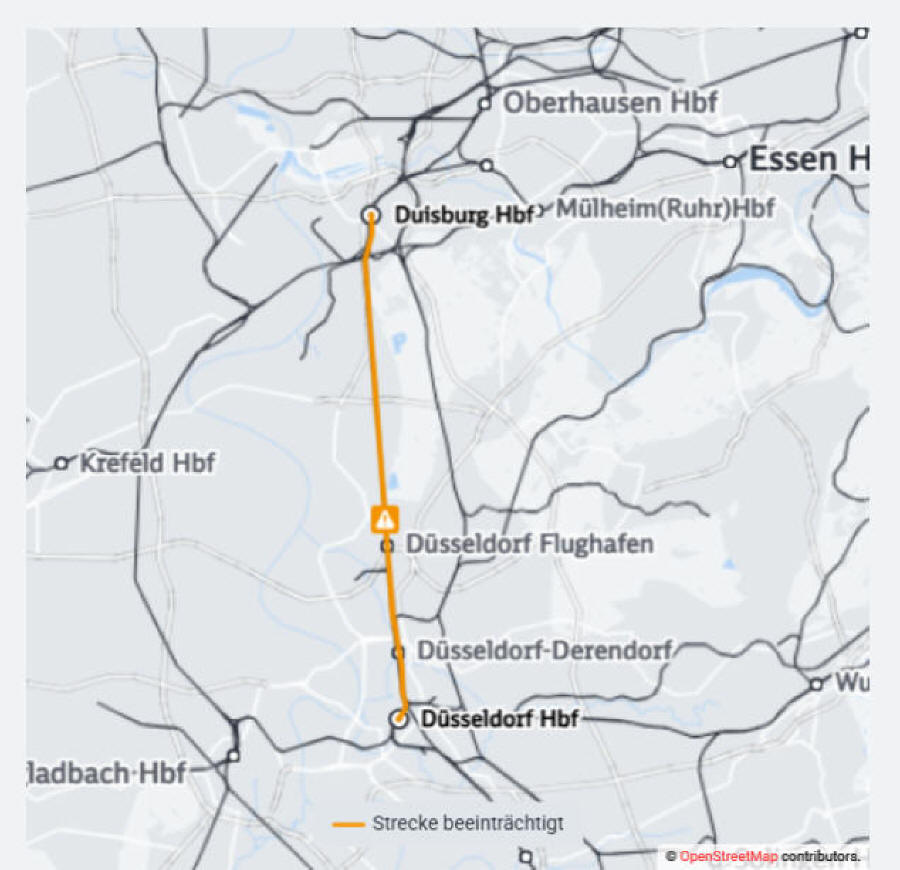
Stadt Duisburg investiert jährlich zusätzliche 3,3 Millionen Euro in
den Ausbau des kommunalen ÖPNV im Bezirk Mitte
Die
Stadt Duisburg setzt ein starkes Zeichen für eine moderne,
umweltfreundliche und bürgernahe Mobilität: Mit einer Investition
von jährlich zusätzlichen 3,3 Millionen Euro wird das Angebot im
städtischen Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) deutlich
verbessert. Der Schwerpunkt liegt im Bezirk Mitte.
Zusätzlich entstehen zwei neue Linienverbindungen nach Oberhausen.
Der größte Fahrplanwechsel seit 2019 tritt am 27. August 2025 in
Kraft. Die Linien 919 und 936 werden verlängert und fahren künftig
zum Oberhausener Hauptbahnhof beziehungsweise zur
Anne-Frank-Realschule in Oberhausen. So entstehen direkte,
städteübergreifende Verbindungen – ideal für Pendlerinnen und
Pendler sowie Besucherinnen und Besucher des Landschaftsparks
Duisburg Nord.
Durch die Verbesserungen im Bezirk Mitte
werden folgende Linien neu strukturiert, mit mehr Fahrten
ausgestattet oder verlängert und sorgen so für dichtere Takte und
bessere Verbindungen:
• Linie 920: fährt zur Universität – ideal
für Studierende
• Linie 923: neue Direktverbindung von Baerl und
Homberg zur Innenstadt, zum Hauptbahnhof und Sportpark. Takt auf der
Strecke Homberg – Hauptbahnhof wird verdoppelt
• Linie 924: neue
Linienführung für schnellere Verbindung zwischen Winkhausen,
Asterlagen und Rheinhausen
• Linie 926: verlängert bis
Sportpark, mit neuen Haltestellen an der Mozartstraße und
Brucknerstraße
• Linie 929: bedient künftig die Haltestelle
„Kaßlerfelder Straße“ und bietet bessere Anbindung nach Moers
•
Linie 930 und 931: häufigere und bessere Verbindungen im Bezirk
Mitte, die Haltestelle „Moltkestraße“ wird wieder angefahren.
Die Linie 930 verbindet die Werthacker-Siedlung mit dem
Hauptbahnhof doppelt so häufig wie bislang. Die Linie 931 fährt vom
Hauptbahnhof über Hochfeld, das Dellviertel und auf direktem Weg
(Karl-Lehr-Tunnel) nach Neudorf und schließlich nach Duissern. •
Linie 933: geänderter Linienweg über Lehmbruck-Museum, deutlich
bessere Taktung an Samstagen
• Linie 937: neue Verbindung in
Kombination mit Linie 947 von Rheinhausen über Hochfeld – Schlenk –
Sportpark – Neudorf – Hauptbahnhof zur Innenstadt sowie
Blumenkampshof, erschließt neue Gewerbegebiete
• Linie 939:
Verlängerung von Oberhausen zur St. Johannes-Klinik in Duisburg mit
verbessertem und beschleunigtem Linienweg
• Linie 947: neue
Verbindung in Kombination mit Linie 937 von Rheinhausen über
Hochfeld, Schlenk, Sportpark, Neudorf und Hauptbahnhof zur
Innenstadt sowie Innenhafen – dadurch bessere Anbindung von
Rheinhausen an den Bezirk Mitte
• NE7: neue Nachtlinie vom
Innenhafen nach Neuenkamp für bessere Anbindung und mehr
Flexibilität in der Nacht
• NE1 / NE11: schnellere Fahrten nach
und aus Neumühl, Fahrtzeit reduziert sich um zwei Drittel,
bisheriger Linienweg und Takt bleiben
• NE2: Verlängerung bis
Kaldenhausen.

Foto: Duisburger Verkehrsgesellschaft AG
Weitere Verbesserungen, Informationen und detaillierte Fahrpläne
sind online unter folgendem Link zu finden:
https://www.dvgduisburg.de/fahrplaene/fahrplanaenderungen/bevorstehende-aenderungen
Rheinhausen: nächste Dreck-weg-Aktion
Der Verein „Du bist Rheinhausen“ startet am 09.08.2025 um 10.00 Uhr
an der Bezirksbibliothek Rheinhausen, Händelstraße 6 in 47226
Duisburg eine weitere Dreck-weg-Aktion und knöpft sich bis 12.00 Uhr
das Gebiet rund um die Bibliothek vor. Alle Rheinhauser*innen sind
eingeladen mitzumachen und mögen sich bitte im Internet auf
du-bist-rheinhausen.de anmelden.
Wie gewohnt werden
Mitstreiterinnen und Mitstreiter mit Allem ausgestattet, was sie
brauchen: Handschuhe, Greifzangen, Müllsäcke und Eimer stehen
bereit. Du bist Rheinhausen e.V. Ackerstr. 16, 47229 Duisburg
E-Mail:
horst@du-bist-rheinhausen.de Du bist Rheinhausen ist eine
Anlaufstelle für Menschen in Rheinhausen, die die Ärmel hochkrempeln
und ihre Heimat gestalten möchten. Seien es bestehende Initiativen,
Vereine oder Einzelne, die Ideen haben, die sich gemeinsam leichter
umsetzen lassen.
Anmeldestart für die 30.
SommerUni Experimentieren, entdecken, durchstarten
In
der letzten Ferienwoche in NRW, vom 18. bis 21. August 2025, lädt
die Universität Duisburg-Essen wieder Schüler:innen ab 15 Jahren zur
SommerUni Natur- und Ingenieurwissenschaften (SUNI) ein. Die
traditionsreiche Veranstaltung feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges
Bestehen – und bietet 2025 so viel wie nie zuvor: Erstmals findet
die SUNI an drei Campusstandorten statt – in Duisburg, Essen und an
der Universitätsmedizin Essen.
Die SommerUni Natur- und
Ingenieurwissenschaften (SUNI) gibt Jugendlichen die Möglichkeit,
sich intensiv mit den spannenden Themen aus den Natur- und
Ingenieurwissenschaften auseinanderzusetzen. Das Programm reicht von
interaktiven Vorträgen und praktischen Workshops bis hin zu
Experimenten im Labor. So erfahren die Teilnehmenden zum Beispiel im
Workshop „Slimy & Smart“, wie Schnecken und ihre Parasiten als
Indikatoren für ökologische Zusammenhänge dienen können.
Zudem gehen sie den Fragen nach, warum wir in der Medizin auch an
das Geschlecht denken und was Laser alles können. Neu in diesem Jahr
ist die Einbindung des Campus der Universitätsmedizin, die weitere
spannende Perspektiven eröffnet – etwa auf die Schnittstellen
zwischen Naturwissenschaften, Technik und Medizin. Damit lernen die
Teilnehmenden erstmals alle drei großen UDE-Standorte kennen.
Ein fester Bestandteil der SUNI ist das sogenannte Kontaktikum:
Einen Tag lang erkunden die Teilnehmenden reale Berufsfelder in
Industrie und Forschung. In diesem Jahr ist ein Besuch beim
Ruhrverband geplant – einem der wichtigsten Akteure der
Wasserwirtschaft im Ruhrgebiet, der für die Abwasserreinigung in 60
Städten und Kommunen verantwortlich ist.
Durch einen Besuch
beim Fischlift am Baldeneysee und der Kläranlage in Essen Kupferdreh
werden durch dieses Kontaktikum Fragen wie: Warum müssen Fische
Aufzug fahren? und Was passiert mit dem Wasser, das ihr täglich
benutzt? geklärt. Die UDE legt besonderen Wert auf
Chancengerechtigkeit: Wie in den vergangenen Jahren werden die
Programme geschlechtergetrennt durchgeführt, um eine gezielte
Förderung in geschütztem Rahmen zu ermöglichen.
Ursprünglich
ausschließlich für Mädchen konzipiert, steht die Veranstaltung seit
2012 allen Interessierten offen. Die SommerUni kostet 35 Euro,
inklusive Mensaessen. Die
Anmeldung zur SUNI 2025 ist ab sofort online möglich. Weitere
Informationen: Hier geht es zum Programm und zur Anmeldung:
www.uni-due.de/schuelerinnenprogramme
Frühe Hilfen: Informationscafé zum Thema
Geschwisterrivalität
Die Frühen Hilfen Duisburg laden
am Freitag, 1. August, von 9.30 bis 11.30 Uhr, zum Informationscafé
in die Zentrale Anlaufstelle Frühe Hilfen auf der Schwanenstraße 5-7
in der Duisburger Innenstadt ein (Eingang Steinsche Gasse 2). Insa
Wessendorf, Leiterin des Instituts für Jugendhilfe, gibt
interessierten Eltern und jenen, die es bald werden, umfassende
Tipps und hilfreiche Empfehlungen rund um das Thema
Geschwisterrivalität.
So beispielsweise, wie Eltern mit
Konfliktsituationen umgehen und ein liebevolles Miteinander im
Familienalltag fördern können. Die Frühen Hilfen Duisburg bieten ein
umfassendes Beratungsangebot zu allen Themen rund um Schwangerschaft
und Geburt sowie Informationen für Eltern mit ihren Kindern im Alter
von 0 bis 3 Jahren an. Sämtliche Angebote der Frühen Hilfen in
Duisburg sind kostenlos. Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist
nicht erforderlich.
Weitere Informationen zu den Frühen
Hilfen gibt es auch auf der Internetseite unter
www.duisburg.de/microsites/fruehe_hilfen. Für Rückfragen steht Ihnen
das Team der Frühen Hilfen auch telefonisch unter 0203/283-8342 zur
Verfügung.
Metall trifft auf Metal –
Modellbahnhersteller Märklin erstmals live beim Wacken Open Air
Märklin goes Metal. Nach einem fulminanten
Jahresauftakt mit der rockigen AC/DC Black Ice Lokomotive zündet der
Traditionshersteller die nächste Stufe: Erstmals in seiner
Geschichte ist der Modellbahnhersteller Märklin auf dem legendären
Wacken Open Air, das von 30.07. bis 02.08.2025 im Norden
Deutschlands stattfindet, vertreten.
Was liegt näher für ein
Unternehmen, das für seine detailreichen Produkte aus Metall bekannt
ist, als sich inmitten der größten Heavy Metal Community der Welt zu
präsentieren. „Märklin freut sich darauf“, so Marketingleiter Jörg
Iske, „in dieser einzigartigen Atmosphäre mit alten und neuen Fans
zu feiern und die Leidenschaft für Miniaturwelten mit der Energie
des Metal zu verbinden.“
Ein besonderes Highlight: Passend
zum Wacken-Debüt legt Märklin exklusive Wacken-Waggons auf, die ihre
erstmalige Präsentation direkt auf dem Festivalgelände im Wacken
United Bereich erleben werden. Märklin lädt alle United Besucher
herzlich ein, dort vorbeizuschauen und die Marke in einem völlig
neuen Kontext zu entdecken.
Das Wacken Open Air ist weit
mehr als nur ein Festival – es ist der jährliche Treffpunkt der
globalen Metal-Familie. Im Wacken United Bereich kommen nicht nur
die besten Fans der Welt zusammen, sondern auch Bands, Partner,
Pressevertreter, Plattenfirmen, Promoter, Manager und Booker. Hier
entsteht in entspannter Atmosphäre ein einzigartiger Raum für
Austausch und Networking.
Ob Branchentreff, Marktplatz,
Klassentreffen, Musikmesse, Party-Metalzone, Zeitreise, Chill-Area
oder Kontaktbörse – Wacken United ist das Herzstück der Community.
Märklin freut sich darauf, Teil dieser pulsierenden Zone zu sein und
lädt alle ein, dabei zu sein, Märklin neu zu erleben und mit jedem
Ticketkauf die Arbeit der Wacken Foundation zu unterstützen.
MSV
Duisburg – VfB Stuttgart II: DVG setzt zusätzliche Busse ein
Für Gäste des Fußballspiels MSV Duisburg gegen den VfB Stuttgart II
am Samstag, 2. August, um 16.30 Uhr in der Schauinsland-Reisen
Arena, setzt die DVG ihre Sportlinie 945 ein.
Abfahrtszeiten
Buslinie 945 Richtung MSV Arena:
ab „Salmstraße“ (Meiderich)
Abfahrt um 14.36, 14.46, 14.56 Uhr
ab „Bergstraße“ um 14.41,
14.51 und 15.01 Uhr
ab „Meiderich Bahnhof“ ab 14.45 bis 15.10 Uhr
alle fünf Minuten
ab „Großenbaum Bahnhof Ost“ um 15.20 und 15.35
Uhr
ab „Betriebshof am Unkelstein“ ab 14.28 bis 14.53 Uhr alle
fünf Minuten
ab Hauptbahnhof (Verknüpfungshalle) ab 14.40 bis
16.05 Uhr alle fünf Minuten
ab „Businesspark Nord“ (Asterlagen)
um 15.03 Uhr .

DVG-Foto
Nach Spielende stehen am Stadion Busse für die Rückfahrt bereit.
Gäste des Fußballspieles, die eine Tageseintrittskarte im Vorverkauf
erworben haben oder eine Dauerkarte besitzen, können kostenlos die
öffentlichen Verkehrsmittel für die Hin- und Rückfahrt benutzen. Für
die Gäste, die sich an der Stadionkasse ihre Eintrittskarte kaufen,
ist die Rückfahrt mit Bus und Bahn kostenlos.
Gebundener Ganztag – Mehr als nur Unterricht
Ab dem
Schuljahr 2026/2027 gilt bundesweit ein Rechtsanspruch auf
Ganztagsbetreuung für alle Erstklässlerinnen und Erstklässler in den
Grundschulen. Ziel dieses Anspruchs ist es, die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf zu verbessern, Bildungsungleichheiten abzubauen
und Kindern einen verlässlichen Lern- und Lebensort zu bieten.
In Nordrhein-Westfalen soll dieser Anspruch überwiegend über das
Modell der Offenen Ganztagsgrundschule (OGS) umgesetzt werden. Die
OGS sieht vor, dass der Unterricht am Vormittag stattfindet und am
Nachmittag durch ein freiwilliges Angebot ergänzt wird, bestehend
aus Mittagessen, Betreuung sowie Freizeit- und Förderangeboten.
Daneben existiert mit der gebundenen Ganztagsschule ein weiteres
Modell der Ganztagsorganisation. Hier sind Unterricht und
außerunterrichtliche Aktivitäten rhythmisiert über den gesamten
Schultag verteilt. Die Teilnahme ist für alle Schülerinnen und
Schüler verpflichtend. Diese Form bietet pädagogisch besonders
wertvolle Strukturen, da sie mehr Raum für individuelle Förderung,
soziales Lernen, Inklusion und Integration eröffnet.
Gebundene Ganztagsschulen gelten als besonders geeignet, um auf die
unterschiedlichen Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern
einzugehen und Chancengleichheit im Bildungssystem zu fördern.
Dennoch spielt diese Organisationsform im nordrhein-westfälischen
Grundschulbereich bisher nur eine untergeordnete Rolle.
Die
Ministerin für Schule und Bildung hat die Kleine Anfrage 5890 mit
Schreiben vom
24. Juli 2025 namens der Landesregierung im
Einvernehmen mit der Ministerin für Kinder, Jugend, Familie,
Gleichstellung, Flucht und Integration sowie der Ministerin für
Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung beantwortet.
Vorbemerkung der Landesregierung
Nach § 24 Absatz 4 Achtes Buch
Sozialgesetzbuch (SGB VIII) in der Fassung des
Ganztagsförderungsgesetzes vom 2. Oktober 2021 greift ab 1. August
2026 ein aufwachsender Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für
Kinder im Grundschulalter.
Zur Umsetzung des Rechtsanspruchs
baut Nordrhein-Westfalen auf dem langjährigen, erfolgreichen Modell
der Offenen Ganztagsschule auf. Das erfolgreiche kooperative
Trägermodell in der Zusammenarbeit von Grundschulen und freien und
öffentlichen Trägern der Jugendhilfe sowie weiteren Trägern und
außerschulischen Partnern soll weitergeführt werden.
Dazu
hat die Landesregierung am 2. Juli 2024 den gemeinsamen Erlass des
Ministeriums für Schule und Bildung und des Ministeriums für Kinder,
Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration „Offene
Ganztagsschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und
Betreuungsangebote im Primarbereich“ gebilligt, der zum 1. August
2026 in Kraft tritt.
Die Erfüllungsverantwortung für die
Umsetzung des Rechtsanspruchs richtet sich gem. § 24 Abs. 4 SGB VIII
i.V. m §§ 79 Abs. 1, 85 Abs. 1 SGB VIII unmittelbar immer und
ausschließlich an den Träger der öffentlichen Jugendhilfe.
1. Wie viele Grundschulen im gebundenen Ganztag gibt es
insgesamt in NordrheinWestfalen (bitte Schulträger und Kommune
aufführen)?
In Nordrhein-Westfalen gibt es 18 gebundene
Ganztagsgrundschulen, davon zehn private Ersatzschulen und acht
öffentliche Grundschulen.
2. Wie viele Grundschulen in
NRW haben im Jahr 2024 (zum Schuljahr 2024/25) die
Form des
gebundenen Ganztags beantragt (bitte Schulträger und Kommune
aufführen?
Der Landesregierung liegen bis auf vereinzelte
Beratungsanfragen bei den Bezirksregierungen keine Informationen zu
konkreten Antragsstellungen zum Schuljahr 2024/2025 zur
Organisationsform des gebundenen Ganztages an Grundschulen in
Nordrhein-Westfalen vor.
3. Welche Unterstützung bietet
die Landesregierung in der Planung und Umsetzung
des gebundenen
Ganztags an den Grundschulen in NRW?
Da der Zeitrahmen des
Ganztagsbetriebs gebundener Ganztagsschulen (§ 9 Absatz 1
SchulG)
gemäß BASS 12-63 Nr. 2 nicht den durch das Ganztagsförderungsgesetz
vom 2.
Oktober 2021 vorgegebenen Zeitrahmen erfüllt, setzt das
Land bei der Umsetzung des aufwachsenden Rechtsanspruchs auf
Ganztagförderung für Kinder im Primarbereich auf die langjährig
bewährten Strukturen des Offenen Ganztages im Primarbereich.
Nach Maßgabe des Haushalts leistet das Land in offenen
Ganztagsschulen im Primarbereich (§ 9 Absatz 3
SchulG) und in
außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten (§ 9 Absatz
2 SchulG) Zuschüsse für Einsatz, Koordinierung und Fortbildung des
Personals außerschulischer Träger (§ 94 Absatz 2 SchulG).
Darüber hinaus besteht eine verlässliche und etablierte
Unterstützungsstruktur für Ganztagsschulen, auch zur konzeptionellen
Ausgestaltung des Ganztags. Die Serviceagentur „Ganztagsbildung NRW“
unterstützt Ganztagsschulen und außerschulische Träger der
Ganztagsangebote in der Zusammenarbeit mit Partnern und bei der
Ausgestaltung des Erziehungs- und Bildungsauftrages in der
Ganztagsschule.
Kleine Anfrage 5890 vom 24. Juni 2025 der
Abgeordneten Silvia Gosewinkel, Dilek Engin und Andrea Busche SPD
Helios St. Johannes Klinik Duisburg lädt zum
Storchentreff
Am kommenden Montag, 4. August, um 18 Uhr
bietet die Helios St. Johannes Klinik Duisburg wieder den
Storchentreff an, einen Informationsabend für werdende Mütter und
zukünftige Eltern. Ärzt:innen aus Geburtshilfe und Neonatologie
(Neugeborenenmedizin) sowie eine Hebamme vermitteln wissenswerte
Informationen rund um Schwangerschaft, Geburt und die erste Zeit von
Mutter und Kind nach der Geburt.
Das Team geht aber auch auf
die Abläufe der Schwangerschaft sowie der Entbindung im Klinikum ein
und steht gerne für individuelle Fragen zur Verfügung. Die
Veranstaltung findet an der Helios St. Johannes Klinik (Dieselstraße
185 in 47166 Duisburg) im Veranstaltungsraum neben der Cafeteria
statt. Um eine kurze Anmeldung per Telefon (0203) 546-30701 oder
E-Mail frauenklinik.hamborn@helios-gesundheit.de
wird gebeten.
Evangelisches Entwicklungswerk
legt Jahresbilanz vor – 15,5 Millionen Euro Spenden aus dem
Rheinland, Westfalen und Lippe
Brot für die Welt hat im
vergangenen Jahr bundesweit deutlich mehr Spenden und Kollekten von
Privatpersonen und Gemeinden erhalten. Im Gebiet der evangelischen
Landeskirchen Rheinland, Westfalen und Lippe waren es 15,5 Millionen
Euro, das ist deutlich mehr als 2023 (2023: 13,2 Millionen Euro,
Steigerung um 17 Prozent). Deutschlandweit spendeten die Menschen
4,6 Millionen Euro mehr als im Jahr 2023.
„Danke an alle
Unterstützerinnen und Unterstützer für ihre Spende an Brot für die
Welt. Insbesondere in diesen für viele Menschen finanziell schweren
Zeiten ist jeder Beitrag ein starkes Zeichen der Solidarität“, sagt
Kirsten Schwenke, juristische Vorständin der Diakonie RWL. Weil die
Entwicklungsorganisation weniger Geld aus dem „Bündnis Entwicklung
hilft“ erhalten hat, ist das Spendenergebnis insgesamt leicht
rückläufig.
Das liegt insbesondere am rückläufigen
Spendenaufkommen beim „Bündnis Entwicklung hilft“ im Zuge der
Ukraine-Unterstützung. Bundesweit gingen bei Brot für die Welt im
vergangenen Jahr 73,9 Millionen Euro Spenden und Kollekten ein
(2023: 75,9 Mio. Euro).
Entwicklungsprojekte von Brot für
die Welt Neben Spenden und Kollekten erhielt Brot für die Welt im
vergangenen Jahr Geld des Kirchlichen Entwicklungsdienstes und
Drittmittel. Das sind vor allem Mittel des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).
Insgesamt standen dem Hilfswerk der evangelischen Kirchen und
Freikirchen für seine Arbeit 332,3 Millionen Euro zur Verfügung—rund
0,2 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Das ist unter anderem auf
mehr Einnahmen aus Nachlässen zurückzuführen. Brot für die Welt hat
im vergangenen Jahr weltweit 2.919 Projekte gefördert. Regionale
Schwerpunkte waren Afrika und Asien.
Insgesamt wurden 318,7
Millionen Euro verausgabt. Rund 91 Prozent der verwendeten Mittel,
289,3 Millionen Euro, hat Brot für die Welt für Entwicklungsprojekte
ausgegeben. Für Werbe- und Verwaltungsaufgaben wurden rund 9 Prozent
eingesetzt. Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI)
bewertet den Anteil der Werbe- und Verwaltungsausgaben an den
Gesamtausgaben als niedrig. Das ist die beste zu vergebende
Kategorie.
Brot für die Welt setzt sich als Werk der
evangelischen Landes- und Freikirchen und ihrer Diakonie seit 1959
für globale Gerechtigkeit, Ernährungssicherheit, Klimagerechtigkeit
und Menschenrechte ein. Gemeinsam mit 1.500 Partnerorganisationen
ermöglicht Brot für die Welt in fast 90 Ländern, dass benachteiligte
Menschen ihre Lebenssituation aus eigener Kraft nachhaltig
verbessern.
Bahn-Sanierung fatal:
„Einzelwagenverkehr nicht abschaffen“
„Schnapsidee“ der
Deutschen Bahn: Sparprogramm auf Kosten von Umwelt- und Klimaschutz

Foto: Michael Lünen/Pixabay CC/PublicDomain
Bahn-Sanierung
fatal: „Einzelwagenverkehr nicht abschaffen“ ÖDP gegen „Schnapsidee“
der Deutschen Bahn: Sparprogramm auf Kosten von Umwelt- und
Klimaschutz Es wäre ein Mehrfach-Debakel: Laut
Medienberichten befürchtet die Eisenbahnergewerkschaft EVG, dass
die Bahntochter DB-Cargo ihren europaweiten „Einzelwagenverkehr“
kippt.
Mit dem Verlust dieses Lieferdienstes gingen aber
nicht nur Tausende Arbeitsplätze verloren. Noch schlimmer wiegt,
dass unter der Entscheidung des Bahnmanagements die Umwelt und das
Klima leiden, weil statt der Güterwaggons täglich zusätzliche 32.000
Lastwagen über unsere Straßen rollen.
Laut
DB-Eigenlob blasen die „1,7 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr“ in
die Luft. Prof. Dr. Herbert Einsiedler vom Bundesvorstand der
Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP – Die Naturschutzpartei)
spricht vom „Schlag gegen das CO2-Reduktionsziel Deutschlands“.
„Natürlich muss die Bahn Verluste möglichst vermeiden“, erkennt
Einsiedler an.
Trotzdem setzt die Schnapsidee an der
falschen Stelle an, ist sich der Ökonom sicher: „Die Bahn AG ist zu
100 Prozent im Besitz der Bundesrepublik Deutschland und die
Bundesregierung hat als Eigentümerin die Verpflichtung, das
Gemeinwohl zu berücksichtigen. Der Artikel 14 des Grundgesetzes sagt
klar: Eigentum verpflichtet.“ Deshalb spricht sich die ÖDP für den
Erhalt des DB-Einzelwagenverkehrs aus. Er ist eindeutig
umweltfreundlicher und emissionsärmer als der Gütertransport im
Lastwagen über die Straßen.
Das neue HUK-E-Barometer
Trendwende bei E-Mobilität möglich: Privatleute steigen so häufig
von Verbrenner- auf Elektroautos um wie zuletzt Ende 2023 – Erstmals
bewertet bundesweit eine Mehrheit E-Autos als „gut“ oder „sehr gut“
– Am stärksten ziehen die Bestandsquoten bei Stromern laut
HUK-E-Barometer in Schleswig-Holstein und Niedersachsen an
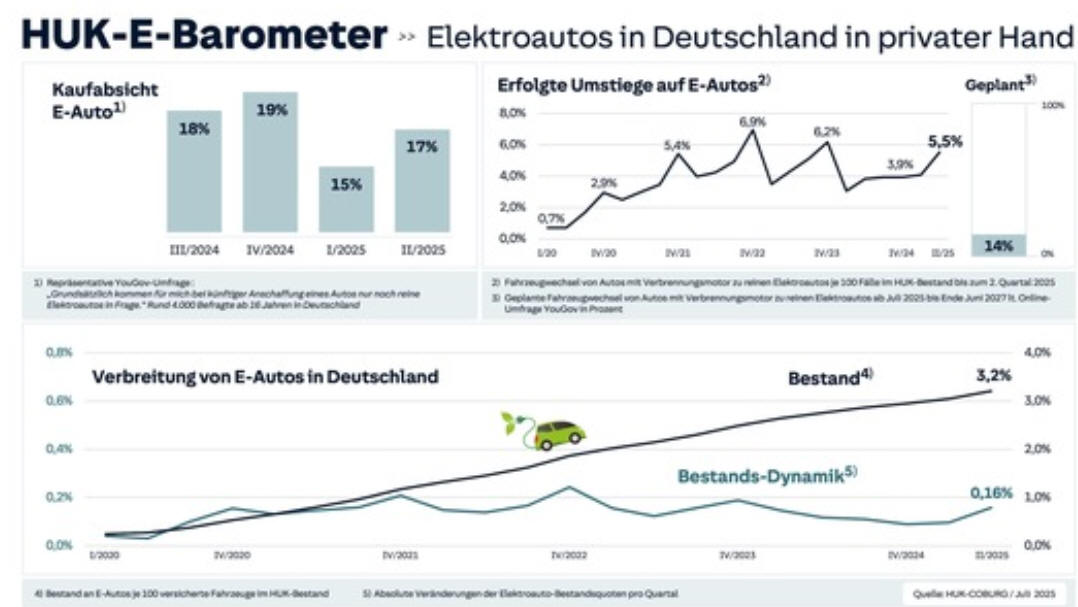
Das einstige Elektro-Spitzenland Baden-Württemberg fällt aus den
Top-3 der Bundesländer heraus
Vor allem Männer, Jüngere und
Vielfahrer bewerten Elektroautos positiver
Eine deutliche
Mehrheit der Bundesbürger will, dass auch gebrauchte E-Autos bei
staatlicher Förderung berücksichtigt werden
Private
Autofahrer entscheiden sich nach langer Zurückhaltung wieder
vermehrt für Elektroautos. Im zweiten Quartal 2025 stiegen laut
HUK-E-Barometer rund ein Drittel mehr beim Fahrzeugwechsel von einem
Verbrenner auf ein reines E-Auto um als im Quartal zuvor. Insgesamt
waren es bundesweit 5,5 Prozent aller Fahrzeugwechsel (4,1% in Q1
2025).
Einen Wert in ähnlicher Höhe gab es zuletzt Ende 2023,
also vor dem Wegfall der staatlichen Kaufprämie. Und auch der
Gesamtbestand an privaten E-Autos hat im zweiten Quartal 2025
spürbar angezogen auf 3,2 Prozent. Die Dynamik der Bestandszunahme
ist damit ebenfalls die höchste seit mehr als einem Jahr.

Das sind zentrale Messergebnisse des neuen HUK-E-Barometers, das
sich aus Daten des umfangreichen Versicherungsbestands des
marktführenden Unternehmens ergibt. Parallel werden von HUK-COBURG
jedes Quartal neu durch bundesweit repräsentative Online-Befragungen
die Einstellungen zu Elektroautos sowie Verhaltensweisen der
deutschen Bevölkerung erfragt.
Und auch hier deutet sich ein
Umschwung an. So erklärt jetzt erstmals mit 48 Prozent eine relative
Mehrheit der Deutschen ab 16 Jahren, dass sie E-Autos „sehr gut“
oder „gut“ findet, 45 Prozent der Befragten finden sie „weniger“
oder „gar nicht gut“. Anfang 2024 waren dagegen erst 37 Prozent
positiv eingestellt und noch 52 Prozent negativ.
Dr. Jörg
Rheinländer, Vorstandsmitglied der HUK-COBURG: „Ob der Umstieg zur
E-Mobilität in Deutschland gelingt, entscheidet sich im privaten
Automarkt, denn er umfasst gut 90 Prozent des Gesamtmarktes. Deshalb
sind die neuen Trendsignale wichtiger als etwa Neuzulassungszahlen
bei gewerblich genutzten Pkw, die nur etwa zehn Prozent ausmachen.“
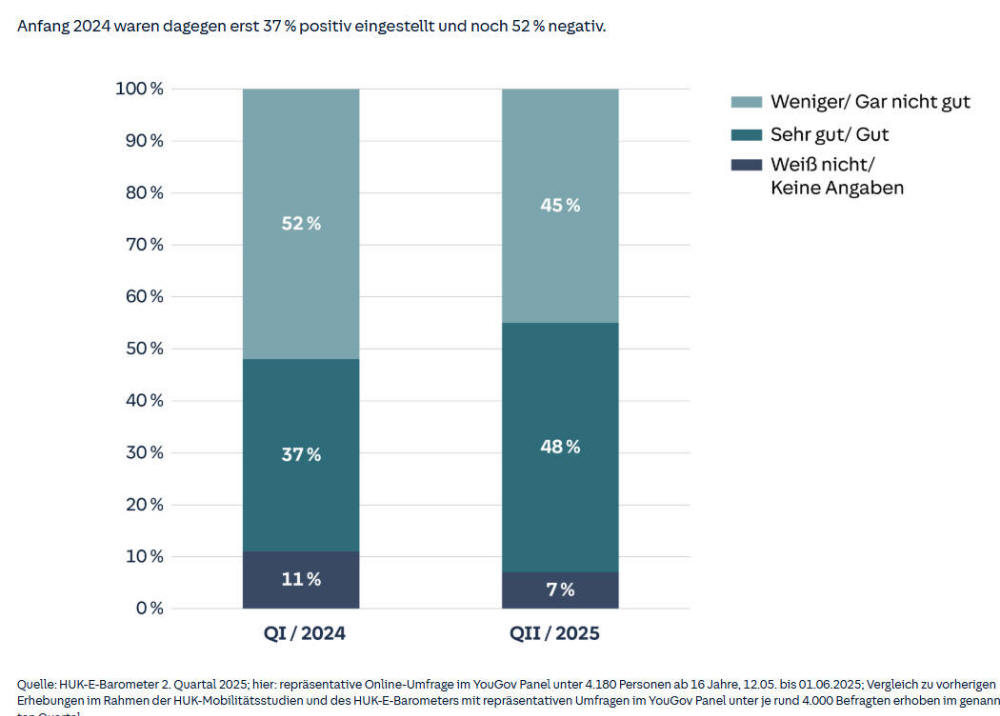
Baden-Württemberg fällt ab, Norddeutschland steigt auf
Beim verstärkten Privatinteresse an Elektroautos fahren im
abgelaufenen Quartal vor allem zwei Bundesländer vorneweg. In
Schleswig-Holstein und Niedersachsen haben die Quoten an E-Autos
gemessen am dortigen gesamten Autobestand am kräftigsten zugenommen.
Bayern und Rheinland-Pfalz folgen dahinter schon mit etwas Abstand.
Die rote Laterne behalten die ostdeutschen Bundesländer Sachsen und
Sachsen-Anhalt wie bereits im gesamten Jahresverlauf 2025.
Überraschend schwächelt aber das Autoland Baden-Württemberg. Beim
Elektro-Anteil am Privatbestand steht es nun erstmals seit fünf
Jahren – dem Beginn der HUK-Auswertung 2020 – nicht mehr unter den
Top-3-Ländern. Begonnen hat dieser Abstieg Mitte 2022. Damals hatte
das Ländle im Bundesländer-Vergleich noch die höchste Bestandsquote
an Elektroautos, bevor es in dieser Kategorie zunächst hinter Bayern
zurückfiel und inzwischen auch Niedersachsen und Schleswig-Holstein
vorbeiziehen lassen muss.
Am stärksten ziehen die
Bestandsquoten an Stromern laut HUK-E-Barometer in
Schleswig-Holstein und Niedersachsen an Beim verstärkten
Privatinteresse an Elektroautos fahren im abgelaufenen Quartal vor
allem zwei Bundesländer vorne weg. In Schleswig-Holstein und
Niedersachsen haben die Quoten an E-Autos gemessen am dortigen
gesamten Autobestand am kräftigsten zugenommen.
Bayern und
Rheinland-Pfalz folgen dahinter schon mit etwas Abstand. Die rote
Laterne behalten die ostdeutschen Bundesländer Sachsen und
Sachsen-Anhalt wie bereits im gesamten Jahresverlauf 2025. Zuwachs
des Anteils von E-Autos am gesamten privaten Autobestand in den
einzelnen Bundesländern im 2. Quartal 2025
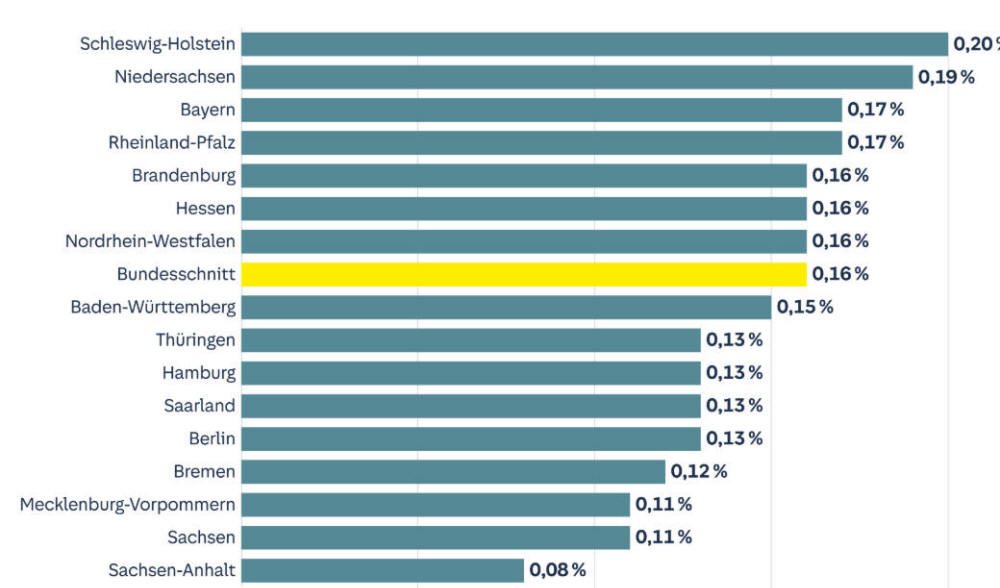
Noch deutlicher hinkt Baden-Württemberg bei den Umstiegen auf
reine Elektroantriebe bei Fahrzeugwechseln hinterher. Im zweiten
Quartal 2025 stiegen in Niedersachsen (6,6%), Bayern (6,4%) und
Hessen (5,9%) die meisten Privatleute von einem Verbrenner- auf
einen Elektromotor um. Für die Autofahrer im Südwesten hingegen
liegt dieser Wert mit nur 4,9 Prozent sogar noch unter dem
Bundesschnitt von 5,5 Prozent.
Jüngere und Männer sind die
größten E-Auto-Fans
Nicht nur regional sind die Unterschiede in
Sachen Elektromobilität groß. Auch zwischen Älteren und Jüngeren
gehen die Einstellungen hierzu deutlich auseinander - und diese
Schere öffnet sich weiter. So bewerten aktuell 65 Prozent der unter
40-Jährigen Elektroautos als „sehr gut“ oder „gut“. Anfang 2024
waren es 49 Prozent. Bei den ab 40-Jährigen ist die Zustimmung
dagegen weit geringer (39 %) und die Steigerung gegenüber Anfang
2024 (31%) auch nur halb so hoch.
Männer zeigen sich
gegenüber Frauen dabei grundsätzlich deutlich positiver gegenüber
E-Autos (55 % zu 41 %). Extrem unterschiedlich sind daher etwa
Einstellungen bei Männern unter 40 Jahren gegenüber Frauen ab 40
Jahren. Hier liegen die Quoten um mehr als das Doppelte auseinander
(73 % zu 34 %). Noch größer sind die Unterschiede bei der
Kaufabsicht. So erklären nur zehn Prozent der Frauen ab 40 Jahren,
sich "künftig grundsätzlich nur noch ein reines Elektroauto"
anschaffen zu wollen. Bei Männern unter 40 Jahren ist die Quote mit
31 Prozent hingegen sogar dreifach höher.
Reichweite schreckt
Vielfahrer offenbar nicht
Auch Vielfahrer finden offenbar
wachsendes Gefallen an E-Mobilität. Wer mehr als 20.000 Kilometer im
Jahr unterwegs ist, bewertet E-Autos aktuell zu 54 Prozent positiv
(„sehr gut“ oder „gut“). Anfang 2024 waren es mit 29 Prozent fast
die Hälfte weniger.
Tatsächlich ziehen auch die Anschaffungen
von E-Autos bei denen an, die vergleichsweise viel fahren. Wer etwa
mehr als 12.000 Kilometer im Jahr unterwegs ist, stieg im zweiten
Quartal 2025 bei Fahrzeugwechseln zu 6,1 Prozent auf Elektroantriebe
um. Diese Umstiegsquote liegt damit um ein Drittel höher als bei
Fahrern mit einer Jahresleistung bis 6.000 Kilometern (4,2 %).
Und eine weitere Messung im zweiten Quartal 2025 ergibt: 80
Prozent derjenigen, die bislang schon ein E-Auto haben und mehr als
12.000 Kilometer im Jahr fahren, wählen beim Fahrzeugwechsel erneut
ein reines E-Auto. Ihre Erfahrungen auf längeren Strecken mit
Reichweite und Lademöglichkeiten sind also offenbar nicht so
schlecht.
Gebrauchte E-Autos als Game Changer
Vermehrte
Wechsel zum E-Auto in der privaten Bevölkerung könnten auch durch
politische Weichenstellungen befördert werden. So plädiert laut
HUK-E-Barometer eine deutliche Mehrheit von 60 Prozent der Deutschen
ab 16 Jahren dafür, dass auch gebrauchte E-Autos bei einer
staatlichen Förderung berücksichtigt werden. Sogar jeder Dritte aus
dieser Gruppe erklärt, dass dann für ihn persönlich die Anschaffung
eines Elektroautos wahrscheinlicher wird.
Dr. Rheinländer:
„Käufe von Gebrauchtwagen sind um ein Vielfaches häufiger als
Zulassungen neuer Fahrzeuge im deutschen Automarkt. Je mehr
Elektroautos im Gebrauchtwagenmarkt daher eine Rolle spielen, desto
stärker werden die Effekte sein –besonders für das Klima."
„Innehalten in der Woche“ in Wanheimerort
Bei Kerzenschein, Musik und Stille vor Gott zur Ruhe und zu sich
zu kommen. Die Idee der besonderen Andacht zum Innehalten während
der Woche hat sich in der Evangelischen Rheingemeinde Duisburg viele
Jahre gut bewährt.
Die Freie Evangelische Gemeinde
Wanheimerort und die Katholische Gemeinde Wanheimerort sind von dem
Konzept auch überzeugt, so dass seit einiger Zeit alle drei
Gemeinden alle zwei Monate gemeinsam zum „Innehalten in der Woche“
einladen.
Das nächste Zusammenkommen ist am Donnerstag, 7.
August 2025 um 18 Uhr in der Gnadenkirche, Paul-Gerhardt-Straße 1.
Weitere Informationen haben Pfarrerin Almuth Seeger (Tel. 0203 /
770607) und Karen Sommer-Loeffen (Tel. 0203 / 727723).
Singen öffnet Körper und Seele Kirchenmusikerin lädt zum
Workshop „Atem-Stimme-Klang - Entfalte deinen Gesang“
Die Landesmusikräte aller Bundesländer haben die Stimme zum
„Instrument des Jahres“ gewählt. Annette Erdmann, Kantorin aus der
Evangelischen Versöhnungsgemeinde Duisburg Süd, lädt Interessierte
aus diesem schönen Anlass ein, sich bei einem Workshop intensiver
mit der eigenen Stimme zu befassen und deren Möglichkeiten zu
entdecken: Am Dienstag, 19. August können Musikfans entweder am
Vormittag von 11 bis 12 Uhr oder am Abend von 19 bis 20 Uhr am
Workshop teilnehmen.
Treffpunkt ist jeweils die
Versöhnungskirche Großenbaum, Lauenburger Allee 23. Die gute Akustik
der Versöhnungskirche lädt dazu ein, den Stimmen Raum zu geben und
beim Singen neue Energie zu gewinnen. Mit praktischen Übungen zu
Atem, Stimme und Klang erhalten die Teilnehmenden die Möglichkeit,
ihr Potential zu entfalten. Gemeinsam soll erlebbar werden, wie das
Singen Körper und Seele öffnet, wie die Stimmen kraftvoller werden
und wie dabei spürbare Freude entsteht.
Interessierte können
sich bis zum 15. August bei Kantorin Annette Erdmann (Tel. 0203 / 76
77 09 oder annette.erdmann@ekir.de) anmelden. Der Workshop ist
kostenfrei. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter www.evgds.de.
Pfarrerin Lahann am nächsten Freitag in
der Kircheneintrittsstelle
Immer freitags können
Unsichere, Kirchennahe oder solche, die es werden möchten, in der
Eintrittsstelle in der Salvatorkirche mit Pfarrerinnen, Pfarrern und
Prädikanten ins Gespräch kommen. Motive für den Kircheneintritt gibt
es viele: Die Suche nach Gemeinschaft, Ordnung ins Leben bringen
oder der Wunsch, Taufen, Hochzeiten, Bestattungen kirchlich zu
gestalten.
Aufnahmegespräche führt das Präsenzteam in der
Eintrittsstelle an der Salvatorkirche immer freitags von 14 bis 17
Uhr. Am Freitag, 1. August 2025 heißt Krankenhauspfarrerin Dörthe
Lahann Menschen in der Südkapelle des Gotteshauses neben dem Rathaus
herzlich willkommen. Infos zur Citykirche gibt es unter
www.salvatorkirche.de.

Bierabsatz im 1. Halbjahr 2025 um 6,3 % niedriger als im
Vorjahreszeitraum
Brauereien und Bierlager verzeichnen
absatzschwächstes Halbjahr seit 1993
Der Bierabsatz in
Deutschland ist im 1. Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum
um 6,3 % oder 262 Millionen Liter auf rund 3,9 Milliarden Liter
gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, fiel
der Bierabsatz damit erstmals seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1993
in einem Halbjahr unter 4 Milliarden Liter. In den Zahlen sind
alkoholfreie Biere und Malztrunk sowie das aus Ländern außerhalb der
Europäischen Union (EU) importierte Bier nicht enthalten.
Ähnlich starker Rückgang nur zu Beginn der Corona-Pandemie
Vergleichbar hohe Absatzrückgänge hatten die in Deutschland
ansässigen Brauereien und Bierlager bisher nur zu Beginn der
Corona-Pandemie im 1. Halbjahr 2020 (-6,6 % zum Vorjahreszeitraum
auf 4,3 Milliarden Liter) sowie im 2. Halbjahr 2023 (-6,2 % auf
4,2 Milliarden Liter) verzeichnet.
Inlandsabsatz sinkt um
6,1 % zum Vorjahreszeitraum, Exporte gehen um 7,1 % zurück 81,9 %
des gesamten Bierabsatzes waren im 1. Halbjahr 2025 für den
Inlandsverbrauch bestimmt und wurden versteuert. Der Inlandsabsatz
sank im Vergleich zum 1. Halbjahr 2024 um 6,1 % auf
3,2 Milliarden Liter. Die restlichen 18,1 % beziehungsweise
711,2 Millionen Liter wurden steuerfrei (als Exporte und als
sogenannter Haustrunk) abgesetzt.
Das waren 7,1 % weniger
als im Vorjahr. Davon gingen 406,9 Millionen Liter (-5,0 %) in
EU-Staaten, 299,6 Millionen Liter (-9,9 %) in Nicht-EU-Staaten und
4,7 Millionen Liter (-8,0 %) unentgeltlich als Haustrunk an die
Beschäftigten der Brauereien. Bei den Biermischungen – Bier gemischt
mit Limonade, Cola, Fruchtsäften und anderen alkoholfreien Zusätzen
– war im 1. Halbjahr dagegen ein Plus zu verzeichnen. Gegenüber dem
1. Halbjahr 2024 wurden 8,0 % mehr Biermischungen abgesetzt. Sie
machten mit 220,8 Millionen Litern allerdings nur 5,6 % des gesamten
Bierabsatzes aus.
Zum Tag des Bieres: Produktion von alkoholfreiem Bier
mit +96,1 % in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt
Biergenuss ohne Alkohol – das wird in Deutschland immer
beliebter. Im Jahr 2024 wurden hierzulande knapp 579 Millionen Liter
alkoholfreies Bier im Wert von rund 606 Millionen Euro produziert.
Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) zum Internationalen Tag
des Bieres am 1. August mitteilt, hat sich die zum Absatz bestimmte
Produktionsmenge von alkoholfreiem Bier in den vergangenen zehn
Jahren damit fast verdoppelt (+96,1 %). 2014 hatte sie noch bei gut
295 Millionen Litern gelegen.
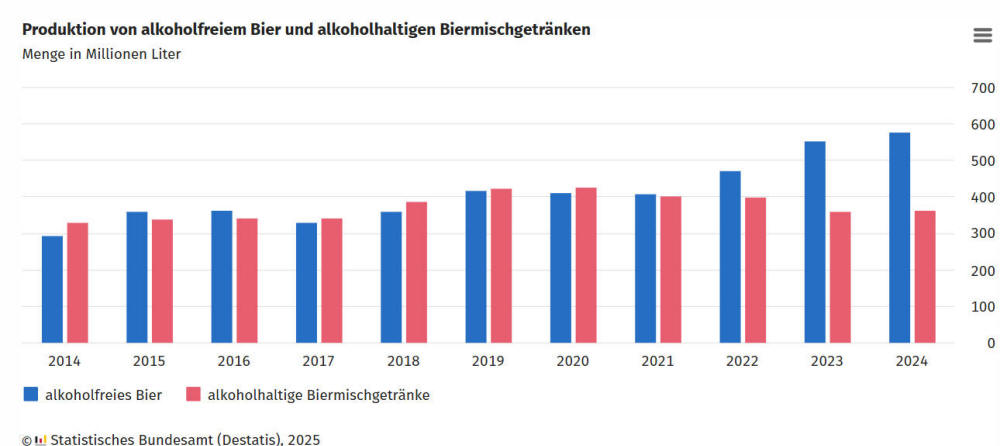
Allerdings wird hierzulande immer noch deutlich mehr Bier mit
Alkohol produziert: Im Jahr 2024 haben die Brauereien in Deutschland
gut 7,2 Milliarden Liter alkoholhaltiges Bier im Wert von rund
6,6 Milliarden Euro hergestellt. Insgesamt ist die Produktion von
alkoholhaltigem Bier in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren
jedoch um 14,0 % zurückgegangen.
2014 wurden hierzulande
noch gut 8,4 Milliarden Liter alkoholhaltiges Bier produziert.
Während damals noch gut 28 Liter Bier mit Alkohol auf einen Liter
alkoholfreies Bier kamen, waren es 2024 rund 12 Liter. Produktion
von alkoholhaltigen Biermischgetränken mit deutlich geringerer
Zunahme Niedrigprozentiger als reguläres Bier, aber nicht gänzlich
alkoholfrei sind Biermischgetränke wie etwa Radler.
Deren
Produktion nahm in den vergangenen zehn Jahren ebenfalls zu: von
knapp 333 Millionen Litern im Jahr 2014 auf rund 364 Millionen Liter
im Jahr 2024. Das entspricht einem Zuwachs von 9,3 %. Im
Zehn-Jahres-Vergleich fällt der Anstieg somit deutlich geringer aus
als bei der Produktion von alkoholfreiem Bier.
NRW-Inflationsrate liegt im Juli 2025 bei 1,8 %
*
Preise für Bohnenkaffee gestiegen (+21,6 %).
* Energiepreise
sanken im selben Zeitraum (−2,2 %).
* Preis für die stationäre
Pflege stieg u. a. für gesetzlich Versicherte um 5,8 %.
Die
Inflationsrate in Nordrhein-Westfalen – gemessen als Veränderung des
Verbraucherpreisindex zum Vorjahresmonat – liegt im Juli 2025 bei
1,8 %. Wie das StatistischesLandesamt mitteilt, stieg der Preisindex
gegenüber dem Vormonat (Juni 2025) um 0,2 %.
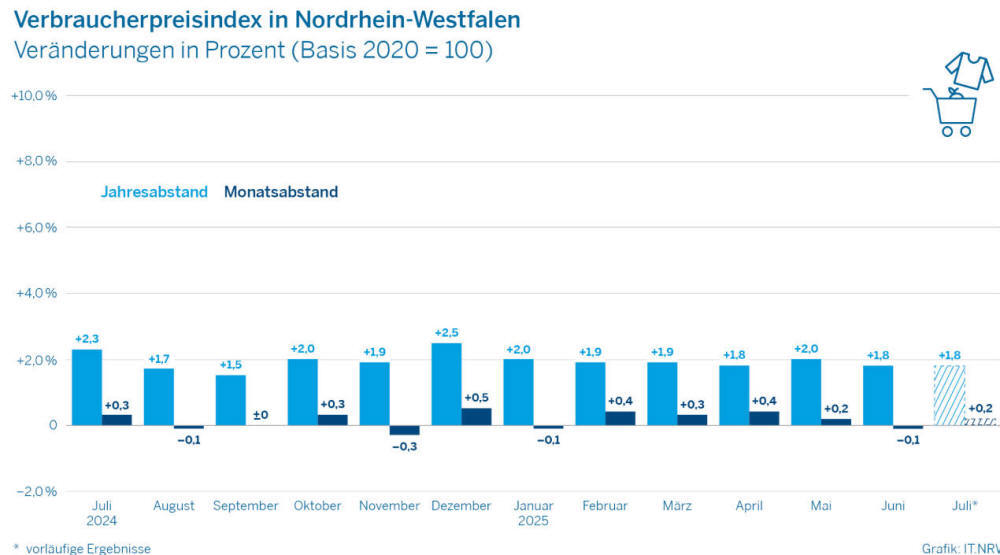
Vorjahresvergleich: Preise für Obst um 10,3 % gestiegen Zwischen
Juli 2024 und Juli 2025 stiegen u. a. die Preise für Obst um 10,3 %,
darunter beispielsweise Zitrusfrüchte (+23,4 %) sowie Pfirsiche,
Kirschen oder anderes Stein-/Kernobst (+21,8 %). Die Preise für
Bohnenkaffee zogen um 21,6 %, die für Pralinen um 20,6 % und die für
Schokoladentafeln um 16,4 % an.
Der Preis für die stationäre
Pflege stieg u. a. für gesetzlich Versicherte um 5,8 %. Dies steht
auch im Zusammenhang mit der jährlichen Rentenanpassung wodurch die
zu zahlenden Eigenanteile gestiegen sind. Die Energiepreise wirken
nach wie vor preisdämpfend auf die Inflation: So sanken diese im
Vergleich zum Vorjahresmonat um durchschnittlich 2,2 %: Dabei wurden
Haushaltsenergien um 0,3 % und Kraftstoffe um 5,2 % günstiger
angeboten.
Vormonatsvergleich: Paprika um 8,6 % günstiger
als im Juni 2025 Zwischen Juni 2025 und Juli 2025 sanken z. B. die
Preise für Bekleidung: Bekleidung für Kinder wurde 4,2 % sowie für
Damen und Herren jeweils 3,7 % günstiger angeboten. Im Bereich der
Nahrungsmittel verzeichnete u. a. Butter einen Preisrückgang
(−3,5 %).
Gemüse wurde um durchschnittlich 1,8 % günstiger
angeboten, insbesondere Paprika (−8,6 %) sowie Kopf-/Eisbergsalat
(−5,6 %). Gleichzeitig verteuerten sich beispielsweise Gurken um
9,4 %, Äpfel um 4,6 % und Hartkäse um 3,7 %. Ebenso wurden
Fitnessgeräte binnen Monatsfrist um 3,8 % teurer.
Wichtige
Preisveränderungen
https://www.it.nrw/system/files/media/document/file/220_25.xlsx
XLSX, 25,74 KB
NRW: 4 von 5 Personen mit Migrationshintergrund sprachen
2024 zu Hause Deutsch
* 18,4 % sprachen zu Hause gar
kein Deutsch.
* Deutliche Unterschiede zwischen selbst
Eingewanderten und ihren Nachkommen.
* Türkisch, Arabisch und
Russisch häufigste ausländische Sprachen.
Im Jahr 2024
lebten rund 5,69 Millionen Personen mit Migrationshintergrund in
NRW. Von diesen sprachen mit 26,7 % über ein Viertel zu Hause
ausschließlich Deutsch. Wie das Statistische Landesamt anhand von
Erstergebnissen des Mikrozensus 2024 weiter mitteilt, lebten 54,8 %
in einem Haushalt, in dem neben Deutsch mindestens eine weitere
Sprache gesprochen wurde. 18,4 % der Personen mit
Migrationshintergrund in NRW sprachen 2024 zu Hause gar kein
Deutsch.
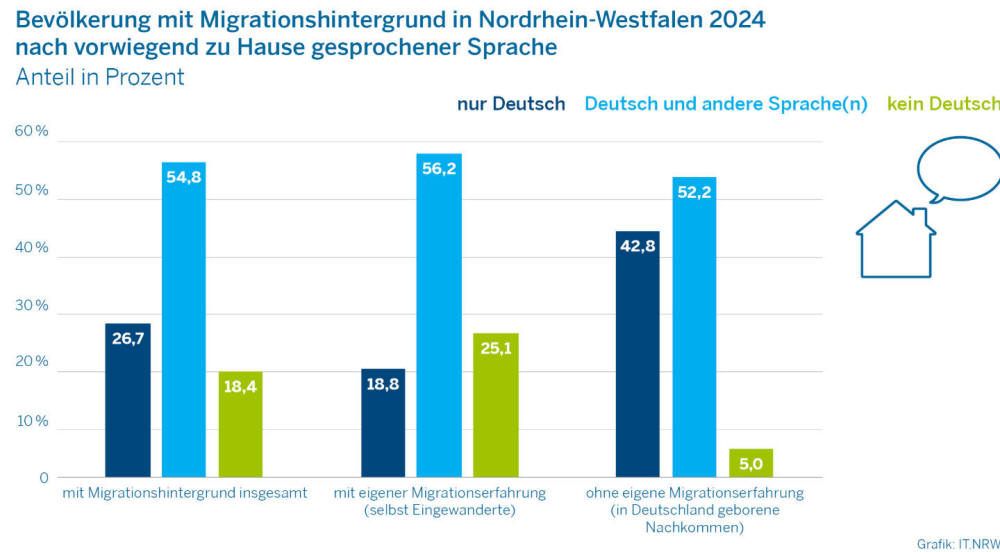
Deutliche Unterschiede zwischen Eingewanderten und ihren
Nachkommen Personen, die selbst nach 1955 nach Deutschland
eingewandert sind, sprechen in den eigenen vier Wänden seltener
Deutsch als ihre direkten Nachkommen. In 2024 verständigten sich
18,8 % der Eingewanderten zu Hause ausschließlich auf Deutsch, bei
Kindern von Eingewanderten lag dieser Anteil mit 42,8 % mehr als
doppelt so hoch.
Demgegenüber sprachen 25,1 % der
Eingewanderten zu Hause gar kein Deutsch, bei den direkten
Nachkommen von Eingewanderten lag dieser Anteil bei nur 5,0 %.
Türkisch, Russisch und Arabisch häufigste ausländische Sprachen Von
Personen mit Migrationshintergrund insgesamt, bei denen im Haushalt
neben Deutsch noch mindestens eine andere Sprache gesprochen wird,
unterhielten sich 21,5 % überwiegend auf Deutsch.
Am
zweithäufigsten wurde Türkisch (15,0 %) als hauptsächlich verwendete
Sprache genannt, gefolgt von Russisch (10,3 %), Arabisch (9,8 %) und
Polnisch (6,6 %). Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund, die zu
Hause gar kein Deutsch spricht, verständigte sich dort am häufigsten
auf Türkisch (12,5 %), Russisch (10,7 %), Arabisch (10,5 %),
Ukrainisch (9,0 %) und Polnisch (7,7 %).
37 400 erfolgreich ausgebildete Pflegefachfrauen und
-männer im Jahr 2024
• 59 400 neu abgeschlossene
Ausbildungsverträge zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann
• Rund
ein Fünftel der Auszubildenden in der Pflege sind älter als 30 Jahre
• 1 200 Studierende befinden sich in einem Studiengang zur
Pflegefachperson
Im Jahr 2024 haben im zweiten
Abschlussjahrgang nach Einführung der generalistischen
Pflegeausbildung etwa 37 400 Personen ihre Ausbildung zur
Pflegefachfrau beziehungsweise zum Pflegefachmann erfolgreich
beendet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt,
wählten dabei weiterhin die meisten Absolventinnen und Absolventen
(99 %) die 2020 bundesweit eingeführte generalistische
Berufsbezeichnung und nur rund 1 % erwarb einen Abschluss mit
Schwerpunkt Gesundheits- und Kinderkrankenpflege (rund 280
Abschlüsse) oder Altenpflege (rund 80 Abschlüsse).
9 % mehr neu abgeschlossene
Ausbildungsverträge als im Vorjahr
Knapp 59 400 Personen haben
im Jahr 2024 eine berufliche Ausbildung zur Pflegefachfrau
beziehungsweise zum Pflegefachmann begonnen. Insgesamt stieg damit
die Zahl der neuen Ausbildungsverträge unter den Auszubildenden
gegenüber dem Vorjahr (2023: 54 400) um rund 9 % an.
Insgesamt, also über alle Ausbildungsjahre hinweg, befanden sich
146 700 Personen in einer solchen Pflegeausbildung (2023: 146 900).
Ein Fünftel der Auszubildenden sind 30 Jahre oder älter, drei
Viertel sind Frauen Die Hälfte der Pflegeauszubildenden, die 2024
ihre Ausbildung begonnen haben, war 21 oder jünger.
Das
Durchschnittsalter lag bei 24 Jahren. Mit 19 % begannen aber auch
viele Personen ab einem Alter von über 30 Jahren noch eine
Ausbildung zur Pflegefachperson. Über alle Ausbildungsjahre hinweg
waren 21 % der Pflegeauszubildenden 30 Jahre oder älter. Knapp drei
Viertel aller Pflegeauszubildenden zum Ende des Jahres (74 %) waren
Frauen und gut ein Viertel (26 %) Männer.
Neue Auszubildende
vor allem in Krankenhäusern und stationären Pflegeeinrichtungen
beschäftigt
Der praktische Teil der Ausbildung zur
Pflegefachperson kann in einem Krankenhaus, einer stationären
Pflegeeinrichtung oder einer ambulanten Pflegeeinrichtung absolviert
werden. Im Jahr 2024 absolvierten die Pflegeauszubildenden mit neu
abgeschlossenem Ausbildungsvertrag mit rund 51 % (30 300) besonders
häufig ihre Ausbildung in Krankenhäusern.
Darauf folgten
stationäre Pflegeeinrichtungen mit 35 % (21 000) und anschließend
ambulante Pflegeeinrichtungen mit einem Anteil von rund 11 %
(6 700). Im Hinblick auf die Art der Trägerschaft begannen 44 % oder
26 100 der neuen Pflegeauszubildenden ihre berufliche Ausbildung bei
einem freigemeinnützigen Träger, also in Einrichtungen, die einer
sozialen, humanitären oder religiösen Vereinigung angehören.
29 % (17 000) der neuen Auszubildenden fingen bei einem privaten
Träger an und 25 % (14 900) bei einem öffentlichen Träger der
praktischen Ausbildung. 1 200 Studierende im Pflegestudium nach dem
Pflegeberufegesetz Im Jahr 2024 konnten erstmals Zahlen zu
Studierenden im Pflegestudium nach dem Pflegeberufegesetz ermittelt
werden.
Zum Jahresende befanden sich insgesamt etwa
1 200 Studierende in einem Pflegestudium, davon
740 Studienanfängerinnen und -anfänger. Den Bachelor-Abschluss
inklusive einer Berufszulassung zur Pflegefachperson erreichten 2024
rund 140 Studierende. An einigen Hochschulen konnte das Studium
bereits vor 2024 begonnen werden.