






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 31. Kalenderwoche:
1. August
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Samstag, 2., Sonntag, 3. August 2025
Nach Brandanschlag in Düsseldorf: Bahnstrecke wieder
befahrbar
Die Deutsche Bahn hat die Schäden an der
Infrastruktur zwischen Duisburg und Düsseldorf erfolgreich behoben.
Bis in die Nacht haben rund 30 Fachleute der DB an der Reparatur der
Kabel gearbeitet. Insgesamt musste das Team fünf Kabel mit jeweils
einer Länge von rund 20 Metern erneuern. Am späten Abend waren die
Kabel wiederhergestellt.
Nach den abschließenden
Probefahrten konnte die Strecke wieder freigegeben werden. Seit dem
frühen Morgen fahren die ersten Züge zwischen Duisburg und
Düsseldorf wieder regulär. Der Schienenersatzverkehr ist nicht mehr
nötig. Es kann allerdings nach der langen Unterbrechung anfangs noch
zu einzelnen Verzögerungen im Zugverkehr kommen.

Sie fahren wieder...
BZ haje
Die Reparaturen waren nach einem Brandanschlag auf
Infrastrukturanlagen der DB an zwei unterschiedlichen Stellen
notwendig geworden. Dies führte zu erheblichen Einschränkungen im
Fern- und Regionalverkehr. Täglich mehrere hundert Züge, die über
diesen Abschnitt durch das Ruhrgebiet fahren, waren betroffen.
Einige Zügen wurden umgeleitet, andere endeten vorzeitig.
Die Auswirkungen des Brandanschlags haben zehntausende Reisende zu
spüren bekommen - Pendlerinnen und Pendler genauso wie
Urlaubsreisende, beispielsweise auf ihrer Anreise zum Flughafen
Düsseldorf.

Der erste Schaden war bereits am Donnerstagmorgen aufgefallen. Nach
den Ermittlungen der Behörden starteten die Reparaturarbeiten. Kurz
vor Abschluss der Reparaturen in der Nacht zu Freitag hatten
Mitarbeitende einen zweiten Schaden entdeckt. Seit Freitagmittag
liefen die Kabelarbeiten, die nun letzte Nacht erfolgreich beendet
werden konnten.
Die Deutsche Bahn dankt allen Reisenden für
ihr Verständnis und ihre Geduld.
Am Freitagabend hat es einen
weiteren Kabelbrand an einer Bahnstrecke in Höhe Webau, einem
Ortsteil der Stadt Hohenmölsen in Sachsen-Anhalt, gegeben. Ersten
Ermittlungen zufolge liegt auch diesem Kabelbrand eine Brandstiftung
zugrunde. Es handelt sich um eine Güterverkehrsstrecke für
Kohletransporte.
Bürgerservice der Stadt: Wohnsitzanmeldung ab sofort digital
möglich
Die Stadt Duisburg macht einen weiteren Schritt
in Richtung Digitalisierung und Bürgerfreundlichkeit: Wer nach dem
Umzug nach Duisburg oder innerhalb der Stadt seinen neuen Wohnsitz
anmelden will, kann dies ab sofort mit Smartphone, Tablet oder PC
ortsunabhängig erledigen.
Um die elektronische
Wohnsitzanmeldung nutzen zu können, benötigen Bürgerinnen und Bürger
ein Bund-ID-Konto mit der Login-Funktion eID. Dies bedeutet, dass
man den Personalausweis bzw. für Unionsbürger die eIDKarte mit
aktivierter Online-Funktion sowie die dazugehörige PIN zur Anmeldung
nutzen muss. Dies stellt sicher, dass nur man selbst
Behördenangelegenheiten online wahrnehmen kann.
Wie bisher
ist für die An- bzw. Ummeldung weiterhin auch eine
Wohnungsgeberbescheinigung notwendig. Diese muss als PDF-Datei
hochgeladen werden und wird anschließend von Mitarbeitenden im
Bürgerservice geprüft. Die Nutzung der elektronischen Anmeldung ist
online unter www.wohnsitzanmeldung.de mithilfe einer
benutzerfreundlichen Oberfläche möglich.
Dort wird man
Schritt für Schritt durch den Anmeldeprozess geführt und innerhalb
weniger Minuten ist die digitale Wohnsitzanmeldung abgeschlossen.
Anschließend erhält man an den neuen Wohnsitz per Post einen
Aufkleber mit Adresse, der auf den Personalausweis aufgeklebt wird.
Der Online-Service eignet sich insbesondere für Menschen mit
eingeschränkter Mobilität und Berufstätige, da dieser auch außerhalb
der Öffnungszeiten der Bürger-Service-Stationen genutzt werden kann.
Weiterhin ist auch die persönliche Vorsprache in einer der
sieben BürgerService-Stationen mit einem Online-Termin möglich.
Weitere wichtige Informationen zur elektronischen Wohnsitzanmeldung
sind auf der der städtischen Internetseite unter www.duisburg.de
(Stichwort: „Elektronische Wohnsitzanmeldung“) abrufbar.
Stadt Duisburg erweitert Netz der Trinkwasserbrunnen in
allen Stadtbezirken
Die Stadt Duisburg geht einen
weiteren wichtigen Schritt in Richtung Klimaanpassung und mehr
Lebensqualität: In den kommenden Wochen werden in sechs
Stadtbezirken moderne Trinkwasserbrunnen aufgestellt.
Oberbürgermeister Sören Link, Matthias Simons, Leiter des
Umweltamtes sowie Dr. Thomas Griebe, Abteilungsleiter im Umweltamt,
stellen am Montag, 11. August 2025, um 11 Uhr Kometenplatz,
47179 Duisburg-Walsum, das Pilotprojekt vor und nehmen den ersten
Trinkwasserbrunnen auf dem Kometenplatz in Duisburg-Walsum in
Betrieb.
Gebührenvergleich 2025 für Abwasser in NRW
Der Bund der Steuerzahler gibt jährlich einen Vergleich der Abfall-
und Awassergebühren in NRW heraus. Am 1. August hat Rik Steinheuer,
Vorsitzender des BdSt NRW, die aktuellen Zahlen für 2025 und die
Forderungen des BdSt auf der Landespressekonferenz in Düsseldorf
vorgestellt:
Wenn Wasserentsorgung zum Luxus wird
Die
Abwassergebühren in NRW erreichen neue Höchststände. Fast 5,1 % mehr
– das ist die durchschnittliche Steigerung der Abwassergebühren in
NRW für 2025. Für den Musterhaushalt des BdSt (vier Personen, 200 m³
Schmutzwasser und 130 m² versiegelte Fläche) bedeutet das eine
Jahresrechnung von teils über 1.000 Euro – in 77 von 370 Kommunen,
die sich an der BdSt-Kommunalumfrage beteiligt haben. Im vergangenen
Jahr war es nur in 57 Kommunen so teuer.
Extreme Unterschiede
zwischen den Kommunen
Die Bandbreite ist enorm: Während in Reken
nur 330 Euro fällig werden, verlangt Monschau satte 1.688 Euro –
über 400 % Unterschied für dieselbe Leistung. In einigen Städten wie
Halle, Wülfrath oder Vreden sind die Gebühren binnen eines Jahres
sogar um über 25 % gestiegen.
Woran liegt das? Der BdSt NRW
hat die Ursachen analysiert:
Preissteigerungen bei den
Wasserwirtschaftsverbänden, die von den Kommunen an die
Gebührenzahler weitergegeben werden
Tarifbedingte höhere
Personalkosten
Neue gesetzliche und technische Vorgaben (z. B.
EU-Wasserrahmenrichtlinie, vierte Reinigungsstufe)
Und vor allem:
kalkulatorische Abschreibungen vom teuren Wiederbeschaffungszeitwert
statt von den günstigeren Anschaffungskosten
Der letzte Punkt
ist besonders brisant, denn die Abschreibungen vom
Wiederbeschaffungszeitwert sind auf dem Vormarsch: 2022 haben 51 %
der Kommunen vom teureren Wiederbeschaffungszeitwert abgeschrieben,
heute sind es schon 55 %. Dieser Trend ist ein langfristiger. Im
Jahr 2010 waren die Kommunen, die vom Wiederbeschaffungszeitwert
abgeschrieben haben, mit 37,5 % noch deutlich in der Minderzahl. Die
Folge: höhere Gebühren für die Verbraucher und damit eine versteckte
Mehrbelastung bei den Wohnkosten für Grundstückseigentümer und
Mieter.
Was der BdSt NRW fordert
Abschreibungen sollen
sich am Anschaffungswert orientieren – nicht am teureren
Wiederbeschaffungszeitwert. Solange die Kommunen in NRW vom
Wiederbeschaffungszeitwert abschreiben dürfen, sollte das KAG
verbindlich regeln, dass der Abwassergebührenzahler den allgemeinen
Haushalt der Kommune nicht subventioniert.
Generell klare
gesetzliche Regelungen: Gewinne aus Gebührenhaushalten dürfen nicht
in den allgemeinen Haushalt abfließen. Doppelbelastungen für
Eigentümer (z. B. durch Abschreibung beitragsfinanzierten Vermögens)
müssen gesetzlich verhindert werden.
NRW sollte sich an
gesetzlichen Vorbildern wie Sachsen und Brandenburg orientieren.
Lichtblicke gibt es auch Es geht auch anders: Kommunen wie Welver,
Emsdetten, Rosendahl oder Sonsbeck senken die Gebühren – zum
Beispiel, indem sie Überschüsse aus Vorjahren zur Entlastung der
Bürger nutzen.
Der BdSt sagt:
„Viele Kommunen nutzen die
Spielräume im Gesetz zu Lasten der Gebührenzahler aus. Das muss ein
Ende haben“, betont Rik Steinheuer, Vorsitzender des BdSt NRW. „Wir
brauchen gesetzliche Leitplanken, damit Gebühren nicht zur
versteckten Einnahmequelle werden.
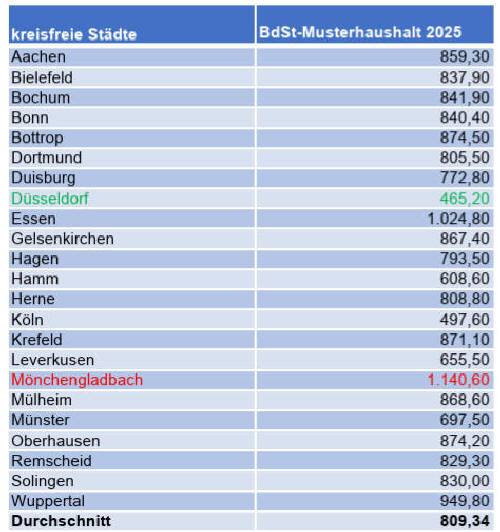
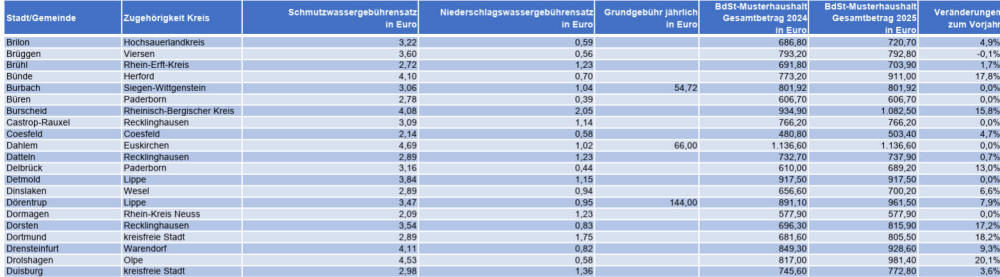
Studio Duisburg unterwegs: Media Day beim
MSV Duisburg
Manchmal verlassen auch wir unsere
gewohnten vier Wände – und genau das war jetzt wieder der Fall:
Das Studio Duisburg war außer Haus, denn wir durften den
diesjährigen Media Day des MSV Duisburg fotografisch begleiten.

Auf dem Programm standen nicht nur das offizielle Mannschaftsfoto,
sondern auch neue Porträts der Spieler, Freisteller für Presse und
Social Media sowie atmosphärische Moody-Pictures, die den Charakter
jedes Einzelnen noch besser einfangen. Ein spannender Tag mit viel
Energie, Teamgeist – und natürlich Zebra-Feeling pur!
Verhaltener Start für Ausbildungsjahr 2025
IHK
veröffentlicht Zahlen – späterer Start für Jugendliche möglich
Minus rund 5,5 Prozent: Die Zahl neuer
Ausbildungsverträge ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Das
betrifft Industrie, Handel und den Dienstleistungssektor. Die
unsichere wirtschaftliche Lage lässt viele Betriebe aber auch
Jugendliche abwarten, bevor sie sich für eine Ausbildung entscheiden
– gerade in der Industrie. Aktuell gibt es noch viele Branchen und
Betriebe, die händeringend suchen, weiß Matthias Wulfert, Leiter
Aus- und Weiterbildung der Niederrheinischen IHK.

Foto IHK/Jacqueline Wardeski
„Der Ausbildungsmarkt am
Niederrhein steht unter Druck. Azubis werden in allen Bereichen
gesucht, ob hinter der Maschine, an der Ladentheke oder am Computer.
Obwohl das Ausbildungsjahr startet, ist es nicht zu spät, sich noch
zu bewerben. Gleichzeitig beobachten wir, dass Unternehmen
zurückhaltend offene Stellen besetzen. Aber auch Jugendliche
überlegen länger. Das führen wir klar auf die wirtschaftspolitischen
Unsicherheiten zurück. Trotzdem bestehen für junge Menschen
weiterhin gute Einstiegsmöglichkeiten. Wer jetzt aktiv wird, kann
noch dieses Jahr eine Ausbildung beginnen.“
IHK vermittelt
noch Ausbildungsberufe für 2025
Eine Übersicht über alle freien
Ausbildungsplätze stellt die IHK unter ausbildung.nrw zur Verfügung.
Jugendliche, die noch auf der Suche nach einem passenden
Ausbildungsplatz sind, können sich auch bei Julien Piron,
piron@niederrhein.ihk.de,
0203 2821-498, melden.
Neue Koordinatorin
für den Kinder- und Jugendhospizdienst am Malteser Hospizzentrum St.
Raphael
Christina Jakubiak ist die Nachfolgerin von
Andrea Kleinefehn, die in den Ruhestand gegangen ist. Ihren ersten
Kontakt mit der Kinder- und Jugendhospizarbeit bekam Christina
Jakubiak über ihr ehrenamtliches Engagement: Als singendes Mitglied
der Musikband „Fighting Spirits“, die sich an Kinder mit
onkologischen Erkrankungen und ihre Familienmitglieder und
Wegbegleiter richtet, erfuhr sie von den Möglichkeiten der
wertvollen Unterstützung betroffener Familien.
Heute, einige
Jahre danach, ist sie selbst Koordinatorin des Kinder- und
Jugendhospizdienstes der Malteser in Duisburg. Zum 1. August hat sie
diese wichtige Aufgabe von Andrea Kleinefehn übernommen, die in den
Ruhestand gegangen ist. Jakubiaks Vorgängerin hatte den
Kinderhospizdienst vor rund 15 Jahren mit aufgebaut und seitdem mehr
als 120 Familien begleitet. „Es war die beste und erfüllendste Zeit
in meinem Berufsleben“, sagte Kleinefehn zum Abschied. „Mit
Christina Jakubiak haben wir eine Koordinatorin gefunden, die mit
viel Herzblut, neuen Ideen und Freude an der Arbeit den Dienst
professionell weiterführen wird.“
Nach einem halben Jahr
der Einarbeitung ist Christina Jakubiak nun erste Ansprechpartnerin
für alle Belange, die Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
betreffen. „Unser ältester Patient ist 30 Jahre alt“, erzählt sie.
„Bereits im Kindesalter war bei ihm eine schwere, lebensverkürzende
Erkrankung festgestellt worden.“
In der Regel werden
Patienten bis zum 27. Lebensjahr vom Kinder- und Jugendhospizdienst
betreut. Um ältere Menschen mit schwersten Erkrankungen kümmert sich
dagegen der ambulante Palliativ- und Hospizdienst der Malteser.
Christina Jakubiak, vor 30 Jahren in Solingen geboren und inzwischen
in Tönisvorst zuhause, ist gelernte Heilerziehungspflegerin.
Vor ihrer jetzigen Aufgabe war sie sieben Jahre lang als
Pflegekraft in einem stationären Kinderhospiz in Düsseldorf tätig.
In Duisburg nimmt sie die Anfragen von Familien entgegen und
vermittelt die passenden ehrenamtlichen Kräfte: Rund 30 Helferinnen
und Helfern des Kinderhospizdienstes betreuen aktuell etwa 25
Familien in Duisburg und Mülheim. Dabei sorgen sie unter anderem für
eine regelmäßige Entlastung der Eltern und widmen sich den
Geschwisterkindern.
Die neue Koordinatorin ist außerdem
Ansprechpartnerin für die Kindertrauergruppe am Malteser
Hospizzentrum St. Raphael: Hier bekommen junge Menschen, die um
einen geliebten Menschen trauern, in einem geschützten Raum
Unterstützung von geschulten Honorarkräften. „Es ist uns ein großes
Anliegen, die Themen Sterben, Tod und Trauer zu enttabuisieren“,
sagt Jakubiak.
„Daher arbeiten wir auf Wunsch auch gerne mit
Schulen zusammen, gehen in den Religions- und
Philosophieunterricht.“ Christina Jakubiak will auch verstärkt auf
Social Media-Kanäle setzen, um falsche Vorstellungen von der
Hospizarbeit auszuräumen und weitere Ehrenamtlerinnen und
Ehrenamtler für diese Tätigkeit zu gewinnen.
Der nächste
Vorbereitungskurs im September ist mit 14 Teilnehmenden zwar schon
ausgebucht. „Im kommenden Jahr wird das Malteser Hospizzentrum St.
Raphael aber wieder zwei Kurse für die ehrenamtliche Begleitung von
jungen und älteren Menschen anbieten“, so Jakubiak. Jeweils ein Kurs
findet in den Stadtteilen Huckingen und Homberg statt. „Die
Teilnehmenden kommen nicht nur aus Duisburg, sondern beispielsweise
auch aus Krefeld und Oberhausen.“
Wer sich für Arbeit des
Kinder- und Jugendhospizdienstes interessiert, erreicht Christina
Jakubiak im Malteser Hospizzentrum St. Raphael an der Remberger
Straße 36 telefonisch unter 0203 6085-2010 sowie per E-Mail:
christina.jakubiak@malteser.org

Christina Jakubiak (l.) hat die Aufgabe von Andrea Kleinefehn
übernommen. Ihre Vorgängerin hatte sie ein halbes Jahr lang
eingearbeitet. Foto: Malteser
Rheinhausen: nächste Dreck-weg-Aktion
Der
Verein „Du bist Rheinhausen“ startet am 09.08.2025 um 10.00 Uhr an
der Bezirksbibliothek Rheinhausen, Händelstraße 6 in 47226 Duisburg
eine weitere Dreck-weg-Aktion und knöpft sich bis 12.00 Uhr das
Gebiet rund um die Bibliothek vor. Alle Rheinhauser*innen sind
eingeladen mitzumachen und mögen sich bitte im Internet auf
du-bist-rheinhausen.de anmelden.
Wie gewohnt werden
Mitstreiterinnen und Mitstreiter mit Allem ausgestattet, was sie
brauchen: Handschuhe, Greifzangen, Müllsäcke und Eimer stehen
bereit. Du bist Rheinhausen e.V. Ackerstr. 16, 47229 Duisburg
E-Mail:
horst@du-bist-rheinhausen.de Du bist Rheinhausen ist eine
Anlaufstelle für Menschen in Rheinhausen, die die Ärmel hochkrempeln
und ihre Heimat gestalten möchten. Seien es bestehende Initiativen,
Vereine oder Einzelne, die Ideen haben, die sich gemeinsam leichter
umsetzen lassen.
MSV
Duisburg – VfB Stuttgart II: DVG setzt zusätzliche Busse ein
Für Gäste des Fußballspiels MSV Duisburg gegen den VfB Stuttgart II
am Samstag, 2. August, um 16.30 Uhr in der Schauinsland-Reisen
Arena, setzt die DVG ihre Sportlinie 945 ein.
Abfahrtszeiten
Buslinie 945 Richtung MSV Arena:
ab „Salmstraße“ (Meiderich)
Abfahrt um 14.36, 14.46, 14.56 Uhr
ab „Bergstraße“ um 14.41,
14.51 und 15.01 Uhr
ab „Meiderich Bahnhof“ ab 14.45 bis 15.10 Uhr
alle fünf Minuten
ab „Großenbaum Bahnhof Ost“ um 15.20 und 15.35
Uhr
ab „Betriebshof am Unkelstein“ ab 14.28 bis 14.53 Uhr alle
fünf Minuten
ab Hauptbahnhof (Verknüpfungshalle) ab 14.40 bis
16.05 Uhr alle fünf Minuten
ab „Businesspark Nord“ (Asterlagen)
um 15.03 Uhr .

DVG-Foto
Nach Spielende stehen am Stadion Busse für die
Rückfahrt bereit. Gäste des Fußballspieles, die eine
Tageseintrittskarte im Vorverkauf erworben haben oder eine
Dauerkarte besitzen, können kostenlos die öffentlichen
Verkehrsmittel für die Hin- und Rückfahrt benutzen. Für die Gäste,
die sich an der Stadionkasse ihre Eintrittskarte kaufen, ist die
Rückfahrt mit Bus und Bahn kostenlos.
Die NATO
verstärkt ihre maritime Präsenz in der Arktis und im hohen Norden
Nordatlantik – Eine maritime Einsatzgruppe der NATO ist derzeit in
den Gewässern der Arktis und des hohen Nordens im Einsatz und
bekräftigt damit das Engagement des Bündnisses für die kollektive
Sicherheit in dieser zunehmend strategischen Region. Im Rahmen der
Operationen werden Schiffe und Flugzeuge der Ständigen Maritimen
Gruppe 1 der NATO (SNMG1) zusammengeführt, um in der gesamten Region
maritime Präsenzoperationen durchzuführen.
Die Operationen
in der Arktis und im hohen Norden spiegeln das anhaltende Engagement
des Bündnisses für Frieden, Stabilität und Freiheit der Schifffahrt
wider. Operationen in dieser Region erfordern Widerstandsfähigkeit,
Anpassungsfähigkeit und reibungslose Zusammenarbeit – Eigenschaften,
die die NATO-Streitkräfte täglich unter Beweis stellen.“

Schiffe der Ständigen Maritimen Gruppe Eins der NATO in Formation
für eine Fotoübung in der Barentssee während ihres Einsatzes im
hohen Norden und in der Arktis
Die maritime Präsenz der NATO
in der Region spiegelt die zunehmende internationale Aufmerksamkeit
für die Arktis wider, wo das schmelzende Meereis neue
Schifffahrtswege und den Zugang zu natürlichen Ressourcen eröffnet.
Gleichzeitig verbessert das Bündnis seine maritimen Kenntnisse in
der gesamten Region, um die Umwelt besser zu verstehen und die
Reaktionsbereitschaft auf Eventualitäten zu erhöhen.
Die
Seestreitkräfte der NATO müssen sich zudem mit der Herausforderung
auseinandersetzen, in einem dynamischen und sich wandelnden
maritimen Umfeld wie der Arktis und dem hohen Norden zu operieren.
Angesichts des zunehmenden Seeverkehrs arbeiten die
NATO-Streitkräfte weiterhin eng mit regionalen Verbündeten und
Partnern zusammen, um sichere Seewege zu gewährleisten, operative
Erfahrungen in der Region zu sammeln und potenziell
destabilisierende Aktivitäten zu verhindern.
Durch die
Aufrechterhaltung einer routinemäßigen und belastbaren maritimen
Präsenz stellt das Bündnis sicher, dass diese strategisch wichtige
Region für alle Nationen sicher, zugänglich und friedlich bleibt.
Sieben Bündnisstaaten – Kanada, Dänemark, Finnland, Island,
Norwegen, Schweden und die Vereinigten Staaten – verfügen über
Gebiete innerhalb des Polarkreises und spielen eine Schlüsselrolle
bei der Unterstützung des kooperativen und integrativen Ansatzes des
Bündnisses zur Sicherheit in der Arktis.
Die SNMG1 ist eine
der vier ständigen maritimen Einsatzgruppen der NATO unter der
operativen Kontrolle des Allied Maritime Command (MARCOM). Diese
Einsatzgruppen bilden die maritime Kernkompetenz der Allied Reaction
Force (ARF) der NATO und gewährleisten die kontinuierliche maritime
Fähigkeit zur Durchführung von NATO-Missionen über das gesamte
Operationsspektrum hinweg.
Sie demonstrieren Solidarität und
stärken den Zusammenhalt und die Interoperabilität zwischen den
alliierten Seestreitkräften. Das Allied Maritime Command (MARCOM)
ist das zentrale Kommando aller Seestreitkräfte der NATO und der
MARCOM-Kommandeur ist der wichtigste maritime Berater des
Bündnisses.
Hinschauen und erinnern: Eine Führung zu Schwarzen
Perspektiven auf postkoloniale Spuren
Das „Zentrum für
Erinnerungskultur“ lädt am Sonntag, 3. August, um 15 Uhr zu einem
Rundgang durch die Ausstellung „ÜBERSEeHEN, im Kultur- und
Stadthistorischen Museum, auf (post)kolonialer Spurensuche in
Duisburg“.
Welche Geschichten erzählen Schwarze Menschen aus
Duisburg über Kolonialismus, Widerstand und Kontinuitäten bis heute?
Wie hängen globale Bewegungen wie „Black Lives Matter“ mit
lokalen Erinnerungsräumen zusammen?
Welche Rolle spielen
Schwarze Netzwerke, Bildungsarbeit und Kinderliteratur in der
postkolonialen Auseinandersetzung?

Naomi Dibu - Foto Tanaj Pickartz
Die Führung mit der
Aktivistin, Politikwissenschaftlerin und kuratorischen Assistentin
Naomi Dibu nimmt die koloniale Geschichte Duisburgs aus einer
schwarzen, widerständigen Perspektive in den Blick. Neben der
Auseinandersetzung mit lokalen kolonialen Spuren beleuchtet Naomi
Dibu insbesondere die Perspektiven und Erfahrungen Schwarzer
Menschen.
Im Zentrum stehen dabei Fragen der Sichtbarkeit,
Selbstermächtigung und der historisch gewachsenen Rassifizierung
Schwarzer Körper. Bezug genommen wird unter anderem auf die Arbeit
von Organisationen wie Phoenix e.V. und CEBIE, auf Erinnerungsarbeit
in Kinderbüchern sowie auf gegenwärtige Formen des Widerstands – von
Workshops bis zur „Black Lives Matter“-Bewegung in Deutschland.
Der Rundgang versteht sich als Einladung, Schwarze Geschichte
und Gegenwart neu zu lesen – als Teil der Stadtgeschichte Duisburgs
und als Ausdruck fortdauernder Kämpfe um Anerkennung und
Gerechtigkeit. Die Führung ist im Museumseintritt enthalten. Um
Anmeldung wird gebeten unter zfe@stadt-duisburg.de oder unter Tel.
0203-283 2640
Erfolg hängt vom Engagement aller
Ministerien ab – Technologiesprung gelingt mit Ingenieurkompetenz
Die von Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) vorgestellte
Hightech-Agenda ist ein gelungener Aufschlag mit dem klaren Ziel,
mehr Anreize zu schaffen, um Innovationen und Schlüsseltechnologien
zu fördern. Der Erfolg hängt auch vom Engagement anderer Ressorts
der Bundesregierung ab, um wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen in
Deutschland zu schaffen.

VDI-Präsident Prof. Lutz Eckstein spricht sich für eine
"strategische Exzellenzinitiative“ aus, um im internationalen
Wettbewerb erfolgreich zu sein. Foto: VDI
Deutschland als
Technologiestandort zu stärken und bestehende Schwächen im
Wissenstransfer zu überwinden, ist auch ein Kernanliegen des VDI.
„Die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standorts und die Bewältigung
unserer Herausforderungen erfordern einen echten Innovationsschub
und gleichzeitig wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen in Deutschland.
Ingenieurinnen und Ingenieure transformieren
wissenschaftliche Erkenntnisse in innovative Produkte und Anlagen,
die den Anspruch haben sollten, nicht nur in Deutschland und Europa,
sondern weltweit erfolgreich zu sein und damit eine globale Wirkung
zu entfalten“, betont Prof. Dr.-Ing. Lutz Eckstein, Präsident des
VDI.
Deshalb kann die Hightech-Agenda nur die gewünschte
Wirkung entfalten, wenn alle Bundesministerien und Beteiligten aus
Forschung und Industrie ihren Beitrag leisten. „Die
Schlüsseltechnologie Künstliche Intelligenz und deren
Einsatzmöglichkeiten in Forschung und Industrie kann nur dann
Wertschöpfung erzeugen, wenn wir auch im Bereich Datenschutz
Anpassungen vornehmen und damit international wettbewerbsfähige
Rahmenbedingungen schaffen.
Daher ist hier unter anderem das
Justizministerium gefragt, die Hightech-Agenda des
Bundesforschungsministerium zügig zu ergänzen und
datenschutzrechtliche Vorgaben rasch anzupassen. Dies ist nur ein
Beispiel, denn es gibt mehrere Themenfelder und
Schlüsseltechnologien, bei denen alle Ressorts der Bundesregierung
für eine erfolgreiche Umsetzung der Hightech-Agenda zusammenarbeiten
müssen,“ so Lutz Eckstein.
Technologische Schwerpunkte
richtig – Offenheit entscheidend
Die richtige technologische
Schwerpunktsetzung ist aus Sicht des VDI entscheidend: „Wir begrüßen
die initiale Fokussierung auf Schlüsseltechnologien wie Künstliche
Intelligenz, Mikroelektronik, Biotechnologie, nachhaltige Mobilität
und klimaneutrale Energie. Für den Industriestandort Deutschland
sind auch Werkstoff- und Produktionstechnologien unverzichtbar,
damit innovative Produkte und anlagen wettbewerbsfähig hergestellt
werden können. Deshalb begrüße ich den offenen Ansatz der Agenda“,
so Prof. Eckstein.
Erfreulich aus Sicht des VDI ist, dass
das Forschungsministerium signalisiert hat, dass in der konkreten
Umsetzung der Hightech-Agenda im Prozess weitere Themen und
Schwerpunkte hinzukommen können. Diese Offenheit ist aus Sicht des
VDI entscheidend, damit die Agenda durch konkrete Roadmaps
hinterlegt und aktuell gehalten werden kann.
VDI-Präsident
Prof. Eckstein betont die Bereitschaft des VDI, sich konstruktiv bei
der Weiterentwicklung und Umsetzung der Hightech-Agenda der
Bundesregierung einzubringen. „Wir sehen im vorgelegten Entwurf eine
echte Chance, eine Aufbruchstimmung zu erzeugen. Mit unserer
Initiative „Zukunft Deutschland 2050“ ergänzen wir die auf
Technologietransfer fokussierte Agenda um eine langfristige
Strategie, um ausgewählte Schlüsseltechnologien langfristig über
Legislaturperioden hinaus zu beleuchten und zu treiben.
Grundsätzlich ist die Stärkung heutiger und die Entwicklung
künftiger Industrien und Wertschöpfungsmöglichkeiten zentral, um
Wohlstand zu sichern sowie technologische Souveränität und
gesellschaftliche Resilienz auszubauen. Die Hightech-Agenda ist ein
guter Aufschlag hierfür,“ so Prof. Eckstein.
Neben den
Schlüsseltechnologien beschreibt die Hightech-Agenda auch generell
künftige Forschungsschwerpunkte. Insbesondere sollte die
Gesundheitsforschung in strategischen Forschungsfeldern gestärkt
werden. „Die Medizintechnik von morgen ist eines unserer zentralen
Zukunftsfelder und bietet großes Potential für einen attraktiven
Standort Deutschland. Aus diesem Grund befassen wir uns in der
VDI-Initiative `Zukunft Deutschland 2050`auch mit diesem Thema.
Ingenieure und Ingenieurinnen leisten Erstaunliches, um mit
Technologien Operationsverfahren und Ärzte zu entlasten und
Menschenleben zu retten“, erläutert VDI-Direktor Adrian Willig.
Hightech Made in Germany – auch im Weltraum
Zum neu
formierten Ministerium gehören auch die Zuständigkeiten für
Technologie und Raumfahrt, was jetzt in der neuen Hightech-Agenda
den nötigen Raum bekommt. Robuste Multi-Satellitensysteme in
niedrigen Umlaufbahnen sind auch aus Perspektive des VDI
entscheidend für zuverlässige weltraumgestützte Informationsquellen,
wie Telekommunikations-, Navigations- und Erdbeobachtungssysteme.
Speziell bei Anwendungen wie dem Katastrophenschutz, der
Verteidigung oder beim autonomen Fahren, existiert großes
Anwendungspotenzial.
In Deutschland besteht trotz
vielversprechenden Technologien im „New-Space“- Sektor in der
Produktion großer Nachholbedarf, um die Herstellung größerer Zahlen
von Satelliten hochzufahren. Daher empfiehlt der VDI unter anderem
die Aufnahme eines Forschungsprogramms zu sicheren
Multi-Satellitensystemen, um mit verteilten Sensoren auf
Kleinstsatelliten die traditionellen Satelliten zu ergänzen und die
Robustheit des Gesamtsystems zu steigern. Die Forschung zu
technischen Grundlagen und Methoden für die Herstellung von
Kleinserien dieser Satelliten sollte unterstützt werden.
Entbürokratisierung der Förderverfahren
Neben einer klaren
Zielsetzung ist auch die konkrete Umsetzung der
Schlüsseltechnologien wichtig. „In der Forschung bedarf es eines
neuen Formats, einer „Strategischen Exzellenzinitiative“, in deren
Rahmen die besten Köpfe universitätsübergreifend im Schulterschluss
mit der Industrie zusammenarbeiten. Damit ließe sich ein neuer
Baustein für einen systematischen Technologietransfer schaffen, den
auch die SPRIND-Agentur von Anfang an begleiten könnte.“
Die
Entbürokratisierung, Digitalisierung und Agilisierung von
Förderverfahren sind ebenfalls unerlässlich, um einen besseren und
schnelleren Transfer von der Forschung in die industrielle Anwendung
zu gewährleisten. Auch neue Formate der Forschungsförderung sollten
ein Hebel sein, um die Zielsetzungen der Hightech-Agenda zu
verstärken. „Notwendig ist aus meiner Sicht eine aktive
Zusammenarbeit führender Universitäten,
Bundesforschungseinrichtungen und Unternehmen im Rahmen einer
„strategischen Exzellenzinitiative“, um im internationalen
Wettbewerb erfolgreich zu sein,“ so VDI-Präsident Prof. Eckstein.
Volkspark Rheinhausen: Sonntagskonzert
mit der Musikgruppe Wahre Freunde
Die Musikgruppe Wahre
Freunde ist am kommenden Sonntag, 3. August, um 15 Uhr im Volkspark
Rheinhausen beim Sonntagskonzert zu Gast. Die Gruppe präsentiert
Volksmusik, Schlager und gefühlvolle Songs zum Mitsingen, verpackt
mit einer großen Prise Humor. Der Eintritt ist frei.

Unterstützt wird die Konzertsaison vom Bauverein Rheinhausen und vom
Förderverein für Kultur- und Brauchtumspflege Rheinhausens &
Rumeln-Kaldenhausens.
Weitere Sonntagskonzerte finden am 10.
August mit den HeybergMusikanten sowie am 17. August mit „Die
Bergsteirer“ statt. Aktuelle Informationen sind online via Facebook
abrufbar unter: www.facebook.com/SonntagskonzerteRheinhausen/
DARGEBOTEN|Tattoos und so viel mehr -
Ausstellungseröffnung David Alsen
David Alsen ist
Tattookünstler des inzwischen zur Institution im Hafenkiez Ruhrort
gereiften Studios Hafenmarie. Aber seine „Leinwände“ sind nicht nur
die Körper seiner Kunden und Kundinnen, wie man rund um den Neumarkt
vielfältig in Augenschein nehmen kann.

Foto Rollin‘ Pictures
Seine Kunstwerke zieren Werbetafeln
Ruhrorter Geschäfte, die bienenfreundlichen, ursprünglich schwarzen
Blumenampeln sind ebenfalls aus seiner Feder gestaltet und sogar
einen unverkennbar von ihm gestalteten Fahrradständer kann man an
der Ankerbar bewundern.
Nicht nur als Werbetafeln seiner
Kunst versteht er die als Inspiration für Tätowierwillige dienenden,
im Studio am Neumarkt in Petersburger Hängung gezeigten Kunstwerke.
Auch auf T-Shirts oder profanen Alltagsgegenständen findet sich
seine „Handschrift“.
Dass die Ausstellung seiner Werke auch
über die Zeit des Hafenfestes im, dem Tattoo-Studio benachbarten
Projektladen stattfindet ist nicht zufällig, sondern
Herzensverpflichtung. Denn die Verbundenheit zum Quartier an Rhein
und Ruhr bezeugt unter anderem auch das von ihm gestaltete Logo des
Kreativquartier Ruhrort.
Samstag, 2. August 2025 um 19:00
Uhr Das PLUS am Neumarkt, Neumarkt 19, 47119 Duisburg-Ruhrort .
Eintritt frei(willig) - Hutveranstaltung Die Ausstellung ist vom
2.8. - 31.8.2025 zu den Öffnungszeiten des Projektladens zu
besuchen: Di, Mi + Do 10:00-13:00 Uhr.
Dancing Pipes
beim Sommerkonzert in der Hamborner Friedenskirche
In
der Friedenskirche in Duisburg Hamborn, Duisburger Straße 174,
sollen am 6. August um 19.30 Uhr die Pfeifen tanzen, denn so lautet
der englischsprachige Titel des Konzertprogramms von Lea Marie
Lenart. Die Gast-Organistin von der Marktkirche aus Lage/ Lippe
spielt mit „Dancing Pipes“ heitere Tänze aus England: Es handelt
sich um Kompositionen von u.a. Charles Hubert Parry, John Stanley,
Charles Villiers Stanford, John Ireland, William Walton und Edward
Elgar.
Auch für dieses Konzert der Reihe der Sommerkonzerte
an der Friedenskirche gilt: Wenn das Wetter mitspielt, kann das
kulturinteressierte Publikum nach der Aufführung im Kirchgarten mit
den Musikerinnen und Musikern bei einem Getränk ins Gespräch kommen.
Der Eintritt zu den Konzerten kostet jeweils
zehn Euro. Schüler, Studenten, Schwerbehinderte zahlen bei Vorlage
des Ausweises nur fünf Euro. Tiina Marjatta Henke beantwortet
Rückfragen und hat mehr Infos zu den Konzerten
(tiinamarjatta@posteo.de).

Lea Marie Lenart (Foto: www.leamarielenart.de).
Die Citykirche kennenlernen
Kostenfreie Führung durch Salvator
Die Salvatorkirche
am Burgplatz gehört zu Duisburgs bekanntesten und imponierendsten
Gotteshäusern. An jedem ersten Sonntag im Monat informieren
geschulte Gemeindeleute, meist Ehrenamtliche, über die Geschichte,
den Baustil und die besonderen Fenster der über 700 Jahre alten
Stadtkirche neben dem Rathaus.
Am Sonntag, 3. August 2025 um
15 Uhr macht Margot Dippe mit Interessierten an verschiedensten
Stellen der Kirche halt und berichtet dazu Wissenswertes und
Kurzweiliges. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, alle
Kirchenführungen in der Salvatorkirche sind kostenfrei. Infos zum
Gotteshaus gibt es unter
www.salvatorkirche.de.

Salvatorkiche - Foto Rolf Schotsch
Auszeiten
geben Chancen
Pfarrerin Sabine Schmitz vom evangelischen
Schulreferat spricht Sommersegen
Auszeiten geben Chancen. Diesen schönen
Gedanken entwickelt Seelsorgerin Sabine Schmitz in einem Kurzvideo zur
Sommerzeit. Die Pfarrerin des Evangelischen Schulreferates Duisburg Niederrhein
weist in ihrem Statement auch auf die besondere, wichtige Wirkung der Auszeit
hin: „Wir erleben, dass es nicht so sein muss, wie es immer ist. Es geht auch
anders. Das eröffnet uns Möglichkeiten. Vielleicht ändert sich etwas zum Guten?“

Pfarrerin Schmitz beendet ihre Ansprache mit Gottes Segen. Das Video ist auf dem
Youtubekanal „Evangelisch in Duisburg“ zu sehen. Infos zum Kirchenkreis, den
Gemeinden und Einrichtungen gibt es im Netz unter www.kirche-duisburg.de; Infos
zum Schulreferat unter
www.schulreferat.duisburg-niederrhein.ekir.de.
Hier ist der Redetext
des Videostatements
Es ist wieder soweit: Die Schulen machen Ferien. Es wird
ruhiger. Und Menschen fahren weg, andere bleiben hier und entspannen. Manches
muss in den nächsten Wochen auch anders organisiert werden. Auszeit. Auszeiten
geben Chancen: vielleicht zur Ruhe zu kommen, vielleicht etwas ganz anderes zu
erleben, vielleicht einfach nur mitzubekommen, was sonst so um mich herum
passiert.
Das wichtige an der Auszeit: Wir erleben, dass es nicht so
sein muss, wie es immer ist. Es geht auch anders. Das eröffnet uns
Möglichkeiten. Vielleicht ändert sich etwas zum Guten? Damit das Leben gut wird,
begleitet uns Gott: im Alltag, in der Auszeit. Damit das Leben schön ist. So
möge Gott Ihre Sommertage segnen und Sie bewahren und behüten.

NRW: Flächen für Weizenanbau im Jahr 2025 um 21 %
gestiegen
* Getreide wird auf 51,7 % der Ackerfläche angebaut.
*
Kartoffelflächen nehmen weiter zu.
* Rückgang bei den Flächen für den Anbau
von Silo- und Körnermais.
Die Anbaufläche für Weizen wurde in
Nordrhein-Westfalen im Jahr 2025 gegenüber 2024 um 21,2 % auf 253.000 Hektar
ausgedehnt (2024: 208.800 Hektar). Wie Information und Technik
Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt anhand von ersten, vorläufigen
Ergebnissen der Bodennutzungshaupterhebung mitteilt ist das die größte Fläche
für Weizenanbau seit 2019.

C
Pixabay
Getreide wird auf 51,7 % der Ackerfläche angebaut Den größten
Anteil an der nordrhein-westfälischen Getreidefläche hat traditionell
Winterweizen. Mit 248.600 Hektar wurde er in diesem Jahr auf 23,2 % des
Ackerlandes angebaut; die Fläche dieser Getreideart war damit um 50.000 Hektar
(+25,2 %) größer als 2024. Beim Sommerweizen nahm die Anbaufläche auf
4.400 Hektar ab (−5.800 Hektar).
Insgesamt bauten die
nordrhein-westfälischen Landwirte im Jahr 2025 auf 553.700 Hektar (+5,2 %
gegenüber 2024) Getreide an; das ist etwas mehr als die Hälfte der gesamten
Ackerfläche (51,7 %). Einen Rückgang der Anbauflächen gab es bei Silo- und
Körnermais: Silomais wurde in diesem Jahr auf 210.400 Hektar angebaut; das waren
2,3 % weniger als 2024 (damals: 215.300 Hektar).
Die Anbaufläche von
Körnermais wurde von 84.700 Hektar um 14,3 % auf 72.500 Hektar verringert. Bei
Silomais wird die gesamte Pflanze geerntet, zu Silage verarbeitet und in Silos
gelagert, um z. B. als Futtermittel oder als Substrat für Biogasanlagen
verwendet zu werden.
Beim Körnermais werden nur die Maiskörner geerntet,
die restlichen Pflanzenbestandteile verbleiben auf dem Feld. Kartoffelflächen
auch 2025 ausgeweitet Die Anbaufläche für Winterraps wurde 2025 wieder
ausgedehnt, nachdem 2024 ein Rückgang zu verzeichnen war. Winterraps wurde auf
57.400 Hektar angebaut (2024: 52.900 Hektar).
Die Anbaufläche von
Kartoffeln erhöhte sich dem Trend der letzten Jahre entsprechend weiter um 6,7 %
auf 47.800 Hektar (2024: 44.800 Hektar). Die Anbaufläche von Zuckerrüben gingen
um 6,4 % auf 57.200 Hektar (2024: 61.100 Hektar) zurück.
Der
Durchschnittsmensch in Deutschland: Wie er lebt, wohnt und arbeitet
• Ende 2024 war der Durchschnittsmensch 44,9 Jahre alt, die
Durchschnittsfrau war gut zweieinhalb Jahre älter als der Durchschnittsmann
• Der Durchschnittsmensch lebt mit einer weiteren Person zusammen in einem
Haushalt, die Durchschnittswohnung hat 94,4 Quadratmeter
Ob von jung bis
alt, von klein bis groß oder von arm bis reich: Mal angenommen, ein Mensch in
Deutschland stünde für alle 83,6 Millionen, die hier leben. Dann wäre dieser
Durchschnittsmensch 44,9 Jahre alt zum Jahresende 2024. Das teilt das
Statistische Bundesamt (Destatis) zum Start einer Sonderseite mit, die den
Durchschnittsmenschen in Deutschland in vielen verschiedenen Lebensbereichen
beschreibt.

Die
Durchschnittsfrau war mit 46,2 Jahren gut zweieinhalb Jahre älter als der
Durchschnittsmann (43,5 Jahren).
Das höhere Durchschnittsalter von
Frauen hängt mit ihrer höheren Lebenserwartung zusammen. Bei Geburt im Jahr 2024
betrug die Lebenserwartung der Durchschnittsfrau 83,5 Jahre. Mit 78,9 Jahren
hatte der Durchschnittsmann eine um etwa viereinhalb Jahre geringere
Lebenserwartung.
Lebt der Durchschnittsmensch in einer Familie, dann hat
diese 3,4 Mitglieder im Haushalt Laut Mikrozensus 2024 hat die Familie des
Durchschnittsmenschen 3,4 Mitglieder. Familien sind hier im engeren Sinne
definiert als alle Eltern-Kind-Konstellationen, die zusammen in einem Haushalt
leben. 
Betrachtet man sämtliche Haushaltsformen vom Einpersonenhaushalt bis zur
Großfamilie, dann lebt der Durchschnittsmensch mit einer weiteren Person
zusammen in einem Haushalt (2,0 Mitglieder je Haushalt). Wie der
Durchschnittsmensch wohnt, zeigen die Ergebnisse der Gebäude- und
Wohnungszählung des Zensus 2022.
Die Durchschnittswohnung hat demnach
eine Wohnfläche von 94,4 Quadratmetern und kostet 7,28 Euro Nettokaltmiete pro
Quadratmeter. Vollzeitbeschäftigte verdienten im Durchschnitt 4 634 Euro brutto
im April 2024 – Medianverdienst bei 3 978 Euro Betrachtet man alle abhängig
Beschäftigten in Vollzeit, dann verdiente der vollzeitbeschäftigte
Durchschnittsmensch im April 2024 ohne Sonderzahlungen 4 634 Euro brutto.

Vollzeitbeschäftigte Frauen verdienten im Schnitt 4 214 Euro brutto im Monat und
damit deutlich weniger als vollzeitbeschäftigte Männer mit 4 830 Euro.
Insbesondere bei Verdienstdaten wird deutlich, dass Durchschnittswerte mit Blick
auf Aussagekraft und Interpretation limitiert sein können.
Der
Durchschnittswert, auch arithmetisches Mittel genannt, ist anfällig für extreme
Werte und kann ein verzerrtes Bild liefern. Da wenige Personen mit sehr hohen
Verdiensten den Durchschnitt stark beeinflussen können, wird hier häufig auch
der Median als aussagekräftiger Mittelwert herangezogen.
Er teilt eine
Verteilung in zwei gleich große Hälften: 50 % der Werte liegen unterhalb des
Medians und 50 % liegen darüber. Betrachtet man die Medianverdienste, verdiente
ein Vollzeitbeschäftigter im Mittel 3 978 Euro brutto im April 2024 (ohne
Sonderzahlungen). Mit einem mittleren Bruttomonatsverdienst von 3 777 Euro
brutto verdiente die vollzeitbeschäftigte Frau exakt 300 Euro weniger als der
vollzeitbeschäftigte Mann mit 4 077 Euro.
Pro-Kopf-Verschuldung steigt
im Jahr 2024 auf über 30 000 Euro
Öffentlicher Schuldenstand
steigt um 63,4 Milliarden Euro auf 2 510,5 Milliarden Euro
Der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder, Gemeinden und
Gemeindeverbände sowie Sozialversicherung einschließlich aller
Extrahaushalte) war beim nicht-öffentlichen Bereich zum Jahresende
2024 mit 2 510,5 Milliarden Euro verschuldet. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) nach endgültigen Ergebnissen weiter mitteilt,
entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung in Deutschland von 30
062 Euro. Das waren 669 Euro mehr als Ende 2023. Zum nicht-
öffentlichen Bereich gehören Kreditinstitute und der sonstige
inländische und ausländische Bereich, zum Beispiel private
Unternehmen im In- und Ausland.
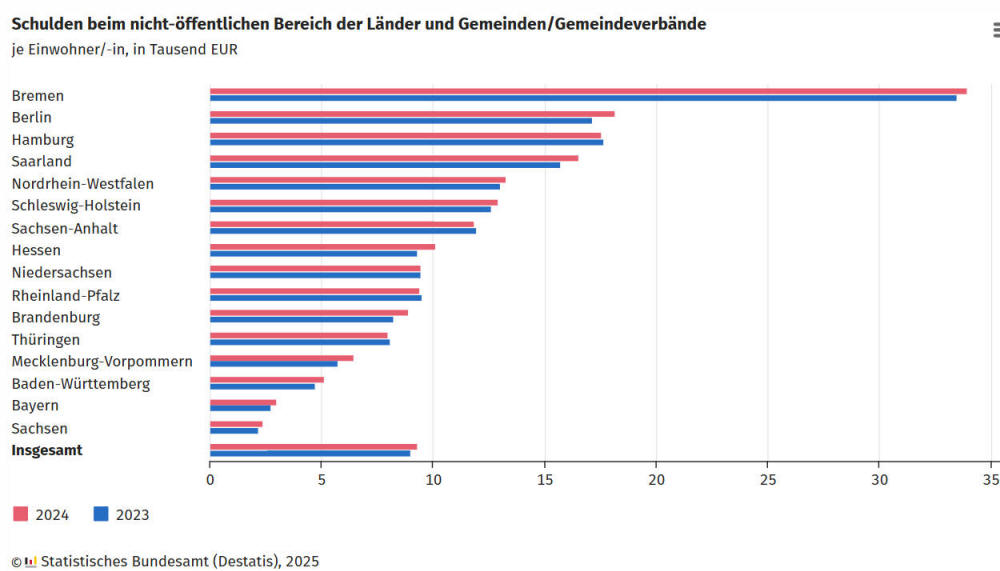
Gegenüber dem Jahresende 2023 stieg die öffentliche Verschuldung zum
Jahresende 2024 um 2,6 % (63,4 Milliarden Euro).
Der Zuwachs kam
durch Schuldenanstiege bei allen Gebietskörperschaften zustande,
wobei der prozentuale Anstieg bei den Gemeinden und Gemeindeverbände
am größten war. Schulden des Bundes steigen um 35 Milliarden Euro
Der Bund war Ende 2024 mit 1 732,7 Milliarden Euro verschuldet.
Der Schuldenstand stieg damit gegenüber dem Jahresende 2023 um
2,1 % beziehungsweise 35,0 Milliarden Euro. Auf die Bevölkerungszahl
umgerechnet betrugen die Schulden des Bundes 20 748 Euro pro Kopf
(2023: 20 391 Euro).
Anstieg der Länderschulden ebenfalls
bei 2,1 %
Die Schulden der Länder stiegen 2024 um 2,1 %
(12,5 Milliarden Euro) auf 607,3 Milliarden Euro. Dies war der erste
Anstieg gegenüber einem Vorjahr seit dem Jahr 2021, als die
Verschuldung auf 638,6 Milliarden Euro angewachsen war. Der
durchschnittliche Länder-Schuldenstand pro Kopf im Jahr 2024 betrug
7 273 Euro (2023: 7 145 Euro).
Die Schulden pro Kopf waren
Ende 2024 in den Stadtstaaten wie in den Vorjahren am höchsten: Sie
lagen in Bremen bei 33 934 Euro (2023: 33 483 Euro), in Hamburg bei
17 571 Euro (2023: 17 642 Euro) und in Berlin bei 18 173 Euro (2023:
17 155 Euro). Zu beachten ist, dass die Stadtstaaten – anders als
die Flächenländer – auch kommunale Aufgaben wahrnehmen.
Unter den Flächenländern hatte das Saarland mit 13 697 Euro (2023:
12 934 Euro) pro Kopf weiterhin die höchste Verschuldung, gefolgt
von Schleswig-Holstein mit 10 903 Euro (2023: 10 784 Euro). Am
niedrigsten war die Pro-Kopf-Verschuldung im Ländervergleich wie in
den Vorjahren in Bayern mit 1 353 Euro (2023: 1 321 Euro) und in
Sachsen mit 1 482 Euro (2023: 1 417 Euro).
Kommunale
Verschuldung erhöht sich um 10,3 %
Die Verschuldung der
Gemeinden und Gemeindeverbände wuchs im fünften Jahr in Folge und
erhöhte sich im Vorjahresvergleich um 10,3 % (15,9 Milliarden Euro)
auf 170,5 Milliarden Euro. Daraus ergibt sich eine
Pro-Kopf-Verschuldung von 2 206 Euro (2023: 2 005 Euro) an
kommunalen Schulden.
Mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von
3 577 Euro (2023: 3 158 Euro) waren wie im Vorjahr die Kommunen in
Nordrhein-Westfalen am höchsten verschuldet. Es folgen die
hessischen Kommunen mit einer Verschuldung pro Kopf von 3 009 Euro
(2023: 2 734 Euro). Auf Platz drei der am höchsten verschuldeten
Kommunen liegen trotz der Entlastung durch den "Saarlandpakt" die
saarländischen Gemeinden und Gemeindeverbände mit einer
Pro-Kopf-Verschuldung von 2 824 Euro (2023: 2 796 Euro).
Die
kommunale Ebene von Rheinland-Pfalz, die im Jahr 2022 noch am
höchsten pro Kopf verschuldet war, ist aufgrund der Entlastungen im
Rahmen des Landesprogramms "Partnerschaft zur Entschuldung der
Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (PEK-RP) erstmals nicht mehr unter den
Top 3 der am höchsten verschuldeten Kommunen vertreten (2024:
2 388 Euro, 2023: 3 076 Euro).
Die geringste kommunale
Pro-Kopf-Verschuldung verzeichneten 2024 die Kommunen in Brandenburg
mit 581 Euro (2023: 556 Euro), gefolgt von den Kommunen in Thüringen
mit 867 Euro (2023: 898 Euro) und in Sachsen mit 892 Euro (2023:
758 Euro). Die Sozialversicherung war Ende 2024 mit 0,12 Euro (2023:
0,48 Euro) pro Kopf verschuldet. Die Gesamtschulden verringerten
sich dabei um 73,9 % auf 10 Millionen Euro (2023:
40 Millionen Euro).