






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 33. Kalenderwoche:
12. August
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Mittwoch, 13. August 2025
64. Jahrestag des Mauerbaus – Kulturstaatsminister Weimer:
„Freiheit ist kein Zustand, sondern immerwährender Auftrag“
Vor 64 Jahren – am 13. August 1961 – ließ die Sozialistische
Einheitspartei Deutschlands (SED) eine 155 km lange Mauer mitten
durch Berlin errichten. Sie sollte die Flucht von Bürgerinnen und
Bürgern aus Ost-Berlin in den Westen verhindern. Damit war die
deutsche Teilung endgültig vollzogen. In den über 28 Jahren ihres
Bestehens – bis zum Fall am 9. November 1989 – forderte die Mauer
vor allem bei Fluchtversuchen über 140 Todesopfer. Hunderte wurden
verletzt oder beim Fluchtversuch verhaftet.
Staatsminister
Wolfram Weimer: „Die Berliner Mauer steht für das
menschenverachtende Grenzregime der DDR, für Unfreiheit und Willkür
in der SED-Diktatur. Meine Gedanken sind heute bei all jenen, die
durch die Mauer und den tödlichen Schießbefehl ihr Leben verloren,
bei Menschen wie Peter Fechter, der 1962 mit nur 18 Jahren bei einem
Fluchtversuch von DDR-Grenzern erschossen wurde. Ihre Schicksale und
das Leid ihrer Angehörigen mahnen uns, dass Freiheit kein Zustand
ist, sondern ein immerwährender Auftrag.“
In diesem Jahr
widmet die vom BKM geförderte Stiftung Berliner Mauer ihr Gedenken
besonders den Kindern, die an der Mauer ums Leben kamen. Dazu gehört
auch der fünfjährige Çetin Mert aus Kreuzberg, der 1975 beim Spielen
ins Wasser der Spree fiel und nicht gerettet werden konnte, weil
Rettungskräfte die innerdeutsche Grenze nicht überschreiten durften.
Diese Schicksale zeigen, wie tief das Unrecht der Mauer in den
Alltag und in alle Generationen hineinwirkte.
Anlässlich des
64. Jahrestag des Mauerbaus macht Staatsminister Weimer deutlich,
dass das kommunistische Unrecht weiter entschlossen aufgearbeitet
und zukünftige Generationen an die Opfer des autoritären SED-Regimes
erinnert werden müssen.
„Den Gedenkstätten zur Aufarbeitung
der SED-Diktatur kommt dabei eine entscheidende Rolle zu“, sagte
Weimer. „Sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag für unsere
Erinnerungskultur, unser Geschichtsbewusstsein, für die
Demokratiebildung und Achtung der Grundrechte in Deutschland. Sie
halten das Gedächtnis an Unrecht und Verfolgung lebendig und stärken
so das Immunsystem der ganzen Gesellschaft gegen totalitäre
Tendenzen. Wichtig ist mir deshalb, die Aktualisierung der
Gedenkstättenkonzeption des Bundes zügig abzuschließen. Das zentrale
Ziel der neuen Gedenkstättenkonzeption ist es, die Gedenkstätten bei
ihrer wichtigen Arbeit zu unterstützen.“
Zu den vom
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien geförderten
Einrichtungen im SED-Bereich zählen unter anderem die Stiftung
Berliner Mauer, die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der
SED-Diktatur, das Deutsch-Deutsche Museum in Mödlareuth, die
Gedenkstätten Berlin Hohenschönhausen und Deutsche Teilung
Marienborn, das Museum in der Runden Ecke Leipzig sowie die
Initiativgruppe Geschlossener Jugendwerkhof Torgau. Allein der Bund
wendet für die SED-Aufarbeitung rund 16 Millionen Euro jährlich auf.
Hinzu kommt das Bundesarchiv – Stasi-Unterlagen-Archiv, das
insbesondere an das von der DDR-Geheimpolizei begangene Unrecht
erinnert.
Für die Errichtung eines zentralen Mahnmals für die
Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft in Deutschland stehen in den
kommenden Jahren laut Regierungsentwurf 2026 im Etat des
Kulturstaatsministers zudem fünf Millionen Euro zur Verfügung.
Mit einer Förderlinie zum SED-Unrecht des Programms „JUGEND
erinnert“ unterstützt der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur
und Medien außerschulische Vermittlungsprojekte von Gedenkstätten,
Bildungs- und Kultureinrichtungen. Mit dem Programm sollen junge
Menschen die Möglichkeit haben, ihr Demokratieverständnis zu
stärken, Haltung zu zeigen und sich aktiv für demokratische
Grundwerte einzusetzen. Aktuell werden mit rund 2,8 Millionen Euro
aus dem Bundeskulturetat 15 Vorhaben gefördert, die sich mit dem
SED-Unrecht auseinandersetzen. Nach Inkrafttreten des
Haushaltsgesetzes 2025 sollen nach Maßgabe des Bundeshaushaltsplans
in einer zweiten Runde weitere Projekte gefördert werden.
Rückblick
An diesem 13. August war ganz normaler
Schultag - dachten wir. In der Klasse in der Stadtmitte war es dem
August entsprechend warm. Dann ging die Tür auf und unser
Klassenlehrer sowie der Schuldirektor kamen in den Raum.
Es wurde für uns eine ganz besondere und zum Teil bedrückende Stunde
in Sachen Realpolitik in zwei geteilten Nationen.
Wir waren
im Schnitt 14 und 15 Jahre alt und einige hatten Verwandte in der
"Ostzone". Es wurde deutlich, dass eine ganze Nation
eingesperrt werden würde.
Was hat das für Auswirkungen? Wie wird
es weiter gehen? Was kann man tun? Wie reagiert wer "Westen"? Was
machen die "Schutzmächte USA, England und Frankreich?
Auch
nach der Schule wurde das Thema auch im heimischen Wohnzimmer
besprochen, was schon äußerst ungewöhnlich war. Immerhin war
ich mit meinen Eltern aus der "Zone" geflüchtet, hatten alles
zurückgelassen. Fortan lebten wir nach diesem 13. August mit einer
enormen Anspannung.
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe:
Vorsorge und Verhalten bei Hitze und Dürre
Die
Hitzebelastung in Deutschland hat in den vergangen Jahren stetig
zugenommen. Die Zahl der „Heißen Tage“, an denen 30 °C oder mehr als
Höchsttemperatur gemessen wurde, ist gestiegen. Das bringt
gesundheitliche Risiken mit sich. Besonders ältere oder isoliert
lebende Menschen, chronisch Kranke und kleine Kinder sind gefährdet.
Vermehrtes Schwitzen kann zu hohen Flüssigkeits- und
Elektrolytverlusten und letztlich zu Dehydrierung führen. Auch das
Herz-Kreislaufsystem kann durch die Anforderungen eines hohen
Wärmetransports überlastet werden. Wann sprechen wir von Hitze? Der
Deutsche Wetterdienst (kurz: DWD) bezeichnet Wetterbedingungen, „die
durch hohe Temperaturen, unbehinderte Einstrahlung, schwachen Wind
und zum Teil durch feuchte Luft (Schwüle) gekennzeichnet sind“, als
extreme Hitze.
Sie führen zu einem besonders starken
Wärmeempfinden der Menschen, das in der „Gefühlten Temperatur“
wiedergegeben wird. Ab Gefühlten Temperaturen von 38 °C spricht der
DWD von extremer Wärmebelastung. Definition von „Gefühlter
Temperatur“
Definition „Gefühlte Temperatur“ des Deutschen
Wetterdiensteswww.dwd.de
Wenn an zwei aufeinander
folgenden Tagen eine mindestens „starke Wärmebelastung“
von 32 bis 38 °C Gefühlter Temperatur vorhergesagt wird und es
nachts nur zu einer unzureichenden Abkühlung kommt oder aber extreme
Belastungen von 38 °C oder mehr erwartet werden, gibt der DWD eine
Hitzewarnung heraus.
Schätzungen zufolge
sind bei einer Hitzewelle im Jahr 2003 etwa 7.500 Menschen an
Hitzefolgen verstorben, in den Jahren 2006 und 2015 jeweils 6.000.
Monitoringbericht 2019 zur Deutschen Anpassungsstrategiean den
Klimawandel
www.umweltbundesamt.de
Es ist daher besonders
wichtig, bei hohen Wärmebelastungen auf Familienmitglieder, Freunde
und Nachbarn zu achten, die zu den besonders gefährdeten
Personengruppen zählen.
Regelmäßige Besuche und Telefonate können
helfen, bei gesundheitlichen Problemen rechtzeitig einzugreifen.
Es gibt einige Dinge, die Sie tun können, um sich auf die Hitze
vorzubereiten und sich vor den Auswirkungen der Hitze zu schützen.
Das können Sie im Vorfeld tun
Sorgen Sie für ausreichend
Getränkevorräte. Gute Durstlöscher sind Mineralwasser (auch gegen
den Mineralverlust durch Schwitzen), verdünnte Säfte und Kräuter-
oder Früchtetee – aber nicht eiskalt! Kühl oder lauwarm helfen sie
dem Körper besser, mit der Hitze umzugehen. Alkohol- oder
koffeinhaltige Getränke sollten Sie besser vermeiden, diese belasten
den Kreislauf zusätzlich.
Machen Sie Ihr Zuhause hitzefest.
Dunkeln Sie Ihre Räume ab und sorgen Sie für Schattenplätze auf
Ihrem
Balkon oder Ihrer Terrasse.
Wenn Sie auf Medikamente
angewiesen sind: Sprechen Sie mit Ihrem Arzt! Es kann sinnvoll sein,
die Dosierung bei Hitze anzupassen.
Die Hitze ist da – das
können Sie tun
Tragen Sie weite, leichte und helle Kleidung und
bei Aufenthalt im Freien eine Kopfbedeckung.
Trinken Sie viel!
Mindestens 1,5-2 Liter pro Tag. Schaffen Sie kleine
Erinnerungshilfen (zum Beispiel ein volles Glas griffbereit in
Sichtweite stellen, gemeinsam mit dem Hausarzt einen Trinkplan
erstellen).
Gemüse, Salate und wasserreiches Obst sind bei Hitze
ideal. Salzhaltige Lebensmittel helfen, den Mineralverlust
auszugleichen. Vermeiden Sie schwer verdauliche und fettreiche
Gerichte, diese belasten den Körper zusätzlich.
Tipps für
Zuhause
Bevorzugt zu kühleren Tageszeiten, zum Beispiel am frühen
Morgen, lüften.
Geschlossene Fenster abdunkeln.
Verwenden Sie
zum Abkühlen kalte Fußbäder, Sprühflaschen mit Wasser (regelmäßig
reinigen, um Verkeimungen zu vermeiden) oder kühlende
Körperlotionen. Handgelenke und Unterarme unter kaltes Wasser halten
wirkt auch lindernd.
Lauwarm Duschen! Kalte Duschen
erschweren dem Körper die Wärmeabgabe. Für Kinder eignen sich
Planschbecken oder andere Wasserspiele.
Auch nachts nur leichte
Bekleidung und leichte Bettwäsche verwenden, um einen Hitzestau zu
vermeiden.
Tipps für Unterwegs
Sonnenschutzmittel nicht
vergessen! Verwenden Sie Mittel mit mindestens Lichtschutzfaktor 20,
für Kleinkinder Lichtschutzfaktor 30. Bei längerem Aufenthalt im
Freien regelmäßig nachcremen.
Kopfbedeckung nicht vergessen! Auch
Sonnenschirme können hilfreich sein.
Pralle Sonne wenn möglich
meiden, Schatten bevorzugen.
Körperliche Betätigungen wie
Einkaufen, Spaziergänge und Sport möglichst in die frühen Morgen-
oder späten Abendstunden legen.
ACHTUNG: Auf keinen Fall
Menschen oder Tiere allein im heißen Auto zurücklassen. Die
Temperaturen in einem abgestellten Auto steigen sehr schnell
deutlich über Außentemperatur-Niveau. Es besteht Lebensgefahr!
Erste-Hilfe-Maßnahmen
Gehen Sie nicht achtlos an
Hilfsbedürftigen vorbei – helfen Sie!
Bringen Sie hilfsbedürftige
Personen in den Schatten.
Lockern Sie die Kleidung, bieten Sie
etwas zu trinken an.
Rufen Sie den Notruf 112.
Vor
der Wahl des Ruhrparlaments: RVR stellt Wahlkompass als
Entscheidungshilfe online
Bei der anstehenden Direktwahl
zum Ruhrparlament lotst erneut ein Wahlkompass die Bürgerinnen und
Bürger durch die politische Landschaft im Ruhrgebiet. Der Kompass
ist eine wissenschaftliche Online-Wahlhilfe, die vom Institut für
Politikwissenschaften an der Universität Münster und dem Unternehmen
Kieskompas aus den Niederlanden für den Regionalverband Ruhr (RVR)
entwickelt worden ist.
Insgesamt 17 Parteien und
Wählergruppen bewerben sich um den Einzug ins Ruhrparlament.
Nutzerinnen und Nutzer geben im Wahlkompass ihre Haltung zu 30
Wahlkampfthemen an und erhalten auf dieser Basis eine Berechnung der
individuellen politischen Übereinstimmung.
"Mit dem
Wahlkompass Ruhr schafft der Regionalverband Ruhr im Vorfeld der
Kommunal- und Direktwahl ein Angebot, das auf die politische
Landschaft im Ruhrgebiet zugeschnitten ist. Es soll die Menschen
informieren und motivieren, am 14. September ihre Stimme für ein
starkes Ruhrgebiet abzugeben", so RVR-Regionaldirektor Garrelt Duin.
Während der Wahlkompass Orientierung bei den Parteien und
Wählergruppen bietet, setzt der RVR mit der Online-Kampagne "Wähl
den Wandel" auf Unterhaltung und Information. Auf Instagram,
Facebook, LinkedIn und auf der Kampagnenwebsite
http://www.waehldenwandel.ruhr erklärt der RVR seit Ende Juli,
worüber das Ruhrparlament entscheidet und welche Aufgaben der
Verband hat. idr
Das Brückenkompetenzzentrum der BASt
startet
Das Brückenkompetenzzentrum der Bundesanstalt
für Straßen- und Verkehrswesen (BASt) ist die zentrale Anlaufstelle
für Forschungsthemen rund um Brücken für das Bundesfernstraßennetz,
aber auch darüber hinaus. Mit umfangreichem Wissen und praxisnahen
Lösungen schlägt es eine Brücke zwischen Forschung und Praxis.
 Wissensbündelung im Brückenkompetenzzentrum der BAS Sicherheit und
Verfügbarkeit von Brücken haben eine hohe gesellschaftliche
Bedeutung.
Wissensbündelung im Brückenkompetenzzentrum der BAS Sicherheit und
Verfügbarkeit von Brücken haben eine hohe gesellschaftliche
Bedeutung.
Besondere Herausforderungen sind dabei
beispielsweise eine alternde Bausubstanz, steigende
Verkehrsbeanspruchungen und Auswirkungen des Klimawandels auf die
Bauwerke. Darüber hinaus stehen Digitalisierung von Prozessen,
Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit von Brücken im Zentrum der
Betrachtungen.
Das Brückenkompetenzzentrum der BASt
fokussiert sich auf forschungsrelevante Fragestellungen zum Thema
Brücken. Es bündelt Wissen aus Forschung und Praxis über den
gesamten Lebenszyklus. Die neue Themenplattform auf der BASt-Website
stellt die Inhalte eingehend und übersichtlich zur Verfügung. Neben
Regelwerken, Planungshilfen und Handlungsempfehlungen sind auch
Informationen zu abgeschlossenen und laufenden Projekten gebündelt
abrufbar, um einen schnellen Wissenstransfer von der Forschung in
die Praxis zu unterstützen.
Des Weiteren gibt es
Informationen zu Leistungen und aktuellen Ausschreibungen sowie
kurze Zusammenfassungen von Workshops und komplette Webinare. Die
Plattform soll die Vernetzung der Fachwelt unterstützen, um einen
gezielten Wissensaustausch zu ermöglichen.
Dr. Richter,
Abteilungsleiter Ingenieurbauwerke der BASt: "Die intensive
Vernetzung diverser Stakeholder, etwa durch Workshops und
Fachveranstaltungen, bewirkt einen gezielten Austausch zu fachlich
relevanten und praxisnahen Forschungsfragen. Mit dem Aufbau unserer
Expertendatenbank bringen wir Fachexpertinnen und Fachexperten aus
allen relevanten Fachbereichen zusammen. Dadurch können wir Bedarfe
aus der Praxis besser erkennen und Marktänderungen und -neuerungen
schneller in unsere Untersuchungen einbeziehen."
Nachruf auf Gründungsdirektor des INEF Franz Nuscheler verstorben
Trauer um Prof. em. Dr. Franz Nuscheler: Der
Gründungsdirektor des Instituts für Entwicklung und Frieden (INEF)
ist am 31. Juli 2025 im Alter von 87 Jahren verstorben. Er forschte
und lehrte an der Universität Duisburg-Essen über Jahrzehnte, in
denen er die Entwicklungsforschung und -politik in Deutschland
entscheidend mitgestaltete.

Prof. Dr. Franz Nuscheler/INEF
„Mit ihm verlieren wir einen
engagierte
n und im besten Sinne des Wortes auch streitbaren
Forscher, der sich seit den 1960er Jahren immer wieder in allen
zentralen Debatten des von ihm in Deutschland mit etablierten
Forschungsfeldes pointiert zu Wort gemeldet hat“, sagt Prof. Tobias
Debiel, stellvertretender Direktor des Instituts für Entwicklung und
Frieden (INEF) und ehemaliger Doktorand von Franz Nuscheler.
Entwicklungspolitik darf kein Nischenthema sein, war Nuscheler
überzeugt. Er forschte zu Menschenrechten, Demokratie, Entwicklung,
Frieden und internationaler Migration, und er prägte das Konzept der
Global Governance entscheidend mit. Dieses begründete Anfang der
2000er Jahre ein neues Denken: Demnach bewältigt ein Netzwerk aus
Staaten, internationalen Organisationen und nichtstaatlichen
Akteuren globale Probleme nach gemeinsamen Regeln und
Ordnungsstrukturen.
Mit Standardwerken wie dem „Handbuch der
Dritten Welt“ und dem „Lern- und Arbeitsbuch Entwicklungspolitik“
setzte Nuscheler außerdem Maßstäbe. Seine Schriften verbanden
wissenschaftliche Tiefe mit politischer Relevanz – stets mit dem
Ziel, Entwicklung, Frieden und globale Kooperation zusammenzudenken.
Nach einem Studium der Politikwissenschaft, der Geschichte und des
Öffentlichen Rechts in Heidelberg promovierte Franz Nuscheler 1967
und war anschließend an der Universität Hamburg tätig.
1974
wurde er zum Professor für Vergleichende und Internationale Politik
an der damaligen Gerhard-Mercator-Universität Duisburg berufen, wo
er bis zu seiner Emeritierung 2003 wirkte. In der dortigen Fakultät
für Gesellschaftswissenschaften gründete er 1990 das INEF, das
seither die Arbeit der gleichnamigen, von Willy Brandt initiierten
Stiftung "Entwicklung und Frieden" wissenschaftlich unterstützt.
Als Direktor stand Franz Nuscheler dem INEF bis Mai 2006 vor.
Nuscheler engagierte sich in zahlreichen wissenschaftlichen
Beiräten, unter anderem in der Enquête-Kommission „Globalisierung
der Weltwirtschaft“ des Bundestages und dem Wissenschaftlichen
Beirat Globale Umweltveränderungen (WBGU) der Bundesregierung. 2001
erhielt er den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen. Sein
Institut und die gesamte Universität werden ihm ein ehrendes
Andenken bewahren.
Vor 20 Jahren in der BZ:
Immobilien-Management Duisburg saniert in diesem Jahr für
40 Millionen Euro Duisburger Schulen
Duisburg, 13. August
2005 - Wenn die Duisburger Schülerinnen und Schüler nach Ferienende
wieder in ihre Schulen zurückkehren, werden sie vielerorts ihr
Umfeld kaum wiedererkennen; denn das Immobilien-Management Duisburg
verbaut auch im zweiten Jahr des 120-Millionen-Euro-Sanierungs- und
Instandsetzungsprogramms an städtischen Schulen wieder 40 Millionen
Euro.
An 88 von 174 Schulstandorten wird gearbeitet. An 177
Schulgebäuden werden insgesamt 310 Maßnahmen durchgeführt.
Damit die Schülerinnen und Schüler nicht unter dem Arbeiten leiden
müssen, wurden die lauten und staubigen Arbeiten in die Sommerferien
verlegt. An den Schulen, an denen besonders stark der Zahn der Zeit
genagt hat, wird mit Hochdruck gehämmert, es werden Löcher gebohrt,
Leitungen verlegt, Heizungen erneuert, Wände eingerissen und wieder
aufgebaut und vieles andere mehr. So werden in diesem Jahr 29.500 qm
Dachfläche für rund 4,6 Millionen Euro saniert - das entspricht der
Größe von mehr als vier Fußballfeldern. 2.500 Fenster mit einer
Gesamtfläche von etwa 10.000 qm müssen ausgetauscht, 4.600 qm
Fassadenfläche überarbeitet, 12 komplette Heizkesselanlagen erneuert
werden, um nur wenige Beispiele zu nennen.
So bekommen an der
Grundschule Sandstraße die Pausen- und WC-Anlagen ein neues
Innenleben und am Sophie-Scholl-Berufskolleg kann demnächst in neuen
Küchen der eine oder andere leckere Braten zubereitet werden.
Selbstverständlich schreitet die PCB-Sanierung des
Max-Planck-Gymnasiums jetzt mit dem 3. Bauabschnitt weiter und im
Franz-Haniel-Gymnasium werden u.a. die kleine Sporthalle sowie das
Schulhauptgebäude feuchtigkeitssaniert. E
inige Schulen - wie
das Krupp-Gymnasium in Rheinhausen - erstrahlen im neuen Glanz nach
Dach- und Fassadenerneuerung sowie Innenausbau. Das
Immobilien-Management Duisburg ist zuversichtlich dass die meisten
Arbeiten fristgerecht abgeschlossen werden können.
Die beliebtesten Schnorchelspots
Europas: 1.790 Regionen im Vergleich!
Immer mehr
Deutsche wollen auf Reisen beim Schnorcheln die bunte
Unterwasserwelt entdecken. Schnorcheln zählt zu den beliebtesten
Freizeitbeschäftigungen für alle, die das türkise Meer nicht nur vom
Strand aus erfahren möchten. Aber welche Schnorchelziele in Europa
stehen besonders hoch im Kurs?
Dies sind die Top 11 der
beliebtesten Schnorchelspots Europas
Top 11 Schnorchelspots im
Überblick. Schnorchel-Expertin Laura Blau verrät: "Kreta bleibt 2025
die Nummer eins mit 2600 monatlichen Suchanfragen. Mallorca ist der
große Aufsteiger und springt mit 2500 auf Platz zwei, Sardinien
komplettiert die Top drei."
Weiter verrät sie:
"Erreichbarkeit schlägt Exotik. Kurze Flüge und viele
Direktverbindungen beflügeln das Interesse an Mittelmeerinseln. Für
Kurzurlaube zählen schnelle Anreise, verlässliche Wetterfenster und
eine dichte Infrastruktur. So entscheiden sich Familien und
Einsteiger eher für Kreta, Mallorca oder Sardinien als für weit
entfernte Ziele."
Die Top 5 Schnorchelspots in Kürze:
1.
Platz: Kreta! Griechenlands größte Insel erzielt ganze 2600
monatliche Suchanfragen.

Kreta ist die
größte Insel Griechenlands und hat eine beeindruckende geografische
Vielfalt. Die Sommer sind lang und warm und die Insel bietet eine
Vielzahl an traditionellen, gesunden Speisen. Auch kulturell kann
die Geschichte der Insel in der Architektur erkundet werden. Die
Insel ist ideal zum Schnorcheln, da die Küstengewässer besonders
klar sind und über 30 m Sichtweite bieten. Es können Seegraswiesen,
felsige Küsten und Unterwasserhöhlen und sogar Wracks erlebt werden.
Die Südinsel bietet besonders viel Artenvielfalt und
weniger Trubel. Zudem können Anfänger sehr gut das Schnorcheln in
windgeschützten Buchten wie Agia Pelagia lernen. Angesichts dieses
breiten Angebots an Natur, Meer und Kultur ist es absolut kein
Wunder, dass Kreta monatlich 2600 schnorchelbezogene Suchanfragen
auf Google verzeichnet.
Wichtige Informationen:
● Beste
Reisezeit: Mai bis Oktober
● Unterwasserflora- und fauna:
Seegraswiesen, kleine Korallenriffe, Oktopusse, Rotfeuerfische,
Brassen, Barsche, Meeräschen, gelegentlich Schildkröten
●
Beliebte Schnorchelspots: Insel Chrissi, Matala, Plakias, Balos,
Elafonisis
● Sonstige Highlights: Erster „Meeresschutz- und
Freizeittauchpark" Griechenlands
2. Platz: Mallorca! 2500
monatliche Suchanfragen zum Schnorcheln zeigen deutlich, dass
Mallorca lange nicht nur ein beliebter Urlaubsort für seine
Party-Meile ist.

Mallorca bietet als größte Insel der Balearen eine vielseitige
Landschaft. Von rauen Bergen, Mandelhainen, und fruchtbare Ebenen
bis hin zu atemberaubenden Buchten und Stränden ist für jeden
Geschmack etwas dabei. Zur Stärkung zwischen den Schnorchelausflügen
sorgen verschiedene Tapas, frisch gefangener Fisch und regionale
Wurst- und Gebäckspezialitäten.
Das kristallklare Wasser
rund um Mallorca bietet bis zu 30 m Sichtweite. Neben den bunten
Seegraswiesen finden sich auch Höhlen und kleine Felsenriffe, sodass
eine Vielzahl an verschiedenen Terrains erkundet werden kann.
Neben den Touristenhotspots gibt es auch einige geschützte
Reservate und eher abgelegene Buchten, in denen die zahlreichen
Tiere wie Meerbrassen, Oktopusse und gelegentlich sogar Schildkröten
entdeckt werden können. Aufgrund dieser landschaftlichen Schönheit
und der Vielfalt an Schnorchelspots ist es verständlich, dass auch
Mallorca monatliche 2600 Suchanfragen erlangt.
Wichtige
Informationen:
● Beste Reisezeit: Mai bis Oktober
●
Unterwasserflora- und fauna: Seegraswiesen, Schwämme, Seesterne,
Anemonen, kleine Korallen, Barrakudas, Oktopusse, gelegentlich
Seepferdchen und Schildkröten
● Beliebte Schnorchelspots: Cala
Llombards, Cala des Moro, Maioris, Badia Blava
● Sonstige
Highlights: Nationalpark Cabrera, Tropfsteinhöhlen
3.
Platz: Sardinien! Die italienische Insel hat passend zu der fast
2000 km langen Küste auch 2000 monatliche Suchanfragen zum
Schnorcheln.

Wer an Sardinien denkt, hat sofort das türkisblaue Wasser und
die weißen Sandstrände vor seinen Augen. Die italienische Insel
bietet heiße Sommer und milde Winter. Kulinarisch sind hier
besonders Meeresfrüchte beliebt. Zudem gibt es Spezialitäten wie
Pecorino Käse und das Spanferkel Porceddu. Besonders die Küste bei
Villasimius bietet viele Felsen, Korallen und Höhlen und ist somit
besonders bei Schnorchlern beliebt. Auch die Naturschutzgebiete bei
den La Maddalena-Inseln sind besonders ruhig, und es ist eine große
Artenvielfalt zu sehen.
Insgesamt ist die Küste Sardiniens
über 1.800 km lang, somit ist das Finden eines geeigneten
Schnorchelspots ein Kinderspiel. Folglich verwundern die 2000
monatlichen Suchanfragen der vielfältigen Insel mit beeindruckender
Natur niemanden.
Wichtige Informationen:
● Beste
Reisezeit: Mai bis Oktober
● Unterwasserflora- und fauna:
Seegraswiesen, Brassen, Muränen, Oktopusse, kleine Korallen,
gelegentlich Schildkröten
● Beliebte Schnorchelspots: La
Maddalena-Archipel, Costa Smeralda, Villasimius
● Sonstige
Highlights: Grotta des Bue Marino, Supramonte-Gebirge, Alghero
4. Platz: Teneriffa! Auch Spaniens größte Insel ist
besonders beliebt bei den Deutschen. 1580 Mal im Monat werden
dortige Schnorchelspots im Monat gesucht.

Besonders prominent sind Teneriffas schwarz-goldene Lavastrände.
Die Insel ist Heimat einiger Lorbeerwälder, atemberaubender Klippen
und dem Vulkanmassiv des Teide. Ganzjährig herrscht hier mildes
Wetter mit einer Durchschnittstemperatur von 23 °C. Wer auf seinen
Schnorchelausflügen Hunger und Durst bekommt, kann sich auf frischen
Fisch und frisches Obst freuen. Auch deftige Eintöpfe und Ziegenkäse
dürfen nicht fehlen.
Überall kann beim Schnorcheln viel
entdeckt werden, doch besonders im Süden finden sich viele
Felsformationen, Höhlen und einige Schiffswracks. Neben Barrakudas
und Oktopussen können auch Schildkröten und Rochen hier beobachtet
werden. Teneriffa zieht wegen seiner einzigartigen Unterwasserwelt,
der Schildkröten und guter Erreichbarkeit monatlich 1580
Schnorchelsuchanfragen auf sich.
Wichtige Informationen:
● Beste Reisezeit: Ganzjährig
● Unterwasserflora- und fauna:
Seegraswiesen, Korallen, Papageienfische, Rochen, Tintenfische,
Delfine, Schildkröten, vereinzelt Engelshaie
● Beliebte
Schnorchelspots: El Puertito, Los Gigantes, Playa Abades, Las Eras
● Sonstige Highlights: Lavastrände, Wal- und Delfinbeobachtung,
Pico del Teide
5. Platz: Fuerteventura! Die im Atlantischen
Ozean gelegene Kanarische Insel ist geografisch näher an Afrika als
an Europa und erhält 1520 monatliche Suchen.

Die Temperaturen auf der Insel liegen zwischen 18 und 29 °C.
Dabei ist die Luft eher trocken als schwül und es gibt das ganze
Jahr über wenig Regen. Es gibt Unmengen an großen, gelben
Sandstränden und das Innere der Insel ist durch eine vulkanische
Landschaft geprägt. Auch hier wird viel frischer Fisch und
Ziegenkäse gegessen. Die Sichtweite im klaren Wasser ist hier über
10 m. Neben Rochen und Papageifischen können hier manchmal sogar
Schildkröten und Engelhaie gesichtet werden.
Da die Buchten
und Seegraswiesen hier eher ruhig sind, sind sie auch ideal für
Einsteiger geeignet, die das Schnorcheln noch lernen. Dank dieser
Kombination aus konstant gutem Wetter, großartiger Landschaft und
schnorchelfreundlichen Bedingungen überrascht es nicht, dass
Fuerteventura viele Suchanfragen bei Google erhält.
Wichtige
Informationen:
● Beste Reisezeit: Ganzjährig, aber mehr Wellen
im Hochsommer
● Unterwasserflora- und fauna: Seegraswiesen,
Felsenriffe, papageienfische, Drückerfische, Rochen, Barrakudas,
Muränen, gelegentlich Engelhaie
● Beliebte Schnorchelspots: Isla
de Lobos, Playa de las Caletillas, Playa Chica
● Sonstige
Highlights: Wanderdünen, Delfin- und Walbeobachtung
Schnorchelregionen
im Vergleich 2025 vs. 2024:

Aktion "Das Ruhrgebiet spricht" lädt zum
Perspektivwechsel ein Ruhrgebiet
Miteinander ins
Gespräch kommen und konträre Meinungen und Perspektiven
kennenlernen: Das ist das Ziel der Aktion "Das Ruhrgebiet spricht",
zu der vier evangelische Kirchen in Bochum, Dortmund, Duisburg und
Essen einladen. Themen der Bürgerdialoge am 22. und 23. August sind
z. B. Gerechtigkeit und Konflikte in der Gesellschaft. Anmeldungen
sind noch bis zum 13. August online möglich.
Bei der
Anmeldung beantworten Interessierte einige Fragen, wie sie zu
aktuellen Themen und Problemen stehen. Ein Algorithmus findet
anschließend einen Gesprächspartner mit einer komplett anderen
Meinung für ein persönliches Eins-zu-eins-Gespräch. Bei dem
Meinungsaustausch gehe es nicht darum, zu überzeugen, sondern
einander besser zu verstehen, so die Veranstalter.
"Das
Ruhrgebiet spricht" ist eine Initiative der evangelischen
Stadtkirchen in Bochum, Dortmund, Duisburg und Essen nach dem
Vorbild des Formats "Deutschland spricht" der Zeit Verlagsgruppe.
Unterstützt wird sie u. a. vom Regionalverband Ruhr (RVR). idr -
Infos und Anmeldung:
https://dasruhrgebietspricht.de
Einladung zum
Reden und Schweigen – auf der Trauerbank am Meidericher
Pfarrfriedhof
Trauernde brauchen Menschen, die zuhören
und Tränen oder auch Schweigen aushalten. Solche Menschen gibt es
bei der Hospizbewegung Duisburg-Hamborn e. V. Sie sind jeden
Donnerstag in der Zeit von 15 bis 16 Uhr auf dem evangelischen
Friedhof in Duisburg Meiderich an der Pfarrstraße am Rande des
Hauptweges - an ihrer Trauerbank.
Dort laden sie zum Reden,
aber auch zum Schweigen ein. „Wir haben Zeit, hören zu und freuen
uns auf ihren Besuch“ sagt die Hospizbewegung Hamborn. Über das
Engagement freuen sich auch die beiden evangelischen Gemeinden
Meiderich und Obermeiderich, die den Friedhof betreiben.
„Das Team der Hospizbewegung ist mit Herz und Kompetenz bei den
Menschen und genau deshalb ist die Trauerbank so wertvoll für
unseren Pfarrfriedhof und die Menschen im Stadtteil“ sagt Pfarrerin
Sarah Süselbeck. Das Angebot ist kostenlos, eine Voranmeldung ist
nicht nötig. Mehr Infos dazu gibt es unter 0203 / 556074.

Foto vom März 2025 bei der Einweihung der Trauerbank auf dem
Meidericher Friedhof (Foto: obermeiderich.de) Rechts sitzend im Bild
ist Pfarrerin Süselbeck
Singnachmittage
mit Popkantor Daniel Drückes in Wanheim und Wanheimerort
Musiker und Popkantor Daniel Drückes lädt alle, die Lust auf
gemeinsames Singen in gemütlicher Runde in der Evangelischen
Rheingemeinde Duisburg haben, zweimal im Monat zum Mitmachen ein.
Das nächste Singen in Gemeinschaft gibt es am 20. August 2025 um 14
Uhr im Gemeindehaus Wanheimerort, Vogelsangplatz 1; der zweite
Singnachmittag in diesem Monat startet am 21. August 2025 um 15 Uhr
im Gemeindehaus Wanheim, Beim Knevelshof 45.
Auf dem
Programm stehen wie immer bekannte Lieder, Popsongs und Evergreens.
Zwischen dem Singen ist Platz für Kaffee und Kekse. Die Idee zu den
Musiknachmittagen zum Mitmachen hatte Daniel Drückes gemeinsam mit
Ehrenamtskoordinatorin Maria Hönes: Mit dem zusätzlichen Angebot
gilt es ältere und junge Menschen beim Singen zusammen zu bringen,
ganz nach dem Motto „Singen verbindet Generationen“. Mitsingen darf
jede und jeder. 
Gemeinschaftliches Singen mit Daniel Drückes (im Hintergrund) (Foto:
Maria Hönes)

NRW: 2024 wurde Bauland im Wert von 1,7 Milliarden Euro
verkauft
* Durchschnittlicher Preis für veräußertes
Bauland lag bei 177,69 Euro je Quadratmeter
* Durchschnittlicher
Kaufwert im Regierungsbezirk Köln am höchsten
* Baureifes Land
hatte mit 4.477 Kauffällen den größten Anteil an den Veräußerungen.
Im Jahr 2024 wurden in Nordrhein-Westfalen 5.590
Baulandverkäufe mit einer Gesamtfläche von rund 9,3 Millionen
Quadratmetern und einem Gesamtverkaufswert von 1,7 Mrd. Euro
getätigt. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, ergibt sich
daraus rechnerisch ein durchschnittlicher Kaufwert von 177,69 Euro
je Quadratmeter Bauland.
Im Vergleich zum Vorjahr wurden 16,6 %
mehr Baulandgrundstücke veräußert. Im Jahr 2023 lag der
durchschnittliche Kaufwert bei 156,87 Euro.
Höchster
durchschnittlicher Kaufwert im Regierungsbezirk Köln
Den
höchsten Durchschnittspreis verzeichnete mit 230,44 Euro pro
Quadratmeter der Regierungsbezirk Köln, gefolgt vom Regierungsbezirk
Düsseldorf mit 204,67 Euro.
Der niedrigste durchschnittliche
Kaufwert in NRW wurde für den Regierungsbezirk Arnsberg mit
136,23 Euro pro Quadratmeter ermittelt.
Wohnbauland:
Baureifes Land wurde für durchschnittlich 273 Euro veräußert
Die
überwiegende Zahl der Kauffälle entfiel mit 4.572 veräußerten
Grundstücken auf das Wohnbauland, das eine Fläche von 4,6 Millionen
Quadratmetern umfasste. Es ist für die Errichtung von Wohngebäuden
vorgesehen und setzt sich aus baureifem Land und Rohbauland
zusammen.
Das baureife Land hatte mit 4.477 Kauffällen den
größten Anteil. Insgesamt wurde baureifes Land mit einer Fläche von
4,2 Millionen Quadratmetern und einer Kaufsumme von 1,1 Milliarden
Euro veräußert. Der durchschnittliche Kaufwert für baureifes Land
lag bei 272,59 Euro. Wohnbauflächen unterscheiden sich in Flächen in
offener und geschlossener Bauweise und stellen die tatsächlich
bebaubaren Flächen dar, welche zu Wohnzwecken genutzt werden sollen.
2024 wurden in NRW 2.757 Wohnbauflächen mit offener Bauweise
veräußert. Der durchschnittliche Kaufwert betrug 234,13 Euro.
Wohnbauflächen mit geschlossener Bauweise wurden 1.655-mal verkauft,
diese hatten einen durchschnittlichen Kaufwert von 317,28 Euro pro
Quadratmeter. Bei geschlossener Bauweise dürfen Gebäude ohne Abstand
errichtet werden, die offene Bauweise erfordert einen seitlichen
Grenzabstand.
Immer mehr junge Mädchen werden wegen
Essstörungen stationär behandelt
• Zahl 10- bis
17-jährigen Patientinnen mit entsprechender Diagnose binnen 20
Jahren verdoppelt
• Insgesamt dagegen leichter Rückgang der
Behandlungsfälle auf 12 100 im Jahr 2023 • 93 % der wegen
Essstörungen in der Klinik Behandelten waren Frauen
Immer
mehr Mädchen und junge Frauen werden wegen Essstörungen stationär im
Krankenhaus behandelt. Die Zahl der Behandlungen von 10- bis 17-
Jährigen hat sich binnen 20 Jahren verdoppelt: Von 3 000
Patientinnen im Jahr 2003 auf 6 000 im Jahr 2023, wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt.
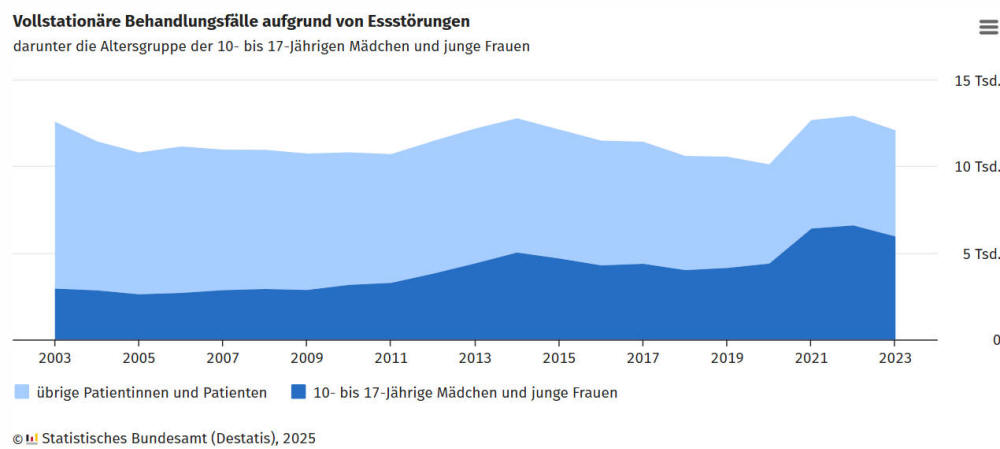
Insgesamt hat sich die Zahl der Behandlungen wegen Essstörungen
im längerfristigen Vergleich dagegen wenig verändert: Im Jahr 2023
wurden hierzulande rund 12 100 Patientinnen und Patienten deswegen
im Krankenhaus behandelt. Das waren weniger als 20 Jahre zuvor
(2003: 12 600 Fälle), aber mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019 mit rund
10 600 Fällen.
Entsprechend machten Mädchen und junge Frauen im
Alter von 10 bis 17 Jahren im Jahr 2023 knapp die Hälfte (49,3 %)
aller stationär wegen Essstörungen behandelten Patientinnen und
Patienten aus. 20 Jahre zuvor lag deren Anteil noch bei knapp einem
Viertel (23,4 %).
Unter den Essstörungen wurde 2023 am
häufigsten Magersucht (Anorexia Nervosa) behandelt, die in gut drei
Viertel der Behandlungsfälle (76,0 % oder 9 200 Patientinnen und
Patienten) diagnostiziert wurde. Danach folgte Bulimie
(Ess-Brechsucht) mit 11,1 % (1 300 Behandlungsfälle). 93 % der wegen
Essstörungen im Krankenhaus Behandelten waren Frauen Frauen werden
deutlich häufiger aufgrund einer Essstörung im Krankenhaus behandelt
als Männer: 11 300 oder 93,3 % der mit dieser Diagnose im Jahr 2023
Behandelten waren Frauen.
2003 waren es rund 11 000
Patientinnen mit einem Anteil von 87,6 %. Dagegen waren lediglich
rund 820 Männer im Jahr 2023 aufgrund von Essstörungen stationär in
Behandlung. Die Zahl ist in den vergangenen Jahren gesunken: 2003
war sie mit 1 560 Behandlungsfällen fast doppelt so hoch. Insgesamt
werden besonders häufig jüngere Menschen wegen Essstörungen
behandelt: Mehr als die Hälfte (52,8 %) der Patientinnen und
Patienten mit einer solchen Diagnose waren 2023 jünger als 18 Jahre.
Mehr als ein Viertel (28,1 %) war in der Altersgruppe von 18
bis 29 Jahre, weitere 12,7 % waren zwischen 30 und 49 Jahren alt.
Nur 6,3 % der Behandelten waren 50 Jahre und älter.
Behandlungsdauer bei Essstörungen überdurchschnittlich lang
Patientinnen und Patienten müssen wegen einer Essstörung deutlich
länger im Krankenhaus behandelt werden als im Durchschnitt aller
Erkrankungen. 53,2 Tage dauerte eine Behandlung bei einer Essstörung
im Jahr 2023 durchschnittlich – das war der höchste Wert seit 2003.
Zum Vergleich: Ein stationärer Krankenhausaufenthalt dauerte
im Jahr 2023 durchschnittlich 7,2 Tage. Essstörungen 2023 in 78
Fällen die Todesursache Im Jahr 2023 starben hierzulande 78 Menschen
aufgrund von Essstörungen. Die Zahl der Todesfälle unterliegt im
langfristigen Vergleich hohen jährlichen Schwankungen. Der
Höchstwert der vergangenen 20 Jahre lag im Jahr 2008, als
100 Menschen an den Folgen von Essstörungen gestorben sind. Der
niedrigste Wert war 2004 mit 36 Todesfällen.
NRW-Tourismus: Inlandsreisen
weiterhin sehr beliebt
* Anteil der Gäste mit Wohnsitz
im Inland liegt bei rund 77 %.
* Urlaub im Inland vor allem
während der Corona-Pandemie.
* Teutoburger Wald bei Gästen mit
Wohnsitz im Inland am beliebtesten.
Der Anteil der
Gästeankünfte von Personen mit Wohnsitz im Inland liegt in
Nordrhein-Westfalen traditionell auf einem hohen Niveau. Wie das
Statistische Landesamt mitteilt, beträgt der Anteil in der Regel
rund 77 % der Ankünfte. Eine deutliche Ausnahme bildeten hier die
Jahre der Corona-Pandemie: Im Jahr 2021 stieg der Anteil der Gäste
mit Wohnsitz im Inland auf den außergewöhnlich hohen Wert von
85,2 %.
Ursache hierfür waren unter anderem die Einschränkungen
im internationalen Reiseverkehr sowie ein verstärkter Trend zum
Heimaturlaub.
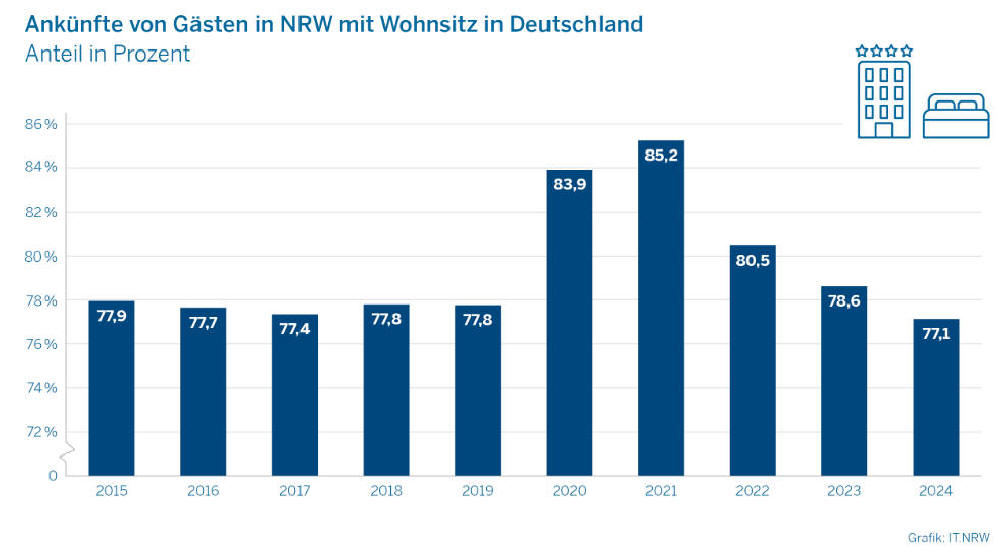
Teutoburger Wald, Bergisches Land und das Münsterland besonders
beliebt
Auch im Jahr 2024 waren in NRW überwiegend Besucher mit
deutschem Wohnsitz zu Gast und entschieden sich größtenteils für
Aufenthalte in den typischen Erholungsgebieten Nordrhein-Westfalens:
Besonders stark vertreten waren die Reisegebiete Teutoburger Wald
mit einem Spitzenwert von 90,2 %, das Bergische Land mit 87,3 %
sowie das Münsterland mit 87,0 % Anteil an inländischen Gästen.
Demgegenüber ist der Anteil von Gästen mit Wohnsitz im Inland in
den Großstadtregionen traditionell niedriger. So verzeichneten die
Regionen Düsseldorf mit 66,1 % und Köln mit 66,7 % den geringsten
Anteil an Inlandsurlaubern. Die aktuellen Zahlen unterstreichen die
große Attraktivität der klassischen Erholungsregionen für die
Urlaubsgäste aus dem eigenen Land und zeigen zugleich die Bedeutung
der Städte als internationale Reiseziele.