






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 33. Kalenderwoche:
13. August
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Donnerstag, 14. August 2025
Vier Jahrzehnte Mikroelektronik »Made in Duisburg«
Von
robusten Mikrochips zur Quantentechnologie: 40 Jahre Fraunhofer IMS
Seit vier Jahrzehnten prägt das Fraunhofer-Institut für
Mikroelektronische Schaltungen und Systeme IMS die
Mikroelektronikforschung in Deutschland und weltweit. Heute bringt
das Institut Licht auf Chips, Sensorik in Gewebe und Intelligenz in
Maschinen. Und das mit Technologien, deren Anwendungen vom Implantat
bis zur Industrieanlage reichen.
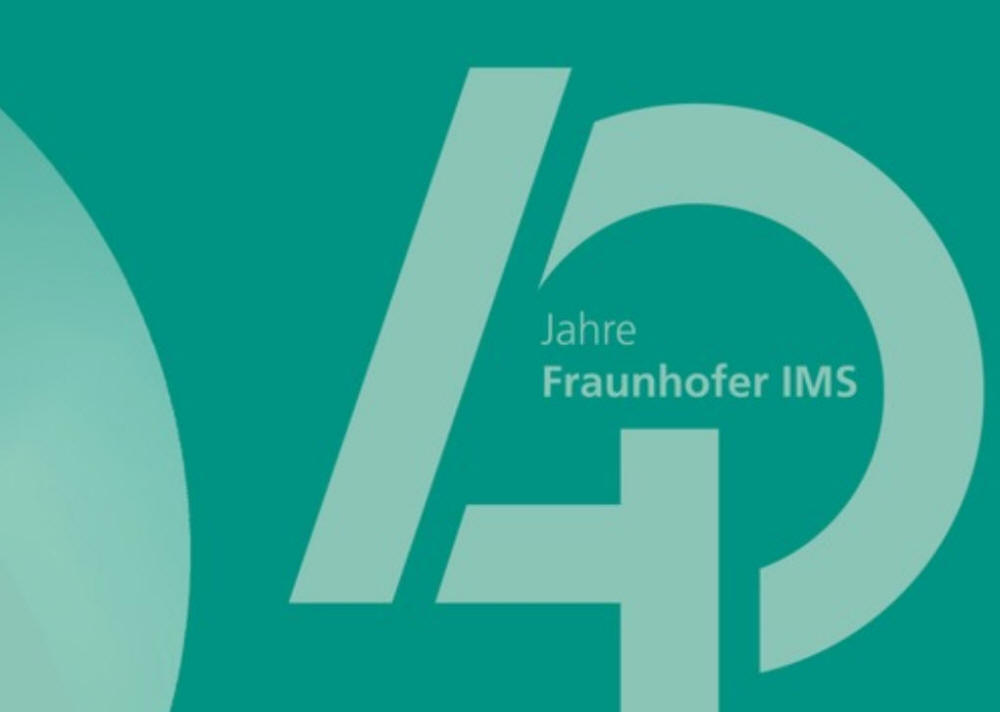
© Fraunhofer IMS
1985 waren PCs noch Exoten, und der Begriff
»Künstliche Intelligenz« ein Zukunftstraum. Heute steuern smarte
Systeme Medizingeräte oder Produktionsanlagen, oft mit Komponenten,
die in Duisburg entwickelt oder hergestellt wurden. Von der ersten
4-Zoll-Wafer-Fertigung in den 1990er-Jahren bis zur heutigen
Entwicklung intelligenter Sensorsysteme: Das Fraunhofer IMS hat sich
stets weiterentwickelt und frühzeitig auf neue Technologien gesetzt.
Technologiewandel als Konstante
Der wissenschaftliche
Grundstein des Fraunhofer IMS wurde bereits 1970 an der Universität
Dortmund gelegt und nur zwei Jahre nach der offiziellen Gründung
konnte 1987 das neu errichtete Institutsgebäude in Duisburg bezogen
werden. Dort nahm das Fraunhofer IMS mit einem eigenen Reinraum die
Entwicklung neuartiger CMOS-Herstellungsverfahren für robuste,
zuverlässige und automobiltaugliche Mikrochips auf. Aufbau und
Ausrichtung des Instituts prägte über viele Jahre Prof. Dr. Günter
Zimmer. Seit 2006 führt Prof. Dr. Anton Grabmaier das Institut: mit
klarem Fokus auf Anwendungen, die Mikroelektronik für Mensch und
Gesellschaft nutzbar machen.
Entwicklungen, wie der gemeinsam
mit Partnern entwickelte Hirndrucksensor für Hydrocephalus-Erkrankte
oder Retina-Implantate, mit denen Blinde wieder sehen können, zeigen
den direkten Einfluss der Forschung auf die Lebensqualität vieler
Menschen. Auch in der Infrastrukturüberwachung, beispielsweise mit
Betonsensoren zur Korrosionsdetektion, setzte das Institut
Standards.
Die langjährige Kooperation mit dem Unternehmen
ELMOS zeigt, dass sich IMS-Entwicklungen auch im hochqualitativen
automobilen Einsatz bewähren. Ein Meilenstein in der photonischen
Sensorik war die Entwicklung eines LiDAR-Systems, also einer
präzisen Abstandssensorik mit Licht, mit extrem rauscharmer
SPAD-Technologie (Einzelphotonen-Detektoren). Diese Innovation
machte das Institut international sichtbar.
Heute: Hightech
für die Lebenswelten von morgen
»Unsere Sensorik wird immer
intelligenter. Sie erkennt Veränderungen, bevor sie zum Problem
werden«, sagt Institutsleiter Prof. Dr. Anton Grabmaier. »Ob in
sicherheitsrelevanten Bildsensoren, biomedizinischen Implantaten
oder der Industrieautomatisierung: IMS-Technologien helfen, Risiken
frühzeitig zu erkennen und Systeme effizienter und sicherer zu
machen.«
Die Verbindung von Sensorik und Künstlicher
Intelligenz (KI) ist dabei ein zentrales Thema: Mit Algorithmen
gelingt es, aus Bilddaten Vitalparameter wie Atemfrequenz und Puls
zu bestimmen; drahtlos und ohne direkten Hautkontakt. Die KI dringt
heute systematisch in neue Anwendungsbereiche vor, von der
Pflegeunterstützung über die Medizintechnik im häuslichen Umfeld bis
hin zur Industrie.
Gleichzeitig steigern die
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Fraunhofer IMS die
Leistungsfähigkeit mikroelektronischer Bauelemente: Beispielsweise
mit 3D-Integration, neuen Materialsystemen und Verfahren wie Atomic
Layer Deposition (ALD), mit denen sich ultradünne, gleichmäßige
Funktionsschichten im Nanometerbereich erzeugen lassen.
Ein
weiterer Fokus liegt auf der Integration photonischer
Funktionalitäten direkt in elektronische Systeme – eine
Schlüsseltechnologie für hochpräzise Sensorik, für biomedizinischen
Diagnostik oder der Quantentechnologie.
»Die Reinräume des
Fraunhofer IMS bieten die ideale Infrastruktur, um
Forschungsergebnisse direkt in innovative Bauteile zu überführen und
im Anschluss zu skalieren und transferieren,« schildert Prof. Dr.
Anna Lena Schall-Giesecke, die am Fraunhofer IMS die Kernkompetenz
»Technology« leitet und gleichzeitig als Professorin an der
Universität Duisburg-Essen forscht.
Zukunft aus Duisburg
Die Mikroelektronik hat das Ruhrgebiet verändert. Das Fraunhofer IMS
bleibt in seiner Rolle als Brückenbauer zwischen Forschung und
industrieller Anwendung ein aktiver Treiber dieses Wandels. Mit
moderner Reinraumtechnik, interdisziplinärer Entwicklungskompetenz
und anwendungsnahen Technologielösungen bringt das Institut
Mikroelektronik aus Duisburg in Systeme weltweit.
Mikroplastik im Abwasser und im Rhein – LANUK legt Analyse zum
Eintrag in den Rhein vor
Im Rhein und erstmals auch
direkt in den Abwassereinleitungen von Industriestandorten hat das
Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen (LANUK)
gezielt nach industriell hergestellten Mikroplastikpartikeln –
sogenannten Pellets und Beads – gesucht.
Die Untersuchung
ist Teil einer neuen LANUK-Studie, deren Ergebnisse Umweltminister
Oliver Krischer und die Präsidentin des LANUK, Elke Reichert, am
Mittwoch, 13. August 2025, an Bord des Laborschiffs Max Prüss der
Öffentlichkeit vorgestellt haben. „Die Studie zeigt deutlich:
Mikroplastik gelangt nicht nur über diffuse Einträge, sondern auch
direkt und punktuell über industrielle Abwassereinleitungen in den
Rhein“, sagte Umweltminister Krischer.

LANUK-Foto
„Mikroplastik darf nicht zusammen mit dem
anfallenden Abwasser in die Gewässer eingeleitet werden – unser
oberstes Ziel muss die Vermeidung von Verlusten aus Herstellungs-
und Transportprozessen sein. Das ist ein entscheidender Hebel, um
unsere Gewässer wirksam zu schützen.“
Auch deshalb sei, so
Krischer, neben technischen Maßnahmen vor allem das
Verantwortungsbewusstsein der Unternehmen gefragt: „Produzentinnen,
Betreiber und Logistikunternehmen – alle Beteiligten in der
Wertschöpfungskette müssen dafür Sorge tragen, dass mit
Kunststoffpartikeln verantwortungsvoll umgegangen wird.“
Die
Präsidentin des LANUK, Elke Reichert, betonte den Pilotcharakter der
Untersuchung: „Wir haben erstmals erfolgreich direkt in den
Abwasserströmen von Industriestandorten Proben auf Beads und Pellets
genommen – das war technisch eine große Herausforderung.
Gleichzeitig ist es ein wichtiger Schritt für unsere Grundlagen- und
Ursachenforschung rund um Mikroplastik.“
Im Rhein wurden an
neun Messstellen Konzentrationen von 0,6 bis 3,6 primären
Mikroplastikpartikeln pro Kubikmeter Wasser festgestellt. Da sich
die Einträge im fließenden Gewässer nicht eindeutig einem Emittenten
zuordnen lassen, arbeitete das LANUK daran, die Proben direkt an den
Einleitungen von Industriestandorten zu entnehmen. Dabei wichen die
Messwerte weit voneinander ab: Die Konzentrationen in den
überprüften Direkteinleitungen lagen zwischen 0,95 und 2.571 Beads
pro Kubikmeter Abwasser.
Die Höchstwerte wurden bei nur
einer Einleitung festgestellt, die übrigen lagen deutlich niedriger
– im Bereich zwischen 0,95 und 19 Beads/m³. Bereits während der
aktuellen Untersuchung gab es erste Gespräche zwischen Behörden und
den Industriestandorten, wie Quellen ermittelt und Einträge in den
Rhein vermindert werden können.
„Obwohl es inzwischen die
technische Möglichkeit zur Analyse gibt, wissen wir längst nicht
alles: Mikroplastik verhält sich nicht wie gelöste Schadstoffe, die
unterschiedlichen Partikel haben ein komplexes Verhalten im
Fließgewässer“, erläuterte LANUK-Präsidentin Reichert. „Umso
wichtiger ist es, dass wir den Eintrag schon an der Quelle
verhindern – mit Aufklärung, Prävention und gelebter Verantwortung
im betrieblichen Alltag.“ Ein wesentliches Problem bleibe die
fehlende Standardisierung der Mess- und Probenahmeverfahren. „Ohne
einheitliche Methoden lassen sich keine belastbaren und
vergleichbaren Daten erheben“, betonte Elke Reichert.
„Alle
bisherigen Untersuchungen, ob in Nordrhein-Westfalen oder anderen
Bundesländern, waren Einzelprojekte und liefern daher
Momentaufnahmen, aus denen leider noch keine langfristigen Trends
abgeleitet werden können. Das erschwert die Bewertung der
Problematik aus Sicht des Umwelt- und Naturschutzes.“
Minister Krischer fasst es so zusammen: „Aus den Untersuchungen
lässt sich ableiten, dass es noch weiteren Forschungsbedarf gibt,
aber es auch an der Zeit ist, zu handeln! Das Ziel muss sein, dass
Mikroplastik gar nicht erst in die Umwelt gelangt – durch saubere
Produktionsbedingungen, sichere Transporte und vor allem durch ein
klares Bekenntnis zur Vermeidung eines Umwelteintrages.“
Mikroplastik-Studien in Nordrhein-Westfalen und zum Laborschiff Max
Prüss Die aktuelle Studie ist ein Teil einer ganzen Dekade der
Mikroplastikforschung in Nordrhein-Westfalen. Bereits 2015
beteiligte sich das Land Nordrhein-Westfalen an einer
länderübergreifenden Untersuchung von Mikroplastik in
Binnengewässern – gemeinsam mit Bayern, Baden-Württemberg, Hessen
und Rheinland-Pfalz sowie bei wissenschaftlicher Begleitung durch
die Universität Bayreuth.
Damals wurden Mikroplastikpartikel
an allen Probenahmestellen nachgewiesen, über 19.000 Objekte
untersucht und mehr als 4.300 Kunststoffteilchen bestimmt. Mit Hilfe
des Laborschiffs Max Prüss entstand in der Folge zusammen mit den
anderen Bundesländern einer der damals weltweit größten,
wissenschaftlich einheitlich erfassten Datensätze zur Belastung mit
Mikroplastikpartikeln von Flüssen. Mikroplastik, also
Kunststoffpartikel mit einem Durchmesser unter 5 Millimetern, ist
längst ein allgegenwärtiges Umweltproblem.
Es wird
unterschieden zwischen primärem Mikroplastik – industriell
hergestellten Partikeln wie Rohpellets und Beads – und sekundärem
Mikroplastik, das durch den Zerfall größerer Kunststoffteile
entsteht, etwa durch UV-Strahlung, Abrieb oder Witterungseinflüsse.
Auch synthetische Fasern aus Kleidungsstücken und technischen
Textilien zählen dazu. Mit der nun vorliegenden Studie liefert das
Landesumweltamt eine neue, belastbare Grundlage für die Diskussion
um Mikroplastik in Industrieabwässern.
Sie macht nicht nur
mögliche Eintragspfade sichtbar, sondern zeigt auch konkrete
Handlungsmöglichkeiten für die Industriestandorte auf. In der
Fortsetzung des Projektes soll dann auch die Verteilung von
Mikroplastik im Gewässer näher untersucht werden. Ein zentrales
Werkzeug für diese wissenschaftlichen Fortschritte bleibt das
Laborschiff Max Prüss, das bis zu 220 Tage im Jahr auf den
schiffbaren Gewässern in Nordrhein-Westfalen unterwegs ist.
Es erlaubt qualitätsgesicherte Probenahmen auch an schwer
zugänglichen Stellen – wie zum Beispiel im Umfeld von
Industriestandorten, Schleusen, Häfen oder an Flussmündungen. Die
Wasserproben werden an Bord mit moderner Sensorik (z.B. für pH-Wert,
Trübung, Sauerstoffgehalt) grob vorerfasst. Eine detaillierte
Analyse auf einzelne Mikroplastik-Partikel erfolgt anschließend in
den Laboren des LANUK an Land.
Stadtwerke Duisburg
erfrischen in der Innenstadt mit frischem Trinkwasser
Meteorologen erwarten in diesen Tagen hochsommerliche Temperaturen
von 34 Grad Celsius und mehr. Bei so einem Wetter ist es besonders
wichtig, ausreichend zu trinken. Die empfohlene Tagesmenge
Flüssigkeit von eineinhalb bis zwei Liter sollte dann noch einmal
erhöht werden.

Die Stadtwerke stehen am Freitag, 15. August, in der Zeit von 10 –
15 Uhr mit ihrer Trinkwasser-Ape in der City vor dem Forum und
verteilen frisches Trinkwasser an die Menschen in der Innenstadt.
Foto: Stadtwerke Duisburg
Die Stadtwerke Duisburg
unterstützen die Duisburger Bürgerinnen und Bürger dabei,
ausreichend Flüssigkeit aufzunehmen. Der lokale Energie- und
Wasserversorger wird deshalb mit seiner Trinkwasser-Ape am Freitag,
15. August, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr in der Innenstadt vor dem
Forum unterwegs sein. Alle Menschen, die dann bei den hohen
Temperaturen in der City unterwegs sind, können frisches Trinkwasser
kostenlos von den Stadtwerken Duisburg erhalten und ihren Durst
löschen.
Außerdem stehen auf der Königstraße natürlich
auch die beiden Trinkwasserbrunnen des lokalen Energiedienstleisters
zur Verfügung, an denen sich die Besucherinnen und Besucher der
Innenstadt jederzeit frisches Trinkwasser in mitgebrachte
Trinkflaschen zapfen können.
Die Stadtwerke
Duisburg versorgen in Duisburg etwa 250.000 Haushalte mit
Trinkwasser. Im Jahr 2024 wurden rund 30,9 Milliarden Liter Wasser
von den Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Duisburg verbraucht.
Gewonnen wird das Wasser in zwei eigenen Wasserwerken, die sich in
Düsseldorf-Wittlaer und -Bockum befinden.
Dabei wird
Grundwasser über Brunnen gefördert, gefiltert, aufbereitet und
anschließend als Trinkwasser in Lebensmittelqualität in das
Duisburger Versorgungsnetz eingespeist. Darüber hinaus bezieht das
Unternehmen Trinkwasser über zwei große Leitungen aus dem Wasserwerk
Haltern am See im Kreis Recklinghausen, wo Grundwasser mit Wasser
aus dem Halterner Stausee angereichert wird. In Homberg und Baerl
schließlich wird aufbereitetes Grundwasser aus dem Binsheimer Feld
in Duisburg verteilt.
Rund 2.200 Kilometer Rohrleitungen
unterhalten die Stadtwerke Duisburg in der Stadt. Als
Wasserversorger sind die Stadtwerke Duisburg für die Sicherung
höchster Qualitätsstandards verantwortlich. Täglich entnimmt das
Unternehmen Wasserproben an zahlreichen Stellen im gesamten
Stadtgebiet und im Bereich der Wasserwerke. Diese rund 8.000 Proben
pro Jahr werden in einem akkreditierten Trinkwasserlabor geprüft, um
jederzeit die hohe Qualität des Trinkwassers zu überwachen.
2025: Stadtwerke feiern 150 Jahre Wasserversorgung
Im Jahr
2025 feiert der lokale Energiedienstleister außerdem ein besonderes
Jubiläum: Die Wasserversorgung in Duisburg wird 150 Jahre alt. Im
Frühjahr 1875 begann die Erfolgsgeschichte mit den Arbeiten zur
Errichtung des ersten städtischen Wasserwerks an der Aakerfähre.
Seitdem werden die Bürgerinnen und Bürger an Rhein und Ruhr
zuverlässig mit sauberem Trinkwasser versorgt. Einen Überblick über
die historische Entwicklung der Duisburger Trinkwasserversorgung mit
zahlreichen Bildern haben die Stadtwerke unter
www.swdu.de/wasser-150 zusammengestellt.
Spannende
Aktionen im Jubiläumsjahr Die Stadtwerke Duisburg feiern das
Jubiläumsjahr mit einer Reihe von spannenden Veranstaltungen und
Aktionen für alle Duisburgerinnen und Duisburger. Am 14. September
steht der Tag des offenen Denkmals im Wasserwerk Bockum ganz im
Zeichen der Trinkwassergeschichte. Und auch zum
WDR-Maus-Türöffner-Tag am 3. Oktober im Wasserwerk Wittlaer dreht
sich alles um die Geschichte der Wasserversorgung.
Verantwortung für Lieferkette übernehmen: IHK-Lehrgang
hilft, Vorgaben einzuhalten
Seit 2023 gilt das
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz. Unternehmen müssen seither
noch stärker darauf achten, Menschenrechts- und Umweltstandards im
gesamten Geschäftsprozess zu wahren. Wie sie diese Anforderungen
praxisnah umsetzen können, zeigt der neue IHK-Zertifikatslehrgang
„Manager/in für menschenrechtliche Sorgfalt (IHK)”.
Die
Teilnehmer erwerben Wissen über Wertschöpfungsketten und lernen, wie
sie die Infos praktisch anwenden. Sie werden darauf vorbereitet, die
Geschäftsführung als strategische Berater zu unterstützen. Nach
Abschluss sind sie in der Lage zu prüfen, ob das Unternehmen die
gesetzlichen Vorgaben einhält. Außerdem erkennen sie, wo es
Potenziale zur Verbesserung gibt. Und mit welchen Maßnahmen diese
erreicht werden können. So helfen sie, soziale und ökologische
Risiken zu vermeiden.
Lehrgangsstart ist am 8. September.
Die Online-Seminare finden bis zum 12. Dezember jeweils montags von
13:00 bis 17:00 Uhr statt. Weitere Informationen und Anmeldung:
www.ihk.de/niederrhein/veranstaltungen
Busse
bekommen Vorrang: DVG errichtet Busschleuse an der
Karl-Jarres-Straße
Die Duisburger
Verkehrsgesellschaft AG (DVG) errichtet gemeinsam mit der Stadt
Duisburg an der Haltestelle „Karl-Jarres-Straße“ (Bussteig 3) im
Dellviertel eine Busschleuse für die Linien 920, 921, 931, NE2 und
934E. Der abgetrennte Fahrbahnabschnitt darf dann ausschließlich von
DVG-Bussen genutzt werden.
Zusätzlich gibt es eine eigene
Lichtsignalanlage für die Busse, so dass diese ihre Fahrt fortsetzen
können, bevor die Ampel für den Individualverkehr auf Grün
umschaltet. „Mit der neuen Busschleuse erhöhen wir den Komfort für
unsere Fahrgäste, da die Busse an der Ampel Vorrang vor anderen
Verkehrsteilnehmern erhalten und unsere Fahrzeuge dadurch schneller
zur nächsten Haltestelle kommen“, sagt Pierre Hilbig,
Hauptabteilungsleiter Betriebsmanagement bei der DVG.
„Wir
erhoffen uns dadurch, dass die Busse weniger im Stau stehen und
somit eine verbesserte Pünktlichkeit für unsere Fahrgäste.“ Die DVG
hatte in der Vergangenheit bereits an anderen Haltestellen im
Stadtgebiet Busschleusen errichtet, so beispielsweise an der
Haltestelle „Duisburg-Hbf. Westeingang“ der Linien 920, 921, 926,
928, 929, 931, Nachtexpresse und Schnellbus-Linien.

Die Arbeiten für die Busschleuse beginnen am Montag, 18. August, mit
Betriebsbeginn und dauern voraussichtlich bis Freitag, 24. Oktober.
Die Linien 920, 921, NE2 und 934E müssen daher in Richtung Duisburg
Hbf. örtliche Umleitungen fahren.
Außerdem müssen
Haltestellen verlegt werden oder entfallen. Die Haltestelle
„Heerstraße Bussteig 1“ wird zur Haltestelle „Heerstraße Bussteig 4“
der neuen Linien 937 und 947 zurückverlegt. Die Haltestelle
„Karl-Jarres-Straße Bussteig 3“ wird zur SEV-Haltestelle
„Karl-Jarres-Straße“ der Linie U79 auf der Düsseldorfer Straße vor
der Kreuzung Karl-Lehr-Straße verlegt.
Die ab dem 27. August
2025 geänderte Linie 931 ist von dieser Umleitungsmaßnahme nicht
betroffen. Eine Ersatzhaltestelle wird auf der Karl-Lehr-Straße in
Höhe der Hausnummer 5 eingerichtet.
Die DVG arbeitet
gemeinsam mit der Stadt Duisburg an der Modernisierung der
Infrastruktur für einen zukunftsfähigen ÖPNV. In den vergangenen
Jahren haben DVG und Stadt durch den Ausbau barrierefreier
Haltestellen, die Modernisierung von Gleisen, Fahrtreppen und
Fahrleitungen sowie den Neubau von Haltestellen bereits viel
erreicht. Zudem wird das ÖPNV-Angebot für die Fahrgäste stetig
verbessert. DVG und Stadt setzen den Weg fort, Bus und Bahn
attraktiver zu machen, um möglichst vielen Menschen mit einem
komfortablen, klimafreundlichen und zuverlässigen ÖPNV eine echte
Alternative zum Auto zu bieten.
Verkehrsinformationen zu
Bus und Bahn gibt es im Internet unter
www.dvg-duisburg.de, bei der DVG-Telefonhotline unter der
Rufnummer 0203 60 44 555 und in der myDVG Bus&Bahn-App.

An der Haltestelle „Duisburg-Hbf. Westeingang“ gibt es bereits eine
Busschleuse mit einer Vorrangschaltung für Busse. Fotos Duisburger
Verkehrsgesellschaft AG
Studie untersucht Agrar-Jobs
– vom Arbeitsplatz-Risiko „Huftritt“ bis zum Lohn Arbeitsplatz
Stall: Wer in Duisburg in der Tierhaltung arbeitet, soll Umfrage
mitmachen
Arbeitsplatz Stall: Gesucht werden
Agrar-Beschäftigte in Duisburg und der Region, die in ihrem Job
ständig mit Tieren zu tun haben. Sie haben jetzt die Chance, bei
einer bundesweiten Umfrage für eine Agrar-Studie mitzumachen. Darauf
hat die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU)
hingewiesen.

Ob Ferkelzucht oder Schweinemast: Die Arbeit im Stall ist kein
08/15-Job. AgrarBeschäftigte in Duisburg haben zum ersten Mal die
Chance, für eine bundesweite Studie bei einer Online-Umfrage
mitzumachen. Dabei geht es um die Arbeitsbedingungen in der
Tierhaltung.
Der Fragebogen ist online – per Smartphone,
Tablet oder am Computer – aufzurufen:
www.peco-ev.de/allgemein/onlineumfrage-unter-beschaeftigten-in-der-tierhaltung-und-tierzucht.
Das Beantworten der Fragen dauert nach Angaben der
Agrar-Gewerkschaft nur rund eine Viertelstunde. Die Online-Umfrage
läuft noch bis zum 14. September. „Sie ist völlig anonym“, so die IG
BAU Duisburg-Niederrhein.
„Die Arbeit mit Tieren in der
Aufzucht oder Mast ist alles andere als ein 08/15-Job. Wer ihn
macht, sollte sich deshalb kurz Zeit nehmen, einige Fragen zur
Arbeit im Stall zu beantworten“, sagt Karina Pfau von der
Agrar-Gewerkschaft. Mit der Online-Umfrage lege zum ersten Mal ein
Forscherteam des gewerkschaftsnahen PECO-Instituts den Fokus gezielt
auf Beschäftigte und Azubis, die in der Tierzucht und Tierhaltung
arbeiten.
Dabei gehe es um Arbeitsbedingungen, Löhne,
Belastungen und auch um die Zufriedenheit im Job. „Vom Huftritt bis
zum Staub – Arbeitsschutz im Stall ist dabei ein wichtiges Thema.
Auch um Arbeitszeiten geht es natürlich. Immerhin gibt es da, wo
Tiere im Stall stehen, eine 7-Tage-Woche“, so Pfau. Außerdem brenne
den Wissenschaftlern ein anderer Aspekt auf den Nägeln: „Haben
Beschäftigte genug Zeit, um sich vernünftig um die Tiere zu kümmern?
Oder anders gefragt: Wie groß ist der Arbeitsdruck im Stall?“, so
Karina Pfau.
Die Vorsitzende der IG BAU Duisburg-Niederrhein
will mit ihrem Umfrage-Appell erreichen, dass auch „die Situation in
den Ställen der Landwirtschaft in Duisburg und der Region mit in die
Studie einfließt“. Das Projekt wird nach Angaben der
Agrar-Gewerkschaft von der Robert-Bosch-Stiftung unterstützt.
Der Umbau zur Königsgalerie hat begonnen!
Multi Development investiert mit gut 70-Millionen Euro mehr als die
Bundesregierung mit dem Konjunktur II-Paket für Duisburg von 67,8
Millionen Euro
Duisburg, 14. August 2009 -
Mit den ersten sichtbaren Abrissarbeiten hat am 14. August 2009 im
Beisein und mit tatkräftiger Unterstützung von Oberbürgermeister
Adolf Sauerland der Umbau der Galeria Duisburg zur Königsgalerie
begonnen. Das Stadtoberhaupt hat eigenhändig mit einem Kran einen
Teil des Glasdaches in der Untermauerstraße, welches der Galeria
vorgelagert ist, entfernt.
Mit der Königsgalerie erfährt die
Haupteinkaufsstraße Duisburgs, die Königstraße, sowie der Sonnenwall
einen weiteren wichtigen Impuls. Die um- und ausgebaute
Einkaufsgalerie wird mit ihrem hochwertigen Handels- und
Gastronomiekonzept eine Marktlücke in Duisburgs
Einzelhandelslandschaft schließen und markiert an der Königstraße
den Auftakt zum Einkaufserlebnis in der Duisburger Innenstadt.
Die
Königsgalerie bietet 16.500 Quadratmeter Einzelhandelsfläche sowie
3.500 Quadratmeter Fläche für Büros und Dienstleistungen in
1A-Innenstadtlage – zwischen Königstraße, Sonnenwall und Steinscher
Gasse. Sie wird über 50 Mieteinheiten und ca. 320 Parkplätze verfügen. Das “Parkhaus Königsgalerie” bleibt
während der gesamten Umbaumaßnahmen geöffnet.
Das
Investitionsvolumen für die Königsgalerie liegt bei 80 Mio. Euro.
Die Eröffnung ist für Ende 2010 geplant. Tag der offenen Tür
Projektentwickler und Investor der Königsgalerie Multi Development
wird am Donnerstag, den 27. August 2009 einen “Tag der offenen Tür”
veranstalten. Von 15.00 bis 18.00 Uhr wird das Multi-Team vor Ort in
der Königsgalerie sein und Anwohner, Nachbarn sowie Interessierte
über die geplanten Baumaßnahmen informieren.
"Dieses Projekt
ist für uns ein Erstlingswerk, da wir bisher bisher nur neu gebaut
und noch nicht umgestaltet haben. Wir investieren in dieses Projekt
mehr als die Bundesregierung mit dem Konjunkturpaket II für
Duisburg, wobei wie auch keinen hauptausführenden Baukonzern damit
beauftragt haben, es wird alles mit Duisburger Unternehmen
umgebaut", erklärte MD-Geschäftsführer Axel Funke (Foto rechts).
Und: "Es sind exakt 70 Millionen Euro an Investitionen", bestätigte
der technische MD-Vorstand Peter Knopf. Harald Jeschke
BDP begrüßt Planungen der Bundesregierung zu Maßnahmen zum
Schutz sensibler Daten bei der elektronischen Patientenakte
Laut einem Kabinettsentwurf zum Gesetz zur Befugniserweiterung und
Entbürokratisierung in der Pflege vom 06.08.2025 sieht die
Bundesregierung die Implementierung weiterer Ausnahmeregelungen bei
der Speicherverpflichtung von hochsensiblen Daten bei der
elektronischen Patientenakte (ePA) vor.
Der Berufsverband
Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP) sowie dessen
Fachsektion Psychologischer Psychotherapeut*innen (VPP im BDP)
begrüßen diese Entwicklungen als richtigen und wichtigen Schritt. So
sieht der Gesetzesentwurf u. a. vor, dass für die ePA zukünftig
keine Speicher- und Übermittlungspflichten mehr bestehen sollen,
„wenn dem erhebliche therapeutische Gründe oder sonstige erhebliche
Rechte Dritter entgegenstehen“.
Zum Schutz von Patient*innen
vor Vollendung des 15. Lebensjahres soll eine weitere
Ausnahmeregelung gesetzlich verankert werden, „wenn gewichtige
Anhaltspunkte für eine Gefährdung bestehen und eine mögliche
Einsichtnahme bestimmter Informationen durch Sorgeberechtigte oder
andere Zugriffsberechtigte den wirksamen Schutz der minderjährigen
Patient*innen in Frage stellen würde.“
Ab Vollendung des 15.
Lebensjahres können Jugendliche ihre Rechte im Hinblick auf die
elektronische Patientenakte dann selbst ausüben. In zahlreichen
Stellungnahmen zur elektronischen Patientenakte hatte der Verband
immer wieder auf die eklatante Datenschutzproblematik, besonders
auch bei sensiblen Daten aus psychotherapeutischen und
psychiatrischen Behandlungen sowie Entlassbriefen aus
psychosomatischen Kliniken, aufmerksam gemacht, in welchen auch
Daten über Dritte, wie Eltern, Geschwister oder Ehepartner*innen,
aufgenommen und weitergegeben werden können.
Im Rahmen der
geplanten neuen Regelungen erhielten Behandelnde die Möglichkeit,
auf eine Speicherung entsprechender Daten und Befunde in der ePA zu
verzichten. Gleiches würde für die Abwägung etwaiger erheblicher
therapeutischer Risiken bei der Datenspeicherung gelten, auch hier
könnten Behandelnde bei sichtbaren Risiken auf eine Speicherung von
Behandlungsdaten in der ePA verzichten.
Vor allem vor dem
Hintergrund der aktuell gegebenen breitflächigen und umfänglichen
Einsichtsrechte Behandelnder sowie Versicherter und weiterer
Personen ist der geplante Schutz von sensiblen Daten besonders
wichtig. Denn bisher gilt bei einem fehlenden Widerspruch zur
ePA-Datenspeicherung durch gesetzlich Versicherte, dass alle (auch
fachfremde) Behandelnde, deren berufliche Gehilfen sowie Apotheken
alle in der ePA gespeicherten Daten einsehen können.
„Die
geplanten gesetzlichen Neuregelungen wären eine gute und sinnvolle
Lösung für die aktuell bestehende prekäre Situation im Bereich der
Speicherung, Weitergabe und Verwendung von ePA-Daten, besonders auch
hochsensibler Daten, und eine Lücke bei der Datenschutzproblematik
könnte geschlossen werden“, erläutert BDP-Vizepräsidentin Susanne
Berwanger. BDP und VPP unterstützen den Kabinettsentwurf daher
vollumfänglich und sprechen sich für eine zeitnahe Umsetzung aus.
Basteln in der Bezirksbibliothek Meiderich
In der Meidericher Bibliothek auf der Von-der-Mark-Str. 71 treffen
sich jeden zweiten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr Interessierte zu
einem Bastelkreis. Das nächste Treffen ist am 14. August. Alle, die
Freude am kreativen Gestalten mit Papier, Tonkarton und anderen
Materialien haben, sind herzlich willkommen.
Selbstverständlich können eigene Bastelmaterialien mitgebracht und
individuell verwendet werden. Es stehen aber auch Klebestifte,
kleine Scheren, Buntstifte sowie Tonpapier und -karton vor Ort zur
Verfügung. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, unter Anleitung von
Marion de Heuvel kreative Upcycling-Ideen mit Papier und Pappe
umzusetzen.
Bastelbücher zu verschiedenen Themen können
liegen bereit und können mit gültigem Bibliotheksausweis auch
ausgeliehen werden. Die Teilnahme ist kostenfrei und eine Anmeldung
ist nicht erforderlich. Für Fragen steht das Team persönlich oder
telefonisch unter 0203/4499366 zur Verfügung. Die Öffnungszeiten der
Bibliothek sind dienstags bis freitags von 10:30 bis 13 Uhr und von
14 bis 18:30 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr.
Rheingemeinde lädt zum Spieleabend nach Wanheim
Am
kommenden Montag, 18. August 2025 ist wieder Spieleabend in der
Evangelischen Rheingemeinde Duisburg. Fans von Würfel-, Karten- und
Gesellschaftsspielen treffen sich um 17 Uhr im Gemeindehaus Beim
Knevelshof 45, um gemeinsam bei Knabbereien und Getränken viel Spaß
zu haben beim Würfeln, Kartenkloppen und Knobeln.
Highlights
sind z.B. „Sky-Jo“, „Dogs“, „Quixx“ oder „Uno Flip“, aber auch
andere Spiele sind gerne gesehen. Anmelden muss sich niemand. Wer
mag, darf sein Lieblingsspiel mitbringen und es den anderen
vorstellen. Mehr Informationen gibt es bei Ute Theisen,
0177/8066048,
ute.theisen.1@ekir.de.

(Foto: Evangelisch Rheingemeinde Duisburg)

Inflationsrate im Juli 2025 bei +2,0 %
Verbraucherpreisindex, Juli 2025:
+2,0 % zum Vorjahresmonat
(vorläufiges Ergebnis bestätigt)
+0,3 % zum Vormonat (vorläufiges
Ergebnis bestätigt)
Harmonisierter Verbraucherpreisindex,
Juli 2025:
+1,8 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis
bestätigt)
+0,4 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)
Inflationsrate bleibt unverändert,
Energiepreisentwicklung wirkt weiterhin dämpfend
Verbraucherpreisindex, Juli 2025: +2,0 % zum Vorjahresmonat
(vorläufiges Ergebnis bestätigt) +0,3 % zum Vormonat (vorläufiges
Ergebnis bestätigt) Harmonisierter Verbraucherpreisindex, Juli 2025:
+1,8 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt) +0,4 %
zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)
Die
Inflationsrate in Deutschland – gemessen als Veränderung des
Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat – lag im Juli 2025
bei +2,0 %. Im Juni 2025 hatte sie ebenfalls +2,0 % betragen, nach
jeweils +2,1 % im Mai und April 2025. "Die Inflationsrate hat sich
seit Jahresbeginn stabilisiert und blieb erneut zwei Monate in Folge
unverändert", sagt Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen
Bundesamtes (Destatis).
"Der Rückgang der Energiepreise hält
an und dämpft die Gesamtteuerung. Dagegen bleibt vor allem der
Preisauftrieb bei Dienstleistungen überdurchschnittlich und hebt die
Inflationsrate." Gegenüber dem Vormonat Juni 2025 stiegen die
Verbraucherpreise im Juli 2025 um 0,3 %.
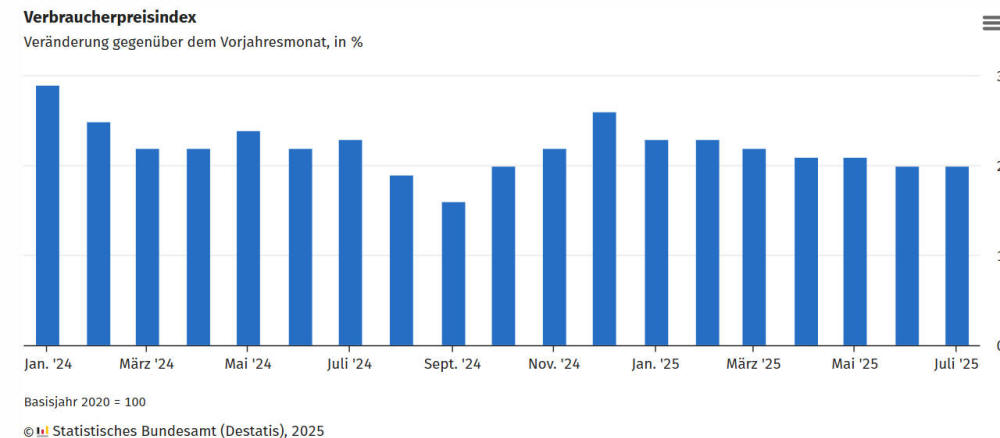
Energieprodukte verbilligten sich um 3,4 % gegenüber Juli 2024
Die Preise
für Energieprodukte lagen im Juli 2025 um 3,4 % niedriger als im
Vorjahresmonat. Der Preisrückgang für Energie hat sich den dritten
Monat in Folge abgeschwächt und fiel somit im Juli 2025 erneut etwas
niedriger aus (Juni 2025: -3,5 %). Binnen Jahresfrist gingen im Juli
2025 sowohl die Preise für Kraftstoffe (-4,5 %) als auch für
Haushaltsenergie (-2,6 %) zurück.
Insbesondere konnten die
Verbraucherinnen und Verbraucher weiterhin von günstigeren Preisen
für Brennholz, Holzpellets oder andere Brennstoffe (-5,3 %) sowie
für leichtes Heizöl (-5,0 %) profitieren. Auch Strom (-2,0 %) und
Fernwärme (-1,8 %) verbilligten sich gegenüber dem Vorjahresmonat.
Etwas teurer als ein Jahr zuvor war hingegen Erdgas (+0,3 %).
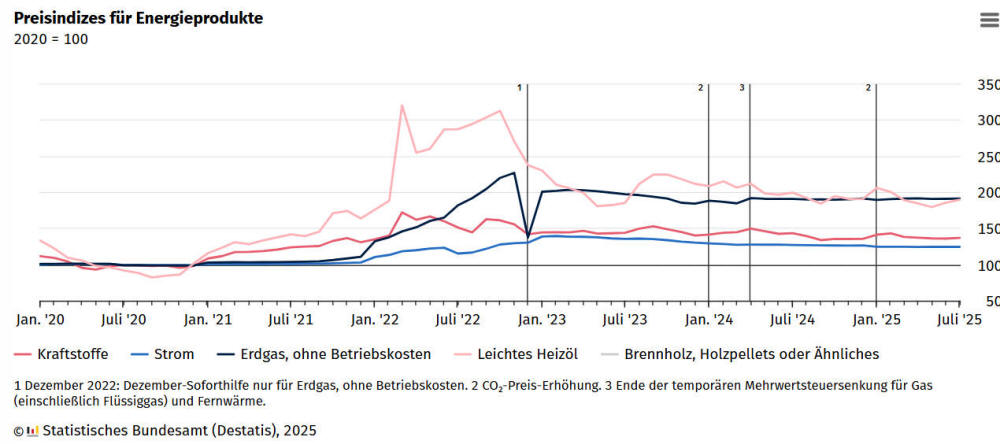
Nahrungsmittel verteuerten sich binnen Jahresfrist um 2,2 %
Die Preise für Nahrungsmittel waren im Juli 2025 um 2,2 % höher als
im Vorjahresmonat und lagen damit wieder knapp über der
Gesamtteuerung. Im Juni 2025 hatte der Preisauftrieb
für Nahrungsmittel etwas niedriger bei +2,0 % gelegen. Von Juli
2024 bis Juli 2025 verteuerten sich vor allem Obst (+7,6 %) sowie
Zucker, Marmelade, Honig und andere Süßwaren (+5,6 %). Auch für
Molkereiprodukte und Eier (+4,1 %) fiel die Preiserhöhung deutlich
aus.
Daneben waren unterdurchschnittliche Preiserhöhungen zu
beobachten, zum Beispiel bei Fisch, Fischwaren und Meeresfrüchten
(+0,9 %) sowie bei Brot und Getreideerzeugnissen (+0,7 %). Günstiger
als ein Jahr zuvor wurde hingegen vor allem Gemüse (-3,2 %). Im
Einzelnen standen auffälligen Preiserhöhungen (zum
Beispiel Schokolade: +18,6 %) auch auffällige
Preisrückgänge (zum Beispiel Zucker: -29,4 %;
Kartoffeln: -16,1 %) gegenüber.
Inflationsrate ohne
Nahrungsmittel und Energie bei +2,7 % Im Juli 2025 lag die
Inflationsrate ohne Energie ebenso wie schon im Juni 2025
unverändert bei +2,6 %. Die Inflationsrate
ohne Berücksichtigung von Nahrungsmitteln und Energie, häufig
auch als Kerninflation bezeichnet, lag im Juli 2025 ebenfalls wie im
Vormonat bei +2,7 %. Die beiden Kenngrößen liegen seit über einem
Jahr über der Gesamtteuerung und verdeutlichen somit, dass die
Teuerung in anderen wichtigen Güterbereichen überdurchschnittlich
hoch war.
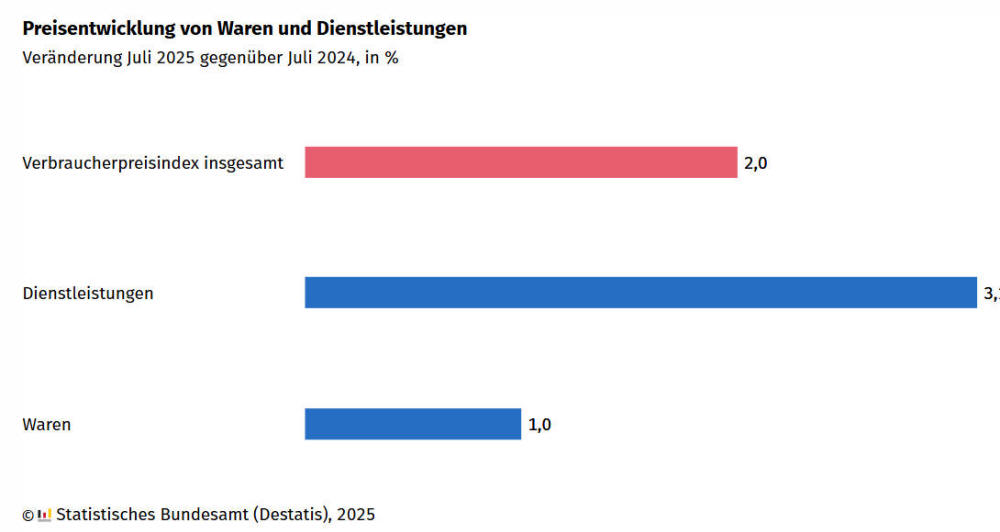
Dienstleistungen verteuerten sich binnen
Jahresfrist überdurchschnittlich um 3,1 % Die Preise für Dienstleistungen
insgesamt lagen im Juli 2025 um 3,1 % höher als im
Vorjahresmonat, nach +3,3 % im Juni 2025. Von Juli 2024 bis Juli
2025 erhöhten sich Preise vor allem für kombinierte
Personenbeförderung (+11,3 %). Auch wurden beispielsweise für
Brief- und Paketdienstleistungen (+9,0 %) und für Dienstleistungen
sozialer Einrichtungen (+8,2 %) überdurchschnittliche
Preiserhöhungen ermittelt.
Deutlich teurer als ein Jahr
zuvor waren zudem viele andere Dienstleistungen wie Versicherungen
(+5,8 %), Wartung und Reparatur von Fahrzeugen (+5,7 %),
Gaststättendienstleistungen (+4,1 %) sowie Wasserversorgung und
andere Dienstleistungen für die Wohnung (+3,9 %). Bedeutsam für die
Preisentwicklung bei Dienstleistungen bleiben auch im Juli 2025 die Nettokaltmieten mit
+2,0 %.
Dagegen waren nur wenige Dienstleistungen günstiger
als im Vorjahresmonat, zum Beispiel internationale Flüge (-6,8 %)
und Telekommunikationsdienstleistungen (-1,4 %). Waren verteuerten
sich gegenüber Juli 2024 um 1,0 % Waren insgesamt verteuerten sich
von Juli 2024 bis Juli 2025 um 1,0 % (Juni 2025: +0,8 %).
Die Preise für Verbrauchsgüter stiegen dabei um 1,1 % und für
Gebrauchsgüter um 0,9 %. Neben dem Preisanstieg bei Nahrungsmitteln
(+2,2 %) wurden einige andere Waren deutlich teurer, zum Beispiel
alkoholfreie Getränke (+7,5 %, darunter Kaffee,
Tee und Kakao: +16,6 %) und Tabakwaren (+6,0 %). Für die meisten
Waren wurde eine geringe Preiserhöhung ermittelt, zum Beispiel für
Möbel und Leuchten (+0,7 %) sowie für Bekleidungsartikel (+0,9 %).
Preisrückgänge waren hingegen außer bei der Energie (-3,4 %)
unter anderem bei Mobiltelefonen (-5,1 %),
Informationsverarbeitungsgeräten (-4,5 %) sowie elektrischen
Haushaltsgeräten (-2,6 %) zu verzeichnen.
Preise insgesamt
stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,3 %
Im Vergleich zum Juni
2025 stieg der Verbraucherpreisindex im Juli 2025 um 0,3 %. Teurer
binnen Monatsfrist wurden in der Sommerreisezeit vor allem
internationale Flugtickets (+12,7 %) und Pauschalreisen ins Ausland
(+10,7 %). Die Preise für Energie insgesamt stiegen um 0,4 %
gegenüber dem Vormonat, insbesondere wurden Heizöl und Kraftstoffe
(+0,8 %) sowie Brennholz, Holzpellets und andere feste Brennstoffe
(+1,1 %) teurer.
Die Preise für Nahrungsmittel insgesamt
blieben binnen Monatsfrist nahezu stabil (-0,1 %). Hier standen den
Preisanstiegen bei Fleisch und Fleischwaren (+0,8 %) Preisrückgänge
bei frischem Obst (-0,9 %) und frischem Gemüse (-1,4 %) gegenüber.
Zudem gingen die Preise für Bekleidungsartikel – auch saisonbedingt
–zurück (-3,5 %).
Produktion von Klimageräten binnen fünf Jahren um 75,1 %
gestiegen
Importe von Klimageräten 2024 mit wertmäßig
+48,2 % ebenfalls deutlich höher als 2019
Mit Blick auf
heiße Sommer wächst der Bedarf an Klimaanlagen und - geräten. Die
Produktion von Klimageräten in Deutschland ist in den letzten fünf
Jahren um 75,1 % auf rund 317 000 Stück im Jahr 2024 gestiegen, wie
das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Das ist der höchste
Stand der letzten fünf Jahre; 2019 wurden hierzulande noch 181 000
solcher Geräte hergestellt. Wertmäßig nahm die Produktion im selben
Zeitraum um 34,4 % auf 1,5 Milliarden Euro im Jahr 2024 zu.
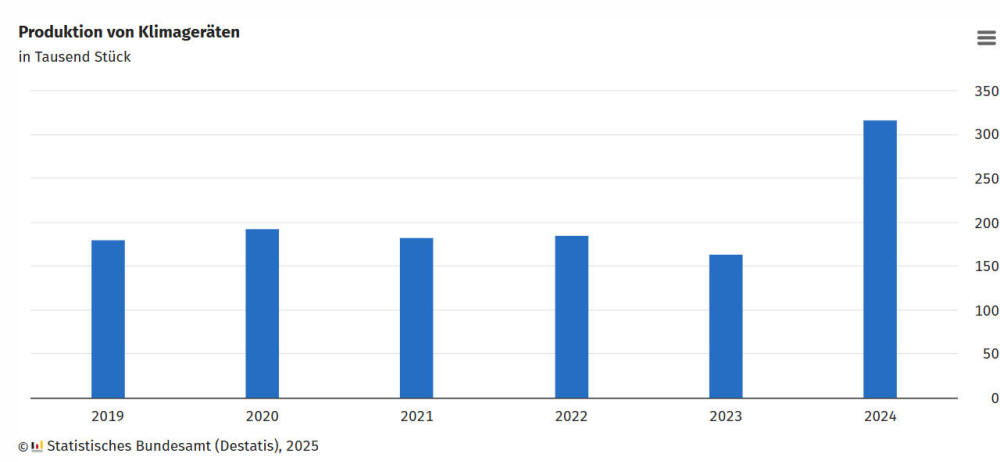
Italien 2024 wichtigstes Herkunftsland von Klimageräten
Auch die
Importe von Klimageräten sind in den letzten fünf Jahren deutlich
gestiegen: Der Wert der insgesamt eingeführten Geräte nahm gegenüber
2019 um 48,2 % auf 949 Millionen Euro im Jahr 2024 zu. 2019 hatte er
noch 640 Millionen Euro betragen. Den bisher höchsten Wert
erreichten die Importe von Klimageräten im Jahr 2023 mit
957 Millionen Euro.
Wichtigstes Herkunftsland von
Klimageräten war im Jahr 2024 Italien mit einem Anteil von 25,0 %
(237 Millionen Euro), gefolgt von China mit 13,7 % (130 Millionen
Euro) und Schweden mit 10,4 % (98 Millionen Euro). Die Exporte von
Klimageräten sind 2024 gegenüber 2019 dagegen leicht zurückgegangen:
um 2,8 % auf 713 Millionen Euro.