






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 39. Kalenderwoche:
23. September
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Mittwoch, 24. September 2025 - Tag der Flüsse
Handelsabkommen EU-Indonesien steht
Die Europäische Union und Indonesien haben ihre Verhandlungen über
ein umfassendes Wirtschaftspartnerschaftsabkommen und ein
Investitionsschutzabkommen abgeschlossen. Dies folgt auf eine
entsprechende politische
Einigung zwischen Kommissionspräsidentin von der Leyen und
Präsident Prabowo Subianto vom 13. Juli.
„Unser Abkommen mit
Indonesien schafft neue Möglichkeiten für Unternehmen, Landwirtinnen
und Landwirte,“ erklärte von der Leyen. „Es bietet uns auch eine
stabile und vorhersehbare Versorgung mit kritischen Rohstoffen, die
für Europas saubere Technologie und die Stahlindustrie von
wesentlicher Bedeutung sind.“
Senkung von Zöllen
Das Handelsabkommen (CEPA) schafft eine
Freihandelszone mit über 700 Millionen Verbraucherinnen und
Verbrauchern.
Es wird den europäischen Landwirtinnen und
Landwirten erheblich zugutekommen, da die Zölle auf Agrar- und
Lebensmittelerzeugnisse gesenkt und traditionelle EU-Erzeugnisse
sowie wichtige Industriezweige wie die Automobil-, Chemie- und
Maschinenbaubranche geschützt werden.
Insgesamt werden die
EU-Exporteure jährlich rund 600 Millionen Euro an Zöllen einsparen,
die derzeit auf Waren entrichtet werden, die auf den indonesischen
Markt gelangen. Europäische Produkte werden für indonesische
Verbraucherinnen und Verbrauchern erschwinglicher.
Das Abkommen
ist auch ein wichtiger Meilenstein für die EU und Indonesien, um
nachhaltiges Wachstum und den ökologischen Wandel zu fördern.
Privilegierter Zugang für große und kleine europäische
Unternehmen
Das Abkommen wird EU-Unternehmen einen privilegierten
Zugang zum indonesischen Markt gewähren, indem
die Einfuhrzölle
auf 98,5 Prozent der Zolltarifpositionen abgeschafft und Verfahren
für EU-Warenausfuhren nach Indonesien, einschließlich wichtiger
Ausfuhren wie Pkw und Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse,
vereinfacht werden; die Erbringung von Dienstleistungen in
Schlüsselsektoren wie IT und Telekommunikation durch EU-Unternehmen
ermöglicht wird;
neue Möglichkeiten für EU-Investitionen in
Indonesien erschlossen werden, insbesondere in strategischen
Sektoren wie Elektrofahrzeuge, Elektronik und Arzneimittel, wodurch
die Integration der Versorgungs- und Wertschöpfungsketten beider
Seiten gefördert wird; geistiges Eigentum wie Marken geschützt wird,
und es EU-Unternehmen so ermöglicht wird, ihre Markenidentität und
ihren Ruf zu schützen.
Ein großer Gewinn für die europäischen
Landwirte
Dank der Abschaffung der Zölle auf wichtige
EU-Ausfuhren wie Milchprodukte, Fleisch, Obst und Gemüse und eine
breite Palette verarbeiteter Lebensmittel werden die Landwirte in
der EU wesentlich bessere Möglichkeiten erhalten, ihre Erzeugnisse
in Indonesien zu verkaufen. Außerdem werden 221 geografische Angaben
für die EU und 72 geografische Angaben für indonesische Produkte
geschützt. Schließlich werden besonders sensible Agrar- und
Lebensmittelerzeugnisse wie Reis, Zucker und frische Bananen
geschützt, indem die bestehenden Zölle aufrechterhalten werden, und
für der Zugang bestimmter anderer Erzeugnisse gelten Quoten für den
Zugang zum EU-Markt.
Ein Deal für nachhaltiges Wachstum und
Entwicklung
Das Abkommen EU-Indonesien verfügt über eine starke
Nachhaltigkeitssäule. So wird mit dem Abkommen das Pariser
Klimaschutzabkommen als wesentliches Element festgelegt und der
Handel mit und Investitionen in Produkte gefördert, die für Umwelt-
und Klimaziele von entscheidender Bedeutung sind, einschließlich
erneuerbarer Energien und CO2-armer Technologien.
Das CEPA
bietet eine Plattform für Zusammenarbeit, Dialog und
Handelserleichterungen in einer Reihe von handelsbezogenen Umwelt-
und Klimafragen, auch im Palmölsektor. Dies bietet Möglichkeiten,
die Gespräche über Nachhaltigkeit zwischen der EU und Indonesien
voranzubringen und sicherzustellen, dass mehr Handel, Sozialschutz
und eine solide Umweltpolitik Hand in Hand gehen.
Sichere und
nachhaltige Versorgung mit kritischen Rohstoffen
Indonesien ist
ein weltweit führender Hersteller von Rohstoffen, von denen viele
für den grünen und digitalen Sektor von entscheidender Bedeutung
sind. Das Abkommen stärkt berechenbare, zuverlässige und nachhaltige
Lieferketten, unter anderem durch ermäßigte Zölle,
Exporterleichterungen, Umweltverträglichkeitsprüfungen und
erweiterte Zusammenarbeit.
Nächste Schritte
Die
ausgehandelten Textentwürfe werden in Kürze veröffentlicht. Diese
Texte werden rechtlich überarbeitet und in alle EU-Amtssprachen
übersetzt. Die Europäische Kommission wird dann dem Rat ihren
Vorschlag für die Unterzeichnung und den Abschluss des CEPA und des
IPA vorlegen. Nach der Annahme durch den Rat können die EU und
Indonesien die Abkommen unterzeichnen.
Nach der
Unterzeichnung werden die Texte dem Europäischen Parlament zur
Zustimmung übermittelt. Nach Zustimmung des Europäischen Parlaments
und nach deren Ratifizierung durch Indonesien können das CEPA und
das IPA in Kraft treten.
Erklärung des
Nordatlantikrats zu den jüngsten Luftraumverletzungen durch Russland
Der Nordatlantikrat ist heute Morgen auf Ersuchen Estlands gemäß
Artikel 4 des Washingtoner Vertrags zusammengetreten, um die
gefährliche Verletzung des estnischen Luftraums durch Russland am
19. September zu beraten und aufs Schärfste zu verurteilen.
Der Oberste Alliierte Befehlshaber Europa (SACEUR) informierte den
Rat über den Vorfall, bei dem drei bewaffnete russische
MiG-31-Flugzeuge über zehn Minuten lang den estnischen Luftraum
verletzten. Die NATO reagierte schnell und entschlossen. Alliierte
Flugzeuge wurden alarmiert, um die drei Flugzeuge abzufangen und aus
dem estnischen Luftraum zu eskortieren.
Dieser Übergriff ist
Teil eines größeren Musters zunehmend verantwortungslosen russischen
Verhaltens. Dies ist das zweite Mal innerhalb von zwei Wochen, dass
der Nordatlantikrat gemäß Artikel 4 zusammentritt. Am 10. September
hielt der Rat Konsultationen als Reaktion auf die großflächige
Verletzung des polnischen Luftraums durch russische Drohnen ab. Auch
mehrere andere Bündnispartner – darunter Finnland, Lettland,
Litauen, Norwegen und Rumänien – waren in jüngster Zeit von
Luftraumverletzungen durch Russland betroffen. Wir bekunden unsere
uneingeschränkte Solidarität mit allen Bündnispartnern, deren
Luftraum verletzt wurde.
Russland trägt die volle
Verantwortung für diese eskalierenden Aktionen, die zu
Fehlkalkulationen führen und Menschenleben gefährden. Sie müssen
aufhören.
Die Reaktion der NATO auf Russlands rücksichtsloses
Vorgehen wird weiterhin entschlossen sein. Am 12. September haben
wir die „Eastern Sentry“-Mission gestartet, um die Position der NATO
entlang der gesamten Ostflanke zu stärken. Wir werden unsere
Fähigkeiten ausbauen und unsere Abschreckungs- und
Verteidigungsposition stärken, unter anderem durch eine wirksame
Luftverteidigung.
Russland sollte keinen Zweifel daran haben:
Die NATO und ihre Verbündeten werden im Einklang mit dem Völkerrecht
alle notwendigen militärischen und nichtmilitärischen Mittel
einsetzen, um sich zu verteidigen und Bedrohungen aus allen
Richtungen abzuwehren. Wir werden weiterhin in der von uns gewählten
Art und Weise, zu unserem Zeitpunkt und in unserem jeweiligen
Bereich reagieren. Unser Bekenntnis zu Artikel 5 ist
unerschütterlich.
Diese und andere unverantwortliche
Handlungen Russlands werden die Verbündeten nicht davon abhalten,
ihre anhaltenden Verpflichtungen zur Unterstützung der Ukraine
einzuhalten, deren Sicherheit auch unsere Sicherheit betrifft, und
zwar bei der Ausübung ihres naturgegebenen Rechts auf
Selbstverteidigung gegen den brutalen und grundlosen Angriffskrieg
Russlands.
Erklärung des Conseil de l'Atlantique Nord zu den
jüngsten Verstößen gegen den Luftraum der Allianz durch Russland
Der Rat des Atlantischen Ozeans ist heute auf Nachfrage von Estland
zu Konsultationen in Bezug auf Artikel 4 der Verhandlungen über
Washington bereit. Ich verurteile die Gefahr einer Verletzung des
estnischen Luftraums, die Russland am 19. September befohlen hat.
Der Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Europa
(SACEUR) übermittelte dem Rat eine Informationsmitteilung über den
Fall dieses Verstoßes, während drei russische Flugzeuge der
MiG-31-Armee in den Luftraum Estlands eindrangen, oder sie blieben
mehr als zwei Minuten übrig. Das Unternehmen reagierte schnell und
wirksam: Die Truppen der Allianz wurden sofort abgeschossen, die
russischen Flugzeuge und die Begleitpersonen wurden in der Luft des
estnischen Weltraums abgefangen.
Dieser Einfall ist eine neue
Illustration des Verhaltens der Pluspunkte und der
Verantwortungslosigkeit Russlands. Am 10. September hat der Rat zwei
Wochen lang Konsultationen wegen eines massiven Verstoßes gegen den
polnischen Luftraum durch russische Drohnen durchgeführt. Plusieurs
autres Alliés – Finnland, Lettland, Litauen, Norwegen und Rumänien –
haben die Verstöße gegen ihren Luftraum durch Russland
zurückgewiesen. Wir bitten alle unsere betroffenen Verbündeten um
Solidarität.
Die Russen tragen die gesamte Verantwortung für
diese Maßnahmen, da sie von Natur aus zu einer Eskalation geführt
haben, es besteht die Gefahr, dass sie sich nicht einem Fehler in
der Wertschätzung unterziehen und in Gefahr geraten. Tout cela doit
cesser.
L'OTAN hat dem Gegner weiterhin eine Antwort auf die
rücksichtslosen Klagen Russlands gegeben. Am 12. September starteten
wir die Initiative Eastern Sentry. Das Ziel bestand darin, die
Haltung des OTAN auf dem orientalischen Ensemble zu verbessern. Wir
alle verstärken unsere Kapazitäten außer unserer Abschreckungs- und
Verteidigungshaltung und benachrichtigen uns über unser gesamtes
Verteidigungswerk in der Luft.
Dass die Russen nicht von der
OTAN und den eingesetzten Alliierten mit Respekt vor dem
internationalen Recht kontrolliert werden, alle militärischen und
nichtmilitärischen Werkzeuge müssen über sie verfügen, um sie zu
verteidigen und alle Bedrohungen abzuwehren, die ihnen bevorstehen.
Wir fuhren fort, zu reagieren, und als wir uns in der Umgebung
unserer Wahl befanden. Unser Anhang zu Artikel 5 ist infektiös.
Gewissenhaft, dass die Sicherheit der Ukraine zu ihrer eigenen
Sicherheit beiträgt, sind die Alliierten immer noch entschlossen,
ihnen dabei zu helfen, ihr natürliches Recht auf Verteidigung im
brutalen Kampf auszuüben, den Russland in Abwesenheit von ihnen
gegen sie abgegeben hat Totale Provokation. Die unverantwortlichen
Agissements von Moskau haben diese Verpflichtung nicht aufgegeben.
Tag der Flüsse: Stadtwerke Duisburg sichern
Trinkwasserversorgung und investieren in klimafreundliche
Technologien
Rhein und Ruhr sind wichtige Lebensadern für Duisburg und prägen die
Stadt und ihre Geschichte. Anlässlich des internationalen Tags der
Flüsse am 24. September machen die Stadtwerke Duisburg die große
Bedeutung des Rheins für die Trinkwasserversorgung und den
Umweltschutz in der Region deutlich.
Mit zwei Wasserwerken
in unmittelbarer Nähe zu Deutschlands größtem Fluss, einer
innovativen iKWK-Anlage an der Kläranlage in Huckingen und einer
bald entstehenden Großwärmepumpe am Energiepark Wanheim setzen die
Stadtwerke konsequent auf nachhaltige Nutzung und Schutz der
Ressource Flusswasser.
„Der Rhein ist für Duisburg weit mehr
als ein Fluss – er ist Grundlage für unsere Trinkwasserversorgung,
er prägt das Stadtbild und ist wichtiger Natur- und Erholungsraum.
Deshalb setzen wir uns für den Schutz des Flusses ein und nutzen
seine Potenziale für eine umweltfreundliche Versorgung der Menschen
in unserer Stadt“, sagt Andreas Gutschek, Vorstand Infrastruktur und
Digitalisierung bei der Stadtwerken Duisburg.

Das Wasserwerk Wittlaer der Stadtwerke Duisburg liegt in
unmittelbarer Nähe zum Rhein. In den angrenzenden Rheinwiesen stehen
die Brunnenanlagen, in denen das Rohwasser für die
Trinkwasseraufbereitung gewonnen wird. Foto Stadtwerke Duisburg
Trinkwasser aus dem Rhein – eine verlässliche Grundlage
Die
Trinkwassererzeugung der Stadtwerke Duisburg basiert bis zu 70
Prozent auf Rheinuferfiltrat, das vor allem im Wasserwerk Wittlaer
der Stadtwerke Duisburg aufbereitet wird. In den Rheinwiesen um das
Wasserwerk herum liegen die Brunnenanlagen, in denen das Rohwasser
gefördert wird. Diese Rheinauen sind sensible Ökosysteme, die nicht
nur als natürliche Filterzonen wirken, sondern auch Lebensräume für
zahlreiche Tier- und Pflanzenarten darstellen.
Um die hohe
Trinkwasserqualität dauerhaft zu sichern, investieren die Stadtwerke
kontinuierlich in den Schutz und die Pflege dieser Flächen. Jährlich
werden mehr als 30 Milliarden Liter Trinkwasser von den Stadtwerken
Duisburg an die Menschen an Rhein und Ruhr geliefert.
iKWK-Anlage kühlt heiße Flüsse im Sommer ab
Mit der innovativen
iKWK-Anlage an der Kläranlage Huckingen tragen die Stadtwerke
Duisburg aktiv zum Gewässerschutz bei. Durch den Einsatz von
Wärmepumpen wird dem bereits geklärten Abwasser fünf Grad seiner
Wärme entzogen, bevor es über den Angerbach in den Rhein eingeleitet
wird.
Gerade in heißen Sommermonaten, in denen Flüsse durch
steigende Temperaturen unter Druck stehen, bedeutet dies eine
Entlastung für das Ökosystem. Die Absenkung der Temperatur
verbessert die Lebensbedingungen für Fische und andere
Wasserlebewesen und trägt dazu bei, die biologische Vielfalt im
Rhein zu erhalten. Gleichzeitig erzeugen die Wärmepumpen
umweltfreundliche Fernwärme und versorgen damit tausende Haushalte
in der Stadt.
Großwärmepumpe am Rhein: Investition in die
Energiezukunft
Ein weiterer Meilenstein in der nachhaltigen
Nutzung des Rheins ist die geplante Großwärmepumpe im Energiepark
Wanheim, bestehend aus vier Aggregaten. Auf dem Gelände direkt am
Fluss soll eine Anlage entstehen, die künftig eine thermische
Leistung von bis zu 60 Megawatt (MW) bereitstellen wird.
Damit sind die Wärmepumpen in der Lage, bei geplanten 6.000
Vollbenutzungsstunden pro Jahr den Wärmebedarf von rund 25.300 an
die Fernwärmeversorgung angeschlossenen Haushalten abzudecken. Die
Wärmepumpen sind ein wichtiger Baustein im Energiesystem der
Stadtwerke, um die Fernwärmeversorgung in Duisburg klimafreundlicher
zu gestalten und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu
verringern. Ziel ist, bis zum Jahr 2035 die Fernwärme für die
angeschlossenen Haushalte in Duisburg CO2-neutral zu erzeugen.
Mit ihrem Engagement am Rhein leisten die Stadtwerke Duisburg
somit nicht nur einen Beitrag zur sicheren Versorgung der Menschen
mit Trinkwasser und Energie, sondern auch zum Schutz der natürlichen
Lebensräume.
14 neue Wasserstoff-Gelenkbusse für
nachhaltige Mobilität in Duisburg
Die DVG arbeitet gemeinsam mit der Stadt Duisburg an der
Modernisierung der Infrastruktur für einen zukunftsfähigen und
nachhaltigen ÖPNV. In den vergangenen Jahren haben DVG und Stadt
bereits viel erreicht.
Früher als geplant sind 14 neue
Wasserstoff-Gelenkbusse vom Typ Solaris Urbino 18 hydrogen auf dem
Betriebshof Unkelstein eingetroffen. Ursprünglich war die
Auslieferung der Fahrzeuge bis Ende 2025 vorgesehen. Kurz vor dem
Start des regulären Linienbetriebs der neuen Wasserstoff-Gelenkbusse
haben jetzt Oberbürgermeister Sören Link und DVG-Technikvorstand
Andreas Gutschek die neuen wasserstoffbetriebenen
Brennstoffzellenbusse vorgestellt.
Mit einer
aufmerksamkeitsstarken Beklebung werden künftig drei der 14
Wasserstoff-Gelenkbusse durch Duisburg fahren und auf die
Internationale Gartenausstellung Ruhrgebiet 2027 (IGA) im Duisburger
Stadtgebiet hinweisen. „Wir wollen für Duisburg einen Nahverkehr,
der verlässlich, zukunftsfähig und klimafreundlich ist. Wasserstoff
spielt dabei eine Schlüsselrolle. Die neuen Wasserstoff-Gelenkbusse
zeigen, wie Innovation und Alltag zusammenpassen“, betont
Oberbürgermeister Sören Link.

Oberbürgermeister
Sören Link und DVG-Vorstand Andreas Gutschek bei der Vorstellung der
neuen Wasserstoff-Gelenkbusse (v.l.). Foto DVG
„Mit den neuen
Wasserstoff-Gelenkbussen treibt die DVG die Antriebswende ihrer
Busflotte weiter voran. Die Inbetriebnahme von weiteren 14
Wasserstoffbussen ist der nächste wichtige Schritt hin zu einem
komplett emissionsfreien Nahverkehr in Duisburg. Wir wollen als
Verkehrsunternehmen diesen Weg weiter gehen. Dabei sind wir auch in
Zukunft auf Fördergelder angewiesen. Denn ohne effektive
Unterstützung von Bund und Land werden wir nicht in der Lage sein,
diesen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz und zur Steigerung der
Lebensqualität in Duisburg zu leisten“, sagt Andreas Gutschek,
Technik-Vorstand der DVG.
Bereits seit März 2025 sind 11
Standard-Wasserstoffbusse vom Typ Solaris Urbino 12 hydrogen im
regulären Linieneinsatz. Mit den neuen Gelenkbussen geht die DVG
einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem
emissionsfreien ÖPNV in Duisburg. Die neuen Fahrzeuge sind 18 Meter
lang, bieten Platz für bis zu 136 Fahrgäste und haben eine
Reichweite von mindestens 400 Kilometern. Fahrgäste und Fahrpersonal
profitieren von einer komfortablen und multifunktionalen
Innenausstattung mit Klimatisierung, großzügigen
Sondernutzungsflächen sowie Assistenzsystemen. Getankt wird an der
mobilen Wasserstofftankstelle auf dem DVG-Busbetriebshof am
Unkelstein in nur rund 20 Minuten.
Vorbereitung für den
Linienbetrieb läuft
Bevor die neuen Gelenkbusse in den regulären
Fahrgastbetrieb starten, werden sie mit DVG-eigener Technik
ausgestattet. Dazu zählen unter anderem Bordrechner,
Einstiegskontrollsysteme, Entwerter sowie Geräte zur digitalen
Fahrdatenübertragung. Anschließend erfolgen umfassende
Funktionsprüfungen aller Systeme.
Nach der technischen Abnahme
werden die Fahrzeuge mit dem DVG-Branding sowie relevanten
Fahrgastinformationen versehen. Bevor sie auf Duisburgs Straßen
unterwegs sind, werden sie auch zu Test- und Schulungszwecken für
das Fahrpersonal eingesetzt. Die neuen Busse werden im gesamten
Stadtgebiet eingesetzt. In den Linienbetrieb starten sie nach und
nach, abhängig vom Fortschritt der Inbetriebnahme jedes einzelnen
Busses.
Tankinfrastruktur: Von mobil zu stationär
Die
Betankung der neuen Gelenkbusse erfolgt – wie auch schon bei den
Standard-Wasserstoffbussen – zunächst an einer mobilen
Wasserstoff-Tankstelle auf dem Busbetriebshof der DVG. Die mobile
Einrichtung überbrückt die Zeit bis zur Fertigstellung der
stationären Wasserstofftankstelle, die durch Fördermittel finanziert
wird und voraussichtlich im vierten Quartal 2026 in Betrieb geht.
Zukunft der Busflotte: Fokus auf alternative Antriebe
Mit den
14 neuen Gelenkbussen steigt die Zahl der lokal emissionsfreien
Fahrzeuge im Fuhrpark der DVG auf 32 Fahrzeuge: 25 Wasserstoff- und
7 Batteriebusse. Das entspricht rund einem Drittel der über 100
Fahrzeuge umfassenden Gesamtflotte. Das Ziel besteht darin, bis
Anfang der 2030er Jahre die komplette Flotte auf alternative
Antriebe umzustellen. Die DVG beobachtet die Marktentwicklung genau
und zeigt sich angesichts der fortgeführten Bundesförderungen für
alternative Antriebe optimistisch, den eingeschlagenen Weg
fortsetzen zu können.
Gefördert mit Landesmitteln
Die DVG
hat 25 Wasserstoffbusse im Juli 2023 bestellt. Der Bushersteller
Solaris hatte bereits elf Solobusse vom Typ Solaris Urbino 12
hydrogen an die DVG geliefert. Jetzt erweitern die vierzehn
Gelenkbusse vom Typ Solaris Urbino 18 hydrogen die Busflotte. Die
Anschaffung dieser 25 Wasserstoffbusse und die für den Betrieb
erforderliche Wasserstoff-Tank- und Werkstattinfrastruktur ist für
die DVG mit erheblichen Investitionen verbunden.
Insgesamt
investiert die DVG rund 20,5 Millionen Euro für die 25 Fahrzeuge und
erhält dafür über den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) Fördermittel
vom Land in Höhe von rund 7 Millionen Euro. Für die Tank- und
Werkstattinfrastruktur sind rund 20 Millionen Euro Investitionen
erforderlich, von denen rund 18 Millionen Euro vom Land gefördert
werden. Die jetzt in Betrieb genommene mobile Wasserstoff-Tankstelle
von Air Liquide wurde ohne Fördermittel angemietet. Sie überbrückt
den Zeitraum, bis die geförderte fest installierte
Wasserstoff-Tankstelle errichtet und voraussichtlich Ende 2026 in
Betrieb genommen wird.
Wasserstoff-Busse mit neuester
Technologie
Die Busse vom Typ Solaris Urbino hydrogen werden mit
Wasserstoff betrieben, der gasförmig in den auf dem Fahrzeugdach
platzierten Tanks gespeichert wird. Die elektrische Energie wird
durch umgekehrte Elektrolyse erzeugt, in einer Batterie
zwischengespeichert, und dann dem Elektro- Antrieb zugeführt.
Die einzigen Nebenprodukte dieses Prozesses sind Wärme und
Wasserdampf. In jedem Bus werden ultramoderne Brennstoffzellenmodule
mit einer Leistung von 70 Kilowatt und 100 Kilowatt verwendet. Der
Antrieb besteht aus Traktionsmotoren mit 240 Kilowatt Leistung. Mit
einer Tankfüllung erzielen die Busse zu allen Jahreszeiten eine
Reichweite von mindestens 400 Kilometern.
Komfortable und
sichere Ausstattung, mobilitätseingeschränkte Fahrgäste im Blick
In den vollklimatisierten Bussen mit bis zu 54 Sitzplätzen empfängt
die Fahrgäste ein freundlicher Innenraum. Die DVG hat
mobilitätseingeschränkte Fahrgäste besonders im Blick. Im Bereich
der zweiten Tür verfügen die Busse über gleich zwei
Sondernutzungsflächen in Fahrtrichtung links und rechts für
Rollstühle und Kinderwagen. Für weitere Fahrgäste sind in diesen
Bereichen Klappsitze vorgesehen. TFT-Bildschirme informieren die
Passagiere.
Der Fahrpersonalarbeitsplatz ist ebenfalls
komfortabel ausgestattet, unter anderem durch eine Klimatisierung,
einen ebenfalls klimatisierten Sitz mit Lordoseunterstützung und
einen elektrisch verstellbaren Innenspiegel. Sicherheit vermittelt
eine Fahrpersonalkabinentür.
Weitere sicherheitsrelevante
Systeme wie Kamera-Außenspiegel, ein Toter-Winkel-Assistent, ein
Bremsassistent, eine Rückfahrkamera und eine
Verkehrszeichenerkennung unterstützen das Fahrpersonal auf ihren
Fahrten. Sie warnen das Fahrpersonal beispielsweise, wenn Fußgänger
oder Radfahrer in der Nähe des Fahrzeugs auftauchen. Eine
Videoüberwachungsanlage vermittelt ein zusätzliches
Sicherheitsgefühl.
„Sauberes Hochfeld“: Aufräumaktion am 24. September
Die Arbeitsgruppe „Sauberes Hochfeld“ möchte aktiv gegen Müll im
Stadtteil vorgehen: Am Mittwoch, 24. September, steht deshalb eine
stadtteilweite Saubermachaktion in Hochfeld an. 17 Einrichtungen und
Gruppen haben sich mit rund 400 Teilnehmenden angemeldet und werden
von 10 bis 18 Uhr an unterschiedlichen Orten im Quartier Müll
sammeln. Aber auch spontane Teilnahme ist möglich.
Eine
Karte mit teilnehmenden Einrichtungen und Orten, an denen man sich
auch noch kurzfristig anschließen kann, gibt es hier:
https://nc.stadtbuero.com/index.php/s/bJ33WDPFr76dCsN
Die vom Stadtteilbüro Hochfeld organisierte und aus dem
Austauschformat „Leben in Hochfeld“ sowie dem Projekt „Gemeinsam
aktiv für Hochfeld“ der Duisburger Bürgerplattform DUaktiv
hervorgegangene Arbeitsgruppe hat seit Anfang 2025 bereits mehrere
Aufräumaktionen im Quartier initiiert. Im Mai haben Kinder und
Erwachsene vor dem Immendal Parkfest am Blauen Haus aufgeräumt. Im
Juni und Juli wurde gemeinsam das Umfeld vom Sozialzentrum St. Peter
sowie von Almogamma e.V. sauber gemacht.
Unterstützt werden
die Aktionen von den Teams der Stadtbildpflege, der Abfallberatung,
der Umwelthelfer der Wirtschaftsbetriebe Duisburg und dem Verein
„Offensive für ein Sauberes Duisburg“. Der Verein stellt das
Material zum Sammeln der Abfälle sowie Bildungsmaterial für die
Einrichtungen im Quartier zur Verfügung.
Insbesondere Kinder
und Jugendliche werden so für das Thema Sauberkeit und
Abfallvermeidung in ihrem Umfeld sensibilisiert. Mehr Informationen
zur Mitmachaktion gibt es im Stadtteilbüro Hochfeld, Heerstraße 109,
47053 Duisburg oder per E-Mail info@stadtteilbuerohochfeld.de und
telefonisch 0203 46808505
Bessere Förderkonditionen
bei Neubauförderprogrammen KFN und KNN
Für die
Neubauförderprogramme „Klimafreundlicher Neubau (KFN)“ und
„Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment (KNN)“ gelten ab
heute deutlich attraktivere Zinskonditionen. Das
Bundesbauministerium setzt damit noch in diesem Jahr einen starken
Impuls, klimafreundlichen sowie auch flächeneffizienten und
bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. In einem ersten Schritt waren im
Programm KNN schon Verbesserungen in Form der Anpassung der
Baukostenobergrenze und der Wohnflächengrenze umgesetzt worden.
Verena Hubertz, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen: „Viele Messpunkte deuten auf eine Erholung im
Wohnungsbau hin. Diesen Aufschwung wollen wir befeuern. Wir ziehen
deshalb den wichtigen Hebel der Zinsverbilligung für Bauherrinnen
und Bauherren noch ein gutes Stück nach oben, damit noch mehr
bezahlbarer und klimafreundlicher Wohnraum entstehen kann.

Foto: Photothek Media Lab / Dominik Butzmann
Wir liegen damit deutlich unter den aktuellen Marktkonditionen.
Zusammen mit der geplanten befristeten Fördermöglichkeit für den EH
55-Standard zur Aktivierung des Bauüberhangs und dem Bau-Turbo
setzen wir gute Rahmenbedingungen, um Planungen schnell von der Idee
zur Schlüsselübergabe umzusetzen.“
KFN ist eines der
wichtigsten Neubauprogramme des Bundes. Seit 2023 konnten bereits
ca. 115.000 klimafreundliche Wohneinheiten gefördert werden. Mit dem
Programm können der Neubau und der Ersterwerb klimafreundlicher und
energieeffizienter Wohn- und Nichtwohngebäude gefördert werden.
Investoren, Genossenschaften, Unternehmen und Privatpersonen können
die Förderung durch zinsverbilligte Kredite bei ihrer Hausbank
beantragen. Kommunen können Zuschüsse erhalten. Eine größere
Unterstützung gibt es für Gebäude, die zusätzlich das
Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) erreichen.
Bei KNN
hatte es bereits Anfang des Monats Konditionsverbesserungen gegeben.
Zum einen werden Küchen und Wohnküchen künftig als Aufenthaltsräume
gewertet. Das Programm wurde damit an die Baupraxis angepasst, die
häufig bei kompakten Wohnungen die Küche offen gestaltet. Die
Flexibilität der Wohnraumgestaltung für die Bauherrinnen und
Bauherren wurde dadurch erhöht. Zum anderen war die Baukostengrenze
angehoben worden. Durch die Anhebung sind mehr Projekte als zuvor
innerhalb der Kostengrenze realisierbar.
Das Programm KNN
fördert klimagerechte und flächeneffiziente Neubauvorhaben. Über
eine Baukostenbegrenzung soll bezahlbarer Wohnraum entstehen. Ebenso
kann der Kauf neuer Gebäude, die bereits gebaut wurden und die
Vorgaben erfüllen, gefördert werden. Die Förderung für Investoren,
Genossenschaften, Unternehmen und Privatpersonen erfolgt mittels
zinsverbilligter Kredite. Kommunen können Zuschüsse erhalten.
Die Förderung erfolgt mittels zinsverbilligter KfW-Kredite. Weitere
Informationen dazu finden Sie auf der Homepage der KfW:
KNN und
KFN
Kostenloser Familientag im
Binnenschifffahrtsmuseum
Es wird gemalt, gebastelt und
gespielt: Der beliebte Familientag findet am Sonntag, 28. September,
von 10 bis 17 Uhr im Museum der Deutschen Binnenschifffahrt an der
Apostelstraße 84 in Duisburg-Ruhrort mit einem vielfältigen Programm
statt. Besonders kleine Matrosinnen und Matrosen sind willkommen.
„Wir bieten zahlreiche Mitmach-Stationen für die ganze
Familie an. Außerdem endet unsere beliebte und oft besuchte
Sonderausstellung ‚Familien unter Dampf.‘ Eine schöne Möglichkeit,
um nochmal durch die Exponate zu stöbern“, erklärt Museumsdirektor
Dr. Dennis Niewerth.
Das Programm im Detail
Malen,
basteln und Spaß mit der Button-Maschine ist von 10 bis 17 Uhr im
Vortragsraum des Museums möglich. Abenteuerliche Erzählungen von
Piratin Yvi finden den ganzen Tag über auf dem Spielschiff HERMANN
in der Damenschwimmhalle statt. Dort erfahren Interessierte mehr
über Goldschätze und die raue See. Ein Kinder-Quiz wird jeweils um
11 Uhr, um 13 Uhr sowie um 15 Uhr veranstaltet.
Mit Wissen
und Geschick können kleine Matrosinnen und Matrosen ein eigenes
Binnenschifferdiplom erhalten. Kinderschminken wird von 13 bis 15
Uhr angeboten. Dazu kann man in das richtige Kostüm schlüpfen und
Erinnerungsfotos vor der Fotowand machen.

Das Programm wird von zwei Kooperationspartnern unterstützt, vom
Spielkorb des Theater Duisburg und dem KultKiosk Hafenmund, der mit
zum Teil veganen Speisen und Getränken für das leibliche Wohl sorgt.
Der Eintritt ist frei.
DHL Paket nimmt postalischen
Warenversand aus Deutschland in die USA und Puerto Rico für
Geschäftskunden wieder auf
Nach nur vier Wochen
Pausierung wegen der neuen zollrechtlichen Vorschriften der
US-Regierung bietet der Unternehmensbereich Post & Paket Deutschland
als einer der ersten Postdienstleister weltweit den Warenversand
über den Postweg in die USA und Puerto Rico für Geschäftskunden
wieder an
Geschäftskunden können ab 25. September wieder das
DHL Paket International für den Warenversand in die USA nutzen
Neu: Buchung des Service „Postal Delivered Duty Paid” (PDDP) für
Sendungen bis 800 US-Dollar Warenwert sowie vollständige und
korrekte Zolldaten obligatorisch
Preise für
Geschäftskunden-Pakete aus Deutschland in die USA bleiben stabil
Aber: Zusatzkosten für Geschäftskunden durch die Zollabfertigung und
die Zölle, die nach Entfall der vorherigen Zollfreigrenze von 800
USD nunmehr für alle Sendungen außer privaten Geschenken mit einem
Wert unter 100 USD anfallen
Bonn, 23. September 2025: Der
Unternehmensbereich Post & Paket Deutschland der DHL Group nimmt als
einer der ersten Post- und Paketdienstleister weltweit den
postalischen Warenversand aus Deutschland in die USA für
Geschäftskunden wieder auf. Nach nur vier Wochen, in denen Deutsche
Post/DHL und viele andere Postdienstleister aufgrund neuer
gesetzlicher Bestimmungen diese Art des Warenversands in die USA
aussetzen mussten, schafft Deutschlands größter Post- und
Paketdienst zum 25. September für Unternehmen wieder die
Möglichkeit, neben DHL Express auch das DHL Paket International für
den Versand in die USA zu nutzen.
Möglich wird dies durch den
Service „Postal Delivered Duty Paid” (PDDP), den DHL bisher nur für
den Warenversand nach Norwegen, Großbritannien und in die Schweiz
angeboten hat und der nun auf die USA ausgedehnt wird. Darüber
hinaus musste DHL den gesamten Prozess der Daten- und Zollerhebung
sowie der Zahlung der fälligen Zollgebühren innerhalb kürzester Zeit
neu aufsetzen, um den neuen zollrechtlichen Bestimmungen gemäß der
Executive Order „Suspending Duty-Free De Minimis Treatment for all
Countries“ der US-Regierung zu entsprechen.
Was sich für
Geschäftskunden ändert
Geschäftskunden, die ihre Waren bis zu
einem Warenwert von einschließlich 800 US-Dollar wieder auf dem
postalischen Weg in die USA schicken möchten, müssen künftig drei
Dinge beachten:
1) Waren bis einschließlich 800 USD sind seit
dem 29. August zollpflichtig. Die Zollfreigrenze von 100 USD gilt
ausschließlich für private Geschenke – nicht für kommerzielle
Versender.
2) Für den postalischen Warenversand über DHL
obligatorisch ist die Beauftragung des PDDP-Service, bei dem der
Versender alle Einfuhrabgaben für seine Empfängerkunden im Vorfeld
übernimmt. 3) Sie müssen vollständige und korrekte Zolldaten,
insbesondere die Warenzolltarifnummer und das Ursprungsland jeder
einzelnen Ware, bereitstellen.
Der Preis für den PDDP-Service
beträgt in die USA 2 Euro je Sendung. Zusätzlich werden die Gebühren
des Dienstleisters - der sogenannten „Qualified Party“ - und die
Zölle selbst ohne Aufpreis an die Geschäftskunden weiterbelastet.
Für die Berechnung der Zölle wird die sogenannte „ad
valorem“-Methode genutzt. DHL weist darauf hin, dass die
eigentlichen Paketpreise in die USA stabil bleiben. Die
Zusatzkosten, die den Geschäftskunden ab sofort beim postalischen
Versand in die USA entstehen, beruhen ausschließlich auf externen
Faktoren, die DHL nicht zu verantworten und auf die sie keinen
Einfluss hat.
Für Privatkunden ist der neue Versandprozess
nicht anwendbar. Pakete von Privatpersonen an Privatpersonen mit
einem Warenwert bis 100 USD, die als „Geschenk / gift“ deklariert
sind, sind von den Neuregelungen in den USA nicht betroffen. Diese
Sendungen werden allerdings noch stärker als bisher kontrolliert
werden, um einen Missbrauch privater Geschenkesendungen zum Versand
kommerzieller Waren zu unterbinden. Beim Versand von Dokumenten in
Briefen ändert sich ebenfalls nichts. Weiter möglich ist zudem der
Warenversand per DHL Express und der kommerzielle Import von Waren
in die USA unter Anwendung der aktuell geltenden Zollsätze.
Die neuen Versandmodalitäten für den postalischen Warenversand aus
Deutschland in die USA betreffen allein die Produkte der Marke DHL
Paket. Produkte anderer DHL-Divisionen wie DHL Express oder DHL
eCommerce sind hier nicht tangiert.
Zum 29. August 2025 sind
neue zollrechtliche Bestimmungen gemäß der Executive Order
„Suspending Duty-Free De Minimis Treatment for all Countries“ in
Kraft getreten. Diese sehen zum einen die Aufhebung der bisherigen
Zollfreigrenze für Waren mit einem Wert bis 800 USD vor. Zudem
werden neue, von den US-amerikanischen Behörden geforderten Prozesse
für den postalischen Versand eingeführt, die von den bisher
geltenden Regelungen abweichen. Aufgrund einiger ungeklärter Fragen
sahen sich alle größeren Postunternehmen weltweit, darunter Deutsche
Post/DHL, gezwungen, den postalischen Warenversand in die USA
vorübergehend einzustellen.
Weitere Informationen unter:
dhl.de/us-versand und dhl.de/pddp
Stadthalle Walsum: Komödie „Das
Kind in mir will achtsam morden“
Die Krimikomödie „Das Kind von mir will
achtsam morden“ gastiert am Mittwoch, 24.
September, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) in
der Stadthalle Walsum auf der Waldstraße 50.
Nachdem ein Achtsamkeitskurs sein Leben in
komplett andere Bahnen gelenkt hat, führt
Ex-Strafverteidiger Björn Diemel gemeinsam
mit Sascha, seinem kriminellen Partner mit
Erzieherausbildung, einen eigenen
Kindergarten.
Im ersten Stock seines
luxuriösen Altbaus wohnt er selbst. Im
Keller ist Boris, ein brutaler Verbrecher,
eingesperrt. Björn verliebt sich in Laura,
deren Sohn Max Boris im Keller entdeckt. Die
daraus entstehenden Verwicklungen führen von
einem Problem für Björn zum nächsten.
Außerdem ist da noch Nils, der Kellner im
Allgäu, die Assis im Park und vor allem die
Holgerson-Bande mit der goldenen
Jesusstatue.
Genervt von
Schlechte-Laune-Attacken kann Björn Diemel
sein neues Leben nicht wirklich genießen.
Und so beschließt er, einen neuen Kurs bei
seinem LieblingsTherapeuten zu buchen, bei
dem er Kontakt zu seinem inneren Kind
aufnimmt. „Das Kind von mir will achtsam
morden“ ist ein amüsanter Krimiabend mit
Psychoeinheiten vom Feinsten.
Der
erste Band von Karsten Dusses mittlerweile
fünf Bücher umfassender „Achtsam
morden“-Reihe hielt sich mehr als ein
Dreivierteljahr an der Spitze der
Spiegel-Bestsellerliste. Für das
Theaterstück der Veranstaltergemeinschaft
Konzertdirektion Landgraf und der
Bezirksverwaltung sind ab sofort Karten
montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr in der
Bezirksverwaltung Walsum (Zimmer 315,
Körnerplatz 1) erhältlich, nach
telefonischer Absprache auch außerhalb
dieser Zeiten.
Die Karten sind in
drei Preisklassen zu 16, 21 und 25 Euro
verfügbar. Weitere Informationen zu den
Theaterkarten gibt es bei Herrn Klapheck
telefonisch unter 0203 283-5731 oder per
E-Mail an
c.klapheck@stadt-duisburg.de
Großer Herbstmarkt und Erntedankfest in
Obermeiderich
In der Evangelischen Kirchengemeinde
Duisburg Obermeiderich steht das letzte Septemberwochenende ganz im
Zeichen der kommenden Jahreszeit: Am Samstag, 27. September 2025
öffnet sie um 12 Uhr die Türen des Gemeindezentrums an der
Emilstraße zum großen Herbstmarkt.
Hier finden Besucherinnen
und Besucher Schönes und Dekoratives aber auch Leckeres, wie Kaffee,
Kuchen, Waffeln, Getränke und natürlich die legendäre Erbsensuppe,
die auch beim Lichtermarkt immer reißenden Absatz findet. Wie immer
bei Aktionen der Gemeinde gilt auch beim Herbstmarkt: viele Hände
helfen, backen, schneiden, räumen, alles selbstgemacht und lecker.
Der Erlös von allem geht an das Untermeidericher
Mutter-Kind-Haus „Hilfe zum Leben“. Kindern wird am Herbstmarkt auch
nicht langweilig, denn sie genießen Stockbrot und Slush-Eis, toben
sich auf der Hüpfburg aus und rasen auf einer Rennstrecke mit
Bobbycars, wofür extra die Straße gesperrt wird.
Der
Eintritt ist frei. Am nächsten Tag feiert die Gemeinde um 11 Uhr
einen Erntedankgottesdienst, nach dem die Stände des Herbstmarktes
nochmal zum Verkauf öffnen. Dann beginnt auch „Emils Mittagstisch“,
das kostenlose Essen für alle, bei dem die gute Erbsensuppe auf den
Tisch kommt. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter
www.obermeiderich.de.

Obermeidericher Herbstmarkt 2024 (Foto: www.obermeiderich.de).
Ev. Gemeinde Obermeiderich lädt wieder zum
kostenfreien Mittagstisch ein Die Evangelische
Kirchengemeinde Duisburg Obermeiderich startete vor zwei Jahren
unter dem Motto „eine Kelle Suppe – eine Kelle Gemeinschaft“ einen
kostenfreien Mittagstisch. Sie lädt seitdem weiterhin alle Menschen
unabhängig von Religion und Kultur an einem Sonntag - meist dem
letzten - im Monat um zwölf Uhr zur gemeinsamen Mahlzeit in das
Gemeindezentrum an der Emilstraße 27 ein.
Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. Das Essen ist gratis, Spenden werden aber gerne
entgegen genommen. Beim nächsten Mittagstisch, am 28. September 2025
kommen um 12 Uhr Erbsensuppe mit Würstchen und ein leckeres
Dessert auf den Tisch. Alles mit Liebe gekocht! Infos zur Gemeinde
gibt es im Netz unter www.obermeiderich.de.

6,4 % mehr
Umsatz im Handwerk im Jahr 2023
• Umsatz steigt um 0,5
Prozentpunkte stärker als Verbraucherpreise
• Zahl
sozialversicherungspflichtig Beschäftigter sinkt im
Vorjahresvergleich leicht, Zahl geringfügig entlohnt Beschäftigter
steigt
• Ausbaugewerbe und Kraftfahrzeuggewerbe mit Umsatz- und
Beschäftigungsplus, Bauhauptgewerbe mit Rückgängen
Die
Handwerksunternehmen in Deutschland haben im Jahr 2023 einen Umsatz
von 766 Milliarden Euro erwirtschaftet. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) zum Tag des Handwerks am 20. September 2025
mitteilt, stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 6,4 % und damit
geringfügig stärker als die Verbraucherpreise (+5,9 %).
Die
Zahl der Handwerksunternehmen sank dagegen um 0,4 % auf rund 568
000. Die Zahl der im Handwerk tätigen Personen blieb mit rund 5,4
Millionen fast unverändert zum Vorjahr (-0,1 %), wobei einem
leichten Rückgang der Zahl sozialversicherungspflichtig
Beschäftigter um 0,3 % auf 4,1 Millionen ein Anstieg der Zahl
geringfügig entlohnt Beschäftigter um 1,7 % auf 646 000
gegenübersteht.
Nach der Unternehmensgröße betrachtet wiesen
große Handwerksunternehmen ab 50 Beschäftigten im Jahr 2023 mit
+9,3 % einen deutlich stärkeren Umsatzanstieg auf als kleinere
Unternehmen mit +3,9 %. Die großen Unternehmen verzeichneten zudem
einen Beschäftigungszuwachs um 1,5 %, während die Beschäftigtenzahl
in kleineren Unternehmen um 1,1 % sank.
Handwerk
erwirtschaftet 7,6 % des Umsatzes der Gesamtwirtschaft
Der Anteil
des Handwerks am Umsatz der Gesamtwirtschaft lag
im Jahr 2023 bei 7,6 %, das waren 0,2 Prozentpunkte mehr als im
Vorjahr. Insgesamt waren im Handwerk 12,8 % aller
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland tätig. Der
Anteil der Handwerksunternehmen an allen Unternehmen betrug 16,4 %.
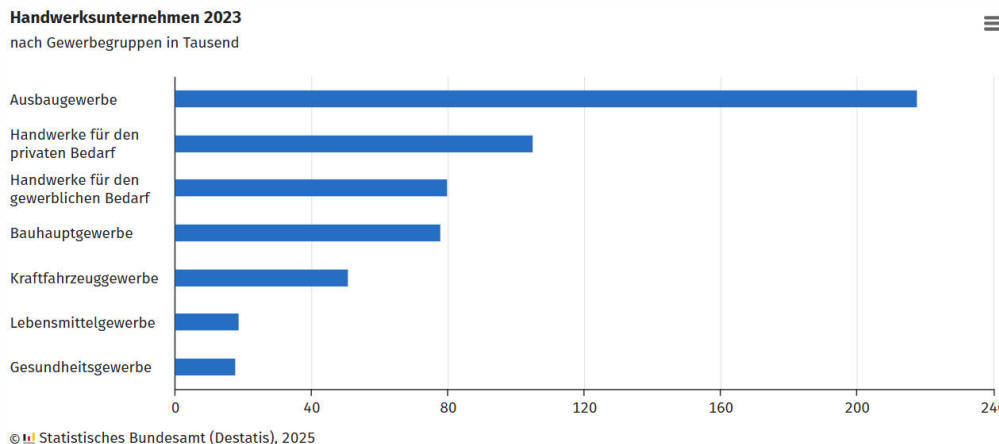
Ausbaugewerbe die mit Abstand größte Gewerbegruppe im Handwerk
Besondere Bedeutung hat das Handwerk im Baugewerbe: Im Jahr 2023
waren knapp zwei Drittel (66,2 %) aller Unternehmen in diesem
Wirtschaftszweig Handwerksunternehmen. Die weitaus größte Gewerbegruppe innerhalb
des Baugewerbes und des Handwerks insgesamt – sowohl bezogen auf die
Zahl der Unternehmen als auch die tätigen Personen sowie den Umsatz
– ist das Ausbaugewerbe.
Im Jahr 2023 erwirtschafteten die
218 000 Handwerksunternehmen dort mit 1,5 Millionen tätigen Personen
einen Umsatz von 220 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr sank
die Zahl der Unternehmen im Ausbaugewerbe um 1,4 %, während die Zahl
der tätigen Personen um 0,4 % stieg und der Umsatz um 8,2 % zunahm.
Unterschiedliche Beschäftigungs- und Umsatzentwicklung nach
Gewerbegruppen
Die Zahl der tätigen Personen nahm im Jahr 2023
lediglich im Kraftfahrzeuggewerbe (+0,8 %), im Ausbaugewerbe
(+0,4 %) und in den Handwerken für den gewerblichen Bedarf (+0,3 %)
geringfügig zu.
In den übrigen Gewerbegruppen waren dagegen
Beschäftigungsrückgänge zu verzeichnen, am stärksten im
Bauhauptgewerbe (-1,5 %). Bei der Umsatzentwicklung unterschieden
sich die Gewerbegruppen zum Teil deutlich. Das größte Plus
verzeichneten das Kraftfahrzeuggewerbe (+9,8 %), gefolgt vom
Ausbaugewerbe (+8,2 %) und dem Gesundheitsgewerbe (+7,2 %). Einen
Umsatzrückgang wies das Bauhauptgewerbe (-0,2 %) auf.
Nachhaltige Entwicklung: Anteil der Einfuhren nach NRW
aus am wenigsten entwickelten Ländern seit 2014 um 39 % gestiegen
* Anteil der Einfuhren nach NRW über dem bundesweiten
Wert.
* Dashboard vergleicht für alle Bundesländer Indikatoren
zur Messung der nachhaltigen Entwicklung.
Der Anteil der
Einfuhren aus am wenigsten entwickelten Ländern ist in NRW seit 2014
um 39 % gestiegen. Wie das Statistische Landesamt anlässlich der
deutschen Aktionstage zur Nachhaltigkeit mitteilt, lag der Anteil
damit noch unter dem für 2030 angestrebten ökonomischen
Nachhaltigkeitsziel zur Verbesserung der Handelschancen der
Entwicklungsländer. Dieses sieht eine Erhöhung des Anteils um 100 %,
also eine Verdoppelung, gegenüber 2014 bis 2030 vor.
Acht
Bundesländer haben das Ziel einer Verdoppelung des Einfuhranteils
bereits erreicht Nach vorläufigen Ergebnissen betrug im Jahr 2024
der Anteil der Einfuhren aus am wenigsten entwickelten Ländern an
allen Einfuhren nach NRW 1,32 % (rund 3,66 Mrd. Euro). Damit lag NRW
über dem bundesweiten Wert von 1,17 % und im Mittelfeld im Vergleich
zu anderen Bundesländern.
Bisher haben acht Bundesländer das
Nachhaltigkeitsziel der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und der
Landesregierung NRW einer Verdoppelung des Einfuhranteils gegenüber
2014 bereits erreicht, darunter Sachsen-Anhalt, Berlin und Saarland.
Zu beachten ist, dass das Ausgangsniveau der einzelnen Bundesländer
stark variiert.
Dashboard zur Nachhaltigen Entwicklung zeigt
interessante Entwicklungen im Bundesländervergleich Diese und
weitere spannende Entwicklungen zeigt ein von den Statistischen
Landesämtern herausgegebenes Dashboard zur Nachhaltigen Entwicklung
unter
https://experience.arcgis.com/experience/9113a815db134c7ba1a6d796bfe9c7b5/.
Das interaktive Angebot ermöglicht den Vergleich aller
Bundesländer anhand von Indikatoren zur Messung der nachhaltigen
Entwicklung. Die deutschen Aktionstage zur Nachhaltigkeit, die seit
10 Jahren Teil der European Sustainable Development Week sind,
fokussieren sich in diesem Jahr auf das Thema Ernährung, denn
Nachhaltigkeitsziele gibt es nicht nur im Bereich Umwelt.
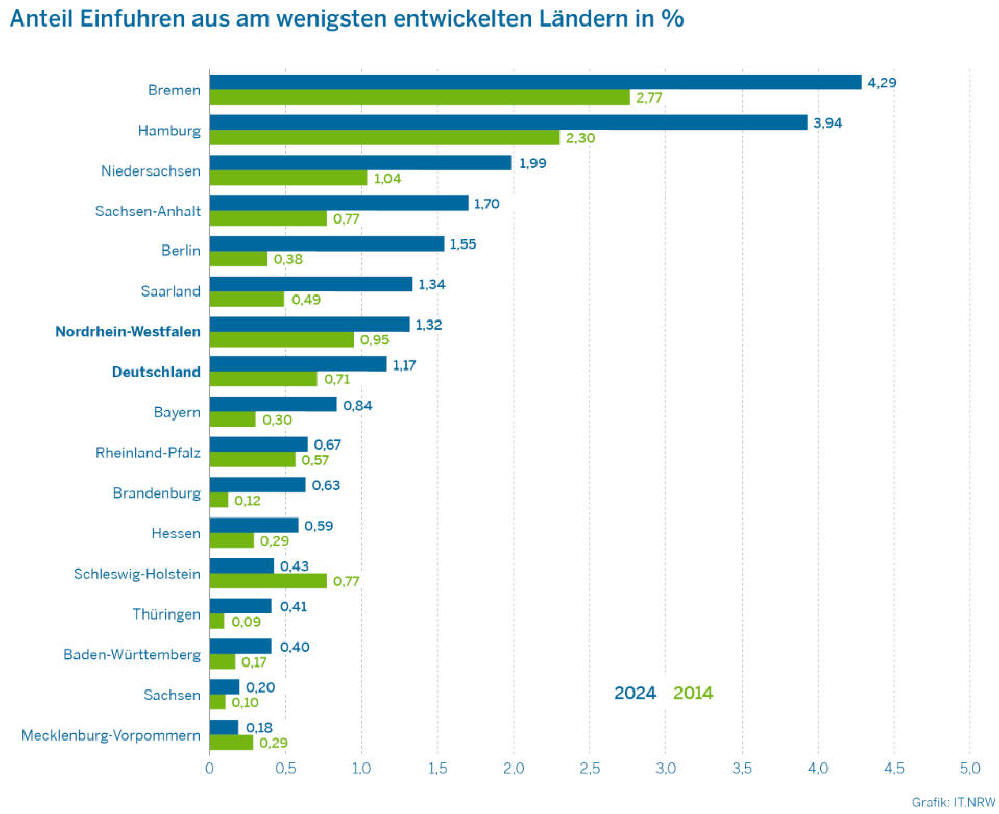
Insgesamt gibt es 17 Nachhaltigkeitsziele, darunter Ziel 17:
Partnerschaften zur Erreichung der Ziele – Umsetzungsmittel stärken
und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem
Leben erfüllen. Hierzu werden in Deutschland unter anderem die
Einfuhren aus am wenigsten entwickelten Ländern betrachtet mit dem
Ziel die Handlungschancen der Entwicklungsländer zu verbessern.