






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 40. Kalenderwoche:
29. September
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Dienstag, 30. September 2025
Notwendige Arbeiten an Dampfleitung in Duisburg-Beeck:
thyssenkrupp Steel informiert über mögliche Geräusche
thyssenkrupp Steel informiert Anwohner:innen im Duisburger Norden
über bevorstehende Arbeiten an der Dampfverbundleitung zwischen dem
werkseigenen Kraftwerk Ruhrort und dem Dampfverbund des Hüttenwerks
Duisburg-Nord
Dampf- und Geräuschentwicklung im Zuge der
Wiederinbetriebnahme der Dampfleitung am 30.09.2025 möglich
thyssenkrupp Steel führt am Dienstag, 30. September 2025, Arbeiten
an einer Dampfverbundleitung in Duisburg-Beeck durch. Die Leitung
liegt zwischen dem werkseigenen Kraftwerk Ruhrort und dem
Dampfverbund des Hüttenwerks Duisburg-Nord. Die Arbeiten finden
außerhalb des Werksgeländes statt – unter anderem am Hundeplatz und
an der Erdgasübernahmestation in der Nähe der Jet-Tankstelle an der
Friedrich-Ebert-Straße.
Zwischen 7:00 und 16:00 Uhr kann es
zu Zischgeräuschen und Dampfwolken kommen. Auch kurze Knallgeräusche
sind möglich. Diese entstehen durch sogenannte „Dampfschläge“ in der
Leitung. Für Menschen und Umwelt besteht keine Gefahr.
Informationen zum Projekt
Die Dampfverbundleitung zwischen dem
Kraftwerk Ruhrort und dem Dampfverbund des Hüttenwerks
Duisburg-Nord, die aufgrund von Sanierungsarbeiten vorübergehend
außer Betrieb genommen werden musste, ist etwa vier Kilometer lang
und hat einen Durchmesser von ca. einem halben Meter.
Sie
ist notwendig für die Verteilung von Prozesswärme im Energieverbund
des Duisburger Hüttenwerkes. Durch die Kopplung von Strom- und
Wärmerzeugung in den Kraftwerken werden die bei der Stahlerzeugung
anfallenden Prozessgase effizient genutzt. Gleichzeitig werden rund
20.000 Haushalte am rechten und linken Niederrhein mit Fernwärme
versorgt.
Was bedeutet das für die Nachbarschaft?
thyssenkrupp Steel bemüht sich, die Unannehmlichkeiten für die
unmittelbare Nachbarschaft so gering wie möglich zu halten. Die
Werkfeuerwehr von thyssenkrupp Steel ist informiert.
Sicherheitszentrale Werkfeuerwehr thyssenkrupp Steel für Notfälle:
0203 / 52-41212
thyssenkrupp Steel bedankt sich im Voraus für das
Verständnis und die Geduld der Anwohner:innen während der
Instandsetzungsarbeiten.
Barrierefreie Haltestelle
„Bronkhorststraße“ kann ab sofort genutzt werden
Die
Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) arbeitet gemeinsam mit der
Stadt Duisburg an der Modernisierung der Infrastruktur für einen
zukunftsfähigen ÖPNV. In den vergangenen Jahren haben DVG und Stadt
durch den Ausbau barrierefreier Haltestellen, die Modernisierung von
Gleisen, Fahrtreppen und Fahrleitungen sowie den Neubau von
Haltestellen bereits viel erreicht.
Zudem wird das
ÖPNV-Angebot für die Fahrgäste stetig verbessert. DVG und Stadt
setzen den Weg fort, Bus und Bahn attraktiver zu machen, um
möglichst vielen Menschen mit einem komfortablen, klimafreundlichen
und zuverlässigen ÖPNV eine echte Alternative zum Auto zu bieten.
Seit Mitte Februar haben die DVG und die Stadt Duisburg in
Duisburg-Meiderich die neue barrierefreie Haltestelle
„Bronkhorststraße“ der Straßenbahnlinie 903 gebaut.

ie Haltestelle „Bronkhorststraße“ bietet den Fahrgästen wesentlich
mehr Komfort und erleichtert vor allem mobilitätseingeschränkten
Fahrgästen den Ein- und Ausstieg. Bildquelle: Duisburger
Verkehrsgesellschaft AG
Diese ersetzt die alte Haltestelle
„Emilstraße“. „Die neue Haltestelle bietet den Fahrgästen wesentlich
mehr Komfort und erleichtert vor allem mobilitätseingeschränkten
Fahrgästen den Ein- und Ausstieg“, sagt Matthias Brockmann,
Abteilungsleiter Fahrweg bei der DVG. Der Neubau war notwendig
geworden, weil ein barrierefreier Umbau der vorhandenen Haltestelle
„Emilstraße“ in heutiger Lage nicht möglich war.
Die DVG hat
einen 35-Meter langen Mittelbahnsteig gebaut. „Der neue
Mittelbahnsteig ist mit einem taktilen Leitsystem, einer neuen
Wartehalle und neuer Betriebstechnik ausgestattet. Die Wege zur
Haltestelle haben ebenfalls taktile Leitelemente für Menschen mit
Sehbehinderung“, sagt Brockmann. Im Zuge des Neubaus wurden auch die
Gleise und die Fahrleitungen auf einer Strecke von rund 630 Metern
erneuert. Auch die Haltestellen für die Nachtexpress-Busse wurden
barrierefrei ausgebaut.
Die Haltestelle „Emilstraße“ ist
bereits zurückgebaut. DVG und Stadt Duisburg investierten etwa sechs
Millionen Euro in den Neubau. Davon wurden circa 60 Prozent durch
das Land NRW gefördert. Die restlichen Kosten wurden von der DVG und
der Stadt Duisburg eigenfinanziert. Mit Beendigung des dritten
Bauabschnittes sind die drei Haltestellen „Brückelstraße”,
„Landschaftspark Nord” und „Bronkhorststraße” barrierefrei
ausgebaut.
Projekt zur Binnenschifffahrt: Die
Zukunft fährt auf Wasserstraßen
Wie lassen sich
ländliche und städtische Gebiete durch Wasserstraßen verbinden? Wie
wirken sich kleine Schiffsnetze auf die Umwelt und die regionale
Wirtschaft aus? Fragen wie diesen ging ein Projekt unter der Führung
der Universität Duisburg-Essen nach.
Nun stellt das Team des
Lehrstuhls
Transportsysteme und -logistik am 30. September
seine Ergebnisse im Nano Energie Technik Zentrum - NETZ in
Duisburg vor.

Die Pilotplattform des Projektpartners NEAC beim Transport von
frischen Produkten bei der Innenstadt von Caen à la Mer. © NEAC
Transporte auf der Straße tragen nach wie vor zu hohen
CO2-Emissionen bei und sind wenig umweltfreundlich. Eine Alternative
könnten Wasserstraßen bieten. Das Projekt
WISTAR* zeigt das
Potenzial der Binnenwasserstraßen für kleine ländliche Unternehmen
in der französischen Normandie, im Ruhrgebiet, am Niederrhein und in
Wallonien in Belgien auf.
„Unser Ziel ist es, durch
energieeffizienten und nachhaltigen Binnenschiffstransport
wirtschaftliches Potenzial und Wachstum sowie die Entwicklung der
Regionen zu verbessern“, so Projektkoordinatorin Dr. Melissa
Szymiczek.
„Im WISTAR-Projekt entwickeln wir Strategien, um
Güter zwischen Stadt und Land mit emissionsfreien,
flachwasserfähigen Schiffen zu transportieren und zu verteilen.
Dafür setzen wir auf einfache, grüne Umschlagspunkte, die eine
flexible und dezentrale Logistik und energieeffiziente Abläufe
ermöglichen. Mit modularer Ausstattung schaffen wir neue
Partnerschaften, stärken die Vernetzung von ländlichen und urbanen
Regionen und treiben so die nachhaltige Transformation der
Binnenschifffahrt voran.“
Um die Ansätze in der Praxis, u.a.
für die westdeutschen Kanäle, zu testen, hat das Team der UDE mit
seinen Partnern die rechtliche, organisatorische, technische
Machbarkeit des Konzepts analysiert und einen Pilottest in Caen
sowie eine Simulationsstudie durchgeführt.
Dabei arbeiteten
Vertreter:innen aus Landwirtschaft, Industrie, Wissenschaft,
Forschung, Kommunalverwaltungen und Verbänden über die drei Länder
hinweg eng zusammen. Sie stellen nun gemeinsam die Ergebnisse des
WISTAR-Projekts zur nachhaltigen Binnenschifffahrtslogistik am
Niederrhein, im Ruhrgebiet, in der Normandie und in Wallonien vor.
idr
Grüner Ring wird die Duisburger Innenstadt mit dem
RheinPark und damit dem Zukunftsgarten der IGA verknüpfen Die
Baukosten für den Umbau des südlichen Teils belaufen sich auf rund
10 Millionen Euro. Unterstützt wird die Maßnahme durch Mittel der
Städtebauförderung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und
Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen sowie des
Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Grüner Ring - Drohenflug im August 2025 - Foto wbd
Realisiert
wird das Projekt im Rahmen der Internationalen Gartenausstellung
(IGA) 2027, für die Duisburg einer der zentralen Austragungsorte
ist. Mit der Fertigstellung Anfang 2027 wächst der Grüne Ring Stück
für Stück zu einem verbindenden Band zusammen, dass die Duisburger
Innenstadt mit dem RheinPark und dem künftigen Zukunftsgarten der
IGA verknüpft.
Duisburg-Hochfeld Zukunftsgärten, Duisburg

Symbolischer Spatenstich in Duisburg-Hochfeld Zukunftsgärten,
Duisburg v.l.n.r.: Felix Lindemann, Bauleitung Landschaftsbau
Knappmann, Laura Kuhl (Projektleiterin Grüner Ring
Wirtschaftsbetriebe Duisburg), Andreas Deselaers (Bereichsleiter
Landschaftsbau Knappmann), Elvira Ulitzka (Bezirksbürgermeisterin),
Sebastian Beck (Vorstand Wirtschaftsbetriebe Duisburg), Claudia
Schoch (IGA-Projektleitung der Wirtschaftsbetriebe Duisburg),
Oberbürgermeister Sören Link, Norbert Amberg (Bauüberwachung), Lukas
Schregel (Projektleiter Grüner Ring Wirtschaftsbetriebe Duisburg)
und Mokhtar Gaballah, (wbp-Landschaftsarchitekten). Foto: NEUARTIG
MEDIA/wbd
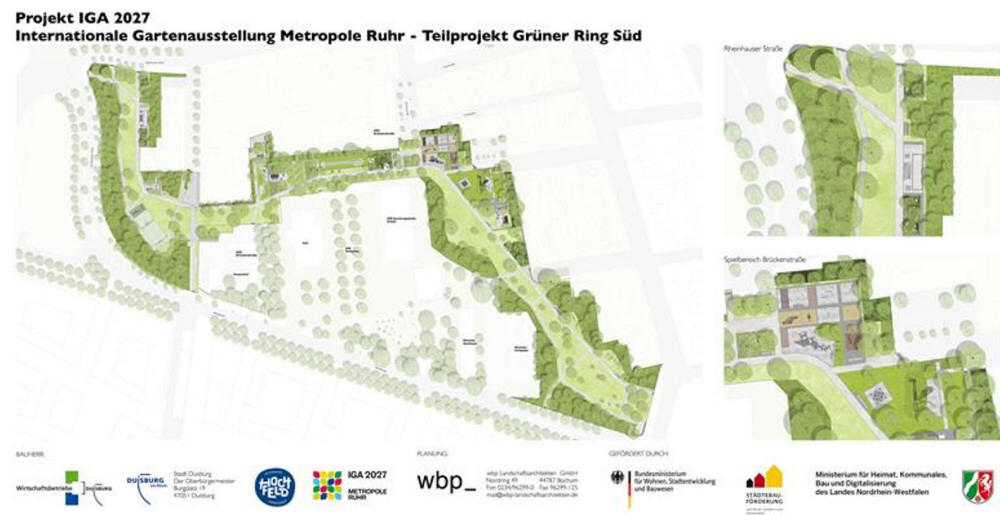
IndustrieFilm Ruhr tourt wieder - Stopps in Bochum
und Duisburg
Aus den Archiven in die Jahrhunderthalle
Bochum und den Landschaftspark Duisburg-Nord: IndustrieFilm Ruhr
geht in diesem Herbst wieder on Tour. Der Regionalverband Ruhr (RVR)
schickt gemeinsam mit den Industrie-Archiven zeigt ein Programm aus
Filmschätzen der Industriearchive der Region am Mittwoch, 8.
Oktober, im Pumpenhaus der Jahrhunderthalle Bochum und am Montag,
27. Oktober, im Hüttenmagazin des Landschaftsparks Duisburg-Nord.

In Bochum
stehen vier Filme auf dem Programm - von der Produktion im Bochumer
Verein um 1940 (Historisches Archiv Krupp) über Einblicke in die
Arbeitswelt unter Tage aus dem Jahr 1961 und die Produktion von
Drahtseilen bei der Westfälischen Union bis zum
Zeichentrick-Werbefilm für eine automatisch geregelte
Kokszentralheizung (alle aus dem Montanhistorischen
Dokumentationszentrum).
In Duisburg werden ein Beitrag aus
der Wochenschau über den Besuch des Kaisers von Äthiopien in
Deutschland im Jahr 1954 (Historisches Archiv Krupp), über die
Formgebung von Roheisen, ein Kurzfilm über die stillgelegte
Meidericher Eisenhütte - heute Landschaftspark Duisburg-Nord - aus
dem Jahr 1990 (beide: Thyssenkrupp Corporate Archives) und ein
Werbefilm für Nachwuchskräfte im Bergbau (Montanhistorisches
Dokumentationszentrum) gezeigt.
Moderiert werden die Abende
mit Filmen und Gesprächen von Paul Hofmann, dem Leiter der
Kinemathek im Ruhrgebiet. Die Programme starten jeweils um 19 Uhr.
Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung per Mail an
becker-romba@rvr.ruhr ist nötig. idr
STUDIO 47 zur
Kommunalwahl 2025: Regionale Medien stärken demokratische
Öffentlichkeit
Über mehrere Wochen hinweg hat STUDIO 47
hat die Kommunalwahlen 2025 in Duisburg intensiv begleitet. Der
regionale Fernsehsender berichtete umfangreich im Vorfeld, live am
Wahlabend der Kommunalwahl am 14. September und erneut zur
OB-Stichwahl am 28. September, jeweils direkt aus dem Duisburger
Rathaus.
Bereits vor dem Wahltag rückte STUDIO 47 zentrale
lokale Themen, politische Konstellationen und Kandidierende in den
Fokus. In Nachrichtensendungen, Interviews, Talkformaten und
TV-Duellen wurden Inhalte und Positionen eingeordnet. Als
Medienpartner der Veranstaltung „Duisburg wählt sozial“ begleitete
der Sender die Wahlarena der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege in
der Kulturkirche Liebfrauen, zudem moderierte Chef vom Dienst Jan
Skrynecki die Podiumsdiskussion der Wirtschaftsjunioren Duisburg mit
den OB-Kandidaten.
Am Wahlabend des 14. September sendete
STUDIO 47 mit einem mobilen TV-Studio live aus dem Rathaus, mit
Ergebnissen, Reaktionen, Live-Schalten und Interviews. Zwei Wochen
später folgte die Berichterstattung zur Stichwahl, erneut live, mit
Einordnung der Ergebnisse und Stimmen der beiden Kandidaten. Bereits
am Freitag vor der Stichwahl strahlte der Sender exklusive
Interviews mit beiden OB-Kandidaten aus.
Die
redaktionellen Angebote erzielten eine hohe Zuschauerresonanz. Im
Durchschnitt erreichten die Wahlsendungen rund 14 Prozent der
650.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im westlichen Ruhrgebiet und
am Niederrhein. Zusätzlich verfolgten über 12.000 Zuschauerinnen und
Zuschauer den Livestream am Wahlsonntag über die digitalen Kanäle
von STUDIO 47.
Die Wahlbeteiligung stieg in Duisburg im
Vergleich zu den vorherigen Kommunalwahlen spürbar. Sie lag 2020 bei
39,15 Prozent und kletterte 2025 auf 48,3 Prozent. Stadtdirektor und
Wahlleiter Martin Murrack betonte in der Wahlsendung die Rolle
regionaler Medien bei der Aktivierung der Öffentlichkeit. „Wir haben
uns Gedanken darüber gemacht, wie wir die Wahlbeteiligung steigern
können. Hier bei STUDIO 47 ist sehr oft darüber berichtet worden,
insofern ist das wirklich super.“
„Wir begleiten Wahlen
nicht nur am Wahlabend, sondern über Wochen hinweg“, unterstreicht
Chefredakteur Sascha Devigne die Rolle regionaler Berichterstattung
im Wahlprozess. „Gerade in einer Stadt wie Duisburg mit komplexer
politischer Lage kommt es darauf an, lokale Themen sichtbar zu
machen und den Diskurs nachvollziehbar abzubilden.“

Das Wahlstudio von STUDIO 47 im Duisburger Rathaus während der
Live-Berichterstattung zur Kommunalwahl 2025. (Fotos: STUDIO 47)
Die Nachberichterstattung beleuchtete die politischen Folgen der
Wahl ebenso wie die Reaktionen der Parteien und das veränderte
Kräfteverhältnis im Rat. Alle Wahlsendungen, TV-Duelle,
Sondersendungen und Interviews sind weiterhin in der Mediathek von
STUDIO 47 abrufbar – ganz einfach unter:
www.youtube.studio47.de
BU: Das Wahlstudio von STUDIO 47 im Duisburger Rathaus während
der Live-Berichterstattung zur Kommunalwahl 2025. (Fotos: STUDIO 47)
Repräsentative Befragung der Aktion Mensch zeigt:
Mobbing bleibt ein Tabuthema
Fast die Hälfte der
Jugendlichen ist betroffen – doch die Mehrheit schweigt
Alarmierend: Fast 80 Prozent der Jugendlichen sprechen selten oder
nie über Mobbing-Erfahrungen
Besonders gefährdet: Drei von vier
Jugendlichen mit Behinderung erlebten bereits Mobbing – deutlich
mehr als Gleichaltrige ohne Behinderung
Neue Initiative: Mit der
Kampagne #SagtNichtNichts möchte die Aktion Mensch Schweigen brechen
und junge Menschen sowie ihr Umfeld zum Handeln bewegen
Bonn
(29. September 2025) Fast jede*r zweite Jugendliche in Deutschland
ist von Mobbing betroffen. Besonders besorgniserregend: Knapp 80
Prozent der Jugendlichen, die gemobbt werden, sprechen selten oder
gar nicht über ihre Erfahrungen – meist aus Angst, Scham oder
Hoffnungslosigkeit. Zu diesen Ergebnissen kommt eine aktuelle
repräsentative Online-Befragung*, die die Aktion Mensch anlässlich
ihrer neuen Kampagne gegen Mobbing und Ausgrenzung durchgeführt hat.
Ein Drittel der Betroffenen berichtet, gleich mehrere Formen
von Mobbing erfahren zu haben – von verbalen Angriffen wie
Beleidigungen oder Bloßstellen, über soziale Ausgrenzung und
Diskriminierung bis hin zu körperlicher Gewalt. Hauptschauplatz ist
dabei mit deutlicher Mehrheit die Schule: 91 Prozent der Betroffenen
geben sie als Ort des Geschehens an.
Die Folgen des Erlebten
sind gravierend für die Betroffenen. Sie benennen vor allem
seelische Belastungen wie Angst und Traurigkeit, Einsamkeit sowie
das Gefühl von Wertlosigkeit als Konsequenzen. Bei 40 Prozent der
Jugendlichen, die nichts gegen Mobbing unternommen haben, ist zudem
die Gefahr einer „Mobbing-Spirale“ besonders hoch – denn sie sind
den Ergebnissen zufolge wiederholtem Mobbing durch verschiedene
Personen ausgesetzt.
Jugendliche mit Behinderung besonders
stark betroffen
Ein eklatanter Unterschied zeigt sich zwischen
jungen Menschen mit und ohne Behinderung: Drei von vier Jugendliche
mit Behinderung (75 Prozent) haben bereits Mobbing-Erfahrungen
gemacht, bei Gleichaltrigen ohne Behinderung ist es knapp die Hälfte
(46 Prozent).
„Diese Ergebnisse sind alarmierend. Sie machen
unmissverständlich deutlich: Mobbing stellt ein massives
gesellschaftliches Problem dar – eines, das viel zu oft im
Verborgenen bleibt. Besonders erschütternd ist, dass Jugendliche mit
Behinderung überdurchschnittlich häufig von Ausgrenzung und
Anfeindung betroffen sind“, kommentiert Christina Marx, Sprecherin
der Aktion Mensch.
„Wir möchten junge Menschen ermutigen und
unterstützen, offen über ihre Mobbingerfahrungen zu sprechen und
sich Hilfe zu suchen – und gleichzeitig sind Eltern, Lehrkräfte und
Beteiligte in der Pflicht, Mobbing frühzeitig zu erkennen und
konsequent entgegenzuwirken.“

Gemeinsam gegen Mobbing mit Nummer gegen Kummer e.V.
Zu den
bei jungen Menschen bekanntesten Hilfsangeboten bei Mobbing zählen
laut den Ergebnissen vor allem anonyme und niedrigschwellige
Beratungsstellen wie die Telefonseelsorge oder Nummer gegen Kummer
e.V. Allein im Jahr 2024 unterstützten die Berater*innen der „Nummer
gegen Kummer" in 117.934 Beratungen Kinder, Jugendliche und Eltern
in schwierigen Lebenslagen – vertraulich und kostenlos.
Im
Rahmen der Initiative #SagtNichtNichts gehen die Aktion Mensch und
„Nummer gegen Kummer“ nun eine Kooperation ein, sensibilisieren
gemeinsam für die Themen Mobbing und Ausgrenzung und stellen
Betroffenen konkrete Hilfsangebote bereit.
Neue Förderaktion
für mehr Respekt und Vielfalt
Begleitend zur Kampagne startet die
Aktion Mensch am 1. Oktober 2025 ihre neue Förderaktion „Zeichen
setzen! Für mehr Respekt und Vielfalt“. Mit einem Fördervolumen von
fünf Millionen Euro sollen Projekte unterstützt werden, die
Jugendliche befähigen, Mobbing und Ausgrenzung zu erkennen,
selbstbewusst zu handeln und sich aktiv für ein respektvolles,
inklusives Miteinander einzusetzen – in der Schule, in der Freizeit
und in der digitalen Welt.
„Als größte nichtstaatliche
Förderorganisation in der Kinder- und Jugendhilfe setzen wir uns
seit über 20 Jahren entschlossen für junge Menschen ein“, sagt
Christina Marx. „Mit unserer neuen Förderaktion unterstützen wir
gezielt Projekte, die auf Vielfalt und Inklusion setzen, junge
Menschen stärken und Mobbing entschieden bekämpfen.“
500 € Förderung sichern: action! unterstützt ehrenamtliche
Bildungsaktionen zu globalen Themen
Globale
Zusammenhänge, wie etwa Klimawandel, Armut oder nachhaltiger Konsum,
sind Themen, die zunehmend auch auf lokaler Ebene diskutiert werden.
Bildungsaktionen, die diese Themen vermitteln, tragen dazu bei, ein
Bewusstsein für globale Herausforderungen und die 17 Ziele für
nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen zu schaffen.
Das Programm action! Aktiv für eine globale Welt unterstützt
seit 2025 solche Aktionen. Engagierte Gruppen und Initiativen können
sich unkompliziert 500 Euro Förderung für ihre Bildungsaktion zu
globalen Themen sichern. Die Deutsche Stiftung für Engagement und
Ehrenamt (DSEE) setzt das Programm gemeinsam mit dem
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) um.
Jetzt mitmachen und Förderung sichern
Das
Programm richtet sich an engagierte Einzelpersonen ab 18 Jahren,
Gruppen und Initiativen, insbesondere aus ländlichen oder
strukturschwachen Regionen. Gefördert werden Bildungsaktionen, die
globale Zusammenhänge verständlich machen, zum Handeln motivieren
und Engagement für eine gerechte und nachhaltige Zukunft stärken.
Die Antragstellung ist unkompliziert und auch für Neueinsteigerinnen
und Neueinsteiger geeignet.
Beratung und Unterstützung
inklusive Neben der finanziellen Förderung bietet die DSEE
umfangreiche Beratungsangebote: In individuellen Sprechstunden und
Webinaren erhalten Engagierte praktische Tipps zur Antragstellung
und Umsetzung bis hin zur Abrechnung ihrer Projekte. So werden auch
diejenigen unterstützt, die zum ersten Mal eine Förderung beantragen
möchten. Förderphase läuft bis 2027 Das Förderprogramm action! läuft
noch bis Ende 2027.
Wer in diesem Jahr noch eine Aktion
umsetzen möchte, sollte jetzt die Chance nutzen und bis spätestens
20. Oktober einen Antrag stellen. Auch in den kommenden Jahren ist
eine Antragstellung möglich. Pro Jahr kann jede Initiative oder
Gruppe einen Antrag einreichen.
Jan Holze, Vorstand der
Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt sagt dazu: „Mit dem
Programm action! gibt es eine einfache und unbürokratische Form der
Unterstützung für Engagierte, um ihre Bildungsaktionen zu globalen
Themen auf den Weg zu bringen.“ Weitere Informationen und
Antragstellung: Alle Informationen zum Programm, Beratungstermine
und das Online-Antragsformular finden Interessierte unter:
d-s-e-e.de/action
Das
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
fördert das lokale Engagement für globale Gerechtigkeit und für eine
nachhaltige Zukunft. Mit dem Förderprogramm „action! Aktiv für eine
globale Welt“ wird dieses Engagement besonders in ländlichen
Regionen Deutschlands gestärkt. Von 2025 bis 2027 werden
entwicklungspolitische Bildungsaktionen mit bis zu 500 Euro
gefördert. Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt setzt
das Förderprogramm um und bietet jungen Engagierten eine umfassende
Beratung und praxisnahe Hilfestellungen.
17 Ziele für
nachhaltige Entwicklung (engl. Sustainable Development Goals)
Die
Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung wurde am
25. September 2015 von 193 Staats- und Regierungschefs auf dem
Gipfeltreffen der Vereinten Nationen in New York verabschiedet. Die
Agenda 2030 stellt einen „Weltzukunftsvertrag“ dar, der die Staaten
dazu verpflichtet, allen Menschen bis 2030 ein Leben in Würde zu
ermöglichen.
Die Deutsche Stiftung für
Engagement und Ehrenamt (DSEE) hat im Juli 2020 ihre
Arbeit in Neustrelitz aufgenommen. Mit der Stiftung gibt
es erstmals eine bundesweite Anlaufstelle zur Förderung
ehrenamtlichen Engagements. Sie berät, qualifiziert,
fördert und vernetzt Engagierte und Ehrenamtliche und
unterstützt insbesondere in ländlichen und
strukturschwachen Räumen.
Kreativ werden in der MachBar in der
Zentralbibliothek
Ausprobieren und Selbermachen – das steht im Mittelpunkt zahlreicher
Veranstaltungen, die in den nächsten Wochen in der MachBar in der
Zentralbibliothek, Steinsche Gasse 26, stattfinden. Bei der nächsten
MachBar-Sprechstunde am Dienstag, 30. September, kann man sich von
16 bis 19 Uhr über die technischen Möglichkeiten der MachBar
informieren.
Die Sprechstunde findet wöchentlich immer
dienstags statt. Beim queeren Handarbeitskreis am Donnerstag,
2.Oktober, 16 bis 18 Uhr, treffen sich kreative Köpfe jeden Alters
zum gemeinsamen Werkeln und Austauschen. Wer sich für die
Möglichkeiten des Plottens interessiert, kann am Dienstag, 7.
Oktober, von 16 bis 17 Uhr an einer Einführung teilnehmen. Erklärt
wird das Gerät und die Software.
Beim „Maschengedöns“, am
Mittwoch, 8. Oktober, erklären die Expertinnen der „Flinken Nadeln“
von 16 bis 18 Uhr alle Kniffe und Techniken rund um das Stricken und
Häkeln. Für die Veranstaltungen sind keine Vorkenntnisse
erforderlich und die Teilnahme ist kostenlos. Die Anmeldung und
weitere Veranstaltungen kann man online auf
www.stadtbibliothek-duisburg.de finden.
Sexualisierte Gewalt: Kirche und CVJM suchen Betroffene und
Zeug*innen
Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter aus den 1970er-Jahren
Die Evangelische Kirche im Rheinland, die Kirchenkreise Moers,
Duisburg und Krefeld-Viersen sowie der CVJM Kreisverband Moers gehen
gemeinsam Vorwürfen sexualisierter Gewalt gegen einen inzwischen
verstorbenen Mitarbeiter nach.
Betroffene, die sich in ihrer
Jugend in den 1970er-Jahren beim evangelischen Binnenschifferdienst
in Duisburg bzw. beim CVJM in Moers engagierten, hätten von
sexualisierter Gewalt durch einen Mitarbeiter berichtet. „Aufgrund
der bisherigen Erkenntnisse werden weitere Betroffene vermutet. Mit
diesem Aufruf möchte die Kirche ihnen die Möglichkeit eröffnen, sich
hierzu zu melden. Außerdem werden Zeug*innen gesucht, die Hinweise
zur Aufklärung geben möchten“, heißt es in dem heute
veröffentlichten Aufruf.
Nach bisherigem Wissensstand
bestehe Anlass zu der Annahme, dass die beteiligten kirchlichen
Ebenen seinerzeit nicht die notwendigen Konsequenzen gezogen und
damit eine weitere Beschäftigung des Mitarbeiters im kirchlichen
Dienst ermöglicht hätten. Die jetzt angestoßene Aufarbeitung diene
auch dazu, sexualisierte Gewalt künftig bestmöglich zu verhindern.
Kontaktstellen für Betroffene und Zeug*innen
Für mögliche
(weitere) Betroffene und für Zeug*innen werden in dem Aufruf
Kontaktstellen und Personen benannt, die Hinweise entgegennehmen,
vertrauliche Gespräche führen und Hilfe und Unterstützung anbieten.
Dazu zählen die Stabsstelle Prävention, Intervention und
Aufarbeitung der Evangelischen Kirche im Rheinland, die
Vertrauenspersonen der beteiligten Kirchenkreise und des CVJM
Kreisverband Moers sowie der Weiße Ring als Anlaufstelle außerhalb
kirchlicher Strukturen.
Stichwort: Stabsstelle Prävention,
Intervention und Aufarbeitung
Für die Gesamtkoordination aller
landeskirchlichen Aktivitäten zum Thema sexualisierte Gewalt wurde
2022 die Stabsstelle Prävention, Intervention und Aufarbeitung
eingerichtet.
Sie wird seit Juli 2024 von der Kriminologin Katja
Gillhausen geleitet und ist dem Zuständigkeitsbereich von Vizepräses
Antje Menn zugeordnet. Die Stabsstelle wurde personell verstärkt und
an die wachsenden Herausforderungen angepasst. Auch die
Ansprechstelle für Betroffene ist mittlerweile in die Stabsstelle
integriert.
Chor „Soul, Heart & Spirit“ und Leiter
laden wieder zum Mitsingen ein
Die Mitglieder des
Chores „Soul, Heart & Spirit“ und dessen Leiter Lothar Rehfuß haben
sich auch für diesen Herbst ein Musikprojekt ausgesucht, von dem sie
wissen, dass dieses schon beim Proben in Gemeinschaft viel Freude
machen wird. Daran möchten sie Menschen ab 16 teilhaben lassen und
laden sie herzlich zum Mitsingen ein. Vorkenntnisse sind nicht
zwingend.
Die Singfans üben das „Vermächtnis eines Freundes“
ein. Das Werk von Gregor Linßen beschreitet in acht Liedern und
verbindenden Texten den Weg aus der Verlusterfahrung heraus. Linßen
verarbeitet in der Komposition den Verlust eines tödlich
verunglückten Freundes. Ab dem 30. September kommen Chormitglieder,
Mitglieder des Singkreises von Beate Hölzl und interessierte
Mitsingende dienstags immer um 20 Uhr im Wanheimer Gemeindehaus,
Knevelshof 45, der Evangelischen Rheingemeinde Duisburg zusammen.
Am Schluss stehen die Aufführungen am 16.
November in der Gnadenkirche Wanheimerort und die am 23. November im
Gottesdienst in der Wanheimer Kirche. Um genügend Notenmaterial
bestellen zu können, bittet Chorleiter Lothar Rehfuß um Anmeldungen
bis zum 27. September (Tel. 01573-1056500 oder
lothar.rehfuss@gmail.com).

Mitglieder von „Soul, Heart & Spirit“ mit ihrem Chorleiter in der
evangelischen Kirche in Wanheim (Foto: Chor „Soul, Heart & Spirit“)
Erntedank in
der Obermarxloher Lutherkirche mit Brunch und Mitbring-Buffet
Die Evangelische Bonhoeffer Gemeinde Marxloh
Obermarxloh feiert in diesem Jahr einen besonderen
Erntedank-Gottesdienst: Neben der Bibel kommt am 5. Oktober um 11
Uhr in der der Lutherkirche, Wittenberger Str. 15, Brunch und
Mitbring-Buffet eine besondere Rolle zu.
Alle drei Elemente
sorgen dafür, dass Klein und Groß Gemeinschaft erleben können, und
zwar beim zum Singen und Beten, Hören und Reden und beim Essen und
Trinken. Für Getränke und Brötchen ist gesorgt; wer mitfeiern möchte
sollte Brotaufstriche, Snacks mitbringen. Den Gottesdienst gestalten
mit viele Liebe die Kita an der Lutherkirche und Gemeindepädagogin
Nicole Enders. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter
www.bonhoeffer-gemeinde.org.
„Innehalten in
der Woche“ in Wanheimerort
Bei Kerzenschein, Musik und
Stille vor Gott zur Ruhe und zu sich zu kommen. Die Idee der
besonderen Andacht zum Innehalten während der Woche hat sich in der
Evangelischen Rheingemeinde Duisburg viele Jahre gut bewährt.
Die Freie Evangelische
Gemeinde Wanheimerort und die Katholische Gemeinde Wanheimerort sind
von dem Konzept auch überzeugt, so dass seit einiger Zeit alle drei
Gemeinden alle zwei Monate gemeinsam zum „Innehalten in der Woche“
einladen.
Das nächste Zusammenkommen ist am Donnerstag, 2.
Oktober 2025 um 18 Uhr in der Gnadenkirche, Paul-Gerhardt-Straße 1.
Weitere Informationen haben Pfarrerin Almuth Seeger (Tel. 0203 /
770607) und Karen Sommer-Loeffen (Tel. 0203 / 727723).

Seit 1991 zogen knapp 735.000 Personen aus den
ostdeutschen Bundesländern nach NRW
* Knapp 514.000
Personen zogen von NRW nach Ostdeutschland.
* Fast jedes Jahr
sind mehr Personen aus den ostdeutschen Bundesländern nach NRW
gezogen als umgekehrt.
* Höchste Wanderungsgewinne von 1991 bis
2024 aus Sachsen-Anhalt.
In den Jahren 1991 bis 2024 sind
fast 735.000 Personen aus den ostdeutschen Bundesländern nach NRW
gezogen. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als
Statistisches Landesamt anlässlich des Tags der Deutschen Einheit am
3. Oktober mitteilt, haben seit 1991 knapp 514.000 Personen ihren
Wohnsitz von NRW in eines der fünf ostdeutschen Bundesländer
verlegt.
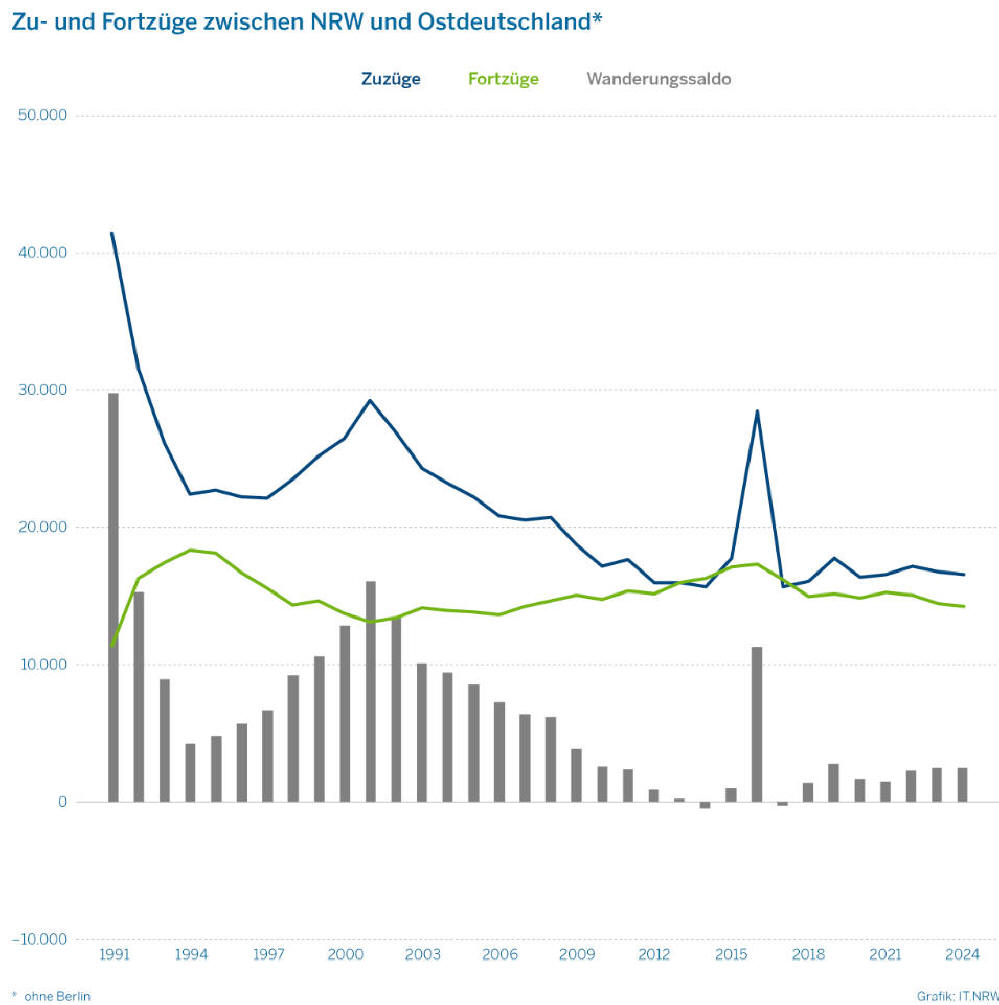
Mehr Zuzüge aus ostdeutschen Bundesländern als Fortzüge dorthin
Seit 1991 waren fast jedes Jahr mehr Personen aus den
ostdeutschen Bundesländern nach NRW gezogen als umgekehrt. Ausnahmen
waren die Jahre 2014 und 2017. Über den gesamten Zeitraum 1991 bis
2024 sind gut 221.000 mehr Personen aus den ostdeutschen
Bundesländern nach NRW gezogen als umgekehrt.
Im Rekordjahr
1991 überstiegen die Zuzüge nach NRW die Fortzüge in ostdeutsche
Bundesländer um fast 30.000 Personen. Auch zur Jahrtausendwende und
im Jahr 2016 infolge der hohen Zuwanderung von Schutzsuchenden
stiegen die Zuzüge aus Ostdeutschland deutlich an. 2024 betrug der
Überschuss der Zugewanderten aus den fünf ostdeutschen Bundesländern
nach NRW nur noch gut 2.400 Personen.
Höchste
Wanderungsgewinne aus Sachsen-Anhalt – geringste aus
Mecklenburg-Vorpommern
Über den gesamten Zeitraum 1991 bis 2024
verzeichnete NRW aus Sachsen-Anhalt mit einem Plus von 63.622
Personen die höchsten Wanderungsgewinne. Aus Sachsen-Anhalt waren
seit 1991 jedes Jahr mehr Personen nach NRW gezogen als andersherum.
Am geringsten fiel der Wanderungsgewinn für NRW mit
Mecklenburg-Vorpommern aus. Er betrug +20.539 Personen über den
Zeitraum von 1991 bis 2024.
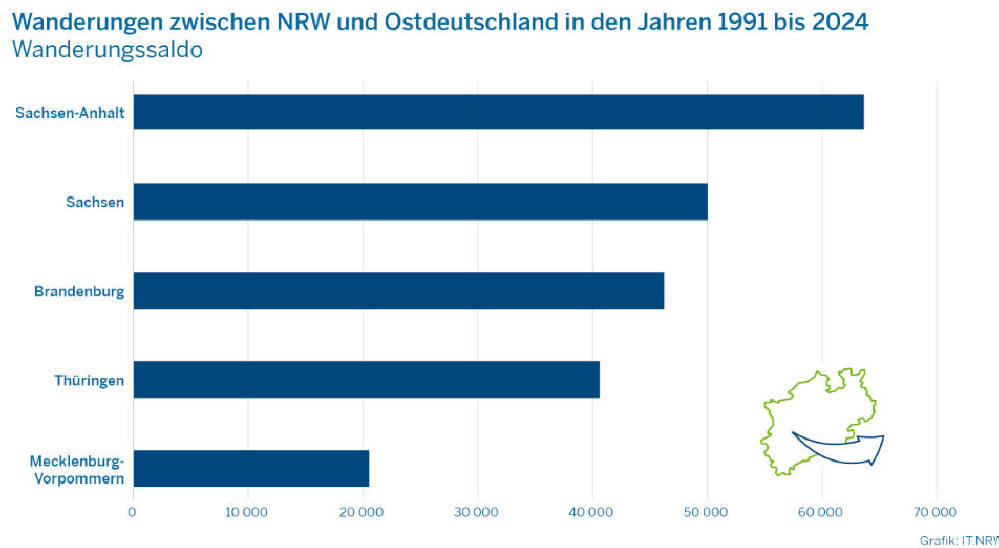
17 900 mindestens Hundertjährige lebten Ende 2024 in
Deutschland
• Zahl gegenüber dem Jahr 2011 um knapp ein
Viertel gestiegen
• Zahlenmäßig leben die meisten Menschen im
Alter 100plus in NRW, ihr Anteil ist am höchsten in Hamburg
•
Japan hat weltweit die meisten Menschen im Alter 100plus
Zum Jahresende 2024 lebten in Deutschland rund 17 900 mindestens
Hundertjährige. Die Zahl ist gegenüber dem Jahr 2011 um knapp ein
Viertel (+24,0 %) gestiegen, wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) zum Tag der älteren Menschen am 1. Oktober mitteilt.
Damals lebten hierzulande gut 14 400 Menschen, die 100 Jahre
oder älter waren. Die mindestens Hundertjährigen sind überwiegend
Frauen: Ende 2024 betrug ihr Anteil 83,8 %. Im Jahr 2011 war er mit
87,0 % noch etwas höher. Die Lebenserwartung ist langfristig
deutlich gestiegen; für Frauen ist sie zudem höher als für Männer.
Auch der Anteil der Altersgruppe
100plus an der Gesamtbevölkerung ist gestiegen. Kamen im Jahr 2011
auf 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner noch 1,8 Menschen, die
100 Jahre oder älter waren, so waren es 2024 bereits 2,1 Personen.
In Hamburg ist der Anteil der mindestens Hundertjährigen am
höchsten, in Bayern am niedrigsten Hinsichtlich Zahl und Anteil der
mindestens Hundertjährigen gibt es regionale Unterschiede.
Die meisten Hochbetagten lebten zum Jahresende 2024 in den
bevölkerungsreichen Bundesländern Nordrhein-Westfalen (3 900),
Bayern (2 400) und Baden-Württemberg (2 300). Betrachtet man den
Anteil der Altersgruppe 100plus an der Gesamtbevölkerung zeigt sich
ein anderes Bild: In Hamburg kamen zuletzt 2,9 mindestens
Hundertjährige auf 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner – im
Vergleich der Bundesländer der höchste Wert.
Anteilig viele
Hochbetagte gab es auch in Sachsen (2,6 je 10 000 Einwohnerinnen und
Einwohner) und im Saarland (2,5). Die wenigsten mindestens
Hundertjährigen gab es gemessen an der Gesamtbevölkerung in Bayern
(1,8 je 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner), Bremen (1,9) und
Brandenburg (2,0).
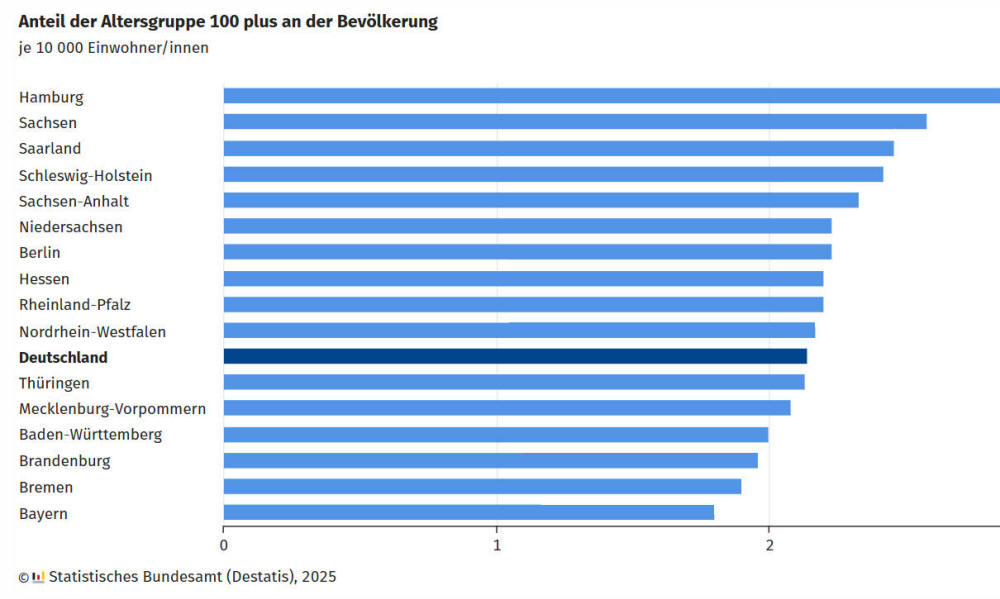
Japan hat weltweit die meisten mindestens
Hundertjährigen
Auch weltweit nehmen Zahl und Anteil der
mindestens Hundertjährigen zu, wenn auch auf niedrigerem Niveau
als in Deutschland. Kamen im Jahr 2011 weltweit 0,4 mindestens
Hundertjährige auf 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner, so waren
es 2024 bereits 0,7 Menschen dieses Alters, wie aus
Vorausberechnungen der Vereinten Nationen (UN
World Population Prospects) hervorgeht.
Danach waren
2024 weltweit mehr als einen halbe Million Menschen (587 000)
mindestens 100 Jahre alt, vier Fünftel von ihnen Frauen (81 %).
Im Jahr 2011 hatten 303 000 Menschen zu dieser Altersgruppe
gehört. Die meisten mindestens Hundertjährigen gab es 2024 in
Japan (121 000), den Vereinigten Staaten (70 000) und China
(43 000).