






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 40. Kalenderwoche:
2. Oktober
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Freitag, 3. Oktober 2025 - Tag der deutschen Einheit
35 Jahre
Deutsche Einheit – Staatsminister Weimer würdigt Mut der
DDR-Bürgerinnen und Bürger und mahnt zu Zusammenhalt und Respekt
Anlässlich
des Tages der Deutschen Einheit hat Wolfram Weimer, Staatsminister
für Kultur und Medien, die Wiedervereinigung als einen bewegenden
Höhepunkt der deutschen Geschichte gewürdigt. Weimer erinnerte an
die Bedeutung des 3. Oktobers und hob die entscheidende Rolle der
DDR-Bürgerinnen und Bürger hervor.
„Bis heute steht der 3.
Oktober 1990 für den glücklichsten Tag in der deutschen
Nachkriegsgeschichte, die Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit.
Immer häufiger war im Jahr davor der Ruf ‚Wir sind das Volk‘ durch
das einende ‚Wir sind ein Volk‘ ergänzt worden. Die Deutsche Einheit
konnte nur Wirklichkeit werden dank des Muts und des Strebens der
DDR-Bürgerinnen und Bürger nach Freiheit und Demokratie, durch ihre
friedliche Revolution.“
Gleichzeitig betonte der
Staatsminister, dass auch 35 Jahre nach der Wiedervereinigung
Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland bestehen: „Sie sind
politisch, wirtschaftlich, mentalitätsgeschichtlich und auch durch
persönliche biografische Erfahrungen begründet.“ Umso wichtiger sei
es, das Verbindende in den Vordergrund zu stellen – insbesondere
„die gemeinsame Liebe zur Freiheit und die gemeinsame Verankerung in
einer großen kulturellen Tradition.“
Weimer rief dazu auf,
die unterschiedlichen Prägungen in Ost und West nicht als trennend,
sondern als bereichernd zu begreifen: „Wir sollten uns unserer
gemeinsamen Wurzeln erinnern, aber auch den Prägungen nachspüren,
die bei den Bürgerinnen und Bürgern beider deutscher Staaten jeweils
charakteristische Spuren hinterlassen haben.
Unterschiede
müssen nicht trennen: Sie können uns bereichern und zur Reflexion
anregen. Für eines möchte ich daher werben: die Neugier aufeinander,
das Interesse für die Unterschiede wie für die Gemeinsamkeiten.
Einheit gelingt nicht durch Gleichmacherei, sondern durch
gegenseitige Anerkennung, Respekt und das Bewusstsein, dass wir
zusammengehören.“
Tag der deutschen Einheit: Feierstunde im Rathaus
Die Wiedervereinigung Deutschlands ist das bedeutsamste Ereignis
in der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik und wird jedes Jahr am
3. Oktober mit dem Nationalfeiertag zur Deutschen Einheit gewürdigt.
Die Stadt Duisburg lädt Bürgerinnen und Bürger am Freitag, 3.
Oktober, um 11 Uhr in den Sitzungssaal des Rathauses am Burgplatz 19
in der Stadtmitte zu einer Feierstunde ein.
Interessierte
können sich auf ein Festkonzert unter dem Motto „Musik ohne Grenzen“
präsentiert von Mitgliedern der Duisburger Philharmoniker und
internationalen Gästen freuen. Die Teilnahme ist kostenlos.
Stadtwerketurm leuchtet am deutschen Nationalfeiertag in den
Farben der Bundesflagge
Zu festgelegten Anlässen
ändert der Stadtwerketurm seine gewohnte grüne Beleuchtung. So auch
am kommenden Tag der deutschen Einheit, der jährlich am 3. Oktober
gefeiert wird. Der Stadtwerketurm erstrahlt am deutschen
Nationalfeiertag in den Farben der Bundesflagge: Schwarz-Rot-Gold.
Mit Einbruch der Dunkelheit lohnt sich also ein Blick in Richtung
Hochfeld zum Baudenkmal der Stadtwerke.

Am Tag der deutschen Einheit erstrahlt der Stadtwerketurm in den
Farben der Bundeflagge. Bildquelle: Stadtwerke Duisburg
Deutscher Lichtdesign-Preis 2020
Der leuchtende Turm der
Stadtwerke begeistert nicht nur die Duisburger Bürgerinnen und
Bürger, auch die Expertinnen und Experten der Jury des Deutschen
Lichtdesign-Preises waren vollauf überzeugt. Der Stadtwerketurm
wurde im September 2020 mit dem renommierten Preis in der Kategorie
„Außenbeleuchtung / Inszenierung – Wahrzeichen“ ausgezeichnet.
Die bestechende Lichtinstallation entsteht durch eine
Kombination aus verschiedenartig geformten LED-Leuchtkörpern,
darunter 180 Strahler und 256 Meter Lichtlinien. Sie illuminieren
die filigrane Stahlkonstruktion des Stadtwerketurms so, dass sie in
der Dunkelheit perfekt zur Geltung kommt.
Um die Leuchtmittel
mit Strom zu versorgen, waren 4.500 Meter Kabel notwendig, 2.400
Meter davon in der Vertikalen innerhalb der Aufzugröhre in der Mitte
des Turms. Weitere Informationen zum Turm gibt es auch im Internet
unter www.stadtwerketurm.de
Mobilitätskongress Rheinland
Wie lassen sich
Baustellen effizient koordinieren, Verkehrsströme intelligent
steuern und eine zukunftsfähige Infrastruktur schaffen, damit Städte
und Kreise erreichbar bleiben? Unter dem Motto „Baustelle Rheinland
– Wie bleiben unsere Städte und Kreise erreichbar?“ haben die
Rheinland-IHKs beim Mobilitätskongress mit NRW-Verkehrsminister
Oliver Krischer Handlungsansätze diskutiert.
Ocke Hamann,
Geschäftsführer des Bereichs Standort, Digital, Innovation und
Umwelt bei der Niederrheinischen IHK und fachpolitischer Sprecher
Verkehr und Mobilität IHK NRW, dazu: „Jede dritte Autobahnbrücke in
NRW muss bald saniert oder ersetzt werden – deutlich mehr als in
allen anderen Bundesländern. Für unsere Unternehmen ist das ein
enormes Risiko. Deshalb braucht NRW den größten Anteil aus dem
Sondervermögen Infrastruktur des Bundes. Aktuell jedoch läuft es
nicht gut.
Die Bundesregierung hatte versprochen, dass das
Geld aus dem Sondervermögen zusätzlich sein soll und dafür gedacht
ist, die Versäumnisse der Vergangenheit auszugleichen. Nun wird im
Verkehrshaushalt allerdings umgeschichtet und gekürzt. Unser
Bundesland aber braucht gerade die klassischen Haushaltsmittel. Denn
in NRW handelt es sich fast ausschließlich um Ausbauvorhaben. Und
diese sind nicht durch das Sondervermögen abgedeckt. Hier muss
nachgebessert werden.“

Foto: © Andreas Endermann
Mobilitätskongress Rheinland
fordert den Sprint bei der Infrastruktur
Der heutige
Mobilitätskongress der IHK-Initiative Rheinland hat erneut
Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung
zusammengebracht, um Lösungen für eine zentrale Herausforderung der
Region zu diskutieren.
Andreas Schmitz, Präsident der IHK
Düsseldorf, machte bereits zur Eröffnung die
Dringlichkeit des
Themas deutlich. Mobilität sei die Lebensader des Rheinlands,
betonte er: „Eine funktionierende Infrastruktur ist für die gesamte
Region von entscheidender, wirtschaftlicher Bedeutung.“
Marode Verkehrswege wirkten dagegen wie eine Wachstumsbremse für die
Volkswirtschaft. Ohne eine kluge Abstimmung der zahlreichen
Baustellen drohten Staus, Umwege und wirtschaftliche Schäden. „Mit
guter Planung jedoch
können Baustellen nicht nur Belastung sein,
sondern auch ein Hebel für nachhaltigen
Fortschritt“, so Schmitz.
Auch NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer betonte, dass
Land, Kommunen und Wirtschaft nur gemeinsam Lösungen finden können,
um Verkehrsflüsse trotz zahlreicher Baustellen zu sichern. Felix
Heinrichs, Vorstand der Metropolregion Rheinland, ergänzte, dass
dafür vor allem eine frühzeitige Abstimmung erforderlich sei, damit
Pendler- und Wirtschaftsverkehre gleichermaßen berücksichtigt
werden.
Wie dringend diese Koordination ist, zeigte Prof. Dr.
Roman Suthold vom ADAC Nordrhein auf: „Zwei Drittel aller
Autobahn-Baustellen in Deutschland liegen in NRW – obwohl nur 17
Prozent des gesamten Netzes durch unser Bundesland verlaufen. Allein
im September waren es 779 Baustellen. Diese Zahlen verdeutlichen die
enorme Belastung für Verkehr, Wirtschaft und Umwelt.“
Die
anschließende Diskussion unter dem Titel „Alt, marode,
unterfinanziert? Warum wir gute Infrastruktur im Rheinland brauchen“
machte unmissverständlich deutlich, dass viele Brücken und Straßen
überlastet sind und dringende Sanierungen längst überfällig. Der
Investitionsbedarf übersteigt die vorhandenen Mittel deutlich.
Gleichzeitig waren sich alle Teilnehmenden einig: Eine
funktionierende Infrastruktur ist das Fundament für Wirtschaft und
Gesellschaft – ohne sie geraten Mobilität, Lieferketten und
Wettbewerbsfähigkeit ins Wanken.
Im weiteren Verlauf stand
die Frage im Mittelpunkt, wie Baustellenkoordinierung und
Verkehrsmanagement so gestaltet werden können, dass unvermeidbare
Eingriffe ins Netz möglichst reibungslos ablaufen. Engere
Abstimmungen zwischen Bauverwaltungen, Verkehrsbehörden und
Infrastrukturbetreibern sind dabei ebenso notwendig wie der Einsatz
digitaler Planungstools und Plattformen.
Diese können helfen,
Bauzeiten zu verkürzen, parallele Sperrungen zu vermeiden und den
Verkehr trotz Sanierungsdruck fließen zu lassen. So lassen sich
Staus verringern, Emissionen senken und die Mobilität in
NordrheinWestfalen nachhaltig sichern.
Die Zukunft der
Mobilität im Rheinland, da waren sich alle einig, hängt entscheidend
von einer leistungsfähigen Infrastruktur, abgestimmten Bauabläufen
und einer intelligenten Verkehrslenkung ab. Nur wenn alle Akteure
gemeinsam handeln, kann die Region auch in Zukunft erreichbar,
klimafreundlich und wirtschaftlich stark bleiben.
Über die
IHK-Initiative Rheinland
Ziel der IHK-Initiative Rheinland GbR
ist die Weiterentwicklung des Rheinlands zu einem der attraktivsten
Standorte Europas. Die Initiative ist ein Bündnis der sechs
Industrie- und Handelskammern Aachen, Bergische Industrie- und
Handelskammer Wuppertal-SolingenRemscheid, Bonn/Rhein-Sieg,
Düsseldorf, Mittlerer Niederrhein und Niederrheinische IHK Duisburg.
Mehr Informationen hier:
www.rheinland.ihk.de
Internationale Delegation
aus der Türkei zu Gast in Duisburg: fachlicher Austausch zur
Suchthilfe
Die Stadt Duisburg durfte kürzlich eine
besondere Besuchergruppe aus ihrer türkischen Partnerstadt Gaziantep
willkommen heißen. Eine Delegation aus Wissenschaftlern und
Wissenschaftlerinnen, Gesundheitsmanagerinnen und -managern,
Ärztinnen und Ärzten sowie Psychologinnen und Psychologen stoppte
auf ihrer europäischen Dienstreise in Duisburg, um auch hier
verschiedene Suchthilfesysteme kennenzulernen.
Die
Fachgruppe setzte sich aus Expertinnen und Experten der Gaziantep
Metropolitan Municipality, Abteilung für Gesundheitsdienste, sowie
der Gaziantep Provinzialdirektion für Gesundheit zusammen. Mit
großem Interesse und Engagement informierten sich die Fachleute über
den Suchthilfeverbund e.V. sowie die Angebote der
Suchtberatungsstelle Nikolausburg der Caritas. Die ambulanten
Beratungs- und Rehabilitationsangebote international zu
präsentieren, war auch für die Duisburger Kolleginnen und Kollegen
wertvoll.
Das Gesundheitsamt der Stadt Duisburg, vertreten
durch Maria-Aniela Malikowska, Koordinatorin für Psychiatrie und
Sucht, begleitete den Besuch. Sie erläuterte die Zusammenarbeit
zwischen dem Gesundheitsamt und den Einrichtungen, sprach über
aktuelle Herausforderungen und präsentierte die Finanzierungsmodelle
der ambulanten Suchtberatung.
„Wir sind sehr stolz darauf,
zwei Einrichtungen der ambulanten Suchtberatung sowie Rehabilitation
vorstellen zu dürfen. Es freut uns sehr, dass wir wertvolle Impulse
aus unserer Versorgung geben konnten“, betonte Maria-Aniela
Malikowska. Besonders spannend war auch der Blick in die Zukunft der
türkischen Suchthilfe in Gaziantep. Dort ist der Aufbau einer
umfassenden Einrichtung geplant, die neben ambulanten und
stationären Hilfen auch arbeitsmarktbezogene Maßnahmen zur sozialen
Eingliederung anbieten soll.
Letztere sollen zugleich die
Therapie begleiten – etwa durch handwerkliche Tätigkeiten wie das
Anfertigen von Teppichen oder Tonarbeiten, die nicht nur die
berufliche Eingliederung unterstützen, sondern auch zur
Stabilisierung und Strukturierung des Alltags beitragen sollen.
„Ein herzlicher Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen des
Suchthilfeverbunds sowie der Suchtberatungsstelle Nikolausburg der
Caritas, die den Besuch inhaltlich vorbereitet, durchgeführt und
zweisprachig begleitet haben. Ihr Engagement hat maßgeblich zum
Gelingen dieses inspirierenden Treffens beigetragen und den
Grundstein für eine mögliche zukünftige Kooperation mit der Gemeinde
Gaziantep gelegt“, resümierte Maria-Aniela Malikowska.

Türkische Fach-Delegation zu Besuch in Duisburg - Foto Stadt
Duisburg
Internationale Gartenausstellung 2027 (IGA
2027) Vögel im Grünen Ring – IGA-Workshop lädt zur Entdeckungstour
ein
Welche Vögel leben eigentlich direkt vor unserer
Haustür – und wie lassen sie sich am besten beobachten? Diesen
Fragen widmet sich eine besondere Exkursion der Biologischen Station
Westliches Ruhrgebiet e. V. am Dienstag, 7. Oktober 2025, von 16:00
bis 18:00 Uhr im Grünen Ring Duisburg. Gemeinsam mit Expertinnen und
Experten begeben sich die Teilnehmenden auf eine spannende
Entdeckungstour.
Die Veranstaltung richtet sich an
Jugendliche und Erwachsene, die Lust haben, die heimische Vogelwelt
näher kennenzulernen – egal, ob bereits passionierte
Vogelfreundinnen und -freunde oder neugierige Einsteiger. Neben
spannenden Beobachtungen in der Natur vermittelt die Exkursion auch
interessante Einblicke in die Lebensweise der Tiere und gibt
praktische Tipps zur Vogelbeobachtung. Wer ein Fernglas besitzt,
kann es gerne mitbringen.
Die Teilnahme ist kostenlos,
eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mit dem Workshop setzt das
IGA-Team der Wirtschaftsbetriebe Duisburg seine Reihe an Angeboten
fort, die Natur, Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit erlebbar
machen. Der Grüne Ring, in dem die Exkursion stattfindet, ist
zugleich ein wichtiges Projekt im Rahmen der Internationalen
Gartenausstellung 2027 in Duisburg: Er verbindet den RheinPark
Hochfeld mit der Innenstadt und schafft neue Freiräume für Erholung,
Begegnung und Naturerfahrung.
Mario-Kart-Stadtmeisterschaft der Duisburger Kinder- und
Jugendzentren
Auf der „Nintendo Switch“ flitzen Mario,
Luigi, Peach, Yoshi, Donkey Kong, Bowser und Co. wieder um die
Wette. Die Rede ist von den Mario-KartStadtmeisterschaft der
Duisburger Kinder- und Jugendzentren. Ausgetragen werden diese am
Freitag, 17. Oktober, ab 12 Uhr im städtischen Kinder- und
Jugendzentrum „Die Insel“, Benediktstraße 46, 47059 Duisburg.
Bereits seit Wochen werden in den Duisburger Jugendzentren
interne Turniere ausgetragen, um dann die jeweils zwei besten
Spielerinnen und Spieler an der Konsole zum Turnier zu schicken, die
dort ihre Einrichtungen vertreten. Insgesamt sind elf Teams
angemeldet. „Die Insel“ richtet bereits seit 2017 jährlich die
FIFA-Stadtmeisterschaft der Duisburger Kinder- und Jugendzentren aus
und wird dabei tatkräftig durch den KellaRindaClan
(www.lan-duisburg.de) unterstützt, der auch dieses Mal den
technischen Support und die Spielleitung übernimmt.
Neben
dem Wanderpokal werden die ersten drei Plätze mit
Einkaufsgutscheinen und die dahinterstehenden Einrichtungen mit
einer Budgetaufstockung belohnt. Als besonderer Clou werden die
Teilnehmenden aber nicht einfach vor einer Konsole auf Stühlen,
sondern in liebevoll von den Einrichtungen selbst gestalteten
Holzkarts sitzen. Auch dafür wird es einen Preis geben.
Ungefährer Ablaufplan 12 Uhr Eröffnungsrede / Aufbau der Geräte
12.40 Uhr Ligasystem (3 Spieltage)
14.30 Uhr Mittagessen
15.10 Uhr Ligasystem (3 Spieltage)
17.20 Uhr Halbfinale H1,
Qualifikationsspiele um die Plätze 9 - 32
18 Uhr Halbfinale H2,
Endspiele um die Plätze 9 - 32
18.40 Uhr Finale 19.50 Uhr
Siegerehrung
Mehr Geld für schulisches Personal und
Investitionen in den offenen Ganztag
- Schulhaushalt
steigt um fast 5 Prozent auf 25,7 Milliarden Euro
-
Schulministerin Feller stellt Etat im Schulausschuss vor
Es gibt
mehr Geld, um zusätzliche Stellen für Lehrerinnen und Lehrer zu
schaffen. Der Offene Ganztag wird weiter gestärkt – mit nunmehr fast
einer Milliarde Euro. Die Investitionssummen für Bildungsangebote
und die Infrastruktur für die Ganztagsbetreuung steigen. Kulturelle
Bildung bekommt einen größeren Stellenwert. Schulen, die am
Startchancenprogramm teilnehmen, erfahren Entlastungen für
Schulentwicklungsprozesse. Dies alles sind Bestandteile des neuen
Schulhaushalts für das Jahr 2026.
Der Einzelplan „Schule“
des nordrhein-westfälischen Landesetats wächst von rund 24,5
Milliarden Euro im Jahr 2025 auf rund 25,7 Milliarden Euro im
kommenden Jahr und steigt damit um rund 5 Prozent. Der Schuletat
stellt mit 22,9 Prozent den größten Part im nordrhein-westfälischen
Landeshaushalt dar.
„Die Haushaltsaufstellung erfolgt
aktuell unter großen finanziellen Herausforderungen – und gerade
deshalb bin ich meinen Kolleginnen und Kollegen im Landeskabinett
sehr dankbar, dass die Bildung unserer Schülerinnen und Schüler auch
weiterhin höchste Priorität hat und sich in weiter gestiegenen
Zahlen ausdrückt“, betonte Schulministerin Dorothee Feller am
Mittwoch, 1. Oktober 2025, bei der Vorstellung des Schuletats im
Schulausschuss des Landtags.
Insgesamt garantiert der
schulische Etat die Finanzierung von 178.758 Lehrkräftestellen. Für
die stufenweise Anhebung der Besoldung der Lehrkräfte der
Primarstufe und Sekundarstufe I nach A13 sind im Etat weitere 60,21
Millionen Euro vorgesehen. „Wir setzen alles daran, die
Personalausstattung an den Schulen weiter zu verbessern und haben in
den vergangenen Jahren auch schon viel geschafft. So konnten wir
seit Ende des Jahres 2022 insgesamt 9.500 Menschen zusätzlich an
unsere Schulen bringen. Insgesamt gab es in dieser Zeit 20.000
dauerhafte Neueinstellungen, darunter 17.000 Lehrerinnen und
Lehrer“, sagt Ministerin Feller.
Einige weitere exemplarische
Kernelemente des Schulhaushalts 2026:Offene Ganztagsschule im
Primarbereich:
Es werden bedarfsgerecht 20.000 zusätzliche Plätze
geschaffen. Damit stehen im Jahr 2026 Mittel bereit, um 50.000
Plätze zu finanzieren, wenn sie von den Kommunen eingerichtet
werden. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung ist ein
substanzieller Platzaufwuchs bis zum Schuljahr 2028/2029 nach
aktuellen Planungen auf bis zu 605.500 Plätze vorgesehen.
Nordrhein-Westfalen liegt damit bei der Vorbereitung des
Rechtsanspruchs auf Kurs.
Das Ausgabenvolumen in 2026 steigt
um rund 93,1 Millionen Euro und beträgt insgesamt rund 983 Millionen
Euro. Jeder von den Kommunen beantragte Platz kann bewilligt werden.
Investitionsprogramm Ganztagsausbau:
Aus Bundes- und
Landesmitteln werden 254 Millionen Euro bereitgestellt, damit die
kommunale Infrastruktur im Ganztagsbereich ausgebaut werden kann.
Die Bundesmittel steigen um rund 69,8 Millionen Euro und die
Landesmittel um rund 35,6 Millionen Euro. Insgesamt stehen rund 892
Millionen Euro an Investitionsmitteln bei Bund, Land und Kommunen
bereit.
Schul- und Bildungspauschale:
Die im
Gemeindefinanzierungsgesetz verankerte Schul- und Bildungspauschale
ist seit dem Jahr 2022 um 129 Millionen Euro angehoben worden, dies
entspricht einer Steigerung von 17,2 Prozent. Im Jahr 2026 wird die
Pauschale vorläufig auf 877 Millionen Euro erhöht. Die endgültige
Höhe der Pauschale wird im Rahmen der Ergänzung des
Gemeindefinanzierungsgesetzes feststehen.
Startchancen-Programm:
Das Startchancen-Programm wird weiter
ausgestaltet. In diesem Zusammenhang werden Mittel aus dem Bereich
der Sachausgaben in den Bereich der Personalausgaben und Zuweisungen
verlagert. Der Gesamtansatz des Startchancen-Programms bleibt bei
rund 128,9 Millionen Euro. Davon werden künftig 2 Millionen Euro im
Rahmen des Chancenbudgets für kulturelle Bildung eingesetzt. Es
werden 101 Planstellen zur Entlastung der
Startchancen-Schulen für Schulentwicklungsprozesse geschaffen.
Zuweisungen und Zuschüsse:
Das Land ist den Kommunen auch
weiterhin ein verlässlicher Partner und erfüllt die sogenannten
Konnexitätsverpflichtungen im Zusammenhang mit der Umstellung von G8
auf G 9 an den Gymnasien vollumfänglich. Zur Unterstützung der
Schulträger und Schulen werden mit dem Haushalt des kommenden Jahres
rund 220,4 Millionen Euro zur Verfügung gestellt – das sind rund
70,5 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.
Auswertung zum Tag der Deutschen Einheit: Weiter
Lohngefälle zwischen West und Ost – Mindestlohn hat
Angleichungsprozess in den letzten zehn Jahren beschleunigt
Auch 35 Jahre nach der Deutschen Einheit besteht bei den Löhnen noch
eine beträchtliche Ost-West-Lücke. Während Vollzeitbeschäftigte in
Westdeutschland im Jahr 2024 durchschnittlich 4.810 Euro brutto im
Monat verdienten, waren es in Ostdeutschland nur 3.973 Euro
monatlich – ein Unterschied von 17,4 Prozent.
Insgesamt gab
es in den vergangenen Jahren aber einige Fortschritte: Seit 2014
ist die Lohnlücke zwischen West und Ost um 7,0 Prozentpunkte kleiner
geworden, während sich die Löhne in Ostdeutschland in den Jahren
davor nur im Schneckentempo an das Westniveau heranbewegt hatten.
So war die Lohnlücke von 1999 bis 2014 gerade einmal um 1,6
Prozentpunkte zurückgegangen. Das ergibt eine Auswertung des
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der
Hans-Böckler-Stiftung zum Tag der Deutschen Einheit auf Basis von
Daten des Statistischen Bundesamtes.
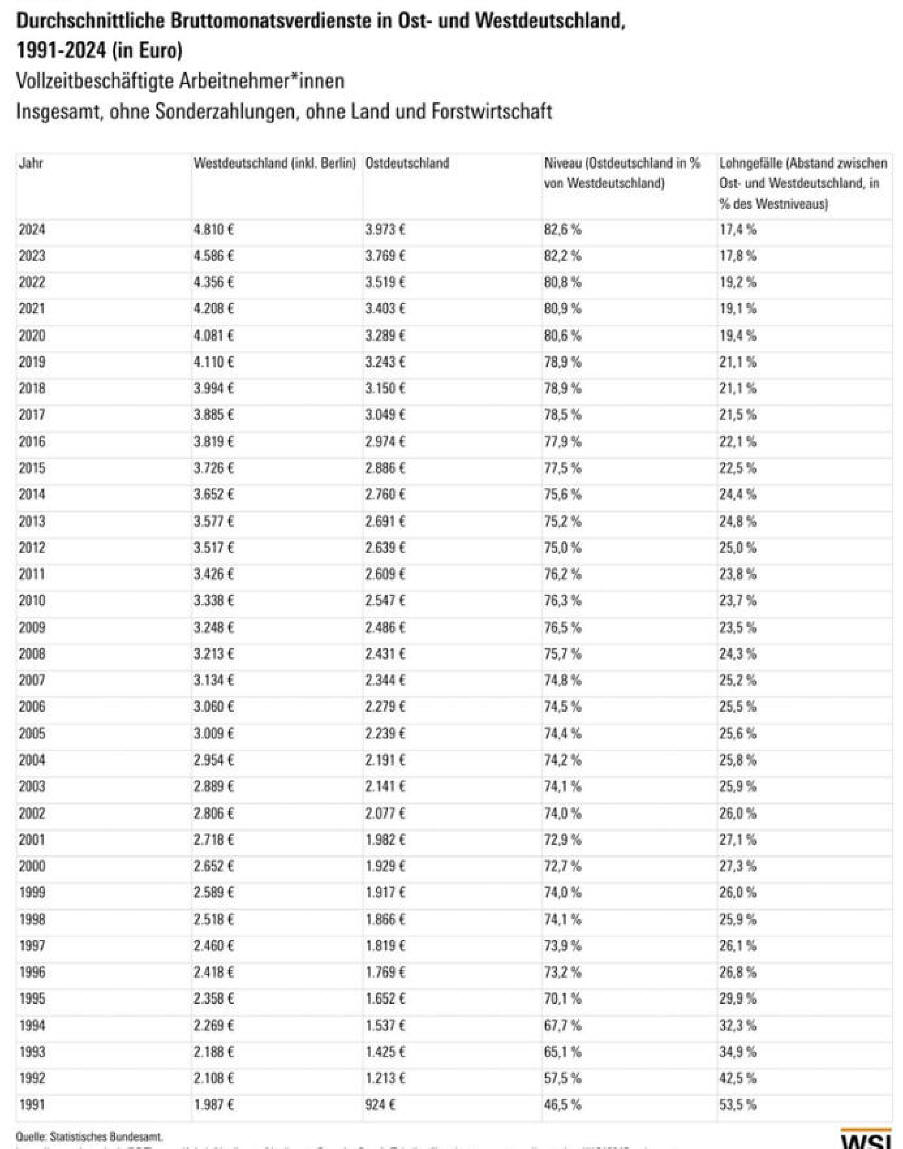
Eine wesentliche Ursache für die Fortschritte sehen die
Forschenden im Mindestlohn, der im Jahr 2015 deutschlandweit
eingeführt wurde. „Beschäftigte in den ostdeutschen Bundesländern
haben vom Mindestlohn überdurchschnittlich häufig profitiert – und
zwar einfach, weil sich hier in den Jahren nach der Wende ein
besonders großer Niedriglohnsektor ausgebreitet hatte“, so Dr. Malte
Lübker, Entgeltexperte am WSI. „Die Erhöhung des Mindestlohns auf 12
Euro im Oktober 2022 hat die Lohnentwicklung in Ostdeutschland noch
einmal zusätzlich unterstützt.“
Am unteren Ende der
Lohnverteilung gibt es mittlerweile kaum noch Ost-West-Unterschiede:
Die Stundenlöhne am 1. Dezil, das das untere Zehntel der
Lohnverteilung von Rest abgrenzt, lagen im April 2024 in
Ostdeutschland bei 12,87 Euro, oder gerade einmal 1,0 Prozent unter
dem Westniveau von 13,00 Euro.
Im Jahr 2014, also vor
Einführung des Mindestlohns, betrug der Ost-West-Abstand am 1. Dezil
noch 17,5 Prozent. Die bereits beschlossene Erhöhung des
Mindestlohns auf 13,90 Euro zum 1. Januar 2026 und auf 14,60 Euro
zum 1. Januar 2027 dürfte einen weiteren Beitrag zur Angleichung der
Löhne leisten.

Für die breite Mehrheit der Beschäftigten, deren Entgeltniveau
über dem Mindestlohn liegt, führt der Weg zu besseren Löhnen über
Tarifverträge. „Mit Tarifvertrag sind die Löhne in vergleichbaren
Betrieben etwa 10 Prozent höher, als wenn der Tarifvertrag fehlt“,
so Lübker. Bei der Höhe der Tariflöhne ist der innerdeutsche
Angleichungsprozess inzwischen weitgehend abgeschlossen.
Viele Tarifverträge – etwa im Bankgewerbe, bei der Bahn oder der
Telekom – gelten einheitlich im gesamten Bundesgebiet. Andere
Branchen – wie etwa der Einzelhandel oder die Metall- und
Elektroindustrie – verhandeln zwar hingegen regional, so dass
zwischen Ost und West oder auch zwischen Süd und Nord Unterschiede
bestehen. Allerdings sind die eher gering: Insgesamt liegt das
Tarifniveau in Ostdeutschland derzeit bei 98,5 Prozent des
Westniveaus.
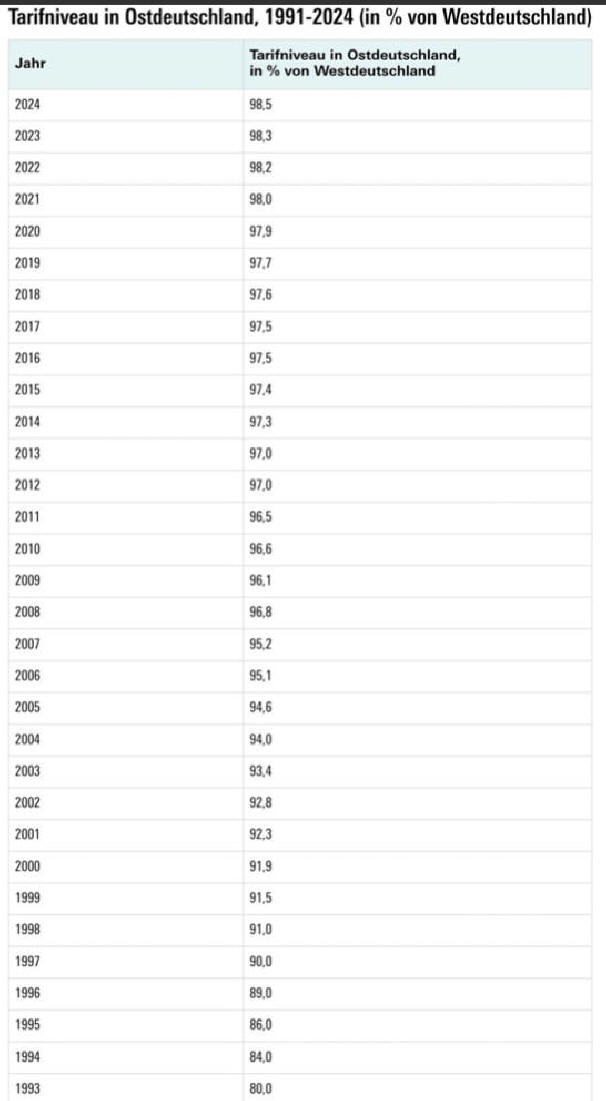
Quelle WSI-Archiv
Zulasten der ostdeutschen Beschäftigten
wirkt jedoch, dass die Tarifbindung nach Berechnungen des Instituts
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Ostdeutschland mit
41,7 Prozent deutlich unterhalb des Wertes für Westdeutschland (50,0
Prozent) liegt. Gleichzeitig unterbieten viele tariflose Arbeitgeber
in Ostdeutschland die Tarifstandards besonders deutlich.
Aufgrund von Strukturunterschieden gibt es auch zwischen den
einzelnen Bundesländern teilweise deutliche Lohnunterschiede. So
liegen die Stundenlöhne in Schleswig-Holstein (22,15 Euro) derzeit
17,6 Prozent unterhalb des westdeutschen Spitzenreiters Hamburg
(26,88 Euro). Das entspricht in etwa dem Lohn-Gap von 18,2 Prozent,
der bei den Stundenlöhnen zwischen West (26,56 Euro) und Ost (22,00
Euro) besteht.

Quelle Statistisches Bundesamt-Verdiensterhebung 2024 - WSI
„In Deutschland gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen,
bleibt eine wichtige Aufgabe“, sagt Prof. Dr. Bettina Kohlrausch,
Wissenschaftliche Direktorin des WSI. „Die Gewerkschaften haben hier
Pionierarbeit geleistet und eine Angleichung der Tariflöhne zwischen
Ost und West weitgehend durchgesetzt. Die Tarifbindung zu stärken,
auch durch politische Maßnahmen wie wirksame Tariftreuegesetze, ist
ein Beitrag zur inneren Einheit und zum gesellschaftlichen
Zusammenhalt.“
MSV Duisburg – FC Hansa Rostock: DVG setzt zusätzliche
Busse ein
Für Gäste des Fußballspiels MSV Duisburg gegen
den FC Hansa Rostock am Freitag, 3. Oktober, um 19 Uhr in der
Schauinsland-Reisen Arena, setzt die Duisburger Verkehrsgesellschaft
AG (DVG) die Sportlinie 945 ein.
Abfahrtszeiten Buslinie 945
Richtung MSV Arena:
· ab „Salmstraße“ (Meiderich) Abfahrt um
17.06, 17.16, 17.26 Uhr
· ab „Bergstraße“ um 17.11, 17.21 und
17.31 Uhr
· ab „Meiderich Bahnhof“ ab 17.15 bis 17.40 Uhr alle
fünf Minuten
· ab „Großenbaum Bahnhof Ost“ um 17.50 und 17.05 Uhr
· ab „Betriebshof am Unkelstein“ ab 16.58 bis 17.23 Uhr alle fünf
Minuten
· ab „Hauptbahnhof“ (Verknüpfungshalle) ab 17.15 bis
18.35 Uhr alle fünf Minuten
· ab „Businesspark Nord“ (Asterlagen)
um 17.33 Uhr

DVG-Foto
Nach Spielende stehen am Stadion Busse für die Rückfahrt bereit.
Gäste des Fußballspieles, die eine Tageseintrittskarte im Vorverkauf
erworben haben oder eine Dauerkarte besitzen, können kostenlos die
öffentlichen Verkehrsmittel für die Hin- und Rückfahrt benutzen. Für
die Gäste, die sich an der Stadionkasse ihre Eintrittskarte kaufen,
ist die Rückfahrt mit Bus und Bahn kostenlos.
Stadtmuseum: Wendezeit in Duisburg – Wie die Einheit ankam
Anlässlich des 35. Jahrestags der Deutschen Einheit am 3.
Oktober lädt das Kultur- und Stadthistorische Museum,
Johannes-Corputius-Platz 1 am Duisburger Innenhafen, um 15 Uhr zu
einer besonderen Führung ein: Unter dem Titel „Wendezeit in Duisburg
– Wie die Einheit ankam“ führt Harald Küst durch die wechselvollen
Jahre nach 1989 und fragt: Was lief gut bei der Wiedervereinigung –
und was hätte besser sein können?
Im Mittelpunkt stehen die
unterschiedlichen gesellschaftlichen Reaktionen zwischen
Aufbruchsstimmung und Skepsis – mit einem besonderen Blick auf
Duisburg. Die Führung bietet spannende Einblicke in die
Herausforderungen der Einheit und schlägt den Bogen von der
historischen Erfahrung zu aktuellen Fragen des Zusammenlebens.
Die Teilnahme ist im Museumseintritt enthalten und kostet für
Erwachsene 4,50 Euro, für Kinder und ermäßigt 2 Euro. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich. Das vollständige Programm ist im Internet
unter www.stadtmuseumduisburg.de abrufbar
Schaurige
Halloweenparty im Kinder- und Jugendzentrum „Die Mühler“
Zu Halloween veranstalten mehrere städtische Kinder- und
Jugendzentren (das Kinder- und Jugendzentrum „Die Mühle“, die
Abenteuerfarm Robinson, das Kinder- und Jugendzentrum Rumeln und das
Regionalzentrum Süd „Sunny“) am Freitag, 24. Oktober, von 16 bis 19
Uhr im Kinder- und Jugendzentrum „die Mühler“ auf der
Clarenbachstraße 14 in RheinhausenFriemersheim eine große, schaurige
Halloweenparty für Kinder und Jugendliche.
Eingeladen sind
alle Kinder, Hexen, Monster, Werwölfe und andere schreckliche Wesen
ab dem Grundschulalter. Die Kinder können sich sowohl auf eine
Gruselstrecke als auch auf eine grauenvolle Party mit vielen
schrecklichen Spielen in der Mühle freuen. Auch auf dem Außengelände
finden fürchterliche Aktionen statt. Der Eintritt ist kostenfrei.
Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Kostüme sind erwünscht. Für das
leibliche Wohl wird mit einem vielfältigen Buffett gesorgt.

Kinder der Deutschen Einheit: 36 % der 35-Jährigen haben
Einwanderungsgeschichte
Am 3. Oktober feiert
Deutschland 35 Jahre Deutsche Einheit. Wer im Jahr der Einheit
geboren wurde, feiert dieses Jahr als “Kind der Einheit” seinen 35.
Geburtstag. Wie sieht das Leben in Deutschland mit 35 Jahren aus?
Mehr als ein Drittel (36 %) der 35-Jährigen in Deutschland hatte im
Jahr 2024 eine Einwanderungsgeschichte – sie oder ihre Eltern sind
also ins jetzt vereinte Deutschland eingewandert, wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt.
In der gesamten
Bevölkerung hatte ein gutes Viertel (26 %) der Menschen eine
Einwanderungsgeschichte. 29 % der 35-Jährigen in Deutschland sind
selbst in das vereinte Deutschland eingewandert. Bis auf
Ausnahmefälle haben sie im Jahr der Deutschen Einheit 1990 noch
nicht in Deutschland gelebt.

56 % der 35-Jährigen leben mit Kindern
zusammen
Mehr als die Hälfte (56 %) aller 35-Jährigen lebte 2024
mit minderjährigen Kindern zusammen. Bei 35-jährigen Frauen waren es
sogar zwei Drittel (66 %), bei Männern etwas weniger als die Hälfte
(46 %). Mehr als die Hälfte (54 %) der 35-Jährigen war verheiratet
oder in einer Lebenspartnerschaft.
Überdurchschnittlich hoher
Anteil mit akademischem Abschluss
Akademische Abschlüsse sind in
dieser Altersgruppe deutlich häufiger als in der Gesamtbevölkerung
vertreten. Ein Drittel (34 %) der 35-Jährigen hatte 2024 eine
abgeschlossene Lehre oder Berufsausbildung, ein weiteres Drittel
einen Hochschulabschluss (34 %) und 13 % hatten einen
Fachschulabschluss. Jeder und jede fünfte 35-Jährige (20 %) hatte
(noch) keinen beruflichen Abschluss. Demgegenüber hatten 41 % aller
Personen ab 15 Jahren eine Lehre oder Berufsausbildung absolviert,
21 % einen Hochschulabschluss, 12 % einen Fachschulabschluss und 27
% waren (noch) ohne beruflichen Abschluss.
35-jährige Männer
häufiger erwerbstätig als Frauen im selben Alter
35-Jährige
stehen mitten im Berufsleben: 85 % von ihnen waren 2024
erwerbstätig, Männer darunter häufiger (90 %) als Frauen (79 %). Ein
Grund für diese Unterschiede ist die geschlechterspezifische
Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit. Diese spiegelt sich auch in
der Teilzeitquote wider: Jede zweite 35-jährige Frau (50 %)
arbeitete 2024 in Teilzeit, bei den Männern waren es 8 %.
Vollzeitbeschäftigte 35-Jährige verdienten im April 2024 im Schnitt
4 555 Euro brutto (ohne Sonderzahlungen). Der durchschnittliche
Verdienst von Männern (4 635 Euro) lag über dem der Frauen (4 370
Euro) dieser Altersgruppe. Damit liegen die 35-Jährigen insgesamt
etwas unter dem Durchschnittsverdienst aller Vollzeitbeschäftigten
(4 634 Euro). 35-jährige Frauen hingegen lagen gut 150 Euro über dem
durchschnittlichen Verdienst aller vollzeitbeschäftigten Frauen in
Deutschland (4 214 Euro).
Zwei Drittel wohnen zur Miete
Knapp zwei Drittel (64 %) der 35-Jährigen in Deutschland wohnten
2024 zur Miete, deutlich mehr als in der Gesamtbevölkerung (53 %).
Durchschnittlich gaben Haushalte mit 35-Jährigen ein Viertel (25 %)
ihres verfügbaren Haushaltseinkommens für Wohnkosten aus und lagen
damit im Schnitt der Gesamtbevölkerung.
Leipzig hat höchsten
Anteil 35-Jähriger
Deutschlandweit machten Ende 2024 die 1,1
Millionen 35-Jährigen 1,4 % der Gesamtbevölkerung aus. Ein Vergleich
der zehn größten Städte Deutschlands zeigt: An der jeweiligen
Bevölkerungszahl gemessen lebten die meisten 35-Jährigen in Leipzig
(1,9 %), gefolgt von Berlin, München und Frankfurt am Main (jeweils
1,8 %).
35 Jahre Deutsche Einheit: Erwerbstätigkeit von
Frauen seit 1991 um 30 % gestiegen
• Verdienste 2024 im Westen
um 21 % höher als im Osten
• Stärkstes Wachstum: Thüringen
steigert Wirtschaftskraft pro Kopf seit 1991 um 163 %
•
Sonderseite des Statistischen Bundesamtes bündelt Statistiken zum
Jubiläum 35 Jahre Deutsche Einheit
Am 3. Oktober feiert
Deutschland 35 Jahre Deutsche Einheit. Die Erwerbstätigkeit von
Frauen ist seit dem Jahr nach der deutschen Vereinigung 1991
bundesweit um 30 % gestiegen, wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) mitteilt. Waren 1991 mehr als die Hälfte (57 %) der
Frauen erwerbstätig, lag die Erwerbstätigenquote von Frauen im Jahr
2024 bei knapp drei Vierteln (74 %).
In den östlichen
Bundesländern und Berlin lag sie 1991 mit zwei Dritteln (66 %) höher
als in den westlichen Ländern mit mehr als der Hälfte (54 %). Im
Jahr 2024 hat sich die Erwerbstätigkeit von Frauen in Ost und West
angeglichen (jeweils 74 %).
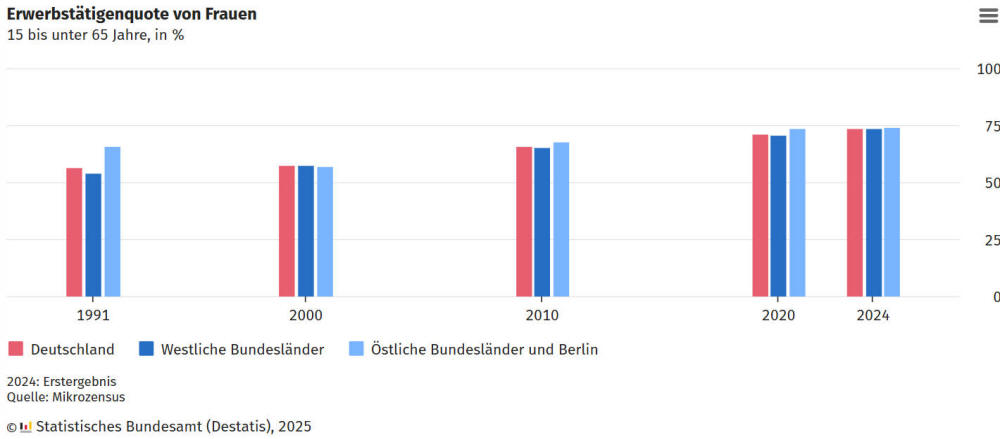
Frauen in Bayern und Sachsen am häufigsten erwerbstätig
Im
Vergleich der Bundesländer war der Anteil der erwerbstätigen Frauen
im Jahr 2024 mit 77 % in Bayern und Sachsen am höchsten, gefolgt von
Baden-Württemberg mit 76 %. Anteilig die wenigsten erwerbstätigen
Frauen gab es in Bremen (67 %), im Saarland (70 %) und in Berlin
(71 %) – dort, wo die Erwerbstätigenquoten insgesamt ebenfalls am
unteren Rand liegen.
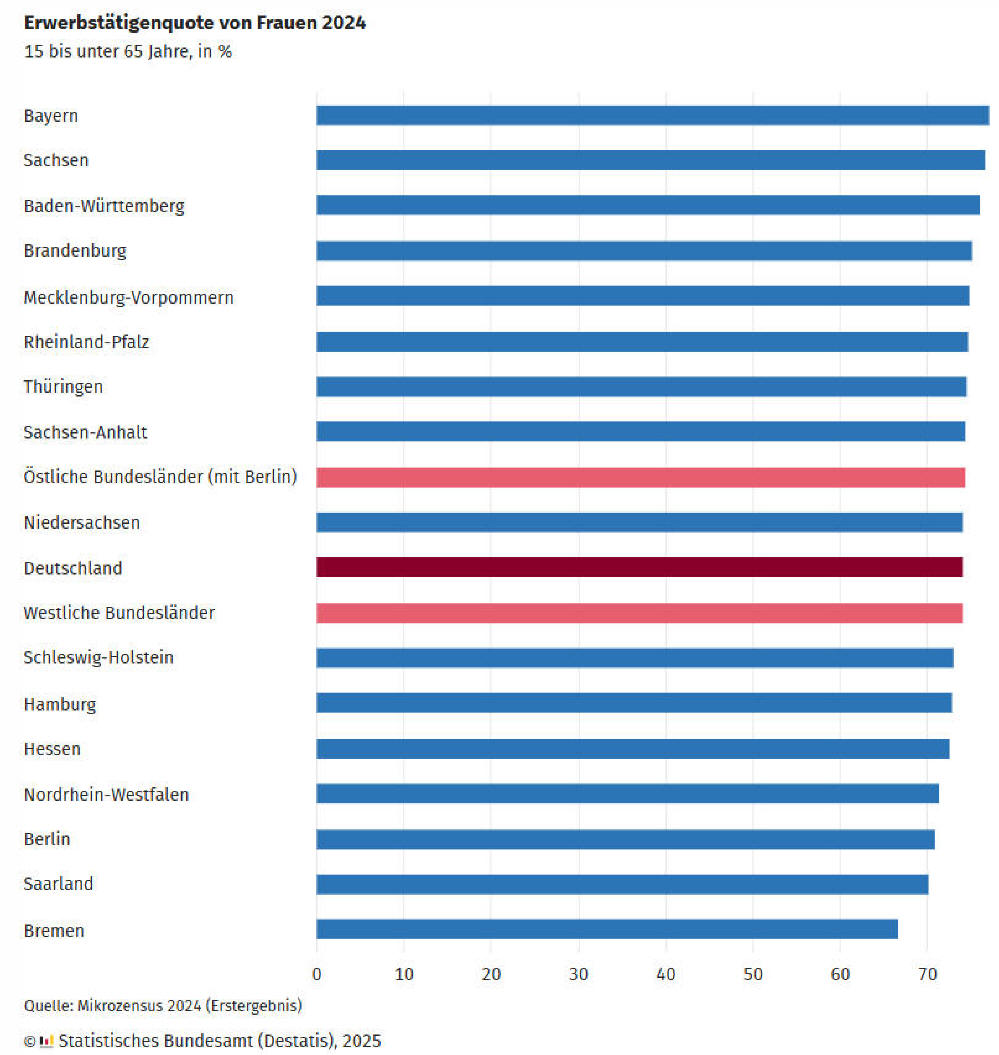
Gender Pay Gap im Osten niedriger
Der Verdienstabstand pro
Stunde von Frauen und Männern, der Gender
Pay Gap, war 2024 im Osten niedriger als im Westen. Der
unbereinigte Gender Pay Gap lag im Jahr 2024 deutschlandweit bei
16 %. In den westlichen Bundesländern und Berlin lag er bei 17 %,
während er in den östlichen Bundesländern mit 5 % deutlich geringer
ausfiel.
Der Gender Pay Gap für Ost und West liegt erstmal
für das Jahr 2006 vor. Damals betrug er in den westlichen
Bundesländern und Berlin 24 %, in den östlichen Bundesländern 6 %
und in Deutschland insgesamt 23 %.
Verdienste 2024 im Westen
im Schnitt 21 % höher als im Osten
Bei den Verdiensten gab
es im Jahr 1991 deutliche Unterschiede zwischen Ost und West. Im
Jahr 2024 gab es weiterhin einen Verdienstunterschied, der jedoch
geringer war. 1991 lagen die durchschnittlichen
Bruttomonatsverdienste vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer in den östlichen Bundesländern bei 924 Euro, in den
westlichen Ländern (mit Berlin-West) bei 1 987 Euro – mehr als
doppelt so hoch.
Im Jahr 2024 konnten Vollzeitbeschäftigte
in den westlichen Ländern (mit Berlin) ihren Verdienst mit
durchschnittlich 4 810 Euro gegenüber 1991 mehr als verdoppeln.
Vollzeitbeschäftigte in den östlichen Ländern konnten ihren
Bruttomonatsverdienst in diesem Zeitraum mehr als vervierfachen und
verdienten 2024 im Schnitt 3 973 Euro. Damit lag der Verdienst im
Westen im Jahr 2024 immer noch um gut ein Fünftel (21) höher als im
Osten. Die Verdienste beziehen sich auf durchschnittliche
Bruttomonatsverdienste im Produzierenden Gewerbe und im
Dienstleistungsbereich ohne Sonderzahlungen.
Wirtschaftskraft
pro Kopf seit 1991 um 40 % gestiegen
Die Wirtschaft in
Deutschland ist seit 1991 gewachsen. Insbesondere in den östlichen
Bundesländern sind seit 1991, gemessen am preisbereinigten
Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Einwohnerin und Einwohner, große
Aufholeffekte zu beobachten. Thüringen verzeichnete darunter mit
+163 % die deutlichste Steigerung des preisbereinigten BIP pro Kopf
zwischen 1991 und 2024, Schleswig-Holstein mit +17 % die geringste.
Das vereinte Deutschland hat seine Wirtschaftskraft seit
1991 pro Kopf um 40 % gesteigert. Im Jahr 2024 betrug das BIP je
Einwohnerin und Einwohner in Deutschland 50 819 Euro. Das höchste
BIP pro Kopf hatten Hamburg (84 486 Euro), Bremen (59 785 Euro) und
Bayern (58 817 Euro). Die niedrigsten Werte gab es in Sachsen-Anhalt
(36 517 Euro), Thüringen (36 942 Euro) und Mecklenburg-Vorpommern
(37 656 Euro).