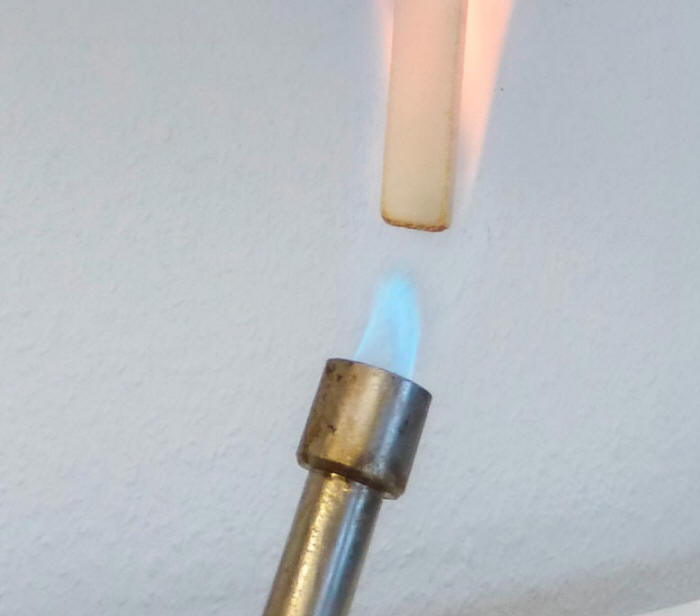|
•
BZ-Sitemap
Redaktion Harald Jeschke
2025
•
2024 •
2023
• 2021/2022
•
2020
•
2019
|
|
|
|
Hochleistungscompound auf Basis von PLA |
|
Verbundprojekt - Biobasierter
Hochleistungskunststoff für die Elektroindustrie
Duisburg/Oberhausen, 12. Februar 2026 - Kunststoffe sind für
die Elektroindustrie essenziell – sie isolieren und schützen
und müssen daher z. B. wärmeformbeständig, flammgeschützt
oder mechanisch robust sein. Derzeit kommen dafür vorwiegend
fossil-basierte Kunststoffe wie Polyamide oder Polycarbonate
zum Einsatz, es fehlen biobasierte Alternativen. Im gerade
gestarteten zweijährigen Verbundprojekt »HighTechPLA«
entwickelt Fraunhofer UMSICHT zusammen mit Partnern* ein
biobasiertes Hochleistungscompound auf Basis von
Polymilchsäure (PLA).
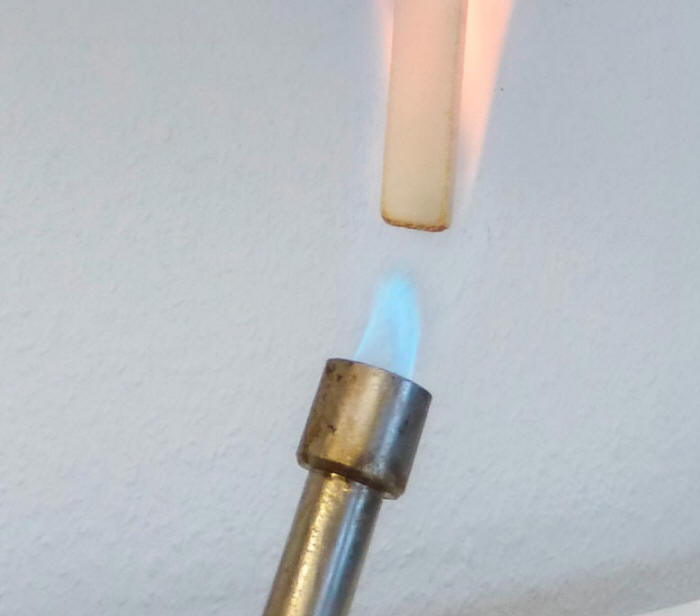
Brennbarkeitstest © Fraunhofer UMSICHT
Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt
In Deutschland werden jährlich rund 1 Millionen Tonnen
Kunststoffe im Elektro-/Elektronikbereich verarbeitet. Der
Großteil ist fossil-basiert, Rezyklate kommen hier eher
geringfügig zum Einsatz. Eine biobasierte Alternative, die in
der Elektroindustrie einsetzbar wäre, könnte enorm dazu
beitragen, eine CO2-Neutralität bis 2050 zu erreichen. Die
große Herausforderung ist es, biobasierte Kunststoffe mit
spezifischen, sich gegenseitig beeinflussenden Funktionen,
auszustatten, sie für technische Anwendungen
weiterzuentwickeln und für konventionelle Spritzgießverfahren
wirtschaftlich kompatibel zu machen.
Vom Struktur-Eigenschaftsmodell bis hin zu marktreifen
Produkten
Im Verbundprojekt »HighTechPLA« entwickelt das Projektteam
einen Hochleistungswerkstoff auf Basis von PLA für
elektronische Bauteile. Das Konsortium vereint Expertise aus
Forschung und Industrie aus den Bereichen
Werkstoffentwicklung, Spritzguss und Produktionsentwicklung.
Ziel ist es zunächst, ein tiefgreifendes Verständnis der
Struktur-Eigenschaftsbeziehungen in PLA-Compounds zu
erlangen, um so Zielkonflikte zwischen
Kristallisationsverhalten, Schlagzähigkeit und Flammschutz
systematisch zu lösen.
Ein Struktur-Eigenschaftsmodell soll es dann ermöglichen,
Rezepturen und Prozesse praxisnah zu simulieren und in realen
Produktionsanlagen zu validieren. Die enge Verzahnung von
Material- und Verfahrensentwicklung soll Zykluszeiten mit
konventionellen Prozessen vergleichbar halten.
»Wir zielen darauf ab, dass Projektergebnisse schnell in
marktreife Produkte transferiert werden können. Die
Ergebnisse haben zudem das Potenzial, auf andere Branchen
ausgeweitet zu werden«, erklärt Christina Eloo, Abteilung
Circular and Bio-based Plastics bei Fraunhofer UMSICHT.
Das Projekt »HighTechPLA« wird im Auftrag und aus Mitteln des
Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt
gefördert.
|
|
Ökobilanzierung - Kanalsanierung: Ökobilanzierung Analyse
belegt: Grabenlose Kanalsanierung (Inliner-Verfahren)
deutlich umweltfreundlicher
|
|
Oberhausen/Duisburg, 4. Februar 2026
- Fraunhofer UMSICHT analysierte für die Firmen RelineEurope
GmbH und Impreg GmbH die Umweltwirkungen, die bei der
Sanierung von Abwasserohren entstehen. Dazu verglich das
Institut mittels Ökobilanzierung die Sanierung von
Abwasserrohren durch das Liner-Verfahren (CIPP:
Cure-in-Place-Pipe) mit dem Austausch der Rohre durch neue
Betonrohre.

© IMPREG Sanierter Abwasserkanal durch das Inliner-Verfahren
In Deutschland gibt es rund 600 000 Kilometer Abwasserrohre.
35 Prozent sind älter als 65 Jahre, sodass zahlreiche
Reparaturen und Sanierungen jetzt bzw. in naher Zukunft
notwendig sind. Das Liner-Verfahren ermöglicht eine
grabenlose Sanierung der Abwasserrohre. Dazu werden die noch
nicht ausgehärteten und somit noch flexiblen Liner wie
Schläuche durch die bestehenden Kanalschächte in das
beschädigte Rohr eingebracht, dann von innen mithilfe von
Druckluft an die alte Rohrwandung angepresst und mit UV-Licht
vor Ort ausgehärtet.
Das Wandmaterial ist ein glasfaserverstärkter Kunststoff
(GFK) bestehend aus ungesättigtem Polyester-Harz und
Glasfasern, das für Transport und Montage in thermoplastische
Kunststofffolien (z.B. PE, PE oder PVC) eingeschlossen wird.
Liner-Verfahren weist bessere Umweltbilanz auf Fraunhofer
UMSICHT erstellte die Umweltbilanzen für die
unterschiedlichen Methoden der Kanalsanierung.
Das Gesamtergebnis: Die Umweltwirkungen lassen sich durch das
Liner-Verfahren im Vergleich zum Austausch der Betonrohre auf
die Hälfte reduzieren. Zum Beispiel sind die
Treibhausgasemissionen zwischen 54 und 77 Prozent geringer –
abhängig vom Durchmesser der Rohre und der konkreten
Einbausituation. Auch weitere Wirkungskategorien der
Ökobilanz zeigen deutliche Vorteile.
Das Institut betrachtete in seiner Analyse die
Wertschöpfungsschritte: Rohstoffe, Herstellung (Energiebedarf
und Abfall), Transport, Installation und End-of-life. »Die
positiven Effekte entstehen weniger bei der Herstellung der
Liner, sondern insbesondere durch die verringerten
Umwelteffekte aufgrund eines geringeren Installationsaufwand
bei der Kanalverlegung« erläutert Dr. Jan Blömer, Abteilung
Nachhaltigkeitsmanagement und Partizipation bei Fraunhofer
UMSICHT.
In der Regel sind keine Erdbewegungen nötig, die
Oberflächenstrukturen (Straßen, Grünanlagen etc.) werden
nicht beschädigt und müssen demzufolge auch nicht
wiederhergestellt werden. Ein weiterer Vorteil – der in
dieser Ökobilanz nicht berücksichtigt wurde: Die Sanierung
mittels Liner-Verfahren dauert nur ein bis zwei Tage, sodass
sich die Belastung für die Anwohner und Verkehrsteilnehmer
minimiert.
|
|
Fahrrad im Winter tabu? Gazelle nimmt 3 Mythen unter
die Lupe |
|
München/Duisburg, 3. Februar 2026 -
Zu rutschig, zu dunkel, zu kalt –
die Liste der Ausreden für Radfahrer im Winter ist lang. Wenn
die Temperaturen sinken und die Tage kürzer werden, lassen
viele ihr Fahrrad in der Garage stehen. Dabei lohnt sich der
Blick hinter die gängigsten Vorurteile. Bikes im Winter sind
weit weniger problematisch als oft angenommen. Gazelle hat
sich typische Mythen rund um das Winterradeln genauer
angesehen.

© Gazelle
Mythos 1: „Es ist viel zu glatt zum Radfahren“
Die Angst vor Stürzen auf glatten Straßen ist ein häufiger
Grund, das Rad im Winter stehen zu lassen. Tatsächlich
erfordern vereiste Fahrbahnen eine angepasste Fahrweise:
langsamer fahren, vorausschauend agieren und besondere
Vorsicht in Kurven sowie beim Bremsen. Winterreifen mit
größerer Profiltiefe bieten deutlich mehr Grip auf nassen und
verschneiten Untergründen. Wer diese Punkte beachtet, kann
auch bei winterlichen Bedingungen sicher unterwegs sein.
Mythos 2: „In der Dunkelheit sieht mich eh keiner“
Schlechte Sichtverhältnisse in der dunklen Jahreszeit sind
eine berechtigte Sorge, aber kein unüberwindbares Hindernis.
Eine angemessene Fahrradbeleuchtung ist ohnehin Pflicht und
sorgt für ausreichende Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Helle
oder reflektierende Kleidung hebt Radfahrer deutlich von der
Umgebung ab. So machen sie sich im Straßenverkehr gut
erkennbar.
Mythos 3: „Mein Fahrrad geht bei den Temperaturen kaputt“
Schmutz, Nässe und Streusalz setzen einem Fahrrad im Winter
stärker zu als in anderen Jahreszeiten. Das bedeutet aber
nicht, dass das Rad die frostigen Temperaturen im Keller
verbringen muss. Wenn Fahrradfahrer ihr Bike trocken lagern
und schützen, haben sie bereits einen wichtigen Schritt
getan. Die Kette sollte häufiger gereinigt und mit Öl für
nasse Bedingungen behandelt werden. Gelenke und Lager
benötigen Pflege und regelmäßiges Fetten. Mit einer
intensiveren Wartung bleibt das Rad auch im Winter
funktionsfähig.
Warum Winterradeln sich lohnt
Auch in der kalten Jahreszeit gibt es viele gute Gründe, aufs
Rad zu steigen. Wer radelt, spart Geld, bleibt fit und stärkt
das Immunsystem durch Bewegung an der frischen Luft. Gerade
im Winter sorgt das Radfahren für einen willkommenen
Ausgleich zum Alltag und hebt die Stimmung. Mit der richtigen
Ausrüstung und etwas Pflege ist das Fahrrad auch bei Frost
ein zuverlässiger Begleiter. Wer sich auf winterliche Fahrten
einlässt, entdeckt neue Seiten am Radfahren und erlebt, wie
viel Freude Touren durch verschneite Landschaften machen.
Fehlt noch das passende Rad? Dann lohnt sich ein Besuch im
Gazelle Testcenter: Hier können Sie ohne Anmeldung und
kostenfrei viele Modelle ausprobieren. So steht dem
Winterradeln nichts mehr im Weg!
|
|
NRW im Wandel: Wissenschaft als
Motor – damals und heute
|
|
Hochkarätige Veranstaltung würdigt
Johannes Rau und diskutiert Zukunftsperspektiven für den
Strukturwandel in Nordrhein-Westfalen
Düsseldorf/Duisburg, 13. Januar 2026 - Wie gelingt
Strukturwandel durch Wissenschaft – damals und heute? Unter
dieser Leitfrage fand am Montag, den 12. Januar 2026, eine
besondere Veranstaltung in der Nordrhein-Westfälischen
Akademie der Wissenschaften und der Künste in Düsseldorf
statt. Anlass war der 20. Todestag von Johannes Rau, dessen
Wirken als Wissenschaftsminister, Ministerpräsident und
Bundespräsident die Wissenschaftslandschaft
Nordrhein-Westfalens nachhaltig geprägt hat.

Die Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft (JRF), die
Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der
Künste (AWK) und die Johannes-Rau-Gesellschaft (JRG) luden
Interessierte aus Wissenschaft, Gesellschaft, Wirtschaft und
Politik ein, um Raus Vision vom „Strukturwandel durch
Wissenschaft“ zu reflektieren und mit Blick auf aktuelle
Herausforderungen weiterzudenken.
Der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen Hendrik
Wüst hob in seiner Keynote die langfristige Bedeutung von
Forschung und Bildung hervor:
„Johannes Rau hat Nordrhein-Westfalen tief geprägt: Als einer
der größten Politiker unseres Landes und als ein Mensch, der
Politik immer in den Dienst des Nächsten gestellt hat. Sein
Leitmotiv ‚Versöhnen statt Spalten‘ war Anspruch und Haltung
zugleich. Er hat zugehört, Brücken gebaut und daran geglaubt,
dass unser Zusammenleben nur gelingt, wenn wir Trennendes
überwinden, ohne Konflikten auszuweichen. Gerade in den
Jahren des tiefgreifenden Strukturwandels hat Johannes Rau
Verantwortung übernommen. Er stand an der Seite der Menschen,
deren Arbeitsplätze und Lebensgrundlagen bedroht waren, und
hat früh erkannt: Bildung, Wissenschaft und Forschung sind
der Schlüssel für neue Chancen und nachhaltigen Wohlstand.
‚Forschung ist der neue Rohstoff Nordrhein-Westfalens‘ –
dieser Gedanke prägt unser Land bis heute, vor allem auf
unserem Weg von der Kohle zur KI. Das Vermächtnis von
Johannes Rau ist von brennender Aktualität. In einer Zeit, in
der Spaltung und Misstrauen wachsen, ist unsere Antwort
Zusammenhalt, Dialog und Versöhnung. Politik kann einen
Unterschied machen. Um die Herausforderungen unserer Zeit
erfolgreich zu meistern, brauchen wir Kooperation statt
Konfrontation. Johannes Raus Wirken verpflichtet uns, den
Wandel kooperativ und immer auf Augenhöhe mit den Menschen zu
gestalten.“
Die Veranstaltung beleuchtete zudem historische Meilensteine
der nordrhein-westfälischen Wissenschaftspolitik und zeigte
ihre Bedeutung für die heutigen Transformationsprozesse auf.
In seinem Impulsbeitrag ging Prof. Dr. Christoph Zöpel (NRW-
und Bundesminister a. D.) auf das Wirken Johannes Raus ein
und ordnete die Universitätsgründungen der 1960er bis 1980er
Jahre und den Strukturwandel der Industrieregionen historisch
und faktenreich ein. Ergänzt wurde das Programm durch
Videostatements ehemaliger NRW-Wissenschaftsminister*innen
Anke Brunn, Gabriele Behler, Hannelore Kraft, Prof. Dr.
Andreas Pinkwart und Svenja Schulze.
In einer Podiumsdiskussion diskutierten anschließend Ina
Brandes MdL, Ministerin für Kultur und Wissenschaft des
Landes Nordrhein-Westfalen, Prof. Dr. Birgitta Wolff, Bodo
Middeldorf, Prof. Dr. Dieter Bathen und Prof. Dr. Gerd Heusch
unter der Moderation von Prof. Dr. Uwe Schneidewind über die
Rolle von Wissenschaft, Forschung und Innovation für die
Transformation im Rheinischen Revier und im Ruhrgebiet.
Wissenschaftsministerin Ina Brandes betonte:
„Johannes Rau hat früh erkannt, dass Wissenschaft der Motor
für Innovation und damit für einen erfolgreichen
Strukturwandel ist. Dieses Verständnis ist aktueller denn je.
Exzellente Forschung ‚made in NRW‘ trägt dazu bei, die großen
Herausforderungen unserer Zeit zu meistern, Wohlstand für
alle zu schaffen und zu erhalten. Dazu brauchen wir starke
Netzwerke wie die Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler finden hier ein
exzellentes außeruniversitäres Netzwerk, das ihre Forschung
nah an der Anwendung noch besser macht.“
Prof. Dieter Bathen, Vorstandsvorsitzender der JRF,
unterstrich die anwendungsnahe Rolle der JRF in
Nordrhein-Westfalen:
„Johannes Raus Idee, Wissenschaft in den Dienst des Wandels
zu stellen, lebt in der JRF fort. Unsere JRF-Institute
erzeugen Wissen dort, wo es gebraucht wird, und leisten mit
ihrer Transferexzellenz einen unmittelbaren Beitrag zum
Strukturwandel in NRW. Sie verbinden wissenschaftliche
Expertise mit praxisorientierten Lösungen für Wirtschaft,
Verwaltung und Gesellschaft. Damit leistet die JRF einen
einzigartigen Beitrag im Wissenschaftssystem
Nordrhein-Westfalens.“
Auch die gastgebende Nordrhein-Westfälische Akademie der
Wissenschaften und der Künste stellte die Bedeutung von
Dialog und Erkenntnis heraus. Ihr Präsident, Prof. Dr. Gerd
Heusch, erklärte:
„Johannes Rau hat die Wissenschaft in NRW und auch unsere
Akademie geprägt: Er war an unserer Gründung beteiligt und 20
Jahre Vorsitzender unseres Kuratoriums. Sein Erbe prägt die
Wissenschaftslandschaft in NRW bis heute. Die Diskussion
darüber ist deshalb keine Nostalgie. Die Akademie beschäftigt
sich vielmehr mit der Frage, was aus diesem Vermächtnis für
die Zukunft folgen und wie die Akademie weiterentwickelt
werden sollte.“
Abgerundet wurde die Veranstaltung durch Dankesworte von
Christina Rau sowie einem Empfang, der den Teilnehmenden Raum
für Austausch und Vernetzung bot. Der Abend machte deutlich:
Nordrhein-Westfalen steht erneut an einem Wendepunkt – und
Wissenschaft bleibt der Schlüssel, um Wandel erfolgreich zu
gestalten.
|
|
ME.LAK: Gemeinsam für die
Stadtreinigung der Zukunft
|
|
Duisburg, 9. Januar 2026 - In Duisburg
entsteht derzeit ein innovatives Projekt für die
Stadtreinigung der Zukunft: Mit „ME.LAK – Menschenzentrierte
Entwicklung einer autonomen Kehrmaschine und Leitstelle“
entwickeln die Wirtschaftsbetriebe Duisburg gemeinsam mit
Partnern aus Industrie, Wissenschaft und IT eine autonome,
vollelektrische Kehrmaschine.
Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg stehen als Konsortialführer
einem Zusammenschluss von insgesamt fünf Partnern vor und
koordinieren und steuern das gesamte Projekt. Das Projekt
läuft seit dem 1. Mai 2025 und wird durch das Ministerium für
Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie NRW mit
Mitteln aus dem EFRE/JTF-Programm 2021-2027 gefördert.
Vollautomatisierte Reinigung – sicher, effizient und
emissionsfrei
Im Mittelpunkt von ME.LAK steht die Entwicklung einer
autonomen, vollelektrischen Kehrmaschine nach SAE-Level 4.
SAE-Level 4 beschreibt dabei ein Automatisierungslevel bei
dem das Fahrzeug in klar definierten Einsatzbereichen alle
Fahr- und Reinigungsaufgaben selbstständig ausführt.
Das Fahrzeug soll künftig den gesamten Arbeitsprozess – vom
Laden über den Reinigungsvorgang bis zur Entleerung –
eigenständig durchführen können. Über eine von geschulten
Remote-Pilotinnen und -Piloten besetzte Leitstelle wird der
Betrieb überwacht und bei Bedarf unterstützt.
Impulse für eine moderne Stadtreinigung
Die Stadtreinigung steht vor großen Veränderungen:
Fachkräftemangel erschwert die Besetzung von Kehrmaschinen,
körperliche Belastungen mindern die Attraktivität des Berufs
und gleichzeitig steigen die Anforderungen an digitale und
effiziente Arbeitsprozesse.
ME.LAK setzt genau hier an: Das Projekt verbindet
technologische Innovation mit einer Weiterentwicklung der
Arbeitswelt. Neue digitale Unterstützungsangebote,
ergonomischere Abläufe und zusätzliche Tätigkeitsprofile
sollen die Beschäftigten entlasten und langfristige
Perspektiven schaffen.
Die Ziele des Projekts
Ziel von ME.LAK ist eine autonome, vollelektrische
Kehrmaschine, die den gesamten Arbeitsprozess selbstständig
ausführt: reinigen, laden, entleeren und interne
Reinigungsschritte durchführen. Das Fahrzeug soll mit seiner
Umgebung interagieren und seine nächsten Fahr- und
Arbeitsmanöver verständlich kommunizieren. Reinigungsrouten
werden softwaregestützt geplant und angepasst.
Herzstück des Systems ist eine menschenzentrierte Leitstelle,
in der Remote-Pilotinnen und -Piloten den Betrieb überwachen
und bei Bedarf eingreifen. Dadurch entsteht zugleich ein
neues, inklusives Berufsbild, das zusätzliche
Beschäftigungsmöglichkeiten bietet.
„ME.LAK zeigt, wie wir kommunale Dienstleistungen
zukunftsfähig gestalten können: durch intelligente
Automatisierung, neue Berufsbilder und eine
menschenzentrierte Perspektive. Besonders stolz bin ich auf
die interdisziplinäre Zusammenarbeit in diesem Konsortium –
hier kommen Expertise, Kreativität und praktische Erfahrung
zusammen. So entsteht ein System, das nicht nur effizienter
und nachhaltiger ist, sondern auch bessere Arbeitsbedingungen
schafft. Wir sind überzeugt: Was hier in Duisburg entsteht,
kann vielen Kommunen in Deutschland und Europa neue Wege
aufzeigen," ist Thomas Patermann, Sprecher des Vorstands der
Wirtschaftsbetriebe Duisburg, für das gesamte Konsortium
sicher.
Interdisziplinäres Konsortium
Damit eine autonome Kehrmaschine Realität werden kann,
braucht es Expertise aus vielen unterschiedlichen Bereichen:
Fahrzeugtechnik, Softwareentwicklung, Psychologie, Logistik,
Stadtverwaltung und operative Stadtreinigung. ME.LAK vereint
diese Kompetenzen in einem interdisziplinären Konsortium, in
dem Forschung, Industrie und kommunale Praxis eng
zusammenarbeiten. Die beteiligten Partner bringen ihr
spezifisches Know-how ein und entwickeln gemeinsam ein
ganzheitliches System, das über Duisburg hinaus
Modellcharakter haben kann.
Wirtschaftsbetriebe Duisburg: Die Wirtschaftsbetriebe
Duisburg leiten das Projektkonsortium, koordinieren die
Zusammenarbeit der Partner und stellen die notwendige
Infrastruktur bereit. Sie testen die Entwicklungen unter
realen Bedingungen der Stadtreinigung und verantworten
rechtliche Vorgaben sowie Öffentlichkeitsarbeit und
Bürgerkommunikation.
Schotte Automotive GmbH & Co. KG: Schotte Automotive
entwickelt die automatisierte Betriebsstätte und eine
benutzerfreundliche Leitstelle zur Überwachung und
Teleoperation der Kehrmaschine. Die Systeme werden
schrittweise getestet und für den Einsatz optimiert.
Universität Duisburg-Essen (UDE): Die Universität
Duisburg-Essen begleitet das Projekt wissenschaftlich. Sie
entwickelt Sicherheitskonzepte, untersucht Akzeptanz und
Nutzerverhalten und analysiert Mensch-Maschine-Interaktionen.
Zudem unterstützt sie die Gestaltung der Leitstelle und
begleitet Testphasen im nichtöffentlichen und öffentlichen
Raum.
Krankikom GmbH: Krankikom entwickelt die zentralen
Kommunikationsschnittstellen zwischen Fahrzeug, Leitstelle
und Umfeld. Das Unternehmen gestaltet zudem die
Nutzeroberflächen und erforscht, wie die Kehrmaschine ihre
Absichten verständlich kommuniziert. Alle Systeme werden im
Prototyp erprobt.
Bucher Municipal (Enway): Bucher Municipal entwickelt die
autonomen Fahrfunktionen der Kehrmaschine, inklusive präziser
Navigation und automatischem Anfahren von Lade- und
Entleerstationen. In Praxistests werden diese Funktionen
kontinuierlich weiterentwickelt.
Vom Prototyp zu Tests unter Realbedingungen
In den kommenden Monaten stehen weitere vorbereitende
Arbeiten, detaillierte Entwicklungsphasen und vertiefende
Planungen an, um den Weg für den praktischen Einsatz zu
ebnen. Mitte 2026 sind erste Tests vorgesehen, die in einem
gesicherten Bereich auf einem der Betriebshöfe der
Wirtschaftsbetriebe durchgeführt werden. Auf Grundlage dieser
Erkenntnisse soll im Jahr 2027 der Testbetrieb auf den
betrieblichen Flächen der Wirtschaftsbetriebe starten.
Langfristig bietet das System das Potenzial, in städtische
Smart-City-Strategien eingebunden und auf andere Kommunen
übertragen zu werden. Das Projekt ME.LAK läuft insgesamt bis
zum 30. April 2028.
|
|