






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 23. Kalenderwoche:
5. Juni
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Freitag, 6. Juni 2025
Duisburg-Bruckhausen: Brand in einer Dachgeschosswohnung
Die Feuerwehr Duisburg wurde am Freitagmittag gegen
14.21 Uhr durch mehrere Anrufe über einen Brand in einer
Dachgeschosswohnung auf der Reinerstraße in Duisburg-Bruckhausen
informiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte, war eine starke
Rauchentwicklung aus der Dachgeschosswohnung zu erkennen.
Es
befanden sich keine Personen in der Wohnung. Die Feuerwehr leitete
sofort die Brandbekämpfung ein und konnte durch schnelles und
gezieltes Handeln, eine Ausbreitung des Brandes verhindern.
Der Einsatz war um ca. 15.30 Uhr beendet. Insgesamt waren 28 Kräfte
der Berufsfeuerwehr, 19 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr sowie vier
Einsatzkräfte des Rettungsdienstes vor Ort. Die Brandursache ist
noch unklar und wird durch die Polizei ermittelt.
Duisburg ehrte
sportliche Spitzenleistungen: 64 Auszeichnungen für das Sportjahr
2024

Übersicht der geehrten
Sportlerinnen und Sportler - Foto Studio Duisburg
Gruppe C Photography
Die Stadt Duisburg
ehrte am 4. Juni im Studio Duisburg bei der diesjährigen
Sportlerehrung 64 Athletinnen und Athleten für ihre sportlichen
Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene, sowohl im Einzel-
als auch im Mannschaftssport. Die Auszeichnung gilt auch in diesem
Jahr als Wertschätzung für den lokalen Sport und gibt sportlicher
Vielfalt und herausragenden Leistungen eine sichtbare Bühne.
Die Auszeichnungen überreichten Oberbürgermeister Sören Link und
Werner von Häfen, Vorsitzender des Betriebsausschusses
DuisburgSport, persönlich, verbunden mit anerkennenden Worten an die
Sportlerinnen und Sportler.
„Was diese Sportlerinnen und
Sportler verbindet, ist nicht nur ihr Erfolg – sondern der lange,
oft stille Weg dorthin. Wer über Jahre hinweg Zeit und Energie in
seinen Sport investiert, tut das meist neben Schule, Ausbildung oder
Beruf – mit großer Disziplin und bemerkenswertem Durchhaltevermögen.
Als Stadt ist es uns ein besonderes Anliegen, diese Leistungen
sichtbar zu machen. Sie bedeuten weit mehr als Medaillen oder
Platzierungen: Sie erzählen von Menschen, die für etwas brennen –
und das kann uns alle inspirieren“, so Oberbürgermeister Sören Link.

64 Auszeichnungen für das Sportjahr 2024 (Sportlerehrung)
Studio Duisburg Gruppe C Photography
Bei der
Sportlerehrung führte Moderator Danny Pabst durch den Abend. Neben
Gesprächen mit den Geehrten und Einblicken in ihre Sportarten und
Erfolge, sorgte ein künstlerisches Rahmenprogramm mit
LED-Performance und Akrobatik für abwechslungsreiche Unterhaltung
des Publikums. Ausgezeichnet wurden insgesamt 64 Athletinnen und
Athleten für Ihre Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene,
sowohl im Einzel- als auch im Mannschaftssport.
Wasserstraßen müssen wieder uneingeschränkt funktionieren
Der Duisburger SPD-Landtagsabgeordnete Frank Börner hat für
seine Fraktion den
Antrag „NRW muss funktionieren: Funktionierende Wasserstraßen statt
Stillstand“ ins Parlament eingebracht und auf die enorme
Bedeutung der Wasserstraßen in Nordrhein-Westfalen hingewiesen. Denn
sowohl die NRW-Wirtschaft als auch die Menschen sind auf intakte
Wasserstraßen, insbesondere den Rhein und das westdeutsche
Kanalnetz, als Transport- und Versorgungswege angewiesen.

Der Verkehrspolitiker erklärt: „Die Binnenschifffahrt und die
Binnenhäfen sind unverzichtbar für Transport, Lagerung und Umschlag
von Rohstoffen, Energieträgern und Kraftstoffen und bilden das
Rückgrat des Industriestandortes im Ruhrgebiet. Die
Industriebetriebe sind von zentraler Bedeutung sowohl für die
Wertschöpfung als auch als Arbeitgeber für viele Familien.
Damit leistet die Binnenschifffahrt nicht nur einen großen Beitrag
für die Versorgung von Unternehmen und Bevölkerung, sondern ist ein
wichtiger Standortfaktor. Die Landesregierung muss daher aus eigenem
Interesse an unserem Wirtschaftsstandort die Belange von Häfen und
Wasserstraßen stärker in den Fokus rücken und die NRW-Interessen bei
der Bundesregierung vertreten.“
Die Wasserstraßen sind
elementare Versorgungsadern in NRW und darüber hinaus. Jährlich 33
Millionen Tonnen Güter im Kanalnetz und 137 Millionen Tonnen auf dem
Rhein zeigen, wie unverzichtbar das System Wasserstraße für die
heimische Wirtschaft und die Versorgung der Bevölkerung im
bevölkerungsreichten Bundesland ist. NRW ist zwingend auf in Stand
gehaltene Infrastruktur, also Kanäle, Schleusen, Brücken, Häfen und
Schifffahrtswege angewiesen.
Hinzu kommt, dass die Wasser-
und Schifffahrtsverwaltung unter einem erheblichen Personalmangel
leidet, was zu weiteren Verzögerungen bei den notwendigen Planungen
und Umsetzungen führt. In der Binnenschifffahrt selbst herrscht ein
gravierender Fachkräftemangel. Nachwuchs für Ausbildungsberufe in
der Schifffahrt sind kaum zu gewinnen, der Altersdurchschnitt der
Beschäftigten steigt stetig. Ohne gezielte Gegenmaßnahmen droht ein
realer Ausfall von Transportkapazitäten.
Der
Binnenschifffahrtsexperte Frank Börner: „Das Land
Nordrhein-Westfalen muss daher ein großes Interesse daran haben,
gemeinsam mit dem Bund als Betreiber der Bundeswasserstraßen für die
Instandhaltung und die Sanierung der maroden Teile der Infrastruktur
zu sorgen. Außerdem fordern wir ein Ausbildungsförderungsprogramm
für die Binnenschifffahrt NRW sowie zeitig greifende Maßnahmen gegen
den Fachkräftemangel einzubringen. Nur so können wir es schaffen,
dass die Wasserstraßen zukünftig uneingeschränkt funktionieren.“
Frühling an Emscher und Lippe fiel deutlich zu
trocken aus
Sowohl der Mai 2025 als auch der
meteorologische Frühling in diesem Jahr (März, April und Mai) fielen
zu trocken aus – das ist das Ergebnis der Niederschlagsauswertungen
der beiden Wasserwirtschaftsverbände Emschergenossenschaft und
Lippeverband. In beiden Verbandsgebieten landet der Mai unter den
Top 20 der trockensten Mai-Monate seit 1931.
Im
Emscher-Gebiet fielen im Mittel 35,3 mm Niederschlag (langjähriges
Mittel: 60 mm) und im Lippe-Gebiet 34,5 mm (langjähriges Mittel: 58
mm). Es fiel damit jeweils nur knapp über die Hälfte des
langjährigen Mittels. Zur Einordnung: Ein Millimeter entspricht
einem Liter pro Quadratmeter.
Beinahe der gesamte
Monatsniederschlag fiel in der Zeit vom 23. bis zum 31. Mai.
Zwischen dem 25. April und dem 23. Mai sind lediglich 0,7 mm
Niederschlag im Mittel im Emscher-Gebiet gefallen. Im Lippe-Gebiet
waren es in diesem Zeitraum nur 1,0 mm. Am 23. Mai endete also eine
etwa vierwöchige Trockenphase.
Das Monatsmittel der
Lufttemperatur liegt mit 14,9 Grad Celsius über dem langjährigen
Mittel von 14,1 Grad Celsius.
Der meteorologische Frühling
(März, April und Mai) war ebenfalls deutlich zu trocken. Im
Emscher-Gebiet fielen im Mittel 112,5 mm Niederschlag. Das
entspricht dem zwölfttrockensten Frühling seit 1931. Im Lippe-Gebiet
lag das Gebietsmittel im Frühling bei 100,0 mm. Damit liegt der
Frühling 2025 mit Rang 8 sogar unter den zehn trockensten Frühjahren
ab 1931 im Lippe-Gebiet.
Das Monatsmittel der Lufttemperatur
lag in allen drei Frühlingsmonaten über dem langjährigen Mittel. Der
März lag mit 7,6 Grad über ein Grad über dem langjährigen Mittel von
6,3 Grad. Im April lag mit 12,0 zu 9,9 Grad sogar eine Differenz von
2,1 Grad vor. Der Mai lag, wie bereits erwähnt, 0,8 Grad über dem
langjährigen Mittel (14,9 gegenüber 14,1).
Emschergenossenschaft und Lippeverband
Emschergenossenschaft und
Lippeverband (EGLV) sind öffentlich-rechtliche
Wasserwirtschaftsunternehmen, die als Leitidee des eigenen Handelns
das Genossenschaftsprinzip leben. Die Aufgaben der 1899 gegründeten
Emschergenossenschaft sind unter anderem die Unterhaltung der
Emscher, die Abwasserentsorgung und -reinigung sowie der
Hochwasserschutz.
Der 1926 gegründete Lippeverband
bewirtschaftet das Flusseinzugsgebiet der Lippe im nördlichen
Ruhrgebiet und baute unter anderem den Lippe-Zufluss Seseke naturnah
um. Gemeinsam haben Emschergenossenschaft und Lippeverband rund
1.800 Beschäftigte und sind Deutschlands größter Abwasserentsorger
und Betreiber von Kläranlagen und Pumpwerken (rund 782 Kilometer
Wasserläufe, rund 1533 Kilometer Abwasserkanäle, 546 Pumpwerke und
59 Kläranlagen). www.eglv.de
Verleihung der Ehrennadel der Stadt Duisburg
Oberbürgermeister Sören Link verleiht zum zweiten Mal
die Ehrennadel der Stadt Duisburg. Mit der Nadel werden langjährige
Verdienste um das gesellschaftliche Leben und das bürgerschaftliche
Miteinander gewürdigt. Diese hohe Auszeichnung erhalten am Dienstag,
10. Juni 2025, um 17 Uhr im Rathaus Duisburg, Prof. Dr. Dr.
Karl-Rudolf Korte und Prof. Dr. Ulrich Radtke.
Prof. Dr. Dr.
Karl-Rudolf Korte, früher Professor an der Universität
DuisburgEssen, ist unter anderem durch sein außergewöhnliches
Engagement an der Universität Duisburg-Essen und vielen weiteren
Projekten bekannt geworden.
Prof. Dr. Ulrich Radtke
wechselte 2008 als Rektor an die Universität Duisburg-Essen. In
seiner Amtszeit bis 2022 wurde er als Hochschulmanager des Jahres
2015 durch „DIE ZEIT“ ausgezeichnet und erzielte für die Universität
zahlreiche Erfolge in Form von Publikationen, Zitationen und
Positionen in internationalen Rankings.
AG 60+
besucht den Landtag
Der Duisburger SPD-Abgeordnete
Frank Börner empfing in dieser Plenarwoche zahlreiche Mitglieder der
AG60+ aus Duisburg. Die Senioren konnten auf der Besuchertribüne die
Debatte zum Antrag der SPD-Fraktion zum bestehenden Investitionsstau
live verfolgen.
Thematisch setzten sich die Punkte marode
Infrastruktur und fehlende Investitionen in NRW sowie der allseits
spürbare Fachkräftemangel auch in der sich anschließenden
Diskussionsrunde mit Frank Börner fort. Der Abgeordnete erklärt:
„Duisburg steht vor enormen Herausforderungen. Nur durch konkrete
Investitionen aus dem Sondervermögen Infrastruktur lassen sich die
zentralen Herausforderungen z. B. in die Verkehrsinfrastruktur,
Bildung und klimafreundlicher Stadtentwicklung wirksam angehen.“

Foto B+ro Börner
Börner dankt der Vorsitzenden der AG60+,
Hannelore Richter, die leider nicht am Besuch teilnehmen konnte, für
die gute Vorbereitung und den Genossinnen und Genossen für den
angeregten Austausch.
DMB-Vorstand Tenbieg:
„Mittelstand hätte sich mehr Mut bei der Steuersenkung erhofft“
Der am 4. Juni vom Kabinett beschlossene
Gesetzesentwurf zur steuerlichen Entlastung von Unternehmen ist aus
Sicht des Deutschen Mittelstands-Bunds (DMB) ein Schritt in die
richtige Richtung. Verbandschef Marc S. Tenbieg lobt insbesondere
die Umsetzungsgeschwindigkeit. Bei der Steuersenkung wäre allerdings
mehr Mut wünschenswert gewesen. Zudem gilt es, neben dem wichtigen
Thema Investitionen weitere Entlastungsschritte für Unternehmen
zügig umzusetzen.
Tenbieg führt aus: „Positiv hervorzuheben
ist, dass die neue Bundesregierung ihr Versprechen aus dem
Koalitionsvertrag heute im Kabinett auf den Weg gebracht hat. Dass
dies zügig und ohne Störgeräusche passiert ist, ist ein positives
Signal an die Unternehmen. Schwarz-Rot zeigt sich handlungsfähig und
hat erkannt, dass es unmittelbare Investitions- und Wachstumsimpulse
für Unternehmen braucht. Der ‚Booster‘ schafft Planungssicherheit
für diejenigen, die aktuell investieren können.
Mehr Mut
hätte es beim Thema Steuersenkungen gebraucht, denn hier wären
krisengebeutelte Unternehmen direkter entlastet worden. Ich
kritisiere vor allem, dass die Reduzierung der Körperschaftsteuer
erst in drei Jahren wirksam wird und damit vom politischen Willen
einer neuen Bundesregierung abhängig ist. Hier wäre mehr Eile
geboten gewesen, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit des
deutschen Mittelstands zu verbessern.
Leider verkennt der
aktuelle Gesetzesentwurf von Schwarz-Rot die Dringlichkeit, die für
die Betriebe tagtäglich zu spüren ist. Dennoch kann das
Gesetzespaket als Schritt in die richtige Richtung gewertet werden.
Nun müssen schnell weitere folgen: Der DMB erhebt seit Jahren mit
seinem Mittelstands-Index die drängendsten Herausforderungen von
Unternehmen. Hier rangieren die Themen Steuersenkungen und
Investitionen regelmäßig hinter den Top-Themen Bürokratieabbau und
Energiekosten.“
UDE und UK Essen:Dual studieren:
Bachelor of Nursing
Die Gesundheitsversorgung steht vor
großen Aufgaben: Die Bevölkerung wird immer älter, Krankheitsbilder
verändern sich, und neue Technologien prägen immer stärker das
Gesundheitswesen. An Fachkräfte im Gesundheitswesen stellt das hohe
Ansprüche. Die Universität Duisburg-Essen und das Uniklinikum Essen
bieten daher ab dem kommenden Wintersemester gemeinsam den dualen
Studiengang Bachelor of Nursing (B.Sc.) an.
30
zulassungsfreie Studienplätze stehen zur Verfügung, die mit einem
Ausbildungsvertrag am Klinikum gekoppelt und tariflich bezahlt sind.
Bewerbungen sind ab sofort bis zum 15. August 2025 möglich.

Neuer BA-Studiengang Pflegewissenschaften startet am UK Essen.
(Foto: Medizinische Fakultät / André Zelck)
Das Studium
kombiniert Theorie- und Übungsphasen an der Medizinischen Fakultät
der Uni mit einer praktischen Ausbildung am Universitätsklinikum.
Nach acht Semestern erhalten die Absolvent:innen zwei Abschlüsse:
den akademischen Grad Bachelor of Science und die Anerkennung als
staatlich anerkannte Pflegefachkraft.
Dass Universität und
Uniklinikum gemeinsam ausbilden, macht den „Bachelor of Nursing“
besonders attraktiv: Theoretisches Wissen wird im SkillsLab
praktisch erprobt und in den Kliniken der Maximalversorgung vertieft
– etwa in der Onkologie, Herz-Kreislauf-Medizin oder
Transplantation. Auch Auslandsaufenthalte sind im 6. Semester
möglich.
„Wir bieten ein Studium, das zukünftigen
Pflegefachpersonen auf eine evidenz-basierte Pflege und Begleitung
von Menschen aller Altersgruppen vorbereitet. Es gibt von Anfang an
Einsätze in der Praxis, dadurch erleben die Studierenden eine enge
Verzahnung von Wissenschaft praktischer Umsetzung. Dies ermöglicht
es ihnen, in verschiedenen Settings wie der Akutpflege, der
Langzeitpflege oder ambulanten Versorgungsarrangements zu arbeiten
und in interprofessionellen Teams zu tätig zu sein.“ sagt Prof. Dr.
Erika Sirsch.
„Mit unserem Bachelorstudium qualifizieren wir
unsere Studierenden für eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der
Gesundheitsversorgung von morgen. Sie werden mit ihren
Fachkenntnissen und Kompetenzen aktiv beteiligt sein und die
Möglichkeit haben, sich in Masterprogrammen weiter zu qualifizieren.
Unsere Absolvent:innen sind somit nicht nur qualifizierte
Pflegefachpersonen, sie können innovativ die Gesundheitsversorgung
der Zukunft mitgestalten.“
Wer sich für den akkreditierten
Studiengang bewerben möchte: Voraussetzung ist die allgemeine oder
fachgebundene Hochschulreife. Aber auch Pflegefachpersonen mit
Berufserfahrung können über einen verkürzten Quereinstieg in das
Programm aufgenommen werden.
https://medizindidaktik.uk-essen.de/angebote-fuer-studierende/pflegewissenschaft
Citizen Science-Projekt „DNA macht Schule“ Was lebt in
meinem Bach?
In NRW stehen bald Schüler:innen der
Grundschule und der Oberstufe an Bächen ihrer Umgebung. Im Projekt
DNA macht Schule der
Universität Duisburg-Essen nehmen sie Wasserproben und untersuchen
den Zustand der Gewässer. Dabei liefern sie auch Daten, die
behördliche Beobachtungen ergänzen können. Am 2. Juni war der
offizielle Projektstart des vom Umweltbundsamtes finanzierten
Projekts. Lehrkräfte können ihre Klassen oder Kurse jetzt
anmelden.

Projektlogo. © UDE
Junge Menschen für Natur und Wissenschaft
begeistern und
nützliche Daten gewinnen. Diesen Ansatz
verfolgt das Citizen Science-Projekt DNA macht Schule. Kinder aus
der Grundschule und Schüler:innen der gymnasialen Oberstufe in NRW
untersuchen in dem Projekt ein schulnahes Fließgewässer. Dort
beurteilen sie die Gewässerstruktur, also beispielsweise, wie der
Bach verläuft und wie seine Umgebung aussieht. Und sie verschaffen
sich einen Überblick über die dort lebenden Tiere, indem sie u. a.
Steine umdrehen und die Arten bestimmen. Aber nicht alle Lebewesen
lassen sich leicht entdecken.
Hier kommt die innovative
Forschungsmethode DNA-Metabarcoding in Spiel: Sie funktioniert wie
ein Barcode-Leser, der auch kleinste Lebewesen anhand genetischer
Spuren im Wasser identifizieren kann. Forscher:innen der Aquatischen
Ökosystemforschung der Universität Duisburg-Essen (UDE) analysieren
die Gewässerproben der Schüler:innen und erstellen Listen der
nachgewiesenen Arten.
Diese werden vom Biology Education
Research and Learning Lab, kurz BERLL, für die Auswertung in der
Schule aufbereitet und in ein Unterrichtskonzept eingebunden. Mit
den Ergebnissen können die Schüler:innen Rückschlüsse auf die
Lebensgemeinschaften und den ökologischen Zustand ihres Gewässers in
Schulnähe ziehen. Die so gewonnen Daten sind auch für die
Gewässerforschung sowie Behörden interessant, denn über den
ökologischen Zustand vieler kleiner Fließgewässer in NRW gibt es nur
wenige Informationen.
Entsprechend des Citizen
Science-Ansatzes, auch Bürgerwissenschaften genannt, arbeiten
Bürger:innen, hier Schüler:innen und Lehrkräfte, und
Wissenschaftler:innen Hand in Hand. Junge Menschen können ihr
Bewusstsein und Interesse für den Schutz dieser fließenden
Ökosysteme weiterentwickeln sowie moderne Forschungsmethoden
kennenlernen. Gleichzeitig entstehen relevante Daten für
Wissenschaft und Behörden. Das Projekt wird durch das
Umweltbundesamt finanziert.
Das Kick-off-Treffen fand am 2.
Juni im Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und
nukleare Sicherheit (BMUKN) in Berlin statt. Hier präsentierten und
diskutierten die Projektbeteiligten aus Wissenschaft, Schule,
Umweltbundesamt und Bundesministerium die Projektpläne und -ziele.
Weitere Informationen und Anmeldung:
www.dna-macht-schule.de
KI-Schulpreis prämiert Einsatz von Künstlicher
Intelligenz an Schulen Bewerbungen noch bis 10. Oktober unter
www.ki-schulpreis.de möglich.
Deutschland – Land der
Ideen, die Deutsche Telekom Stiftung und die Dieter Schwarz Stiftung
rufen Schulen in ganz Deutschland zur Teilnahme
am KI-Schulpreis auf. Der Wettbewerb zeichnet Schulen aus, die
Künstliche Intelligenz (KI) innovativ im Unterricht nutzen,
beispielsweise in der Schulorganisation oder zur Unterstützung von
Lehrkräften und Schüler:innen.
Ziel ist es, durch
wegweisende Konzepte andere Schulen zu inspirieren und den Blick auf
die Chancen von KI in der Bildung zu lenken. Die prämierten Schulen
werden als bundesweite Vorreiter im Bereich KI sichtbar gemacht und
bei einer feierlichen Abschlussveranstaltung am 16. Januar 2026 auf
dem Bildungscampus Heilbronn geehrt. Neben der öffentlichen
Würdigung und der Möglichkeit, wertvolle Kontakte zu knüpfen,
erwarten die Gewinner Geldpreise im Gesamtwert von 100.000 Euro.

Jetzt bewerben! Noch bis 10. Oktober 2025 können sich Primar- und
Sekundarschulen mit Sitz in Deutschland in zwei Kategorien
bewerben:
KI-Gesamtkonzept: Schulen, die KI strategisch und
umfassend in verschiedenen Bereichen einsetzen – etwa im Unterricht,
zur Förderung von Inklusion oder zur Automatisierung administrativer
Aufgaben.
KI-Teilkonzept: Schulen, die KI gezielt in einem
bestimmten Fachbereich oder für einen klar definierten
Anwendungsfall nutzen – beispielsweise zur Bereitstellung
individueller Lernangebote oder für Pilotprojekte.
Weitere
Informationen sowie Text- und Bildmaterial zur redaktionellen
Verwendung finden Sie unter www.ki-schulpreis.de.
Über die
Initiative Deutschland – Land der Ideen
2006 anlässlich der
Fußball-WM von der Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft
gegründet ist Land der Ideen die Plattform für gute Ideen in
Deutschland. Gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft, Politik,
Wissenschaft und Gesellschaft realisiert Deutschland – Land der
Ideen Ideenwettbewerbe, Publikationen, Ausstellungen, virtuelle
Formate und internationale Dialoge, darunter aktuell das Ostdeutsche
Wirtschaftsforum (OWF) und das afrikanisch-deutsche Young Leaders
Programme AGYLE.
Über die Deutsche Telekom Stiftung
Die
Deutsche Telekom Stiftung will mit ihren Aktivitäten die
MINT-Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen verbessern. Dazu
gehören auch das Arbeiten in der Kultur der Digitalität und das
Lernen mit und über Künstliche Intelligenz. Sie will die
Bildungschancen junger Menschen erhöhen und konzentriert sich
darauf, dass die Gruppe der leistungsstärksten Schülerinnen und
Schüler größer und die der leistungsschwächsten kleiner wird. Sie
arbeitet mit Schulen und deren Partnern im Bildungsökosystem
zusammen und engagiert sich für bessere Rahmenbedingungen im
gesamten Bildungssystem.
Über die Dieter Schwarz Stiftung
Die Dieter Schwarz Stiftung gehört zu den großen Stiftungen in
Deutschland und wird dort tätig, wo Wirtschaft und Gesellschaft
Anforderungen stellen, die staatliche Organe nicht oder nicht
ausreichend erfüllen können. „Bildung fördern, Wissen teilen,
Zukunft wagen“, ist das Credo der Stiftung, die mit ihrem Engagement
heute das fördert, was die Gesellschaft von morgen stark macht: Ein
breites Spektrum an Bildungsangeboten für Menschen in verschiedenen
Lebensphasen.
Digitalisierung und Künstliche Intelligenz inklusiv
gestalten
BAGSO-Stellungnahme zum Regierungsprogramm von CDU,
CSU und SPD
Die BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der
Seniorenorganisationen setzt sich dafür ein, dass die Bedürfnisse
und Rechte älterer Menschen bei der voranschreitenden
Digitalisierung berücksichtigt werden. In ihrer Stellungnahme
„Digitalisierung und Künstliche Intelligenz inklusiv gestalten –
Teilhabe älterer Menschen sichern“ zum Koalitionsvertrag der
schwarz-roten Regierung fordert sie, dass die Digitalisierung allen
zugutekommen muss.
Menschen, die nicht über ausreichende
digitale Kompetenzen oder Unterstützungsangebote verfügen, dürfen
nicht ausgeschlossen werden. Ziel muss es sein, die digitale
Transformation barrierearm, verständlich und generationengerecht zu
gestalten. Im Koalitionsvertrag bekennt sich die Bundesregierung zu
einer Strategie des „digital only“ für Verwaltungsprozesse und
öffentliche Dienstleistungen.
Auch in Gesundheitswesen und
Pflege sollen verstärkt digitale Lösungen umgesetzt werden. Um
hierbei Menschen ohne oder mit geringen digitalen Kompetenzen nicht
auszugrenzen, fordert die BAGSO, dass weiterhin analoge Zugänge
angeboten werden. Zugleich müssen Beratungs- und
Unterstützungsangebote zur Förderung digitaler Kompetenzen ausgebaut
werden. Unter anderem muss der DigitalPakt Alter als gemeinsame
Initiative von Bundesseniorenministerium und BAGSO verstetigt und
weiterentwickelt werden.
Die BAGSO setzt sich für einen
verantwortungsvollen Umgang mit Künstlicher Intelligenz ein. In
ihrer Stellungnahme weist sie auf die Gefahren von
Altersdiskriminierung bei automatisierten Entscheidungen hin, der
entgegengewirkt werden muss. Sie fordert zudem einen starken und
transparenten Datenschutz, um das Vertrauen von Nutzerinnen und
Nutzern in digitale Anwendungen zu erhöhen.
Nach Ansicht der
BAGSO muss die digitale Transformation nicht nur als technisches
Modernisierungsprojekt sondern als gesamtgesellschaftliche
Gestaltungsaufgabe verstanden werden.
Zur Stellungnahme „Digitalisierung und Künstliche Intelligenz
inklusiv gestalten – Teilhabe älterer Menschen sichern“
„Rock vorm Treppchen“ - Open-air-Livemusik in Neudorf
Die Evangelische Kirchengemeinde Hochfeld-Neudorf lädt
mit dem Begegnungs- und Beratungszentrum der Evangelischen Dienste
Duisburg zum Open-Air-Konzert vor dem Gemeindehaus auf der
Gustav-Adolf-Straße 65 in Neudorf. Die Musik-Party mit Snacks und
Getränken steigt am 13. Juni 2025 um 17 Uhr und steht wie im letzten
Jahr unter dem Motto „Rock vorm Treppchen“.
Für Stimmung
sorgen gleich drei Bands: „Les Croûtons (blanc et noir)“ mit
bekannten Pop- und Jazznummern, die Band „Soundsalad“ mit Pop-,
Punk- und Metal-Songs sowie die Formation „100 Kühe“ mit amtlichen
Rockklassikern der 60er und 70er Jahre. Der Eintritt ist frei. Infos
zur Gemeinde gibt es im Netz unter
www.hochfeld-neudorf.de.

Die Band "Soundsalad" beim Konzert "Rock vorm Treppchen" von 2024 in
Neudorf (Foto: Hartmut Hansen).
Hamburger
Michel-Organist in der Duisburger Salvatorkirche zu Gast
Das Orgelfestival Ruhr startet auch in diesem Jahr wieder in der
Duisburger Salvatorkirche. Dort ist am Sonntag, den 15. Juni um 18
Uhr der Organist des Hamburger Michel, Magne Draagen, zu Gast. Er
ist der Herr über eine der größten Anlagen der Welt mit vier (!)
Orgeln.

Foto: Michael Zapf
Entsprechend vielfältig und virtuos wird
das Programm seines Gastkonzertes: Neben Werken von Bach und einer
Transkription von Edvard Grieg spielt der Norweger Werke von Elgar
und Guilmant. Mit „The jazzy fillette“ von Charles Balayer gönnt
sich der vielfach ausgezeichnete Star-Organist auch einen spannenden
Ausflug in den Jazzbereich.
Nach dem einstündigen Konzert
wird bei einem Glas Wein mit dem Künstler geplaudert. Der Eintritt
kostet 12 Euro, Schüler und Studenten sind frei. Karten gibt es nur
an der Abendkasse. Infos zur Konzertreihe gibt es im Netz unter
www.orgelfestival.ruhr, zum Duisburger Konzertort unter
www.salvatorkirche.de.
Rheinhausen-Halle: Abonnement der Theaterspielzeit
2025/2026 „Theater im Rampenlicht“
Die Theaterspielzeit
2025/2026 in der Rheinhausen-Halle rückt näher: Auch in dieser
Theatersaison hat die Veranstaltergemeinschaft, Konzertdirektion
Landgraf und die Bezirksverwaltung Rheinhausen, wieder ein
abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Ab sofort können
Abonnements für die neue Theaterreihe erworben werden. Alle sechs
Vorstellungen beginnen jeweils um 20 Uhr in der Rheinhausen-Halle
auf der Beethovenstraße 20. Der Einlass ist bereits um 19 Uhr.
Das Programm:
•
Für einen heiteren Auftakt sorgt am Montag, 20. Oktober, die Komödie
„Kalter weißer Mann“ von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob, mit
Timothy Peach, Nicola Tiggeler, Andreas Windhuis u. a. Ein
Todesfall, ein Pfarrer und eine trauernde Gesellschaft sorgen mit
hochaktuellen Diskussionen für eine schnelle und sehr unterhaltsame
Komödie.
•
Am Mittwoch, 12. November, geht es weiter mit der Kirchenkomödie
„Kardinalfehler“ von Alistair Beaton und Dietmar Jacobs. Dass diese
satirische Breitseite leichtfüßig und ohne moralisierende Anklage
daherkommt, liegt vor allem am Komödientalent des Autors sowie an
den hervorragenden Schauspielern Gerd Silberbauer, Hans Machowiak,
Susanne Theil und Katrin Filzen.
•
Als vorweihnachtlichen Genuss wird die musikalisch-poetische
AkrobatikShow „Steam“ am Mittwoch, 3. Dezember, aufgeführt. Das
italienische Ensemble Sonics hat sich mit seiner sensationellen
Luftakrobatik einen Namen gemacht. Varieté, Musik und betörende
Lichteffekte verbinden sich zu visueller Poesie, die Zuschauerinnen
und Zuschauer jeden Alters zu verzaubern vermag.
•
Das neue Jahr startet am Montag, 5. Januar 2026, mit der
zweistündigen Bühnenfassung von „Achtsam Morden“, einer
Krimi-Komödie nach dem Bestsellerroman von Karsten Dusse: Um endlich
mehr Zeit für seine Familie zu haben, wird Björn Diemel (gespielt
von Martin Lindow) – wie der Titel verspricht – nach neu erlernten
Prinzipien mit höchster Achtsamkeit zum Morden bereit sein.
•
Geld allein macht nicht glücklich. Das beweist die schwarze Komödie
„Bis dass der Tod“ von Stefan Vögel am Donnerstag, 5. Februar 2026.
Die Unternehmerin Helena, gespielt von Alice von Lindenau, muss auf
schmerzliche Weise erfahren, dass ihr Gatte Gregor sie nur ihres
Vermögens wegen geheiratet hat.
Unter der Regie von
Frank-Lorenz Engel wird den Akteuren Alice von Lindenau, Julian
Boine, Markus Schöttl u. a. viel Raum gelassen, um für einen rundum
gelungenen Spaß zu sorgen. Lutz Hübner und Sarah Nemitz, die zu den
meistgespielten deutschen Theaterautoren gehören, haben für die
Schauspielbühnen ein Stück geschrieben, das nun erstmalig auf
Tournee zu sehen ist.
•
Mit dem Schauspiel „Wunderheiler“ am Dienstag, 21. April 2026, endet
die Theaterspielzeit 2025/2026 in der Rheinhausen-Halle. In dieser
Familienzusammenführung prallen Welten aufeinander: „Was ist besser?
Evidenzbasierte Medizin oder alternative Heilmethoden?“
Volkspark Rheinhausen: Sonntagskonzert mit den „Treuen
Bergvagabunden“
In der Sonntagskonzertreihe im
Musikpavillon des Rheinhauser Volksparks treten am kommenden
Sonntag, 8. Juni, ab 15 Uhr die „Treuen Bergvagabunden“ mit
alternativer Volksmusik auf. Pierre Lavendel und Buddy Diamond sind
das bekannte Rheinhauser Duo. Sie spielen seit 2001 Volkslieder,
Songs aus der Mundorgel sowie Shantys und Sixties-Instrumentals.
Auftritte in zahlreichen Orten Deutschlands, der Schweiz, den
Niederlanden, Belgien und England hinterließen viel Be- und
Verwunderung beim Publikum. Grund dafür ist die Show: sie ist
actiongeladen, witzig, melancholisch und – dank der Rockabilly-,
Swing- und PunkAttitüde der Performer – rau und kraftvoll. Bis 17.
August sind Woche für Woche bei freiem Eintritt wechselnde
Künstlerinnen und Künstler im Musikpavillon zu Gast.
Unterstützt wird die Konzertsaison vom Bauverein Rheinhausen sowie
Förderverein für Kulturund Brauchtumspflege Rheinhausens &
Rumeln-Kaldenhausens. Der Eintritt ist frei. Aktuelle Informationen
auch bei Facebook im Internet:
https://www.facebook.com/SonntagskonzerteRheinhausen/
Weitere Konzerttermine:
15.06.2025 BSW Musikcorps Hohenbudberg
1973
22.06.2025 Männer- und Frauenchor Rumeln
29.06.2025 1.
Akkordeon-Orchester Rheinhausen 1950 e.V.
06.07.2025
Musikvereinigung Du-West DSB e.V.
13.07.2025 Bläsersymphonie der
Abtei Hamborn
20.07.2025 Hafenchor Duisburg
27.07.2025
Shanty Chor Duisburg-WSP NRW
03.08.2025 Musikgruppe „Wahre
Freunde“
10.08.2025 „Heyberg-Musikanten“
17.08.2025 Die
Bergsteirer

Pfarrer Blank am nächsten Freitag in der
Duisburger Kircheneintrittsstelle
Immer freitags können
Unsichere, Kirchennahe oder solche, die es werden möchten, in der
Eintrittsstelle in der Salvatorkirche mit Pfarrerinnen, Pfarrern und
Prädikanten ins Gespräch kommen und über die Kirchenaufnahme reden.
Motive für den Kircheneintritt gibt es viele: Die Suche nach
Gemeinschaft, Ordnung ins Leben bringen oder der Wunsch, Taufen,
Hochzeiten, Bestattungen kirchlich zu gestalten. Aufnahmegespräche
führt das Präsenzteam in der Eintrittsstelle an der Salvatorkirche
immer freitags von 14 bis 17 Uhr. Am Freitag, 6. Juni 2025 heißt
Pfarrer Stephan Blank Menschen in der Südkapelle des Gotteshauses
neben dem Rathaus herzlich willkommen. Infos zur Citykirche gibt es
unter www.salvatorkirche.de.

Mehr als zwei Drittel der im Jahr 2024 errichteten
Wohngebäude heizen mit Wärmepumpen
• Anteil von
Wärmepumpen als primäre Heizung binnen zehn Jahren verdoppelt
•
Baugenehmigungen: 81,0 % der 2024 genehmigten Wohngebäude sollen
primär mit Wärmepumpen heizen
• Produktion von Wärmepumpen im
Jahr 2024 deutlich rückläufig
In immer mehr neuen
Wohngebäuden in Deutschland werden Wärmepumpen zum Heizen genutzt.
Mehr als zwei Drittel (69,4 %) der knapp 76 100 im Jahr 2024
fertiggestellten Wohngebäude nutzen Wärmepumpen zur primären, also
überwiegend für das Heizen eingesetzten Energie.
Gegenüber
2023 stieg der Anteil um rund 5 Prozentpunkte, gegenüber 2014 (31,8
%) hat er sich mehr als verdoppelt, wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) mitteilt. Wärmepumpen kommen vor allem in Ein- und
Zweifamilienhäusern zum Einsatz: In 74,1 % aller 2024
fertiggestellten Ein- und Zweifamilienhäuser wurde eine Wärmepumpe
zur primären Heizenergie genutzt, deutlich seltener war der Einsatz
in Mehrfamilienhäusern (45,9 %).
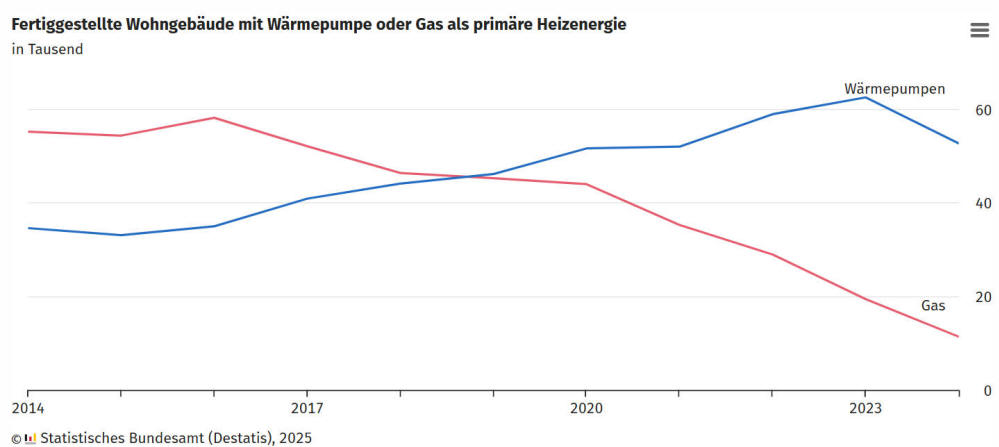
In vier von fünf neuen Wohngebäuden werden erneuerbare
Energiequellen zum Heizen genutzt
Wärmepumpen nutzen zum Heizen
Geo- und Umweltthermie, die zu den erneuerbaren Energiequellen
zählen. Inzwischen wird ein Großteil der neu errichteten Wohngebäude
hierzulande überwiegend mit erneuerbaren Energien beheizt: In 73,9 %
der 2024 fertiggestellten Wohngebäude waren erneuerbare die primäre
Energiequelle für das Heizen. 2014 lag der Anteil noch bei 38,5 %.
Zu den erneuerbaren Energien bei Heizungen zählen neben Erd-
oder Luftwärmepumpen auch Holz, etwa in Pelletheizungen oder
Kaminöfen (Anteil als primäre Heizenergiequelle 2024: 3,6 %),
Solarthermie (0,5 %), Biogas/Biomethan (0,2 %) sowie sonstige
Biomasse (0,2 %). Erneuerbare Energien kommen aber auch als
ergänzende Energiequelle zum Einsatz, beispielsweise durch einen
Holzofen.
Ob als primäre oder sekundäre Quelle – insgesamt
werden erneuerbare Energien 2024 in vier von fünf neuen Wohngebäuden
(82,3 %) zum Heizen genutzt. 2014 lag der Anteil noch bei 61,7 %.
Primär mit Gas wird in 15 % der Neubauten geheizt Als
zweitwichtigste primäre Energiequelle wurde im Jahr 2024 in 15,0 %
der Neubauten Erdgas eingesetzt.
Der Anteil von Gasheizungen
als primäre Energiequelle hat sich binnen zehn Jahren mehr als
halbiert: 2014 hatte er noch bei 50,7 % gelegen. Primär mit
Fernwärme beheizt wurden 8,5 % der neuen Wohngebäude (2014: 7,9 %).
Ölheizungen wurden nur noch in rund 230 neuen Wohnhäusern als
Primärheizung eingesetzt, das waren 0,3 % der Neubauten (2014:
1,2 %).
Mehr als drei Viertel aller genehmigten
Wohnneubauten sollen primär mit Wärmepumpen heizen
Der Trend zum
Heizen mit erneuerbaren Energien zeigt sich auch beim Planen neuer
Wohngebäude. 84,8 % der rund 54 800 im Jahr 2024 genehmigten
Wohngebäude sollen primär mit erneuerbarer Energie beheizt werden.
Meist handelt es sich auch hier um Wärmepumpen: Sie sollen in 81,0 %
der genehmigten Neubauten als primäre Heizung zum Einsatz kommen.
Erdgas als häufigster konventioneller Energieträger spielt mit einem
Anteil von 3,7 % auch bei der Planung von Wohngebäuden eine
zunehmend kleinere Rolle.
Bestehende Gebäude mit Wohnraum
werden mehrheitlich mit Gas beheizt
Bei den bestehenden Gebäuden
mit Wohnraum dominiert Erdgas als primärer Energieträger: Laut
Zensus wurden zum Stichtag 15. Mai 2022 mehr als die Hälfte (53,9 %)
der bestehenden Gebäude mit Wohnraum konventionell mit Erdgas
beheizt. Bei rund einem Viertel (24,7 %) der Gebäude mit Wohnraum
kam Heizöl zum Einsatz.
Erneuerbare Energiequellen zum
Heizen spielen im Gesamtbestand mit einem Anteil von 10,2 % bislang
eine untergeordnete Rolle. Mit Solar- oder Geothermie, Umwelt- oder
Abluftwärme (in der Regel mit Wärmepumpen) wurden 4,2 % der Gebäude
mit Wohnraum beheizt.
Produktion von Wärmepumpen 2024
gegenüber Vorjahr mehr als halbiert
Trotz des zunehmenden
Einsatzes von Wärmepumpen in Neubauten gingen die Produktionszahlen
deutlich zurück und erreichten den niedrigsten Stand innerhalb der
letzten sechs Jahre: Im Jahr 2024 wurden in Deutschland rund 162 400
Wärmepumpen im Wert von 587 Millionen Euro hergestellt. Mengenmäßig
waren das 59,4 % weniger als im Jahr zuvor mit rund 400 100
Wärmepumpen im Wert von 1,2 Milliarden Euro.

Außenhandel mit Wärmepumpen im Jahr 2024 deutlich zurückgegangen
Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich beim Außenhandel mit
Wärmepumpen: 2024 wurden Wärmepumpen im Wert von 755 Millionen Euro
importiert, ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr von wertmäßig 27,9 %.
Im Jahr 2023 wurden Wärmepumpen im Wert von rund 1,0
Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Noch deutlicher gingen
die Exporte von Wärmepumpen zurück: So wurden im Jahr 2024
Wärmepumpen im Wert von 480 Millionen Euro exportiert und damit
40,2 % weniger als noch 2023.
NRW 2024:
3,7 % weniger Betriebs-, Büro- und Verwaltungsgebäude fertiggestellt
* 2.533 neue Nichtwohngebäude fertiggestellt
*
Baukosten steigen um 7 %; Rauminhalt sinkt um 17,5 % gegenüber 2023
* Handels- und Lagergebäude deutlich von Rückgängen betroffen
Im Jahr 2024 wurden in Nordrhein-Westfalen 2.533 neue
Betriebs-, Büro- und Verwaltungsgebäude fertiggestellt. Wie
Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches
Landesamt auf Basis der Statistik der Baufertigstellungen mitteilt,
waren das 97 Fertigstellungen oder 3,7 % weniger als ein Jahr zuvor.
Der Rauminhalt dieser neuen sogenannten Nichtwohngebäude sank um
17,5 % auf knapp 28 Millionen Kubikmeter.

Investiert wurden hierfür fast fünf Milliarden Euro (4,96) – ein
Zuwachs von 7 % im Vergleich zu den Baukosten 2023, die bei
4,63 Milliarden Euro lagen. Knapp ein Drittel der 2024
fertiggestellten Nichtwohngebäude in NRW waren Handels- und
Lagergebäude (833; −7,4 %). Bei weiteren rund 20 % handelte es sich
um landwirtschaftliche Betriebsgebäude (518; +0,6 %). Außerdem
wurden 262 Büro- und Verwaltungsgebäude (−0,4 %) und 249 Fabrik- und
Werkstattgebäude (−15,3 %) fertiggestellt.
Bei den übrigen
671 Nichtwohngebäuden lag der Zuwachs bei 2,0 %, hier wurden 13
Gebäude mehr fertiggestellt als 2023. Der Rauminhalt – ein Indikator
für die Bauaktivität bei Nichtwohngebäuden – sank gegenüber 2023 um
17,5 % auf knapp 28 Millionen Kubikmeter. Rückgang des Rauminhaltes
von über 30 % bei Handels- und Lagergebäuden Fast die Hälfte des
neuen umbauten Raumes entfiel mit 13,6 Millionen Kubikmetern auf
Handels- und Lagergebäude – ein Rückgang um 32,6 % im Vergleich zum
Vorjahr.
Auch bei Fabrik- und Werkstattgebäuden sank der
Rauminhalt um 10,8 % auf 2,9 Millionen Kubikmeter. Bei den Büro- und
Verwaltungsgebäuden gab es einen Zuwachs um 20,6 % auf 3,6 Millionen
Kubikmeter, bei den landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden wurde
ebenso eine positive Entwicklung verzeichnet mit 8,9 % auf
2,9 Millionen Kubikmeter und in der Kategorie übrige
Nichtwohngebäude lag der Anstieg bei 3,7 % auf 5,1 Millionen
Kubikmeter.