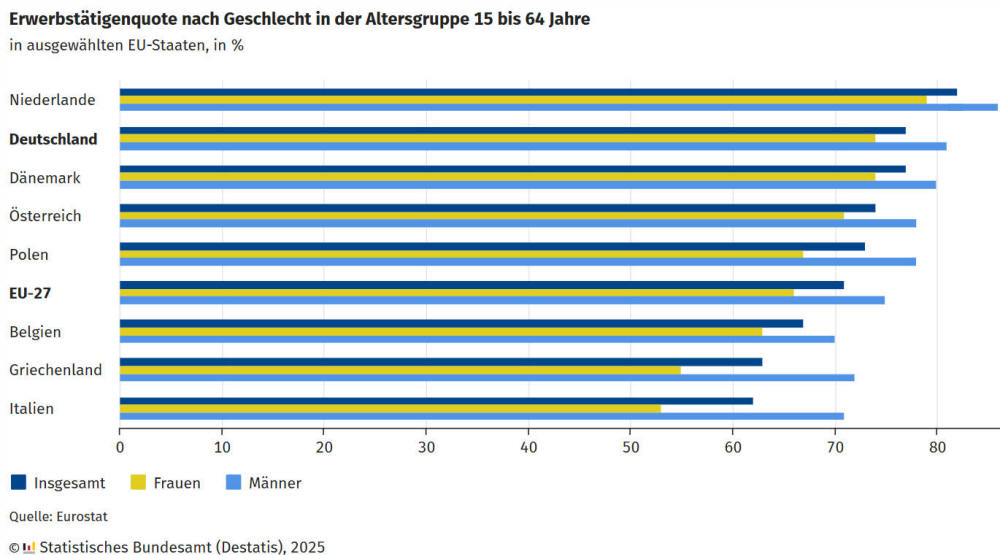|
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 25. Kalenderwoche:
21. Juni
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Montag, 23. Juni 2025
Da freuen sich Igel- und Gartenfeunde

Foto Barbara Jeschke
Bei heißen und trockenen Tagen haben alle Durst. Und auch Igel und
Vögel müssen trinken. Darauf weist auch das Igel-Notnetz mit einer
Wurfsendung in Vororten mit Gärten eindringlich hin. Im Bild sind
wohl Mutter Igel am Samstagabend mit Nachwuchs an der Vogeltränke.
Mehr auch unter info@igel-notnetzt.net
Die DVG weicht für Straßenbauarbeiten in Homberg vom
Linienweg ab
Von Montag, 23. Juni, circa 6 Uhr, bis voraussichtlich
Freitag, 18. Juli, Betriebsende, müssen die Busse der Linie 923 der
Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) in Duisburg-Homberg eine
Umleitung fahren. Grund hierfür sind Straßenbauarbeiten auf der
Hochfeldstraße, weshalb diese gesperrt wird.
Linie 923: In
Fahrtrichtung Dubliner Straße fahren die Busse ab der Haltestelle
„Zollstraße“ eine örtliche Umleitung über die Rheindeichstraße und
Lauerstraße. Ab da gilt der normale Linienweg. Die Haltestelle
„Stadtbad Homberg“ wird auf die Rheindeichstraße vor die Zufahrt zur
Hochfeldstraße verlegt. Die Haltestelle „Margarethenstraße“
entfällt.
Die DVG bittet die Fahrgäste die
Ersatzhaltestellen „Stadtbad Homberg“ und „Verbandstraße“ zu nutzen.
Die Haltestelle „Verbandstraße“ wird auf die Lauerstraße hinter die
Kreuzung Hochfeldstraße verlegt. In Gegenrichtung wird die Umleitung
sinngemäß gefahren.
Autounfall im EU-Ausland – Gut vorbereitet in den
Urlaub
Ein Autounfall im Ausland kann die Urlaubsfreude schnell
trüben. Doch wer gut vorbereitet reist, kann unnötigen Stress
vermeiden – und im Nachhinein Verzögerungen oder hohe Kosten, sollte
es zu Problemen bei der Schadensregulierung kommen.

Foto: © Adobe Stock / mpix-foto
Beispiel aus der juristischen
Beratung des EVZ
Basil M. aus Schleswig-Holstein war mit seiner
Familie in Belgien unterwegs, als eine niederländische Autofahrerin
auf einem Parkplatz sein Fahrzeug beschädigte. Die Polizei nahm den
Unfall auf, und Basil M. informierte die gegnerische Versicherung in
den Niederlanden.
Wegen ungeklärter Schuldfrage verweigerte
diese jedoch die Kostenübernahme. Erst nach Intervention der
EVZ-Juristen konnte die Schuldfrage geklärt und der Schaden
vollständig reguliert werden.
Diese Unterlagen sollten mit
ins Auto
Im Handschuhfach sollte der Europäische Unfallbericht
nicht fehlen. Das europaweit einheitliche Formular, erhältlich bei
Automobilclubs oder Versicherungen, erleichtert die spätere
Schadensregulierung. Sinnvoll ist auch die Internationale
Versicherungskarte (früher „Grüne Karte“), die alle wichtigen
Versicherungsdaten enthält.
Darüber hinaus empfiehlt es sich,
folgende Telefonnummern griffbereit zu haben: den Zentralruf der
Autoversicherer, den Schadenservice der eigenen Versicherung sowie
den Pannendienst des Automobilclubs.
Was bei einem Unfall vor
Ort zu tun ist
Warnweste anziehen und Unfallstelle sichern
(Warndreieck, Warnblinker).
Bei Personenschaden europaweit die
einheitliche Notrufnummer 112 wählen.
Polizei verständigen
(Hinweis: In einigen Ländern wie Frankreich kommt bei Blechschäden
nicht immer eine Streife).
Kontaktdaten mit dem Unfallgegner
austauschen, ggf. Zeugen notieren.
Fotos und Videos der
Unfallstelle machen. Europäischen Unfallbericht gemeinsam mit dem
Unfallgegner ausfüllen – möglichst vollständig und sorgfältig.
Hinweise zur Schadensregulierung
Wird der Unfall selbst
verschuldet, übernimmt die eigene Kfz-Haftpflichtversicherung die
Schäden des Unfallgegners. Für den eigenen Schaden ist eine
Vollkaskoversicherung erforderlich.
Liegt die Schuld beim
Unfallgegner, sollte der Schaden schnell bei dessen Versicherung
gemeldet werden – über den Schadensregulierungsbeauftragten. Jede
europäische Versicherung muss einen solchen Beauftragten in
Deutschland benennen. Er ist Ansprechpartner für alle in Deutschland
wohnhaften Personen, die Ansprüche gegen eine ausländische
Kfz-Versicherung geltend machen. Dessen Kontaktdaten kann man über
den Zentralruf der Autoversicherer erfragen.
Für die
Schadensmeldung sind der Europäische Unfallbericht, ein
Kostenvoranschlag oder ein Sachverständigengutachten sowie ggf.
weitere Nachweise wie eine Ersatzwagenrechnung einzureichen. Mit der
Einreichung sollte nicht zu lange gewartet werden, denn in einigen
Ländern gibt es strenge Ausschlussfristen.
Wichtig: in der
Regel werden Unfälle wie der oben geschilderte nach dem Recht des
Landes abgewickelt, in dem der Unfall passiert ist. Dort können ganz
andere Regeln gelten als in Deutschland. Erkundigen Sie sich bei der
gegnerischen Versicherung genau, welche Kosten übernommen werden und
welche nicht. Halten Sie die Kosten vor einer ausdrücklichen,
schriftlichen Genehmigung der Versicherung so gering wie möglich,
sonst bleiben Sie eventuell darauf sitzen.
Innerhalb von drei
Monaten muss die gegnerische Versicherung den Schaden regulieren
oder ein konkretes Entschädigungsangebot unterbreiten. Ist die
Schuldfrage unklar, kann sich das Verfahren über sechs Monate oder
länger hinziehen.
Unfall mit einem Mietwagen – was ist zu
beachten?
Kommt es mit einem Mietwagen zu einem Unfall, muss in
jedem Fall der Autovermieter informiert werden. Die meisten
Mietverträge schreiben zudem die Verständigung der Polizei vor –
auch bei kleinen Schäden. Andernfalls kann der Versicherungsschutz
entfallen. Ein Nachweis, dass man versucht hat, die Polizei zu
kontaktieren, kann im Zweifel hilfreich sein.
Wer hilft?
Wenn sich die Schadensregulierung als schwierig erweist oder ins
Stocken gerät, unterstützt das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ)
Deutschland kostenlos bei grenzüberschreitenden Fällen. Zum
Online-Formular. Alternativ können sich Verbraucher auch an eine
Schlichtungsstelle für Versicherungen im Land des Versicherer
wenden.
Ausführliche Informationen zum Thema Autounfall im
EU-Ausland und speziell zum Vorgehen bei Unfällen in Frankreich.
Pater Tobias läuft für das Ameland-Ferienlager -
1.500 Euro Spende für die „Insel der Kinder“
Mit jedem Schritt für eine gute Sache: Pater Tobias,
Prämonstratenser aus der Abtei Hamborn und als „Marathon-Pater“
bekannt, ist eigens zugunsten des Ferienlagers der Pfarrei St.
Johann auf Ameland beim Marathon in Rheda-Wiedenbrück angetreten.
Das Ergebnis: Eine Spende in Höhe von 1.500 Euro, die nun offiziell
an Abt Albert übergeben wurde - als Unterstützung für das
Sommerferienlager vom 12. bis 26. Juli 2025.
„Ich freue mich,
dass mein Lauf den Kindern direkt zugutekommt. Ferien in guter
Gemeinschaft sind unbezahlbar - besonders für Familien, die sich so
etwas sonst nicht leisten könnten“, betont Pater Tobias. Das
zweiwöchige Lager auf der niederländischen Nordseeinsel ist für
viele Kinder ein echtes Highlight. Ameland, wegen der zahlreichen
Ferienfreizeiten auch als „Insel der Kinder“ bekannt - bietet mit
ihren Dünen, Stränden, Wäldern und Ortschaften ideale
Voraussetzungen für Abenteuer, Spiel und Gemeinschaft.
Abt
Albert, der das Lager seit vielen Jahren begleitet, zeigte sich
dankbar: „Diese Spende hilft uns ganz konkret, auch Kindern aus
einkommensschwachen Familien eine Teilnahme zu ermöglichen.“ Und
weiter: „Unser Ferienlager lebt von Gemeinschaft, Glauben und echter
Lebensfreude. Dank solcher Unterstützung können wir das weiter
ermöglichen.“

Foto: Projekt LebensWert
Untergebracht ist die Gruppe wieder
in der bewährten Unterkunft der Familie Brouwer nahe dem Dorf Buren
- mitten in der Natur, mit viel Platz für kreative Spiele, Ausflüge
und gemeinsame Aktivitäten. Neben Geländespielen, Bastelangeboten,
Fahrradtouren und Ausflügen ans Meer gibt es geistliche Impulse,
Abendrunden und gemeinsame Gottesdienste.
Mitfahren können
alle Kinder zwischen 7 und 11 Jahren, unabhängig von Konfession oder
Herkunft. Die Plätze sind begrenzt. Informationen und
Anmeldemöglichkeiten sind über die Pfarrei St. Johann erhältlich.
Spendenkonto: Katholische Kirchengemeinde St. Johann
IBAN:
DE65 3506 0386 5111 1302 06
Volksbank Rhein-Ruhr.
Verwendungszweck: „Ameland-Ferienlager“
Mariéla
Santana | Die Stimme aus Havanna in Ruhrort
Aus persönlichen Gründen muss
Mariéla Santana ihr Konzert in Ruhrort diesmal leider absagen. Die
Veranstaltung wird voraussichtlich später im Jahr nachgeholt.
Nach mitreißenden Konzerten in den letzten beiden Jahren kehrt die
Star-Sängerin Mariéla Santana aus Kuba nun endlich mit ihrer ersten
CD nach Ruhrort zurück.
Die professionelle Sängerin hat an
der ISP Enrique José Varona (Institut für Kunst in Havanna)
Pädagogik und Musik studiert. Ihre Lehrerin war die berühmte
Sängerin und Musikpädagogin, Emilia Morales. Seit 15 Jahren tritt
die in Havanna geborene Mariéla Diéguez Santana in zahlreichen Shows
und als Solistin auf.
Sie ist eine der jüngeren Sänger und
Sängerinnen, die in allen In-Szenen Havannas präsent sind, wie z.B.
in den Kulturzentren von Artex, „Delirio Habanero“ und „Gato
Tuerto“.
In der 'Casa de la Cultura' in Havanna, wo in
früheren Zeiten die Auftritte der legendären Gruppe Irakere
stattfanden, hat sie gearbeitet. Mariéla wird mit kubanischer
Musik, romantischen Boleros und Balladen, die vom Leben und Lieben
erzählen sowie von Salsa, Latin- und Popmusik begeistern.
Mit ihren sympathischen und temperamentvollen Auftritten hat sie in
den letzten drei Jahren eine hohe Popularität erreicht und in
mehreren Städten Deutschlands und der Schweiz aufgetreten. Sie war
Gast bei der Stiftung Udo Lindenberg und hat zwei Mal die Bühne mit
dem Panik Orchester verzaubert.

Foto: Arian Irsula
Mariéla Santana | Die Stimme aus
Havanna. Das Plus am Neumarkt, Neumarkt 19, 47119 Duisburg-Ruhrort
26. Juni 2025, 19:00 Uhr Eintritt frei(willig) - Hutveranstaltung
Studie zu
privaten Krankenversicherungen - Lange Laufzeiten entschärfen
Probleme
Langfristige Verträge der privaten Krankenversicherung in
Deutschland kommen nah an das, was die Wirtschaftstheorie als
„optimal“ beschreibt. Eine internationale Studie mit Beteiligung der
Universität Duisburg-Essen zeigt: Viele Probleme des
Versicherungsmarkts lassen sich durch lange Laufzeiten abfedern –
ganz ohne komplizierte Konstruktion der Verträge. Veröffentlicht
wird die Studie im Journal of Political Economy, einem der fünf
führenden Fachjournale der Volkswirtschaftslehre.
Einer der
vier Studienleiter ist Prof. Dr. Martin Karlsson von der Universität
Duisburg-Essen (UDE). Gemeinsam mit Kollegen der Cornell University,
der University of Pennsylvania (beide USA) sowie des
Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung analysierte
er, wie gut die langfristigen Verträge in der privaten
Krankenversicherung (PKV) funktionieren – gemessen an dem, was die
ökonomische Theorie als „optimal“ beschreibt.
Optimal ist ein
Vertrag dann, wenn er sich flexibel an die aktuelle Lebenslage
anpasst. In einkommensstarken Lebensphasen zahlt man mehr, in
schwächeren wird man entlastet. In der Realität funktioniert das
kaum. Trotzdem zeigen die Gesundheitsökonomen: Die PKV-Verträge
kommen diesem Ideal erstaunlich nah – vor allem, wenn das Einkommen
im Lauf des Lebens relativ stabil bleibt.
Inflation für 8 von 9 Haushaltstypen unter Zielrate
der EZB, weiterer EZB-Zinsschritt notwendig
Die Inflationsrate in Deutschland hat im Mai bei 2,1 Prozent
verharrt und liegt damit fast am Inflationsziel der Europäischen
Zentralbank (EZB) von zwei Prozent. Von neun verschiedenen
Haushaltstypen, die sich nach Einkommen und Personenzahl
unterscheiden, hatten acht eine haushaltsspezifische Teuerungsrate
unter dem Zielwert, der neunte direkt beim Inflationsziel. Konkret
reichte die Spannweite im Mai von 1,4 bis 2,0 Prozent, der
Unterschied lag also bei 0,6 Prozentpunkten, zeigt der neue
Inflationsmonitor des Instituts für Makroökonomie und
Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung.*
Zum
Vergleich: Auf dem Höhepunkt der Inflationswelle im Herbst 2022
betrug die Spanne 3,1 Prozentpunkte. Während Haushalte mit niedrigen
Einkommen, insbesondere Familien, während des akuten Teuerungsschubs
der Jahre 2022 und 2023 eine deutlich höhere Inflation schultern
mussten als Haushalte mit mehr Einkommen, war ihre Inflationsrate im
Mai 2025 wie in den Vormonaten gering: Der Warenkorb von Paaren mit
Kindern und niedrigen Einkommen verteuerte sich um 1,4 Prozent. Auf
1,7 Prozent Inflationsrate kamen Alleinlebende mit niedrigen
Einkommen. Alleinerziehende sowie Alleinlebende mit jeweils
mittlerem Einkommen wiesen mit 1,5 bzw. 1,6 Prozent ebenfalls
relativ niedrige Teuerungsraten auf.

Als einziger Haushaltstyp hatten im Mai Alleinlebende mit sehr
hohen Einkommen mit 2,0 Prozent eine Inflation direkt auf dem Niveau
der EZB-Zielrate. Es folgten Paare mit Kindern und hohen Einkommen
(1,9 Prozent) sowie Paare ohne Kinder mit mittleren Einkommen (1,8
Prozent). Ein wichtiger Faktor für das etwas höhere Niveau ist, dass
bei diesen drei konsumstarken Haushaltstypen die niedrigeren
Energiepreise weniger stark ins Gewicht fallen als bei Haushalten
mit weniger Einkommen, deren Warenkörbe stärker durch Güter des
täglichen Bedarfs geprägt sind.
Zudem fragen Haushalte mit
höheren Einkommen stärker Dienstleistungen nach, die sich derzeit
noch merklich verteuern, wie Versicherungsdienstleistungen,
Pflegedienstleistungen und Dienstleistungen des Gastgewerbes.
Allerdings verzeichneten alle drei Haushaltsgruppen einen leichten
Rückgang ihrer Inflationsrate, weil sich der Preisauftrieb bei
Pauschalreisen gegenüber dem Vormonat normalisiert hat. In der Folge
hat sich die Spanne zwischen den haushaltsspezifischen
Inflationsraten von 0,8 Prozentpunkten im April auf 0,6
Prozentpunkte im Mai verringert.
Die beiden anderen
untersuchten Haushaltstypen, Familien mit mittleren Einkommen und
Alleinlebende mit höheren Einkommen, verzeichneten im Mai eine
Inflationsrate von je 1,7 Prozent. Dass aktuell alle vom IMK
ausgewiesenen haushaltsspezifischen Inflationsraten leicht unter der
Gesamtinflation liegen, wie sie das Statistische Bundesamt
berechnet, liegt an unterschiedlichen Gewichtungen: Das IMK nutzt
für seine Berechnungen weiterhin die repräsentative Einkommens- und
Verbrauchsstichprobe, während Destatis seit Anfang 2023 die
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung heranzieht.
Zusätzliches
Argument für Zinssenkung: Euro hat deutlich aufgewertet
Im
Jahresverlauf 2025 dürfte sich die Inflationsrate weiter
normalisieren und um den Wert von zwei Prozent schwanken, so die
Erwartung von Dr. Silke Tober, IMK-Expertin für Geldpolitik und
Autorin des Inflationsmonitors. Allerdings sind die Risiken für die
Inflationsprognose in den vergangenen Wochen etwas gestiegen, und
zwar in beide Richtungen: Während ein länger andauernder Konflikt
zwischen Israel und dem Iran zu anhaltend höheren Rohöl- und
Erdgaspreisen führen könnte, besteht durch den weiter schwelenden
von US-Präsident Donald Trump provozierten Zollkonflikt das Risiko,
dass die Teuerung sogar unter die Zielinflation fällt. Denn auch
wenn sich die handelspolitische Auseinandersetzung zeitweilig etwas
beruhigt hat, hält sie die Gefahr einer weltweiten Rezession hoch,
die die Preisentwicklung zusätzlich dämpfen würde.
Tober hält
eine weitere Leitzinssenkung durch die EZB für erforderlich. Die
Zinsschritte der vergangenen Monate, zuletzt am 11. Juni auf 2,0
Prozent, hätten zwar für Entlastung gesorgt. Sie reichten aber noch
nicht aus, zumal seit Jahresbeginn der Euro gegenüber dem US-Dollar
um 10 Prozent aufgewertet hat, was die ohnehin verhaltenen
Exportaussichten der Europäer bremst. Ein weiterer Zinsschritt solle
„zeitnah folgen, zumal die aktuelle Inflationsprognose der EZB dies
ohnehin annimmt“, erklärt die Ökonomin. „Eine Belebung der
Binnennachfrage ist dringend erforderlich und könnte zudem einen
Beitrag zur Lösung des Zollkonflikts liefern.“
Langfristiger
Vergleich: Lebensmittel knapp 40 Prozent teurer als 2019
Das IMK
berechnet seit Anfang 2022 monatlich spezifische Teuerungsraten für
neun repräsentative Haushaltstypen, die sich nach Zahl und Alter der
Mitglieder sowie nach dem Einkommen unterscheiden (mehr zu den Typen
und zur Methode unten). In einer Datenbank liefert der
Inflationsmonitor zudem ein erweitertes Datenangebot: Online lassen
sich Trends der Inflation für alle sowie für ausgewählte einzelne
Haushalte im Zeitverlauf in interaktiven Grafiken abrufen.
Die längerfristige Betrachtung illustriert, dass Haushalte mit
niedrigem bis mittlerem Einkommen von der starken Teuerung nach dem
russischen Überfall auf die Ukraine besonders stark betroffen waren,
weil Güter des Grundbedarfs wie Nahrungsmittel und Energie in ihrem
Budget eine größere Rolle spielen als bei Haushalten mit hohen
Einkommen.
Diese wirkten lange als die stärksten
Preistreiber, zeigt ein längerfristiger Vergleich, den Tober in
ihrem neuen Bericht ebenfalls anstellt: Die Preise für
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke lagen im Mai 2025 um 39,6
Prozent höher als im Mai 2019, also vor Pandemie und Ukrainekrieg.
Damit war die Teuerung für diese unverzichtbaren Basisprodukte mehr
als dreimal so stark wie mit der EZB-Zielinflation von kumuliert
12,6 Prozent in diesem Zeitraum vereinbar. Energie war trotz der
Preisrückgänge in letzter Zeit um 33,0 Prozent teurer als im April
2019.
Informationen zum Inflationsmonitor
Für den IMK
Inflationsmonitor werden auf Basis der Einkommens- und
Verbrauchsstichprobe (EVS) des Statistischen Bundesamts die für
unterschiedliche Haushalte typischen Konsummuster ermittelt. So
lässt sich gewichten, wer für zahlreiche verschiedene Güter und
Dienstleistungen – von Lebensmitteln über Mieten, Energie und
Kleidung bis hin zu Kulturveranstaltungen und Pauschalreisen – wie
viel ausgibt und daraus die haushaltsspezifische Preisentwicklung
errechnen.
Die Daten zu den Haushaltseinkommen stammen
ebenfalls aus der EVS. Im Inflationsmonitor werden neun
repräsentative Haushaltstypen betrachtet: Paarhaushalte mit zwei
Kindern und niedrigem (2000-2600 Euro), mittlerem (3600-5000 Euro),
höherem (mehr als 5000 Euro) monatlichem Haushaltsnettoeinkommen;
Haushalte von Alleinerziehenden mit einem Kind und mittlerem
(2000-2600 Euro) Nettoeinkommen; Singlehaushalte mit niedrigem
(unter 900 Euro), mittlerem (1500-2000 Euro), höherem (2000-2600
Euro) und hohem (mehr als 5000 Euro) Haushaltsnettoeinkommen sowie
Paarhaushalte ohne Kinder mit mittlerem Haushaltsnettoeinkommen
zwischen 3600 und 5000 Euro monatlich. Der IMK Inflationsmonitor
wird monatlich aktualisiert.
Ein Drittel des
EU-Haushalts fließt in die Kohäsionspolitik
-
Die EU-Prüfer ziehen Lehren aus den Schwächen bei der
Kohäsionspolitik und beim Corona-Aufbaufonds der EU.
-
Kohäsionsmittel können künftig bessere Ergebnisse und einen größeren
Mehrwert für die EU-Regionen erzielen.
Kohäsionspolitik ist
die Strategie der Europäischen Union zur Förderung und Unterstützung
einer "harmonischen Entwicklung der Gemeinschaft als Ganzes", ihrer
Mitgliedstaaten und ihrer Regionen
Bereits seit Jahren
weist der Europäische Rechnungshof auf die Voraussetzungen für eine
erfolgreiche EU-Kohäsionspolitik hin: Sie sollte strategische Ziele
verfolgen, leistungsorientiert sein, flexibel bei der Planung der
Förderung sein, fristgerecht umgesetzt werden und auf einfachen
Vorschriften beruhen.
So ließe sich die Wirksamkeit und
Effizienz dieses zentralen Politikfelds der EU verbessern, das der
Entwicklung der verschiedenen Regionen der EU dient und ehrgeizige
Gesamtziele verfolgt. In ihrer heute veröffentlichten Analyse ziehen
die EU-Prüfer Lehren aus der Vergangenheit, die der EU dabei helfen
sollen, für den nächsten sogenannten mehrjährigen Finanzrahmen ab
2028 eine bessere Kohäsionspolitik auf die Beine zu stellen.

Zwischen 1989 und 2023 hat die EU über die Kohäsionspolitik rund
eine Billion Euro bereitgestellt. Bis 2027 sollen weitere 400
Milliarden Euro folgen, was die EU-Kohäsionspolitik zum weltweit
bedeutendsten Faktor für Regionalentwicklung macht. Laut
EU-Kommission hat die Kohäsionspolitik zum Abbau der sozialen und
wirtschaftlichen Ungleichheiten in der EU beigetragen.
Den
EU-Prüfern zufolge sei dies in den einzelnen Regionen jedoch
unterschiedlich gut gelungen. In ihrer Analyse weisen sie auf eine
Reihe wichtiger Faktoren hin, die Einfluss darauf hatten, wie
wirksam die Kohäsionsmittel eingesetzt wurden. Zudem erläutern sie,
welche Lehren aus den Erfahrungen mit dem Corona-Aufbaufonds gezogen
werden können. Diese Erkenntnisse sollten bei der Gestaltung und
Umsetzung der Kohäsionspolitik für die Jahre ab 2028 berücksichtigt
werden. Mehr...
Infoabend zum Konfi-Unterricht
Auf
dem Weg zum Erwachsensein begleiten Kinder viele Fragen, dazu
gehören auch die nach dem Glauben an Gott. Die Antworten auf die
wichtigen Fragen im Leben und Glauben versuchen Engagierte der
Evangelischen Versöhnungsgemeinde Duisburg-Süd um Jugendpfarrerin
Ulrike Kobbe in der Konfirmandenzeit zu finden.
Wie immer
wurden im Frühjahr evangelische Schülerinnen und Schüler auf dem
Gebiet der Gemeinde angeschrieben, die bald in die 7. Klasse gehen,
und zum Konfirmandenunterricht eingeladen. Sie und alle, die keine
Nachricht erhalten haben sollten, laden Pfarrerin Kobbe und die
Gemeinde zu einem Anmelde- und Infoabend rund um die
Konfirmandenzeit ein: am 24. Juni 2025, 18 Uhr im Gemeindezentrum
Huckingen, Angerhauser Str. 91, 47249 Duisburg.
Dort werden
Fragen beantwortet und es erfahren alle, was für den ca. 18moantigen
Konfirmandenunterricht geplant ist.

Fragen vorab rund um das Thema Konfirmandenunterricht oder
Konfirmation beantwortet Jugendpastorin Ulrike Kobbe -
Foto: www.evgds.de
- gerne (Tel.: 0203 9331907 oder Email:
ulrike.kobbe@ekir.de).
Infos zur Evangelischen
Versöhnungsgemeinde-Duisburg Süd gibt es im Netz unter
www.evgds.de.
Gottesdienst mit Johannitern in der
Marienkirche
Am Mittwoch, 25. Juni 2025 begrüßt die Evangelische
Kirchengemeinde Alt-Duisburg in der Marienkirche,
Josef-Kiefer-Straße 10, im Gottesdienst um 17.30 Uhr wieder
Mitglieder des Johanniterordens und Mitarbeitende von der
Johanniterunfallhilfe und vom Johanniterjugendverband.
Die
Gemeinde erinnert durch die gemeinsame Feier des Gottesdienstes
daran, dass Gemeinde und Orden vor allem der christliche Glaube
verbindet, dass aber zudem die Marienkirche auf eine sehr lange
Johannitertradition zurückblicken kann: Die Johanniter erbauten in
der Mitte des 12. Jahrhunderts im Südwesten der Stadt Duisburg eine
Hospitalkapelle, die man 1295 in die Stadtmauer einbezog.
Fundamente dieser romanischen Anlage und eines steinernen Wohnturmes
aus dem 11. Jahrhundert sind heute noch unter der jetzigen
Marien-Kirche vorhanden. Pfarrer Stephan Blank und die Gemeinde
laden herzlich zur Feier des Gottesdienstes ein. Infos zur Gemeinde
und zur Marienkirche gibt es im Netz unter www.ekadu.de.
Tiergottesdienst und Sommerfest an der Kreuzeskirche
übertreffen die Erwartungen
Die Sorge, ob uns durch das lange Wochenende die Menschen
dem Tiergottesdienst- und Sommerfest an der evangelischen
Kreuzeskirche in Duisburg Marxloh wegbleiben würden, war völlig
unbegründet! 130 Menschen besuchten mit 40 Hunden und der schon
bekannten Schildkröte Nepomuk am 21. Juni den Ökumenischen
Tiergottesdienst unter freiem Himmel und lauschten der Predigt von
Schwester Mariotte und Jessica Wachtel (s. Foto mit Pfarrerin Anja
Humbert in der Bildmitte).

(Fotos Ev. Bonhoeffer Gemeinde Marxloh Obermarxloh).
Anschließend war reges und fröhliches Treiben bis in
den Nachmittag hinein rund um die Kirche angesagt. Hüpfburg, Basteln
und Geschicklichkeitsspiele, der Eiswagen und der
Hundegeschicklichkeitsparcours, die Kirchenführung… alles war gut
besucht von vielen fröhlichen kleinen und großen Menschen.

Evangelische und katholische Kirche danken alle Helferinnen und
Helfern, die bei der Hitze über viele Stunden tatkräftig im Einsatz
waren. Und an alle, die gekommen sind und einfach fröhlich
mitgefeiert haben! „Es war toll!“ freut sich Pfarrerin Anja Humbert
von der Evangelischen Bonhoeffer Gemeinde Marxloh Obermarxloh und
verkündet fröhlich: „Der Tiertafel werden wir 500,- überweisen
können.“ Infos zur Gemeinde gibt es im netz unter
www.bonhoeffer-gemeinde.org.

Meidericher Gemeinde lädt zur Kirchenkneipe ein
An einem der vier Freitage jeden Monats öffnet im
Gemeindezentrum der Evangelischen Kirchengemeinde Duisburg
Meiderich, Auf dem Damm 8, die Kirchenkneipe. So auch am 27. Juni
2025, wo Besucherinnen und Besucher nach dem
19-Uhr-Wochenabschlussandacht ab 19.30 Uhr wieder gute Getränke,
leckere Kleinigkeiten und eine gemütliche Atmosphäre erwarten
können, die zum Wohlfühlen einlädt und Platz für nette Gespräche
lässt. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter
www.kirche-meiderich.de oder im Gemeindebüro unter 0203-4519622.

Baugenehmigungen für Wohnungen im April 2025: +4,9 % zum
Vorjahresmonat +15,4 % bei Einfamilienhäusern
-9,7 % bei
Zweifamilienhäusern
-0,1 % bei Mehrfamilienhäusern
Im
April 2025 wurde in Deutschland der Bau von 18 500 Wohnungen
genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren
das 4,9 % oder 900 Baugenehmigungen mehr als im April 2024. Von
Januar bis April 2025 wurden insgesamt 73 900 Wohnungen genehmigt.
Das waren 3,7 % oder 2 700 Wohnungen mehr als im Vorjahreszeitraum.
In diesen Ergebnissen sind sowohl Baugenehmigungen für
Wohnungen in neuen Wohn- und Nichtwohngebäuden als auch für neue
Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten. In neu zu errichtenden
Wohngebäuden wurden im April 2025 insgesamt 15 000 Wohnungen
genehmigt. Das waren 5,1 % oder 700 Wohnungen mehr als im
Vorjahresmonat.
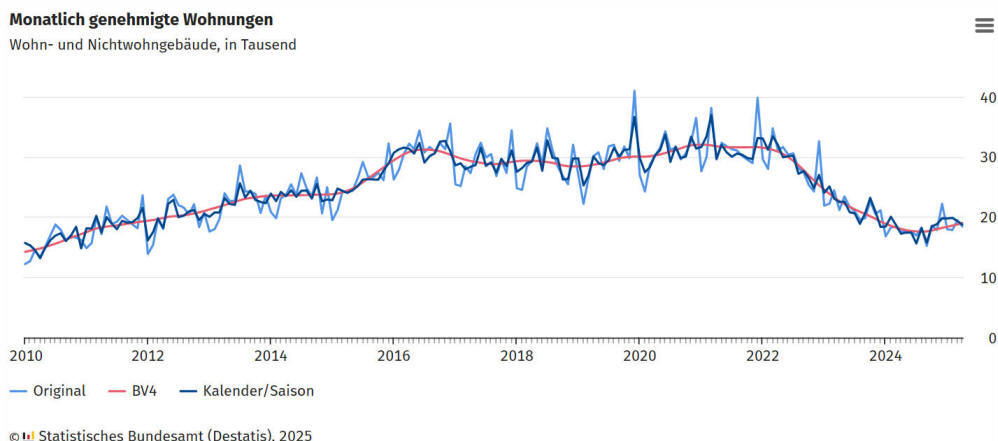
Januar bis April 2025: Aufwärtstrend bei Einfamilienhäusern setzt
sich fort, Stagnation bei Mehrfamilienhäusern Von Januar bis April
2025 wurden in Wohn- und Nichtwohngebäuden 4,3 % oder 2 500 mehr
Neubauwohnungen genehmigt als im Vorjahreszeitraum 2024. Dabei stieg
die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser gegenüber dem
Vorjahreszeitraum um 15,4 % (+1 900) auf 14 200 an.
Der
positive Trend bei den Einfamilienhäusern hält bereits seit Dezember
2024 an. Bei den Zweifamilienhäusern sank die Zahl in den ersten
vier Monaten 2025 um 9,7 % (-400) auf 4 000 genehmigte Wohnungen.
Bei den Mehrfamilienhäusern, der zahlenmäßig stärksten Gebäudeart,
blieb die Zahl der Baugenehmigungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum
mit 38 600 Wohnungen nahezu konstant (-0,1 % oder -40 Wohnungen).
Leicht unter EU-Schnitt: 40,2 Wochenstunden haben in
Vollzeit Erwerbstätige hierzulande 2024 gearbeitet
• Im
EU-Durchschnitt arbeiten 15- bis 64-jährige Vollzeitbeschäftigte
40,3 Stunden pro Woche
• Teilzeitquote in Deutschland deutlich
höher als in den meisten EU- Staaten
• Erwerbstätigenquote in
Deutschland überdurchschnittlich hoch, vor allem bei Frauen
Vollzeitbeschäftigte in Deutschland leisten durchschnittlich etwas
weniger Arbeitsstunden pro Woche als im EU-Durchschnitt. 15- bis
64-jährige Erwerbstätige in Vollzeit haben im Jahr 2024 im Schnitt
40,2 Wochenstunden gearbeitet. Sie lagen damit geringfügig unter dem
EU-Durchschnitt von 40,3 Wochenstunden, wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) auf Basis von Daten der europäischen
Statistikbehörde Eurostat mitteilt. In den letzten zehn Jahren ist
die Arbeitszeit in Deutschland und EU-weit leicht zurückgegangen:
2014 hatte sie hierzulande noch bei 41,5 Wochenstunden gelegen,
EU-weit waren es 41,3 Wochenstunden.
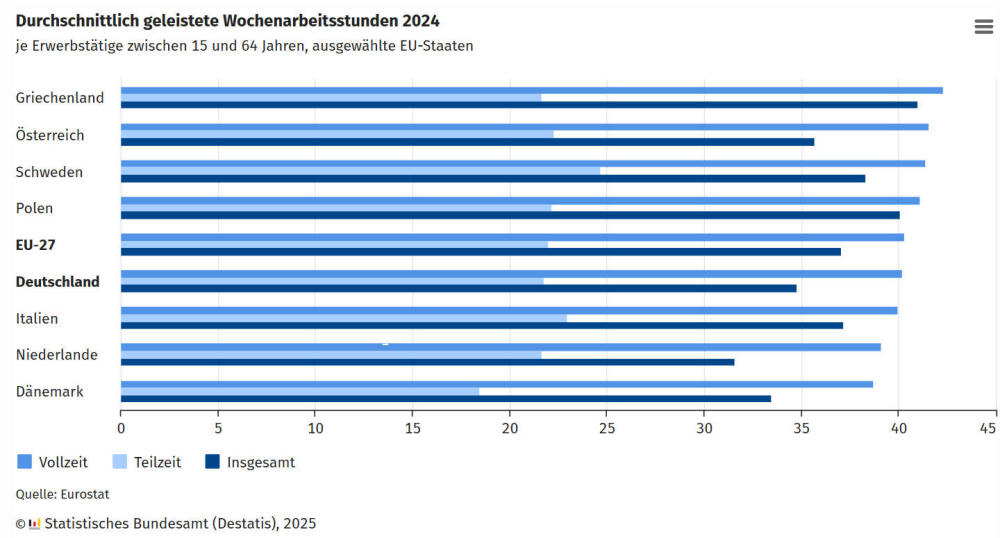
Teilzeitquote in Deutschland mit 29 % eine der höchsten in der
EU
Im Jahr 2024 arbeiteten in Deutschland nach Daten der
Europäischen Arbeitskräfteerhebung 29 % der Erwerbstätigen zwischen
15 und 64 Jahren in Teilzeit. Höher war die Teilzeitquote lediglich
in den Niederlanden (43 %) und in Österreich (31 %). EU-weit
arbeiteten 18 % der Erwerbstätigen in Teilzeit.
Frauen waren
dabei hierzulande mehr als viermal so häufig in Teilzeit tätig wie
Männer: Während 48 % der Frauen Teilzeit arbeiteten, traf dies nur
auf 12 % der Männer zu. Auf EU-Ebene fallen die
Geschlechterunterschiede bei insgesamt deutlich niedrigeren Quoten
geringer aus; Frauen arbeiteten gut dreimal so häufig in Teilzeit
wie Männer: EU-weit waren 28 % der Frauen in Teilzeit tätig und 8 %
der Männer.
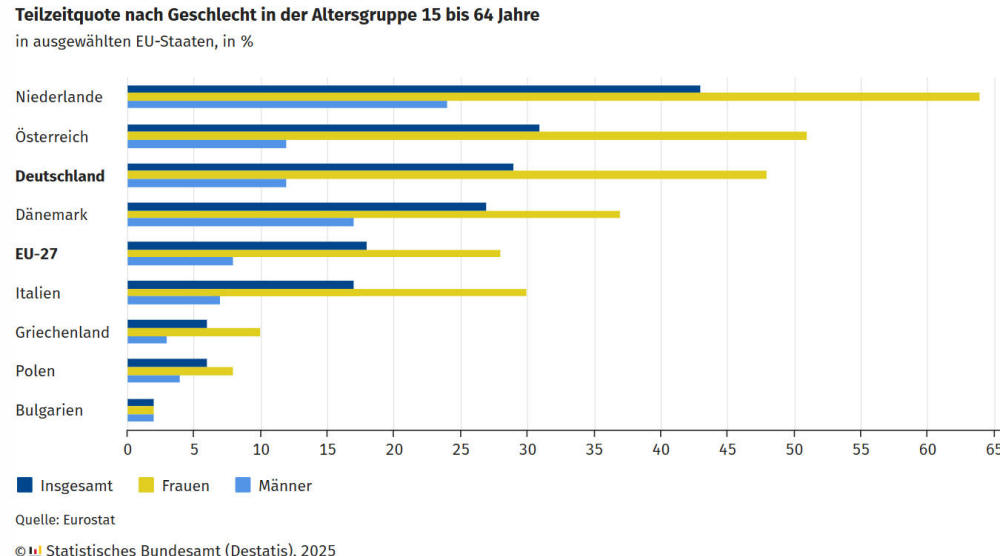
Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten ist EU-weit in den letzten
Jahren leicht zurückgegangen (2014: 19 %), was auf einem Rückgang
der Teilzeitquote bei den Frauen beruht. In Deutschland ist der
Anteil der Teilzeit Arbeitenden hingegen gestiegen, und zwar
geschlechterübergreifend: 2014 waren 27 % der Beschäftigten
hierzulande in Teilzeit tätig, 9 % der Männer und 46 % der Frauen.
Erwerbstätigenquote mit 77 % deutlich höher als in der EU Eine
Teilzeittätigkeit kann als Möglichkeit wahrgenommen werden, Beruf
und Familie zu vereinbaren. In Deutschland geht die im EU-Vergleich
höhere Teilzeitbeschäftigung mit einer höheren Erwerbstätigkeit, vor
allem von Frauen, einher.
77 % der 15- bis 64-jährigen
Bevölkerung waren hierzulande im Jahr 2024 erwerbstätig – ein
Rekordwert, der deutlich über der EU-Erwerbstätigenquote von 71 %
lag. Noch deutlicher war der Unterschied bei der Erwerbstätigkeit
von Frauen: Die Quote betrug hierzulande 74 % und war damit
8 Prozentpunkte höher als im EU-Durchschnitt mit 66 %.
Gegenüber 2014 nahm die Erwerbstätigkeit hierzulande zu – damals
waren noch knapp drei Viertel (74 %) erwerbstätig. Der Anstieg fiel
in diesem Zeitraum bei Frauen (von 70 % auf 74 %) etwas deutlicher
aus als bei Männern (von 78 % auf 81 %). EU-weit stieg die
Erwerbstätigkeit im selben Zeitraum noch deutlicher an: von 64 % auf
71 %. Bei Männern nahm sie von 69 % auf 75 % zu, bei Frauen von 59 %
auf 66 %.