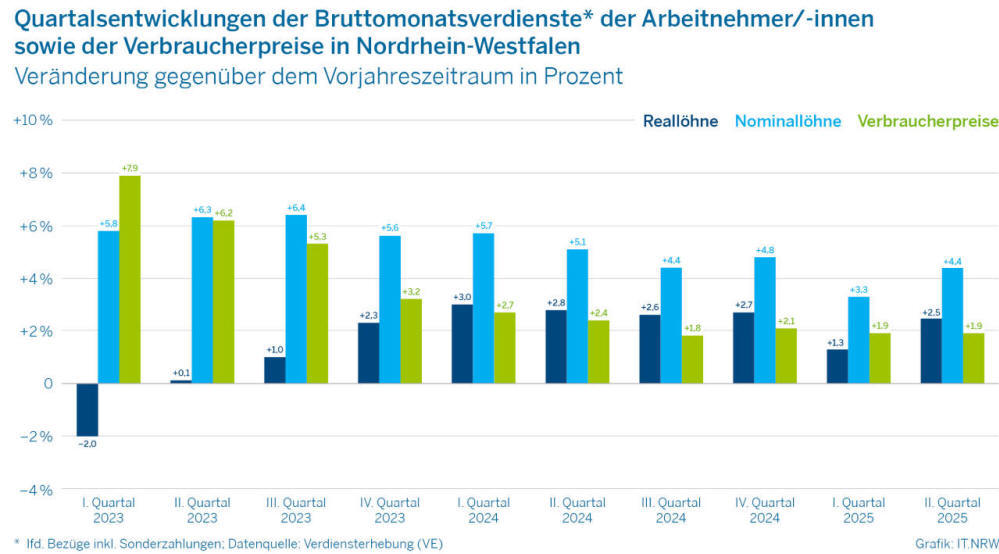|
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 34. Kalenderwoche:
23. August
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Montag, 25. August 2025
Start ins neue
Schuljahr: Von den Basiskompetenzen bis zur Lehrkräfteausbildung
gibt der Schulkompass NRW 2030 die Richtung vor
Bezirksregierung genehmigt neuen Flächennutzungsplan der Stadt
Duisburg
Die Stadt Duisburg
hat einen neuen Flächennutzungsplan (FNP) aufgestellt.
Regierungspräsident Thomas Schürmann überreichte heute die
Genehmigung an Duisburgs Bürgermeisterin Edeltraud Klabuhn.
„Mit dem neuen Flächennutzungsplan verfügt Duisburg nun über
eine verlässliche und zeitgemäße Grundlage für die städtebauliche
Entwicklung der kommenden 15 bis 20 Jahre. Damit ist die Stadt für
die anstehenden Herausforderungen – vom Wohnungsbau über
Gewerbeflächenentwicklung bis hin zu Klimaschutz und
Hochwasservorsorge – gut gerüstet“, sagte Regierungspräsident Thomas
Schürmann bei der Übergabe.
Duisburgs Bürgermeisterin
Edeltraud Klabuhn blickt erwartungsvoll in die Zukunft: „Der neue
Flächennutzungsplan dient nicht nur der Bereitstellung von
Bauflächen, sondern steuert die Stadtentwicklung in Zeiten des
Klimawandels und steigenden Flächenverbrauchs. Er ist das Fundament
für ein lebenswertes, klimaresilientes Duisburg.“
Der
Flächennutzungsplan ist ein zentrales Instrument der Bauleitplanung:
Er stellt in Grundzügen dar, wie die städtebauliche Entwicklung im
gesamten Stadtgebiet aussehen soll. Der bisherige Plan in Duisburg
stammte noch aus dem Jahr 1986.
Bereits 2007 hatte der Rat
der Stadt die Verwaltung mit der Neuaufstellung beauftragt. Nach
einem komplexen Verfahren, das mit der Stadtentwicklungsstrategie
„Duisburg2027“ startete, liegt nun ein neuer, an das aktuelle Recht
angepasster Plan vor. Zentrale Inhalte des neuen FNP Wohnen: Neben
großen Projekten wie „6-Seen-Wedau“, „RheinOrt“ und dem
innerstädtischen „Mercatorviertel“ wurden zahlreiche kleinere
Wohnbauflächen eingeplant.
Gewerbe und Industrie: Der
Bestand sowie Entwicklungsflächen wurden überprüft, um Betrieben
Perspektiven zu eröffnen und zugleich Anforderungen an
Störfallvorsorge und Umweltschutz zu berücksichtigen. Einzelhandel:
Der neue FNP orientiert sich weitgehend am Bestand, insbesondere bei
großflächigen Einzelhandelsvorhaben.
Umwelt- und
Klimaschutz: Themen wie Immissionsschutz, Bodenschutz,
Störfallschutz, Hochwasser- und Klimaanpassung wurden in die
Neuaufstellung integriert. Ein Umweltbericht dokumentiert die
voraussichtlichen Auswirkungen.
Besonderheiten des
Verfahrens
Aufgrund seines Umfangs und der rechtlichen
Komplexität hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bauen und
Digitalisierung NRW (MHKBD) die gesetzliche Genehmigungsfrist auf
vier Monate verlängert. Im Verfahren spielte auch die sogenannte
„Entfeinerung“ eine Rolle: Der Maßstab wurde von 1:10.000 auf
1:20.000 übertragen, ohne dass wesentliche planungsrechtliche
Informationen verloren gingen.
„Das Verfahren hebt sich
deutlich aus dem Tagesgeschäft hervor – es zeigt, wie anspruchsvoll
Bauleitplanung in einer Großstadt mit langer Industriegeschichte
ist“, betonte Regierungspräsident Schürmann. „Besonders die Fragen
rund um Altlasten, Hochwasserschutz und Störfallschutz haben die
Neuaufstellung geprägt.“ Mit der Genehmigung ist der Weg nun frei,
dass die Stadt Duisburg auf Grundlage des neuen Flächennutzungsplans
die weitere städtebauliche Entwicklung konkret ausgestalten kann.

Die Stadt Duisburg hat einen neuen
Flächennutzungsplan (FNP) aufgestellt. Regierungspräsident Thomas
Schürmann überreichte am Montag (25.08.) die Genehmigung an
Duisburgs Bürgermeisterin Edeltraud Klabuhn (Vierte von links Foto
Bezirksregierung).
Bezirksbibliothek Buchholz schließt vorübergehend
Die
Bezirksbibliothek Buchholz auf der Sittardsberger Allee 14 bleibt
aufgrund umfangreicher Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen von
Dienstag, 9. September bis voraussichtlich Montag, 20. Oktober,
geschlossen.
In den Räumlichkeiten werden aufgrund eines
undichten Daches Feuchtigkeitsschäden beseitigt und der Bodenbelag
erneuert. Gleichzeitig sollen Kundinnen und Kunden nach der
Wiedereröffnung eine modernisierte Bezirksbibliothek vorfinden. Alle
Arbeitsplätze werden elektrifiziert, so dass es dann deutlich mehr
Lademöglichkeiten von Mobilgeräten geben.
Die Abtrennung
zwischen Lesesaal und Bibliotheksbereich wird zu einer
Schallschutzwand umgebaut, um Veranstaltungen, Gruppenarbeiten und
den Publikumsbetrieb besser voneinander zu trennen. Der
Gamingbereich wird modernisiert und zeitgemäß ausgestattet. Im
Rahmen der energetischen Sanierung werden Lichtkuppeln gedämmt und
die Beleuchtung auf LED umgestellt.
Die Leihfristen für in
Buchholz entliehene Medien werden entsprechend angepasst. Kundinnen
und Kunden können während der Schließung auf die Bibliothek in der
Gesamtschule Süd auf der Großenbaumer Allee 168-174 ausweichen
(Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10.30 bis 13 Uhr und von 14
bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr).
Selbstverständlich
können auch alle anderen Zweigstellen der Stadtbibliothek genutzt
werden. Der Medienbote bringt Bücher und anderes auf Wunsch
kostenlos bis an die Wohnungstür und holt die Medien auch wieder ab.
Alle Informationen finden sich auf
www.stadtbibliothek-duisburg.de.
Bis zur Schließung
steht das Team in Buchholz gerne persönlich oder telefonisch unter
(0203) 283-7284 für Auskünfte zur Verfügung. Die Öffnungszeiten sind
dienstags bis freitags von 10.30 bis 13 Uhr und von 14 bis 18.30 Uhr
sowie samstags von 10 bis 13 Uhr.
Mähroboter als Gefahr für Igel und andere Kleintiere
– Stadt Duisburg appelliert an verantwortungsvollen Einsatz
Die Naturschutzbehörde der Stadt Duisburg weist erneut auf die
Gefahr hin, die der unbeaufsichtigte Einsatz von Mährobotern für
Kleintiere - insbesondere Igel, Maulwürfe und Amphibien - in Gärten
darstellt. Gerade jetzt zum Herbst hin sind oftmals junge Igel
besonders aktiv, wodurch das Risiko schwerer oder gar tödlicher
Verletzungen steigt.
Selbst moderne Geräte sind oft nicht in
der Lage, Tiere von anderen Hindernissen zu unterscheiden und
weichen ihnen nicht aus. Die Folge sind oft schwere
Schnittverletzungen an Schnauze, Bauch und Rücken, die viele Tiere
nicht überleben. Da Igel und Amphibien hauptsächlich dämmerungs- und
nachtaktiv sind, sollten Mähroboter ausschließlich tagsüber
eingesetzt werden, idealerweise in der Mittagszeit. Insbesondere im
Herbst besteht aber auch dann noch vor allem für junge Igel ein
Restrisiko.

BZ-Foto Baje
Daher appelliert die Naturschutzbehörde an alle
Bürgerinnen und Bürger, ihre Mähroboter zum Schutz der Wildtiere
nicht nachts einzusetzen. Tagsüber sollten sie nur unter Aufsicht
verwendet werden. Vor dem Einsatz ist es zu empfehlen, den Rasen
nach möglichen Unterschlupfen von Tieren abzusuchen.
Die
Schnitthöhe des Mähroboters sollte zudem möglichst hoch eingestellt
sein. Beim Kauf eines Gerätes sollte auf moderne Sensortechnik
geachtet werden, die Hindernisse so gut wie möglich erkennen und
umfahren. Damit leisten Gartenbesitzer einen wichtigen Beitrag zum
Artenschutz. Denn die Igel-Bestände sind in den vergangenen Jahren
stark zurückgegangen.
Er steht inzwischen auf der
Vorwarnliste gefährdeter Arten steht und ist durch das
Bundesnaturschutzgesetz besonders geschützt. Gesetzlich ist es
verboten, Igel zu beunruhigen, zu verletzen oder gar zu töten.
Das Umweltamt hat außerdem einen Leitfaden entwickelt, der Tipps
für eine naturnahe Gartengestaltung liefert. Auch das Förderprogramm
des Umweltamtes (www.duisburg.de/mehrgruen) trägt dazu bei,
Bürgerinnen und Bürger in diesem Vorhaben zu unterstützen.
Freibad Homberg: Neuer Eingangsbereich bietet mehr
Platz, Komfort und Barrierefreiheit
Die neue
Eingangsbereich des Freibades Homberg ist ab sofort großzügiger,
freundlicher und bequemer. Die im März begonnenen Umbauarbeiten sind
abgeschlossen. Der Vorplatz ist nun offener und übersichtlicher. So
können sich die Besucherinnen und Besucher besser verteilen –
besonders an heißen Tagen, wenn viele Menschen ins Bad wollen. Es
gibt mehr Platz, um zu warten und barrierefreie Zugänge. 700.000
Euro sind in die Neugestaltung investiert worden.

Oberbürgermeister Sören Link (rechts) und v.l.: Marc Rüdesheim und
Markus Farsch (Duisburg Sport) im neuen Eingangsbereich des Freibads
Homberg. Foto: Tanja Pickartz / Stadt Duisburg
„Das Freibad Homberg gehört einfach zum Sommer in Duisburg“, sagt
Oberbürgermeister Sören Link. „Jetzt passt auch der Eingangsbereich
wieder zu dem, was die Gäste erwarten dürfen: modern, übersichtlich
und einladend. Wer ankommt, bekommt sofort Lust auf einen Tag im
Freibad.“
Als Bauherrin und Betreiberin der Bäder übernahm
die Stadttochter DuisburgSport die Planung und Umsetzung des
Vorhabens: „Uns war wichtig, dass der neue Eingangsbereich nicht nur
optisch überzeugt, sondern vor allem den Anforderungen des täglichen
Betriebs gerecht wird“, erklärt Markus Farsch, Bereichsleiter Bau
und Technik die praxisgerechte Ausgestaltung.
Durch die
Neugestaltung befindet sich die Anstellfläche vor dem Eingang jetzt
vollständig auf dem Schwimmbadgelände. Dafür wurde eine ungenutzte
Nebenfläche umgestaltet: Alte Garagen wurden abgerissen und
Wildwuchs wurde beseitigt. So entstand ein offener Vorplatz, der den
Zugang deutlich entzerrt. Das neue Konzept umfasst zudem klare
Abläufe bei starkem Besucheraufkommen, sichere Wege, wenn zum
Beispiel die Gäste das Bad bei plötzlichem Wetterumschwung schnell
verlassen möchten.
Neu sind auch barrierefreie Zugänge – so
wurde ein 275 Meter langes, in den Boden eingelassenes, Leitsystem
für sehbehinderte Personen installiert. Zu den Veränderungen zählen
auch moderne Eingangs- und Bezahlsysteme, neu angelegte
Fahrradstellplätze, 1.900 Quadratmeter neue Pflasterflächen sowie
1.100 Quadratmeter neu gestaltete Grünflächen geschaffen.
Für mehr Sicherheit und eine angenehme Atmosphäre sorgen 14 neue
Wegeleuchten. Außerdem wurde das Gelände ökologisch aufgewertet: Auf
den Stellplätzen wurde ein Rasenfugenpflaster eingesetzt, sodass
Regenwasser besser versickern kann.
„Dass der Rat der Stadt
dem Vorhaben frühzeitig Priorität eingeräumt hat, ist ein wichtiges
Signal für den Wert unserer Bäderlandschaft“, sagt Marc Rüdesheim,
stellvertretender Betriebsleiter von DuisburgSport. „So konnten wir
zügig in die Umsetzung gehen und stehen nun vor einem Ergebnis, das
Gästen wie Team gleichermaßen zugutekommt.“
Bahn setzt umfangreiche Sanierung auf der Hauptstrecke durch
das Ruhrgebiet fort
Bahnreisende im Ruhrgebiet müssen
sich ab dem 5. September in Geduld üben: Dann wird für zwei Monate
die Hauptverbindung zwischen Essen und Dortmund gesperrt. Grund für
die bis zum 31. Oktober geltende Sperrung sind Arbeiten für den
RRX-Ausbau in Bochum, gleichzeitig werden auf der Strecke Schienen
ausgetauscht, Weichen instand gesetzt und Schallschutzarbeiten
durchgeführt.
Das Umleitungskonzept, das bereits im Frühjahr
dieses Jahres galt, wird erneut umgesetzt. So werden die Züge im
Nahverkehr zwischen Dortmund und Essen umgeleitet. Die S-Bahn-Gleise
bleiben in dem Streckenabschnitt unter der Woche befahrbar, an den
Wochenenden kommt es zu Sperrungen. Im gesamten Bauzeitraum fahren
Ersatzbusse.
Die Züge im Fernverkehr werden hauptsächlich
zwischen Dortmund und Essen sowie zwischen Dortmund und Köln bzw.
Düsseldorf umgeleitet. Am Bochumer Hauptbahnhof entfallen sämtliche
Fernverkehrshalte. Die Fahrplananpassungen sind bereits in den
Auskunftsmedien und Apps hinterlegt und werden über Aushänge an den
Bahnsteigen bekannt gegeben. Außerdem sind sie unter
https://www.bahn.de/service/fahrplaene abrufbar. idr
In die Pedale treten fürs STADTRADELN 2025 – mit neuer
Extrawertung für Schulen und Schulklassen
In einer
Woche startet das Stadtradeln in Duisburg, und dies bereits zum
zwölften Mal: Eine Anmeldung ist nach wie vor möglich unter
www.stadtradeln.de/duisburg. Auf der Website finden sich auch
weitere Informationen rund um das Stadtradeln, das am 19. September
endet.
Zu Beginn der Aktion wird es wieder eine
Eröffnungstour geben: Treffpunkt ist am 30. August um 10:30 Uhr das
Stadttheater in der Duisburger Innenstadt. Am Startpunkt wird
Umweltdezernentin Linda Wagner die Teilnehmenden begrüßen und das
diesjährige Stadtradeln eröffnen. Die Tour wird dann zirka 35
Kilometer lang sein, an der Ruhr entlang und durch den Duisburger
Stadtwald führen.
Zurück in Richtung Innenstadt geht es rund
um die Sechs-Seen-Platte. Neu ist diesmal, dass es in diesem Jahr
eine extra Wertung für Schulen und Schulklassen geben wird. Zu
gewinnen sind für die Klasse mit dem meisten Kilometern pro Person
insgesamt 400 Euro für die Klassenkasse. Die zweiten und dritten
Plätze werden ebenfalls für ihr Engagement belohnt.
Die
Anmeldung dazu erfolgt ebenfalls über die Stadtradeln-Anmeldeseite.
Dabei ist die Sonderwertung „Schulradeln“ anzuklicken und die Schule
auszuwählen. Für jede teilnehmende Klasse kann ein eigenes Team
gegründet werden. Das Stadtradeln in Duisburg ist mittlerweile zu
einer festen Institution geworden und unter den Radfahrerinnen und
Radfahrern bekannt. So konnten im Laufe der Jahre sowohl die
Teilnehmerzahl als auch die erzielten Kilometer kontinuierlich
gesteigert werden, auch wenn im letzten Jahr die Zahlen leicht
zurückgegangen sind.
Die aktivsten Radlerinnen und Radler
werden, wie schon in den vergangenen Jahren, zu einem Empfang ins
Rathaus eingeladen und mit Preisen belohnt. Dazu werden unter allen
Teilnehmenden einige Preisträger ausgelost, so dass alle eine Chance
auf einen Gewinn haben. Warum sind die Aktion und eine
umweltfreundliche Fortbewegung wichtig? Ereignisse wie Starkregen
oder auch Hitzeperioden lassen es für jeden sichtbar werden: Der
Klimawandel ist da und bedroht alle Menschen.
Ein wichtiger
Beitrag, um die Folgen des Klimawandels abzumildern ist die
Verkehrswende, bei der das Fahrrad eine bedeutende Rolle spielt. Die
Aktion Stadtradelns möchte für dieses emissionsfreie Fahrzeug
Fahrrad werben und Menschen dazu bewegen, das Auto öfter mal stehen
zu lassen.
Tag der Oststraße in Neudorf – Ein Fest
für die ganze Familie
Am Donnerstag, dem 4. September,
ab 11 Uhr, lädt der Bürgerverein Neudorf gemeinsam mit
Gewerbetreibenden und Händlern herzlich zum „Tag der Oststraße“ ein.

Entlang der Oststraße erwartet die Besucherinnen und Besucher ein
buntes Programm mit zahlreichen Attraktionen, Präsentationen,
kulinarischen Angeboten sowie vielfältigen Ständen von Vereinen und
Verbänden. Der Tag bietet Gelegenheit, die Oststraße als lebendige
Einkaufs- und Begegnungsmeile zu erleben und gleichzeitig die
Gemeinschaft im Stadtteil zu stärken.
„Wir sind stolz
darauf, gemeinsam mit den Anwohnern und Geschäftsleuten die
Oststraße zu feiern und ihre Vielfalt zu präsentieren“, so der
Vorstand des Bürgervereins Neudorf.
Doch damit nicht
genug: Bereits am Freitag, dem 5. September, ab 11 Uhr, geht es mit
dem traditionellen Weinfest weiter. Hier laden edle Tropfen,
gemütliche Atmosphäre und kulinarische Spezialitäten zum Verweilen
und Genießen ein. Der Kreativmarkt rundet den Tag ab. Der
Bürgerverein Neudorf und alle Mitwirkenden freuen sich auf
zahlreiche Gäste an beiden Tagen.
Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie: Nichts
bleibt, wie es ist
Geht es um das Thema Wandel, passt
wohl kaum eine Stadt besser als Duisburg: Hier diskutieren vom 22.
bis 26. September rund 2.000 Expert:innen auf dem 42. Kongress der
Deutschen Gesellschaft für Soziologie das Leitthema „Transitionen“.
Das Institut für Soziologie der Universität Duisburg-Essen richtet
erstmals die traditionsreiche Fachveranstaltung aus.
Zur
Eröffnung in der Philharmonie Mercatorhalle werden Oberbürgermeister
Sören Link und die Schriftstellerin Lena Gorelik erwartet. Im
Mittelpunkt des Kongresses steht die Frage, wie Gesellschaft und
Leben der Menschen sich entwickeln und verändern oder wie sie neue
Formen annehmen - in Gemeinschaften, in Institutionen und im Alltag
einzelner.
„Die Soziologie reflektiert und begleitet
gesellschaftliche Veränderungen kritisch, kann aber auch aktiv
Einfluss nehmen, indem sie Diskussionen anstößt“, so
Soziologieprofessorin Dr. Helen Baykara-Krumme, die mit vier
Mitarbeiterinnen des Instituts für Soziologie den Kongress am Campus
Duisburg der Universität Duisburg-Essen (UDE) organisiert.
„Einige Transitionen sind unvorhersehbar und kaum kontrollierbar,
wie sich am Beispiel des Klimawandels zeigt, andere im Bereich der
Bildung oder der Stadtentwicklung werden gezielt gestaltet, um
gesellschaftliche Ziele zu erreichen. Die soziologische Forschung
soll sowohl die Dynamiken als auch die Konflikte hinter Transitionen
untersuchen, darunter Machtverhältnisse, Ressourcenverteilung und
die sich daraus ergebenden sozialen Ungleichheiten“, erklärt Prof.
Baykara-Krumme.
Die Plenen, Hauptvorträge und Panels
befassen sich nicht nur mit Wandel in Bereichen wie Demokratie,
Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Arbeit oder Familie, sondern auch
mit den Methoden der Soziologie selbst: Bei der Frage, wie sich
Transitionen erfassen und analysieren lassen, spielen nicht nur
klassische sozialwissenschaftliche Instrumente wie Zeitreihen- und
Längsschnittanalysen oder Diskursanalysen eine Rolle, sondern auch
neue Ansätze, etwa aus der Big Data- oder der interdisziplinären
Forschung. Im Rahmenprogramm geht es um den Zeitenwandel Duisburgs.
So gibt es Exkursionen und Führungen durch die Stadtteile
Marxloh, Ruhrort und Hochfeld sowie eine Besichtigung des
Innenhafens. Außerdem bietet der erste DGS-Kongress in Duisburg mit
dem ‚Campusabend‘ am Dienstag, 23. September, eine Besonderheit:
Dieses neue Format richtet sich nicht nur an Kongressteilnehmende,
sondern auch an weitere Hochschulangehörige und die
Stadtgesellschaft.
Der Campus präsentiert sich in
ausgelassener Abendstimmung – mit einem Live-Auftritt der beiden
Physiker Dr. Nicolas Wöhrl (UDE) und Dr. Reinhard Remfort vom
Podcast „Methodisch inkorrekt!“ im Audimax, Foodtrucks im L‑Bereich
und vielen Gelegenheiten zum Austausch.
Bundesverband der Freien Berufe e. V.: „Arbeitszeitwende für mehr
Flexibilität.“
„Die freiberuflichen Praxen, Kanzleien,
Büros und Apotheken stehen unter Druck. Der Ressourcenmangel –
getrieben durch Fachkräftemangel und überbordende Bürokratie –
bringt die Freiberuflerinnen und Freiberufler längst an ihre
Belastungsgrenzen. Frühere Umfragen zeigen: Der Fachkräftemangel
bremst unsere Wirtschaftsleistung um jährlich 16 Milliarden Euro.
Während 27 Prozent der Arbeitszeit für Bürokratie aufgewendet
werden, die nicht zu den Kernaspekten ihrer freiberuflichen
Tätigkeit zählt, arbeitet jede beziehungsweise jeder Dritte bereits
über Anschlag. Das ist ineffizient und demotivierend.
Trotzdem begegnen Freiberuflerinnen und Freiberufler dieser
Situation mit hoher Flexibilität. Das bestätigt auch die aktuelle
Sonderauswertung unserer jüngsten Konjunkturumfrage: Als
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber setzen die Freien Berufe auf
Eigenverantwortung, Vertrauen und eine moderne Arbeitskultur.
Wo es möglich ist, bieten sie etwa Gleitzeit, Teilzeit oder eine
Vier-Tage-Woche an – und schaffen so nicht nur Freiräume, sondern
auch attraktive Arbeitsplätze. Flexible Modelle und echte
Wertschätzung sind entscheidend, um qualifizierte Fachkräfte zu
gewinnen sowie zu halten und den Teamgeist zu stärken“, so
BFB-Präsident Dr. Stephan Hofmeister zu den Ergebnissen einer
Sonderauswertung der BFB-Konjunkturumfrage Sommer 2025.
„Die
im Koalitionsvertrag angekündigte Reform der täglichen
Höchstarbeitszeit hin zu einem flexiblen, wochenbasierten Modell
muss so umgesetzt werden, dass sie in der Praxis greift – mit
Spielraum etwa für Projektspitzen, Belastungsphasen oder Notdienste
– und den Verwaltungsaufwand spürbar verringert. Statt neue
bürokratische Belastungen zu schaffen – wie etwa durch das geplante
Tariftreuegesetz in seiner jetzigen Form – braucht es gezielte
Entlastungen. Eine leistungsfähige, digitale Verwaltung ohne
Medienbrüche ist dafür Grundvoraussetzung. Flexible Arbeitszeiten
sind zudem ein Schlüssel zur besseren Vereinbarkeit von Familie und
Beruf, wobei eine verlässliche Kinderbetreuung – auch zu Randzeiten
und für alle Altersgruppen – ebenso wichtig ist.
Viele
Lösungsansätze sind im Koalitionsvertrag angelegt. Doch es fehlt an
der Umsetzung. Die Bundesregierung muss jetzt handeln und den Rahmen
schaffen, in dem wir Freie Berufe unsere Potenziale entfalten können
– auch im Interesse unserer Teams, Patientinnen, Mandanten,
Klientinnen und Kunden, der übrigen Wirtschaft und der
Gesellschaft.“
Ergebnisse: Breites Spektrum an
Arbeitszeitmodellen
Fast neun von zehn Befragten (86,4 Prozent)
ermöglichen ihren Mitarbeitenden Teilzeitoptionen. Knapp zwei
Drittel bieten flexible Pausengestaltung (64 Prozent) und Gleitzeit
(62,8 Prozent) an. Für knapp die Hälfte ist die Vier-Tage-Woche
(49,3 Prozent) umsetzbar. Arbeitszeitkonten (44,8 Prozent) und die
Möglichkeit zu unbezahltem Urlaub (43,9 Prozent) gehören bei vielen
zum Angebot, ebenso wie eine flexible Einteilung der täglichen
Arbeitszeit (39,8 Prozent). Wo es die Tätigkeit erlaubt, setzen
Freie Berufe moderne Arbeitszeitmodelle um – selbst in Teams mit
starker persönlicher Präsenz und direktem Kontakt zu Patientinnen,
Mandanten, Klientinnen und Kunden.
Für modernes Arbeiten sind
drei Aspekte für die Abläufe im Betrieb besonders wichtig:
Vor
allem wünschen sich die Freiberuflerinnen und Freiberufler mehr
medienbruchfreie digitale Prozesse – besonders auch bei Empfängern
wie Behörden –, um Abläufe zu erleichtern und zu beschleunigen.
Ebenso zentral sind praxistaugliche Arbeitszeitmodelle, die den
freiberuflichen Praxen, Kanzleien, Büros und Apotheken sowie ihren
Beschäftigten mehr Flexibilität ermöglichen.
Überdies sind für
eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch eine
verlässliche Kinderbetreuung und weitere Unterstützungsangebote
wichtig.
Für modernes Arbeiten sind folgende grundlegende
Rahmenbedingungen entscheidend:
- Abbau bürokratischer Hürden
- Eine angemessene und auskömmliche Vergütung
- Zugang zu
qualifizierten Fachkräften
Zentrale Elemente der
Mitarbeiterführung und -entwicklung
Offene Kommunikation hat bei
Freiberuflerinnen und Freiberuflern mit Mitarbeitenden einen hohen
Stellenwert: 93,7 Prozent der Befragten geben an, dass der Austausch
zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden offen gestaltet wird,
87,3 Prozent bestätigen dies auch für die Kommunikation im
Kollegenkreis. Auch Wertschätzung und Lob sind fest verankert – 83,1
Prozent geben an, dass diese aktiv vermittelt werden. Zudem prägt
eine hohe Eigenverantwortung (81,5 Prozent) die Arbeitskultur vieler
freiberuflicher Betriebe.
Weiterbildung
Freiberuflerinnen
und Freiberufler motivieren ihre Mitarbeitenden gezielt zur
Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen (77,8 Prozent) und informieren
sie über die vielfältigen Angebote (71,5 Prozent). Die Kosten werden
dabei meist vollständig (70,5 Prozent) oder zumindest teilweise
übernommen. Auch eine Freistellung für die Weiterbildungszeiten wird
häufig (62,8 Prozent) ermöglicht.
Über die Umfrage
Sonderteil zu modernem Arbeiten auf Basis der BFB-Konjunkturumfrage
Sommer 2025 des Instituts für Freie Berufe (IFB) im Auftrag des BFB
vom 17. März bis 28. April 2025 unter rund 1.700 Freiberuflerinnen
und Freiberuflern.
Inflation für alle Haushaltstypen
unter Zielrate der EZB, weitere Zinssenkung im September nötig
Die Inflationsrate in Deutschland hat im Juli erneut bei 2,0 Prozent
gelegen und damit genau beim Inflationsziel der Europäischen
Zentralbank (EZB). Von neun verschiedenen Haushaltstypen, die sich
nach Einkommen und Personenzahl unterscheiden, hatten alle eine
haushaltsspezifische Teuerungsrate unter dem Zielwert. Konkret
reichte die Spannweite im Juni von 1,5 bis 1,9 Prozent, der
Unterschied lag also bei geringen 0,4 Prozentpunkten, zeigt der neue
Inflationsmonitor des Instituts für Makroökonomie und
Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung.*
Zum
Vergleich: Auf dem Höhepunkt der Inflationswelle im Herbst 2022
betrug die Spanne 3,1 Prozentpunkte. Während Haushalte mit niedrigen
Einkommen, insbesondere Familien, während des akuten Teuerungsschubs
der Jahre 2022 und 2023 eine deutlich höhere Inflation schultern
mussten als Haushalte mit mehr Einkommen, war ihre Inflationsrate im
Juli 2025 wie in den Vormonaten niedrig: Der Warenkorb von Paaren
mit Kindern und niedrigen Einkommen verteuerte sich um 1,5 Prozent.
Eine identische Inflationsrate hatten Alleinerziehende mit mittlerem
Einkommen. Alleinlebende mit niedrigem bzw. mittlerem Einkommen
folgten mit jeweils 1,6 Prozent.
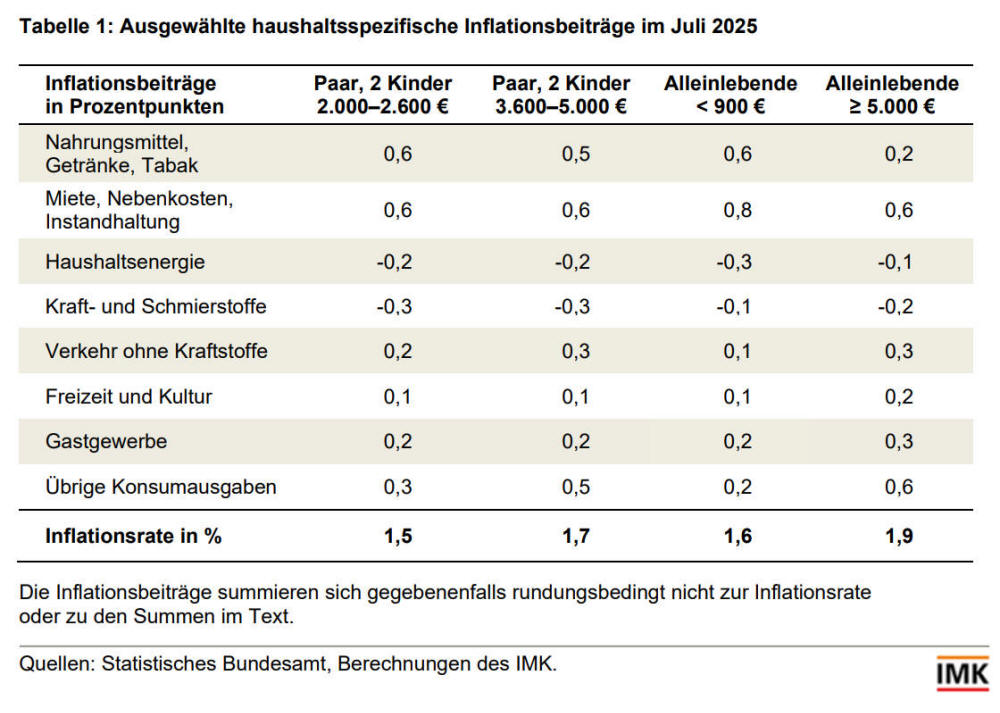
Als einzige Haushaltstypen hatten im Juli Alleinlebende mit sehr
hohen Einkommen und Familien mit hohen Einkommen mit je 1,9 Prozent
eine Inflation nahe beim EZB-Ziel, allerdings ebenfalls darunter.
Ein wichtiger Faktor für das etwas höhere Niveau ist, dass bei
diesen konsumstarken Haushaltstypen die erneut niedrigeren
Energiepreise weniger stark ins Gewicht fallen als bei Haushalten
mit weniger Einkommen, deren Warenkörbe stärker durch Güter des
täglichen Bedarfs geprägt sind.
Zudem fragen Haushalte mit
höheren Einkommen stärker Dienstleistungen nach, die sich derzeit
noch merklich verteuern, wie Versicherungsdienstleistungen und
soziale Dienstleistungen. Allerdings nimmt der Preisauftrieb bei
Dienstleistungen mittlerweile etwas ab.
Die drei anderen
untersuchten Haushaltstypen, Paarfamilien und Paare ohne Kinder mit
jeweils mittleren Einkommen sowie Alleinlebende mit höheren
Einkommen, verzeichneten im Juli eine Inflationsrate von je 1,7
Prozent.
Inflationslage im gesamten Euroraum entspannt
„Die Inflationslage ist in Deutschland und im Euroraum insgesamt
mittlerweile entspannt“, lautet das aktuelle Fazit von Dr. Silke
Tober, IMK-Expertin für Geldpolitik und Autorin des
Inflationsmonitors. „So nimmt der Preisauftrieb bei Dienstleistungen
auch im Euroraum weiter ab, die Inflation lag den zweiten Monat in
Folge bei 2,0 Prozent und sie dürfte wie auch in Deutschland im
weiteren Jahresverlauf um das Inflationsziel der EZB von zwei
Prozent schwanken.“
Tober hält in dieser Situation eine
weitere Leitzinssenkung durch die EZB bei ihrer Sitzung im September
für erforderlich. Denn gleichzeitig lahme die Wirtschaft,
insbesondere weil die US-Zölle, hohe Energiepreise und die starke
Aufwertung des Euro die Konjunktur belasteten, wodurch auch das
Risiko einer mittelfristig sogar zu niedrigen Inflation steige.
„Nach der Zinspause im Juli sollte die EZB daher den Leitzins auf
der nächsten Sitzung erneut senken und damit einen Beitrag zur
Stärkung der Investitionstätigkeit leisten. Dies gilt umso mehr als
die Investitionsschwäche zum Teil durch die übermäßig restriktive
Geldpolitik der EZB bewusst herbeigeführt wurde“, schreibt die
Forscherin.
Lebensmittel knapp 39 Prozent teurer als im Juli
2019
Das IMK berechnet seit Anfang 2022 monatlich spezifische
Teuerungsraten für neun repräsentative Haushaltstypen, die sich nach
Zahl und Alter der Mitglieder sowie nach dem Einkommen
unterscheiden.
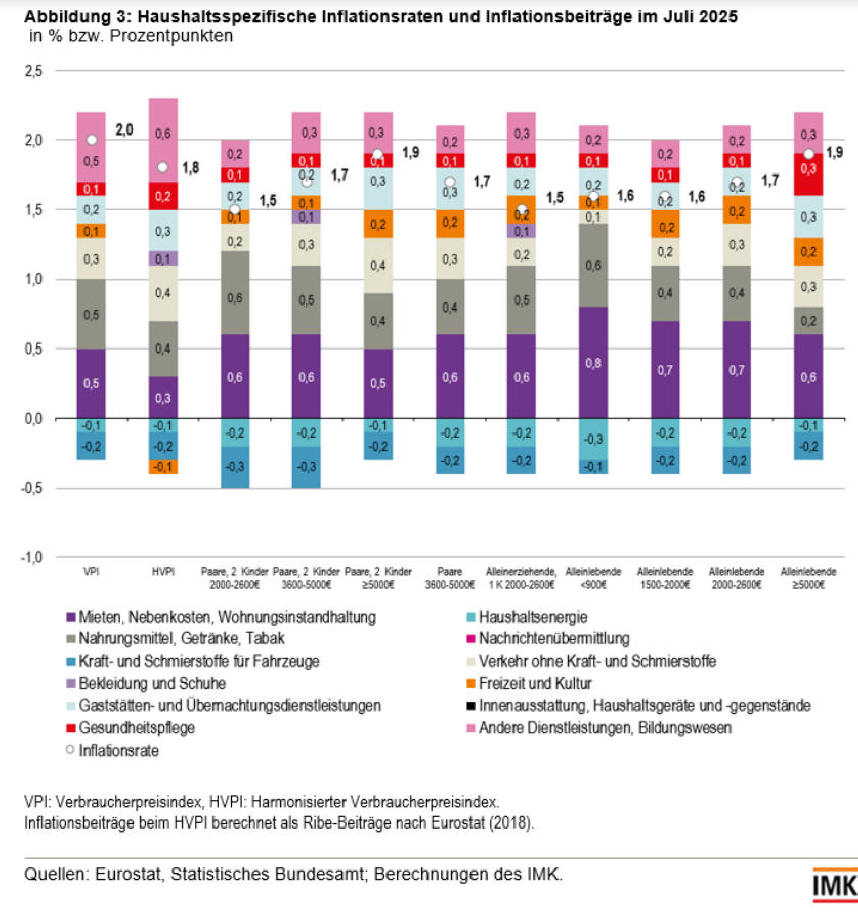
Dass aktuell alle vom IMK ausgewiesenen haushaltsspezifischen
Inflationsraten leicht unter der Gesamtinflation liegen, wie sie das
Statistische Bundesamt berechnet, liegt an unterschiedlichen
Gewichtungen: Das IMK nutzt für seine Berechnungen weiterhin die
repräsentative Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS), während
Destatis seit Anfang 2023 primär die Volkswirtschaftliche
Gesamtrechnung heranzieht.
Die längerfristige Betrachtung
illustriert auch, dass Haushalte mit niedrigem bis mittlerem
Einkommen von der starken Teuerung nach dem russischen Überfall auf
die Ukraine besonders stark betroffen waren, weil Güter des
Grundbedarfs wie Nahrungsmittel und Energie in ihrem Budget eine
größere Rolle spielen als bei Haushalten mit hohen Einkommen.
Diese wirkten lange als die stärksten Preistreiber, zeigt der
längerfristige Vergleich, den Tober in ihrem neuen Bericht ebenfalls
anstellt: Die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke
lagen im Juli 2025 um 38,7 Prozent höher als im Juli 2019, also vor
Pandemie und Ukrainekrieg. Damit war die Teuerung für diese
unverzichtbaren Basisprodukte mehr als dreimal so stark wie mit der
EZB-Zielinflation von kumuliert 12,6 Prozent in diesem Zeitraum
vereinbar. Energie war trotz der Preisrückgänge in letzter Zeit um
35,2 Prozent teurer als sechs Jahre zuvor, darunter Haushaltsenergie
um 46,3 Prozent und Kraftstoffe um 20,2 Prozent.
Die Meinung im fairen Dialog sagen Viel Einigkeit und
wenig Kontroverses bei der Duisburg-Ausgabe von „Das Ruhrgebiet
spricht“
„Das Ruhrgebiet spricht“ heißt die
Aktion, zu der vier evangelische Citykirchen in Dortmund, Essen,
Bochum und Duisburg am vergangenen Wochenende interessierte,
aufgebrachte, verdrossene, neugierige und engagierte Mitmenschen
eingeladen hat. In insgesamt 150 Vieraugen-Gesprächen sollten die
sich auf einander und auf einen anderen Standpunkt einlassen.
Zuvor wurden bei der Anmeldung im Internet anhand einiger
Kernfragen Gesprächspaare einander zugeordnet, dabei sollten
möglichst Menschen verschiedener Ansichten miteinander sprechen,
statt übereinander. „Es brodelt der Schmelztiegel Ruhrpott“, sagte
Pfarrer Martin Winterberg bei der Begrüßung in Duisburg auf der
Wiese hinter der Salvatorkirche, „und man kann durchaus den Eindruck
haben, dass die Temperatur ansteigt.“
Winterberg betonte,
auch im Hinblick auf die kommenden Wahlen, wie wichtig ein echter
Austausch sei, dafür solle im Raum der Kirche so oft wie möglich
Gelegenheit geboten werden. Ein bisschen Verwunderung erzeugten die
stark unterschiedlichen Anmeldezahlen, in Dortmund kamen 118
Anmeldungen zustande, in Duisburg waren es nur 26.
„Wir
wissen nicht genau, woran das liegt“, sagte der Pfarrer im Gespräch,
„aber wir geben nicht auf. Im Gegenteil, wir wollen uns umso mehr
darum bemühen, dass die Menschen Lust bekommen, ihre Meinung im
fairen Dialog zu sagen und ihre Blase zu verlassen, wenn sie denn in
einer sind.“
Zu den angemeldeten Gesprächsteilnehmern
kamen spontan noch einige dazu und wurden auf der Kirchwiese mit
Akkordeonmusik, Kaffee aus dem Kirchenmobil der Pfarrei St. Johann
und Grillwürstchen empfangen. Hanna Hassenjürgen und Julia Foth
hatten sich beide gewappnet, falls sie im Gespräch auf einen
Menschen mit sehr rechten Auffassungen gestoßen wären.
Aber
sie verstanden sich auf Anhieb und sprachen über Diversität und
darüber, dass die Stadt in sogenannte Problemviertel und bürgerliche
Ecken zerfällt. Hoffnung macht beiden, dass sich immer noch viele
Menschen gesellschaftlich engagieren und sich austauschen. Und mit
Blick auf die AfD sagen beide: „Die Zeit der einfachen Wahrheiten
ist vorbei.“
Auch Oskar Mikulski (28) und Frank-Michael
Rich (66) stellten bei aller Verschiedenheit doch viele
Übereinstimmungen fest. „Man muss sich besseres Gehör verschaffen,
denn es wird in unserer Gesellschaft nicht jedem gleich gut
zugehört,“ sagt Mikulski, der mit Rich über Generationsprobleme,
über die Bundeswehr und über Bildung gesprochen hatte. Da helft es
nur, wenn man sich Gehör verschaffe. Ob man das als Presbyter in
einer Kirchengemeinde tut, wie Rich oder sich bei der
paneuropäischen Partei VOLT engagiert, wie Mikulski, das ist dabei
zweitrangig.
Jutta Eckardt und Karin Flesch bewegte
gemeinsam eine Frage, die sich durch alle Gespräche zog, die auf der
Kirchwiese geführt wurden. „Wir wollten doch alle mal mit einem
AfD-Wähler diskutieren, wo sind die denn?“ fragten sie sich beide.
Sie waren also „angenehm enttäuscht“ voneinander und sprachen „über
Gott und die Welt“ miteinander. Dass sie sich von der Politik nicht
gesehen fühlen, darin waren sie einig. Und dass es gar nicht so
leicht ist, die eigene Blase zu verlassen, das betraf auch beide.
„Im eigenen Bekanntenkreis gibt es keine AfD-Wähler, wir
dachten halt, die treffen wir hier.“ Katharina (27) aus Dinslaken
und Detlef (66) aus Walsum kamen gemeinsam zu dem Schluss, „dass die
Leute oft nicht das Bewusstsein haben, dass eine politische
Entscheidung etwas in ihrem Leben verändern kann.“ Katharina hatte
sich auch auf eine hitzige Diskussion mit einer AfD nahen Person
eingestellt. Nun fragt sie sich, warum die Leute, die doch im
Internet immer so freigiebig mit ihren politischen Ansichten
umgehen, diese Gelegenheit zum echten Austausch ungenutzt gelassen
haben.
Auch das Fehlen der großen Gruppe von Duisburgern
und Duisburgerinnen mit Migrationshintergrund fiel den
Gesprächsteilnehmern auf. Josip Sosic, der in der Volkshochschule
den Fachbereich der Politischen Bildung verantwortet, zeigte sich
aber sehr zufrieden mit der konstruktiven Gesprächsatmosphäre. „Das
soll ja erst der Anfang solcher Gespräche gewesen sein“, sagte er,
„mal sehen, was sich daraus noch alles ergibt.“ Sabine Merkelt-Rahm

Pfarrer Winterberg )li) an der Salvatorkirche zeigen, eines zeigt
ihn im Gespräch mit Josip Sosic von der Volkshochschule Duisburg,
die den Aktionstag in Duisburg mit unterstützt hat (Foto: Bartosz
Galus)
Migration in Duisburg zwischen neuer
Heimat und Kirchenasyl
Weltladen Duisburg lädt zu
Vortrag und Diskussion
Der Weltladen
Duisburg ist viel mehr als ein Ort für den Kauf fairer
Waren. So organisiert das Team der Ehrenamtlichen, das den
Weltladen betreibt, regelmäßig Veranstaltungen zu Themen
der „Einen Welt“.
Jetzt lädt der Weltladen zu
einem Vortrag über Migration in Duisburg zwischen neuer
Heimat und Kirchenasyl und anschließender Diskussion: am
29. August 2025, um 19 Uhr im Weltladen Duisburg, an der
Koloniestraße 92 in Neudorf. Unter dem Titel „Ohne Angst
verschieden sein“ geben die Referenten Reiner Siebert,
Presbyter und Migrationsbeauftragter, und Sören Asmus,
Pfarrer für interreligiösen interkulturellen Dialog, beide
Evangelische Kirche Duisburg, Einblicke in die Situation
von Geflüchteten in Duisburg unter den Rahmenbedingungen
internationaler und nationaler Entwicklungen.
Der
Eintritt zu der Kooperationsveranstaltung der Amnesty
International Gruppe Duisburg, Evangelischer Kirche
Duisburg und dem Weltladen Duisburg e.V. ist frei. Infos
zum Weltladen gibt es unter
www.weltladen-duisburg.de.

Ehrenamtliche des Weltladens bei einem Planungstag im
Januar 2025
Meidericher Kirchenkneipe unter freiem
Himmel... mit Hawaiifeeling
An einem der vier
Freitage jeden Monats öffnet im Gemeindezentrum der
Evangelischen Kirchengemeinde Duisburg Meiderich, Auf dem
Damm 8, die Kirchenkneipe. So auch am 29. August 2025, wo
Besucherinnen und Besucher nach dem
19-Uhr-Wochenabschlussandacht ab 19.30 Uhr wieder gute
Getränke, leckere Kleinigkeiten und eine gemütliche
Atmosphäre erwarten können, die zum Wohlfühlen einlädt und
Platz für nette Gespräche lässt.
Bei schönem
Wetter wird auf dem Kirchplatz gefeiert, bei schlechtem
drinnen. Bei dieser Ausgabe der Kirchenkneipe steht alles
im Zeichen von Hawaii - mit Südseeklängen und exotischen
Köstlichkeiten. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz
unter www.kirche-meiderich.de oder im Gemeindebüro unter
0203-4519622.
Meisterhafte Klarinette in
der Marienkirche mit ungarischen Anklängen
Die „Musik am Marientor“ am Sonntag, 31. August, hält ab
17 Uhr „Meisterhafte Klarinette mit ungarischen Anklängen“
bereit. Das verspricht der Titel des Konzertes in der
Marienkirche, Josef-Kiefer-Straße 10, bei dem der
Quintett-Satz B-Dur KV 516c von W. A. Mozart, Béla Bartóks
Contrasts für Violine, Klarinette und Klavier und das
Klarinettenquintett h-Moll, op. 115 von Johannes Brahms
erklingen.
Für die wunderbaren Musik sorgen
Andreas Oberaigner (Klarinette), Tonio Schibel & Osman
Mustafazade (Violine), Leona Kondratenko (Viola), Inés
Bueno Lopez (Violoncello) und Mariia Matsiievska
(Klavier). Der Eintritt kostet 18 Euro, Karten gibt es nur
an der Abendkasse. Infos zum Gotteshaus gibt es unter
www.ekadu.de.

Die im Jahr 2021 renovierte Marienkirche im Herzen der
Altstadt (Foto: Ulrich Sorbe)
Pfarrer Korn am Service-Telefon der
evangelischen Kirche in Duisburg
„Zu welcher
Gemeinde gehöre ich?“ oder „Wie kann ich in die Kirche eintreten?“
oder „Holt die Diakonie auch Möbel ab?“: Antworten auf Fragen dieser
Art erhalten Anrufende beim kostenfreien Servicetelefon der
evangelischen Kirche in Duisburg.
Es ist unter der Rufnummer
0800 / 12131213 auch immer montags von 18 bis 20 Uhr besetzt, und
dann geben Pfarrerinnen und Pfarrer Antworten auf Fragen rund um die
kirchliche Arbeit und haben als Seelsorgende ein offenes Ohr für
Sorgen und Nöte. Das Service-Telefon ist am Montag, 25. August 2025
von Stefan Korn, Pfarrer in der Evangelischen Kirchengemeinde
Alt-Süd, besetzt.

NRW: Preisentwicklung rund um das Pausenbrot
* Butterpreise in NRW um 7,3 % gestiegen.
* Preise für
Toastbrot im Vergleich zum Vorjahr um 10,5 % gesunken.
* Möhren
25,5 % günstiger.
Die Preise für Butter sind in
Nordrhein-Westfalen zwischen Juli 2024 und Juli 2025 um 7,3 %
gestiegen. Wie das Statistische Landesamt Nordrhein-Westfalen zum
Start des neuen Schuljahres mitteilt, gab es rund um das Frühstück
und das Pausenbrot unterschiedliche Preisentwicklungen.
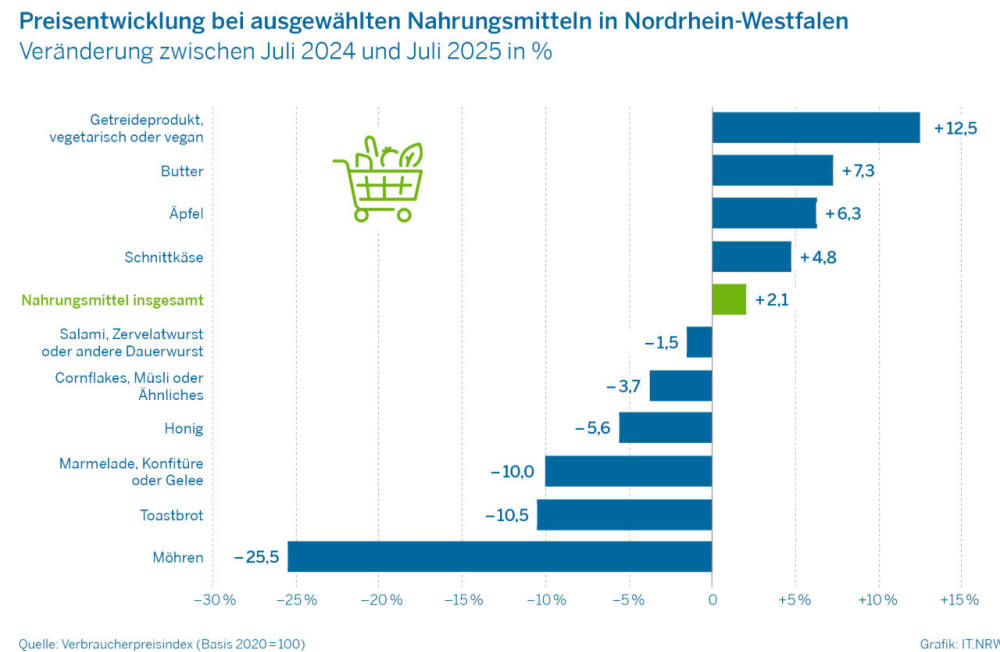
Während insbesondere die Preise für Toastbrot (–10,5 %) gesunken
sind, wurden frische Brötchen um 3,4 % und Brötchen zum Fertigbacken
um 3,2 % teurer angeboten als noch ein Jahr zuvor. Zum Vergleich:
Die Preise für Nahrungsmittel insgesamt sind zwischen Juli 2024 und
Juli 2025 um 2,1 % gestiegen. Auch Käse verzeichnete zwischen Juli
2024 und Juli 2025 einen Preisanstieg, so stiegen sowohl die Preise
für Weich- (+7,8 %), Schnitt- (+4,8 %) als auch Frischkäse (+1,4 %).
Für vegetarische oder vegane Fleisch- oder Wurstalternativen
sowie Brotaufstriche auf Getreidebasis mussten Verbraucherinnen und
Verbraucher im letzten Monat mehr ausgeben als ein Jahr zuvor
(+12,5 %). Dagegen vergünstigten sich Salami, Zervelatwurst oder
andere Dauerwurst um 1,5 % sowie Wurstaufschnitt um 1,9 %.
Wer bei Frühstück und Pausenbrot im vergangenen Monat auf süßen
Aufstrich setzte, konnte im Vergleich zum Vorjahresmonat sparen. So
sanken die Preise für Marmelade, Konfitüre oder Gelee um 10,0 %, die
für Honig um 5,6 % und die für Quark um 3,4 %.
Preise für
Cornflakes, Müsli o. Ä. gesunken, für Bananen gestiegen
Bei
Gemüse und Obst, die gerne zum Frühstück oder als Pausenhofsnacks
gegessen werden, war ebenfalls eine unterschiedliche
Preisentwicklung zu beobachten: Während die Preise für Möhren
(–25,5 %) und Paprika (–11,9 %) gesunken sind, stiegen die Preise
für Bananen (+6,4 %) und Äpfel (+6,3 %) an. Frühstücksalternativen
wie Cornflakes, Müsli oder Ähnliches wurden um 3,7 % günstiger
angeboten. Milch verteuerte sich derweil um 4,0 % und Joghurt um
3,4 %.
Straßenverkehrsunfälle im 1. Halbjahr 2025:
Zahl der Unfälle um 2 % gesunken
Zahl der Verkehrstoten im 1.
Halbjahr 2025 um 25 Personen gegenüber dem Vorjahreszeitraum
gestiegen
In den ersten sechs Monaten des Jahres 2025
gab es in Deutschland rund 1,21 Millionen Straßenverkehrsunfälle.
Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes
(Destatis) waren das 23 300 oder 2 % weniger als im
Vorjahreszeitraum. Bei gut einer Millionen Unfällen blieb es bei
Sachschaden (-2 %), bei rund 139 800 Unfällen gab es Getötete oder
Verletzte (+1 %).
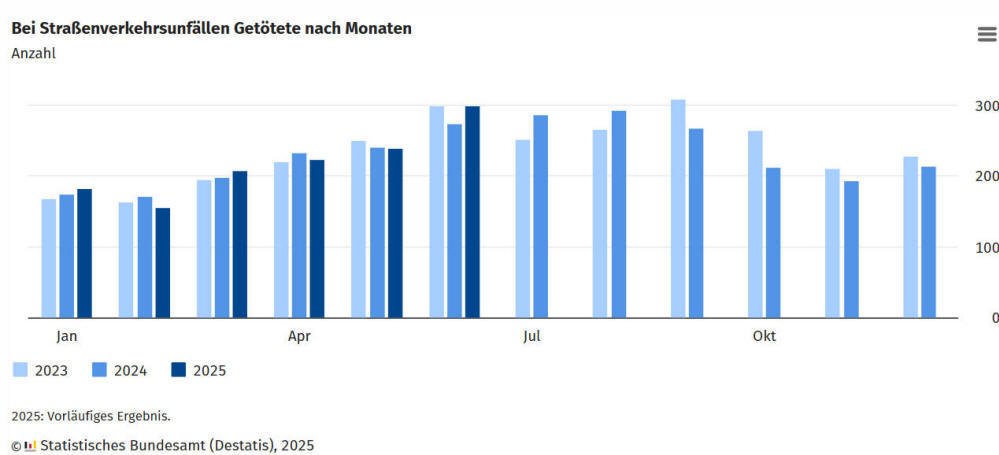
Insgesamt sind 175 000 Menschen im 1. Halbjahr 2025 bei
Straßenverkehrsunfällen verletzt worden – in etwa so viele wie im
1. Halbjahr 2024. Die Zahl der Verkehrstoten stieg dagegen um
25 Personen auf 1 322.
Zahl der Verkehrstoten je
1 Million Einwohnerinnen und Einwohner im Vergleich zum 1. Halbjahr
2024 unverändert Auf die Bevölkerungszahl bezogen starben im
Straßenverkehr im 1. Halbjahr 2025 in Deutschland durchschnittlich
16 Menschen je 1 Million Einwohnerinnen und Einwohner. Sowohl
gegenüber dem 1. Halbjahr 2024 als auch gegenüber dem 1. Halbjahr
2023 veränderte sich dieser Wert nicht.
Juni 2025: 10 %
weniger Verkehrsunfälle als im Vorjahresmonat Nach vorläufigen
Zahlen sank im Juni 2025 die Zahl der polizeilich erfassten Unfälle
gegenüber dem Vorjahresmonat um 10 % auf insgesamt 195 000 Unfälle.
Bei 165 000 Unfällen blieb es bei Sachschaden (-12 %).
Bei
29 900 Unfällen kam es zu Personenschaden (+3 %). Mit rund
37 000 Personen wurden 2 % mehr Verkehrsteilnehmende verletzt. Die
Zahl der Getöteten ist gegenüber dem Vorjahresmonat um 26 Personen
auf 301 gestiegen und damit so hoch wie im Juni vor zwei Jahren.
NRW: Positive Entwicklung der
Reallöhne setzt sich im zweiten Quartal fort
*
Reallöhne stiegen im zweiten Quartal 2025 um 2,5 %.
* Anstieg
der Nominallöhne übertraf Zunahme der Verbraucherpreise.
Die
effektiven Bruttomonatsverdienste der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer sind in Nordrhein-Westfalen im zweiten Quartal 2025
real – also preisbereinigt – um 2,5 % höher gewesen als im
Vorjahreszeitraum. Wie das Statistische Landesamt auf Basis der
Ergebnisse der Verdiensterhebung mitteilt, übertraf der Anstieg der
Nominallöhne von 4,4 % die Zunahme der Verbraucherpreise von 1,9 %.
Damit setzt sich die seit dem 2. Quartal 2023 positive Entwicklung
der Reallöhne weiter fort.