






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 10. Kalenderwoche:
7. März
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Samstag, 8. , Sonntag, 9. März 2025 - Internationaler Frauentag
•
DVG wird am 12. März ganztägig
bestreikt
LKA-NRW: Achtung, Betrüger und keine
Kollegen am Telefon
Schützen Sie sich vor
Vishing-Angriffen - Das LLKA NRW warnt vor einer aktuellen
Betrugsmasche, die sich gegen Unternehmen richtet
Das
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA NRW) warnt vor
sogenannten Vishing-Angriffen, die sich bundesweit gegen Unternehmen
richten. Aus aktuellem Anlass weisen die Experten darauf hin, dass
bei Anrufen unbekannter Personen generell Vorsicht geboten ist.
Genauso wichtig ist es, auf unangekündigte Anrufe der
eigenen IT-Abteilung zu achten. Hinter dem vermeintlichen Kollegen
am anderen Ende der Leitung kann ein Betrüger stecken. Vishing -
eine Kombination aus "Voice" und "Phishing" - ist eine Form des
Betrugs, bei der Angreifer versuchen, sensible Informationen von
Opfern über Telefonanrufe abzugreifen oder Schadsoftware auf den
Computern der Betroffenen zu installieren.
Dabei geben
sich die Täter oft als vertrauenswürdige Personen oder Institutionen
aus, wie beispielsweise Mitarbeiter von Banken, IT-Abteilungen oder
anderen Unternehmen und täuschen dabei deren echte Rufnummer vor.
Der Appell der LKA-Experten: "Wenn Sie einen Anruf von Ihrer
IT-Abteilung erhalten, ohne dass zuvor ein Problem gemeldet wurde,
sollten Sie vorsichtig sein. Betrüger nutzen diese Taktik, um
Kontakt aufzunehmen und das Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen."
Ihr Ziel ist es, die Angerufenen dazu zu bringen,
persönliche Daten wie Passwörter oder Kontoinformationen
preiszugeben. In einigen Fällen versuchen die Betrüger auch, die
Opfer dazu zu bewegen, schädliche Software herunterzuladen, die dann
auf ihren Geräten installiert wird. Das Vorgehen der Täter ist
professionell und lässt sich daher schwer durchschauen: Die Betrüger
sprechen akzentfreies Deutsch und nutzen teilweise die bekannte
Telefonnummer der IT-Abteilung des betroffenen Unternehmens
(Spoofing).
Die Experten des LKA NRW empfehlen, keine
telefonischen Anweisungen zum Herunterladen oder Ausführen von
Programmen aus dem Internet zu befolgen. Zudem sollte man
misstrauisch sein, wenn sich die interne IT-Abteilung ohne
vorherigen Anlass meldet.
•
8. März:
Stadtwerke:
Weltwassertag und Baumpflanzaktion im Grünen März
Die
Stadtwerke-Baumpflanzaktion 2025 findet von 11 bis 15 Uhr im
Duisburger Stadtwald statt.
Das erste Highlight im „Grünen
März“ ist in diesem Jahr die große Baumpflanzaktion, die
bereits am 8. März ansteht. Ab sofort können sich
Baumpatinnen und Baumpaten bei den Stadtwerken Duisburg
registrieren.
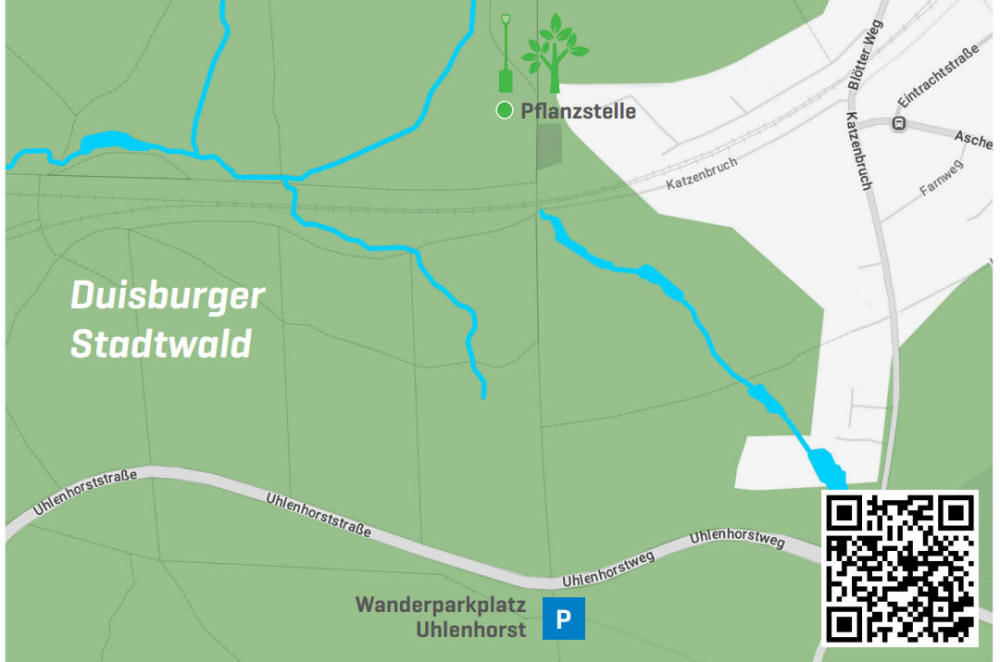
Es wird die bereits 13. Auflage
derAktion sein, bei der Bürgerinnen und Bürger hunderte
neue Bäume pflanzen und damit ganz konkret etwas für den
Klimaschutz vor Ort tun. „Unsere Baumpflanzaktion ist
immer etwas für die ganze Familie. Alle zusammen packen
wir an, greifen zu Spaten und Schaufel und pflanzen neue
Bäume für ein grünes Duisburg.
Mit der Aktion 2025
werden wir die Gesamtmarke von insgesamt mehr als 14.000
gepflanzten Bäumen deutlich überschreiten“, sagt
Christian Theves, Abteilungsleiter Privatkundenvertrieb
bei den Stadtwerken. Neben dem Pflanzen der Bäume wird es
auch wieder ein buntes Rahmenprogramm mit Spielen für die
Kleinen, einer leckeren Stärkung und tollen Andenken an
die Aktion geben.
Für die Baumpflanzaktion am 8.
März im Duisburger Stadtwald suchen die Stadtwerke wieder
Baumpaten, die selbst Hand anlegen und einen Baum
pflanzen und mit einer Patenkarte versehen möchten. Diese
werden übrigens aus ungeleimtem Graskarton erstellt, um
die Umwelt zu schonen und Tiere im Wald nicht zu
schädigen. Das Anmeldeformular ist für alle Naturstrom-
und Naturgaskunden unter swdu.de/baumpflanzaktion
abrufbar. Anmeldeschluss ist der 28. Februar.

Baumpflanzaktion: Am 8. März laden die Stadtwerke
Duisburg wieder zur großen Baumpflanzaktion ein. Quelle:
Stadtwerke Duisburg AG
Neue Studie:
Frauen kommen bei längeren, karriereförderlichen Weiterbildungen
seltener zum Zug
Bei Weiterbildungen, die der
Karriere nutzen, kommen Frauen seltener zum Zug als Männer, zeigt
eine neue Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen
Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung.* Das kann die ohnehin
bestehenden Nachteile von Frauen auf dem Arbeitsmarkt verstärken,
erst recht in der aktuellen Umbruchsituation.
Frauen nehmen
insgesamt etwas häufiger an betrieblicher Weiterbildung teil als
Männer. Aber: Sie absolvieren häufiger kürzere Maßnahmen, die
weniger karrierefördernd sind. Sie erhalten dabei seltener
finanzielle und zeitliche Unterstützung durch das Unternehmen.
Männer hingegen profitieren häufiger von längeren Fortbildungen und
werden dabei stärker von Vorgesetzten gefördert.
Das ist
das Ergebnis der Analyse von Dr. Yvonne Lott, Magdalena Polloczek
und Dr. Eileen Peters im neuen Gleichstellungsreport, den das WSI
heute im Vorfeld von Equal-Pay-Day und Internationalem Frauentag
vorlegt. Die Sozialwissenschaftlerinnen haben eine repräsentative
Befragung ausgewertet, die im Auftrag des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung alle zwei Jahre durchgeführt wird, zuletzt von
Juli 2022 bis März 2023. Die vorliegende Studie zum
Weiterbildungsverhalten bezieht sich auf die Angaben von rund 6000
Erwerbspersonen.
„In Zeiten tiefgreifender Umbrüche auf dem
Arbeitsmarkt ist Weiterbildung eine wichtige Voraussetzung für
stabile Erwerbsverläufe. Umso wichtiger ist es, Frauen einen
gleichberechtigten und vor allem karriereförderlichen Zugang zur
Weiterbildung zu ermöglichen, um die ohnehin bestehenden
geschlechtsspezifischen Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt nicht zu
verschärfen“, ordnet Prof. Bettina Kohlrausch, wissenschaftliche
Direktorin des WSI, die Befunde ein.
Bei Frauen in Vollzeit
liegt die Teilnahmequote an betrieblicher Weiterbildung laut
Befragung bei rund 66 Prozent. Zum Vergleich: Bei
vollzeitbeschäftigten Männern beträgt sie rund 59 Prozent. Das liegt
vor allem daran, dass in Bereichen mit überwiegend weiblichen
Beschäftigten wie zum Beispiel dem Gesundheits- und Sozialwesen die
Weiterbildung häufiger gesetzlich vorgeschrieben ist als in
männerdominierten Bereichen etwa in der Industrie.
Gleichzeitig nehmen Frauen mit 47 Prozent deutlich häufiger an
kürzeren, nur wenige Stunden dauernden Weiterbildungen teil als
Männer mit 39 Prozent. Bei den längeren, mehrtägigen Weiterbildungen
liegt die Quote der Männer bei 29 Prozent gegenüber knapp 21 Prozent
bei den Frauen. Kurze Fortbildungen dienen vor allem dazu, neue
Arbeitsmethoden einzuführen oder vorhandenes Wissen aufzufrischen,
„ohne jedoch die Karriere maßgeblich voranzubringen“, schreiben die
Forscherinnen.
„Längere Weiterbildungen, die sich über
mehrere Tage erstrecken, vermitteln hingegen tiefer gehenden
fachlichen Input und Wissen, was die Aufstiegschancen tatsächlich
erhöhen kann.“
Besonders förderlich für den beruflichen
Aufstieg ist die Unterstützung durch Vorgesetzte: Während 20 Prozent
der Männer angeben, von ihren Vorgesetzten zu
Weiterbildungsmaßnahmen ermutigt worden zu sein, sagen dies nur 15
Prozent der Frauen. Außerdem werden Männer etwas häufiger finanziell
und zeitlich von ihrem Arbeitgeber unterstützt. Frauen hingegen
ergreifen deutlich häufiger selbst die Initiative zur Weiterbildung.
Dies deute darauf hin, dass sie auf diese Weise versuchen,
fehlende Unterstützung zu kompensieren – und dass es nicht, wie
bisweilen unterstellt, an Interesse oder beruflichem Engagement
mangelt, erklären die Wissenschaftlerinnen. 29 Prozent der befragten
Frauen nennen Eigeninitiative als einen der wichtigsten Gründe für
Weiterbildung, bei den Männern sind es 24 Prozent.
Besonders
schwierig ist die Lage für Mütter: Sie sind der Doppelbelastung von
Beruf und Familie stärker ausgesetzt als Väter. Aufgrund familiärer
Verpflichtungen verzichten 39 Prozent von ihnen auf Weiterbildung,
aber nur 22 Prozent der Väter. Zusätzlich werden Mütter bei der
betrieblichen Weiterbildung am seltensten von ihren Vorgesetzten
unterstützt. Dies fällt insbesondere im Vergleich zu Vätern und
kinderlosen Männern auf.
Teilzeitbeschäftigte erhalten
seltener Unterstützung von ihrem Arbeitgeber als
Vollzeitbeschäftigte. Davon sind Frauen und Männer gleichermaßen
betroffen. Allerdings haben Frauen in Teilzeit häufig mehr familiäre
Verpflichtungen und sind daher stärker auf zeitliche Unterstützung
während der Arbeitszeit oder auf Freistellung angewiesen, um an
Weiterbildungen teilnehmen zu können. Insgesamt nehmen Frauen in
Teilzeit am häufigsten an kürzeren und am seltensten an mehrtägigen
Weiterbildungen teil.
Um Ungleichheiten im Bereich der
Weiterbildung abzubauen, empfehlen die Forscherinnen:
- Die
Unterstützung für Eltern auszubauen, zum Beispiel durch flexiblere
Arbeitszeiten und mehr Selbstbestimmung.
- Mehr betriebliche
Angebote zur Kinderbetreuung zu schaffen, zusätzlich zum Ausbau von
Kita- und Ganztagsbetreuung durch den Staat.
- Gesetzliche
Ansprüche zu schaffen, damit Weiterbildung nicht allein vom
Wohlwollen des Arbeitgebers abhängt.
- Die bisherigen
Vorschlagsrechte von Betriebsräten bei der Weiterbildung zu
Mitbestimmungs- und Initiativrechten auszubauen. Damit könnten
Betriebsräte gezielter auf die Weiterbildung benachteiligter
Beschäftigter hinwirken.
- Weiterbildungsverbünde zu stärken. Das
sind Netzwerke, in denen sich mehrere Betriebe einer Region
zusammenschließen, um in der Weiterbildung zu kooperieren.
Bibliothek, Supermarkt und Weinbar: Zum internationalen
Frauentag informiert die Frauenberatungsstelle
Duisburg gleich dreifach
Um möglichst viele und
verschiedene Zielgruppen zu erreichen, informiert die
Frauenberatungsstelle am diesjährigen internationalen Weltfrauentag
an drei unterschiedlichen Standorten, und macht so auf die noch
lange nicht erreichte Gleichberechtigung von Frauen aufmerksam.
Den Fokus richtet die Beratungsstelle dabei besonders auf
bestehende oder zukünftige Partnerschaften. Aktuellen Daten des
Weltwirtschafsforums zufolge braucht es noch 5 Generationen oder 130
Jahre, bis die volle Parität der Geschlechter erreicht ist. Daher
lautet das diesjährige Motto des Weltfrauentages „Accelerate
Action“, also eine geforderte Beschleunigung von Maßnahmen, um die
in vielen Bereichen immer noch bestehende Diskriminierung von Frauen
abzubauen.
Besonders die Themen häusliche und
sexualisierte Gewalt, für die die Frauenberatungsstelle Fach- und
erste Anlaufstelle in Duisburg ist, steht dabei gleich drei mal auf
der Tagesordnung:
Los geht es mit den Jüngsten: Die
Stadtbibliothek Duisburg lädt bereits am Donnerstag, 6.3. eine
Gruppe 9-Klässlerinnen des Hildegardis-Gymnasiums zu einer
Präventionsveranstaltung in ihre Räumlichkeiten ein.
Dort
wird die Frauenberatungsstelle über wichtige Themen wie
beispielsweise über das Gewaltschutzgesetz, Frauenhäuser und weitere
Hilfseinrichtungen informieren. „Für uns ist es wichtig, die jungen
Mädchen für Grenzüberschreitungen zu sensibilisieren, dass sie
lernen, ihrem eigenen Bauchgefühl zu trauen und möglichst früh
erkennen, wenn etwas in der Partnerschaft schiefläuft“, so Anika
Walther, langjährige Mitarbeiterin der Frauenberatungsstelle
Duisburg.
„Erlebtes in Worte zu fassen und sich jemandem
anzuvertrauen ist gerade bei Gewalt, Machtmissbrauch oder
Manipulation so wichtig, “ ergänzt ihre Kollegin Kathrin Knaup.
Daher liegt der Schwerpunkt solcher Präventionsveranstaltungen-
einem Herzstück der Beratungsstelle Duisburg -auch immer auf
Erfahrungen und Beispielen aus der Praxis.
Wie auch in
den Jahren zuvor wird der Internationale Weltfrauentag wieder zum
Anlass genommen, abends mit dem Kneipenpublikum mittels Flyer und
Give-Aways über Angebote der Beratungsstelle ins Gespräch zu kommen.
Melanie Lüdtke von der Frauenberatungsstelle freut sich schon
besonders darauf, am Samstag ab 18:00 Uhr in toller Atmosphäre im
Kalt Weiß Trocken und mit bewährter Unterstützung der Initiatorin
von „women4women“ ihre wichtige Arbeit präsentieren zu dürfen.
Neu ist dieses Jahr die Veranstaltung im Supermarkt, denn „wir
wollen auch die Frauen erreichen, die nicht unbedingt abends
ausgehen“, erklärt Diana Determann von der Beratungsstelle.

In Kooperation mit dem Globus Meiderich hat sich die
Frauenberatungsstelle dafür eine tolle Aktion ausgedacht: „Dieses
Jahr können wir mit Waffelduft an unseren Stand locken, wo es neben
Flyern, neu erstellten Visiten- Karten mit positiven Bildern und
Botschaften, diversen Broschüren auch eine Glücksrad-Aktion mit
kleinen Gewinnen geben wird“, erklärt Anika Walther, dankbar über
den vom Globus Meiderich dafür gespendeten Waffelteig.
Den
Erlös der verkauften Waffeln kann die Frauenberatungsstelle, die
immer auch auf Spenden angewiesen ist, gut gebrauchen. „Besonders
attraktiv sind unsere neuen, direkt einsetzbaren
Einkaufswagen-Chips“, findet Kathrin Knaup und freut sich schon
jetzt auf viele wichtige Informationsgespräche.
Eines sei
bereits jetzt verraten: Um den „Gender-Pay-Gap“ zumindest am
Weltfrauentag etwas auszugleichen, kommen die Frauen am Waffelstand
natürlich besonders günstig weg!
Weltfrauentag:
„In gemischten Teams herrscht oft die beste Stimmung“
Alexandra Peters (53) ist pflegerische Bereichsleitung der
Kardiologie am Duisburger Helios Standort St. Anna und seit über 30
Jahren am Patientenbett. Sie würde die Krankenpflege gerne aus der
unterschätzten „Kümmer“-Ecke holen und hofft, dass sich zukünftig
auch mehr Männer für den Beruf begeistern.

Alexandra Peters im Gespräch
Warum haben Sie sich
für die Pflege entschieden?
Ich wusste schon als Kind, dass ich
diesen Beruf ergreifen will. Wir haben uns damals in der Familie
intensiv um meine Großmutter gekümmert, die schwer krank war und für
mich war klar, dass ich das auch später beruflich machen möchte.
Verschiedene kleine Arbeitseinsätze in Krankenhäusern bestärkten
meine Pläne und die Begeisterung für die Pflege ist bis heute – mehr
als 30 Jahre später – geblieben.
Was genau macht diese
Begeisterung aus?
Die meisten Menschen wissen nicht, wie
vielseitig und hochkomplex die moderne Pflege eigentlich ist. Unser
Beruf bietet so viel mehr als sich „nur“ um kranke Menschen zu
kümmern und Bettpfannen auszuleeren. Man hat viel Verantwortung und
kann sich umfassend weiterbilden, ob in der Intensivpflege, im
Wundmanagement oder in der Versorgung von Tumorpatienten, um nur
einige Möglichkeiten zu nennen. Natürlich ist die Basis weiterhin,
dass man für erkrankte Menschen da sein möchte, aber es ist
gleichzeitig auch technisch und intellektuell höchst anspruchsvoll.
Über 80 Prozent der Pflegekräfte in den Krankenhäusern sind
immer noch weiblich. Woran liegt das?
Ich glaube, das hängt sehr
mit dem gerade erwähnten Klischee des Kümmer-Berufes zusammen. Es
wird angenommen, dass das eine typisch weibliche Eigenschaft sei,
aber ich sehe ja an unseren männlichen Kollegen, dass es für sie
genauso erfüllend sein kann. Und ihre Anzahl steigt seit Jahren an.
Langsam, aber kontinuierlich.
Interessant ist allerdings,
dass die männlichen Pflegekräfte eher in den trubeligen und
körperlich herausfordernden Abteilungen wie in der Notaufnahme oder
im operativen Bereich zu finden sind. Ein Beispiel: Die Männerquote
in unserem pflegerischen Team des Herzkatheterlabors liegt bei 80
Prozent, auf der kardiologischen Station dagegen bei nur etwas über
12 Prozent.
Würden Sie sich mehr Männer als Kollegen
wünschen?
(schmunzelt) Ich würde mir wünschen, dass sich
grundsätzlich mehr Menschen für den Pflegeberuf entscheiden. Und
gerne auch mehr Männer. Denn wenn wir dem Fachkräftemangel etwas
entgegensetzen wollen, müssen wir so viele Menschen wie möglich für
diesen wichtigen Job gewinnen.
Hat das
Geschlechterverhältnis Einfluss auf die Stimmung im Team?
Aus
meiner Erfahrung heraus: Ja. Denn meist ist die Stimmung
entspannter, wenn es gemischte Teams sind. Es ist zwar auch immer
die Frage, welche individuellen Charaktere eine Abteilung hat, aber
es bringt eine besondere Art von Ruhe hinein, wenn es sowohl Frauen
als auch Männer im Team gibt.
Das Klischee des männlichen
Arztes und der weiblichen Pflegekraft hält sich ja leider
hartnäckig. Wie erleben Sie das im Alltag?
Bei uns intern hat
sich da in den letzten Jahren sehr viel getan, zum einen, weil die
Hierarchien stark abgeflacht sind. Früher war es undenkbar einen
Oberarzt oder eine Oberärztin zu duzen. Heute agieren wir alle als
Team und die Meinung und Kompetenz der Pflege hat viel mehr Gewicht
bekommen. Zum anderen gibt es heute viel mehr Ärztinnen als früher
und sie bringen den Wandel glücklicherweise automatisch mit.
Pflegerische Bereichsleitung
Eine pflegerische
Bereichsleitung wie Alexandra Peters ist in einem Krankenhaus für
die Führung und Organisation eines bestimmten Pflegebereichs wie
etwa für die Intensiveinheiten oder für die Stationen der Inneren
Medizin verantwortlich. Sie koordiniert das dazugehörige
Pflegepersonal, stellt die Qualität der Pflege sicher, sorgt für
eine effiziente Personaleinsatzplanung und ist eine wichtige
Kommunikationsschnittstelle zwischen den Pflegekräften und anderen
Abteilungen. Alexandra Peters verantwortet an der Helios St. Anna
Klinik in Duisburg rund 80 pflegerische Kolleginnen und Kollegen.
Der Anteil männlicher Pflegekräfte in deutschen
Krankenhäusern ist in den letzten zehn Jahren kontinuierlich
gestiegen, bleibt jedoch weiterhin bei unter 20 Prozent und variiert
sehr in den verschiedenen Abteilungen. So gibt es etwa eine größere
Anzahl männlicher Pflegekräfte in der Notaufnahme, auf der
Intensivstation oder in der Chirurgie.
Bei den Auszubildenden in
Pflegeberufen zeigt sich jedoch ein deutlicher Trend: Im Jahr 2023
begannen 54.400 Personen eine Pflegeausbildung, davon waren 15.100
Männer, was einem Anteil von etwa 27 Prozent entspricht. Dieser
Anteil ist gegenüber 2020 um rund drei Prozent gestiegen. *
In Deutschland steigt der Anteil von Ärztinnen kontinuierlich
an. Laut der Kassenärztlichen Bundesvereinigung waren im Jahr 2022
erstmals über 50 Prozent der an der vertragsärztlichen Versorgung
teilnehmenden Ärzt:innen und Psychotherapeutinnen Frauen. Die
Verteilung variiert jedoch wie in der Pflege je nach Fachrichtung.
Beispielsweise waren in der Chirurgie nur etwa 22,8 Prozent
der Ärzt:innen weiblich, während ihr Anteil in der Frauenheilkunde
und Geburtshilfe bei 70,9 Prozent lag. Die Frauenquote bei den
Assistenzärzt:innen an den Duisburger Helios Kliniken liegt bei 61
Prozent. Im ärztlichen Dienst allgemein sind rund die Hälfte der
Beschäftigten weiblich. *Quelle: Statistisches Bundesamt
Zeitreise ins Duisburg um 1900: Aufbruch, Krisen und
Neuanfang
Heimatforscher Harald Küst stellt am Sonntag,
9. März, um 15 Uhr bei einer Zeitreise durch die Ausstellung zur
Stadtgeschichte im Kultur- und Stadthistorischen Museum,
Johannes-Corputius-Platz 1, die Stadt Duisburg um das Jahr 1900 vor.
Das Image als Industrie- und Arbeiterstadt prägt das
Selbstverständnis vieler Duisburger.
Während heute die
Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung dominiert,
herrschten in Duisburg um 1900 Industrieboom, Fortschrittsglaube und
wirtschaftliche Dynamik. Politische und gesellschaftliche
Bedingungen veränderten sich, Strukturkrisen trafen Duisburg in der
Folge massiv.
Harald Küst stellt die Themen seiner geführten
Zeitreise „125 Jahre Duisburg: Aufbruch, Krisen und Neuanfang“ in
einen überregionalen Kontext und vergleicht sie mit dem heutigen
Handlungsbedarf. Die Teilnahme ist im Museumseintritt enthalten und
kostet für Erwachsene 4,50 Euro, für Kinder und ermäßigt 2 Euro. Das
gesamte Programm ist unter www.stadtmuseum-duisburg.de abrufbar
Einladung zum
4. Vaskulitis-Tag an der Helios St. Johannes Klinik
Seltene Erkrankungen wie die Vaskulitis eint ein Defizit: Viele
Betroffene und auch Ärztinnen und Ärzte wissen oftmals deutlich zu
wenig darüber, deshalb ist Aufklärung und Information ein
entscheidendes Puzzleteil in der Versorgung.
Um
Patient:innen, Angehörigen und Fachleuten wertvolle Informationen zu
vermitteln, lädt die Helios St. Johannes Klinik am Samstag, 8. März
2025, von 10 bis 14 Uhr gemeinsam mit der Selbsthilfegruppe
Vaskulitis der Rheuma-Liga NRW zum 4. Vaskulitis-Tag nach
Duisburg-Hamborn ein.
Im Rahmen der Veranstaltung können
sich Betroffene und Interessierte, aber auch Ärzt:innen über
aktuelle Forschungsergebnisse, Hilfestellungen bei der Diagnose und
über den Alltag mit Vaskulitis informieren. Zudem gibt es
ausreichend Möglichkeit zu Austausch und Kontaktaufnahme, ob mit
anderen Betroffenen oder den Organisator:innen der
Selbsthilfegruppe. Weitere Informationen zu Programm und
Veranstaltungsort gibt es unter:
Vaskulitistag 2025 - Aktionstag für Betroffene und Interessierte |
Helios St. Johannes Klinik Duisburg
"Ab jetzt
finanziell unabhängig" - Neuerscheinung der Verbraucherzentrale
Frauen arbeiten häufiger Teilzeit, sodass sie schon deshalb
weniger verdienen als Männer. Dafür haben sie bei Care-Arbeit die
Nase vorn: Ob Kinder oder pflegebedürftige Angehörige – die Stelle
für die Betreuung der Familienmitglieder ist meist weiblich besetzt.
Spätestens beim Blick auf die Renteninformation wird
klar: Die gängige Biografie von Frauen endet vielfach in
Altersarmut. Dass das kein unabänderliches Schicksal sein muss,
zeigt der neue Ratgeber „Ab jetzt finanziell unabhängig: Ein
nachhaltiger Finanzplaner für Frauen“ der Verbraucherzentrale.
Das Buch behandelt die Themen:
- Warum Rentenlücken
entstehen und wie der Kassensturz klappt - Welche Stellschrauben für
eine gute Altersvorsorge wichtig sind
- Geldanlage individuell:
Risikoneigung, Anlagehorizont und persönliche Ziele -
Versicherungen: Passende Absicherung in verschiedenen Lebensphasen
- Was bei Trennung und Scheidung in Sachen Finanzen zu regeln
ist - Finanzen in Patchworkfamilien - Erbschaften – nicht immer ein
finanzielles Plus

Ab jetzt finanziell unabhängig: Ein Finanzratgeber für Frauen 1.
Auflage 2025, 208 Seiten, 20,- Euro, als E-Book 15,99 Euro
www.verbraucherzentrale.de/buecher-und-ebooks/frauenfinanzplaner
Winterlaufserie: Buslinien
machen Platz für die Läuferinnen und Läufer
Der
erste Lauf der diesjährigen Winterlaufserie am Samstag, 8. März,
wirkt sich auf den Fahrplan der Buslinien 928, 930, 931 und 942 der
Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) aus. Die Kruppstraße wird
zwischen Kalkweg und Masurenallee gesperrt, die Masurenallee
zwischen Kruppstraße und Wedauer Straße. Daher müssen die Busse von
ihren normalen Linienwegen abweichen. Haltestellen werden verlegt
oder entfallen ganz.
Linien 928 und 942
Die
Haltepunkte „Ausbesserungswerk“ und „Barbarasee“ der Linie 928 sowie
„Elbinger Straße“ und „Ausbesserungswerk“ der Linie 942 müssen von
14.30 bis 17 Uhr entfallen. Die Haltestelle „Kiesendahl“ wird für
beide Fahrtrichtungen in den Kalkweg zu der Haltestelle „Kiesendahl“
der Linie 934 verlegt. Die DVG bittet die Fahrgäste die Haltestellen
„Kiesendahl“ und „Wedau Bahnhof“ zu nutzen.
Linien 930 und
931
Die Haltestellen „Wildstraße“, „Sportpark“, „Bertaallee“,
und „Regattabahn“ können in der Zeit von 13 bis 15.45 Uhr nicht
angefahren werden. Die DVG bittet die Fahrgäste die Haltestellen
„Koloniestraße“ und „MSV Arena“ zu nutzen oder auf die Linie 928
auszuweichen.
Drei neue DHL Paketshops in
Duisburg eröffnet
Die DHL hat in dieser Woche drei
neue Paketshops in Duisburg eröffnet. Hamborn: Kiosk Bulut,
Jägerstraße 14, Öffnungszeiten: montags bis freitags von 07:00 bis
24:00 Uhr, samstags von 00:00 bis 02:00 Uhr und von 07:00 Uhr bis
24:00 Uhr, und sonntags von 08:00 Uhr bis 24:00 Uhr.
Hochemmerich: Amogam Shop, Atroper Straße 23, Öffnungszeiten:
montags bis freitags jeweils von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr und von
15:00 bis 19:00 Uhr, sonntags von 10:00 bis 16:00 Uhr.
Altstadt: Münzstraße 28, Öffnungszeiten: montags bis donnerstags
jeweils von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr, freitags und samstags von 08:00
bis 24:00 Uhr, sonntags von 09:00 bis 22:00 Uhr.
Fotoausstellung zur Folk- und Weltmusikreihe
„Spelunken-Spektakel“ in Ruhrort - 15 Jahre Kulturarbeit im
Stadtteil
Das Kreativquartier Ruhrort blickt in diesem Jahr unter dem
Motto „anderthalb.dekaden“ auf 15 Jahre Kulturarbeit im Stadtteil
zurück. Startpunkt war das Kulturhauptstadtjahr 2010, in dem Ruhrort
als „Hafen der Kulturhauptstadt“ Akzente setze. Daraus entwickelte
sich eine engagierte Szene, die nach dem Motto, „das
Kulturhauptstadtjahr kann ja nicht alles gewesen sein“, weitere
vielfältige kulturelle Aktivitäten organisierte.
Eine davon ist die Folk- und
Weltmusikreihe „Spelunken-Spektakel“, die seit 2017 Konzerte aus
dieser Musiksparte in den Kneipen und Kultureinrichtungen in Ruhrort
veranstaltet. Diesem „Spelunken-Spektakel“ ist nun eine
Fotoausstellung vom 9. bis 21. März 2025 im „Das Plus am Neumarkt“,
Neumarkt 19, 47119 Duisburg gewidmet.
Vielfältiges
Rahmenprogramm
Die Ausstellungseröffnung/Vernissage am
Sonntag, 9. März 2025, Beginn 11:00 Uhr, wird von Holger Technau und
weiteren Musikern der Gruppe „Singadjo“ gestaltet. Die Singadjos
verquicken virtuos viele unterschiedliche Stilrichtungen, ob Gipsy,
Rumba, Rembetiko, Mariachi, Balkan, Latin, Chanson usw.
Daher ist für ihre Musik „Folk“ im Sinne von „Weltmusik“ der einzig
richtige Sammelbegriff. Die Singadjos waren 2017 am ersten Konzert
des Spelunken-Spektakels beteiligt und sind der Reihe seit dem
freundschaftlich verbunden.
Am Freitag, 14. März 2025,
Beginn 19:30 Uhr im Ausstellungslokal wird die Gruppe „Schlagsaite“
ein Spelunken-Spektakel Konzert gestalten.
Virtuoser Folk trifft hier auf leidenschaftliche Polkarhythmik,
moderne Chansons werden mit Balkan und Gypsy-Swing Elementen
versetzt und verträumte Akustik-Balladen stehen neben
gesellschaftskritischen Stücken in der Tradition deutscher
Liedermacher. Kurz: Das ist Weltmusik in deutscher Sprache.
Ihr
neuestes Album „Fantasie von Übermorgen“ mit Gedichtvertonungen von
Erich Kästner, wurde gerade für den Preis der deutschen
Schallplattenkritik nominiert.
Und zum guten
Ausstellungschluss/Finissage am Freitag, 21.März 2025, Beginn 19:00
Uhr, wird das Duo „Im Taxi rauchen“ den musikalischen Schlusspunkt
setzen.„Im Taxi rauchen“ steht dafür, etwas tun zu dürfen, was man
einfach mal braucht und das zu teilen, mit denen die es wollen. Die
Songwriterpunks Thore und Maurice machen Indie-Alternative-Rock mit
deutschen Texten, die aus ihren Herzen plaudern, nuanciert bis
plakativ, gut gefühlt bis schlecht gelaunt.
Öffnungszeiten: Zu den Veranstaltungen im „Das Plus am Neumarkt“
sowie Dienstag + Donnerstag 10:00 - 13:00 Uhr und Freitag 10:00 -
13.00 und 14:00 - 18:00 Uhr. Eintritt frei. Zu den Veranstaltungen
wird um Spenden gebeten.
Ein Projekt im Rahmen von
Kreativ.Quartiere, gefördert vom Ministerium für Kultur und
Wissenschaft des Landes NRW und umgesetzt von ecce - european centre
for creative economy
Konzert in der Marienkirche: Ravel zum
150. Geburtstag
Dem vor 150 Jahren geborenen Maurice
Ravel widmet sich das Konzert am Sonntag, 9. März um 17 Uhr in der
Marienkirche, Josef-Kiefer-Straße 10, mit Kammermusik. Im
Mittelpunkt steht das Klaviertrio, das Ravel unter dem Eindruck des
Kriegsausbruchs 1914 komponierte.
In einem Brief erzählt er
auch von einem Besuch der Gießerei in Hamborn, die ihn nachdrücklich
zu seiner Musik inspiriert hat: „Überall ein roter, düsterer,
brennender Himmel. Wie musikalisch dies alles ist. Ich habe die
feste Absicht, das zu verwenden.“ Dieser unbekannten Verbindung von
Ruhrgebiet und Ravels Musik spüren Tonio Schibel, Violine, Mathieu
Jocqué, Violoncello, und Catherine Klipfel, Klavier, nach.
Neben
dem Klaviertrio sind auch die Violinsonate und ein Sonatensatz für
Cello und Klavier zu hören. Der Eintritt zu dem einstündigen Konzert
beträgt 18 Euro.
Schwofen im Gemeinde-Café Dreivierteltakt in Wanheimerort
Die Evangelische Rheingemeinde Duisburg öffnet zum
Monatsausklang das „Café Dreivierteltakt“, bei dem Seniorinnen und
Senioren zu Kaffee, Tee und Kuchen zusammenkommen, die Begleit-Musik
genießen, dazu schunkeln und sogar tanzen. Für den guten Ton sorgt
Frank Rohde, der zu seinem Spiel an der elektronischen Orgel auch
singt.
Es gibt dabei nicht nur Klänge im
Dreivierteltakt, doch alle Lieder haben Rhythmus und sind vielen
bekannt. Das nächste gesellig-musikalische Treffen im Beratungs- und
Begegnungszentrum (BBZ) Wanheimerort, Paul-Gerhardt-Straße 1, ist am
Samstag, 8. März 2025 um 15 Uhr. Bei sieben Euro Eintritt sind
Kaffee und Kuchen inbegriffen; Anmeldungen sind bei Maria Hönes
telefonisch möglich (Tel.: 0203 770134).

Zum
internationalen Frauentag
Frauen in
Parlamenten in Deutschland nach wie vor unterrepräsentiert
• Frauenanteil im Deutschen Bundestag sinkt nach der Wahl um 2,4
Prozentpunkte auf 32,4 %; geringerer Anteil als in vielen
europäischen Staaten
• Auf Bundes- und Landesebene kaum
Veränderung gegenüber 2008
• Frauenanteil auf kommunaler Ebene
mit 30,5 % am niedrigsten
Frauen sind in Parlamenten in
Deutschland nach wie vor unterrepräsentiert. Im neu gewählten 21.
Deutschen Bundestag beträgt der Frauenanteil 32,4 %. Auch in den
Länderparlamenten (33,2 %) sowie auf kommunaler Ebene (30,5 %) lag
der Frauenanteil zuletzt knapp unter einem Drittel, wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt.
Im Bundestag
war der Frauenanteil 2,4 Prozentpunkte geringer als zu Beginn der
letzten Legislaturperiode, als der Frauenanteil bei 34,8 % lag. Im
Vergleich zu 2008, als die Ergebnisse erstmals im
Gleichstellungsatlas des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend veröffentlicht wurden, hat sich der Anteil der
Frauen im Bundestag kaum verändert.
Damals waren 31,8 %
der Abgeordneten Frauen. Einen Einfluss auf den Frauenanteil im
Parlament hat unter anderem, ob Parteien mit einer verankerten
Frauenquote stärker vertreten sind oder nicht. Zur Einordnung: Von
der erwachsenen Bevölkerung mit deutscher Staatsbürgerschaft waren
zuletzt 51,7 % Frauen.

Das weltweite
Ranking der Interparlamentarischen Union (IPU), das auch
Veränderungen zwischen zwei Wahlen etwa durch Nachrückende
berücksichtigt, liegt aktuell zum Stichtag 1. Februar 2025 vor. Dort
ist Deutschland noch mit einem Frauenanteil von 35,7 % für
den 20. Deutschen Bundestag auf Platz 44 verzeichnet.
Mit dem neuen Anteil von 32,4 % dürfte
Deutschland am Ende des vorderen Drittels der mehr als 180 erfassten
Staaten zu finden sein. In vielen europäischen Staaten sind anteilig
mehr Frauen in den Parlamenten vertreten als hierzulande,
beispielsweise in allen skandinavischen Staaten (jeweils mehr als
43 %), in Spanien (44,3 %), dem Vereinigten Königreich (40,5 %),
Belgien und den Niederlanden (je 39,3 %), Frankreich (36,2 %) und
Österreich (36,1 %).
Mit einem Frauenanteil von 63,8 %
ist das ostafrikanische Land Ruanda aktuell weltweiter
Spitzenreiter. Daneben gehören nur noch Kuba (55,7 %), Nicaragua
(55,0 %) und Mexiko (50,2 %) zu den Ländern, in deren Parlamenten
Frauen derzeit ebenfalls in der Überzahl sind. Geschlechterparität
herrscht in den Parlamenten von Andorra und den Vereinigten
Arabischen Emiraten.
Frauenanteil im Bayerischen
Landtag am niedrigsten
In den Parlamenten der Bundesländer
haben Frauen nach den Wahlen zur Hamburger Bürgerschaft im
Durchschnitt ein knappes Drittel (33,2 %) der Abgeordneten gestellt.
Damit stieg der Anteil gegenüber dem Vorjahr leicht an (2024:
32,9 %) – ein Ergebnis der Wahl in Hamburg, wo in der Bürgerschaft
nun anteilig mehr Frauen vertreten sind als zuvor.
Längerfristig hat sich in Bezug auf die Repräsentanz von Frauen in
Länderparlamenten wenig getan: Im Jahr 2008 lag ihr Anteil ebenfalls
bei knapp einem Drittel (32,3 %). Gezählt wurden jeweils die bei der
letzten Wahl gewählten Vertreterinnen; Nachrückende wurden nicht
berücksichtigt. Im Vergleich der Bundesländer ist der Frauenanteil
im Bayerischen Landtag mit knapp einem Viertel (24,6 %) am
niedrigsten, gefolgt von Sachsen mit 27,5 % und Sachsen-Anhalt mit
27,8 %.
Einem paritätischen Geschlechterverhältnis am
nächsten war Hamburg mit einem Frauenanteil von 48,8 %, darauf
folgten Bremen mit 42,5 % sowie Schleswig-Holstein und Berlin mit
jeweils 37,7 %. In den einzelnen Länderparlamenten waren die
Schwankungen bezüglich des Geschlechterverhältnisses deutlich größer
als auf Bundesebene. So gab es in Brandenburg, wo aktuell 28,4 % der
Landtagsabgeordneten Frauen sind, den mit knapp 13 Prozentpunkten
stärksten Rückgang im Vergleich zu 2008. Damals hatte der
Frauenanteil noch 40,9 % betragen.
In Hamburg stieg der
Frauenanteil im selben Zeitraum um knapp 16 Prozentpunkte von 33,1 %
auf 48,8 %. Frauenanteil auf kommunaler Ebene gegenüber 2008
gestiegen Der Frauenanteil in den Kreistagen der Landkreise sowie
in den Stadträten der Stadtkreise und der kreisfreien Städte war im
Jahr 2024 mit 30,5 % noch einmal niedriger als auf Bundes- und
Länderebene.
Gegenüber dem Vorjahr gab es damit kaum
eine Veränderung (2023: 30,3 %), längerfristig ist der Anteil jedoch
gestiegen: 2008 war in kommunalen Vertretungen nur gut ein Viertel
(25,6 %) weiblich. Besonders selten waren Frauen zuletzt in den
kommunalen Vertretungen in Sachsen (22,0 %), Sachsen-Anhalt (22,8 %)
und Baden-Württemberg (24,6 %). Besonders häufig vertreten waren sie
in den Stadtstaaten Bremen (42,5 %), Hamburg (Stand 2020: 42,0 %)
und Berlin (41,1 %) sowie in Hessen (38,7 %).
Vor 10 Jahren in der BZ: Bei 13 % der Paare ist die
Frau die Hauptverdienerin
Im Jahr 2013
verdiente bei 13 % der Paare in Deutschland die Frau mehr
als ihr Ehe- oder Lebenspartner. Das teilt das
Statistische Bundesamt anlässlich des Internationalen
Frauentags am 8. März 2015 mit. Bei 10 % der Paare hatten
die Partner ein ähnlich hohes Einkommen.
Ganz überwiegend
(77 %) erzielte jedoch der Mann das höchste Einkommen im
Haushalt. Das zeigen die Ergebnisse des Mikrozensus, der
größten jährlichen Haushaltsbefragung in Deutschland. Im
Jahr 2003 hatte bei 11 % der Paare die Frau das höhere
Einkommen bezogen.
Aktuell: Bei 10,3 % der Paare ist die Frau die
Haupteinkommensperson
Bei 56,6 % der Paare im Jahr 2024
hat der Mann ein höheres Einkommen als die Frau, bei 33,1 % liegen
beide in etwa gleichauf
In den meisten Paarhaushalten in
Deutschland steuern nach wie vor Männer einen größeren Teil zum
Einkommen bei als Frauen. Lediglich in jedem zehnten Paarhaushalt
(10,3 %) hatte die Frau ein höheres Nettoeinkommen als ihr Ehe- oder
Lebenspartner.
Das teilt das Statistische Bundesamt
(Destatis) zum Internationalen Frauentag am 8. März
anhand von Erstergebnissen der Erhebung zu Einkommen und
Lebensbedingungen (EU-SILC) 2024 mit. Bei 56,6 % der Paare war es
umgekehrt und der Mann die Haupteinkommensperson.
In 33,1 %
der Fälle lagen Frau und Mann beim Einkommen in etwa gleichauf. Als
Haupteinkommensperson gilt diejenige Person, deren Anteil des
persönlichen Nettoeinkommens am Gesamteinkommen des Paares 60 % oder
mehr beträgt.
Ohne Kinder im Haushalt
fallen die Unterschiede etwas geringer aus – mit Kindern noch
stärker Bei Paaren ohne Kinder im Haushalt fällt das Ungleichgewicht
zwischen Frauen und Männern als Haupteinkommenspersonen etwas
weniger stark, aber immer noch deutlich aus.
In 11,8 %
der Paarhaushalte ohne Kinder hatte die Frau das höhere Einkommen
und in 51,1 % der Mann. Bei 37,1 % der Paare ohne Kinder im Haushalt
hatten beide ein in etwa gleich hohes Einkommen. In Paarfamilien
mit Kindern sind Frauen noch seltener die Haupteinkommensperson. So
hatte die Frau bei Paaren mit Kindern im Haushalt in nur 7,8 % der
Fälle das höhere Einkommen.
Mit einem Anteil von 65,7 %
war dagegen ganz überwiegend der Mann die Haupteinkommensperson. In
26,5 % der Paarhaushalte mit Kindern hatten Frau und Mann ein
ähnlich hohes Einkommen. Ein Grund für die größeren
Einkommensunterschiede zwischen den Geschlechtern bei Paaren mit
Kindern: Mütter arbeiten häufiger in Teilzeit als
Frauen ohne Kinder.
Bei Männern ist es umgekehrt: Väter
arbeiten seltener in Teilzeit als Männer ohne Kinder.
Haupteinkommensperson* in Paarhaushalten 2024 nach Geschlecht,
Anteil in % * Person, deren Anteil des persönlichen Nettoeinkommens
am Gesamteinkommen des Paares 60 % oder mehr beträgt. Quelle:
EU-SILC, Erstergebnis.
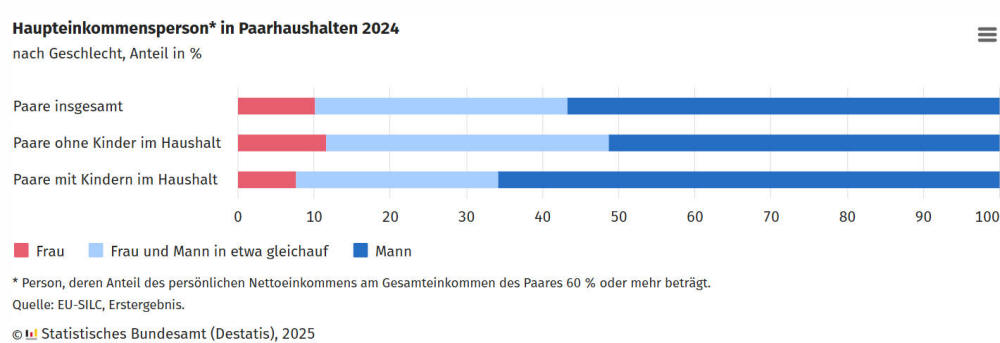
Anteil der Frauen mit höherem Einkommen stagniert, Anteil der
Paare mit in etwa gleich hohen Einkommen gestiegen Insgesamt hat
sich das Geschlechterverhältnis mit Blick auf die
Einkommensverteilung in den letzten Jahren kaum verändert.
Der Anteil der Frauen als Haupteinkommensperson liegt seit 2021
(10,5 %) auf einem ähnlichen Niveau. Leicht zurückgegangen ist im
selben Zeitraum der Anteil der männlichen Haupteinkommenspersonen:
von 58,8 % im Jahr 2021 auf 56,6 % im Jahr 2024.
Zugenommen
hat entsprechend der Anteil der Paare, bei denen beide in etwa
gleich viel Einkommen haben. 2021 traf das auf 30,7 % aller
Paarhaushalte zu, 2024 hatten in 33,1 % der Fälle beide Partner ein
ähnliches Einkommen.
Gender Gap Arbeitsmarkt sinkt
2024 auf 37 %
• 2023 lag der Gender Gap Arbeitsmarkt
bei 39 %
• Der Indikator berücksichtigt Unterschiede in
Bruttostundenverdiensten, Arbeitszeit und Erwerbsbeteiligung von
Frauen und Männern
• Rückgang des unbereinigten Gender Pay Gaps
von 18 % auf 16 %
• Gender Hours Gap und Gender Employment Gap
unverändert bei 18 % beziehungsweise 9 %
Der Gender Pay Gap
gilt als der zentrale Indikator für Verdienstungleichheit zwischen
Frauen und Männern. Da sich Verdienstungleichheit jedoch nicht nur
auf Bruttostundenverdienste begrenzt, berechnet das Statistische
Bundesamt mit dem Gender Gap Arbeitsmarkt einen Indikator für
erweiterte Verdienstungleichheit.
Dieser betrachtet
neben der Verdienstlücke pro Stunde (Gender Pay Gap) zusätzlich die
Unterschiede in der bezahlten monatlichen Arbeitszeit (Gender Hours
Gap) und in der Erwerbsbeteiligung von Frauen und Männern (Gender
Employment Gap). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
anlässlich des Equal Pay Day am 7. März 2025 mitteilt, lag der
Gender Gap Arbeitsmarkt im Jahr 2024 bei 37 % und damit 2
Prozentpunkte niedriger als im Vorjahr.
Hauptursachen für
erweiterte Verdienstungleichheit sind weiterhin geringere
Stundenverdienste und Arbeitszeiten von Frauen Ausschlaggebend für
den Rückgang des Gender Gap Arbeitsmarkt war der Rückgang des
unbereinigten Gender Pay Gaps. Dieser sank
2024 im Vergleich zum Vorjahr um 2 Prozentpunkte auf 16 %. Das
heißt Frauen verdienten 16 % weniger pro Stunde als Männer.
Der Rückgang ist vor allem auf gestiegene Bruttomonatsverdienste
(ohne Sonderzahlungen) von Frauen zurückzuführen. Im Jahr 2024
erhöhten sich die Bruttomonatsverdienste der Frauen gegenüber 2023
um rund 8 %. Der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst von Männern
stieg dagegen nur um 5 %. Eine wesentliche Ursache für die
Verdienstunterschiede zwischen Frauen und Männern ist die höhere
Teilzeitquote von Frauen.
Während Männer 2024 im Monat
149 Stunden einer bezahlten Arbeit nachgingen, waren es bei Frauen
nur 122 Stunden. Damit brachten Frauen wie im Vorjahr 18 % weniger
Zeit für bezahlte Arbeit auf als Männer (Gender
Hours Gap). Auch in der Erwerbsbeteiligung gibt es Unterschiede
zwischen den Geschlechtern.
Aktuelle Zahlen zur
Erwerbstätigkeit aus dem Jahr 2023 zeigen, dass 73,6 % aller Frauen
einer bezahlten Arbeit nachgingen. Bei den Männern waren es 80,8 %.
Damit lag der Gender
Employment Gap wie bereits im Vorjahr bei 9 %. Aus den drei
genannten Gender Gaps wird der Gender Gap Arbeitsmarkt berechnet.
Je höher der Gender Gap Arbeitsmarkt, desto stärker ist die
Verdienstungleichheit auf dem Arbeitsmarkt ausgeprägt.
Besonders im Zeitverlauf und im Vergleich zwischen Regionen
ermöglicht der Gender Gap Arbeitsmarkt interessante Einblicke in die
verschiedenen Ursachen und Entwicklungen von Verdienstungleichheit.
Gender Gap Arbeitsmarkt im langfristigen Vergleich rückläufig In den
letzten zehn Jahren sank der Gender Gap Arbeitsmarkt um 8
Prozentpunkte. Im Jahr 2014 hatte er noch bei 45 % gelegen.
Wie auch 2024 waren die Hauptursachen die geringeren
Stundenverdienste (Gender Pay Gap 2014: 22 %) und Arbeitszeiten von
Frauen (Gender Hours Gap 2014: 21 %). In den letzten zehn Jahren
näherten sich jedoch die Verdienst- und Beschäftigungssituationen
von Frauen und Männern an.
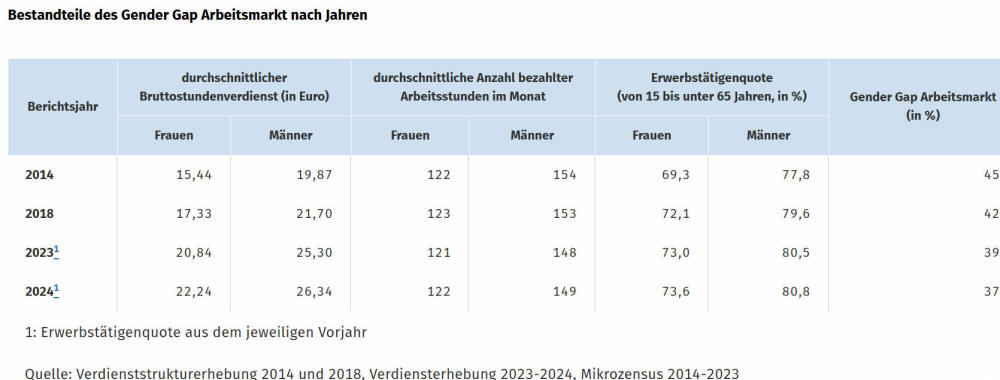
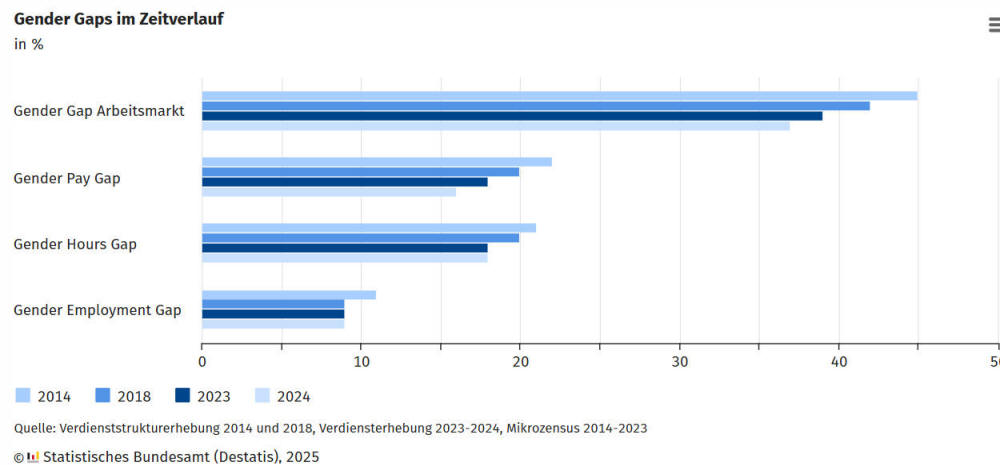
Vor allem die Bruttostundenverdienste der Frauen stiegen seit
2014 stärker als die der Männer. Das führte zu einem Rückgang des
Gender Pay Gap um 6 Prozentpunkte von 22 % im Jahr 2014 auf 16 % im
Jahr 2024. Gleichzeitig verringerte sich auch der Gender Hours
Gap um 3 Prozentpunkte, von 21 % auf 18 %. Grund dafür war ein
Rückgang der Arbeitsstunden bei den Männern von 154 im Jahr 2014 auf
149 im Jahr 2024.
Bei den Frauen blieben die bezahlten
Stunden mit 122 in den letzten zehn Jahren nahezu konstant. Die
Erwerbsbeteiligung von Frauen stieg dagegen stärker als die der
Männer. Im Jahr 2014 waren 69,3 % aller Frauen im Alter zwischen 15
und 64 Jahren erwerbstätig, 2023 waren es 73,6 %. Bei den Männern
stieg die Erwerbstätigenquote nur um 3 Prozentpunkte.
Der Gender Employment Gap sank damit von 11 % auf 9 %. Gender
Gap Simulator verdeutlicht verschiedene Ursachen von
Verdienstungleichheit Der Gender
Gap Simulator zeigt verschiedene Ursachen von
Verdienstungleichheit anhand von simulierten Szenarien. Dabei können
Nutzende verschiedene Komponenten auf dem Arbeitsmarkt verändern und
die damit verbundenen Auswirkungen auf Verdienstungleichheit
beobachten. Neben dem Gender Pay Gap stehen hier insbesondere die
Themen Arbeitszeit und Erwerbsbeteiligung im Fokus.